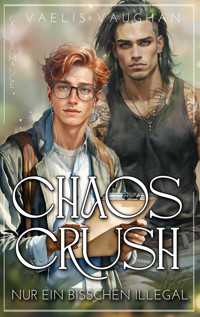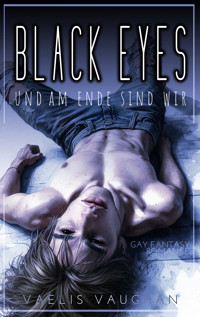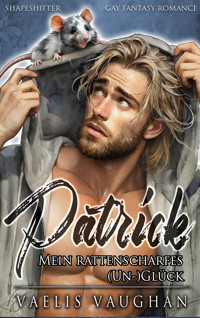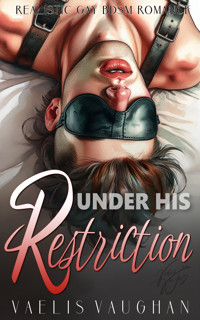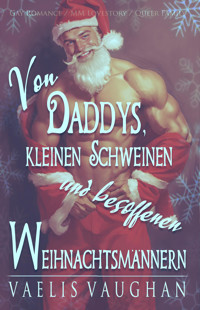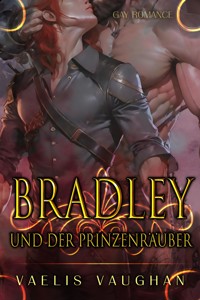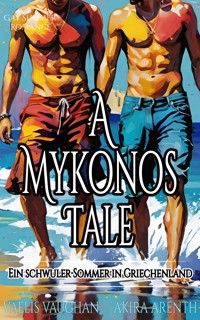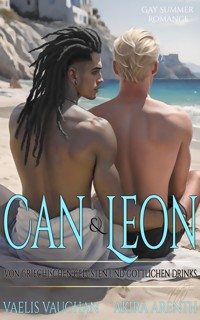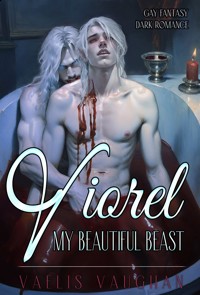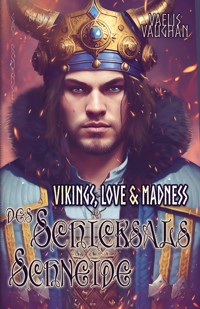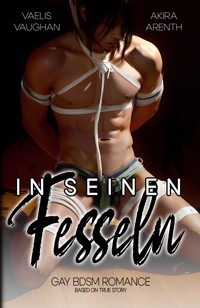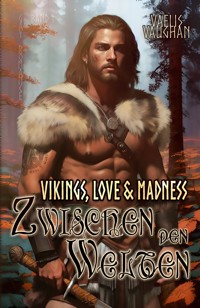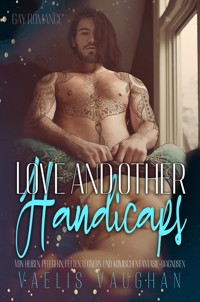CHAOS CRUSH
nur ein bisschen illegal
Klappentext
Gay Romance / MM Lovestory
Laurence führt ein Leben voller glänzender Noten, Markenklamotten und einer vorgeplanten medizinischen Karriere. Als Sohn einer elitären, akademischen Familie ist sein Weg geebnet und seine Zukunft erfolgversprechend. Seine Homosexualität ist dabei längst kein Tabu mehr, sondern ein Symbol für fortschrittliches Prestige. Vorausgesetzt, der künftige Ehemann passt ins Bild. Laurence tut alles, um seine Eltern stolz zu machen, doch dann begegnet er César und mit einem Mal herrscht Chaos in seinem Herzen. César ist ein hispanischer junger Mann mit scharfen Kanten, dessen Herkunft von Illegalität, Drogen, Gewalt und einem Leben auf der Straße geprägt ist – all das, wovor Laurence stets bewahrt wurde. Ein erster Blick zum Katalysator, ein Lächeln zur Einladung und ein Kuss zu so viel mehr. Was als heiße Affäre beginnt, wächst schnell zu etwas heran, das Laurence den Boden unter den Füßen wegreißt. Vor allem, weil er Tequila für spanisches Mundwasser hält und sein erstes Mal auf einem sehr wackeligen Holzbett stattfindet. Aber zwischen all den Lehrstunden im Bett entsteht auch was Echtes, denn César ist nicht nur sein perfekter Gegenpart, sondern genau das, wonach sich Laurence immer gesehnt hat. Doch was passiert, wenn sich etwas so Verbotenes plötzlich wie Zuhause anfühlt? Wenn eine Liebe, die nie hätte sein dürfen, alles ins Licht rückt, was bisher im Schatten lag? Dies ist eine Geschichte von zwei jungen Männern aus verschiedenen Welten, die niemals füreinander bestimmt waren und sich genau deshalb nicht mehr loslassen können.
Kapitel 1
______________
>R umms!<
Zum dritten Mal an diesem glorreichen Nachmittag schlage ich mit dem Gesicht auf der Tischplatte auf. Nicht irgendwie, sondern mit einer Grazie, die jedem betrunkenen Flamingo die Schamesröte ins Gefieder treiben würde!
Ich zucke hoch, greife mir theatralisch an die Nase und keuche: »Auuuuua ... nicht schon wieder!«, während ich einen Sabberfaden durchtrenne, der sich wie ein klebriges Mahnmal meiner Erschöpfung von der Unterlippe zur Tastatur zieht.
Immerhin blute ich nicht. Mein Gesicht scheint inzwischen eine Art Extrahornhaut entwickelt zu haben. Und meine Brille lebt auch noch! Kleine Siege, die gefeiert werden sollten ... vielleicht mit einem weiteren Schlag auf die Tischkante.
›Los jetzt! Konzentration! Schlaf wird überbewertet.‹
Ich stütze mein Kinn aufs linke Handgelenk, starre in den Laptop, und dämmere zurück in meine histologische Parallelwelt. Dort, wo mich die basophilen Zellen irgendwann anlachen. Also wirklich. Die grinsen mich an, als wüssten sie, dass ich auf dem besten Weg bin, endgültig den Verstand zu verlieren ... und sie freuen sich drauf, die kleinen Scheißer!
Ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon erraten: Ich bin Medizinstudent. Allerdings hab ich mich, zur Schande meiner Eltern, nicht für Humanmedizin entschieden, so wie sie, sondern für Veterinärmedizin, weil ich mit Tieren einfach besser klarkomme als mit Menschen. Dadurch brauchte ich auch nicht nach Harvard gehen, so wie sie es sich erträumt hatten, und konnte mich stattdessen auf der Cornell University in Ithaca einschreiben.
Gerade noch merke ich, wie sich meine Augenlider erneut Richtung Boden schleichen, wie zwei gelangweilte Teenager auf einem Schiffshebewerk. Ich schüttle den Kopf, reiße die Brille von der Nase, rubble mir einmal panisch durchs Gesicht wie ein Hund nach einem Bad, setze sie wieder auf und denke: ›Komm schon! Bleib jetzt wach! Irgendwie‹, doch das reicht nicht. ›Ich brauche mehr Koffein!‹
Ja. Kaffee. Das beste Mittel gegen geistige Verwahrlosung. Ich spähe in meine Tasse, aber unbefriedigenderweise besteht der darin herumdümpelnde Spuckschluck nur noch aus den Tränen meiner Verzweiflung und etwas Angstschweiß. Trotzdem exe ich ihn weg, denn wer weiß, wie viele Nährstoffe sich in der Zwischenzeit auf dem Boden gebildet haben.
Ja, ich bin fertig mit den Nerven. Durch. Komplett. Mein Hirn klingt wie ein alter Laserdrucker, der gerade versucht, in kyrillischer Kursivschrift einen Roman zu drucken – auf Klopapier! Seit gefühlt drei Jahrhunderten lerne ich für die Abschlussprüfungen im Mai und wette, mein Neocortex sieht inzwischen aus wie Schwarzenegger in seinen krassesten Bodybuilderzeiten! Trotzdem weint er sich jede Nacht in den Schlaf, weil ich ihn immer so überstrapaziere.
Aber gut. Aufgeben ist keine Option und meine Grandma sagte mir mal: »Das erste Studienjahr ist das schlimmste.« Ich sage: Das erste Studienjahr ist eine raffinierte Mischung aus Folter, Schlafentzug und der ständigen Frage: Warum hab ich mir das freiwillig angetan? Trotzdem versuche ich, weiter durchzuhalten ... und das geht nur mit noch mehr Kaffee.
Mühsam erhebe ich mich also von meinem Schreibtisch und schleppe mich zu meiner Zimmertür, doch bevor ich die öffne, halte ich inne, lausche und höre sie, das wahre Grauen: meine Mitbewohner! Deren durchschnittliche Konversationsdauer liegt nämlich bei einer Stunde achtunddreißig. Meine bei vier. Sekunden.
Ich frage mich immer, warum alle Menschen zu Introvertierten sagen, sie müssten sich mehr öffnen und ihre Komfortzone verlassen, aber niemand sagt zu Extrovertierten, dass sie auch einfach mal die Schnauze halten könnten, damit ihre Gegenwart zu einer Komfortzone für Intros wird!
Während ich lausche, fällt mein Blick in die verspiegelte Schranktür gegenüber und ich zucke zusammen.
›Aiaiai ...‹
Meine Augenringe schimmern wie kleine blaubeige Schiffchen, die meine Sehorgane ins Land der waagerechten Glückseligkeit schiffen wollen. Meine Haare, rostrothellbraune Locken, sehen aus wie ein zerplatzter Wischmopp, und das trotz des biederen Haarschnitts Marke Superman – nur ohne Gleitgel. Zudem muss ich eine Hornbrille von irgendeinem Designer tragen, den meine Mum gut findet. Außerdem meinte sie, das Teil würde meine babyblauen Augen umrahmen ... so wie jede Brille. Na ja, Pragmatismus liegt halt bei uns in der Familie. Als wäre das alles nicht so schon schlimm genug, ist mein Gesicht auch noch von Sommersprossen übersät, die darauf eine flächendeckende Orgie feiern, selbst auf meinen Lippen. Ich bin praktisch eine menschliche Streuselschnecke – in schlaksig!
Leider habe ich auch von Mode weniger Ahnung als vom Paarungsverhalten gefleckter Furchenmolche. Klamottentechnisch trage ich daher, was mir mein Vater zum Studienstart vorsortiert hat. Teuer, ja. Geschmackvoll, nein. Weiße Hemden mit mausgrauen Strickjacken über hellblauen Karomuster-Chinos. Aber hey, mit dieser schnieken Garderobe könnte ich ohne Probleme »Rentner des Monats« werden und ehrlich gesagt interessiert es mich auch herzlich wenig, dass ich aussehe, wie der letzte Biomilchprinz. Das war im Übrigen mein Spitzname als Kind, weil ich einen fetten Aufkleber auf dem Ranzen hatte, auf dem stand: Bitte nich` schubsen, hab Joghurt im Rucksack!
Ich glaube, die Leute sehen mich an und denken sofort: Jungfrau! Und direkt danach: Nerd! Traurigerweise ist beides korrekt.
›Kaffeeeeeeeeeeee!‹, kräht mein Hirn, während ich mich langsam gegen das Türblatt lehne, als sei es ein sehr aufrechtes Holzkopfkissen. Im Flur herrscht endlich göttliche Stille, also wage ich es, mein Zimmer zu verlassen.
Ich schaue aus dem Fenster: Alle draußen. Kein Wunder, es herrschen milde zwanzig Grad und die Sonne scheint, daher haben sich die meisten in den Campuspark verzogen, samt einer Bataillon Ersatzakkus für all ihre technischem Spielereien. Mehr braucht es nicht, damit sich all die Digital-Dopaminsüchtigen ins Freie beamen. Also kann ich in aller Ruhe wie ein Zombie zum Kaffeeautomaten schlurfen, der sich in der Küche befindet.
Ich wohne übrigens in einem Verbindungshaus für Söhne reicher Arztfamilien. Klingt wie ein Klischee? Ist es auch. Willkommen bei Phi Epsilon Delta – der Ort, an dem Träume sterben und Daddy dafür zahlt.
Mein Vater nennt solche Studentenverbindungen: Das Sprungbrett in die chirurgische Elite. Ich nenne es: Einen Gentlemen’s Club für Proteinshake-Suchtis. Das Gebäude selbst ist ein dreigeschossiges Backsteingebäude mit weißen Säulen und gepflegtem Rasen. Innen riecht’s nach altem Leder, verbotenem Tabak und generationsübergreifendem Erwartungsdruck oder auch emotionaler Erpressung durch Erbgut. Wir haben sogar ein Hauswappen über dem Kamin mit einem lateinischen Spruch, der so viel bedeutet wie: Ich wurde mit einem goldenen Skalpell in der Hand geboren, du kannst mich mal! - Grob übersetzt, versteht sich.
Die anderen neunundzwanzig Jungs, mit denen ich hier zusammenlebe, sind allesamt supernett. Das heißt, insofern man auf Menschen steht, die Begriffe wie Networking, LinkedIn und Smart goals häufiger verwenden als Pfarrer das Wort Amen, und jeden Menschen, dem sie begegnen, fragen, wie viele Follower er auf Insta hat, ehe sie mit ihm reden.
Ich hingegen will einfach nur Kaffee. Sofort. Der Weg zum Automaten fühlt sich an wie eine Prozession. Jeder Schritt ein stilles Gebet, dass die heiße Wunderplörre meine Synapsen wieder in Wallung bringt. Allerdings zapfe ich mir heute schon das achte Tässchen und erfahrungsgemäß weiß ich leider, dass der zauberhafte Wachmacher mit steigendem Konsum seine Wirkung verliert. Eine Alternative habe ich jedoch nicht, denn ich hasse den Geschmack von Energydrinks und von Koffeinpflastern krieg ich Herzrasen.
Für die meisten meiner Mitbewohner bin ich so eine Art Hausgeist. Nicht der coole, der durch Wände geht oder Wasser in Wein verwandeln kann. Nein. Ich bin der mit dem Erdgeschosszimmer. Der, der durchs Fenster verschwindet, bevor irgendjemand »Bierpong?« fragen kann. Der, den man nur vom Hörensagen kennt – wie Vitamin D im Winter oder Mitgefühl bei Multiple-Choice-Klausuren. Ich beteilige mich also weder an gemeinschaftlichen Saufexzessen, noch trainiere ich stundenlang im hauseigenen Fitnesskeller. Wie auch? Ich kriege schon Muskelkater, wenn ich zweimal am Tag meinen Stift vom Boden aufheben muss.
Inzwischen nennen mich einige: The Curly-Phantom. Ich glaube, das ist halb spöttisch, halb ehrfürchtig gemeint ... oder nur spöttisch.
Aber hey – die Zimmer sind groß, ich habe mein eigenes Bad und dreimal täglich bekommen wir Essen von einem Cateringdienst geliefert. Ich beschwere mich daher nicht und arrangiere mich stattdessen ... wie ein Salatblatt in einem schlecht belegten Sandwich.
Ich tippe auf dem Automaten herum, als würde ich gleich eine Rakete starten. Double Espresso Latte. Klingt pompös, ist aber eigentlich nur bitteres Elend mit Milchschaum. Während das Zeug langsam in meine Häschentasse tröpfelt, überlege ich kurz, ob ich es mir nicht auch intravenös einflößen kann. Nein, zu heiß.
Seufzend lege ich den Kopf in den Nacken und gehe in Gedanken noch einmal durch, was ich für die kommenden Prüfungen wissen muss, doch egal, wie viel ich weiß, es scheint nie genug. Mal ernsthaft. Ich kann inzwischen jeden Muskelursprung beim Hund benennen, selbst die, die er nie benutzt. Ich kenne die Rektusscheide der Kuh besser als meine eigene Zukunft, genau wie die Reizleitungen beim Huhn, die Pansenmotorik beim Rind und die Thermoregulation bei Schweinen! Ich weiß, wie ein Wiederkäuer verdaut, hab aber keine Ahnung, wie man Smalltalk führt. Citratzyklus, Glykolyse, Harnstoffzyklus – läuft alles in meinem Gehirn in Dauerschleife, sogar nachts im Traum. Ich bete mittlerweile ureotelische Organismen an. Kein Witz. Dazu Histologie, Zellbiologie, Ethik, Berufskunde und nicht zu vergessen das allseits beliebte Fach: Wie schiebe ich meinen Arm in den Arsch eines ausgewachsenen Bullen und entnehme ihm via Rektalstimulation eine Samenprobe, ohne meine Würde zu verlieren?
Indem ich dabei Kaffee trinke!? Ja, das ist die Antwort auf alles!
Ich nehme meine geliebte Tasse. Von dem kindlichen Hasen in der Mitte abgesehen, ist sie grau, schlicht und warm – also im Prinzip eine Töpferversion meiner selbst. Ich halte sie fest, erhitze meine zittrigen Finger, atme tief ein. Der Duft ist besser, als jeder Pheromonrezeptor erklären könnte, und ich weiß jetzt schon, dass ich den Geschmack dieses Automatenkaffees nie mehr vergessen werde, sollte ich das Studium überleben.
Ich drehe mich um, will zurück in meine kleine Gruft der Stille schlurfen, als just in diesem Moment die Haustür aufgerissen wird und ausgerechnet Jonathan Cunningham hereinschlendert.
›Nein. Bitte nicht.‹
Jonathan, unser Chapter President aka Oberhaupt der Selbstoptimierungssekte, ist die fleischgewordene Reizüberflutung. Eine Welle aus Parfüm, Männlichkeitswahn und dem festen Glauben, dass ihn jeder Raum vermisst, sobald er ihn verlässt. Allein seine Shorts kosten mehr als meine Monatsmiete, seine Zähne sind so weiß wie frisch gebleichter Schnee und sein Selbstbewusstsein passt in kein Zimmer mit weniger als vier Meter Deckenhöhe. Kurzum: Er ist alles, was ich nicht bin: sportlich, groß, laut, sozialverträglich. Angeblich ist das hier sein Zweitstudium, was erklärt, warum er ungefähr fünf Jahre älter ist als der Durchschnitt hier. Er hält sich daher für besonders erfahren und murmelt gern Sätze wie: »Ich hab schon Dinge erlebt, die du nicht mal googeln kannst, Bro.« Will ich auch gar nicht, aber das ist ihm wurscht.
»Hey Laurie«, spricht er mich an, ehe ich mich verzupfen kann, und betont die Verniedlichung meines Namens wie ein Zahnarzt, der dir beim Bohren ohne Betäubung sagt, dass du »einfach nur zu sensibel bist«.
»Hey Jon«, murmle ich und versuche, an ihm vorbeizukommen, aber er bleibt lässig im Türrahmen stehen und versperrt mir damit den Weg. Er scannt mich von oben bis unten und aktualisiert sichtbar seine Laurence-Mängelliste.
»Dein wievielter Kaffee ist das heute?«, fragt er, hebt eine seiner perfekt gezupften Augenbrauen und deutet auf meine Tasse, als sei sie der Hauptverdächtige in einem Mordfall.
»Die Vierte«, lüge ich und will ihn umsegeln, aber da legt er plötzlich seine Hand auf meine Schulter und schnalzt mit der Zunge – ein Geräusch, so unangenehm wie ein feuchter Händedruck.
»Kleiner Freundschaftstipp: Nimm Methylphenidat. Damit sparst du dir das ganze Gerenne zum Automaten. Ist deutlich effizienter, sauberer, hält länger wach und lässt deine Hände nicht so jämmerlich zittern.« Er zwinkert mir zu, als hätte er mir soeben den ultimativen Schlüssel zum Erfolg überreicht, patscht mir gönnerhaft auf die Wange, ein bisschen zu fest, und geht an mir vorbei, um sich einen seiner berüchtigten Matcha-Latte mit Kollagenpulver und Hafermilchschaum zu machen.
»Das klingt nicht so, als würde ich es rezeptfrei in der Apotheke kriegen«, bemerke ich und bereue es im selben Augenblick, denn damit sporne ich ihn nur zu weiteren dämlichen Ratschlägen an.
»Genau das ist der Grund, warum du während deines Studiums eines mehr als alles andere brauchst!«
»Einen guten Masseur für meinen verspannten Nacken?«, witzele ich, schaue nur noch über meine Schulter und laufe heimlich weiter in Richtung meines Zimmers.
»Scherzkeks«, schnauft er und dreht sich grinsend zu mir um, woraufhin ich abrupt stehen bleibe: »Was du brauchst, ist ein zuverlässigerDealer, mein Lieber! Ohne Witz. Amphetamine und Ritalin sind besser als jedes Repetitorium.«
Ich blinzele irritiert und öffne den Mund für ein halbherziges »Aha«, aber da geht Jonathan schon zum Fenster und reißt die Jalousien hoch, als wolle er dem Universum sagen: Schaut her, ich leuchte heller als ihr alle.
»Ich muss zugeben, dass ich diesbezüglich selber ziemlich lange auf dem Trockenen gesessen hab, weil meiner im Knast saß. Die anderen, die sich hier während seiner Abwesenheit breitgemacht haben, hatten nur gestreckte Scheiße. Aber seit letzter Woche ist er wieder auf freiem Fuß und - ah, da ist er ja! Wenn man vom Teufel spricht.«
Eigentlich will ich meinem Mitbewohner sagen, dass ich nichts auf seinen gutgemeintenRat gebe und lieber ohne chemische Dopingmittelchen studiere - zumindest, solange es geht. Aber der Typ kann ein richtig mieser Arsch werden, wenn er merkt, dass einem seine Meinung egal ist.
»Der vertickt hier auf dem Gelände?«, frage ich daher simuliert interessiert nach und schaue ebenfalls aus dem Fenster.
»Natürlich nicht«, prustet Jon und zeigt auf den Zaun. »Da, hinter der Absperrung steht er, das ist sein Stammplatz. Leicht versteckt, aber noch überschaubar und mit Fluchtwegen zu drei Seiten.« Plötzlich giggelt er: »Du solltest mal sehen, wie der kleine Tacofresser rennen kann, sobald ihm die Bullen auf den Fersen sind. Deswegen guckt er auch immer so paranoid durch die Gegend, selbst während man mit ihm redet. Ist echt zum Schießen.«
Ich verkneife mir meinen Kommentar, schiebe meine Brille höher und ziehe die Augen zusammen, um irgendwas zu erkennen, denn die Sonne steht gerade so ungünstig, dass sie enorm blendet. Aber dann entdecke ich einen Typen von hinten, der am Zaun lehnt, so lässig wie auf einem Werbeplakat für Gleichgültigkeit. Seine schulterlangen, schwarzen Haare, die zu einem seitlichen Undercut geschnitten sind, wirken ein wenig struppig, fast als wären sie voller Staub, außerdem schimmern sie leicht grünlich. Er raucht, kleine Kringel wabern über ihm in die Luft, doch entgegen meiner Erwartung ist er kein von Suchtmitteln gezeichnetes, ausgezehrtes Individuum, sondern hat eine traumhafte Figur. Seine Haut schimmert wie flüssige Bronze auf seinen breiten Schultern, die in seinem weit ausgeschnittenen Tanktop äußerst eindrucksvoll zur Geltung kommen. Er hat einige Tattoos, auch wenn ich die einzelnen Motive von hier aus nicht erkennen kann, doch mein Blick hängt vielmehr an seiner rissigen, ausgewaschenen Jeans, die ihm recht tief auf den Hüften sitzt.
Plötzlich fährt er sich mit einer Hand durch die Haare, um sie hinters Ohr zu schieben. So erhasche ich einen kurzen Blick auf seinen Serratus anterior, den seitlichen Rippenmuskel, der bei ihm besonders schön ausgeprägt ist, und schlucke.
»Wenn du jetzt schon zu sabbern anfängst, warte mal, bis du den Typen von vorne siehst«, prustet Jonathan, als wüsste er genau, was in meinem Kopf vorgeht. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit rät er nur, denn seit er weiß, dass ich schwul bin, macht er bei jedem attraktiven Kerl solche Sprüche. »Aber glaub mir, spätestens wenn er den Mund aufmacht, vergeht`s dir.«
»Warum? Hat er so schlechte Zähne?« Das wäre tatsächlich ein Abtörner, doch Jonathan schüttelt den Kopf und verlässt seinen Posten.
»Das nicht, aber er ist strunzendämlich!« Er lacht erneut, geht zur Garderobe und zieht seine Schuhe an. »Hätte ohne Probleme Model werden können, der Idiot. Hat sogar mal ein konkretes Angebot von Louis Vuitton bekommen, doch statt es anzunehmen hat er sich komplett zuhacken lassen, nur um zu irgendeiner Gang zu gehören, für die er jetzt Stoff vertickt. Außerdem legt er den meisten kultivierten Weißen gegenüber eine Attitüde an den Tag, die alles andere als feierlich ist. So will natürlich keiner mit ihm zusammenarbeiten.« Er hat sich die Schuhe angezogen und zählt nun ein paar Scheine in seinem Portemonnaie, was mich hoffen lässt, dass er sich gleich davonmacht. »Letztendlich ist es halt auch egal, wie gut du aussiehst, wenn du nur ein hübscher Haufen Abschaum von der Müllkippe bist, der sich nicht zu benehmen weiß.« Abermals grinst er und steckt sich ein paar Scheine in die linke Hosentasche, während seine Geldbörse in der rechten verschwindet. »Na ja, mir kommt es jedenfalls sehr gelegen, denn er hat verdammt gute Beziehungen und sein Stoff ist erstklassig!«
Ich nicke nur, weil ich nicht wirklich weiß, was ich dazu sagen soll, beziehungsweise, mir alles, was ich gerne sagen würde, verkneifen muss. Also belasse ich es bei einem neutralen »Na dann ...«, hebe die Hand zum Abschied und will endlich wieder in meinem Zimmer verschwinden.
»Jetzt beeil dich mal, ich warte hier nicht ewig«, antwortet er jedoch auffordernd und ich sehe ihn leicht verstört an.
»Beeilen? Womit?! Meine Dissertation dauert noch eine Weile.«
»Sehr witzig! Du wirst ja wohl kaum in Hausschuhen rausgehen wollen, und ein paar Scheinchen solltest du ebenfalls einstecken, oder denkst du, ich lad dich ein?! Sorry, in den Genuss kommen nur heiße Chics!« Ich runzle die Stirn, denn ich hab ja nie gesagt, dass ich jetzt irgendwas haben will, aber Jonathan redet einfach weiter: »Eine Ritalin kostet aktuell um die zehn Dollar. Adderall kriegt man schon für die Hälfte, doch das Zeug hat krasse Nebenwirkungen. Amphis kriegst du im Schnitt für vierzig Mücken pro Gramm, aber das reicht auch für vier bis fünf Einheiten und wenn ich dich ihm vorstelle, macht er dir sicher `nen Einsteigerpreis. Ich verhandle für dich, keine Sorge, und der Typ beißt nicht ... zumindest nicht, wenn ich da bin!« Dabei zwinkert er mir zu und mit einem Schlag weiß ich, warum ich wirklich mitkommen soll. Vermutlich kriegt er sowas wie eine Vermittlungsprovision in Form von Pillen, für jeden, den er zu ihm bringt.
Ich will etwas sagen – eine höfliche Absage, die mit: Ich brauch das nicht - beginnt, aber meine Stimme bleibt mir in der Kehle stecken. »Ich weiß nicht«, ist das Einzige, was ich nach einer Weile hervorkriege. »Wenn meine Eltern herausfinden, dass ich mir was einwerfe, dann -«
»Ach komm schon«, stöhnt er genervt und wirft den Kopf zurück, ehe er ihn schwungvoll wieder nach vorne schnalzt. »Als wenn deine Oldies das rausfinden! Solange du ihnen nichts sagst, tut es auch kein anderer hier! Außerdem: Willst du weiter zwanzig Tassen Kaffee am Tag saufen? Meinst du ernsthaft, das ist gesünder, als eine Pille zu nehmen? Damit arbeitest du sechs bis zwölf Stunden hochkonzentriert und schläfst danach wie ein Stein, ohne dir von fünf Liter Koffein den Magen zu verätzen!«
»Sorry Jon, aber ich bin gerade so gut wie pleite«, lüge ich schließlich notgedrungen, um doch noch glimpflich aus der Sache rauszukommen, doch leider lässt er auch das nicht gelten.
»Mein Gott, dann borg` ich dir halt was!« Er wirft mir einen genervten Blick zu und mustert mich dabei wie eine fleischgewordene Fehlkonstruktion. Offenbar will er auf keinen Fall alleine gehen. »Die Chance solltest du dir nicht entgehen lassen! Der Kerl braucht gerade dringend Kohle, weil er im Knast ein paar Schulden gemacht hat, um seine Bude zu halten. Ich meine – mir ist ja scheißegal, ob der in einem Bett oder in `nem Zelt pennt, solange er liefert, aber aktuell gibt er deswegen richtig fette Nachlässe für größere Mengen und Neukunden.« Er schnauft gefrustet. »Wer weiß, wie lange er diesmal auf freiem Fuß ist? Ich will für mein Examen ein bisschen was zur Seite packen und du bist gerade mal im ersten Studienjahr, das heißt du brauchst noch viel mehr Vorrat als ich - also los!«
Und wieder hat er unabsichtlich seine wahre Intension verraten. Er will mir nicht helfen, effizienter zu werden, sondern einfach nur auf meine Kosten seinen Stoff billiger kriegen, das ist alles.
Ich zögere, überlege, ob ich es wagen kann, abzusagen oder ob er mich dann ewig auf dem Kieker hat, aber ich will auch auf keinen Fall bei ihm Schulden machen. Schließlich krame ich in der Tasche meiner Strickjacke und entscheide mich für einen Mittelweg.
»Na schön, ich hab noch ... ähm ... zehn Dollar! Also: Ich komme mit und kaufe eine von diesen Ritalin-Pillen, aber mehr nicht. Dann hast du mich offiziell angeworben und ich kann das Zeug erst mal testen, bevor ich mir größere Mengen besorge.«
Jonathan knirscht mit den Zähnen. Das ist nicht, was er wollte, aber mal ehrlich, dachte er wirklich, ich kaufe mir direkt von null auf hundert einen Jahresvorrat?
»Na ja, besser als nichts. Dann nehm ich heute nur `ne kleine Menge und wenn du`s getestet hast, reden wir noch mal drüber. Dean und Miles sind nächste Woche auch wieder da, dann können wir mit denen zusammen eine fette Sammelbestellung machen.«
Ich schaffe es nicht mal mehr, meine Schuhe zu wechseln, da hat Jon bereits seine Hand auf meinem Rücken und schiebt mich Richtung Tür. Und ich? Ich lasse es geschehen, in der Hoffnung, dass die Sache ganz schnell vorbeigeht und ich gleich wieder in meinem Zimmer bin, um in Ruhe weiterlernen zu können.
***
Mein Herz schlägt mir bis zum Hals.
Die Geräusche von Studenten, die zwischen den Gebäuden hin- und herlaufen, dringen an meine Ohren, aber je näher wir diesem Zaun kommen, desto stiller wird es.
Ich habe noch nie etwas Verbotenes getan – noch nie! Ich geh nicht mal bei Rot über eine übersichtliche, leere Straße! So bin ich einfach nicht! Und trotzdem dackle ich jetzt hinter unserem Prollparadenpräsidenten her, wie ein folgsames Hündchen, um heimlich Drogen zu kaufen!
»W-Wie heißt er denn?«, frage ich und fühle mich, als würde ich mit jedem Schritt kleiner werden.
»César[1]«, antwortet mein Verleiter, ohne sich umzudrehen.
»A-Ach? Wie d-dieser berühmte Hundetrainer?«
»Genau. Nur dass er dich weder zwicken noch anzischen wird, wenn du dich respektlos verhältst.« Jon giggelt und wirkt nach wie vor völlig entspannt. Er scheint das schon tausendmal gemacht zu haben. Ich hingegen bin inzwischen so nervös, dass ich mich an meine Kaffeetasse klammere, als sei sie ein Rettungsring.
›Warum hab ich die überhaupt mitgenommen?‹
»Ach, eins noch: Sieh ihm nicht zu lange in die Augen, das könnte er falsch verstehen.«
»Äh ... o-okay. U-Und waru-«
»Stell keine blöden Fragen - machs einfach nicht«, unterbricht er mich schroff und schaut wieder nach vorne. »Halt dich zurück und fertig! Der Typ hat mehr Leute auf dem Gewissen als ein ungesicherter Bahnübergang und du bist genau sein Beuteschema; schüchtern, verträumt, mit diesem unschuldigen Babyface ...«
»Äh ... wie bitte?« Ich blinzle ihm an den Hinterkopf, unsicher, ob ich das richtig verstanden habe, doch Jonathan schaut nur bedächtig über seine Schulter und nickt, als wäre er der größte Menschenkenner dieser Erde.
»Ich sag’s ja nur. Der Kerl ist promiskuitiv und kann gefährlich charmant sein, wenn er will. Du hingegen ... na ja. Nimms mir nicht übel, aber du hattest noch nie Besuch hier und wirkst völlig untervögelt, daher bist du leichte Beute.« Er lacht knapp und macht eine fahrige Geste, als hätte er gerade etwas ausgesprochen Schlaues gesagt. »Außerdem hat er `ne Nase wie`n Staubsauger und ist unberechenbar.«
Ich ziehe die Brauen zusammen und verstehe nicht ganz, was die Form seines Riechorgans mit seinem sexuellen Verhalten zu tun hat ...
›Ah! Wahrscheinlich spielt er auf diesen »Wie die Nase eines Mannes, so auch sein Johannes«-Blödsinn an.‹
»Lass dich einfach nicht auf ihn ein, sonst holst du dir noch was weg oder schleppst Ungeziefer in unser Haus ein«, fährt Jonathan etwas leiser fort. »Bei solchen Typen holt man seinen Stoff, gib ihnen die Kohle und dann: Ciao, du Sau!«
Ich sage nichts. Zum einen, weil mir von dieser Mischung aus Vorurteilen und Paranoia so langsam schwindlig wird, zum anderen, weil ich weiß, wie Jonathan ist. Wenn er jemanden nicht versteht, wird er entweder überheblich oder feindselig – meistens beides.
Ich lasse seine Aussage also unkommentiert, doch auch wenn ich seine Warnung als übertrieben und latent rassistisch abhake, keimt da ein gewisses, neugieriges Kribbeln in meinem Bauch auf. Ich meine, so etwas über einen Dealer zu hören ist schon irgendwie ungewöhnlich, oder?!
»Überlass das Reden am besten mir!«, sagt Jonathan noch. »César mag im ersten Moment durchaus nett und harmlos wirken, aber wenn du ihm blöd kommst, reißt er dir den Arsch auf, klar?« Er schaut erneut über seine Schulter, diesmal jedoch äußerst mitleidig. »Ich will dich nur beschützen ... und ich weiß genau, wie man mit solchen Cartel-Boys umgehen muss, damit sie brav sind und einem geben, was man braucht.«
›Super, das klingt doch alles richtig vertrauenserweckend! Fehlt nur noch die Beerdigungsmusik.‹
Wenn ich daran denke, dass der Typ dasselbe studiert wie ich, und anschließend in die Klinik seiner Eltern einsteigen will, wird mir schlecht. Aber ehe ich länger darüber nachdenken kann, spricht er unser Ziel auch schon an.
»Hola, César! Qué onda?«, ruft er in perfektem Spanisch und wirkt dabei tatsächlich kein bisschen rassistisch.
Unser Dealer löst seinen Rücken vom Zaun, dessen Draht an manchen Stellen schon etwas ausgeleiert und kaputt ist, dennoch agiert er wie eine Mauer, die zwei Welten voneinander trennt. César dreht sich zu uns um, während er sich unauffällig umschaut, und zieht ein letztes Mal an seiner Zigarette, ehe er sie in den Sand schnippst. Er ist gut einen Kopf größer als ich und in der flimmernden Nachmittagssonne wirkt er, als wäre er direkt aus einem Indie-Musikvideo gefallen.
Statt auf Jonathans Gruß zu antworten nickt er ihm nur zu und schiebt seine Sonnenbrille hoch in die Haare. Dann treffen sich unsere Blicke.
Für einen kurzen Augenblick scheint die Zeit stehen zu bleiben.
Mein Mund wird trocken, in meinem Magen beginnt es auf Anhieb zu kribbeln und meine Ohren werden heiß, doch da rempelt mich mein Mitbewohner auch schon mit dem Ellenbogen an und ich erinnere mich daran, was er gesagt hat. Hastig reiße ich mich von den ungewöhnlich grünen Augen meines Gegenübers los und schaue zu Boden, wie ein gescholtenes Kind.
Die beiden fangen an, sich zu unterhalten, aber ich höre nur einen unverständlichen Gesprächsbrei durch meine glühenden Gehörgänge rauschen und starre zittrig in meine halbvolle Tasse, ehe ich es wage, noch einmal unauffällig hochzuschauen.
Ja. Jonathan hat nicht übertrieben. César ist einer dieser Typen, bei denen einem der Atem stockt, wenn sie dich ansehen. Einer, der zwar sehr männlich, aber gleichzeitig auch so unverschämt hübsch ist, dass er in dieser rauen, staubigen Umgebung komplett deplatziert wirkt. Und das trotz seiner offensichtlich alten, ausgewaschenen Klamotten und all den wirklich schlecht gestochenen Tattoos, die scheinbar völlig wahllos auf seinem Körper verteilt sind.
Ich erkenne einen Totenkopf auf seiner rechten Schulter, darunter einige Blätter und dann etwas, das wie ein Kristall aussieht, in dem Pilze wachsen. Eine Art Schwert ist da auch noch und um sein Handgelenk wird es ziemlich dunkel, denn darum zieht sich eine schwarze Sonne, in deren Mitte ein Auge prangt. Auf seinem linken Arm erkenne ich ebenfalls Pilze, die allerdings eher wie Bäume aussehen, darüber fliegen schwarze Schmetterlinge in einen von Wolken bedeckten Himmel. Auf seiner rechten Brust schaut so etwas wie eine stachlige Sichel unter dem Träger seines Tanktops hervor. Dieses Tattoo scheint das Älteste zu sein, denn es ist bereits ordentlich aufgequollen und unscharf.
Alles andere als unscharf ist hingegen sein Body, der von Nahem noch mal um einiges krasser aussieht als aus der Ferne. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so perfekt geformte Muskeln gesehen, ohne dass es übertrieben oder unnatürlich wirkt. Im Gegenteil, er ist eigentlich eher schlank, aber sein breites Kreuz lässt ihn trotzdem irgendwie bullig wirken.
Seine Jeans besteht nur noch aus Fetzen, beult sich jedoch in seinem Schritt so verheißungsvoll aus, dass mir richtig schwindelig wird. Er trägt einige Holzperlen- und Lederarmbänder und als ich bemerke, dass er mich nicht weiter beachtet, wage ich es auch, ihm wieder ins Gesicht zu sehen. Seine Haare schimmern tatsächlich ein wenig grünlich, doch erst jetzt erkenne ich, dass er an mehreren Stellen gepierct ist. Er hat einen Ring in der Unterlippe, ist bis auf ein sehr kurzes Kinnbärtchen komplett rasiert, trägt Ohrringe, die wie metallische Blätter aussehen, und dazu einige kleine Creolen. Eine solche zieht sich auch durch seine linke Augenbraue.
Im Gesamten sieht er viel mehr indigen als hispanisch aus, vor allem durch sein eher kantiges als rundes Kinn und seine ausgeprägten Wangenknochen. Aber seine auffällig hellen Augen zeugen eh davon, dass er ein wunderschöner Mix verschiedener Ethnien ist.
Plötzlich scheint er zu bemerken, dass ich ihn mustere, denn für den Bruchteil einer Sekunde sieht er erneut zu mir rüber und ich spüre sofort, wie mir das Blut in die Wangen schießt. Augenblicklich weiche ich seinem Blick aus und schaue wieder eisern auf meine endpeinlichen, weißen Socken, die in den noch viel peinlicheren Sandalen stecken. Dazu die Augenringe, die verwuschelten Haare, die Kaffeetasse mit dem Häschenmotiv in meinen Händen ... wahrscheinlich hält er mich für einen um Spenden bettelnden Pfadfinder!
Während ich mich für meinen Aufzug in Grund und Boden schäme und mir wünsche, auf der Stelle in eben diesem zu versinken, bemerke ich, wie Jonathan seine Geldbörse zückt, die er ja vorher um die Hälfte erleichtert hat. »Shit, ich hab nur noch hundertsechzig«, murmelt er vor sich hin und hält sie so, dass sein Gegenüber sehen kann, wie viele Scheine in seinem kleinen Krötenknast schlummern.
»Dann kriegst du halt nur sieben statt zehn«, entgegnet César abgeklärt, wobei ich zum ersten Mal bewusst seine tiefe, rauchige Stimme wahrnehme. Sie klingt, als würde er jeden Morgen mit einem Liter Aschenbecherwasser gurgeln. Er wirkt deutlich gelassener, als Jonathan es behauptet hat, auch wenn er sich tatsächlich immer wieder mal umschaut. Aber wer würde das nicht, in seiner Situation?
»Ach, jetzt sei doch nicht so«, schnauft Jonathan aufgesetzt mitleiderregend, doch offenbar kennt César den Trick mit dem versteckten Geld und lässt sich nicht so einfach aufs Kreuz legen.
»Weißt du, wie schwer es aktuell ist, an Amphis zu kommen?«, fragt er und zieht etwas aus der Gesäßtasche seiner Jeans, das aussieht wie ein besonders schlechtes Giveaway von einem dubiosen Pharma-Kongress: ein schwarzsilbernes, wasserdichtes Aluminiumetui mit Totenkopfprägung, ursprünglich vermutlich für Visitenkarten gedacht, denn als er es aufklappt, entfalten sich kleine Fächer darin. In jedes davon hat César eine andere Sorte Pillen, Blättchen und Pülverchen einsortiert, wie andere Leute Teebeutel oder Pokémonkarten. Das ist offenbar sein mobiler Tagesvorrat, den er so, praktisch, handlich und gut geschützt, immer mit sich herumträgt. »Für die hier musste ich bis nach Prattsburgh fahren!«, fügt er an und hält eine Tüte mit weißen unscheinbaren Tabletten vor unsere Nase.
Jon bleibt unbeeindruckt, was bei ihm vermutlich genetisch verankert ist, und zieht weiter seine ganz persönliche Bettelshow durch. »Okay, okay. Dann gib mir halt neun, mit ’nem kleinen Freundschaftsrabatt, und die Sache ist geritzt.«
César schnaubt leise, kein Lachen, eher ein müder Kommentar zur Welt.
»Wir sind keine Freunde und du kriegst den Schnee schon fast für die Hälfte des üblichen Preises«, erwidert er, hat dabei jedoch mehr einen amüsierten als wütenden Unterton in der Stimme, was mich angesichts Jonathans Dreistigkeit wundert. »Außerdem kannst du es dir leisten, also verarsch mich nicht.«
Mit einem Mal schubst mich der Vorsitzende unserer Proteinriegelgruppe so rüde nach vorne, dass mir mein Käffchen überschwappt, obwohl es schon halb leer war. »Alter, ich hab dir einen neuen Stammkunden gebracht, da wirst du mir doch wohl ein bisschen entgegenkommen können«, knurrt er erbost. »Der ist im ersten Jahr und hat noch zig Semester vor sich, in denen er jetzt immer schön regelmäßig bei dir seinen Stoff holen wird – dank mir! Meinst du nicht, da wäre ein wenig Dankbarkeit angesagt?«
Mit einem Mal verschwindet das seichte Lächeln aus Césars Gesicht und sein Blick bekommt etwas so Abgebrühtes, dass ich einen Schritt zurückweiche, als er sich mit dem Unterarm gegen den Zaun lehnt.
»Erstens:«, sagt er leise, aber messerscharf. »Wenn du den Kleinen noch einmal so grob anpackst, kriegst du nicht mal mehr ein scheiß Nikotinpflaster von mir, Amigo. Zweitens: Sieht er nicht so aus, als ob er es nötig hat, regelmäßig Stoff zu kaufen, um sein Studium zu schaffen!« Dabei schaut er für eine Sekunde aus dem Augenwinkel zu mir – und zwinkert! »Er bringt mir also nada!«
›War ... war das gerade ein Kompliment? Flirtet der Kerl mit mir?‹
Während ich aufpassen muss, nicht gleich Schnappatmung zu kriegen, während ich meine kaffeenassen Hände an meiner Hose abreibe, schnauft Jonathan schwer beherrscht und scheint so langsam die Geduld zu verlieren.
»Klar will er was kaufen, oder denkst du, der wär nur zu Dekorationszwecken mitgekommen?! Der Kerl säuft an die zwanzig Kaffee am Tag und braucht dringend `ne Alternative!«
Ich hab noch nie in meinem Leben zwanzig Tassen Kaffee an einem Tag getrunken! Aber da ich mich gerade an eine solche klammere, als wär sie der heilige Gral, glaubt mir das eh keiner, also halte ich die Klappe.
César hebt prüfend eine seiner schwarzen Augenbrauen, die gepiercte, um genau zu sein, mustert mich einen Moment und nickt mir dann zu. »Ay, Chico, stimmt das?«
»Ähm ... n-na ja ... äh«, ich versuche, meine Nervosität herunterzuschlucken, aber der Kerl bringt mich völlig aus der Fassung. »A-Also i-i-ich trinke schon ziemlich viel Kaffee, j-ja.«
›Gott verdammt, ich stammle wie der letzte Vollidiot!‹
»Hm.« Er scheint überrascht. »Und was willst du?«
›Oh nein. Jetzt muss ich was sagen, oder? Fuck! Wie hieß das Zeug noch mal?‹
»Er nimmt sechs Ritalin«, antwortet Jonathan für mich und steckt mir heimlich einen Fünfziger in meine Gesäßtasche. »Zum Einstiegspreis, versteht sich!«
›Sechs? Spinnt der?‹
»Na ja ... e-eigentlich wollte ich nur ei-«
»Eine für dich und fünf für deineFreundin«, unterbricht mich unser Präser erneut und sieht mich eindringlich an. »Hast du Susan vergessen?«
›Ich kenn` keine verdammte Susan! Ich -... Ach, warte. Er ist Susan. Er will die für sich!‹
»A-Ach so, j-ja. Susan. G-Genau.«
»Aber erst will ich meinen Shit!«, fordert Jon, rollt ein paar Scheine zusammen und schiebt sie durch den Maschendrahtzaun. »Hier!« Césars angespannte Körperhaltung lockert sich wieder, als er sie wortlos nimmt und das Geld checkt, doch selbst das scheint Jonathan nicht mehr zu passen. »Alter, willst du noch mit `nem Marker drübergehen?« Er wird immer gereizter. »Jetzt gib mir meinen verdammten Stoff!«
»Warum so nervös, hombre?«, fragt unser Gegenüber wieder etwas lockerer, zählt drei verschiedene Sorten Pillen in ein Mini-Druckverschlusstütchen und nimmt auch noch zwei mit einem weißen Pulver aus einer weiteren schwarzen Metallbox, auf der ein Pilz prangt. Offenbar hat er mehrere davon.
»Ich will hier keine Wurzeln schlagen, das ist alles!« Jonathan ruppt ihm die Ware aus der Hand, sobald er sie durch den Zaun reicht, dreht sich auf dem Hacken um und tippt sich an die Stirn. »Für dein großzügiges Entgegenkommen lass ich mir bis zum nächsten Mal etwas mehr Zeit!« Mir klopft er nur noch auf die Schulter, während er an mir vorbeigeht: »Wir sehen uns später, Laurie.«
›Was? Jetzt lässt er mich hier einfach allein zurück?‹
Ich bin geschockt, wütend und erleichtert zugleich. Seltsame Mischung.
César scheint meinen panischen Blick zu bemerken, denn er lächelt erneut, wenn auch nur ein bisschen, und lehnt sich seitlich an den Maschendraht. »Hey, Chico. Keine Angst ... ich beiße nicht.« Dabei zwinkert er mir schon wieder so unverschämt verführerisch zu, dass sich mein Puls schlimmer beschleunigt als nach den erlogenen zwanzig Tassen Kaffee! »Du heißt Laurie, ja?«
›Oh Gott ist das schön, wie er meinen Namen sagt!‹
»Ähm ... e-eigentlich Laurence, a-aber du darfst gern Laurie sagen, ja.« Das hab ich noch nie jemandem freiwillig angeboten!
»Gracias, corazón«, raunt er verschmitzt, was ich nur halb verstehe, doch er reicht mir die Hand durch eine der ausgerissenen Stellen des Zauns. »Ich bin César ... und du darfst mich César nennen, denn dafür gibts keine gute Abkürzung.« Der Kerl hat echt ein schamlos süßes Lächeln. »Also, Laurie ... hast du eine Chica?«
Ich stutze. ›Fragt der mich gerade wirklich durch die Blume, ob ich Single bin?‹
»Äh ... nein, ich -«
»Also gibt`s keine Susan und die fünf Ritalin sind für Jon, weil du nur eine probieren wolltest, correcto?«
›Fuck. Klar. Darum geht es ihm!‹
Ich nicke beschämt, was er erwidert, doch dann schaut er kurz zur Seite und reicht mir die sechs Pillen in einem Tütchen durch den Zaun, ohne mich anzusehen. »Aquí tienes, Laurie. Damit du mit dem Cabrón keinen Ärger kriegst. Gib mir dafür die Fünfzig, die er dir zugesteckt hat, und dann ist gut.«
»Hm.« Offenbar ist dem Kerl nichts entgangen oder er ist einfach deutlich schlauer, als Jonathan behauptet hat. »Danke, César«, sage ich leise und gebe ihm das Geld, ehe ich die Pillen einstecke.
»Gern«, wispert er, wirkt dabei aber eher bedrückt. »Weißt du, wie dein Körper auf sowas reagiert? Hast du schon mal was in der Art genommen?« Anscheinend will er sicherstellen, dass ich mir bewusst bin, was ich da tue, doch ich schüttle den Kopf.
»Äh, nein«, gebe ich zu. »Noch nie.«
»Neta? ... ay, dios mío«, schnauft er sofort, nickt langsam, als hätte er die Antwort bereits erwartet, und reibt sich durchs Gesicht. »Weißt du, ob du Herzprobleme oder Bluthochdruck hast?«, hakt er daraufhin nach und scheint ernsthaft Bedenken zu haben, denn selbst als ich den Kopf schüttle, redet er direkt weiter: »Du wirst dich konzentrieren können, sí. Aber du wirst auch nervös werden, dein Herz schlägt schneller, du atmest anders ... ist nicht ohne! Wenn du regelmäßig Medikamente nimmst oder Alkohol trinkst, kann es Wechselwirkungen und Überreizungen geben, die sehr gefährlich werden können. Ist nicht wie Weed, das Zeug drückt dich richtig hoch.«
Ich atme tief durch, versuche, die Nervosität abzuschütteln, und antworte: »Ja, das dachte ich mir schon.« Verlegen reibe mir durch den Nacken, während ich ihn beruhige, und mich gleich mit. »Aber keine Sorge, ich bin gesund, trinke nicht und nehme auch sonst keine anderen Mittelchen.«
»Hm«, schnauft er und nickt. »Na gut, nimm aber erst mal nur eine halbe und schau, wie es dir damit geht. Und warte ab! Das ist kein Red Bull! Manchmal dauert es etwas, also nicht gleich nachwerfen, klar? Sonst bist du die ganze Nacht wach und kriegst so heftig Puls, dass du denkst, dir springt das Herz aus dem Hals!«
›So wie jetzt?‹
»Okay«, erwidere ich und kann mir nicht verkneifen zu grinsen, denn ich finde es unfassbar süß, wie er sich um mich sorgt.
»Gut.« Gerade will er sich umdrehen, doch da scheint ihm noch etwas einzufallen. Er hebt den Finger vor meine Nase und sieht mich gespielt streng an. »Ach ja! Iss was vorher und trink später viel Wasser. Sonst trocknet’s dich aus.«
Der Kerl wird mir immer sympathischer. Zumindest hab ich bisher nie von einem Dealer gehört, der so umsichtig mit seinen Kunden umgeht ... allerdings rede ich auch selten mit welchen.
»Ich bin vorsichtig, versprochen!« Ich bin kurz davor ihm freundschaftlich an die Schulter zu stupsen, aber letztendlich traue ich mich nicht. »Also ich ... ähm ... ich werd` dann mal wieder.«
»Vale«, schnauft er und hebt etwas verhalten die Hand. »Pero con cuidado, eh?«
Verwirrt nicke ich und antworte ins Blaue hinein: »Ja ... bis irgendwann«, da ich kein Wort verstanden habe. Aber irgendwas in der Art wird er sicher gesagt haben.
Die Sonne wärmt mir den Rücken, als ich gehe, trotzdem wird mir irgendwie kalt.
›Ich sollte mir eine Übersetzer-App aufs Handy laden! Nur für den Fall, dass ich ihn noch mal treffe ... rein zufällig versteht sich.‹
»Laurie«, ruft er mir plötzlich hinterher, als ich schon vier Schritte weg bin, und ich schaue über meine Schulter, während ich anhalte.
»Ja?«
»Vielleicht solltest du gar nicht erst damit anfangen ...«, sagt er zu meiner völligen Verwunderung. »Wenn du’s falsch machst, kann’s richtig hässlich werden. Dein Körper gewöhnt sich schneller dran, als du „nur dieses Mal noch“ sagen kannst ... und plötzlich brauchst du immer mehr. Viele merken erst, dass sie süchtig sind, wenn’s schon zu spät ist.«
Dass seine Warnung gerade alles andere als gut für sein Geschäft ist, scheint ihm bewusst zu sein, denn ich sehe deutlich, wie er mit sich hadert.
»Äh ... okay. Danke.« Verwirrt nicke ich, aber er merkt, dass ich unsicher bin.
Er atmet tief ein, seine Augen noch immer auf mir. »Wenn du’s trotzdem machen willst, dann sorg` dafür, dass ein Freund in deiner Nähe ist, der dir im Notfall helfen kann.«
»Oh, ich bin nie allein im Haus, so viel ist sicher«, flachse ich, eher aus Verlegenheit, als um witzig zu sein, und zeige mit dem Daumen auf unser Verbindungsgebäude. »Da leben neunundzwanzig Typen auf engem Raum.«
»Und wie viele davon sind deine Freunde?«, hakt er nach und auf einmal höre ich einen beunruhigenden Unterton heraus, der mir ein wenig Angst macht.
»E-Einige ...!?« Meine Antwort klingt vielmehr wie eine Frage. »Also ... bis bald.« Schnell drehe ich mich um und laufe los.
»Lass es lieber sein, Chico ...«, ruft er mir hinterher, fast herausfordernd. »Und komm besser nicht nochmal her – sonst beiß ich dich doch noch ...«
Kapitel 2
______________
Ich bin zu einem Stalker mutiert.
Jonathan hätte ihn mir niemals vorstellen und mir auch niemals zeigen dürfen, wo er sich jeden Tag aufhält, denn jetzt ist mein schlimmster Feind nicht meine Müdigkeit – sondern er!
Das Schicksal scheint mich beschenken und gleichzeitig verfluchen zu wollen, denn vom Fenster in meinem Zimmer aus habe ich einen geradezu lächerlich perfekten Blick auf seinen Stammplatz!
Jetzt beobachte ich ihn. Tagein, tagaus. Ich brauche nur von meinem Laptop aufzuschauen und da ist er. Schemenhaft, flimmernd in der immer wärmer werdenden Mittagssonne, fast wie eine Fata Morgana, und doch weiß ich, dass er echt ist und zum Greifen nah! Ich müsste nur rübergehen und ihn ansprechen.
Aber was soll ich denn sagen? Vielleicht sowas wie: »Hey, du kennst mich zwar eigentlich gar nicht und ich dich auch nicht, aber entgegen aller Logik kann ich nur noch an dich denken! Ja, ich glaube, ich hab mich voll in dich verschossen, weil ... du so warmherzig gesagt hast, dass ich keine Drogen nehmen soll ... obwohl du sie mir verkauft hast.«
Wahrscheinlich würde er sich totlachen.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, ob ich mich wirklich in ihn verliebt habe. Ich war noch nie verliebt. Vermutlich ist es eher eine Schwärmerei, so wie damals, als ich vierzehn war und ganz extrem auf Antonio Banderas stand. Ich habe alle Filme gesehen, in denen er mitgespielt hat, mehrmals, konnte sie förmlich mitsprechen, hatte Poster, Karten und ... ein geheimes Wichsheft, in das ich sämtliche Nacktfotos von ihm geklebt hatte. Und ja, das wissen zwar nicht allzu viele, aber von dem Kerl gab es haufenweise! Er war zigmal im Playgirl, in verschiedenen Homo-Zeitschriften und selbst in seinen B-Movies gab es so einige Szenen, in denen man ihn nackt sah! Davon machte ich Screenshots und druckte sie aus, aber natürlich gab es auch im Internet schon sehr gut gemachte Collagen, die meine Fantasie zusätzlich anreizten.
So im Nachhinein betrachtet hab ich durch ihn vielleicht auch mein ausgeprägtes Faible für spanische Männer entwickelt ... oder Typen, die in die Richtung gehen ... so wie César.
Meine Eltern würden mich umbringen, wenn sie das wüssten. Dass ich schwul bin, haben sie ziemlich schnell akzeptiert, ja geradezu gefeiert. Meine Mutter stellte mich manchen ihrer Bekannten sogar mit »Das ist mein Sohn Laurence, er geht bald nach Harvard und ist homosexuell« vor. Fast so, als sei es gerade in Mode, einen schwulen Sprössling zu haben.
Tja, aus Harvard wurde nichts und wenn ich meinen Eltern jetzt noch beichte, bei welcher Art von Kerlen mein Schwanz hart und meine Knie weich werden, würde sie mich vermutlich enterben.
Allerdings wusste ich das auch selbst lange Zeit nicht. Die Highschool, die ich besuchte, war eine sehr elitäre Privatschule, voller hübscher, reicher Selfie-Prinzen mit gebleachten Zähnen, perfekt gestylten Frisuren und einem Sportwagen von Papi. Es war eine Ganztagsschule, so eine, in der das Mittagessen besser war als in den meisten Restaurants, aber Herz und Seele irgendwo zwischen Geldbörsen und Collegebewerbungen verloren gingen. Alle sahen gleich aus. Als wären sie mit dem gleichen Föhn, dem gleichen Zahnarzt und dem gleichen Lebensziel gebügelt worden: Erfolg, Prestige, Selbstoptimierung, Yale oder Harvard – das waren die einzigen Themen.
Verliebt hab ich mich dort nie. Nicht mal ein kleines bisschen. Ich wollte immer jemanden wie Antonio; dunkle Haare, mediterrane Haut, ein warmer Akzent und mit einem Lächeln, das nicht in einem Jahrhundert Familiendynastie geübt wurde. Jungs, die nach Sonne riechen und ein bisschen nach frischem Schweiß. Die ein feuriges Temperament haben, an dem ich mich nach Strich und Faden verbrennen wollte - aber solche Jungen oder Männer gab es dort nicht. Das heißt ... das stimmt nicht ganz. Es gab welche. Bei manchen der Partys standen sie unscheinbar in der Ecke, meistens mit einem Tablett in der Hand, oder sie arbeiteten in der parkähnlichen Anlage des Highschoolgeländes, schnitten die Hecken, mähten den Rasen und ähnliches.
Und ich sah ihnen zu. Von weitem, meist mit einem Buch vor der Nase, über dessen Rand ich immer wieder beschämt hinwegschaute. Ich fand sie so viel attraktiver als jeden dieser geschniegelten Sunnyboys im Gucci-Polo, die meine Mutter vergötterte.
Ständig fragte sie mich; »Wie wärs denn mit dem? Der ist doch sexy. Oder der da drüben, mit dem würdest du auch toll aussehen!«
Ja, genau diese Worte benutzte sie! Als würde ich mir ein paar neue Socken aussuchen! Sie wollte, dass ich mir große, weiße, saubere Strümpfe aus parfümierter luxuriöser Piuma-Baumwolle nehme, während ich viel lieber in kleine, dunkle, schmutzige Arbeitersocken schlüpfen mochte.
Ja ich weiß, der Vergleich hinkt ein bisschen. Zumal ich ganz sicher nie in irgendwen hineinschlüpfen - ... ach lassen wir das.
Ein einziges Mal gab es eine Gelegenheit, die mein Schicksal hätte verändern können. Aber ich hab es verkackt. Es war ein Nachmittag im Spätsommer, an den ich mich bis heute erinnere, als wäre es gestern gewesen. Ich war mit meinen Eltern bei Freunden zu Besuch. Die Sonne stand tief, der Rasen war frisch gemäht und ich hatte mich hinter den Poolbereich verirrt, wo auch all die Geräte aufbewahrt wurden. Tja und da war er. Ein junger Mann, kaum älter als ich, der mein jugendliches Herz sofort höherschlagen ließ. Oberkörperfrei, dafür mit einem ausgeblichenen Basecap auf dem Kopf, sprengte er gerade den frisch gemähten Rasen mit einem Gartenschlauch in der Hand. Seine dunkelblaue Hose klebte vor Nässe an seinen Beinen, genau wie ein paar Grashalme. Als er aufsah, traf mich sein Blick wie ein Stromschlag. Dunkle Augen. Warm. Neugierig. Wach. Für ein paar Sekunden waren wir allein auf der Welt.
»Lost, señorito?«, fragte er mit einem Grinsen, das mir später nächtelang den Schlaf raubte. Ich wollte was Schlaues sagen, etwas Charmantes oder überhaupt irgendwas, aber mein Hirn kochte im eigenen Saft und hatte sich bereits in eine Pfütze verwandelt. Also nickte ich nur stumm, murmelte ein »Sorry« hervor und drehte mich um, als würde ich mich schämen. Dabei hätte ich viel lieber gefragt, wie er heißt, ob er ein Zeitarbeiter ist oder immer hier arbeitete ... und ob er Lust hätte, mich zu küssen ... einfach so. Aber ich sagte nichts und als ich es endlich schaffte, mich nochmal umzudrehen, war er schon wieder verschwunden, zwischen den Brombeerbüschen und einer Mauer.
Natürlich erzählte ich niemandem davon.
Immer wieder sah ich sie, doch reden – wirklich unterhalten – konnte ich mich mit ihnen nicht. Höchstens mal zwanzig Sekunden, wenn ich mir ein Glas vom Tablett nahm oder mir einer das Tor öffnete. Ich war und bin eine absolute Niete in Sachen flirten! Ich hab mal versucht, es zu lernen, mithilfe eines Artikels über nonverbale Kommunikation im Journal of Behavioral Neuroscience. Hat seltsamerweise nicht funktioniert.
Ich will auch gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn ich einen solchen jungen Mann mit nach Hause gebracht hätte. Wahrscheinlich hätte ich von meinem Vater einen seiner berühmten todesenttäuschten Blicke kassiert und meine Mutter wäre in Tränen ausgebrochen. Erst ist er schwul, dann studiert er nur zweitklassige Veterinärmedizin an einem ebenso zweitklassigen College und schlussendlich lässt er sich auch noch von einem hispanischen Angestellten bumsen? Das wäre der Spermatropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hätte! ... Schon wieder so ein dämlicher, unpassender Vergleich. Verzeihung.
Jedenfalls wollte ich das meiner Familie einfach nicht antun – und selbst wenn, hätte es auch gar keine echte Gelegenheit dafür gegeben, da ich ja den ganzen Tag in dieser Schnöselschule feststeckte und praktisch nur zum Schlafen nach Hause fuhr, beziehungsweise gefahren wurde! Also unterdrückte ich alles, was irgendwie mit Liebe oder Verlangen zu tun hatte, holte mir alle paar Tage einen auf Antonio runter und konzentrierte mich ansonsten auf meine Noten, was zur Folge hat, dass ich bis heute Jungfrau bin. Also in der Theorie weiß ich natürlich genau, was beim Geschlechtsverkehr passiert. Heterosexuell wie auch homosexuell – der Pfahl will halt ins Loch, ob nun oben, unten, vorne oder hinten. In der Praxis ist das jedoch wie eine OP-Technik, die ich nur aus dem Lehrbuch kenne ... mit sehr begrenzter Hands-on-Erfahrung.
Tja und hier sitze ich nun. Nerdig wie meine Mutter mich schuf, ungebumst und ungeküsst! Gleichzeitig irgendwie verliebt, verschossen oder verschwärmt, wie auch immer man das nennen will, aber eins ist klar: Ich bin völlig überfordert!
›Ich muss mich konzentrieren!‹, ermahne ich mich zum gefühlt tausendsten Mal, doch ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich aus dem Fenster sehe, um ihn zu suchen.
Mein Alltag ist völlig durcheinander! Eigentlich sollte ich mich auf nichts anderes, als auf die Abschlussprüfung konzentrieren – Anatomie, Physiologie, Biochemie, Zellbiologie - das volle Programm eben, aber ich schaffe es nicht.
Jeden Morgen zwinge ich mich, früh aufzustehen, um in der Vet Library ein paar ruhige Stunden zu erwischen, bevor der Campus erwacht. Ich lerne mit Karteikarten, zeichne Organe in mein Notizbuch, lese mir laut Stoffwechselvorgänge vor, bis ich mich selbst nicht mehr hören kann. Zwischendurch habe ich Vorlesungen und Praxis, da geht’s gerade um das Mikroskopieren von Gewebeproben. Ich bin ständig unterwegs zwischen Unterricht, Labor und Lerngruppen – und jetzt glotze ich auch noch ständig aus dem Fenster, um ihn zu suchen!
Ich werfe den Stift aufs Papier, wie das sprichwörtliche Handtuch, und wubble mir mit allen zehn Fingern durch die Haare, als würde ich damit meine Gedanken neu ordnen können. Aber ich kann es nicht. Ich bin müde, meine Augen brennen, mein Hirn ist überreizt und gleichzeitig weiß ich, dass ich noch unendlich viel Stoff pauken muss.
Die Prüfung läuft über mehrere Tage. Schriftlich, praktisch, mündlich – alles dabei. Im schriftlichen Teil müssen wir Multiple-Choice-Fragen und Kurzantworten zu sämtlichen Grundlagen beantworten, also zu Themen wie Stoffwechselprozessen, Nervenleitungen oder der Anatomie verschiedener Tierarten. Dann kommt der praktische Teil, wo wir an Präparaten bestimmte Strukturen zeigen und benennen müssen und als Krönung gibt’s noch die mündliche Prüfung mit den Professoren – ein absoluter Albtraum, wenn man gerade einen Blackout hat.
Ich muss mindestens siebzig Prozent schaffen, sonst war das gesamte erste Jahr für die Katz. Wenn ich darunter liege, bin ich durchgefallen. Und das bedeutet: Wiederholen oder raus! Wir bekomme das Ergebnis offiziell ein paar Tage nach der letzten Prüfung, aber im Grunde wissen es die meisten schon früher – die Gerüchteküche ist eben schneller als jede Mail vom Prüfungsamt.
›Ich darf nicht versagen‹, säuselt mir eine kleine Stimme ins Hirn, immer und immer wieder, aber mein Schädel fühlt sich an wie ein nasser Schwamm, der einfach keinen Tropfen Wissen mehr aufnehmen kann! Darüber hinaus ist mein Fokus auf allem anderen, nur nicht mehr auf meiner Arbeit. In meine Nase kriecht der Geruch des Mittagessens, das ich ausgelassen habe, weil es irgendwas mit Bohnen gab und ich allergisch auf Hülsenfrüchte bin. Dazwischen vernehme ich den aufdringlichen Duft des Männershampoos, das Jonathan immer benutzt, was letztendlich eine äußerst seltsame Geruchsmischung ergibt. Irgendwo läuft Musik – ein Elektro-Mix mit stetig gleichbleibendem Beat – und aus der Küche höre ich das Klirren von Geschirr, gemischt mit Stimmen und kurzem Lachen.
Mein ruheloser Blick fällt auf den aufgeschlagenen Anatomiewälzer, während meine Finger über das Papier meines Notizbuches streichen, in das ich den Gastrointestinaltrakt eines Pferdes skizziert habe. Ich sehe ihn an und versinke in all seinen Windungen, irgendwo zwischen dem Caecum und dem Colon ascendens. Mein Kopf wird immer schwerer, doch kurz bevor meine Nase das Blatt berührt, reiße ich mich aus dieser morbiden Selbsttrance heraus und lehne mich in meinem Bürostuhl zurück.
»Scheiße ... ich schaff das einfach nicht«, realisiere ich und bemerke, wie mir dabei ein eiskalter Schauer über den Rücken läuft. »Aber warum? Wie kann das sein?«
Ich verstehe es wirklich nicht, denn ich habe nie auch nur eine Sekunde daran gezweifelt, dass ich mein Studium mit links schaffe! Ich meine, schon als ich klein war, bekam ich medizinisches Wissen eingeimpft wie andere Peppa Wutz. Meine Eltern diskutierten schon beim Frühstück über Aneurysmen-Clippings, laparoskopische Eingriffe oder perioperative Risiken, während ich aufmerksam zugehört und dabei zuckerfreie Dinkel-Cornflakes in mich reinschaufelte. Außerdem war ich jedes Jahr Jahrgangsbester an der Pre- und Highschool! Wie kann es also sein, dass ich hier solche Probleme habe?
Am liebsten würde ich heulen, denn inzwischen kann ich meine permanente Müdigkeit nicht mal mehr auf den fehlenden Schlaf schieben. Heute habe ich gut sieben Stunden geschlafen, jetzt ist es siebzehn Uhr und bin erst sein neun Uhr wach!
›Aber woran liegt es dann?‹
Ich schiebe meine Brille hoch, reibe mir durchs Gesicht und verstehe es einfach nicht. Klar, mein Schlafrhythmus ist komplett im Arsch, allein durch das permanente Koffein, doch in den letzten Tagen habe ich bereits ernsthaft versucht, meinen Konsum auf fünf Tassen pro Tag zu beschränken, damit ich in den Nächten erholsam schlafen kann – und es hat geklappt! Schlafen konnte ich, aber wacher und konzentrierter bin ich dadurch trotzdem nicht.
Seufzend schaue ich in meine Tasse, die natürlich schon wieder leer ist, aber selbst, wenn ich die Fünferregel breche, wird mir das nicht den Frischekick geben, den ich jetzt bräuchte. Also ziehe ich schließlich meine Schreibtischschublade auf und hole eine kleine Plastikdose heraus, in der ich meine Ohrstöpsel aufbewahre, und erstarre für einen Augenblick.
Dazwischen liegt sie – immer noch unberührt und fast vergessen – die weiße Ritalintablette von César, an die ich mich bis heute nicht herangetraut habe. Die anderen fünf hab ich Jonathan gegeben und sein anschließendes Geschimpfe ignoriert, weil ich nicht noch mehr Rabatt bekommen habe.
»Nie wieder geh ich zu diesem bohnenfressenden Blutsauger!« – waren seine Worte, doch keine drei Tage später hab ich ihn erneut zum Zaun pilgern sehen. Offenbar war sein Monstervorrat ziemlich schnell aufgebraucht, allerdings feiert er auch viel und gibt einiges an Freunde und Mädels weiter – für den doppelten Preis, versteht sich.
›Wenn die Dinger wirklich so gut sind, kann ich sie ja dosiert einsetzen‹, kommt mir in den Sinn. ›Nur ein oder zweimal die Woche, oder zu besonders heftigen Stoßzeiten, wie jetzt, kurz vor den Prüfungen. Außerdem hätte ich dann einen Grund, ihn regelmäßig wiederzusehen ...‹
Ohne weiter darüber nachzudenken, breche ich sie mit einem Lineal in zwei Hälften, stecke mir eine davon zwischen die Lippen, öffne schnell die Flasche Wasser, die immer auf meinem Tisch steht, und spüle sie herunter. Der Geschmack ist bitter und typisch medizinisch-beißend, weshalb ich sofort das Gesicht verziehe, doch mit ein paar weiteren großen Schlucken verschwindet das chemische Aroma aus meinem Mund.
›Jetzt gibt es kein Zurück‹, werde ich mir bewusst, als ich die zweite Hälfte wieder in die kleine Dose tue. ›Wie lange es wohl dauert, bis es wirkt?‹
Ich werde ein wenig nervös, doch ich zwinge mich, ruhig zu bleiben, und verschränke die Finger ineinander, während ich warte. Dabei komme ich mir jedoch ultradämlich vor. Nach ein paar Sekunden bemerke ich außerdem, wie mein Kinn schon wieder auf meine Brust und meine Augenlider gen Teppich sinken, also stehe ich auf, um mich wach zu halten.
›Ja. Vielleicht sollte ich nicht nur dasitzen und darauf warten, dass die Wirkung einsetzt. Besser ich beschäftige mich solange mit irgendwas Aktivem, damit ich nicht wegschnarche.‹
Weiterlernen macht ja gerade keinen Sinn, also stehe ich auf und schaue mich nach etwas um, mit dem ich mich ablenken kann. Da ich ein ziemlich ordentlicher Mensch bin, muss ich richtig suchen. Das Einzige, was mir ins Auge springt, ist der volle Wäschekorb auf dem Boden. Die Sachen sind sauber und trocken, ich habe nur noch nicht geschafft, sie einzuräumen.
›Gut ... ja. Das ist was Sinnvolles, das ich eh machen muss.‹
Das ist übrigens klassische Prokrastination – eine weit verbreitete Studentenkrankheit, wegen der man das Erledigen wichtiger, aufwendiger, manchmal auch unangenehmer Aufgaben möglichst lange hinauszögert und stattdessen haufenweise Kleinscheiß erledigt, der auf der Prioritätenliste eigentlich ganz unten stehen sollte.
Ich nehme meine T-Shirts heraus und beginne sie ordentlich zusammenzulegen. Der Stoff gleitet durch meine Hände, glatt, fast seidig, als würde dabei jeder Faltenzug präzise und perfekt ausgerichtet werden. Meine Bewegungen sind ruhig und trotzdem schnell – ohne nachzudenken. Die Struktur des Stoffes, der Widerstand beim Falten, alles wird nach und nach ein bisschen klarer, als es normalerweise ist, aber das fällt mir erst auf, als ich fertig bin.
›Hm ... Zufall?‹
Da der Unterschied zu sonst noch nicht allzu gravierend ist, kann ich das kaum sagen, also suche ich mir etwas anderes, das ich tun kann. Nach einer kurzen Überlegung entscheide ich mich dafür, all meine durcheinandergewürfelten Stifte aus der untersten Schublade meines Schreibtisches zu sortieren und beginne damit, sie in verschiedene Pappbecher zu stecken. Es dauert keine Minute, bis ich sie auch noch anspitze und dabei bemerke ich bereits, wie ich das ratschende Geräusch des Spitzers irgendwie intensiver wahrnehme. Als sich der Widerstand löst und die Mine in einem gleichmäßig zulaufenden Schnitt aus der Vorrichtung auftaucht, gibt mir das ein erstaunlich befriedigendes Gefühl, sodass ich noch einen und noch einen und noch einen anspitze. Sobald all meine Minen spitzer sind als der Dackel unserer früheren Nachbarin, gehe ich zum Bett rüber, nicht um zu schlafen, sondern um die Falten in der Decke glattzustreichen. Auch das ist nur eine Kleinigkeit, aber auf irgendeine Art und Weise fühlt sich jeder Zug mit meinen Händen über den Stoff anders an als sonst. Irgendwie vollendeter, besser und ... richtig.
Ja, das ist es! Endlich fühlt sich alles, was ich tue ... richtig an. Aber wie kann das sein?
Ich drehe mich zurück zum Schreibtisch, setze mich, schaue in mein Anatomiebuch und beginne, leise zu lesen. Plötzlich wabern die Worte nicht mehr zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, sondern sie bleiben in meinem Kopf! Die Diagramme, Tabellen und grafischen Abbildungen scheinen sich beinahe von selbst zu erklären und sind vollkommen einleuchtend! Ich sehe alle zuvor verborgenen Details, erkenne die Strukturen und präge mir jeden Satz ein, als hätte ich ein inneres Bild vor Augen, das mit jeder Information an Farbe und Realität zunimmt. Es ist fast schon haptisch – ganz klar, prägnant und greifbar.
Ich verliere mich in den Seiten, als könnte ich die Schrift umschließen. Alle störenden Geräusche um mich herum ebben ab, der Krach aus der Küche, selbst die Laute von draußen werden zu einem fast schon angenehmen, weichen Rauschen in meinen Ohren, das mir vielmehr hilft, als mich zu stören.