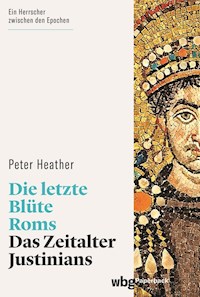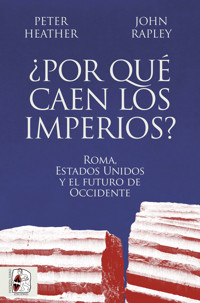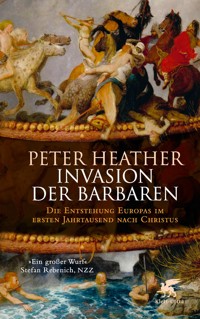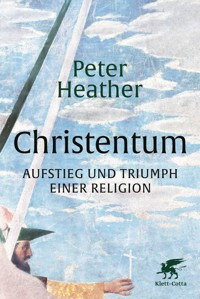
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer Religion zwischen Glauben und Machtpolitik Mit großer Erzählkunst schildert Peter Heather den langen Prozess der Entstehung des Christentums und zeigt, wie es sich über ein Jahrtausend hinweg verwandelte und zu einem machtvollen Element europäischer Politik und Kultur wurde. Sein großes episches Panorama reicht von den frühen Christenverfolgungen bis zur Etablierung des Christentums als dominierende Religion und autoritäre Institution. Eine moderne Darstellung des historischen Christentums unter dem Aspekt der Machtpolitik für unsere Zeit. Im 4. Jahrhundert brach ein neuer Glaube aus Palästina hervor. Er überwältigte das Heidentum und bekehrte Kaiser Konstantin. Fast 1000 Jahre später wurde ganz Europa von christlichen Herrschern regiert und die Religion, tief in Kultur und Gesellschaft verwurzelt, kontrollierte die Bevölkerung. Doch wie Peter Heather zeigt, war der Aufstieg des Christentums zur europaweiten Dominanz keineswegs unvermeidlich. Eindrucksvoll schildert er, wie es zum prägenden Merkmal der europäischen Landschaft wurde. Vom Zusammenbruch des Römischen Reiches, der die Religion an den Rand des Aussterbens brachte, bis zur erstaunlichen Papstrevolution im Mittelalter, aus der die Kirche als Haupt einer riesigen internationalen Organisation hervorging, verfolgt Heather die Fähigkeit des Christentums zur Selbstneuerfindung und die erstaunliche Bereitschaft, gezielte Gewalt einzusetzen. Dies ist die außergewöhnliche Geschichte einer Religion zwischen Glauben und Machtpolitik. »Eine brillante Entzauberung … hervorragend erzählt … Heather bietet unglaublich reiche Schilderungen und verliert dabei nie das große Ganze aus den Augen. Ein fesselndes wie tiefgründiges Buch.« Costica Bradatan, Literary Review »Eine faszinierende Geschichte über eine Religion in einer überraschend prekären Lage.« Dan Jones, Sunday Times »Hervorragend erzählt ... fesselnd und tiefgründig.« Literary Review »Ein Pageturner.« The Spectator
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1427
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
PETER HEATHER
CHRISTENTUM
Aufstieg und Triumph einer Religion
Aus dem Englischen übersetzt von Susanne Held
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: produktsicherheit@klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Christendom. The Triumph of a Religion« im Verlag Allen Lane, Penguin Random House UK
© 2022 by Peter Heather
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © akg-images / Rabatti & Domingie (Gemälde von Piero della Francesca, Sieg Konstantins)
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98122-3
E-Book-ISBN 978-3-608-12458-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Erster Teil
Die Romanisierung des Christentums
1
»Durch dieses siege …«
Der Weg nach Nicaea
»Macht zu Jüngern alle Völker«?
Das Nizänische Glaubensbekenntnis
Nach Nicaea
Die Kirche der Märtyrer?
»Wenn ihr (immer noch) vollkommen sein wollt …«
2
Bekehrung in einem christlichen Imperium
Bekehrungsmuster
»Es gibt mehrere mögliche Wege …«
Des Kaisers neuer Kult
»Der Mann, den Gott liebt …«
3
Der Siegesaltar
Serapeum
Der Gottesstaat
»Der Höchste Gott«
Zweiter Teil
Der Untergang des römischen Christentums
4
Nicaea und der Untergang des Westens
Hunerich und Chlodwig
Der nachrömische Westen
Kleiner Wolf
Gebt dem Kaiser
Hunerich und die Taufe Chlodwigs
5
Der Islam und der Niedergang des Ostens
»Auf Gottes Geheiß …«
Fünf Säulen der Weisheit
Es gibt keinen Gott außer Gott …
Isaac Tabanos
Die Taufe Chlodwigs (da capo)
6
»Keine Engel«: Bekehrung in Nordwesteuropa
Missionare und Könige
Vorwärts, Christi Streiter!
Missionarseinstellungen
Kirche und Volk
7
Die Neustrukturierung des lateinischen Christentums
Vom Imperium zum Commonwealth
De correctione rusticorum
8
Kultur und Gesellschaft im nachrömischen Westen
Jenseits der Dunklen Jahrhunderte
Kirche und Bildung
Kirche und Staat
Dritter Teil
Die Erneuerung des christlichen Reiches
9
Christliche Expansion in einem zweiten imperialen Zeitalter
Weihnachten Anno Domini 800
translatio imperii
Das Kreuz geht in den Osten
Könige und Christentum im Schatten des Imperiums
10
Der Gottesstaat Karls des Großen
Correctio
Religion der Massen
11
Päpste und Kaiser
Päpste und Missionare
Die Erfindung der päpstlichen Autorität
Der Weg nach Canossa
12
»Gott will es«
Päpstliche Außenpolitik?
Die Kreuzzüge und die Grenzen der Christenheit
Kanon-Harmonisierungen
13
Die Ökonomie der Erlösung
»Nur der Büßer wird bestehen«
Schule und Universität
Die Armen von Lyon
Einbeziehung und Kreativität
»Minderbrüder«
14
Christentum und Zwang
accusatio und inquisitio
Die große Lepra-Panik
Die Visitationen des Richard de Clyve
Tafelteil
Anhang
Danksagungen
Liste der Karten
Abbildungsverzeichnis mit Nachweisen
Anmerkungen
Vorwort
»Durch dieses siege …«
Bekehrung in einem christlichen Imperium
Der Siegesaltar
Nicaea und der Untergang des Westens
Der Islam und der Niedergang des Ostens
»Keine Engel«: Bekehrung in Nordwesteuropa
Die Neustrukturierung des lateinischen Christentums
Kultur und Gesellschaft im nachrömischen Westen
Christliche Expansion in einem zweiten imperialen Zeitalter
Der Gottesstaat Karls des Großen
Päpste und Kaiser
»Gott will es«
Die Ökonomie der Erlösung
Christentum und Zwang
Bibliographie
Primärquellen
Sekundärliteratur
Register
Vorwort
Um das Jahr 1250 wurde Großfürst Mindaugas(1) von Litauen durch die Taufe in das Christentum aufgenommen. Ein Vertreter des letzten nicht-christlichen Herrschergeschlechts von einer gewissen Bedeutung auf dem gesamten europäischen Territorium schloss sich jener Religion an, für die der Kontinent nun ein Synonym war. Er wurde dafür gebührend belohnt: Papst Innozenz IV.(1) erhob sein Herzogtum in den Rang eines Königreichs. Einige Jahre später, im August 1253, erkannte derselbe Papst offiziell die Legitimität eines neuen italischen monastischen Ordens an, der von und für Frauen geführt wurde: die Klarissen(1), benannt nach Klara(1) von Assisi, Freundin, Schülerin und Mitarbeiterin des berühmten Heiligen Franziskus(1). In der Zwischenzeit, am 15. Mai 1252, hatte der Papst außerdem Ad extirpanda(1) erlassen, eine wichtige Rechtsverordnung (päpstliche »Bullen« werden immer nach ihren einleitenden Worten benannt), die bei der Vernehmung von Ketzern den Einsatz der Folter erlaubte, und zwar in sämtlichen Ländern, in denen die heilige Autorität des Papstes maßgebend war: in eben der lateinischen Christenheit, um die es in diesem Buch gehen soll.
Diese kleine chronologische Zusammenstellung von Ereignissen gegen Ende der tausendjährigen Periode, die in diesem Buch untersucht wird, hebt einige seiner wichtigsten Themen hervor. Jeder Bericht über die Ursprünge und die Entwicklung des europäischen Christentums ist notwendigerweise eine Bekehrungsgeschichte. Zu Beginn der Geschichte, mit Kaiser Konstantin(1) im Jahr 300 n. Chr., der als erster Herrscher in Europa das Christentum annahm, blieb dieses selbst in der römischen Welt eine Minderheitenreligion; und die überwiegende Mehrheit der Christen des Imperiums lebte nicht in den europäischen Provinzen, sondern in Kleinasien, dem Nahen Osten, Ägypten und Nordafrika. Um 1300 war die gesamte europäische Landmasse (mit Ausnahme kleiner Teile Litauens, der Iberischen Halbinsel und des Polarkreises) christlich, während sich ein Großteil des ehemaligen Kernlandes der christlichen Welt im südlichen Mittelmeerraum dem Islam zugewandt hatte, wodurch die untrennbare Verbindung zwischen Europa und dem Christentum hergestellt war, die bis heute Bestand hat. Aber ebenso wie im Fall von Fürst Mindaugas(2) und Litauen(1) begannen die christlichen Konversionen eines erstaunlich großen Teils des europäischen Kontinents mit einem Wechsel der religiösen Zugehörigkeit seitens eines Herrscherhauses. Die Eigentümlichkeit von Konversionsprozessen, die von den Mächtigsten ausgehen, wird im Folgenden immer wieder thematisiert werden.
In der engen zeitlichen Gegenüberstellung von Papst Innozenz’(2) Zulassung der Klarissen(2) und seiner Bulle über die Folterung von Ketzern klingen einige weitere zentrale Themen des Buches an. Der Christus der Evangelien ist für viele Dinge berühmt, nicht zuletzt jedoch für seine Worte »Liebet eure Feinde« und »Halte die andere Wange hin«. Das europäische Christentum des 13. Jahrhunderts orientierte sich an vielen dieser aufgezeichneten Ideale, weil es die Darstellung der Lehren und Taten Christi im Neuen Testament beibehielt, studierte und verehrte. Die beiden Heiligen Klara(2) und Franziskus(2) und viele andere charismatische christliche Leitfiguren in den ersten Jahrhunderten des zweiten Jahrtausends hielten diese Werte darüber hinaus nicht nur theoretisch hoch, sondern versuchten auch, sie in die Praxis umzusetzen. Sowohl Klara als auch Franziskus verzichteten tatsächlich auf all ihre weltlichen Güter; sie verkauften alles, was sie besaßen, widmeten ihr Leben den Armen und Kranken und forderten ihre Anhänger auf, dasselbe zu tun.
Doch auch wenn einige ihrer moralischen Werte sofort als die des Neuen Testaments erkennbar waren, agierten Klara(3) und Franziskus(3) innerhalb eines christlichen religiösen Gefüges, dessen institutioneller und dogmatischer Rahmen sich seit dem 1. Jahrhundert n. Chr. bis zur Unkenntlichkeit verändert hatte. Noch im Jahr 300, zur Zeit der Bekehrung Konstantins(2), besaß das Christentum keinerlei zentrale Autoritätsstruktur. Es bestand aus einer Reihe von zumeist städtischen Gemeinden, die ihre Oberen selbst wählten und – trotz einiger Gemeinsamkeiten in den erforderlichen Glaubensinhalten, im persönlichen Verhalten und in der institutionellen Organisation – ihre Angelegenheiten größtenteils unabhängig voneinander regelten. Vieles war im Fluss. Selbst eine so grundlegende christliche Lehre wie die von der Heiligen Dreifaltigkeit(1) fand erst nach der Bekehrung Konstantins eine allgemein anerkannte Formulierung, und viele theoretische und praktische Fragen – die in jeder Religion eng miteinander verbunden sind – blieben lange Zeit ungelöst.
Klara(4) und Franziskus(4) sind dafür ein gutes Beispiel. Trotz der neutestamentlichen Werte, zu denen sie sich bekannten, lebten sie ihr religiöses Leben aufgrund eines bestimmten Verständnisses davon, was es bedeutet, ein guter Christ zu sein: eines Verständnisses, das von Pariser(1) Theologen formuliert worden war, die innerhalb jenes Jahrhunderts tätig waren, in dem die beiden Heiligen selbst zur Welt gekommen waren. Der von Franziskus gegründete Predigerorden(1) hatte es sich zur Aufgabe gemacht, in ganz Europa eine Vorstellung von Himmel, Hölle(1) und Fegefeuer(1) zu verbreiten. Dies umfasste sowohl die Auswirkungen der Sünde auf die Bestimmung der menschlichen Seele nach dem Tod als auch die Frage, wie das Verhalten des Einzelnen und derjenigen, die ihn im Hier und Jetzt liebten, das künftige und (im Falle der Toten) das gegenwärtige Schicksal ihrer Seele beeinflussen konnte. Diese klare Vorstellung von den drei möglichen Bestimmungsorten der Seele nach dem Tod und von den genauen Auswirkungen einzelner Sünden bei der Entscheidung, an welchen dieser Orte eine einzelne Seele gelangen würde, entstand erst im 12. und 13. Jahrhundert. Der Gedanke, dass gute Taten schlechte Taten kompensieren können, war in der christlichen Tradition schon sehr alt, aber bis dahin war noch kein umfassendes und kohärentes System von Bußtarifen und anderweitigen Heilmitteln formuliert worden.
Und selbst wenn ein solches System existiert hätte, wäre vor dieser Zeit vollkommen unmöglich gewesen, dass es breite Anerkennung gefunden hätte. Anders, als die päpstliche religiöse Autorität selbst gerne von sich glauben machte (und einige ihrer Apologeten tun dies nach wie vor), war sie ein erstaunlich spätes Phänomen innerhalb der sich entwickelnden europäischen christlichen Tradition. Die Bischöfe von Rom genossen als Erben des Apostels Petrus(1) schon früh enormes Ansehen, und andere christliche Führer holten regelmäßig ihre Meinung zu wichtigen religiösen Fragen ein. Wenn sie jedoch anderer Meinung waren, fühlten sie sich nicht im Geringsten verpflichtet, den Ansichten des Papstes zu folgen. In vergleichbarer Weise übten Kaiser und Könige, wie in diesem Buch untersucht wird, noch viele Jahrhunderte nach Konstantin eine viel größere reale religiöse Autorität aus als jeder Papst, und zwar nicht nur in der Praxis, sondern auch von Rechts wegen, da allgemein anerkannt wurde, dass die christlichen Herrscher direkt vom Allmächtigen ernannt waren. Erst im 11. Jahrhundert entwickelte sich das seit Langem bestehende päpstliche Prestige zu einem ersten offiziellen Anspruch, dass Päpste eine allgemeine religiöse Autorität ausüben sollten. Und es sollte noch den größten Teil des folgenden Jahrhunderts dauern, bis diese Forderung in der Praxis akzeptiert wurde. Die religiöse Autorität, die Innozenz IV.(3) zu Beginn der 1250er Jahre geltend machte, war also etwas grundlegend Neues. Und wie der Erlass Ad extirpanda(2) nur allzu deutlich macht, ging es bei der Durchsetzung einer weit verbreiteten Akzeptanz dieser neuen Autoritätsstruktur – sowie der Lehren und Visionen guter christlicher Frömmigkeit, die sie unterstützen wollte – nicht nur um die Art von überzeugendem Konsens, den das Beispiel und die Predigten eines Franziskus(5) oder einer Klara(5) hervorbringen konnten. Es ging auch um die Anwendung von beträchtlichem Zwang, selbst wenn nicht alles von so direkter Brutalität war wie die physische Folter, die nun von Gesetzes wegen gegen jene angewendet werden durfte, die als Ketzer galten.
Diese kleine Zusammenstellung von Ereignissen unterstreicht einen noch wichtigeren Punkt. Der Begriff »Christentum« ist in einem entscheidenden Sinn ein irreführender Singular. Die christliche Religion, der Konstantin(3) die Treue schwor, hatte wenig Ähnlichkeit mit der ausdifferenzierten, monolithischen religiös-kulturellen Struktur, die sich bis zum 12. und 13. Jahrhundert herausgebildet hatte und die dann die überwiegende Mehrheit der unterschiedlichen Landschaften und Bevölkerungen Europas beherrschte, bis die Reformation in den 1500er Jahren ernsthaft Fuß fasste. Die Entstehung dieser außergewöhnlichen, voll ausgereiften Struktur soll im Mittelpunkt des vorliegenden Buches stehen. Und schließlich wird es sich mit jener lateinischen Christenheit befassen, die in der Ära päpstlicher Monarchie von Rom aus dominiert wurde – dem mittelalterlichen Christentum (im Wortsinn »das Gebiet, in dem der christliche Glaube herrscht«) par excellence. Die Trennung von der griechisch-orthodoxen Gemeinschaft erfolgte jedoch spät und war keineswegs vorherbestimmt, so dass vieles von dem, was folgt, insbesondere in den vorderen Kapiteln, einen breiteren geographischen und kulturellen Fokus hat.
Um 1900, als sich zum ersten Mal professionelle Historiker dieses Problemfeldes annahmen, und während eines Großteils des sich anschließenden Jahrhunderts waren Darstellungen über den Aufstieg des Christentums einfach zu schreiben. Vom ersten bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. verbreitete sich der christliche Glaube allmählich an den Ufern des Mittelmeers. Im 4. Jahrhundert verdrängte das Christentum dann nach der Bekehrung Kaiser Konstantins(4) das griechisch-römische Heidentum und übernahm die Herrschaft über die römische Welt, bevor es dann eine Vielzahl anderer Konkurrenten besiegte und zur vorherrschenden Religion auf der gesamten europäischen Landmasse wurde. Tausend Jahre nach Konstantin wurde ganz Europa von christlichen Herrschern regiert. Das Christentum – jener Teil der Welt, in dem die offizielle christliche Religion die Gesamtheit der Bevölkerung beherrschte: Adel und Volk, Herrscher und Beherrschte – war entstanden, und das war’s. In dieser Erzählung der christlichen Geschichte war der Rest der europäischen Religionsgeschichte – selbst die explosive Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert – kaum mehr als eine Fußnote: Christen, die Anpassungen an bestimmte Glaubensvorstellungen und Verhaltensanforderungen vornahmen. Eine entscheidende Übereinstimmung zwischen den Grenzen Europas und der Sphäre einer überwältigenden christlichen Herrschaft hatte sich im Mittelalter herausgebildet, und von dort aus verbreitete sich die Religion in den großen Epochen der europäischen Kolonialbewegung und des Imperialismus triumphal über einen Großteil des restlichen Planeten.
Solche triumphalistischen Überblicksvisionen der christlichen Geschichte sind intellektuell nicht mehr vertretbar. In den letzten Jahren haben sich verschiedene europäische Politiker auf der Suche nach etwas Besonderem, das die Völker des Kontinents vereint, auf das Christentum gestürzt. Eine – rapide abnehmende – Mehrheit der europäischen Bevölkerung bezeichnet sich zwar in den Fragebögen nationaler Zählungen immer noch als »christlich«, aber in Wirklichkeit bedeutet das oft lediglich »alles andere nicht«. Nur sehr wenige moderne Europäer würden in den Augen der mittelalterlichen Kirchenmänner, die als Erste die Schlacht um die Seele Europas gewonnen haben, als Christen durchgehen. Lässt die große Mehrheit der sich selbst als Christen bezeichnenden Menschen von heute ihre Kinder taufen? Gehen sie in die Kirche? Gehen sie zur Beichte und zur Heiligen Kommunion und zahlen sie Abgaben an die Kirche? Lernen sie die wichtigsten Lehren des christlichen Glaubens und richten sie ihr Leben nach den großen christlichen Festen aus, einem jährlichen Zyklus des Gedenkens, der die wichtigsten Momente und Botschaften des Christentums in der kollektiven Psyche verankert? Die Antwort lautet nein – auch wenn sich am Ostersonntag immer noch große Menschenmengen vor dem Petersdom(1) versammeln.
Das ist allgemein bekannt. Wir alle wissen, dass das Christentum seinen Einfluss auf das Innenleben vieler Europäer verloren hat; das Phänomen der Entchristlichung wird allgemein diskutiert, und viele christliche Religionsgemeinschaften kämpfen um ihr Überleben. Aber die Bedeutung dieser modernen Entchristlichung für ein erneutes Nachdenken über Schlüsselelemente der Geschichte, über die Frage, wie und warum Europa überhaupt erst zu einer Welt des Christentums wurde, ist noch nicht erkannt worden.
Es ist heute grundsätzlich nicht mehr möglich, eine Geschichtsdarstellung auf der Grundlage der Annahme zu konstruieren, dass der Sieg des Christentums über sämtliche Konkurrenten in grauer Vorzeit ein Beweis für die grundlegende Überlegenheit des Christentums als Religion ist. Eine solche Perspektive war so gut wie unvermeidlich, als die ersten akademisch anspruchsvollen historischen Darstellungen des Christentums im späteren 19. und selbst noch im frühen 20. Jahrhundert verfasst wurden. Zu diesem Zeitpunkt besuchten die meisten Menschen in Europa noch regelmäßig die eine oder andere Kirche, und der europäische Imperialismus verbreitete das Christentum über den ganzen Globus. Mein Großvater (den ich leider nie kennengelernt habe) trat 1909 in die britische Armee ein und bekannte sich an seinem ersten Sonntag unter der Flagge als Agnostiker. Dadurch konnte er zwar die Church Parade vermeiden, wurde aber stattdessen zur Reinigung der Latrinen eingeteilt. Es folgte ein schneller Übertritt zur Church of England, weil ihm »der Andachtsort der Agnostiker« nicht zusagte. In einem solchen Kontext war es schwer vorstellbar, dass das Christentum nicht weiterhin erfolgreich bleiben würde.[1] Die Entchristlichung des modernen Europa seit 1945 straft jedoch nicht nur triumphalistischen Annahmen über den anhaltenden Erfolg des Christentums Lügen, sondern muss notwendig auch die Herausforderung verändern, über die christliche Vergangenheit zu schreiben.
Heute muss jeder Historiker des Christentums immer noch von einer Religion ausgehen, die stark genug war, um sich in einer ganzen Reihe von Kontexten der Antike und des Mittelalters durchzusetzen und diese Position einer etablierten kulturellen Vorherrschaft über Jahrhunderte hinweg gegen eine Vielzahl weiterer Herausforderungen zu behaupten. Gleichzeitig muss das Christentum aber auch als eine Religion angesehen werden, die nicht in allen Kontexten und zu allen Zeiten unverwundbar ist. Um die Entstehung des europäischen Christentums von diesem Standpunkt aus neu zu betrachten, müssen drei bisher weitgehend ignorierte Dimensionen der Geschichte des Christentums gebührend berücksichtigt werden.
Erstens: Kontingenz. Wir wissen heute – im Gegensatz zu den Historikern, die um 1900 schrieben –, dass das Christentum unter den entsprechenden Umständen verlieren kann, und zwar in dem Sinne, dass es nicht in der Lage ist, das Innenleben der Mehrheit der europäischen Bevölkerung fest im Griff zu behalten. Das bedeutet, dass der ursprüngliche Erfolg des Christentums viel genauer unter die Lupe genommen werden muss. Vor einem Jahrhundert war es schwierig, irgendeinen der dokumentierten religiösen Widerstände gegen das offizielle Christentum, das in ganz Europa dominierte, ernst zu nehmen. Ganz gleich, ob es sich um Herausforderungen von außen handelte – wie das griechisch-römische und andere Formen von – oder von innen – abweichende, so genannte häretische Formen des Christentums: Der totale Sieg des offiziellen Christentums (wie er auf einer Reihe bedeutender Konzilien, beginnend in Nicaea(1) im Jahr 325, definiert wurde) erschwerte die Vorstellung, dass eine dieser Alternativen jemals eine ernsthafte Bedrohung hätte darstellen können. Diese Sichtweise ist nach wie vor so tief in der akademischen Tradition eingewurzelt, dass ihr Einfluss sich bisher als nahezu unerschütterlich erwiesen hat. Die moderne Wissenschaft neigt immer noch dazu, die antichristlichen Bemühungen des letzten heidnischen römischen Kaisers Julian(1) als völlig perspektivlos abzutun, und alternative, nicht-nizänische(1) christliche Strömungen der spätrömischen Periode werden im Allgemeinen nur in wenigen Fußnoten abgehandelt. Aber da wir heute wissen, dass das offizielle Christentum, sowohl in seiner katholischen als auch in seiner orthodoxen Ausprägung, nicht dazu auserkoren war, sich für alle Zeiten durchzusetzen, ergibt sich die ernsthafte Möglichkeit, dass es an anderen Stellen in der Vergangenheit tatsächlich auch »verloren« haben könnte. Ein zentrales Ziel dieses Buches ist es daher, der religiösen Opposition – wo es angebracht ist – ebenso viel Sendezeit zu schenken wie dem »offiziellen« Christentum.
Zweitens muss viel stärker herausgearbeitet werden, wie unterschiedlich das Christentum zu verschiedenen Zeitpunkten tatsächlich war. Einige seiner Glaubensvorstellungen waren, verankert in einem Kanon heiliger Texte, mehr oder weniger konstant, und in vielen anderen Fällen kann man kontinuierliche Prozesse der Verfeinerung und Klärung beobachten. Dies hat die Traditionen des Schreibens über das Christentum stark beeinflusst – vor allem, wenn die Texte von praktizierenden Gläubigen stammen –, die sich natürlich auf die Kontinuitäten in den Glaubensvorstellungen und Praktiken und deren allmähliche räumliche und zeitliche Ausbreitung konzentrieren. Aber obwohl es zweifellos wichtige und reale Kontinuitäten gibt, deren Dauerhaftigkeit für die gesamte Existenz einer christlichen Tradition von zentraler Bedeutung ist, würde ich argumentieren, dass sie bei näherer Betrachtung weder so zahlreich noch so konstant sind, wie das offizielle Christentum gerne vorgibt. Ebenso wichtig: Wenn man aufhört, das Christentum als ein einzigartig mächtiges kulturelles Konstrukt zu betrachten, das dazu bestimmt ist, für alle Zeiten siegreich zu bleiben, dann können die Diskontinuitäten als eine wesentliche Dimension der Gesamtgeschichte der sich entwickelnden Religion neu dargestellt werden, eine Dimension, die ebenfalls gleichberechtigt zur Sprache kommen muss. Bei näherer Betrachtung unterscheidet sich das frühmittelalterliche Christentum in vielerlei Hinsicht stark von seinem spätrömischen Vorgänger, der sich seinerseits tiefgreifend von der frühen Kirche der vorkonstantinischen Zeit abhob; und das spätmittelalterliche Christentum war noch einmal etwas ausgesprochen Anderes. Wie alle großen missionierenden Religionen hat das Christentum die Fähigkeit, sich – innerhalb einer rhetorischen Selbstdarstellung, die stets den Schwerpunkt auf Kontinuität legte – je nach Kontext quasi aus dem Stand neu zu erfinden. Im Folgenden werde ich die These vertreten, dass ebenso entscheidend für den Erfolg des Christentums wie die religiösen Kontinuitäten seine chamäleonartige Anpassungsfähigkeit war, die es ihm ermöglichte, den sehr unterschiedlichen religiösen Bedürfnissen der verschiedenen Gruppen religiöser Konsumenten gerecht zu werden, mit denen es zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Geschichte zusammentraf und die es mit einbezog.
Drittens möchte ich das Potenzial europäischer Bevölkerungsgruppen, sich im Laufe der Zeit für eine alternative religiöse Zugehörigkeit zu entscheiden, sehr viel genauer unter die Lupe nehmen. In dieser Hinsicht scheint mir die Darstellung der Bekehrung zum Christentum im Mittelalter immer noch stark von einem überkommenen christlichen Triumphalismus geprägt zu sein. Da Europa am Ende vollständig christlich sein würde, kann man sich nur schwer der Annahme entziehen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Menschen sich dem Christentum anschließen würden. In der heutigen Zeit haben sich die Menschen in Europa jedoch in großer Zahl dafür entschieden, sich in der Praxis nicht zum Christentum zu bekennen, was auch immer sie in den Volkszählungslisten angeben mögen. Diese nackte Tatsache zwingt uns, nach Antworten zu suchen, die besser sind als die alte Annahme, das Christentum sei einfach die bessere, überlegene Religion. Was genau veranlasste einen Großteil der Bevölkerung Europas im Mittelalter dazu, sich zum Christentum zu bekennen? Haben alle Menschen diese Entscheidung aus demselben Grund getroffen? Und kann das Verständnis dieser ursprünglichen Entscheidungen dazu beitragen, zu erklären, warum eine alternative Entscheidung zu einem immer wichtigeren Merkmal der jüngeren europäischen Kulturgeschichte geworden ist?
Somit ist dieses Buch eine Antwort auf die meines Erachtens dringliche intellektuelle Herausforderung, den Aufstieg des Christentums zu seiner Vormachtstellung im Lichte seines Verschwindens in der Gegenwart neu zu bewerten, indem es die geschichtlichen Prozesse neu untersucht, die überhaupt erst zu dem Europa definierenden Zusammenfall mit der kulturellen Dominanz der christlichen Religion geführt haben. Es zielt darauf ab, die Kontingenz, die fast grenzenlose Fähigkeit des Christentums zur Selbsterfindung, sowie das Potenzial früherer Bevölkerungen, alternative Entscheidungen zu treffen, ganz und gar ernst zu nehmen. Mein Ziel ist es nicht, eine weitere Gesamtgeschichte des Christentums zu schreiben, sondern neu zu erkunden, wie »Europa« und »Christentum« deckungsgleich wurden: also der Teil der Erde, der von christlichen Herrschern dominiert wird und eine überwiegend christliche Bevölkerung hat. Der natürliche Ausgangspunkt ist daher das frühe 4. Jahrhundert n. Chr. und die Bekehrung des römischen Kaisers Konstantin(5) zum Christentum, womit historisch gesehen das überhaupt erste christliche Staatsoberhaupt auftrat. Zu Ende ist diese Geschichte im 13. Jahrhundert, als die letzten überlebenden nicht-christlichen Herrscher in Europa verschwinden.
Selbst dies ist natürlich ein enorm ehrgeiziges Projekt. Ich bin mir der Grenzen meines Fachwissens und der damit verbundenen Abhängigkeit von der Arbeit einer kleinen Heerschar anderer Wissenschaftler durchaus bewusst (was in den Anmerkungen und der Bibliographie sehr prägnant zum Ausdruck kommt). Ich bin Fachmann für spät- und nachrömische Geschichte und kenne mich mit dem griechischen und lateinischen Primärmaterial dieser Epochen sowie mit der vielfältigen wissenschaftlichen Literatur aus, die diese Quellen hervorgebracht haben. Mein jetziges Vorhaben ist sehr viel breiter angelegt, und seine Fertigstellung wäre nicht möglich gewesen ohne die immense Hilfe entsprechender Fachliteraturen aus einer ganzen Reihe anderer Gebiete, mit denen es an verschiedenen Stellen Berührungspunkte gibt: Studien zum Neuen Testament, zum frühen Christentum, zur Orientalistik, zur Islamistik und insbesondere zur Religions- und Rechtsgeschichte des Mittelalters, um nur einige zu nennen. Aber ein solches Maß an Abhängigkeit ist bei einer so weitreichenden Studie unvermeidlich, und auch wenn das, was hier folgt, von Natur aus eher ein (wenn auch umfangreicher!) Essay als eine detaillierte wissenschaftliche Monographie ist, bin ich der festen Überzeugung, dass eine so weit gefasste Betrachtung der Geschichte des frühen und mittelalterlichen Christentums große Vorteile bietet, die die potenziellen Probleme, die sich daraus ergeben können, wenn ich mich außerhalb meines eigentlichen Fachgebiets bewege, mehr als aufwiegen.
In der letzten Historikergeneration gab es eine starke Tendenz, die Behandlung großer historischer Themen über längere Zeiträume zu vermeiden. Das geschah größtenteils aus sehr positiven Gründen: einem Wunsch, in einer Ära immer ausgefeilterer Methoden, in welcher der akademische Zeitgeist eher das Intime und Fragmentarische begünstigt hat, wirklich Experte zu sein. Zum Teil spiegelt sich darin auch eine negative Reaktion auf die Art von anachronistischen Werten wider, die für die älteren so genannten Meta-Narrative oder Meistererzählungen früherer Generationen westlicher Gelehrter kennzeichnend waren: einen unterschwelligen christlichen Triumphalismus im Bereich der Religionsgeschichte zum Beispiel, oder die damit eng verbundene Annahme der vielen dem Aufstieg der westlichen Zivilisation gewidmeten Studien, dass diese eine unhinterfragbar »gute Sache« war. Die Gesamtwirkung dieser sehr notwendigen intellektuellen Reaktion auf viele Dimensionen der Geschichte des Christentums wird wiederum aus meinen Endnoten ersichtlich, deren Abhängigkeit von einer ganzen Reihe wunderbarer Studien zu Aspekten des Jahrtausends, mit denen sich mein Buch befasst, auch das Fehlen jedes neueren Versuchs unterstreicht, sich mit dem übergreifenden Phänomen der europäischen Christianisierung als Ganzem auseinanderzusetzen.[2]
Aber vor diesem wissenschaftlichen Hintergrund hat ein größerer Zeitrahmen Vorteile, die weit über die bloße chronologische Vollständigkeit hinausgehen. Meiner Ansicht nach besteht die richtige Antwort auf die Unzulänglichkeiten der wertbefrachteten Meta-Narrative nicht darin, das Schreiben umfassender Geschichtswerke gänzlich zu verwerfen, sondern bessere zu schreiben. Ohne eine langfristige Perspektive werden wichtige Phänomene und wiederkehrende Muster eher übersehen, so wie man beim Betrachten eines Mosaiks durch ein starkes Vergrößerungsglas zwar immer mehr Details erfasst, was aber auf Kosten wichtiger Dimensionen des Gesamtbildes geschieht.
Ich würde sagen, dass dies in besonderem Maße auf die Geschichte des Christentums zutrifft, und zwar wegen eines grundlegenden Merkmals der Quellenbasis, auf der sie zu erstellen ist. Da das Christentum der Inbegriff einer Buchreligion ist, gab es schon immer Christen, die schreiben konnten. Historiker, die sich mit der Entwicklung des Christentums befassen, selbst mit der spätrömischen und frühmittelalterlichen Epoche, sind mit einer außergewöhnlichen Bandbreite an Quellen gesegnet, die ihnen oft viel mehr zur Verfügung stellen als für jeden anderen Aspekt der europäischen Geschichte in denselben Zeiträumen. Der Umfang des Materials variiert von einem Zeitpunkt zum anderen, aber es finden sich regelmäßig nicht nur ausführlich dokumentierte Situationen, sondern sogar vollständig erkennbare Personen. Die überwiegende Mehrheit dieser Quellen wurde allerdings von aufrichtig gläubigen Christen verfasst. Zahlreiche vergleichende soziologische und anthropologische Studien zum Thema Religion haben jedoch gezeigt – und der jüngste Trend zur Entchristlichung der modernen europäischen Bevölkerung bestätigt dies –, dass die wirklich gläubigen Christen immer nur eine Minderheit der Gesamtbevölkerung waren. Auch das muss in die Darstellung der Entstehung des Christentums mit einbezogen werden. Ideologie und überzeugter Glaube haben zwar zweifellos eine Rolle gespielt, aber es ist wichtig, sehr genau darüber nachzudenken, inwieweit die dokumentierten Beweggründe gläubiger Christen auf ganze Bevölkerungsgruppen übertragen werden können.
Generell hat diese inhärente Voreingenommenheit in den Quellen die Tendenz, die kulturellen Erklärungen für den Erfolg des Christentums zu verstärken und die Attraktivität und Überzeugungskraft seiner religiösen Botschaften zu unterstreichen. Nimmt man jedoch Abstand von den überlieferten Berichten engagierter Christen, so wird schnell deutlich, dass der Entstehung des europäischen Christentums auch zahlreiche Arten von Zwang zugrunde lagen und dass folglich sowohl das öffentliche Leben als auch die gesellschaftlichen und rechtlichen Machtverhältnisse für die Entstehungsgeschichte des Christentums von großer Bedeutung sind. In diesem Buch wird daher argumentiert, dass wir neu über die Beziehung zwischen jenen Bereichen nachdenken müssen, die in der Regel als getrennte Aspekte der politischen, sozialen und kulturellen Geschichte in einer europäischen Vergangenheit betrachtet werden, in der staatliche Strukturen und dominante soziopolitische Eliten sich häufig öffentlich für die Förderung und Aufrechterhaltung bestimmter religiöser Positionen einsetzten. Alles in allem ist die Fähigkeit des mittelalterlichen Christentums, bei der großen Mehrheit der europäischen Bevölkerung eine einheitliche religiöse Kultur zu schaffen, ein außergewöhnliches historisches Phänomen, das mit Sicherheit von einer ganzen Reihe von Faktoren abhing, die über die sich herausbildenden kulturellen Eigenheiten der Religion selbst hinausgingen.
Die folgende Studie ist in drei Teile gegliedert. Jeder Teil ist einer identifizierbaren Epoche tiefgreifender revolutionärer Veränderungen gewidmet, die dazu beitrugen, eine kleine Sekte aus isolierten, intensiv ihrem Glauben verpflichteten und vorwiegend städtischen Gemeinden in eine religiöse Massenbewegung zu verwandeln, die zentral von Rom aus gesteuert wurde und die in der Lage war, eine Reihe erforderlicher religiöser Überzeugungen und Praktiken zu definieren und zu vermitteln, die auf alle wesentlichen Elemente der Bevölkerung des mittelalterlichen Europa zugeschnitten waren. Der erste Teil konzentriert sich auf die spätrömische Welt, in welcher der christliche Glaube nach der Bekehrung Konstantins die klassische Philosophie und die kulturellen Zwangsmechanismen des kaiserlichen Staates nutzte, um zu einem theologisch kohärenten, institutionell wirksamen Phänomen zu werden, das fähig war, das klassische Heidentum (manchmal buchstäblich) zu zerschlagen und in diesem Prozess zum ersten Mal Massen von Konvertiten zu gewinnen. Dieser Prozess, der oft als Christianisierung des römischen Imperiums dargestellt wird, müsste eigentlich zutreffender als Romanisierung des Christentums bezeichnet werden: ein Prozess, in dem sich die Religion im 4. und 5. Jahrhundert zu einem Zweig des römischen Staates entwickelte. Wie im zweiten Teil erläutert wird, stürzte das Verschwinden dieses Imperiums das entstehende Christentum zwangsläufig in eine Krise. Das offizielle kaiserliche nizänische(2) Christentum war einerseits in seinen ehemaligen westlichen Provinzen sehr viel stärker davon bedroht, durch eine alternative Definition des Glaubens abgelöst zu werden, als dies allgemein anerkannt ist; und andererseits waren sowohl der institutionelle als auch der erzieherische Rahmen der Kirche von den parallelen Strukturen des Imperiums abhängig geworden: Als letztere verschwanden, brachen die beiden ersteren zusammen. Infolgedessen wurden kriegerische Werte und breitere kulturelle Muster, in denen lokale Gemeinschaften relativ frei waren, Elemente des eindringenden Christentums und ihres eigenen bestehenden Glaubens zu vermischen, schnell charakteristisch für das Christentum des frühen Mittelalters, insbesondere unter den verstreuten Massen der europäischen Bauernschaft. Eine relevante zusätzliche Perspektive auf die Entwicklungen in der westlichen Hälfte des alten römischen Imperiums bieten die Ereignisse im Süden und Osten. Hier ist es wichtig, das mittel- bis längerfristige Schicksal der christlichen Bevölkerung in den Provinzen des östlichen Imperiums, die gleichzeitig vom Aufstieg der islamischen Kalifate verschlungen wurden, näher zu betrachten.
Diese neuen Muster des nachrömischen europäischen Christentums begannen sich dann erneut zu verändern, wie im dritten Teil untersucht wird, als die karolingischen(1) und ottonischen(1) Kaiser zwischen 800 und dem Ende des Jahrtausends für zunächst zwei Jahrhunderte einer kohärenteren religiösen Führung sorgten. In diesem zweiten Zeitalter des christlichen Imperiums verbreitete sich die Religion zum ersten Mal unter kaiserlicher Schirmherrschaft weit über die Grenzen des alten römischen Imperiums hinaus und eroberte dabei sehr viel größere Teile der europäischen Landschaft. Ebenso wichtig ist, dass Karl der Große(1) und die Gelehrten an seinem Hof ein neues Muster für die Institutionalisierung des christlichen Bildungswesens festlegten, das Westeuropa – zum ersten Mal wieder – zum intellektuellen Kraftzentrum einer sich rasch wandelnden Christenheit machte. Ab der Mitte des 11. Jahrhunderts trug dann eine Reihe weiterer außerordentlicher Veränderungen dazu bei, das mittelalterliche Christentum in seiner voll entwickelten Form hervorzubringen. Gewisse dem Römischen Recht entlehnte Techniken, verbunden mit spektakulären Rechtsfälschungen, ermöglichten es dem Papsttum, sich in eine Institution zu verwandeln, die in der Lage war, praktisch über ganz Europa eine wirksame religiöse Autorität auszuüben. Eine Abfolge von Päpsten nutzte dann diese Autorität, um neue Muster christlicher Frömmigkeit sowohl für den Klerus als auch für die verschiedenen Laiengruppen der europäischen Christenheit zu definieren und durchzusetzen, was schließlich die Grundzüge des vorreformatorischen mittelalterlichen Christentums hervorbrachte, von denen viele bis heute in der römisch-katholischen Kirche erhalten geblieben sind.
In meinem Bestreben, diesem außergewöhnlichen historischen Prozess gerecht zu werden, war ich mir meiner zahlreichen Unzulänglichkeiten stets bewusst. Die größte davon ist möglicherweise die Tatsache, dass ich selbst kein gläubiger Christ bin. Ich gehe immer noch gerne (gelegentlich) in die Kirche und finde tiefe Inspiration in einigen christlichen Lehren – vor allem in der Osterbotschaft, dass man selbst inmitten tiefster Verzweiflung oft neue Hoffnung finden kann. Abgesehen davon könnte ich mich lediglich als einen ausgesprochen mangelhaften Anglikaner bezeichnen (ich vermeide den Begriff Agnostiker, denn ich habe aus der Erfahrung meines Großvaters gelernt). Aber die richtige Antwort auf die alte (von älteren Prüfern der allgemeinen Geschichte geliebte) Frage, ob die Geschichte der Religion am besten von Gläubigen oder von Nichtgläubigen geschrieben wird, war schon immer ein entschiedenes »sowohl als auch«. Und da es mir darum geht, zu verstehen, wie die außergewöhnliche religiöse Struktur des mittelalterlichen Christentums dazu kam, weite Teile der europäischen Bevölkerung zu umfassen, die dem Glauben weltanschaulich offenkundig nicht in vollem Umfang verpflichtet waren (ebenso wie viele, die es durchaus waren), könnte mein Mangel an persönlichem Glauben sogar ein Vorteil sein. In dieser Frage, wie auch in der Frage des Erfolgs oder Misserfolgs dieses Unternehmens insgesamt, kann das abschließende Urteil natürlich bei keinem anderen als beim Leser liegen.
Erster Teil
Die Romanisierung des Christentums
1
»Durch dieses siege …«
Zu Beginn des zweiten Jahrzehnts des 4. Jahrhunderts n. Chr. war der römische Kaiser Konstantin(6) tief in sein ganz persönliches Game of Thrones verwickelt. In der vorangegangenen politischen Generation war die kaiserliche Macht zwischen vier Generälen aufgeteilt worden, zwei in der westlichen Hälfte des Reiches und zwei im Osten. Diokletian(1) hatte 285 die Alleinherrschaft übernommen, sich 293 aber an die Spitze eines kaiserlichen Kollegiums gestellt: die Tetrarchie(1) (»Herrschaft der Vier«), bestehend aus zwei älteren Augusti (ihm selbst und Maximian(1)) sowie zwei Caesaren (Constantius Chlorus(1) und Galerius(1)). Im Jahr 305 traten die beiden Augusti zurück, die bisherigen Caesaren stiegen zu deren Rang auf, und zwei neue jüngere Kollegen (Severus im Westen, Maximinus(1) im Osten) wurden ernannt. Diese Regelung sollte die Übergabe der kaiserlichen Macht besser strukturieren als die dynastische Erbfolge, führte aber schnell zu zahlreichen Bürgerkriegen. Constantius Chlorus starb im Jahr nach seiner Ernennung, woraufhin sich sein Sohn Konstantin anstelle seines Vaters zum Augustus des Westens erklärte. Maximians Sohn Maxentius(1) warf ebenfalls seinen Hut in den kaiserlichen Ring, und um die Verwirrung noch zu vergrößern, kam Maximian selbst aus dem Ruhestand zurück. Im Jahr 312 waren Severus(1) und Maximian ausgeschaltet, und der Kampf um die Macht im Westen lief auf ein direktes Duell zwischen Konstantin, der Britannien, Gallien und Spanien kontrollierte, und Maxentius, dem Herrscher über Italien und Nordafrika, hinaus. So groß das westliche Reich auch sein mochte – groß genug für beide war es nicht. Im Laufe des Sommers versammelte Konstantin seine Armeen und drängte in Hannibal-Manier über die Alpen. Und dann griff Gott ein. Was nun geschah, löste die erste von drei gewaltigen Revolutionen aus, die einen kleinen, nahöstlichen Mysterienkult in die dominierende religiöse Struktur der europäischen Landmasse verwandeln sollte, von wo aus er sich dann im Zeitalter des europäischen Imperialismus weltweit ausbreitete.
Die Geschichte wurde kurz nach dem Tod des Kaisers von Konstantins(7) Biographen Eusebios(1)(1) erzählt, dem Bischof von Caesarea, der sie vom Kaiser selbst gehört hatte:
Um die Zeit der Mittagssonne, als sich der Tag gerade zum Nachmittag zu neigen begann, sah er [Konstantin(8)], so sagte er, mit eigenen Augen am Himmel über der Sonne ein kreuzförmiges Zeichen aus Licht, verbunden war damit eine Schrift, die besagte: »Durch dieses siege«. Das Erstaunen über den Anblick ergriff ihn und die ganze Truppe von Soldaten, die ihn damals auf einem Feldzug begleitete, den er irgendwo durchführte, und die Zeuge des Wunders wurden. Er sagte, er habe sich gefragt, was die Erscheinung bedeuten könne; und dann, während er lange nachdachte und überlegte, brach die Nacht an. Daraufhin erschien ihm im Schlaf der Christus Gottes mit dem Zeichen, das am Himmel erschienen war, und forderte ihn auf, sich ein Abbild des Zeichens zu machen und es zum Schutz gegen die Angriffe des Feindes zu verwenden.
Das Zeichen war das Chi-Rho(1)-Labarum, das der Kaiser auf seinen Feldzeichen anbrachte, und am 28. Oktober 312 errang Konstantin(9) in der Schlacht an der Milvischen Brücke(1) am Stadtrand von Rom einen überwältigenden Sieg über Maxentius(2). Der triumphierende und dankbare Konstantin revanchierte sich mit reichen Geschenken an die christlichen Gemeinden der Hauptstadt und verwandelte die Kaserne des Elite-Kavalleriekorps von Maxentius in eine riesige Kirche: die Lateranbasilika(1), den ersten Sitz des mittelalterlichen Papsttums.[1]
Aber das war erst der Anfang. Der Sieg im Westen war der Vorbote noch größeren Ruhmes. Ende 312 hatte ein paralleler Kampf um die posttetrarchische kaiserliche Macht in der Osthälfte des Reiches seinerseits einen Sieger hervorgebracht: Licinius(1) (zunächst ernannt von Galerius(2), einem der ursprünglichen Tetrarchen). Die beiden regierenden Augusti – Konstantin(10) im Westen und Licinius im Osten – erklärten spontan ihre unsterbliche Liebe zueinander, Bündnistreue und ewige Zusammenarbeit, aber letztlich konnte es immer nur einen geben. Es dauerte über ein Jahrzehnt, aber nachdem der Konflikt über mehrere Runden gegangen war, schaltete Konstantin seinen östlichen Rivalen im Jahr 324 endgültig aus. Dank der göttlichen Vision, die ihm zuteil geworden war, veränderte der Christ Konstantin das Gesicht der kaiserlichen Politik und vereinigte die gesamte römische Welt zum ersten Mal seit der Mitte des 3. Jahrhunderts wieder unter einem einzigen, unangefochtenen Kaiser.[2]
Eusebios’ Schilderung(2) des entscheidenden visionären Erlebnisses ist unzählige Male wiederholt und – ganz vorzüglich (Abb. 1) – ins Bild gebracht worden, doch sie ist äußerst problematisch. Und ich meine nicht nur die Tatsache, dass Konstantin(11) eine Vision am Himmel gesehen hat. Ich selbst habe nie eine Vision gehabt, aber viele Menschen in der gesamten Menschheitsgeschichte haben Visionen gehabt, und zumindest die subjektive »Realität« übernatürlicher religiöser Erfahrungen – wie auch immer man sie erklären möchte – ist nicht etwas, das man a priori ausschließen sollte. Die Geschichte Konstantins wirft aber daneben auch ganz profane Probleme auf, denn der Kaiser scheint mehr oder weniger zur gleichen Zeit verschiedene übernatürliche Erfahrungen gemacht zu haben, die nicht alle christlich waren, und er hat verschiedenen Personen verschiedene Dinge darüber erzählt. Abgesehen von der kombinierten Vision- / Traum-Geschichte, die Eusebios wiedergibt, sind drei weitere Varianten überliefert. Etwa zwanzig Jahre vor Eusebios(2) schrieb der Rhetor Lactantius(1) – er war ein angesehener Hochschullehrer der lateinischen Sprache und Literatur, also der Fächer, in denen die Sprösslinge der Elite der westlichen Reichshälfte üblicherweise ausgebildet wurden (ihre östlichen Altersgenossen erhielten eine identische Ausbildung im Griechischen) –, der den Kaiser kannte und in den frühen 310er Jahren Hauslehrer seines ältesten Sohnes Crispus(1) war, dass Konstantin am Vorabend der Schlacht an der Milvischen Brücke(2) einen Traum hatte, in dem ihm gesagt wurde, er solle »das himmlische Zeichen Gottes« auf die Schilde seiner Soldaten zeichnen lassen.[3]
Der Zeitpunkt des göttlichen Eingreifens ist im Bericht des Lactantius(2) ein anderer, und es gibt keine Vision am Himmel. Unser zweiter Zeuge ist ein weiterer Rhetor, diesmal aus Gallien(1), der 310, zwei Jahre vor der Niederlage des Maxentius(3), eine feierliche Rede vor Konstantin(12) und seinem versammelten Hofstaat hielt. In einer Passage, die sicher zuvor vom Kaiser genehmigt worden war, beschrieb dieser Redner eine weitere himmlische Vision. Als er von der Hauptstraße abbog, um »den schönsten Tempel der Welt« zu besuchen, »hast du, Konstantin, so glaube ich, deinen Apollo(1) gesehen, in Begleitung der Victoria(1), die dir Lorbeerkränze überreichte, ein Omen für dreißig Jahre [des Lebens oder Herrschaft]«.[4]
Hier haben wir ebenfalls eine Vision, allerdings von einem anderen Gott (Apollo(2) als Sonnengott); und keinen Traum. Im Jahr 321 schließlich bezog sich ein dritter Rhetor in einer anderen offiziellen – und daher kaiserlich gebilligten – Rede auf den Sieg Konstantins(13) über Maxentius(4). In dieser Rede wird weder eine göttliche Heimsuchung noch eine Art Kreuz am Himmel erwähnt. Stattdessen sollen Konstantins Truppen inmitten der Schlacht durch die Vision eines himmlischen Heeres gestärkt worden sein, das von Constantius(2), dem vergöttlichten Vater des Kaisers, angeführt wurde und dem Sohn zu Hilfe kam.[5]
Es hat viele Versuche gegeben, Konstantins(14) mehrfach berichtete religiöse Erfahrungen zu rationalisieren. Der einflussreichste unter den neueren Versuchen war derjenige von Peter Weiß(1), der 1993 erklärte, dass sich die 310 berichteten Visionen von Apollo(3) und das Kreuz am Himmel des Eusebios(3) auf ein und dasselbe Ereignis bezogen, das unterschiedlich interpretiert wurde. Weiß argumentierte, angesichts der Tatsache, dass Apollo zu diesem Zeitpunkt überwiegend als Sonnengott dargestellt wurde, sei das, was Konstantin tatsächlich sah, ein Halo der Sonne gewesen, der eine Art Kreuzform annehmen kann, und der Kaiser habe dieses Naturphänomen später als eine Botschaft des christlichen Gottes verstanden. Das ist natürlich eine mögliche Herangehensweise, und der Traum des Lactantius(3) könnte dann mit dem Bericht des Eusebios in Einklang gebracht werden – vorausgesetzt, man nimmt eine Verzögerung von zwei Jahren zwischen der ersten Vision und dem erklärenden Traum an, während Eusebios(4) eindeutig davon ausging, dass der Traum in der folgenden Nacht stattfand. Meines Erachtens müssen alle diese Berichte jedoch mit sehr viel mehr Misstrauen betrachtet werden.
Es war üblich, dass antike Herrscher, die vorgaben, von einer göttlichen Macht ernannt worden zu sein (wie es alle römischen Kaiser und insbesondere Konstantin(15) zu tun pflegten), geeignete Omen als Bestätigung ihrer besonderen Regierungsbestimmung anführten. Der spätere Kaiser Claudius(1) hatte Berichten zufolge das – zweifellos verstörende – Erlebnis, dass ein Adler auf seiner Schulter landete, als er zum ersten Mal als Konsul das Forum betrat; und eine mysteriöse Kraft pflegte jeden zu vertreiben, der versuchte, im Kinderzimmer des ersten römischen Kaisers Augustus(1) zu schlafen. Kein Historiker, der etwas auf sich hält (und nicht einmal Konstantin), würde im Traum daran denken, diese früheren Geschichten wörtlich zu nehmen, und sowohl die Zweckmäßigkeit als auch die Vielfalt der Geschichten, die der erste christliche Kaiser über seine persönliche Begegnung mit dem Gott des Neuen Testaments erzählte, deuten darauf hin, dass wir auch hier ein Stück weit von Tatsachenberichten entfernt sind.[6] Das überlieferte Bild eines visionären Konstantin, der wie Paulus(1) auf der Straße nach Damaskus(1) durch eine direkte persönliche Erfahrung des Allmächtigen zu einer vollständigen und plötzlichen Bekehrung zum Christentum gezwungen wurde, wird noch problematischer, wenn man es mit der Art und Weise vergleicht, wie der Kaiser seine sich herausbildende religiöse Zugehörigkeit im Laufe seiner langen und brutal erfolgreichen Herrschaft der gesamten Bevölkerung seines Reichs präsentierte.
Die offizielle religiöse Selbstdarstellung des konstantinischen Regimes durchlief vier verschiedene Phasen. In seinen ersten Jahren bezeichnete sich Konstantin(16) als treuer Anhänger der religiösen Ideologien des kaiserlichen Kollegiums Diokletians(2), jener Tetrarchie(2), der sein Vater angehört hatte. Zwar behaupteten alle römischen Kaiser, von einer göttlichen Macht ernannt und unterstützt zu werden, aber die betreffende Gottheit konnte wechseln oder zumindest in verschiedenen Gestalten auftreten. Viele Kaiser des 3. Jahrhunderts hatten ihren göttlichen Beistand als vom Sonnengott (griechisch Helios, lateinisch Sol oder spezifischer Apollo(4)) kommend dargestellt, wobei sie das Bild der Sonne als Manifestation des höchsten göttlichen Prinzips verstanden, welches das gesamte Universum und all seine dazwischen liegenden geistigen Mächte im Sein erhält. Die Tetrarchen kehrten jedoch zu einer eher traditionell römischen religiösen Symbolik zurück und stellten Jupiter(1) und Hercules(1) als die göttlichen Stützen ihrer – weitgehend siegreichen – Herrschaft dar. Diokletian und Galerius(3) fügten ihrer Liste von Beinamen den Namen »Jovius(1)« – geschützt von Jupiter – hinzu, während Maximian(2) und Constantius Chlorus(3) den Namen »Herculius(1)« – geschützt von Hercules(2) – annahmen. In seinen ersten Jahren an der Macht gab Konstantin Münzen heraus, die einfach die Zugehörigkeit seines Vaters wiederholten; er bezeichnete also auch sich selbst als »Herculius«.[7] Das änderte sich dann plötzlich im Jahr 310. Gerade als der gallische Rhetor Konstantins Vision von Apollo bekannt gab, brach der Kaiser mit den religiösen Ideologien der Tetrarchen. »Herculius« erschien auf seinen Münzen nicht mehr, stattdessen prangte dort nun sol invictus(1): »die unbesiegte Sonne«.[8]
Die dritte Phase begann im Jahr 312. In dieser Zeit verfasste Lactantius(4) seinen Bericht über den Traum des Kaisers vom christlichen Gott. Konstantin(17) begünstigte außerdem die christlichen Gemeinden in seinem Herrschaftsbereich, indem er Geld verteilte und einige umfangreiche Kirchenbauprogramme einleitete. In überlieferten Briefen an nordafrikanische Kirchenmänner (im heutigen Tunesien, und Algerien(1)) erklärte er ferner, dass er und sie dieselbe religiöse Zugehörigkeit teilten, während eine kleine Anzahl früher Inschriften und besonderer Münzmedaillons das Chi-Rho(2)-Monogramm trug.[9] Letztere waren jedoch sehr selten und wurden bei Weitem von Münztypen übertroffen, die weiterhin sol invictus(2) feierten. Diese bewusste Vermeidung des offensichtlich Christlichen in den meisten öffentlichen Kontexten zeigt sich auch in dem Triumphbogen, den Konstantin in Rom(1) zur Feier seines Sieges über Maxentius(5) errichten ließ (er steht bis heute in der Nähe des Kolosseums). Er besticht durch seine sehr traditionellen Darstellungen des Kaisers und der göttlichen Macht, die ihm den Sieg beschert hatte, und enthält nicht den geringsten Hinweis auf irgendeine christliche Ausrichtung. Die gleiche Zweideutigkeit zeigt sich auch in einem neuen Gesetz, das Konstantin in derselben Phase erließ und das den Sonntag zu einem Ruhetag erklärte. Das klingt wie ein christlicher Schritt, um den Wochentag zu feiern, an dem Christus von den Toten auferstanden ist, aber das Gesetz bezeichnet ihn beflissentlich nur als »Tag der Sonne«. Auch die ersten offiziellen Redner, die den großen Sieg des Kaisers über Maxentius in der Öffentlichkeit feierten, hielten an der Zweideutigkeit fest und sprachen nur von der Unterstützung, die Konstantin von einer nicht näher bezeichneten »Höchsten Gottheit(1)« erhalten habe. Dieser Begriff war im Laufe des 3. Jahrhunderts in einigen nicht-christlichen Kreisen allmählich als eine alternative Bezeichnung für dasselbe zugrunde liegende göttliche Prinzip wie sol invictus in Gebrauch gekommen.[10]
Erst ab 324, in seiner vierten und letzten Phase, verstand sich das Regime Konstantins(18) als unzweideutig christlich. Die sol invictus(3)-Münzen wurden zwar beibehalten, aber auch das christliche Kreuz wurde zu einem häufigen Motiv auf seinen Münzen, und zu diesem Zeitpunkt hatten die Christen auch bereits selbst eine ikonographische Gleichsetzung zwischen Christus und dem Sonnengott vorgenommen, indem sie die Sonne, wie die heidnischen Kaiser des 3. Jahrhunderts, als Symbol der höchsten göttlichen Macht verstanden: in diesem Fall des Gottes des Alten und Neuen Testaments. In einer ganzen Reihe öffentlicher Erklärungen teilte Konstantin sein Christentum nun jedem mit, der es hören wollte. Anlässlich der Feierlichkeiten zum zwanzigsten Jahrestag seiner Thronbesteigung berief er ein Gipfeltreffen von Vertretern aller damals bestehenden christlichen Gemeinschaften innerhalb und außerhalb des Reiches ein, das 325, ein Jahr nach seinem endgültigen Sieg über Licinius(2), in Nicaea(2) (Iznik in der heutigen Türkei) stattfand. Dort bestätigte Konstantin öffentlich die Stärke seiner christlichen Loyalität, nicht nur durch die Aufmerksamkeit, die er den vielen Bischöfen schenkte, sondern auch dadurch, dass er an einigen der Sitzungen persönlich teilnahm.[11] Aber wenn es Mitte der 320er Jahre nicht den geringsten Zweifel am Christentum des ehemaligen Tetrarchen und Sonnenmonotheisten geben kann, wie genau können wir dann den persönlichen religiösen Weg verstehen, der ihn zu diesem Punkt gebracht hat – angesichts all der verschiedenen Dinge, die er in den dazwischen liegenden zwanzig Jahren seit seiner Machtergreifung dazu geäußert hatte?
Der Weg nach Nicaea
Im Laufe der Jahre sind viele unterschiedliche psychologische Deutungen der sich herausbildenden religiösen Bindungen des Kaisers erwogen worden. Sie begannen in der Antike. Eine feindselige heidnische Tradition behauptete, Konstantin(19) habe sich dem Christentum zugewandt, weil es die einzige Religion war, die ihm die Hinrichtung seines ältesten Sohnes Crispus(2) und seiner zweiten Ehefrau Fausta(1) verzeihen würde. Diese erfreulich boshafte Verunglimpfung von Konstantins Motiven knüpfte auch an die seit Langem bestehende heidnische Kritik an, dass die Bereitschaft des Christentums, Sünden zu vergeben, dem menschlichen Handeln die notwendige moralische Stringenz raube. Aber der Zeitpunkt ist falsch gewählt. Das Christentum des Kaisers hatte sich bereits zwei Jahre vor dem Tod von Crispus und Fausta im Jahr 326 unmissverständlich manifestiert.[12] Modernere Versuche reichten von herablassend – Konstantin war ein »ungehobelter Soldat«, der nicht verstand, dass es nicht anging, sich gleichzeitig zum Christentum und zum nicht-christlichen solaren Monotheismus zu bekennen – bis hin zu anspruchsvolleren Überlegungen. Einige haben argumentiert, dass er in Wirklichkeit bis 320 ein nicht-christlicher solarer Monotheist war, obwohl neuere Entdeckungen früher Verwendungen des Chi-Rho(3)-Symbols zeigen, dass dies nicht zutrifft; andere, dass wie bei einigen modernen religiösen Konvertiten das, was damals ein langsamer Bekehrungsprozess war, später vom Kaiser als ein plötzliches »Ereignis« verstanden wurde.[13] Jeder dieser Ansätze mag in sich stimmig sein, aber sie alle gehen von der Annahme aus, dass die persönlichen religiösen Überzeugungen des Kaisers mit der sich entwickelnden öffentlichen religiösen Haltung seines Regimes übereinstimmten. Meines Erachtens ist diese Annahme jedoch methodisch unhaltbar, da sie ein wichtiges Teil des konstantinischen Puzzles außer Acht lässt. Der Beginn jeder neuen religiösen Phase des konstantinischen Regimes fiel mit einem der großen militärischen Erfolge des Kaisers zusammen. Wenn wir diese Tatsache und ihre tiefere Bedeutung einmal wirklich in den Blick genommen haben, dann müssen wir alle bisherigen Darstellungen der persönlichen Religionsgeschichte Konstantins umschreiben.
Konstantins(20) Wechsel zum solaren Monotheismus im Jahr 310 erfolgte unmittelbar nachdem er einen Versuch des ehemaligen Tetrarchenkaisers Maximian(3), wieder an die Macht zu kommen, vereitelt hatte. Maximian, der fünf Jahre zuvor von Diokletian(3) in den Ruhestand gezwungen worden war, hatte bereits zwei gescheiterte Versuche unternommen, seinen Titel wiederzuerlangen. Nun, da seine verbliebenen Truppen von Konstantin zerschlagen worden waren, wurde Maximian »ermutigt«, sich das Leben zu nehmen, eine Anregung, die er angesichts der Aussichtslosigkeit der Situation auch prompt in die Tat umsetzte.
Die zweite Phase der religiösen Selbstdarstellung Konstantins(21) – das Ablegen des alten Beinamens Maximians(4) (und seines Vaters(4)) »Herculius(2)« zugunsten eines unspezifischen nicht-christlichen solaren Monotheismus – begann unmittelbar nach Maximians Tod. Das Muster wiederholt sich dann noch zweimal. Die dritte Phase – in der er sich gegenüber ausgesuchten Mitchristen zum Christentum bekannte, ansonsten aber einen unspezifischen solaren Monotheismus vertrat – wurde gleich nach dem Sieg über Maxentius(6) an der Milvischen Brücke(3) eingeleitet. Und ebenso die vierte und letzte Phase: Unmittelbar nach der endgültigen Vernichtung des Licinius(3) im Jahr 324 begann Konstantin, sich gegenüber allen und jedem und in allen Kontexten zu seinem eindeutigen Christentum zu bekennen.
Es ist wichtig, die Bedeutung dieses beständigen Zusammenhangs zwischen den militärischen Siegen Konstantins(22) und den verschiedenen Phasen seiner religiösen Selbstdarstellung herauszustreichen. Sowohl praktisch als auch ideologisch spielte der militärische Sieg eine zentrale Rolle für das Funktionieren des Römischen Reiches. Die Reichspolitik beruhte nicht auf Wahlen. Potenzielle Kaiser wurden in der Regel von kleinen Gruppen von Verschwörern aus den oberen Rängen der Armee und/oder der Hofbürokratie vorgeschlagen. Sie mussten dann genügend militärischen Rückhalt sowie eine breitere Zustimmung unter den politisch bedeutenden landbesitzenden Klassen des Imperiums gewinnen – ein Beispiel dafür ist der verworrene und zeitweise gewaltsame Prozess, der von der Auflösung von Diokletians Tetrarchie(3) im Jahr 305 bis zur Wiedervereinigung des Reiches durch Konstantin im Jahr 324 führte. Auch die Anfechtung der Herrschaft eines amtierenden Kaisers und die Ablehnung dieser Herrschaft nahmen in der Regel die Form von Putschversuchen und Usurpationen an, wobei das endgültige Ergebnis wiederum meist auf dem Schlachtfeld entschieden wurde. Der Sieg über interne Gegner – wie Konstantin ihn nacheinander über Maximian(5), Maxentius(7) und Licinius(4) errang – war das römische Äquivalent zu einer Reihe von Wahlsiegen.
Allerdings stand in der römischen Welt ideologisch viel mehr auf dem Spiel. Der Sieg auf dem Schlachtfeld war die wichtigste Bestätigung für das Recht eines angehenden Kaisers auf die Regierungsgewalt – denn die römischen Kaiser verstanden sich nicht als weltliche Herrscher und wurden auch von anderen nicht als solche angesehen. Als vom Himmel auserwählte, vom Himmel unterstützte Monarchen sah man in ihnen den Auftrag der herrschenden Kräfte des Universums umgesetzt, das Römische Reich und die Zivilisation, die es schützte, zu verteidigen. Diese Zivilisation verstand sich als das ultimative Beispiel menschlicher Ordnung; eine Zivilisation, die in der Tat eine einzigartige Rolle im göttlichen Plan für die Menschheit spielte – und daher, so der Schluss dieser logischen Schleife, das anhaltende göttliche Interesse an denjenigen, die sie regierten. Aber es gab eine Ausstiegsklausel. Die Ideologie ließ die Möglichkeit zu, dass durch menschliches Versagen der falsche Mann auf dem Thron landete. Deshalb würde die Gottheit nur denjenigen Kandidaten wirklich unterstützen, der auch wirklich zur Herrschaft bestimmt war. Neben der rein praktischen Bedeutung für die Machtergreifung und den Machterhalt spielte der militärische Sieg also auch eine entscheidende ideologische Rolle: Er war das einzige Attribut eines tatsächlich legitimen römischen Herrschers. Was könnte die Unterstützung durch die höchste, allmächtige Gottheit in der Praxis bedeuten, wenn nicht die Fähigkeit, auf dem Schlachtfeld zu siegen?[14] Der Sieg, also der Zeitpunkt, da sich die unmittelbare, direkte göttliche Unterstützung in vollem Umfang offenbart hatte, war – als direkte Konsequenz – auch der Moment der ultimativen politischen und ideologischen Stärke in der römischen Welt. Die Tatsache, dass Konstantin(23) die bedeutenden Veränderungen seiner religiösen Zugehörigkeit erst nach jedem seiner großen Siege bekannt gab – in Momenten also, in denen er völlig unanfechtbar war –, bedeutet, dass er dies nur dann tat, wenn es politisch sicher war; dass folglich diese Momente des Wandels keinen zuverlässigen Hinweis auf die tatsächliche Entwicklung der inneren religiösen Überzeugungen des Kaisers geben können.
Man denke zum Beispiel an die erste Phase der Herrschaft Konstantins(24): Der neue Kaiser, der von der Armee seines Vaters an die Macht gebracht wurde, bezeichnete sich selbst als Herculius(3). Zu diesem Zeitpunkt war die genaue religiöse Zugehörigkeit eine äußerst heikle politische Frage. Die Tetrarchen hatten nicht nur auf eine ältere, nicht-christliche Symbolik zurückgegriffen und das monotheistische sol invictus(4) abgelehnt, das von den Kaisern des 3. Jahrhunderts bevorzugt worden war, sondern sie hatten außerdem die so genannte »Große Verfolgung« gegen ihre christlichen Untertanen eingeleitet. Diese begann im Februar 303 mit einem ersten Edikt zur Beschlagnahme christlichen Eigentums. Nachfolgende Edikte verbannten den christlichen Klerus (Edikt 2) und verlangten schließlich, dass die Christen unter Androhung des Todes den traditionellen Göttern opferten, zuerst der Klerus im November 303 und dann die breite Bevölkerung Anfang des nächsten Jahres (Edikte 3 und 4).[15] Alle diese Erlasse waren noch in Kraft, als Konstantin im Jahr 306 den Thron bestieg, was ihm – insbesondere in Anbetracht der instabilen politischen Lage – allen Grund gab, bei der öffentlichen Äußerung religiöser Ansichten äußerste Vorsicht walten zu lassen.
Wenn man in die ausgegrabenen Fundamente des Minster von York(1) hinabsteigt, das mehr oder weniger auf dem alten römischen Legionshauptquartier, dem Praetorium, erbaut wurde, steht man ganz in der Nähe jenes Ortes, an dem Konstantin(25) im Jahr 306 von der Armee seines Vaters zum Kaiser ernannt wurde. Zu diesem Zeitpunkt erhoben fünf weitere Möchtegern-Kaiser Anspruch auf die Macht im gesamten Reich: drei im Westen, wo neben Konstantin auch Maximian(6), Maxentius(8) und Severus(2) – der nach Diokletians(4) Rücktritt im Jahr 305 offiziell zum westlichen Caesar gewählt wurde – ihre Ansprüche geltend machten; der Osten war unterdessen zwischen Galerius(4) – dem alten tetrarchischen, nun zum Augustus aufgestiegenen Caesar – und seinem neu ernannten untergeordneten Caesar, Maximinus Daia(2), gespalten. In diesem Zusammenhang ist es nicht überraschend, dass Konstantin in religiöser Hinsicht die bestehenden tetrarchischen religiösen Normen aufgriff und sich für die nächsten vier Jahre Herculius(4) nannte. Mit allem anderen wäre er in einer Zeit, in der die Verbindung zur Tetrarchie(4) Diokletians das Kennzeichen politischer Legitimität blieb, wie ein weißer Rabe aus der Menge der Rivalen herausgestochen. Damit wäre er das offensichtliche Risiko eingegangen, dass einige oder alle anderen sich gegen ihn verbünden würden, da er ein bequemes erstes Ziel in dem sich zwangsläufig anschließenden Ausleseprozess darstellte.
In der Tat leistete Konstantin(26) 306/307 geschickte Vorarbeit, um vom älteren östlichen Augustus Galerius(5) die sofortige Anerkennung als Caesar zu erlangen: Er akzeptierte eine fiktive Degradierung von seinem ursprünglichen Anspruch auf den Rang seines Vaters als Augustus und verbündete sich dann mit Maxentius(9), um Severus(3) zu beseitigen. Als er Maximian(7) 310 erfolgreich aus dem Weg geräumt hatte, konnte Konstantin den Namen Herculius(5) getrost ablegen, da die Gefahr einer geeinten Opposition gebannt war. Seine neu entdeckte Verbundenheit mit sol invictus – die sich sowohl in Proklamationen als auch in der Münzprägung niederschlug – war Teil eines gezielten und umfassenderen Vorgehens, um seine politische Legitimität auf eine neue Grundlage zu stellen, welche die Bedeutung jeglicher Verbindungen zur vorangegangenen tetrarchischen Ära minimierte. In derselben Rede, in der verkündet wurde, dass Konstantin Apollo(5) gesehen habe, wurde aus heiterem Himmel auch erwähnt, er stamme von einem berühmten und äußerst erfolgreichen Kaiser aus dem 3. Jahrhundert ab, nämlich von Claudius Gothicus(1). Soweit wir wissen, stimmte das nicht – aber die Behauptung dieser fiktiven Abstammung ermöglichte es Konstantin, eine alternative, ganz und gar untetrarchische Rechtfertigung für seinen Kaisertitel vorzubringen (der große Claudius hatte seinen göttlichen Beschützer ebenfalls als die unbesiegte Sonne bezeichnet).[16] Vor diesem Hintergrund erscheint Konstantins ursprüngliche Übernahme der religiösen Ideologie der Tetrarchie(5) durch den Signalbegriff Herculius(6) von Anfang an als äußerst zweckmäßig. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die erste religiöse Phase seines Regimes oder ihre spätere Aufgabe im Jahr 310 zugunsten des solaren Monotheismus einen ernsthaften Umbruch in den persönlichen und internen religiösen Überzeugungen des Kaisers widerspiegelte.
Das gilt in gleichem Maße für die beiden darauf folgenden Änderungen der öffentlichen religiösen Haltung Konstantins(27), die er 312 und 324 vornahm. Beide erfolgten unter genau denselben Umständen, nach einem durchschlagenden militärischen Erfolg – über Maxentius(10) bzw. Licinius(5) –, der den perfekten Moment bot, um etwas potenziell Problematisches anzukündigen. Die Tatsache, dass Konstantin nur dann Änderungen in der Religionspolitik ankündigte, wenn es politisch opportun war, macht es sehr unwahrscheinlich, dass diese öffentlichen Erklärungen einen auch nur annähernd verlässlichen Hinweis auf die genaue Chronologie des internen religiösen Werdegangs des Kaisers geben (falls es überhaupt einen gab), und jeder Versuch, sie auf diese Weise zu nutzen, ist methodisch unzulänglich.
Diese sich durchziehende Korrelation zwischen Sieg und religiösem Bekenntnis im Laufe der Regierungszeit Konstantins(28) unterstreicht, dass die sich allmählich herausbildende christliche Religionszugehörigkeit des Kaisers zumindest teilweise – wenn nicht sogar vollständig – eine Geschichte seines Coming-out als Christ ist und nicht die einer religiösen »Bekehrung« à la Damaskus(2). Die Gunst, die er ab 312, nach der Niederlage des Maxentius(11), den Christen entgegenbrachte, und Briefe, in denen er die nordafrikanischen Christen als Glaubensbrüder bezeichnete, deuten stark darauf hin, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits ein überzeugter Christ war (ebenso wie die Traumgeschichte des Lactantius(5), die in die gleiche Zeit fällt).[17] Angesichts des bevorstehenden Kräftemessens mit Licinius(6) verhielt Konstantin sich jedoch in den meisten öffentlichen Zusammenhängen vorsichtig und neutral monotheistisch – vermutlich aus Furcht, eine zu offensichtliche christliche Ausrichtung könnte die Opposition in dem immer noch weitgehend heidnischen Reich zusammenschweißen. Hinter der letzten, eindeutig christlichen Phase seiner Herrschaft, die 324 begann, stand also keine wirkliche »Bekehrung« (im Sinne eines tiefgreifenden Glaubenswandels). Vielmehr war dies der Moment, in dem der Kaiser sich endlich sicher genug fühlte, um sich gegenüber dem ganzen Reich als Christ zu outen.
Dass Konstantins(29) gesamter religiöser Weg ein Coming-out und keine echte Bekehrung gewesen sein könnte, wird durch einige spezifische Belege und eine wichtige potenzielle Parallele in der nächsten politischen Generation untermauert – eine Parallele, die, soweit ich weiß, noch nie in die Diskussion über Konstantins religiöse Entwicklung eingebracht worden ist. Das ist allerdings dringend geboten.
Mitte der 350er Jahre lag die kaiserliche Macht in den Händen von Konstantins(30) einzigem überlebendem Sohn, dem Augustus Constantius(1) II. (337–361). Da er selbst keine Kinder hatte, beförderte Constantius – der die pro-christliche Politik seines Vaters erheblich gestärkt hatte – seinen Cousin Julian(2) in den Rang eines Caesars: Junior-Mitkaiser. Obwohl Julian christlich erzogen worden war, war er insgeheim zum Heidentum übergetreten: eine Konversion, die er später auf etwa 351 datierte. Er hielt die ganze Sache ein Jahrzehnt lang geheim, in dessen Mitte Constantius ihn zum Caesar ernannte (355). Nach seinem Amtsantritt nutzte Julian eine Reihe von Siegen, die seine Armeen zwischen 357 und 360 über die Barbaren in Gallien(2) errangen, um sich als unabhängiger Herrscher zu profilieren. Im Winter 360/361 lehnte er sich schließlich gegen die Oberherrschaft von Constantius auf und strebte die Anerkennung als mindestens gleichwertiger Augustus an. Dennoch hielt er sein Heidentum weiterhin geheim und besuchte am Dreikönigsfest 361 die Messe. Erst als die Würfel wirklich gefallen waren und Constantius’(2) Unnachgiebigkeit jede Chance auf ein Verhandlungsergebnis zunichte machte, bekannte sich Julian zu seinem Heidentum. Dies tat er im folgenden Sommer in einer Reihe von Briefen, in denen er versuchte, sein Verhalten zu rechtfertigen und im ganzen Reich nicht-christliche Unterstützung zu mobilisieren.[18]
Die Parallele zu Konstantins(31) eigener, sorgfältig inszenierter religiöser Entwicklung – wenn auch in umgekehrter Richtung – ist frappierend. In einer angespannten politischen Situation konnte eine subversive religiöse Zugehörigkeit erst dann offenbart werden, wenn das gefahrlos möglich war – oder wenn es nichts mehr zu verlieren gab.
Wann genau Konstantin(32) Christ wurde – oder anders gesagt, wann genau die Coming-out-Geschichte die Bekehrungsgeschichte ablöst –, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, aber es gibt einige Hinweise. Konstantins Mutter, Kaiserin Helena(1), zeigte nach der Niederlage des Licinius(7) schnell ein auffallendes Maß an christlicher Frömmigkeit, und ihre breit beworbene Reise ins Heilige Land im Jahr 326 wurde bald (wenn auch fälschlicherweise) mit der Entdeckung des Wahren Kreuzes in Verbindung gebracht. Wir wissen nicht genau, wann Helena Christin wurde, aber ihre offensichtliche Frömmigkeit in den 320er Jahren, sobald es politisch sicher war, sie zu zeigen, macht es zumindest möglich, dass sie schon lange Christin war und dass Konstantin daher sein Christentum bereits auf dem Schoß seiner Mutter empfangen hatte. Eusebios(5)