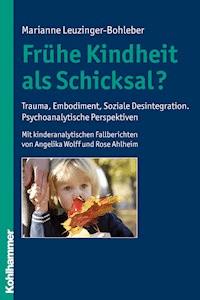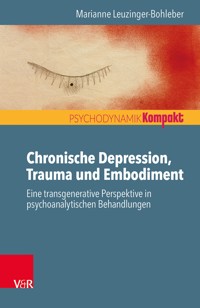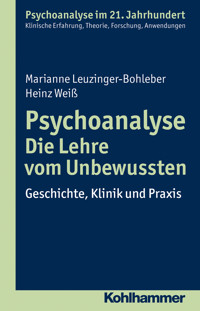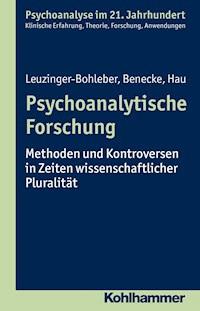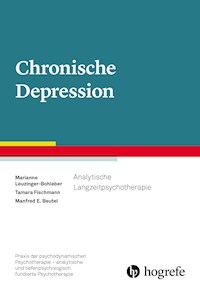
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
An einer chronischen Depression erkrankte Patientinnen und Patienten gelten oft als schwer behandelbar. Häufig hängt die chronische Depression mit schweren traumatischen Erfahrungen zusammen. Das in diesem Band vorgestellte Behandlungsmanual berücksichtigt diese Gegebenheit und legt den Fokus auf traumatisierte, chronisch depressive Patientinnen und Patienten. Der Band beschreibt einleitend das Störungsbild und das diagnostische Vorgehen und erläutert die Grundannahmen des psychoanalytischen Verständnisses von Depression. Anschließend geht es um grundsätzlichere behandlungstechnische Aufgaben sowie um spezifische Herausforderungen in psychoanalytischen Langzeitbehandlungen mit chronisch depressiven, früh traumatisierten Patientinnen und Patienten, wie z.B. Suizidalität, Aggression und Schuld. Die ausgeführten therapeutischen Grundhaltungen und Behandlungsprinzipien werden jeweils anhand von konkreten Fallbeispielen veranschaulicht. Die Wirksamkeit des vorliegenden Manuals konnte in einer Studie zu Langzeittherapien bei chronischer Depression (sog. LAC-Depressionsstudie) gezeigt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Marianne Leuzinger-Bohleber
Tamara Fischmann
Manfred E. Beutel
Chronische Depression
Analytische Langzeitpsychotherapie
unter Mitarbeit von Gilles Ambresin, Nicolas de Coulon, Jean Nicolas Despland, Cheryl Goodrich und Bernard Reith
.
gewidmet Hugo Bleichmar
Praxis der psychodynamischen Psychotherapie – analytische und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Band 12
Chronische Depression
Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber, Prof. Dr. Tamara Fischmann und Prof. Dr. Manfred E. Beutel
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Manfred E. Beutel, Prof. Dr. Stephan Doering, Prof. Dr. Falk Leichsenring, Prof. Dr. Günter Reich
Prof. Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber. Psychoanalytikerin. 1988–2015 Professorin für Psychoanalyse an der Universität Kassel. 2001–2016 Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt am Main. Seit 2016 Senior Scientist an der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Prof. Dr. Tamara Fischmann. Psychoanalytikerin. Seit 1995 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sigmund-Freud-Institut Frankfurt. Seit 2016 Professorin für Klinische Psychologie an der International Psychoanalytic University Berlin.
Prof. Dr. Manfred E. Beutel. Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalytiker. Seit 2004 Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3142-0; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3142-1)
ISBN 978-3-8017-3142-7
https://doi.org/10.1026/03142-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Einführung
1.1 Chronische Depression und Trauma: Signaturen unserer Zeit?
1.2 Die LAC-Studie: Konzeptualisierungen von chronischer Depression und empirische Untersuchung von Langzeitbehandlungen
1.3 Chancen und Herausforderungen von Psychoanalysen im Rahmen von empirischen Studien
1.4 Das LAC-Manual: Anmerkungen zu einem Behandlungsmanual für Psychoanalysen und psychoanalytische Langzeitbehandlungen
2 Beschreibung der Störung
2.1 Definition
2.1.1 Depressive Episode
2.1.2 Anhaltende depressive Störung (Dysthymie)
2.2 Epidemiologische Daten
2.3 Verlauf und Prognose
2.4 Differenzialdiagnose
2.5 Komorbidität
2.6 Diagnostische Verfahren und Dokumentationshilfen
2.6.1 Anamnese und Befunderhebung
2.6.2 Erfassung depressiver Symptome
3 Störungstheorien und -modelle
3.1 Grundannahmen eines psychoanalytischen Verständnisses von Depression
3.1.1 Depression als Reaktion auf einen Verlust: Schulddepression und Wiedergutmachung
3.1.2 Narzisstische und psychotische Depression
3.1.3 Integrative Modelle der Depression
3.2 Chronische Depression, Trauma und Embodied Memories
4 Behandlungstechnische Überlegungen für psychoanalytische Langzeittherapien von chronisch depressiven Patienten
4.1 Matchingprozesse zwischen Patient und Analytiker
4.2 Setting und Behandlungsvereinbarungen
4.3 Entscheidung für ein nieder- oder hochfrequentes Behandlungssetting
5 Generelle behandlungstechnische Aufgaben und psychoanalytische Grundhaltungen
5.1 Behandlungstechnische Aufgabe I: Sich gemeinsam dem psychischen Schmerz annähern und sich dem Unerträglichen des Traumas stellen
5.2 Behandlungstechnische Aufgabe II: Psychoanalytisches Zuhören, Verstehen, Halten und Containen bei Patienten ohne Urvertrauen in ein helfendes Objekt und die eigene Self-Agency
5.3 Behandlungstechnische Aufgabe III: Bearbeitung des Traumas in der Übertragungsbeziehung und Annäherung an die „Historizität des Traumas“
5.4 Behandlungstechnische Aufgabe IV: Umgang mit Verlust- , Trennungs- und Vernichtungsangst sowie einem drohenden Behandlungsabbruch
5.5 Behandlungstechnische Aufgabe V: Berücksichtigung und Verstehen von Depression und Trauma im Lebenszyklus
5.5.1 Spätadoleszenz bzw. frühes Erwachsenenalter (20 bis 30 Jahre)
5.5.2 Mittleres Erwachsenenalter (30 bis 50 Jahre)
5.5.3 Späteres Erwachsenenalter (ab 50 Jahre)
6 Spezifische behandlungstechnische Herausforderungen
6.1 Suizidalität
6.2 Aggression und Schuld und ihre Bedeutung für die Beendigung der Behandlung
6.3 Masochismus und negative therapeutische Reaktion
6.4 Ich-Ideal und Über-Ich
6.5 Narzisstische Vulnerabilität, Selbstregulierung und Identitätskonflikte
6.6 Defizite in den Ich-Ressourcen, Manie und psychotische Depression
6.7 Transgenerationelle Aspekte
7 Wirksamkeit
7.1 Kurze Beschreibung der Studie
7.2 Design der Studie und Studienteilnehmende
7.3 Ausgewählte Ergebnisse
7.3.1 Hauptzielkriterien
7.3.2 Strukturelle Veränderungen 3 Jahre nach Beginn der Behandlungen
7.4 Diskussion
7.5 Varianten der psychotherapeutischen Interventionen und Kombinationen
7.5.1 Analytische Langzeittherapie im Vergleich mit tiefenpsychologisch fundierter Therapie
7.5.2 Kombination mit medikamentöser Behandlung
8 Ausführliches Fallbeispiel
8.1 Zusammenfassung der strukturellen Veränderungen aus Sicht der behandelnden Psychoanalytikerin
8.1.1 Erstvorstellung und Behandlungsmotivation
8.1.2 Behandlungsverlauf
8.1.3 Anmerkungen zur Behandlungstechnik und strukturellen Veränderung
8.2 Einschätzung der Strukturveränderungen bis zu 3 Jahre nach Behandlungsbeginn
Weiterführende Literatur
Literatur
Anhang
Anhang 1: Kurze Beschreibung der in der LAC-Studie untersuchten Therapieverfahren
Anhang 2: Das Three-Level Model (3-LM) of Clinical Observation
|11|Vorwort
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Manual die klinisch-psychoanalytische Arbeit mit chronisch depressiven Patienten1 zur Diskussion stellen können. Wir hatten das Privileg, im Rahmen der LAC-Depressionsstudie mit einigen der erfahrensten Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytikern der internationalen Psychoanalyse intensiv zusammenzuarbeiten: mit David Taylor (London), Hugo Bleichmar (Barcelona), Peter Fonagy (London), Mary Target (London), Siri Gullestad (Oslo), Dieter Bürgin (Basel), Robert N. Emde (Denver), Henri Parens (Philadelphia), Judy Kantrowitz (Boston), Charles und Margaret Hanly (Toronto), Norman Doidge (Toronto), Steven Ellmann (New York), Steven Roose (New York) sowie mit dem Committee for Clinical Research der International Psychoanalytical Association (IPA). Darüber hinaus hatten wir die Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren das sogenannte Three-Level Model for Clinical Observation entwickelten: u. a. Ricardo Bernardi (Montevideo), Margaret Anne Fitzpatrick Hanly (Toronto), Marina Altmann, (Montevideo), Marvin Hurvich (New York), Virginia Ungar (Buenos Aires), Adela Leibovich de Duarte (Buenos Aires) sowie Glen Gover (San Francisco), Judy Kantrowitz (Boston), Steven und Carolyne Ellman (New York), Norbert Freedman (New York) sowie Agneta und Rolf Sandell (Stockholm).
Dabei haben wir zwei Kollegen besonders viel zu verdanken: David Taylor schulte alle Studientherapeutinnen und -therapeuten der LAC2-Studie im sogannten Tavistock-Manual zur Behandlung von Depressionen und unterstützte uns bei verschiedenen Workshops und Tagungen während der 15 Jahre, in denen die LAC-Studie durchgeführt wurde. Hugo Bleichmar, einer der anerkanntesten Depressionsforscher der IPA stellte uns sein reiches klinisches und konzeptuelles Wissen in regelmäßigen Workshops und Tagungen zur Verfügung und war an der ersten Fassung dieses Manuals |12|beteiligt. Leider ist er im März 2019 für uns unerwartet plötzlich verstorben. Wir bleiben mit ihm in Dankbarkeit verbunden und widmen ihm dieses Manual.
Auch allen anderen oben erwähnten Kolleginnen und Kollegen danken wir sehr herzlich für die jahrelange Unterstützung und Bereicherung. Ihr Wissen hat Eingang in das vorliegende Manual gefunden.
Ebenfalls sehr herzlich bedanken wir uns bei den 73 engagierten Studientherapeuten der LAC-Studie in Frankfurt am Main, Mainz, Berlin und Hamburg, die wir leider nicht alle namentlich hier aufführen können. Sie haben durch ihre kontinuierliche, großzügige und offene, aber auch immer kritische Mitarbeit die LAC-Studie erst möglich gemacht. Viele von ihnen haben an den wöchentlichen klinischen Konferenzen teilgenommen und zu einer ständigen Weiterentwicklung der psychoanalytischen Behandlungstechnik bei dieser schwierig zu behandelnden Gruppe von Patienten beigetragen. Einige waren dazu bereit, ihre Erfahrungen in ausführlichen Falldarstellungen zusammenzufassen und gemeinsam in einem Buch zu publizieren: Was nur erzählt und nicht gemessen werden kann. Einblicke in psychoanalytische Langzeitbehandlungen chronischer Depressionen (Leuzinger-Bohleber, Grabhorn & Bahrke, 2020). Dieses Fallbuch kann Lernenden als eine wichtige Ergänzung zu diesem Manual dienen.
So ist das vorliegende Manual einerseits das Ergebnis von intensiven klinisch-psychoanalytischen Erfahrungen im Rahmen der großen multizentrischen LAC-Studie, andererseits umfasst es darüber hinaus den aktuellen Stand des psychoanalytischen Wissens zur Depressionsbehandlung. Daher sind wir der Meinung, dass sich das Manual als interessant für alle psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Therapeutinnen und Therapeuten erweisen kann. Die vielen Fallbeispiele, die teilweise aus früheren Publikationen zur LAC-Studie stammen, sprechen in der Regel für sich und können das Nachdenken über komplexe klinische Phänomene sowohl bei Anfängern als auch bei erfahreneren Therapeutinnen und Therapeuten bereichern.
Ein besonderer Schwerpunkt des Manuals liegt auf dem Thema „Trauma“. Ein unerwartetes Ergebnis der LAC-Studie war, dass fast alle chronisch Depressiven in ihrer Kindheit schwere Traumatisierungen erlebt hatten. Daher sind wir überzeugt, dass es in psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Behandlungen dieser Patientengruppe wichtig ist, die individuelle Traumageschichte dieser Patienten in den Blick zu nehmen und in der Behandlungstechnik zu berücksichtigen. Dies führt in manchen Unterabschnitten zu recht anspruchsvollen behandlungstechnischen Überlegungen, die aber, so hoffen wir, auch für weniger erfahrene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nachvollziehbar sind.
|13|Wir haben versucht, in einer gut verständlichen Sprache zu schreiben, sodass das Manual nicht nur Therapeutinnen und Therapeuten anspricht, die sich bereit erklären, in Studien mit chronisch depressiven Patienten mitzuwirken, sondern auch solche, die in ihren Praxen oder Kliniken mit dieser Gruppe von Patienten arbeiten. So richtet sich das Manual vor allem an unsere Kolleginnen und Kollegen, und wir hoffen, dass es sich auch in der Ausbildung bewähren wird. Wir müssen zwar einige Grundbegriffe und -kenntnisse des psychoanalytischen Arbeitens hier voraussetzen, doch können diese im Einführungsband dieser Reihe, Psychodynamische Psychotherapie, von Manfred E. Beutel, Stephan Doering, Falk Leichsenring und Günter Reich (2020) nachgelesen werden.
Wir danken Andju Labuhn, Anna Leszszynska-Koenen, Christiane Schrader und Erhard Mohr herzlich für die kritische Lektüre des Manuskripts und Anne Schorr für die sorgfältige Hilfe beim Erstellen des Literaturverzeichnisses.
Wir wünschen diesem Buch eine breite Leserschaft und hoffen, durch dieses Manual zu einer Verbesserung der psychoanalytischen Behandlungen dieser schwer kranken Patienten beitragen zu können.
Frankfurt, Mainz und Berlin
Marianne Leuzinger-Bohleber
im Frühjahr 2022
Tamara Fischmann
Manfred E. Beutel
Im Dienste einer besseren Lesbarkeit verwenden wir hier überwiegend den masculinus generalis, ohne jedoch den Genderaspekt zu negieren, die bekanntlich gerade beim Thema Depression entscheidend ist: Zwei Drittel der chronisch Depressiven sind Frauen.
Die Abkürzung LAC steht für Langzeitbehandlungen bei chronisch depressiven Patienten.
|15|1 Einführung
1.1 Chronische Depression und Trauma: Signaturen unserer Zeit?
Depressionen gelten heute weltweit als eine der häufigsten psychischen Erkrankungen. Sie gehörten aber schon immer zu den Geißeln der Menschheit, wie die vielbeachtete Kunstausstellung Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst (2006 in Paris, Berlin etc.) eindrucksvoll dokumentierte. Depressive Stimmungen bis hin zu schweren depressiven Erkrankungen sind Teil der conditio humana. Dennoch ist unbestritten, dass Depressionen zu einem der gravierendsten Probleme der heutigen Gesundheitssysteme geworden sind. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) litten 2015 4.4 % der Weltbevölkerung, d. h. 322 Millionen Menschen, an Depressionen, 18 % mehr als 10 Jahre zuvor (Andrews, 2008; Horwitz & Wakefield, 2007).
Nach Bohleber (2005, 2010) ist die Depression in den Sozialwissenschaften zu einer Signatur unserer Zeit avanciert, in der sich traditionelle Strukturen und klare Verhaltenserwartungen weitgehend aufgelöst haben. Abgrenzungsphänomene und die enorme Zunahme individueller Wahlmöglichkeiten von Lebensperspektiven führen zu einem Verlust an sozialer Sicherheit und machen die eigene Identität zum Lebensprojekt des Einzelnen. Der französische Soziologe Alain Ehrenberg (2016) erklärt in seiner Studie zu Depression und Gesellschaft das erschöpfte Selbst zur Krankheit der heutigen Gesellschaft, deren Verhaltensnormen nicht mehr auf Schuld und Disziplin, sondern vor allem auf Verantwortung und Initiative beruhen. An die Stelle des spätbürgerlichen Individuums scheint ein Individuum zu treten, das die Idee hat, dass „alles möglich ist“. Es ist von der Angst um seine Selbstverwirklichung geprägt, die sich leicht bis zum Gefühl der Erschöpfung steigern kann. Der Druck zur Individualisierung spiegelt sich in Versagens-, Scham- und Unzulänglichkeitsgefühlen und schließlich in depressiven Symptomen wider. Wenn Neurose für Ehrenberg (ebd.) eine Krankheit des Individuums ist, das durch den Konflikt zwischen Erlaubtem und Verbotenem zerrissen wird, so ist Depression für ihn die Krankheit des Indivi|16|duums, das durch die Spannung zwischen Möglichem und Unmöglichem gehemmt und erschöpft ist. Depression wird so zu einer Tragödie der Unzulänglichkeit.
Lange Zeit galt die Depression als eine Erkrankung, die relativ gut psychotherapeutisch und medikamentös zu behandeln ist. Diese positive Sicht auf den Erfolg von Therapien hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Ergebnisse aus der epidemiologischen Forschung zeigen, dass es sich bei Depressionen häufig um eine wiederkehrende Erkrankung mit einer hohen Rückfallquote handelt, die bei 25 bis 30 % der Betroffenen chronisch wird (s. z. B. Steinert et al., 2014; vgl. auch Kap. 2.3).
Für all diese Patienten können langfristige psychoanalytische Therapien oder Psychoanalysen eine Alternative bieten (s. Leichsenring, 2008; Leichsenring & Rabung, 2011). In der repräsentativen DPV-Katamnesestudie der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) haben rund 80 % aller 402 ehemaligen Psychoanalysepatienten oder Patienten mit psychoanalytischen Langzeittherapien eine nachhaltige Verbesserung ihrer psychopathologischen Symptome sowie ihrer Objektbeziehungen, ihrer Arbeitsfähigkeit und ihrer Lebensqualität gezeigt (Leuzinger-Bohleber et al., 2003). Von den Teilnehmenden waren 27 % als depressiv diagnostiziert worden, oft in Kombination mit Persönlichkeitsstörungen.
Dieses Manual legt den Fokus auf Patienten, die an einer chronischen Depression, häufig aufgrund schwerer traumatischer Erfahrungen, leiden. Auf den Zusammenhang zwischen chronischer Depression und Traumata weisen sowohl die DPV-Katamnesestudie als auch die LAC-Studie hin. Es war ein unerwartetes Ergebnis der DPV-Katamnesestudie, dass 62 % der Patienten, die in den 1980er Jahren in einer psychoanalytischen Langzeittherapie waren, schwere Traumatisierungen während ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg erlebt hatten (vgl. Leuzinger-Bohleber et al., 2003). Auch die Ergebnisse der LAC-Depressionsstudie ergaben, dass bei 84 % der untersuchten 252 Patienten die chronische Depression in engem Zusammenhang mit kumulativen Frühtraumatisierungen standen (zur Definition von Trauma vgl. Kap. 3.2).
1.2 Die LAC-Studie: Konzeptualisierungen von chronischer Depression und empirische Untersuchung von Langzeitbehandlungen
Obwohl die Depression als eine der psychoanalytisch am besten untersuchten Störungen angesehen werden kann, ist die Unterscheidung zwischen |17|ihren verschiedenen Formen keineswegs einfach und noch nicht ausreichend verstanden. Frühere Definitionen konzentrierten sich auf die psychogene, endogene und somatogene Depression. Im DSM-IV und in der ICD-10 wurde von der deskriptiv-symptomatischen Ebene ausgegangen und verschiedene Störungsbilder werden voneinander abgegrenzt (Major Depression, Dysthymie etc.). Ohne die biologischen Faktoren auszuschließen, werden in einem psychodynamischen Verständnis verschiedene Erscheinungsformen der Depression nicht kategorisch oder dimensional aufgefächert (s. z. B. Hill, 2009; Böker, 2011; Jimenez, 2019). So können, wie u. a. Sidney Blatt (2004) vorschlägt, die verschiedenen Formen der Depression auf einem Kontinuum angesiedelt sein, das von der dysphorischen Stimmung der Mikrodepression bis zur schweren Depression reicht (s. Fonagy et al., 2010).
Alle diese Befunde fordern auch die Psychoanalyse heraus, die Frage der Depression neu zu stellen und den Stand ihrer Forschung zu bewerten. Deshalb beschloss 2004 eine multizentrische Forschungsgruppe von Psychoanalytikern und kognitiven Verhaltenstherapeuten, eine vergleichende Psychotherapiestudie über die Ergebnisse kognitiv-verhaltenstherapeutischer und psychoanalytischer Langzeitbehandlungen, die sogenannte LAC-Studie, zu initiieren (vgl. dazu Beutel et al., 2012). Wir konzipierten die Studie in enger Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe von Phil Richardson, Peter Fonagy und David Taylor, die in London ebenfalls eine Studie über die Ergebnisse psychoanalytischer Langzeitpsychotherapien bei schwer zu behandelnden Depressionen plante, die sogenannte Tavistock-Depressionsstudie. Wir setzten eine Reihe identischer Messinstrumente ein, um die Daten aus den beiden Studien zu vergleichen. Eine enge Zusammenarbeit ergab sich auch bei der psychoanalytischen Konzeptualisierung von Depressionen und behandlungstechnischen Überlegungen. David Taylor hatte bei Beginn der Hauptuntersuchung der LAC-Studie (2010) erste Versionen des Tavistock-Behandlungsmanuals für die Behandlung schwer zu behandelnder depressiver Patienten verfasst. Er erklärte sich bereit, die psychoanalytischen Studientherapeuten der LAC-Studie zu schulen. Dies war eine methodische Voraussetzung, um Psychoanalytiker unterschiedlicher psychoanalytischer Ausrichtungen aus den verschiedenen Fachgesellschaften der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT3; nämlich |18|DPV, DPG, DGIP4, Deutsche Gesellschaft für Analytische Psychologie, freie Institute) als Studientherapeuten einbeziehen zu können. Die Schulung im Tavistock-Behandlungsmanual ermöglichte es daher, Psychoanalytiker der verschiedenen psychoanalytischen Gesellschaften der DGPT auf einen ähnlichen Stand des theoretischen Verstehens der Psychodynamik von Depressionen sowie der internationalen Behandlungstechnik zu versetzen, was sich für die LAC-Studie sowohl methodisch als auch klinisch als relevant erwies.
Die Vorarbeiten zur multizentrischen LAC-Studie (Projektleitung: M. Leuzinger-Bohleber, M. Hautzinger, M. E. Beutel, W. Keller, G. Fiedler) hatten bereits 2005 begonnen und zu mehreren Pilotstudien geführt. 2007 wurde mit den ersten Behandlungen in den vier beteiligten Zentren Frankfurt am Main, Mainz, Berlin und Hamburg begonnen (vgl. Kap. 7).
In der voliegenden Publikation des LAC-Manuals werden nun die Ergebnisse der sogenannten klinisch-psychoanalytischen Forschung im Rahmen dieser Studie zusammengefasst (vgl. Leuzinger-Bohleber, 2015b). Das bereits erwähnte Tavistock-Manual blieb während der gesamten Studie die Basis der behandlungstechnischen Überlegungen sowie der Überprüfung der Adhärenz. Es gehörte zum Studiendesign, dass alle Studientherapeuten in sogenannten wöchentlichen klinischen Konferenzen oder regelmäßigen Supervisionsgruppen ihre Behandlungen gemeinsam reflektierten. Zudem fanden regelmäßige Workshops, Tagungen und Supervisionen vor allem mit einem der bekanntesten psychoanalytischen Depressionsforscher, Hugo Bleichmar, und anderen internationalen Experten statt, z. B. mit Siri Gullestad (Oslo), Peter Fonagy (London), Mary Target (London), John Clarkin (New York), Robert B. Emde (Denver), Rolf Sandell (Stockholm), Steven Roose (New York), Norman Doidge (Toronto), Charles und Margaret Hanly (Toronto) und Steven Ellmann (New York). Dies führte dazu, dass die Behandlungstechnik dieser Gruppe von chronisch depressiven Patienten ständig weiterentwickelt und in einer Reihe von Publikationen zur Diskussion gestellt wurde (vgl. dazu u. a. Leuzinger-Bohleber, 2015a; Leuzinger-Bohleber, Bahrke & Negele, 2013). Das hier vorgelegte LAC-Manual zur Behandlung chronisch depressiver, früh traumatisierter Patienten ist das Produkt dieser jahrelangen klinischen und konzeptuellen Forschung (vgl. dazu auch Leuzinger-Bohleber, Solms & Arnold, 2020).
Um diese Art der Forschungzu illustrieren, publizierten Studientherapeuten und -therapeutinnen 2020 ein Buch mit ausführlichen Falldarstellungen der LAC-Studie (Was nur erzählt und nicht gemessen werden kann …; |19|Leuzinger-Bohleber, Grabhorn & Bahrke, 2020). Die methodische Besonderheit ist, dass die Publikation der ausführlichen Falldarstellungen mit dem Einverständnis der ehemaligen Patienten geschieht. Zudem wurden die Patienten mithilfe des sogenannten Three-Level Model of Clinical Observation (3-LM) systematisch untersucht und diese Ergebnisse mit Ergebnissen der quantitativen Untersuchungen der LAC-Studie und den Untersuchungen der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD-2; Arbeitskreis OPD, 2014) in Verbindung gebracht (vgl. Anhang 3).
1.3 Chancen und Herausforderungen von Psychoanalysen im Rahmen von empirischen Studien
Für Psychoanalytiker, die noch nie an einer empirischen Studie teilgenommen haben, könnte das Engagement in einem Forschungsprojekt an die bekannte Psychodynamik der Konfrontation mit „dem Fremden“ erinnern. Der Fremde ruft immer ambivalente Gefühle hervor: Einerseits weckt das Neue, Unbekannte die eigene Neugierde, Interesse und Entdeckerfreude, andererseits werden Angst, Unsicherheit und eine Destabilisierung von Selbst und Identität evoziert.
Jeder Forschungskontext ist geeignet, sowohl bewusste als auch unbewusste Übertragungs- und Gegenübertragungsfantasien zu stimulieren. So können darin z. B. die Leiter des Forschungsteams eine hilfreiche, triangulierende Funktion erhalten oder aber in der Übertragung zu einer kontrollierenden, möglicherweise sogar sadistischen, präödipalen oder ödipalen Vater- oder Bruderfigur werden.