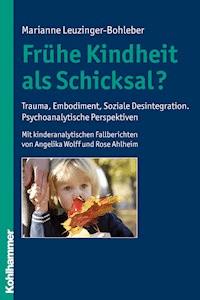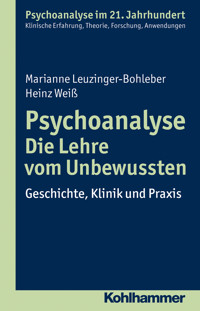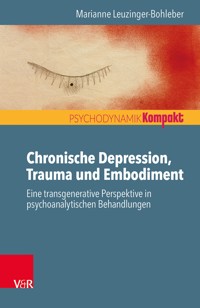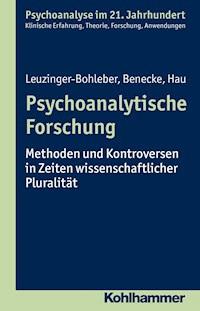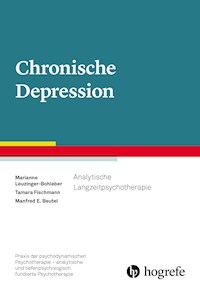Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
More recent developments in neuroscience have intensified the interdisciplinary dialogue between psychoanalyses and neuroscience and have opened a new door to the world of science for the psychoanalysis. Five leading experts are exploring the opportunities and difficulties of this dialogue. They discuss scientific theoretical and methodical problems and explore, how the central concepts of the psychoanalysis can be developed further through an exchange with neuroscience.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Psychoanalyse im 21. Jahrhundert
Klinische Erfahrung, Theorie, Forschung, Anwendungen
Herausgegeben von Cord Benecke, Lilli Gast,
Marianne Leuzinger-Bohleber und Wolfgang Mertens
Berater der Herausgeber
Ulrich Moser
Henri Parens
Christa Rohde-Dachser
Anne-Marie Sandler
Daniel Widlöcher
Marianne Leuzinger-Bohleber, Tamara Fischmann, Heinz Böker, Georg Northoff, Mark Solms
Psychoanalyse und Neurowissenschaften
Chancen – Grenzen – Kontroversen
Unter Mitarbeit von Michael Dümpelmann, Rolf Pfeifer, Margerete Schött und Michael O. Russ
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2015
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-022984-6
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-026784-8
epub: ISBN 978-3-17-026785-5
mobi: ISBN 978-3-17-026786-2
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Geleitwort zur Reihe
Die Psychoanalyse hat auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer Bedeutung und Faszination verloren. Sie hat sich im Laufe ihres nun mehr als einhundertjährigen Bestehens zu einer vielfältigen und durchaus auch heterogenen Wissenschaft entwickelt, mit einem reichhaltigen theoretischen Fundus sowie einer breiten Ausrichtung ihrer Anwendungen.
In dieser Buchreihe werden die grundlegenden Konzepte, Methoden und Anwendungen der modernen Psychoanalyse allgemeinverständlich dargestellt. Worin besteht die genuin psychoanalytische Sichtweise auf Forschungsgegenstände wie z. B. unbewusste Prozesse, Wahrnehmen, Denken, Affekt, Trieb/Motiv/Instinkt, Kindheit, Entwicklung, Persönlichkeit, Konflikt, Trauma, Behandlung, Interaktion, Gruppe, Kultur, Gesellschaft u. a. m.? Anders als bei psychologischen Theorien und deren Überprüfung mittels empirischer Methoden ist der Ausgangspunkt der psychoanalytischen Theoriebildung und Konzeptforschung in der Regel zunächst die analytische Situation, in der dichte Erkenntnisse gewonnen werden. In weiteren Schritten können diese methodisch trianguliert werden: durch Konzeptforschung, Grundlagenforschung, experimentelle Überprüfung, Heranziehung von Befunden aus den Nachbarwissenschaften sowie Psychotherapieforschung.
Seit ihren Anfängen hat sich die Psychoanalyse nicht nur als eine psychologische Betrachtungsweise verstanden, sondern auch kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche sowie geisteswissenschaftliche Perspektiven hinzugezogen. Bereits Freud machte ja nicht nur Anleihen bei den Metaphern der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts, sondern entwickelte die Psychoanalyse im engen Austausch mit geistes- und kulturwissenschaftlichen Erkenntnissen. In den letzten Jahren sind vor allem neurowissenschaftliche und kognitionspsychologische Konzepte und Befunde hinzugekommen. Dennoch war und ist die klinische Situation mit ihren spezifischen Methoden der Ursprung psychoanalytischer Erkenntnisse. Der Blick auf die Nachbarwissenschaften kann je nach Fragestellung und Untersuchungsgegenstand bereichernd sein, ohne dabei allerdings das psychoanalytische Anliegen, mit spezifischer Methodik Aufschlüsse über unbewusste Prozesse zu gewinnen, aus den Augen zu verlieren.
Auch wenn psychoanalytische Erkenntnisse zunächst einmal in der genuin psychoanalytischen Diskursebene verbleiben, bilden implizite Konstrukte aus einschlägigen Nachbarwissenschaften einen stillschweigenden Hintergrund wie z. B. die derzeitige Unterscheidung von zwei grundlegenden Gedächtnissystemen. Eine Betrachtung über die unterschiedlichen Perspektiven kann den spezifisch psychoanalytischen Zugang jedoch noch einmal verdeutlichen.
Der interdisziplinäre Austausch wird auf verschiedene Weise erfolgen: Zum einen bei der Fragestellung, inwieweit z. B. Klinische Psychologie, Entwicklungspsychologie, Entwicklungs-psychopathologie, Neurobiologie, Medizinische Anthropologie zur teilweisen Klärung von psychoanalytischen Kontroversen beitragen können, zum anderen inwieweit die psychoanalytische Perspektive bei der Beschäftigung mit den obigen Fächern, aber auch z. B. bei politischen, sozial-, kultur-, sprach-, literatur- und kunstwissenschaftlichen Themen eine wesentliche Bereicherung bringen kann.
In der Psychoanalyse fehlen derzeit gut verständliche Einführungen in die verschiedenen Themenbereiche, die den gegenwärtigen Kenntnisstand nicht nur klassisch freudianisch oder auf eine bestimmte Richtung bezogen, sondern nach Möglichkeit auch richtungsübergreifend und Gemeinsamkeiten aufzeigend darstellen. Deshalb wird in dieser Reihe auch auf einen allgemein verständlichen Stil besonderer Wert gelegt.
Wir haben die Hoffnung, dass die einzelnen Bände für den psychotherapeutischen Praktiker in gleichem Maße gewinnbringend sein können wie auch für sozial- und kulturwissenschaftlich interessierte Leser, die sich einen Überblick über Konzepte, Methoden und Anwendungen der modernen Psychoanalyse verschaffen wollen.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber
Cord Benecke, Lilli Gast,
Marianne Leuzinger-Bohleber und Wolfgang Mertens
Inhalt
Geleitwort zur Reihe
Persönliches Vorwort
Teil I – Einführung, methodische Fragen und Perspektiven
1
Einleitung: Zum Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften – Trauma, Embodiment, Gedächtnis
Marianne Leuzinger-Bohleber
1.1 Einführung: Psychoanalyse und Neurowissenschaften – eine lange Geschichte mit neuen Möglichkeiten
1.2 Chancen und Klippen der Neuro-Psychoanalyse: einige einleitende Anmerkungen
2
Von der Neurologie zur Neuro-Psychoanalyse: ein historischer Abriss
Heinz Böker
2.1 Anfänge bei Sigmund Freud
2.2 Die klinisch-anatomische Korrelationsmethode
2.3 Der neurodynamische Ansatz von Lurija
2.4 Zur neuroanatomischen Methode von Kaplan-Solms und Solms
2.5 Aktuelle Studien von Panksepp, Le Doux und anderen
3
Sigmund Freud heute – eine neurowissenschaftliche Perspektive auf die Psychoanalyse
Mark Solms
3.1 Einleitung
3.2 Das Bewusstsein und das Unbewusste
3.3 Abschließende Bemerkungen
4
Psyche und Gehirn? Konzept-Fakt-Iterativität als transdisziplinäre Methode einer zukünftigen Neuro-Psychoanalyse
Georg Northoff
4.1 Hermeneutik und Naturwissenschaft
4.2 Methodischer Dualismus zwischen Psychoanalyse und Neurowissenschaften?
4.3 Neuropsychodynamische Konzept-Fakt-Iterativität
4.4 Schlussfolgerung und Zusammenfassung
5
Schizophrenie – neuro-psychoanalytische Aspekte eines Dilemmas
Georg Northoff und Michael Dümpelmann
5.1 Neuropsychodynamik der Schizophrenie
5.2 Objektverlust, Besetzungsentzug und sensorisches Processing
5.3 Verlust der Ichgrenzen und abnorme intrinsische Aktivität
5.4 Existenzielles Dilemma und kortikale Mittellinienstrukturen
5.5 Zusammenfassende neuropsychodynamische Hypothese: ›Existenzielles Dilemma‹ und die kortikalen Mittellinienstrukturen
6
Neuropsychodynamische Implikationen für die Praxis der psychoanalytischen Psychotherapie: in Sichtweite?
Heinz Böker und Georg Northoff
6.1 Eine neurobiologisch informierte Perspektive der Psychotherapie
6.2 Psychotherapie, Bindungsmuster und Gedächtnis
6.3 Schnittstellen zwischen psychoanalytischer Theorie, Behandlungsmodell und neurowissenschaftlicher Forschung
6.4 Neuropsychodynamische Mechanismen in der psychoanalytischen Psychotherapie: Gehirnvermittelte Person-Umwelt-Beziehung
6.5 Empirische Evidenz für das SBP
6.6 Ausblick
Teil II – Traum, Trauma und Gedächtnis: Beispiele konzeptueller Weiterentwicklungen und klinischer Anwendungen
7
Trauma, Übertragung und Embodied Memories – zum Dialog zwischen Psychoanalyse und Embodied Cognitive Science
Marianne Leuzinger-Bohleber und Rolf Pfeifer
7.1 Einleitung
7.2 Relevanz des Dialogs mit der Embodied Cognitive Science für die klinisch-psychoanalytische Praxis
7.3 Die Integration des Traumas – und ihre therapeutische Wirkung
7.4 Zusammmenfassung
8
Traum und psychische Transformationsprozesse in Psychoanalysen: ein Dialog zwischen Psychoanalyse und Neurowissenschaften
Tamara Fischmann, Marianne Leuzinger-Bohleber, Margerete Schött und Michael O. Russ
8.1 Psychoanalytische Transformationsprozesse gemessen mit bildgebenden Verfahren: eine interdisziplinäre Herausforderung
8.2 Traum und Depression
8.3 Die Frankfurter fMRT/EEG-Depressionsstudie (FRED)
8.4 Psychoanalytische Evaluationen von Veränderungen von Träumen während Psychoanalysen und psychoanalytischen Langzeitbehandlungen
8.5 Zusammenfassung
Literatur
Sachwortverzeichnis
Persönliches Vorwort
Dieser Band in der Reihe »Psychoanalyse im 21. Jahrhundert« wurde nicht von einem Autor allein, sondern von fünf Psychoanalytikern und Neurowissenschaftlern verfasst.
Da am Sigmund-Freud-Institut (SFI) in Frankfurt am Main der Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften eine lange Tradition hat und in den letzten Jahren eine neue Blüte erfährt, habe ich die Erstautorenschaft für diesen Band übernommen. Ich habe vier weitere Experten auf diesem Gebiet gebeten, die Verantwortung für diesen Band mit mir zu teilen, einem Band, der sowohl eine Einführung als auch einen Einblick in aktuelle Fragen, Chancen und Grenzen dieses faszinierenden Forschungsfeldes für die aktuelle Psychoanalyse bieten soll.
Schon in den 1980er Jahren begann Wolfgang Leuschner mit einer Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter ihnen Tamara Fischmann und Stefan Hau, ein experimentelles Schlaf- und Traumlabor am Sigmund-Freud-Institut aufzubauen. Das Team führte eine Reihe origineller Studien u. a. zur subliminalen Verarbeitung von Reizen im Traum durch, um die Freud’sche Traumtheorie experimentell abzustützen bzw. zu widerlegen. Konzeptuell begründeten sie diese Experimente insofern durch den Dialog mit den Neurowissenschaften, als sie vom damaligen Wissensstand zur experimentellen Schlaf- und Traumforschung ausgingen und sich dabei u. a. auf zentrale Kontroversen zu neurophysiologischen Korrelaten von Schlaf und Traum (z. B. zwischen Solms und Hobson) bezogen. Das Forscherteam organisierte eine Reihe internationaler Tagungen, in denen sie u. a. in Austausch mit Forschern aus den USA (z. B. Howard Shevrin, Harry Fiss, u. a.) und aus der Schweiz (z. B. Inge Strauch, Ulrich Moser, Rolf Pfeifer und mir) aufnahmen.
Zwischen 1992 und 1996 förderte die Köhler Stiftung GmbH Darmstadt ein Kolloquium, an dem 20 Psychoanalytiker und Neurowissenschaftler unter der Leitung der Neurologin und Psychiaterin Martha Koukkou-Lehmann und mir als Psychoanalytikerin versuchten, die Brücke zwischen diesen beiden Disziplinen zu schlagen. U. a. nahmen auch Wolfgang Leuschner und Wolfgang Mertens am Kolloquium teil, das in vielerlei Hinsicht aus heutiger Sicht als ein »Pionier- Experiment« betrachtet werden kann (vgl. Koukou, Leuzinger-Bohleber, Lehmann & Mertens, 1998; Leuzinger-Bohleber, Mertens & Koukkou, 1998).
Als ich 2001 meine Tätigkeit als Direktorin am SFI aufnahm, versuchte ich einen Forschungsschwerpunkt »Neuro-Psychoanalyse« einzurichten mit dem Ziel, die oben erwähnte Tradition der experimentellen Schlaf- Traumforschung am SFI mit meinen Erfahrungen in dem erwähnten Kolloquium, der jahrelangen Zusammenarbeit zum Dialog Psychoanalyse – (Embodied) Cognitive Science mit Rolf Pfeifer und dem Engagement in der neu gegründeten Society for Neuropsychoanalysis (gegründet von Mark Solms und anderen) zu integrieren. In allen großen Studien im Bereich der Psychotherapieforschung (u. a. der LAC-Depressionsstudie) und der Frühprävention stützen wir uns konzeptuell auf den interdisziplinären Dialog zwischen Psychoanalyse und Neurowissenschaften. Durch die Gastprofessur von Mark Solms am SFI und der Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Frankfurt a.M. (Wolf Singer, Aglaia Stirn, Michael Russ u. a.), der psychosomatischen Abteilung des Universitätsklinikums Frankfurt a.M. (Ralf Grabhorn, Harald Mohr u. a.) und dem IDeA Zentrum (Christian Fiebach) konnten wir vor allem unter der zunehmenden Federführung von Tamara Fischmann eine Reihe neuer Studien auf den Weg bringen, von denen in diesem Band berichtet wird, die FRED-Studie sowie zwei DFG-Anträge. Ein Projekt untersucht die neurobiologischen Korrelate von desorganisierten verglichen mit sicher gebundenen Kindern (Tamara Fischmann, Christian Fiebach, Marianne Leuzinger-Bohleber). Eine zweite Studie vergleicht mit Hilfe eines fMRI-Paradigmas chronisch Depressive mit und ohne die Komorbidität Borderline-Störung (Tamara Fischmann, Ralf Grabhorn, Harald Mohr, Michael Russ, Margarete Schoett, Konstanze Rickmeyer, Marianne Leuzinger-Bohleber, Mark Solms u.a.). Ein weiterer DFG-Antrag zur Neurobiologie des Träumens wird in diesem Jahr zusammen mit Mark Solms, Heinz Weiß und dem Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart, eingereicht.
Unsere Forschungsgruppe am SFI steht seit Jahren in intensivem Austausch mit Heinz Böker und seiner Forschungsgruppe an der Psychiatrischen Universitätsklinik, Zürich, und Georg Northoff, Universität Ottawa, vor allem zu neurobiologischen und psychoanalytischen Untersuchungen im Bereich der Depressionsforschung (LAC-Studie, FRED-Studie). Heinz Böker und Georg Northoff sind zwei der international führenden Experten auf diesem Gebiet.
Daher bot es sich an, Tamara Fischmann, Heinz Böker, Georg Northoff und Mark Solms als Mitautoren dieses Bandes ins Boot zu holen. Ich freue mich sehr, dass alle vier Wissenschaftler meine Anfrage positiv aufgenommen haben und eigene Beiträge in dem Band verfassten. Ich verspreche mir, dass durch unsere unterschiedlichen Kompetenzen im Dialog Psychoanalyse – Neurowissenschaften dem Leser und der Leserin dieses Bandes ein breites Spektrum an Wissen vermittelt werden kann.
Ich danke meinen vier Mitautoren sehr für ihre Bereitschaft zu dieser Zusammenarbeit und den Verantwortlichen dieser Reihe, Wolfgang Mertens, Lily Gast und Cord Benecke, für ihre Offenheit für diese Konzeptualisierung des Bandes.
Einigen Personen möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich danken: Prof. Dr. em. Ulrich Moser, meinem wissenschaftlichen Mentor und Freund, der uns schon als Studierende für eine radikale Offenheit der Psychoanalyse für interdisziplinäre Kooperationen gewonnen hat, Prof. Dr. Rolf Pfeifer, der mich seit mehr als drei Jahrzehnten dazu animiert, in konkreter Zusammenarbeit die ungewöhnlichen Brücken zwischen der Psychoanalyse und der Cognitive Science zu bauen, und Dr. med. Lotte Köhler und Prof. Dr. Wolfgang Mertens, die Prof. Dr. Martha Koukou-Lehmann und mir zu einer Zeit das oben erwähnte Kolloquium »Psychoanalyse und Neurowissenschaften« ermöglichten, als dies noch quer zum damaligen Zeitgeist stand. Ihnen allen: sehr herzlichen Dank!
Herbert Bareuther danke ich für die tatkräftige Unterstützung bei der Literatursuche und der Bibliographie.
Frankfurt am Main, im Frühjahr 2014
Marianne Leuzinger-Bohleber
Teil I – Einführung, methodische Fragen und Perspektiven
1 Einleitung: Zum Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften – Trauma, Embodiment, Gedächtnis
Marianne Leuzinger-Bohleber
Lernziele
• Einen Überblick über historische und aktuelle Aspekte des Dialogs zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften bekommen
• Verschiedene Forschungsfelder und deren Bedeutung für die Weiterentwicklung der Psychoanalyse kennenlernen
• Einsicht in die Chancen und Klippen des aktuellen Dialogs zwischen den beiden Disziplinen
• Reflektieren, warum die Psychoanalyse als »spezifische Wissenschaft des Unbewussten« definiert wird und auf welcher Ebene eine Befruchtung der Psychoanalyse durch die Neurowissenschaften stattfindet
1.1 Einführung: Psychoanalyse und Neurowissenschaften – eine lange Geschichte mit neuen Möglichkeiten
Im Freud-Jahr 2006 konnte der Eindruck entstehen, der Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften bilde das wichtigste Fenster für die heutige Psychoanalyse, das sich für sie zur Welt der aktuellen wissenschaftlichen Diskurse eröffnet. Gewinnen wir in diesem Dialog zusätzliche Erkenntnisse zu bisherigen theoretischen Annäherung an das Unbewusste, dem spezifischen Forschungsgegenstand der Psychoanalyse? (vgl. dazu Leuzinger-Bohleber & Weiß, 2014 und Sonderheft der PSYCHE, Oktober 2013 zum Unbewussten).
Sein Leben lang hoffte Freud bekanntlich, neuere Entwicklungen in den Neurowissenschaften könnten dazu beitragen, psychoanalytische Prozesse auch naturwissenschaftlich zu erforschen. Der englische Neuropsychologe und Psychoanalytiker Mark Solms, einer der Autoren dieses Bandes, belegt in vielen seiner historischen und theoretischen Beiträgen, dass sich Freud – angesichts des Standes der neurowissenschaftlichen Methoden seiner Zeit – von dieser Vision abwandte und die Psychoanalyse als ausschließlich psychologische Wissenschaft des Unbewussten definierte. Wie Böker in seinem historischen Abriss in diesem Band skizziert (Kap. 2), haben neuere Entwicklungen in den Neurowissenschaften, z. B. die Untersuchung des lebenden Gehirns mit Hilfe von bildgebenden Verfahren, aber auch die von Solms und anderen psychoanalytischen Forschern beschriebene neuroanatomische Methode den interdisziplinären Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften in den letzten Jahren befruchtet und intensiviert. 1999 erschien zum ersten Mal die internationale Zeitschrift Neuro-Psychoanalysis, in der namhafte Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker Themen wie Emotion und Affekt, Gedächtnis, Schlaf und Traum, Konflikt und Trauma sowie bewusste und unbewusste Problemlösungsprozesse detailliert und kontrovers diskutieren. 2000 wurde die internationale Gesellschaft Neuropsychoanalysis gegründet, die anlässlich regelmäßiger Kongresse ebenfalls den Austausch zwischen diesen beiden Wissenschaften pflegt. Zudem haben sich in verschiedenen Ländern psychoanalytische Forschungsgruppen gebildet, die Patienten nach lokalisierbaren Hirnverletzungen psychoanalytisch behandeln, einmal um diese Patienten bei der Verarbeitung ihrer Behinderungen (z. B. Neglects) therapeutisch zu unterstützen, aber auch um in diesen Therapien gemeinsam mit den Betroffenen klinisch sorgfältig die Auswirkungen der hirnorganischen Schädigungen auf das seelische Funktionieren und Befinden zu studieren (vgl. u. a. Röckerath, Strauss & Leuzinger-Bohleber, 2009). Die mit Hilfe dieser neuroanatomischen Forschungsmethode gewonnenen Erkenntnisse wurden dokumentiert, im internationalen Austausch zwischen den Expertengruppen miteinander verglichen und in der Zeitschrift Neuro-Psychoanalysis regelmäßig publiziert.
So scheinen zunehmend viele Forschergruppen weltweit zu realisieren, dass sich Neurowissenschaften und Psychoanalyse in interessanter Weise ergänzen könnten: Die Neurowissenschaften verfügen inzwischen über die objektivierenden und exakten Methoden zur Prüfung anspruchsvoller Hypothesen über menschliches Verhalten, während die Psychoanalyse aufgrund ihrer reichen Erfahrung mit Patienten und ihrer besonderen Art der klinischen Feldforschung einen Reichtum differenzierter Erklärungsansätze entwickelt hat, um die vielschichtigen und komplexen Beobachtungen in der psychoanalytischen Situation zu konzeptualisieren. Diese Erklärungsansätze bzw. die Erkenntnisse, die aus den idiosynkratischen Verstehensprozessen mit einzelnen Patienten gewonnen und in Modellvorstellungen eingegangen sind, können auch für Neurowissenschaftler von Interesse sein und spezifische Forschungsfragen aufwerfen (vgl. Böker in diesem Band, Kap. 2).
Inzwischen sind einige erste Übersichtswerke zum Dialog der Psychotherapie und der Neurowissenschaften erschienen (u. a. von Leuzinger-Bohleber, Roth & Buchheim, 2008; Mancia, 2006; Böker & Seifritz, 2012). Unser Band ist als Einführung und Ergänzung zu diesen umfangreichen Publikationen gedacht. Während z. B. Böker und Seifritz (2012) in ihrem Sammelband ein breites Spektrum an Psychotherapie einschließen (von psychodynamischen, psychiatrischen bis hin zu kognitiv-behavioralen Psychotherapien), liegt der Schwerpunkt unserer Publikation auf der klinischen und extraklinischen (d. h. empirischen, experimentellen und interdisziplinären) Forschung in der heutigen Psychoanalyse (Leuzinger-Bohleber, 2010c, 2013). In der Einleitung wird die Auswahl der hier berücksichtigten methodischen, konzeptuellen und klinischen Arbeiten begründet und in einen größeren wissenschaftshistorischen und -theoretischen Kontext eingeordnet.
1.2 Chancen und Klippen der Neuro-Psychoanalyse: einige einleitende Anmerkungen
Bezogen auf die Psychoanalyse als klinische und wissenschaftliche Disziplin haben moderne Diskurse zum Leib-Seele-Problem, vor allem im intensivierten Dialog mit den Neurowissenschaften, zu einer neuen Wahrnehmung der Psychoanalyse in der breiteren Öffentlichkeit geführt. Anlässlich des 150. Geburtstages von Sigmund Freud sprach sogar die Zeitschrift »Der Spiegel« von einer »Renaissance der Psychoanalyse «. Diese neue Aufmerksamkeit in den Medien und in der Fachöffentlichkeit ist unter anderem dem Nobelpreisträger für Neurobiologie Eric Kandel zu verdanken. Sein Buch »Psychiatrie, Psychoanalyse und die neue Biologie des Geistes« (2006) wurde breit rezipiert und führte zu einer Intensivierung spannender interdisziplinärer Dialoge.
Für viele Autoren, auch für Eric Kandel, ist in den letzten Jahrzehnten dank der enormen technischen Fortschritte im Bereich der Neurowissenschaften eine Vision von Sigmund Freud teilweise zur Wirklichkeit geworden, nämlich dass die Erkenntnisse der Psychoanalyse sich auch mit Methoden der Naturwissenschaften belegen lassen. Bekanntlich ließ er selbst diese Vision, die er im »Entwurf einer Psychologie« (1895/1950) beschrieben hatte, wie eben erwähnt, angesichts der methodischen Grenzen der Neurowissenschaften seinerzeit fallen und definierte in der »Traumdeutung « (1900) die Psychoanalyse ausschließlich als eine psychologische Wissenschaft des Unbewussten (vgl. u. a. Kaplan-Solms & Solms, 2000). Wie Kandel in seinem Buch aufzeigt, öffnen die neuen Untersuchungsmethoden der Neurowissenschaften (wie PET, fMRI, EKP) ein neues Fenster für die Psychoanalyse, ihre Konzepte und Modelle durch Methoden der »harten Wissenschaften« zu überprüfen. Eric Kandel ist ein leidenschaftlicher Vertreter dieser Vision und sagte beispielsweise im Neuroforum der Hertie Stiftung 2008 öffentlich, dass die Zukunft der Psychoanalyse weitgehend davon abhänge, ob sie diese neue Herausforderung annehme.
Kandel (2006) diskutiert folgende Bereiche, in denen zukünftig die »Biologie im Dienste der Psychoanalyse« (S. 128 ff.) produktiv werden könnte:
1. Das Unbewußte geistiger Prozesse
2. Das Wesen der psychologischen Determiniertheit: Wie werden zwei Ereignisse im Geist miteinander verknüpft?
3. Psychologische Kausalität und Psychopathologie
4. Frühkindliche Erfahrungen und die Prädisposition zur Psychopathologie
5. Das vorbewußte Unbewußte und der präfrontale Kortex
6. Sexuelle Orientierung und die Biologie der Triebe
7. Therapieergebnisse und strukturelle Veränderungen im Gehirn
8. Psychopharmakologie und Psychoanalyse
Viele verschiedene Forschergruppen haben inzwischen seine Anregungen aufgenommen, auch viele Psychoanalytiker, wie exemplarisch in diesen Band berichtet wird. Allerdings scheint der Weg noch weit, die drei Disziplinen Psychoanalyse, Neurobiologie und kognitive Psychologie »zu vereinheitlichen«, wie es Eric Kandel vorschwebt, wenn er abschließend schreibt:
»Das, was so viele von uns in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren für die Psychoanalyse begeisterte, war ihre kühne Neugier – ihr Forschungseifer. Ich selbst fühlte mich von der neurobiologischen Erforschung des Gedächtnisses angezogen, weil ich das Gedächtnis als zentral für ein tieferes Verständnis des Geistes ansah. Dieses Interesse wurde ursprünglich von der Psychoanalyse angeregt. Man sollte hoffen, dass die spannende und erfolgreiche Arbeit der gegenwärtigen Biologie die Forscherinstinkte der psychoanalytischen Gemeinschaft wiederbelebt und dass eine vereinheitlichte Disziplin von Neurobiologie, kognitiver Psychologie und Psychoanalyse den Weg zu einem neuen und tieferen Verständnis des Geistes ebnet« (Kandel, 2006, S. 174).
Es ist indes aus wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Gründen zu hinterfragen, ob es dabei um eine »Vereinheitlichung« geht. Wie wir in verschiedenen Arbeiten diskutiert haben, scheint es uns adäquater, von einem »Dialog auf gleicher Augenhöhe« zu sprechen, einem Dialog zwischen »spezifischen Wissenschaften, mit spezifischen Forschungsgegenständen, die sie mit spezifischen Methoden und Wahrheitskriterien überprüfen« (Leuzinger-Bohleber, 2010a). Wie wir unten kurz skizzieren werden, ist das Ziel des interdisziplinären Austausches immer ein Vergleich auf der Modellebene und nie eine Inkorporation einer Disziplin durch eine andere (vgl. dazu auch Warsitz & Küchenhoff, 2015).
1.2.1 Zur Notwendigkeit, die Ergebnisse psychoanalytischer Behandlungen auch mit neurowissenschaftlichen Methoden zu belegen
So ist Kandel davon überzeugt, dass die Psychoanalyse zukünftig die Ergebnisse ihrer Behandlungen auch mit neurowissenschaftlichen Methoden belegen muss. Diese Forderung ist, wie wir in den verschiedenen Beiträgen dieses Bandes diskutieren werden, mit anspruchsvollen wissenschaftstheoretischen und methodischen Problemen verbunden. Viele davon sind noch ungelöst und erfordern eine weitere intensiven Reflexion und Diskussion. Allerdings hat Eric Kandel in einem Punkt völlig recht: Wenn es der Psychoanalyse gelingen würde zu zeigen, dass ihre Therapien auch die Funktionsweise des Gehirns nachhaltig verändern, wie dies etwa der Neurowissenschaftler und Psychoanalytiker Norman Doidge (2007) bereits postuliert, würde sie im Bereich der Medizin und im Gesundheitswesen auf neue Weise ernst genommen. Wie Böker und Seifritz (2012) zeigen, versuchen einige psychoanalytische Forschergruppen entsprechende Studien durchzuführen: Buchheim, Kächele et al. in der sogenannten Hanse Neuro-Psychoanalysis Studie; Northoff, Grimm, Böker et al. in ihren Untersuchungen an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich und Tamara Fischmann, Michael Russ, Marianne Leuzinger-Bohleber u. a. am Sigmund-Freud-Institut in Kooperation mit dem Max Planck Institute for Brain Research (vgl. ihre Beiträge in diesem Band) sowie Manfred Beutel und sein Team an der Psychosomatischen Abteilung der Universitätsklinik in Mainz, Linda Mayes und ihre Forschergruppe an der Yale University und Bradley Petersen und Andrew Gerber an der Columbia University in New York (vgl. u. a. Peterson, 2013), um nur einige wenige zu nennen. Somit haben viele Forschergruppen den Ball aufgenommen, der ihnen von Eric Kandel zugespielt worden ist.
Einige weitere Forschergruppen gehen von psychoanalytischen oder psychodynamischen Konzepten aus und untersuchen vor allem die Ergebnisse psychoanalytischer Kurztherapien. Einige wenige Studien befassen sich auch mit den Resultaten von Langzeitbehandlungen bei bestimmten Patientengruppen. In den nachfolgenden Kästen, die Margerete Schött dankenswerterweise erstellt hat, wird eine Übersicht über bereits publizierte Studien gegeben, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Weitere Studien dienen Überprüfung spezifischer psychoanalytischer Konzepte, z. B. Studien von Schmeing et al. (2013), Kehyayan et al. (2013), Gerber et al. (2006), Atamaca et al. (2011), Fan et al. (2011) und Siegel et al. (2012). Böker und Seifritz (2012) schreiben zusammenfassend:
»Noch wissen wir nicht, wie groß letztlich die Out-come-Varianz für die Wirkung von Psychotherapie durch einen tieferen neurobiologischen Blick sein wird. Auch wenn die Antwort auf die Frage nach direkt handlungsleitenden Erkenntnissen bisher vielfach nur in ersten Ansätzen skizziert werden kann, so tragen doch bereits jetzt vielfältige Erkenntnisse neurowissenschaftlicher Forschung, dadurch inspirierte Sichtweisen und Heuristiken erheblich zum Verständnis von Wirkmechanismen und nicht zuletzt auch zum Erfolg einer Therapie bei […]
Zusammenfassend wird die neurobiologische Forschung in Zukunft einen wesentlichen Beitrag leisten zur Aufdeckung von Wirkmechanismen spezifischer psychotherapeutischer Interventionen, zur Identifikation der Prädiktoren der Ansprechbarkeit auf Psychotherapie (insbesondere auch im Vergleich zu der auf Psychopharmakotherapie) und zur Gewinnung von Risikoindikatoren für hohe Rückfallswahrscheinlichkeiten« (S. 632).
Um die Einschätzung dieser Autoren konkret zu illustrieren, fassen wir im Teil II dieses Bandes exemplarisch einige Studien zusammen, die wir zurzeit am Sigmund-Freud-Institut durchführen. Wir werden dadurch, so hoffen wir, einige der grundlegenden methodischen und wissenschaftstheoretischen Probleme, die mit diesen Studien verbunden sind, für die Leser konkret nachvollziehbar machen. Vor allem aber werden wir durch einen Einblick in die psychoanalytische Praxis anhand von relativ ausführlichen Fallbeispielen die eben zitierte Auffassung von Böker und Seifritz konkretisieren und zeigen, wie anregend der interdisziplinäre Dialog mit Neurowissenschaftlern auch heute schon eine wichtige Anregung und Herausforderung für das Verständnis therapeutischer Prozesse sein kann, aber auch auf welche Grenzen wir dabei stoßen.
1.2.2 Interdisziplinär inspirierte Konzeptforschung in der neueren Psychoanalyse: einige Beispiele
Ein weiteres Feld, das Eric Kandel erwähnt und in dem sich der interdisziplinäre Dialog mit den Neurowissenschaften schon seit Jahrzehnten in fruchtbarer Weise auswirkt, ist die psychoanalytische Konzeptforschung, eine spezifische Form der genuin psychoanalytischen Forschung, die vom Committee for Clinical, Conceptual, Historical and Epistemological Research unter dem IPA-Präsidenten Daniel Widlöcher genauer charakterisiert und weiterentwickelt wurde (vgl. dazu u. a. Leuzinger-Bohleber & Fischmann, 2006; Leuzinger-Bohleber, 2010c). Wie wir in anderen Arbeiten ausführlich diskutiert haben, befruchtet der interdisziplinäre Dialog mit den Neurowissenschaften die klinisch-psychoanalytische Arbeit nicht direkt, d. h. vereinfacht ausgedrückt: Kein neurowissenschaftliches Forschungsergebnis kann einem Psychoanalytiker konkret raten, wie er sich in einer spezifischen klinisch-psychoanalytischen Situation mit einem spezifischen Analysanden verhalten soll: Die psychoanalytische Behandlungstechnik und -intuition liegt auf einer völlig anderen Ebene als die Weiterentwicklung psychoanalytischer Konzepte, Modelle und Theorien. Daher findet der Austausch der Wissenskorpi zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften immer auf der Ebene der Konzepte und nicht auf der Ebene des konkreten klinischen Handelns statt, wie wir anhand einer Übersichtsgraphik zu verschiedenen Formen psychoanalytischer Forschung in mehreren anderen Arbeiten thematisiert haben (vgl. u. a. Leuzinger-Bohleber, 2008, S. 256 ff.).
Um die Psychoanalyse als wissenschaftliche Disziplin für den Austausch mit anderen Wissenschaften attraktiv zu machen, ist aber eine Offenheit, ein Bemühen um »externale Kohärenz« (C. Strenger) ihrer psychoanalytischen Konzepte und Begriffe unverzichtbar. In anderen Worten sollten psychoanalytische Konzepte und Theorien nicht im Widerspruch zum aktuellen Wissen in anderen Wissenschaften, z. B. den Neurowissenschaften, stehen und müssen daher ständig kritisch reflektiert und weiterentwickelt werden. Mark Solms zeigt in seiner Übersichtsarbeit anlässlich des 150. Geburtstages von Sigmund Freud, die in diesem Band in modifizierter Form nochmals abgedruckt wird, in brillanter Weise auf, wie zentrale psychoanalytische Konzepte wie das Bewusste und das Unbewusste, Verdrängung, Ersatzbildung, Primär- und Sekundärvorgang, das Lustprinzip, die Libidotheorie und die Traumtheorie mit dem Stand heutiger neurowissenschaftlicher Erkenntnisse kritisch in Beziehung gebracht werden können. Erstaunlicherweise erweisen sich viele der Kernkonzepte von Sigmund Freud als »external kohärent« mit dem heutigen neurowissenschaftlichen Verständnis komplexer seelischer Prozesse und können sogar in ihrem Erklärungsgehalt präzisiert und teilweise erweitert werden. Anhand der Freud’schen Triebtheorien, der Ätiologie der Neurosen sowie der Theorien zur infantilen Sexualität und der Stellung des Ödipuskomplexes beleuchtet Solms aber auch kritische Punkte in psychoanalytischen Konzepten, die durch den Dialog mit den Neurowissenschaften modifiziert und teilweise sogar fallengelassen werden müssen. Doch dies ist wissenschaftlicher Alltag in jeder heutigen Wissenschaftsdisziplin. In den 1970er Jahren wurde der Psychoanalyse noch eine Sonderstellung als »Wissenschaft zwischen den Wissenschaften«, zwischen Hermeneutik und Nomothetik, zwischen Natur- und Geisteswissenschaften eingeräumt, da sie sich mit einem nicht direkt beobachtbaren Gegenstand, unbewussten Phantasien und Konflikten beschäftigt (vgl. dazu u. a. Lorenzer in Leuzinger-Bohleber, 2002; Warsitz & Küchenhoff, 2015.). Inzwischen ist die Reflexion des wissenschaftlichen Status der Psychoanalyse weitergegangen und hat zu der Einsicht geführt, dass die Psychoanalyse als »spezifische Wissenschaft des Unbewussten« charakterisiert werden kann, die, wie alle anderen wissenschaftlichen Disziplinen auch, ihren spezifischen Forschungsgegenstand (unbewusste Phantasien und Konflikte), ihre Forschungsmethodik und ihre spezifischen Prüf- und Wahrheitskriterien entwickelt hat (vgl. dazu u. a. Hampe, 2003; Leuzinger-Bohleber, Dreher & Canestri, 2003). In diesem Sinne hat sie ihren Sonderstatus als »Wissenschaft zwischen den Wissenschaften« in dem Sinne verloren, als sie sich mit ihren Forschungsergebnissen und ihren Konzeptualisierungen und Theorien, wie jede andere »spezifische Wissenschaft« auch, der Kritik von innen und außen zu stellen hat und sich in ständiger Weiterentwicklung befindet (vgl. dazu u. a. Leuzinger-Bohleber, 2010c). So fasst Solms seine Auffassung dazu abschließend wie folgt zusammen:
»Abschließend aber müssen wir uns daran erinnern, daß es letzlich nicht darum geht, Freud zu widerlegen oder ihn zu bestätigen, sondern daß es darauf ankommt, die Aufgaben zum Abschluss zu bringen‹ (Guterl, 2002, S. 63). Mit scheint, daß wir schließlich doch noch zu dem Projekt zurückkehren, das Freud in Angriff genommen hat, und uns noch einmal ernsthaft an der (wahrscheinlich unmöglichen) Aufgabe versuchen, es zu vollenden […]« (Solms, 2007, S. 857 f.).
Im Teil II dieses Bandes werden exemplarisch einige Einblicke in solche aktuelle Bemühungen verschiedener Forschergruppen gegeben, psychoanalytische Konzepte zu Gedächtnis, »Wiederholen, Erinnern und Durcharbeiten« (Freud, 1914a), Trauma und Traum sowie von Übertragung und therapeutischer Veränderung mit dem aktuellen Stand neurowissenschaftlicher Forschungen zu verbinden. Anhand ausführlicher Fallbeispiele wird gezeigt, welche Auswirkungen modifizierte Konzepte auf die konkrete psychoanalytische Arbeit mit verschiedenen Patienten haben.
1.2.3 Interdisziplinär angelegte Forschungsprojekte: Ergänzungen von Erkenntnissen klinischer und extraklinischer Forschung
Ebenfalls nur exemplarisch kann im begrenzten Rahmen dieses Bandes aufgezeigt werden, wie verschiedene Forschergruppen am Sigmund-Freud-Institut derzeit versuchen, klinische und extraklinische Forschung (vgl. Leuzinger-Bohleber, 2008, 2010) zu verbinden. Die Ausgangsbasis für den interdisziplinären Dialog zwischen der Psychoanalytikerin Marianne Leuzinger-Bohleber und dem Experten für Embodied Cognitive Science Rolf Pfeifer zur Relevanz von »embodied memories« bei therapeutischen Veränderungen schwer traumatisierter Analysanden bildeten einerseits minutiöse Beobachtungen in Psychoanalysen, wie durch Leuzinger-Bohleber anhand einer ausführlichen Falldarstellung einer Psychoanalyse mit einer ehemaligen Poliopatientin illustriert wird. Andererseits wurden die Gedächtnismodelle, die zu einer radikal neuen Sicht von Erinnerungsprozessen führten, experimentell durch die Entwicklung von mobilen Systemen im Labor für Artificial Intelligence and Robotics an der Universität Zürich getestet. Im zweiten Beitrag geht es um den Traum, der immer noch als die »via regia zum Unbewussten« gelten kann. Tamara Fischmann, Michael Russ und Marianne Leuzinger-Bohleber berichten von einer Studie, in der die Veränderung von Träumen in Psychoanalysen sowohl mithilfe neurobiologischer als auch psychoanalytischer Methoden untersucht werden. Weitere Beispiele, etwa aus der großen multizentrischen Depressionsstudie und verschiedenen Präventionsprojekten sowie einer Studie zu Albträumen von Fischmann et al., wurden in anderen Kontexten publiziert (vgl. dazu u. a. Fonagy, Kächele, Leuzinger-Bohleber & Taylor, 2012): Leuzinger-Bohleber, Bahrke & Negele, 2013; Leuzinger-Bohleber, Emde & Pfeifer, 2013; Emde & Leuzinger-Bohleber, 2014.
1.2.4 Psychoanalytische Entwicklungsforschung im Dialog mit den Neurowissenschaften
Ein weiteres Feld, in dem der Dialog zwischen Psychoanalyse und Neurowissenschaften in den letzten Jahren eine neue Blüte erfährt, ist die psychoanalytische Entwicklungsforschung. Da wir soeben ein Buch zu dieser Thematik publiziert haben, möchten wir hier darauf verweisen und den Schwerpunkt in diesem Band vor allem auf die konzeptuelle Forschung der Psychoanalyse sowie auf die eben erwähnte Psychotherapieforschung legen. In dem Band »Embodiment – ein innovatives Konzept für Psychoanalyse und Entwicklungsforschung« (herausgegeben von Leuzinger-Bohleber, Emde & Pfeifer, 2013) haben wir diskutiert, dass neuere neurowissenschaftlich inspirierte Konzepte wie das Embodiment ein neues Licht auf Entwicklungsprozesse beziehungsweise die determinierende Wirkung von frühen und frühesten Interaktionserfahrungen werfen können. Wie auch epigenetische Studien zeigen, »triggern« diese frühen Beziehungserfahrungen die genetische Anlage des Säuglings in spezifischer Weise (vgl. dazu u. a. Hill, 2009; Suomi, 2011; Leuzinger-Bohleber, im Druck) und erhalten sich im Sinne des Embodiments im Körper. Dadurch bestimmen sie späteres Denken, Fühlen und Handeln grundlegend. Sie bilden die Basis der weiteren psychischen und somatischen Entwicklung und zwar nicht nur, wie dies bisher oft verstanden wurde, als »nonverbales Kommunikationsverhalten«, sondern als basal konstitutive Elemente psychischer Prozesse ganz allgemein. Embodiment heißt daher nie einfach nur »nonverbal« oder »körperlich ausgedrückt«, sondern bedeutet, dass im Hier und Jetzt einer neuen Interaktionssituation durch sensomotorische Koordinationen die Analogien zur früheren Situationen (nicht kognitiv, sondern im Körper) erkannt werden und Erinnerungen jedes Mal neu konstituiert und dadurch die Interpretation einer aktuellen Problemlösungssituation determinieren werden. Diese Prozesse spielen sich nicht nur im Gehirn, sondern vor allem im Körper, in den Sinneswahrnehmungen, ab, die in komplexer, unbewusster Weise zusammenspielen und Denken, Handeln und Fühlen determinieren. Dabei folgen sie den Koordinationen, wie sie sich in früheren Interaktionssituationen abgespielt haben: Embodiment ist daher eine Perspektive, die immer den Entwicklungsaspekt berücksichtigt. Dies ist ein Grund, warum das Konzept des Embodiment für die Psychoanalyse derart fruchtbar ist: Die Psychoanalyse hat immer schon postuliert, dass psychische Realitäten das Produkt komplexer, körperlich-seelischer und immer auch konflikthafter Erfahrungen sind, die sich im Unbewussten erhalten haben und aktuelles Denken, Fühlen und Handeln in neuen Interaktionssituationen unbewusst determinieren. Embodiment ist ein Konzept, das in neuer, innovativer Weise psychoanalytische Erkenntnisse präzise erklären kann.
Empirisch und klinisch gut untersucht ist u. a. das frühe Interaktionsverhalten von depressiven Müttern mit ihren Babys (vgl. dazu u. a. Stern, 1985/1992; Beebe & Lachmann, 2002; Feldmann, 2012; Rutherford & Mayer, 2013). Durch ihre Depression sind Einfühlung und emotionale Resonanz auf die individuellen Bedürfnisse des Säuglings stark eingeschränkt oder brechen sogar weitgehend zusammen. Daniel Stern hat eindrucksvoll beschrieben, dass Säuglingen depressiver Mütter keine andere Wahl bleibt, als sich mit den Affekten ihrer »toten Mutter« zu identifizieren, um überhaupt Nähe zu ihrem Primärobjekt herzustellen. Eine der vier von ihm beschriebenen möglichen langfristigen Copingstrategien, die die werdende Persönlichkeit stark prägen, ist das Ausbilden eines »falschen Selbst« (Winnicott, 1971) (vgl. dazu Falldarstellungen in Teil II dieses Bandes).
So besteht eine enge Verbindung von Embodiment und frühen Entwicklungsprozessen: Die frühen Interaktionserfahrungen bestimmen als »embodied Erinnerungen« die weitere Entwicklung und die spontanen (nicht kognitiven) Erwartungen und unbewussten Interpretationen neuer Interaktionssituationen. Die psychoanalytischen Erkenntnisse, wie entscheidend und langfristig determinierend sich die ersten Beziehungserfahrungen in den durch extreme Vulnerabilität, aber auch durch enorme Plastizität geprägten ersten Lebenswochen und -monate erweisen, erhalten durch die interdisziplinären Forschungen zum »Embodiment« und zur frühen Elternschaft eine faszinierende, empirische Abstützung. Schon Freud sagte bekanntlich, dass das Ich ursprünglich ein Körperliches sei.
Wie Helena Rutherford und Linda Mayes (2013) in einem kürzlich erschienenen Übersichtsartikel berichten, kann dieses Postulat inzwischen in vielfältigen empirischen, vor allem neurobiologischen Studien konkretisiert werden: die frühen, »embodied« Interaktionserfahrungen mit den Primärobjekten schlagen sich sowohl im Körper als auch im Gehirn, vor allem im Stressregulationssystem in prägender Weise nieder. Daher sprechen auch führende Neurowissenschaftler heute vom »social brain «. Sie müssten allerdings immer auch ergänzen, dass dieses »social brain« nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern Teil eines »social body« ist.
Historisch zu erwähnen ist, dass Alfred Lorenzer, damals Wissenschaftler am Sigmund-Freud-Institut, bereits in den 1970er-Jahren als einer der ersten Pioniere die Relevanz des Dialogs mit den Neurowissenschaften für die Psychoanalyse erkannt hat. Lorenzer hat bereits damals postuliert, dass sich Interaktionserfahrungen während der Embryonalzeit und der ersten Lebensmonate »verleiblichen«, das heißt, in sensomotorische Reaktionsweisen des Körpers einprägen und – unbewusst – spätere Informationsverarbeitungsprozesse in adäquater oder inadäquater (»neurotischer«) Weise determinieren. – Eine Einsicht, die nun auch von empirischen Forschern zur Bedeutung resonanter, interaktiver Prozesse für die frühe Entwicklung des Selbst sowie die Auswirkungen früher Traumatisierungen bestätigt, aber konzeptuell in anderer Weise gefasst wird (vgl. Beiträge in Teil II dieses Bandes).