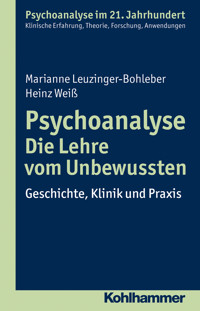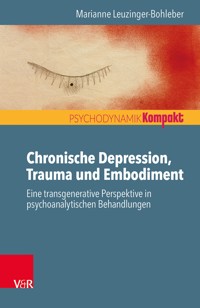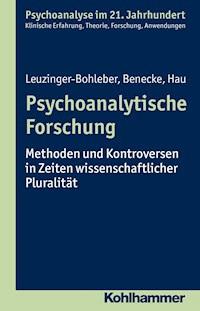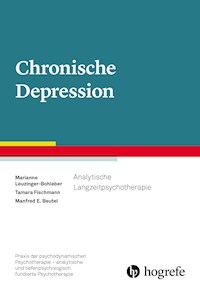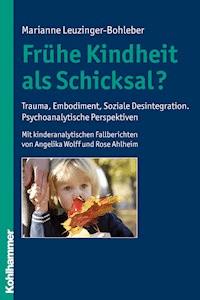
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die soziale Schere zwischen Kindern, denen alle Türen zu einer attraktiven Zukunft offen stehen, und jenen, die am Rande der Gesellschaft aufwachsen, klafft immer weiter auseinander. Die Förderung und Integration sozial Benachteiligter gelingt in Deutschland häufig nur unzureichend. Die Autorin zeigt vor dem Hintergrund nationaler wie internationaler Studien die Grundlagen und Möglichkeiten einer spezifisch psychoanalytisch fundierten Theorie und Praxis der Frühprävention auf, die auch neuere Befunde der Neurowissenschaften und der Embodied Cognitive Science mit einschließen. Eine Vielfalt verschiedener psychoanalytischer Theorien der Frühentwicklung wird gut verständlich zusammengefasst. Ausführliche Behandlungsberichte aus Kindertherapien geben dabei anschauliche Einblicke in Indikation, psychodynamische Diagnostik, behandlungstechnische Aspekte sowie in den therapeutischen Prozess mit Kindern in seelischer Not.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die soziale Schere zwischen Kindern, denen alle Türen zu einer attraktiven Zukunft offen stehen, und jenen, die am Rande der Gesellschaft aufwachsen, klafft immer weiter auseinander. Die Förderung und Integration sozial Benachteiligter gelingt in Deutschland häufig nur unzureichend. Die Autorin zeigt vor dem Hintergrund nationaler wie internationaler Studien die Grundlagen und Möglichkeiten einer spezifisch psychoanalytisch fundierten Theorie und Praxis der Frühprävention auf, die auch neuere Befunde der Neurowissenschaften und der Embodied Cognitive Science mit einschließen. Eine Vielfalt verschiedener psychoanalytischer Theorien der Frühentwicklung wird gut verständlich zusammengefasst. Ausführliche Behandlungsberichte aus Kindertherapien geben dabei anschauliche Einblicke in Indikation, psychodynamische Diagnostik, behandlungstechnische Aspekte sowie in den therapeutischen Prozess mit Kindern in seelischer Not.
Professor Dr. Marianne Leuzinger-Bohleber ist geschäftsführende Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt/Main und lehrt an der Universität Kassel (Institut für Psychoanalyse).
Marianne Leuzinger-Bohleber
Frühe Kindheit als Schicksal?
Trauma, Embodiment, Soziale Desintegration. Psychoanalytische Perspektiven.
Mit kinderanalytischen Fallberichten von Angelika Wolff und Rose Ahlheim
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Zeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2009
Alle Rechte vorbehalten © 2009 W. Kohlhammer GmbH Stuttgart Umschlagabbildung: „Herbstspaziergang“, © U. Grabowsky/photothek.net Fotoagentur Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
ISBN 978-3-17-020344-0
E-Book-Formate
pdf:
978-3-17-022741-5
epub:
978-3-17-028114-1
mobi:
978-3-17-028115-8
Für Werner, Laura Maria und Pascal Dominik
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Frühprävention – eine der dringendsten gesellschaftlichen Aufgaben heute
1.2 Migrantenschicksale – immer noch ein dunkler Fleck in unserer Wahrnehmung
1.3 Zur Psychoanalyse der Frühbeziehung
1.4 Embodiment und Neuroplastizität
1.5 Übersicht über das Buch
2 Klinischer Einstieg – Verpasste Chancen von Frühprävention aus der Sicht einer exemplarischen Psychoanalyse mit einem jungen Erwachsenen
2.1 Eine ungewöhnliche Abklärung und eine Reise um den Globus
2.2 Fragmente eines psychoanalytischen Prozesses und das Neuschreiben der eigenen Geschichte
2.3 Einige zusammenfassende Überlegungen zum Versuch einer Reintegration frühinfantiler Traumatisierungen im psychoanalytischen Prozess und zur spätadoleszenten Psychodynamik
3 Zur Psychoanalyse der Frühbeziehung – Frühe Objektbeziehungen, Affektregulation, Trauma
3.1 Strukturelle Ansätze („Klassische Ich-Psychologie“ bzw. „Triebtheorie“)
3.1.1 Das Strukturmodell von Sigmund Freud
3.1.2 Weiterentwicklungen des Strukturmodells in ich-psychologischen Ansätzen
3.1.3 Frühe emotionale Verwahrlosung, Trennung und Hospitalisation
3.1.4 Trieb und Kultur: Das epigenetische Entwicklungsmodell von Erik Erikson (1957)
3.1.5 Entwicklungslinien von Anna Freud: Das Hampstead Profile
3.1.6 Symbiose und Individuation: Ein Entwurf früher Entwicklungsaufgaben von Margret Mahler
3.1.7 Zusammenfassung
3.2 Objektbeziehungstheorien
3.2.1 Die Kleinianische Objektbeziehungstheorie
3.2.2 Unabhängige britische Schule (Independent British School)
3.2.3 Nordamerikanische Objektbeziehungstheorie
3.2.4 Zusammenfassung
3.3 Psychoanalytische Selbstpsychologie
3.3.1 Zusammenfassung
3.4 Säuglings-, Bindungs- und Mentalisierungsforschung
3.4.1 Zur empirischen Säuglingsforschung: Selbstentwicklung, Affektregulierung
3.4.2 Zur Sicht der empirischen Bindungsforschung auf die Frühentwicklung
3.4.3 Zur Entwicklung der Fähigkeit zu mentalisieren
3.4.4 Zusammenfassung
3.5 Anmerkungen zur französischen Psychoanalyse
3.5.1 Zusammenfassung
3.6 Zwischenbilanz: Frühentwicklung im Kaleidoskop pluraler Theorieansätze in der heutigen Psychoanalyse – Reichtum und Gefahr?
3.7 Zum Dialog zwischen Psychoanalyse und Neurowissenschaften: Trauma, Embodiment und Neuroplastizität, frühe Affektregulationsstörung und ADHS
3.7.1 Psychoanalytische und neurobiologische Traumaforschung
3.7.2 Embodiment und Neuroplastizität
3.7.3 Embodiment, frühe Affektregulationsstörungen und ADHS
3.7.4 Einige zusammenfassende Überlegungen und wissenschafstheoretische Anmerkungen – Der Dialog ist noch neu: Vorsicht mit übertriebenen Erwartungen ist geboten
4 Studien und Projekte zur Frühprävention
4.1 Frankfurter Präventionsstudie zur Verhinderung psychosozialer Integrationsstörungen (insbesondere von ADHS im Kindergartenalter)– Frühprävention als Stärkung der Resilienz gefährdeter Kinder
4.1.1 Kinder ohne Kindheit: Einführende Bemerkungen zu Anliegen und Intentionen der Frankfurter Präventionsstudie
4.1.2 Privilegierte Kindheiten versus Kinder ohne Kindheit: Ein gesellschaftliches Problem
4.1.3 Frankfurter Präventionsstudie: Ergebnisse der quantitativen Untersuchungen
4.1.4 „Verlorene Kindheiten“ und der Versuch, sie wiederzugewinnen
4.1.5 Zusammenfassung und Ausblick
4.2 FIRST STEPS – Ein Präventionsprogramm in einer multikulturellen Gesellschaft
4.2.1 Zum Hintergrund und zur Entstehung von FIRST STEPS
4.2.2 Zur Konzeption und Methodik des FIRST STEPS-Programms
4.2.3 Evaluation und ausgewählte Ergebnisse des FIRST STEPS-Programms
4.3 Einige Überlegungen zur Frühintegration und Pilotprojekt: ERSTE SCHRITTE – ein Integrationsprojekt für Kinder mit Migrationshintergrund
4.3.1 Vorarbeiten im Rahmen eines internationalen Workshops
4.3.2 Pilotprojekt: ERSTE SCHRITTE – ein Integrationsprojekt für Kinder mit Migrationshintergrund
5 Klinische Beispiele – Genutzte und verpasste Chancen von Frühprävention aus der Sicht exemplarischer Kindertherapien und von Psychoanalysen mit Erwachsenen
5.1 Einleitung – Zur Problematik von Fallgeschichten als wissenschaftliche Kommunikationsform
5.2 Zwei Fallbeispiele zur Illustration früher Affektregulationsstörungen bei einem Kind und einem jungen Erwachsenen
5.2.1 Einsichten aus einer Kinderanalyse aufgrund einer katamnestischen Nachuntersuchung 31 Jahre nach Abschluss der Behandlung
5.2.2 Das Ringen um Affektregulierung in einer Erwachsenenanalyse
5.2.3 Zusammenfassung
5.3 Trauma und Entwicklung: Robert – aus der psychoanalytischen Behandlung eines achtjährigen Jungen (Angelika Wolff)
5.4 Brandstifter und Feuerwehrmann – Aggressive Kinder in der Psychotherapie (Rose Ahlheim)
5.4.1 Zur Psychodynamik kindlicher Aggression
5.4.2 Zur Bedeutung der frühen Interaktionserfahrungen für die Ausbildung von Affektregulation und Empathie
5.4.3 Aggression als Suche nach dem Objekt
5.4.4 Aggression als Maskierung von Depression
5.4.5 Aggressives Agieren als Abwehr von Über-Ich-Angst – Destruktivität nach Zusammenbruch der Symbolfunktion
5.4.6 Aggressives Agieren bei strukturell unzureichender Symbolisierungsfähigkeit – als Abwehr von Abhängigkeitswünschen und Verlustangst
6 Zusammenfassende Überlegungen
6.1 Wissenschaftstheoretische und methodische Anmerkungen: Psychoanalytisch Forschen im Bereich der Frühentwicklung
6.2 Frühe Kindheit als Schicksal? Eine kurze inhaltliche Zusammenfassung
Literatur
Vorwort
Als Angehörige der sog. 68er-Generation hat mich in den letzten vierzig Jahren die Frage ständig begleitet, ob und in welcher Weise psychoanalytische Konzepte einerseits selbst durch gesellschaftliche Aktualitäten geprägt sind und wie sie andererseits fruchtbar in aktuelle gesellschaftliche Diskurse eingebracht werden können. Zu Zeiten von Alexander Mitscherlich, dem Begründer des Sigmund-Freud-Instituts (SFI), dessen hundertsten Geburtstag wir dieses Jahr feiern, schien es unbestritten, dass die psychoanalytische Sozialpsychologie den Auftrag hat, unbewusste Prozesse in aktuellen gesellschaftlichen Realitäten zu erkennen und zu deuten. Viele seiner bekanntesten Bücher waren diesem Anliegen gewidmet: „Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivität“ (1968), „Die Unfähigkeit zu trauern“ (1967), „Auf dem Weg zu einer vaterlosen Gesellschaft“ (1963), die „Unwirtlichkeit der Städte“ (1965), um nur einige zu nennen. Alexander Mitscherlich verstand sich vor allem als politische und öffentliche Persönlichkeit. Auch sein Nachfolger und der direkte Vorgänger des heutigen Direktoriums des SFI, Horst Eberhard Richter, teilte, wenn auch in anderer Form, dieses basale Verständnis eines gesellschaftlich engagierten Psychoanalytikers. Als Mitbegründer der „Ärzte gegen die Atomkraft“ erhielt er 1985 den Friedensnobelpreis, einer der Höhepunkt der Würdigung seines zeitkritischen Engagements.
Es ist nicht einfach, heute in stimmiger Weise diese Tradition aufzunehmen und sie mit neuen Aufgaben eines international anerkannten psychoanalytischen Forschungsinstituts zu verbinden. Anhand der in diesem Band geschilderten Forschungsprojekte mag exemplarisch der Versuch der neuen Leitung des SFI sichtbar werden, uns als psychoanalytische Kliniker, Theoretiker und Forscher in ein interdisziplinäres und internationales Netzwerk von Forschern einzubinden und uns gemeinsam um ein vertieftes Verständnis und einen möglichst differenzierten Umgang mit komplexen, gesellschaftlich drängenden Problemen zu bemühen. Die Frühprävention ist ein solches Forschungs- und Interventionsfeld. Psychoanalytiker, Neurowissenschaftler, Pädagogen und Soziologen sind sich darin einig, dass viele Weichen in der Entwicklung eines Menschen und seiner Persönlichkeit sehr früh gestellt werden. Die Zeichen stehen auf Sturm: die Schere zwischen den Gewinnern und den Verlierern von Globalisierung, Flexibilisierung, Migration und Wettbewerb klafft immer weiter auseinander. Einige Zahlen werden in diesem Band aufgeführt: jedes vierte Kind mit Migrationshintergrund verlässt die deutschen Schulen ohne Abschluss. Die Bereitschaft, Konflikte gewaltsam auszutragen, scheint zuzunehmen und ist vor allem bei immer jüngeren Kinder in allen Schichten der Bevölkerung zu beobachten. Diese Fakten sind alarmierend, besonders wenn wir an die enormen Chancen denken, frühe Entwicklungen zu fördern und nicht optimal verlaufende Startbedingungen in den ersten Lebensjahren zu korrigieren.
Am Sigmund-Freud-Institut haben sich daher in enger Kooperation mit dem Institut für Analytische Kinder- und Jugendpsychotherapie in den letzten Jahren psychoanalytische Studien zur Frühentwicklung und Frühprävention als einer der Forschungsschwerpunkte herausgebildet. Wir hoffen, durch sorgfältige wissenschaftliche und interdisziplinär angelegte Studien nicht nur das Wissen zu frühen Entwicklungsprozessen und Möglichkeiten der Förderung zu erweitern, sondern auch die politische Öffentlichkeit für die Notwendigkeit des Handelns zu sensibilisieren. Seit der Abgabe dieses Buchmanuskriptes wurde im Juni 2008 unser Forschungsantrag im Rahmen der Landes-Offensive zur Entwicklung Wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE) bewilligt, uns an einem interdisziplinären Forschungszentrum zur Untersuchung von Risikokindern (Centre für Research on Individual Development and Adaptive Education of Children at Risk) (IDeA) zu beteiligen. Das Sigmund-Freud-Institut wurde vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung und der Johann Wolfgang Goethe Universität als Kooperationspartner (Scientific Coordinator: Prof. Dr. Marcus Hasselhorn) angefragt, weil wir in der Frankfurter Präventionsstudie auch empirisch nachweisen konnten, dass sich unser professioneller, hoch spezialisierter Blick auf unbewusste Phantasien und Konflikte von Vorschulkindern lohnt, um ihre aggressiven, ängstlichen und hyperaktiven Symptome langfristig zu lindern und die psychische und psychosoziale Situation vieler dieser Risikokinder nachhaltig zu verbessern. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Rahmen unsere Studien zur Frühprävention, von denen in diesem Band berichtet wird, intensivieren und fortsetzen können.
Als Psychoanalytikerin und Wissenschaftlerin bedeuten die Studien im Bereich der Frühprävention für mich persönlich zudem eine Chance, meine klinischen Erfahrungen als praktizierende Psychoanalytikerin, meine Auseinandersetzung mit der Theorienvielfalt der heutigen Psychoanalyse und den damit verbundenen interessanten und komplexen wissenschaftstheoretischen und –-historischen Fragen sowie mein Engagement in vielen Formen der psychoanalytischen und interdisziplinären Forschung nochmals neu zu überdenken und zu integrieren. In diesem Buch spiegelt sich ein Teil dieses Integrationsversuchs, der oft frühere Arbeiten aufnimmt und weiterführt. Ich hoffe, dass diese Auseinandersetzung mit klinischen, konzeptuellen, empirischen und interdisziplinäre Annäherungen an frühe Entwicklungsprozesse das Interesse sowohl meiner psychoanalytischen Kolleginnen und Kollegen, als auch interdisziplinärer Gesprächspartner und von nichtpsychoanalytischen Fachleuten findet, die sich tagtäglich – professionell oder persönlich – mit kleinen Kindern beschäftigen. Ich denke dabei an neugierige und engagierte Eltern, Erzieher, Lehrer, Sozialpädagogen1 und andere Berufsgruppen in diesem Feld. Zudem hoffe ich sehr, dass sich die heranwachsende Generation von Fachleuten durch dieses Buch anregen lässt, Studierende, die sich näher mit Psychoanalyse befassen möchten und vielleicht sogar überlegen, sich selbst in diesem Gebiet zu qualifizieren. Wünschen würde ich mir natürlich auch, dass Politiker, die für den Bereich der frühen Sozialisation und Bildung zuständig sind, Zeit und Interesse finden, das eine oder andere Kapitel dieses Buches zu lesen. Die politische und gesellschaftliche Sensibilität, wie wichtig sich die frühen Entwicklungsprozesse für die individuelle, aber auch die psychosoziale Entfaltung und Integration erweisen, scheint mir erfreulicherweise trotz aller Ohnmachtgefühle und resignativen Einschätzungen politischer Zusammenhänge in den letzten Jahren zuzunehmen.
Noch kurz zur Konzeptualisierung dieses Bandes: Selbstverständlich weiß ich um die Schwierigkeit, sowohl Experten aus der eigenen Disziplin, ausgebildete und erfahrene Psychoanalytiker des Erwachsenen-, Jugend- und Kindesalters, als auch nicht psychoanalytische Fachleute und sogar interessierte Laien unterschiedlichster Altersgruppen ansprechen zu wollen. Ich hoffe nicht, mich dabei zwischen alle Stühle gesetzt zu haben. Ich versuchte in einer klar verständlichen Sprache zu schreiben, ohne auf ein Niveau der fachlichen Differenzierung und der Vermittlung der Komplexität von Phänomenen und deren Konzeptualisierungen zu verzichten. Zudem können alle einzelnen Kapitel des Buches für sich gelesen werden; jedes Kapitel enthält darüber hinaus am Schluss eine Zusammenfassung.
Nach einem einleitenden Kapitel wird in einem ausführlichen Bericht aus einer Psychoanalyse mit einem jungen Mann veranschaulicht, welche Chancen verpasst werden, falls Kindern in seelischer Not nicht rechtzeitig jene Hilfe und Unterstützung erhalten, die sie für ihre psychische Entwicklung benötigen (Kapitel 2). Die Falldarstellung mag illustrieren, dass wir als Psychoanalytiker nicht in Kategorien von „seelisch krank“ und „seelisch gesund“; „normaler“ und „pathologischer“ Entwicklung denken, wenn wir uns mit Fragen der Frühprävention befassen. Wir versuchen, einzelne Kinder oder Kindergruppen möglichst differenziert und in ihrer Einmaligkeit zu verstehen, für uns eine Voraussetzung für therapeutisches und pädagogisches Handeln sowie für kritische Reflexionen von gesellschaftlichen Realitäten. Wie in den Zusammenfassungen verschiedener theoretischer Modelle der heutigen pluralistischen Psychoanalyse zur Frühbeziehung (Kapitel 3) ersichtlich wird, geht es in einer psychoanalytischen Betrachtung immer um das Verständnis individueller Entwicklungsprozesse und ihrer unbewussten, persönlichen Determinanten im Spannungsfeld mit der jeweiligen psychosozialen und gesellschaftlichen Realität, in der sich Entwicklung vollzieht, und nicht um normative oder kategoriale Sichtweisen mit der bekannten Gefahr einer sozialen Stigmatisierung und Ausgrenzung. Auf die zu diesen Fragen stattfindenden grundlagenwissenschaftlichen Diskurse in der Sozialpsychologie oder Sonderpädagogik kann ich in diesem Rahmen nicht eingehen. Ich möchte mich darauf beschränken, einen Einblick in die Vielfalt heutiger psychoanalytischer Konzeptforschung zu frühen Entwicklungsprozessen zu vermitteln. Da ich bei meinen Studierenden immer wieder feststelle, dass sie Autoren der „klassischen“ psychoanalytischen Entwicklungstheorien, wie z. B. Anna Freud, Melanie Klein, René Spitz, Erik Erikson, Margret Mahler u. a. nicht mehr kennen, habe ich mich entschlossen, einige ihrer wichtigsten Beiträge nochmals zusammenzufassen und neueren Entwicklungstheorien kritisch gegenüberzustellen. Um den Erklärungsgehalt dieser Theorien zu illustrieren, wird immer wieder auf das ausführliche Fallbeispiel (Kapitel 2) oder klinische Beobachtungen aus der Frankfurter Präventionsstudie zurückgegriffen. Schließlich wird auf einen der heute meist beachteten Diskurse zur Frühentwicklung kurz eingegangen, den Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften (3.7).
Diese theoretischen Annäherungen an die Komplexität früher Entwicklungsprozesse bildet der Hintergrund für zwei exemplarische Studien im Bereich der Frühprävention, die in Kapitel 4 des Bandes kurz diskutiert werden und mit einigen Überlegungen zur frühen Integration von Migrationsfamilien verbunden werden, die in einem Workshop im März 2007 von internationalen Experten entwickelt wurden. Anhand von ausführlichen Berichten aus der kinderanalytischen Arbeit mit Kindern wird anschließend nochmals anschaulich gemacht, welches individuelle Leiden und welche Schwierigkeiten im familiären, institutionellen und gesellschaftlichen Bereich entstehen, wenn Kindern in Situationen, in denen ihre Entwicklung wegen für sie unlösbaren Konflikten gefährdet ist, nicht jene therapeutische (oder pädagogischer bzw. soziale) Hilfe zukommt, die sie brauchen (Kapitel 5). Schließlich werden im letzten Kapitel des Buches (Kapitel 6) die verschiedenen Annäherungen an frühe Entwicklungsprozesse zusammenfassend kurz in der Forschungslandschaft der heutigen Psychoanalyse verortet.
Ich danke als erstes meinen beiden kinderanalytischen Kolleginnen, Angelika Wolff und Rose Ahlheim, dass sie ihre eindrücklichen Falldarstellungen in diesem Band nochmals abdrucken.
Tamara Fischmann und Judith Vogel danke ich dafür, dass ich unsere gemeinsame Arbeit, die in der Zeitschrift „Psyche“ im Sommer 2008 erschienen ist2, in modifizierter Form auch in diesem Band publizieren kann. Schließlich danke ich der großen Gruppe der Mitforscher der Frankfurter Präventionsstudie (FP), die bereit waren, das Experiment dieser umfangreichen und anspruchsvollen „Feldstudie“ mit mir gemeinsam durchzuführen und zu einem guten Abschluss zu bringen. Gerald Hüther und Angelika Wolff haben die Studie mit mir zusammen geleitet. Verantwortlich für die Datenerhebung und das Design waren: Yvonne Brandl, Stephan Hau, und Bernhard Rüger; als psychologische und pädagogische Mitarbeiter beteiligten sich Lars Aulbach, Betty Caruso, Katrin-Marleen Einert, Oliver Glindemann, Gerlinde Göppel, Paula Hermann, Pawel Hesse, Jantje Heumann, Gamze Karaca, Julia König, Jochen Lendle, Alex Schwenk, Adelheid Staufenberg, Sibylle Steuber, Christiane Uhl, Judith Vogel, Christina Waldung, Lisa Wolff. Zudem engagierten sich Kinder- und Jugendlichentherapeuten des Instituts für Analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (IAKJP) als Therapeuten und/oder Supervisoren in der Studie. Ich danke ihnen – und allen beteiligten Erziehern – für ihr Engagement und ihre Mitarbeit. Die Studie wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Analytische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie durchgeführt. Eine besondere Chance war für uns, dass wir die Untersuchung im direkten Austausch mit den politisch für den Bereich „frühe Bildung“ Zuständigen hier in Frankfurt, der jetzigen Bürgermeisterin Jutta Ebeling und den Mitarbeiterinnen der Städtischen Schulamts, Monika Berkenfeld und ihrem Team durchführen konnten. Daher hatten wir die Fragen möglicher politischer Umsetzungen unserer Forschungsergebnisse ständig konkret vor Augen, ohne kaum direkt zu beeinflussende, gesamtgesellschaftliche Realitäten zu verleugnen. Dass die Stadt Frankfurt unsere Studie als Anregung für die Konzeptarbeit im Frühpräventionsbereich aufgenommen und die Mittel, die in diesen Bereich fließen, erhöht hat, ist mehr als wir zu erwarten wagten. Zudem freuen wir uns ganz besonders, dass wir dank der Unterstützung der Zinkann-Stiftung, der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, der Crespo Foundation, der Ursula Ströher-Stiftung, der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und der International Psychoanalytical Association eine Langzeitperspektive für die Umsetzung unserer Forschungsergebnisse entwickeln konnten. Für all diese Kooperationen und tatkräftigen Unterstützungen vielen Dank!
Besonders herzlich danken möchte ich Prof. Dr. Bernhard Rüger, der seit den 1990er-Jahren mir seine Kompetenz als Fachmann für Statistik in verschiedenen Studien zur Verfügung stellt und auch das Design der Frankfurter Präventionsstudie entworfen hat. Dr. Tamara Fischmann danke ich für die sorgfältige Auswertung der statistischen Daten. Prof. Dr. Rolf Pfeifer involviert mich seit fast drei Jahrzehnten in einen spannenden und für mich immer wieder neu herausfordernden Dialog mit der Embodied Cognitive Science. Frau Dr. med. Lotte Köhler danke ich sehr, dass sie Frau Prof. Dr. med. Martha Konkkon-Lehmann und mir dank eines Stipendiums der Köhler-Stiftung Darmstadt ermöglichte, den Dialog zwischen Psychoanalyse und Neurowissenschaften zu beginnen, als er noch keineswegs in Mode war. Herr Prof. Henri Parens, einer der erfahrendsten Experten im Bereich der Frühprävention aus Philadelphia, begleitet als Consultant unsere neuen Projekte. Auch dafür bin ich sehr dankbar.
Meinem Mitdirektor am SFI, Prof. Dr. Dr. Rolf Haubl, danke ich für die ganz besondere, kollegiale Zusammenarbeit; Dr. Heinrich Deserno und Dr. Tomas Plänkers für die fruchtbare Kooperation im Direktorium des SFI. Auch ohne die tagtägliche Unterstützung und Hilfsbereitschaft von Renate Stebahne könnte ich alle meine Forschungsprojekte kaum durchführen. Jeannette Kuhlewey half mir in kompetenter Weise, das Manuskript in die entsprechende Form zu bringen. Herbert Bareuther unterstützte mich bei der zeitaufwändigen bibliographischen Arbeit. Ihnen allen gilt mein herzlichster Dank!
Schließlich möchte ich meinen Analysanden danken, die mir durch ihr Vertrauen und ihre Bereitschaft, mich auf ihre Reisen ins Unbewusste mitzunehmen, zu jenen Erkenntnissen verhalfen, die ich in diesem Buch zu beschreiben und mitzuteilen versuche.
Marianne Leuzinger-Bohleber
Frankfurt am Main, im Dezember 2008
1 Der besseren Lesbarkeit wegen verwenden wir in diesem Text, sofern wir im Plural von Frauen (z. B. „Lehrerinnen“) und Männern (z. B. „Lehrer“) sprechen, im Folgenden (in der Regel) nur eine Geschlechterform.
2 Psyche, Juli 2008
1 Einleitung
„Ich schlug meine Tschechow-Ausgabe auf und mein Blick fiel auf die Zeile: ‚Wir werden Frieden finden. Wir werden den Engeln lauschen und den Himmel funkeln sehen vor Diamanten.‘Ich klappte das Buch zu und spürte, wie die Worte mir ins Blut schossen gleich einem Martini von Onkel Charlie. Ich hatte Frieden gefunden, ich hatte Engel gehört, und der Himmel war tatsächlich voller Diamanten – es schneite dicke fedrige Flocken, und in dem von Glaswänden umgebenen Laden kam ich mir vor wie in einer Schneekugel. Ich sah zu, wie der Schnee den Campus betupfte, trank einen Schluck Kaffee, hörte Mozart und sagte mir – warnte mich – das muss es sein. Glücklicher konnte ich nicht mehr werden. Ich stand kurz vor meinem Examen, ich bewarb mich an den juristischen Fakultäten, war wieder mit der Liebe meines Lebens zusammen. Und sogar meiner Mutter ging es besser...“ (S. 253), so schreibt J. R. Moehringer in „Tender Bar“, einem autobiographischen Roman eines jungen amerikanischen Schriftstellers, der sofort nach seinem Erscheinen zum Bestseller wurde. Liegt dies nicht nur an den literarischen Qualitäten des Romans, sondern auch an seinem Inhalt – einer schließlich doch noch gelingenden persönlichen Entwicklung eines Jungen, der bald nach seiner Geburt, vom Vater, „einem gewalttätigen Gauner“, ohne einen Pfennig Geld verlassen wird, in Armut und Elend aufwächst, sich für seine überforderte Mutter verantwortlich fühlt und eine ausgeprägte psychische Störung mit Zwangsgedanken und Panik entwickelt? Trotz all dieser katastrophalen psychischen und psychosozialen Bedingungen schafft er es schließlich, dank eines Stipendiums an der Yale University aufgenommen zu werden, seine Alkoholsucht zu überwinden und zu einem Schriftsteller zu werden. Eine neue Version des amerikanischen Mythos, dass in diesem Lande immer noch Tellerwäscher zu Millionären werden?
Nein, der Roman spielt eine andere Melodie: Der kleine Junge ohne richtigen Vornamen hat, wie es die Resilienzforschung inzwischen belegt, trotz aller Armut, Gewalterfahrungen und psychischem und psychosozialem Elend, in entscheidenden Situationen seiner frühen Kindheit bis hin zur Spätadoleszenz das Glück, tragfähige, positive Beziehungen zu erleben, die in seiner Seele das „Prinzip Hoffnung“ (Bloch) implementieren und aufrecht erhalten – trotz aller Verzweiflung, Enttäuschung und Desillusionierung: Seine Mutter liebt ihn und hält zu ihm in allen Lebenslagen – bei aller Rollenumkehr und psychischem Missbrauch. In der „Tender-Dickins-Bar“ findet er Ersatzväter, die ihn trotz Alkoholsucht und bizarren Biographien als „Junior“ adoptieren und seine Beichten zu den Aufs und Abs seines Lebens rau aber authentisch interessiert entgegennehmen – und er trifft in einem Buchlanden in Arizona zwei schrullige Buchhändler, die ihn in die Welt der Literatur einführen und ihn ermuntern, sich in Yale zu bewerben.
1.1 Frühprävention – eine der dringendsten gesellschaftlichen Aufgaben heute1
Junior wird nicht Millionär oder einer der Topgewinner einer globalisierten Wirtschaft, aber er findet – als Reporter einer renommierten Zeitung – schließlich seinen Platz in der Gesellschaft, ohne in Kriminalität oder Alkoholismus abzurutschen. In literarisch eindrücklicher Form gestaltet Möhringer unsere klinisch-psychoanalytische Erfahrung, dass es manchmal solche stimmigen Beziehungserfahrungen sind, die gefährdeten Kindern dazu verhelfen, ohne dass sie die familiären oder gesellschaftlichen Realitäten ändern können, einen Rest an Vertrauen in Andere, sich selbst und eine eigene Zukunft seelisch aufrecht zu erhalten. Dank eines rudimentären Verständnisses von Gewalt und Trauma können sie ihre resilienten Fähigkeiten stärken. Solche Erfahrungen legten wir – neben Ergebnissen der Resilienzforschung – als Hoffnung der Frankfurter Präventionsstudie zugrunde, denn ohne ein Stück Hoffnung, vielleicht sogar einen Schuss Omnipotenz und Selbstüberschätzung, hätten wir uns nicht an das Forschungsexperiment gewagt, dessen Ergebnisse in diesem Buch in einen breiteren theoretischen, institutionellen und gesellschaftlichen Kontext gestellt werden. Was soll schon eine wissenschaftliche Studie angesichts von gesellschaftlichen Entwicklungen ausrichten können, die bekanntlich die Schere zwischen Armen und Reichen immer weiter auseinanderdriften lässt, zwischen Kindern, denen alles offen steht und solchen, deren Schicksal schon beim Eintritt in die Schule besiegelt scheint. Gewalt, soziale Desintegration oder aber Depression, Sucht und andere Formen der psychischen Resignation gehören zu ihren Folgen, wie z. B. die Studie von Freyberg und Wolff zu nicht beschulbaren Jugendlichen so eindrücklich belegt hat (v. Freyberg und Wolff, 2004). Die untersuchten Jugendlichen wurden im Alter von 13–15 Jahren „ausgeschult“, weil sie wegen ihres gewalttätigen und dissozialen Verhaltens in allen verfügbaren Bildungsinstitutionen „nicht mehr tragbar waren“. Für die betroffenen Jugendlichen bedeutete dies eine Katastrophe: Der Weg in die Kriminalität, Drogensucht oder andere schwere psychopathologische oder psychosomatische Entwicklungen schien vorgezeichnet. – Welch’ eine Kapitulation unserer Bildungsinstitutionen!
Auch diese Studie warf – wie „Tender Bar“ – die Frage auf, ob man solche desolaten Entwicklungen von Kindern hätte verhindern, oder mindestens abmildern können, wenn den Kindern und ihren Familien schon im Kindergartenalter die Hilfe angeboten worden wäre, deren sie so dringend bedurften. Stuart Hauser (2006), ein amerikanischer Forscher und Psychoanalytiker, hat Ergebnisse einer Studie publiziert, in der 150 extrem gewalttätige Kinder, die im Alter von 5–17 Jahren in einer psychiatrischen Institution untergebracht waren, als Spätadoleszente – zwischen 20 und 30 – sorgfältig nachuntersucht worden waren. Seine Ergebnisse entsprechen den Schilderungen im Roman von J.R. Moehringer: Zwar haben die meisten der behandelten Kinder problematische Karrieren genommen: sie wurden kriminell, drogensüchtig oder in anderer Weise schwer psychisch krank. Doch – entgegen der Erwartung von Fachleuten – haben sich immerhin 9 der 16 genauer untersuchten, ehemals schwer gewalttätigen Kinder erstaunlich gut entwickelt. Detaillierte Analysen ihrer Lebensgeschichten zeigten, dass diese Kinder (wie Junior) – im Gegensatz zu den Biographien der anderen – mindestens eine verlässliche, gute Beziehungserfahrung (zu einer Oma, einer Nachbarin, einer befreundeten Familie) machen konnten. Diese positiven Beziehungserfahrungen schienen für diese Kinder eine Quelle der Hoffnung und ein Schutz gegen Aufgeben und Resignation geworden zu sein, ein Gegengewicht zu den vorherrschenden Erfahrungen von Gewalt und schweren Traumatisierungen, denen sie jahrelang ausgeliefert gewesen waren.
Als wir die Frankfurter Präventionsstudie planten, von der in Kapitel 4 dieses Bandes berichtet wird, pflegten wir die Hoffnung, dass es uns im Rahmen dieser auch noch so beschränkten Studie gelingen könnte, für einige Kindern ein helles Fenster in ihrem düsteren kindlichen Alltag zu öffnen, vor allem durch die Unterstützung der Erzieherinnen und Eltern, aber auch durch unsere Mitarbeiterinnen oder – in Einzelfällen – durch analytische Kinder- und Jugendlichentherapeutinnen.
Allerdings war uns als Psychoanalytiker gleichzeitig immer bewusst, dass wir Kindern bestenfalls helfen könnten, den Mut nicht zu verlieren, sich der Welt der Erwachsenen zuzuwenden und für sich selbst eine lebenswerte Zukunft zu erhoffen. Das Leiden an ihren fehlenden Kindheiten und den teilweise unerträglichen Realitäten ihres Lebensalltags sollte dadurch nicht verleugnet oder bagatellisiert werden. Dies ist in der Tat eine gewisse Gefahr beim Gebrauch des Begriffs „Resilienz“, wie in Kapitel 2 diskutiert werden wird. So zeigten z. B. Henry Massie und Nathan Szajnberg (2006) in ihrer eindrücklichen Studie auf, dass sich Spuren von psychischem und physischem Missbrauch und Gewalterfahrungen auch bei jenen Erwachsenen finden ließen, die sich – nach den Kriterien der Resilienzforschung – erstaunlich positiv entwickelt hatten. Die beiden Autoren führten nach 30 Jahren eine Nachuntersuchung jener ehemaligen Säuglinge durch, die Sylvia Brody und Sidney Axelrad in den 1960er-Jahren untersucht hatten. Sie schreiben zusammenfassend: „Resilienz könnte dafür ein vordergründiges Konzept sein. In dieser Fallreihe, scheinbar angemessener Bewältigungsstrategien, vormals misshandelter Kinder, war der Preis immer eine besonders emotionale Verletzlichkeit und ein beeinträchtiges Potenzial...“ (S. 471)
Ein weiteres Ziel der Frankfurter Präventionsstudie war es wissenschaftlich nachzuweisen, dass sich Prävention lohnt, auch wenn oft viele der pathogenen Faktoren in Familie, Institution und Gesellschaft nicht verändert werden können. Selbstverständlich möchten wir dadurch nicht von der Notwendigkeit politischen Handelns ablenken – im Gegenteil: Wir hoffen, durch die konkreten Beobachtungen und Ergebnisse der Studie auf die akut drohende Desintegration und Gewaltentwicklung hinzuweisen und auch einige der politischen Verantwortlichen etwa durch Schilderungen konkreter Fallbeispiele zu erreichen und sie in der Einsicht zu bestärken, wie wichtig Frühprävention ist und wie sehr sich Anstrengungen zur Verbesserung von Bildungsinstitutionen lohnen.
Als Beispiel der eben erwähnten krasser werdenden Unterschiede zwischen heutigen Kindheiten kurz eine Illustration von zwei (deutschen) Kindern aus unserer Studie:
Marion ist die fünfjährige Tochter eines Lehrerehepaars, die beide ihren Beruf ausüben. Die Großeltern mütterlicherseits leben in der Nähe und übernahmen vormittags die Kinderbetreuung bis zum Eintritt in die Kindertagesstätte, als die Mutter nach dem Jahr Mutterschutz ihre Tätigkeit als Grundschullehrerin wieder aufnahm. Marion hat einen um zwei Jahre älteren Bruder. Sie wirkt auf die Erzieherinnen und die Projektmitarbeiterin wie ein Kind, das „auf der Sonnenseite dieser Welt geboren wurde“, voll von Lebensfreude, Zuversicht, Phantasie, Kreativität und Neugier. Sie hat viele Freundinnen und Freunde, mit denen sie ihre Zeit in der Kita teilt: Sie ist eine begabte Zeichnerin, erzählt gerne Geschichten und Witze, und turnt gerne. Den Erzieherinnen fällt sie durch die ihre Heiterkeit, ihre große Einfühlung und ihre sozialen Fähigkeiten auf. In Konflikten kann sie sich gut durchsetzen und ihre Gefühle, auch Ärger und Enttäuschung, direkt ausdrücken. Marion hat, aus psychoanalytischer Sicht, aufgrund tragfähiger, einfühlsamer früher Objektbeziehungen eine sichere Bindung entwickeln können, wie wir aus vielen Studien wissen, ein zentraler protektiver Faktor für die weitere Entwicklung. Marion gehört zu den Kindern, die es wahrscheinlich – historisch gesehen gerade in einem Land wie Deutschland – so gut haben wie kaum Kinder je zuvor. Sie wachsen mit Eltern auf, die sich – dank ihrer Persönlichkeit und aufgrund ihrer Bildung – sowohl durch Einfühlung in kindliche Bedürfnisse, durch Wissen um Merkmale und Charakteristika der frühkindlichen Entwicklung und ihrer Manifestationen sowie -dank ihrer eigenen inneren und äußeren Situation – durch die Fähigkeit zur „reifen Elternschaft“ ausweisen.
Lisa (4,5 Jahre) lebt in der gleichen Stadt, doch ihre Kindheit sieht ganz anders aus. Sie hat eine ältere und eine jüngere Schwester. Alle Kinder haben unterschiedliche Väter. Derzeit lebt ein neuer Freund der Mutter in der Familie. Zum leiblichen Vater besteht wenig Kontakt, obwohl das Kind ihn häufig erwähnt und ihn in der Phantasie idealisiert. Die Mutter ist Sozialhilfeempfängerin und hat immer wieder verschiedene Jobs. Die Herkunftsfamilie der Mutter ist ebenfalls lange beim Jugendamt bekannt. Es gab in der Vergangenheit schon die Drohung des Kindesentzuges (für den Bruder der Mutter) aufgrund eines Verdachts auf sexuellem Missbrauch. Die Mutter äußert daher, sie habe schlechte Erfahrungen mit Ämtern. Lisa fällt durch große Distanzlosigkeit auf. Sie nimmt sofort körperlichen Kontakt auf, umarmt und herzt Erwachsene. Nach Aussagen der Mutter verhält sie sich außerhalb der Kita genau gegenteilig. Sie hat große Ängste, schon bei kleineren Ereignissen, z. B. im Einkaufszentrum, bei wenigerMetern Entfernung von der Mutter beginnt sie zu weinen und völlig hilflos zu wirken. In der Kita fällt auf, dass sie inzwischen keine Freundinnen mehr hat. Sie stört meist andere Kinder beim Spiel und versucht nur mit den Erwachsenen zu spielen. Sie ist dabei schnell frustriert und reagiert aggressiv, vor allem Schwächeren gegenüber. Beim Spiel selbst fällt es ihr schwer, sich länger auf etwas zu konzentrieren, sie ist auch motorisch sehr unruhig und wird von den Erzieherinnen als „hyperaktiv“ bezeichnet. Am meisten erschreckt die Erzieherinnen, dass sie entdeckt haben, dass sich Lisa zuweilen mit einem Messer in den Arm schneidet, das Blut aufleckt und äußert, es schmecke ihr gut...
Lisa ist eines der Kinder unserer Studie, das dringend sozialpädagogische und psychotherapeutische Hilfe brauchte. Wie viele Studien zu geschlechtsspezifischen, psychopathologischen Entwicklungen zeigen, scheint es nicht zufällig, dass sie – ein Mädchen – schon im frühen Alter den Weg in psychische und psychosomatische Symptome wählt, während Jungs häufiger aggressiv und sozial destruktiv werden.
Vor der seelischen und psychosozialen Situation von Kindern wie Lisa die Augen nicht zu verschließen, ist – dies sei wenigstens kurz angemerkt – nicht nur für Lisa und ihre Familie selbst entscheidend. Bekommt sie die Hilfe, die sie benötigt, hat dies auch eine Auswirkung auf die gesamte Atmosphäre in der Kita. Kinder, Erzieherinnen und Eltern werden konkret erfahren, dass jemand Hilfe bekommt, der sie braucht – exemplarisch eine Erfahrung von Humanität und Einfühlung, statt Gleichgültigkeit, Resignation und individuellem und kollektivem Wegschauen! Gerade die Betroffenen selbst scheinen sehr präzise wahrzunehmen, welche Kurz- und Langzeitfolgen das Wegschauen und Verleugnen von Problemen hat. Auch wissenschaftliche Untersuchungen von so genannten „high-risk-families“ belegen, dass chronische Erfahrungen von Gewalt und Verwahrlosung (z. B. gewalttätige Väter, Missbrauchserfahrungen, Zeugenschaft häuslicher Gewaltszenen etc.) zu einer asozialen Entwicklung bei den Heranwachsenden führen. Diese Phänomene treten gehäuft bei jenen Familien auf, die sich – etwa bedingt durch Langzeitarbeitslosigkeit – am Rande der Gesellschaft befinden und sich oft mit ihrem Schicksal abgefunden zu haben scheinen. Sie haben resigniert und vermitteln ihren Kindern, dass sie auch für sie kaum mit einer besseren Zukunft rechnen. Allerdings verdient gleichzeitig die beunruhigende Beobachtung von Lehrern und Erziehern unsere Aufmerksamkeit, dass die Entwicklung von Gewaltbereitschaft und -handlungen nicht mehr auf Kinder aus diesen „high-risk-Milieus“ beschränkt werden kann, sondern in beunruhigender Weise auch bei Kindern aus sog. „normalen Verhältnissen“ bzw. bei anderen „Risikogruppen“ (z. B. bei Scheidungskindern, Kindern aus multikulturellen Familien etc.) zu beobachten ist. Eine weitere irritierende Beobachtung von Praktikern ist, dass immer jüngere Kinder bereit scheinen, ihre Konflikte gewaltsam auszutragen und sich dabei gegenseitig ernsthaft zu verletzen. Dies ist auch deshalb alarmierend, weil verschiedene Studien, vor allem aus dem Bereich der empirischen Bindungsforschung, darauf hingewiesen haben, dass die Wahrscheinlichkeit, antisoziales Verhalten beizubehalten, um so größer ist, je jünger die Kinder sind, bei denen Verhaltensauffälligkeiten auftreten. Zeigen sich schon bei Dreijährigen massiv aggressiv-destruktive Verhaltensweisen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie später zu jenen 3 % der Jugendlichen gehören werden, die das gefährliche Gewaltpotential in unserer Gesellschaft ausmachen werden (vgl. Fonagy, 2007). Fonagy spricht von einem „violent attachment pattern“, das diese Kinder in Identifikation mit ihrem gewalttätigen Aggressor entwickelt haben und was sie – in grausamen Wiederholungszwang – oft dazu bringt, als Adoleszente oder Erwachsene selbst gewalttätig oder gar zu Mördern zu werden.
Als Psychoanalytikerin denke ich bei solchen Phänomenen vor allem an die betroffenen Kinder und ihre Zukunft. Doch handelt es sich nicht nur um ein individuelles, sondern gleichzeitig um ein institutionelles und gesellschaftliches Problem höchster Priorität.
Karl Lauterbach (2007) schreibt in seinem vor kurzem erschienenen Buch „Der Zweiklassen Staat. Wie die Privilegierten Deutschland ruinieren“: „In keinem Land in ganz Europa hängen die Bildungsergebnisse... so sehr vom Einkommen der Eltern ab wie in Deutschland ... Der Hauptunterschied zu den Vereinigten Staaten besteht darin, dass wir dies bestreiten, weil wir es eigentlich falsch finden, während die Amerikaner solche Unterschiede in großen Teilen für richtig halten. Wir wähnen uns in einer Gesellschaft, die die Ideale der Chancengleichheit und der sozialen Gerechtigkeit verwirklicht hat, und der Staat hilft, diese Fiktion zu erhalten.
Es ist eine Schande: Statt für einen gerechten Ausgleich zu sorgen, vergrößert der deutsche Staat die Kluft zwischen Arm und Reich. Intelligente Kinder aus armen und bildungsfernen Familien haben – bei gleicher Leistung – eine vielfach geringere Chance, aufs Gymnasium zu kommen und zu studieren. Deutschland ist nicht nur ungerechter, als wir wahrhaben wollen, sondern auch schutzlos den Herausforderungen des demographischen Wandels und der Globalisierung ausgesetzt. Es ist ein kinderarmes Land, das bei der Integration versagt, seine Talente zum großen Teil verschwendet und seine Sozialsysteme bald nicht mehr bezahlen kann...“ (S. 5). Auch vor diesem Hintergrund werden der Umgang mit Zuwanderern, mit Migranten und ihre Integration in unsere Gemeinschaft wesentlich über unsere Zukunft entscheiden.
1.2 Migrantenschicksale – immer noch ein dunkler Fleck in unserer Wahrnehmung
Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern und den USA scheinen viele Menschen in Deutschland nach wie vor zu verleugnen, dass Deutschland schon lange ein Einwanderungsland ist und die Integration der ausländischen Kinder zu einer der vordringlichsten gesellschaftlichen Aufgaben geworden ist.
Es ist bekannt, dass Migrantenkinder in unseren Bildungsinstitutionen besonders benachteiligt sind. Mittlerweile erhält nur noch jeder Vierte von ihnen einen Ausbildungsplatz – mit sinkender Tendenz.
Die im Dezember 2007 veröffentlichten Ergebnisse der neuen PISA-Studie (Programme for International Assessment) des Jahres 2006 haben gezeigt, dass Deutschland im Vergleich mit den ersten beiden PISA-Studien (2000 und 2003) vor allem bezüglich der Schulleistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern deutlich aufholen konnte; es belegt nun Rang 8 unter den 30 OECD-Ländern und Rang 13 unter allen 57 teilnehmenden Ländern. Bezüglich der Lesekompetenz und auch im Fach Mathematik befindet sich Deutschland allerdings weiterhin im Mittelfeld (Rang 18 bzw. 20). Allerdings bleibt weiterhin alarmierend, dass bezüglich ihrer Lesekompetenz Kinder aus Migrantenfamilien in Deutschland dramatisch schlechter abschneiden: Kinder, deren beide Eltern im Ausland geboren sind, erzielen 93 Punkte weniger in den Testergebnissen als Kinder deutscher Eltern (bei einem Mittelwert von 495 Punkten unter allen Kindern). Dieser Abstand entspricht ungefähr einem Schulwissen von 2,5 Jahren. Wie in kaum einem anderen Land Europas scheint in Deutschland die Integration von Einwanderungsfamilien zu scheitern. Eine wesentliche Ursache dafür ist (wie auch die PISA-Studien bestätigt) mangelnde Sprachkenntnisse und hier vor allem der Faktor, ob und wie stark Deutsch als innerfamiliäre Sprache bereits im Vorschulalter der Kinder ausgeübt wird. Wie in diesem Band diskutiert werden soll, ist eine über diesen Sprachfaktor hinausgehende Ursache für eine fehlende oder mangelhafte Frühintegration dieser Kinder der Bindungsfaktor zwischen Mutter und Kleinkind und die spezifische, durch Migration hervorgerufene Störung dieser „natürlichen“ Bindung mit ihren Folgen für die Entwicklung des Kindes.
Migration wird in verschiedenen psychoanalytischen Arbeiten als ein schockartiger Verlust von kulturellen Sinnsystemen und des eigenen Halts in der Ursprungskultur beschrieben. Es gibt unterschiedlich kreative Umgangsweisen damit, z. B. das Ausbilden einer bi-kulturellen Identität oder einer multiplen, hybriden oder gemischten Identität. „Ein Schlüsselmoment tritt im Familienkreis mit der Geburt einer neuen Generation ein, wenn selbst die kreative Balance zwischen Fortsetzung und Unterbrechung der kulturellen Identität in Frage gestellt wird. Eltern z. B. stellt sich die Frage, wie sie ihren Kindern ihre Kulturen näher bringen oder kurz gesagt, wie mit der Veränderung oder dem bevorstehenden neuen Leben einer „bi-kulturellen Identität“ anhaftende Stärken und Schwächen plötzlich konfliktträchtiger werden. Wir betrachten dies als einen Aspekt, der im Zusammenhang allgemeiner Immigrationsprozesse steht“. (Meurs, 2006, S. 269).
Daher scheint es kein Zufall, dass sich viele Konflikte von Migrantenfamilien gerade im Bildungsbereich manifestieren und sich zu einem immer ernster werdenden gesellschaftlichen Problem entwickeln, denn sie betreffen einen zunehmend großen Teil der Bevölkerung in westlichen Ländern wie Deutschland. Zudem ist eine nicht gelingende Integration eine Hauptursache nicht nur für das Scheitern von Bildungswegen, sondern auch für Jugendarbeitslosigkeit, Dissozialität und Kriminalität.
Was verstehen wir unter „Migrationsfamilien“?
Unter dem Begriff „Bevölkerung mit Migrationshintergrund“ werden alle Personen erfasst, die entweder seit 1950 auf das heutige Gebiet der BRD selbst zugewandert sind (Personen mit eigener Migrationserfahrung), alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit mindestens einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil. Dazu einige aktuelle Zahlen (aus „Migration und Bevölkerung“, beruhend auf Daten des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden, zusammengestellt von Prof. Dr. B. Rüger, 20082):
In Deutschland leben 15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund (18,6 % der Bevölkerung), darunter 7,3 Millionen Ausländer und 8,0 Millionen Deutsche. Unter den 15,3 Millionen gibt es 10,4 Millionen Personen mit eigener Migrationserfahrung (5,6 Mio. Ausländer und 4,8 Mio. Deutsche). In vielen Großstädten liegt der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund bei 30–40 %. Darüber hinaus ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund deutlich jünger als die Gesamtbevölkerung. In der für uns besonders wichtigen Altersgruppe der unter 5-Jährigen gehört ein Anteil von 33 % zu Kindern mit Migrationshintergrund, in vielen Großstädten liegt dieser Anteil sogar deutlich über 50 %, in sechs Großstädten sogar über 60 % (z. B. in Nürnberg: 67 %, Frankfurt/Main: 65 %, Düsseldorf: 64 %). Eine wichtige Ursache dafür ist (neben dem Ehegatten- und Familiennachzug) die in den letzten Jahrzehnten anhaltend deutlich niedrigere Geburtenrate der Deutschen ohne Migrationshintergrund im Vergleich zur Population mit Migrationshintergrund.
Bei Kindern aus Migrantenfamilien bündeln sich oft die Nachteile: Die Eltern scheinen wenig Interesse an Bildung überhaupt, sowie an der Bildung ihrer eigenen Kinder zu haben. Oft gehören sie zu der sozialen Unterschicht, sind arm, leiden an vielfältigen sozialen Problemen und verfügen nur über rudimentäre Sprachkenntnisse. Übereinstimmend stellen daher Experten fest, dass korrigierende, supportive Maßnahmen Migrantenkinder so früh wie möglich erreichen sollten, denn die meisten zeigen schon bei Schuleintritt kaum mehr auszugleichende Defizite (z. B. bezüglich des Spracherwerbes, aber auch der sozialen Kompetenzen). Vorgeschlagen werden verpflichtende Sprachkurse für Eltern, Krippenbetreuung, verbindlicher Kindergartenbesuch (mit besser ausgebildeten Erzieherinnen) sowie die Einführung einer ganztägigen Pflichtvorschule.
Daher richten sich Integrationsmaßnahmen, wie wir sie in der FP versuchten, oder wie sie im FIRST STEP-Programm aus Belgien praktiziert werden (vgl. Kapitel 4) auch auf Migrantenfamilien, denn sie stellen keine „Minderheit“ mehr dar, sondern einen in eine Mehrheit hineinwachsenden Anteil unserer Bevölkerung.
So war eines der Ziele FP, Kinder aus Migranten- und anderen sozial benachteiligten Familien in der ersten Bildungsinstitution zu erreichen, die von den meisten hier in Deutschland in Anspruch genommen wird: die Kindertagesstätten. Wir wussten zwar schon vor Beginn der Studie, dass wir in einer multikulturellen Stadt leben. Als wir jedoch die konkrete Integrationsaufgabe, die diese Einrichtungen tagtäglich leisten, wirklich zu Gesicht bekamen, bekam dieses Wissen eine andere Gegenwärtigkeit und Realität. So waren in einer Einrichtung mit 108 Kindern Kinder aus 24 Nationen vertreten – nur vier waren Deutsche und hier aufgewachsen. – Wir brauchten drei arabische Dolmetscherinnen, als wir unsere Studie am Elternabend vorstellten. In einer anderen Einrichtung stammen 80 % der Kinder aus muslimischen Familien. Erstaunlich viele ihrer Mütter sind zum Islam übergetreten und verfolgen die Regeln dieser ihnen ursprünglich fremden Religion, so die Kitaleiterin, oft rigider als die Frauen, die in einer muslimischen Kultur aufgewachsen sind. Sie besuchen die Moscheen – werden aber oft dort als Fremde wahrgenommen. Aus einer psychoanalytischen Perspektive kann nur vermutet werden, in welch große Identitätskonflikte diese Frauen geraten: Sie gehören weder der einen noch der anderen Kultur wirklich an!
Die psychische und psychosoziale Situation der Mütter und Väter entscheidet weitgehend über die Startchancen ihrer Kinder – in der eigenen oder einer fremden Kultur. Alle verschiedenen psychoanalytischen Schulen stimmen darin überein, dass der menschliche Säugling als „psychophysiologische Frühgeburt“ zur Welt kommt und daher existenziell davon abhängt, wie er von seinen primären Beziehungspersonen in Empfang genommen wird. Biologisch angelegt, öffnet sich kurz nach der Geburt bei der Mutter (aufgrund der hormonellen und psychosozialen Krise) ein Zeitfenster für ein großes Bedürfnis nach Unterstützung und Anlehnung, nach Austausch über die tausend kleinen Alltagsprobleme mit einem Neugeborenen und nach Beratung, um der lebenswichtigen Funktion, die sie für ihren Säugling zu übernehmen hat, adäquat entsprechen zu können. Sie ahnt, dass in diesen ersten Tagen und Wochen, die Weichen sowohl für die Anbahnung der frühen Mutter-Kind-Beziehung als auch für wesentliche Richtungen der psychischen und psychosozialen Entwicklung ihres Babys gestellt werden.
Diese psychobiologische Situation kann nun unserer Meinung nach für eine früheste Prävention genutzt werden. So bietet sich z.B. bezogen auf die eben erwähnte Gruppe von Migrantinnen, daher in der Zeit kurz nach der Geburt eine einzigartige Chance, sie mit Angeboten zu erreichen, die ihre Wünsche nach „belonging-to“, nach Aufgenommensein und Zugehörigkeit aufnehmen, dabei die besonderen Probleme des Isoliertseins in einem fremden Gastland ernst nehmen und Hilfe anbieten, dass das Neugeborene gut gedeihen kann. Der Wunsch und das Interesse an einer möglichst guten Entwicklung des Kindes können bei einem solchen Angebot als erste und bedeutsame Gemeinsamkeit von Migranteneltern und der Gesellschaft des Gastlandes fungieren und sinnvoll für eine frühe Integration genutzt werden. Gerade Mütter, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat (und meist auch ihre Familie) verlassen haben, fühlen sich in dieser Zeit einsam, ziehen sich besonders leicht depressiv zurück oder klammern sich an ihr Baby und fühlen sich doch selber schutzbedürftig. Gleichzeitig sind die meisten Mütter (Eltern) nach der Geburt ihres Kindes von dem Wunsch getragen, die bestmöglichen (sozialen) Bedingungen für ihren Säugling zu schaffen. Oft nehmen daher sogar Mütter und Väter aus den so genannten „Hoch-Risiko-Familien“ in dieser Zeit Hilfsangebote an, die sie sonst vermeiden würden, eine Chance, die wir in einem Anschlussprojekt der FP zu nutzen versuchen (wie übrigens auch das Projekt von Cierpka und seinen Mitarbeitern, das eben in Offenbach begonnen hat).
Wie viele Studien aus dem Bereich der empirischen Säuglingsforschung, der Bindungsforschung und der Psychoanalyse belegen, sind tragende emotionale Beziehungserfahrungen im ersten Lebensjahr die beste Voraussetzung für eine gelingende psychische, kognitive und psychosoziale Entwicklung einschließlich des Spracherwerbs. So entwickelt sich z.B. die Art des empirisch messbaren „Bindungstyps“ auf der Basis der kontinuierlichen, wichtigsten Beziehungserfahrungen mit den Primärobjekten im Laufe des ersten Lebensjahres. Sicher gebundene Kinder zeigen – verglichen mit den unsicher gebundenen Kindern – schon im Kindergarten ein kreativeres Problemlösungsverhalten, sind weniger häufig in aggressiv-destruktive Konflikte verwickelt und haben mehr Freunde. Es ist davon auszugehen, dass sich sicher gebundene Migrantenkinder auch besser in die fremde Kultur integrieren, neugieriger sein können und daher ein ausgeprägteres Explorationsverhalten zeigen – auch gegenüber der Andersartigkeit und der Sprache des Gastlandes – als unsicher gebundene Kinder. Urvertrauen begründet am Ende des 1. Lebensjahres beobachtbar ein „Liebesverhältnis mit der Welt“. Bindungsforscher beschreiben einen zentralen Antagonismus zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten. Erlebt ein Kind in einer Gefahrensituation Angst, aktiviert es sein Bindungssystem und sucht Schutz und Nähe bei seiner Bindungsperson. Es stellt sofort sein Explorationsverhalten ein. Erst wenn es sich wieder sicher fühlt, kann es sein Lern- und Explorationsverhalten wieder aufnehmen. Wie psychoanalytische Erfahrungen und Konzepte schon seit langem zeigen: Erfolgreiches Lernen kann nur aufgrund einer basalen äußeren und inneren Sicherheit (aufgrund tragender, sicherheitsspendender Beziehungen) erfolgen.
Dabei hat sich gezeigt, dass die Empathie der Mütter (bzw. der wichtigsten Bezugsperson des Säuglings) die wichtigste Variable ist, die Mütter von Kindern mit einem sicheren Bindungstyp von jenen mit unsicher gebundenen Kindern unterscheidet. Empathie ist eine menschliche Fähigkeit, über die die allermeisten Menschen – auch Neugeborenen gegenüber – verfügen. Allerdings ist diese Fähigkeit ausgesprochen störungsanfällig: Stress, Krankheit, Überforderung – oder auch ein Gefühl des Alleingelassenseins und der Isolation – beeinträchtigten als erstes die einfühlenden Fähigkeiten. Daher setzen verschiedene Frühpräventionsprojekte an dieser Stelle an und versuchen, die Bedingungen zu optimieren, die es jungen Migrantenfamilien, besonders den Müttern, erleichtern, eine „genügend gute“, empathische Beziehung zu ihrem Säugling zu entwickeln, um dadurch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sich eine tragende emotional-kognitive Basis in der Seele des Kindes entwickelt (vgl. Kapitel 4: Zwei exemplarische Frühpräventionsprogramme).
So wichtig die früheste Mutter-Kind-Bindung ist: Gerade für Migranteneltern ist es nach aller Erfahrung schwer und mit starken inneren und äußeren Konflikten verbunden, wenn im zweiten Lebensjahr die wachsenden Explorationsimpulse Separation signalisieren. Trennung ist besonders für Migranten der ersten Generation und für Flüchtlinge ein hochempfindsames, Konflikt beladenes Thema. Separation und Individuation sind zugleich psychische Entwicklungsprozesse, die wesentlich kulturell geprägt sind und stark differieren können. Diese zu begleiten, die unausweichlich aufkommenden Konflikte sorgfältig zu beobachten, und unter Einbeziehung der unterschiedlichen Kulturen zwischen Mutter-Kind-Konflikten (im Dienste der Entwicklung des Kindes) einerseits und interkulturellen oder Migrationskonflikten der Eltern andererseits unterscheiden zu lernen, und bis zum Alter von drei Jahren und dem Eintritt der Kinder in den Kindergarten – auf dem Weg zu einem guten Selbstgefühl, zur Anerkennung von Fremdheit, zu angemessenem Umgang mit Aggression und zur Integration – zu begleiten, gehört ebenfalls zu den Aufgaben früh ansetzender Präventionsangebote.
So wichtig und notwendig solche frühesten Angebote sind, so selten erreichen sie bis heute jene Familien, die sie am dringendsten benötigen. Oft sind die Kindertagesstätten die ersten Bildungsinstitutionen in Frankfurt, die Kontakt zu einem Großteil aller Eltern ermöglichen. Daher konzentrierte sich die FP auf ein Präventionsangebot in diesen Einrichtungen, wohl wissend, dass wir auch schon bei Dreijährigen kein Tabula rasa bezüglich ihrer seelischen und psychosozialen Situation vorfinden werden, sondern sich die frühen Beziehungserfahrungen schon in charakteristischer Weise niedergeschlagen haben. Allerdings zeigen sowohl zahlreiche Erfahrungen aus psychoanalytischen Kindertherapien als auch aus empirischen Studien, dass in diesem frühen Lebensalter mit einer – verglichen mit Therapien von Erwachsenen – geringen Aufwand, noch sehr viel zu erreichen ist. Sowohl die kindliche Seele als auch das kindliche Gehirn verfügen, wie wir heute wissen, über erstaunliche Entwicklungsfähigkeiten und die tröstlich anmutende Potenzialität, schlechte Beziehungserfahrungen durch bessere zwar nicht zu vergessen, aber doch weitgehend zu kompensieren. Dazu kommt, dass das Zeitfenster für solche produktiven Entwicklungen möglichst optimal genutzt werden sollte, wie sich in der schlichten Volksweisheit schon Jahrhunderte lang ausdrückt: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr...“ (vgl. dazu auch 1.4).
1.3 Zur Psychoanalyse der Frühbeziehung
Daher befasst sich das erste Unterkapitel des Theorieteils III dieses Buches mit den frühen Objektbeziehungserfahrungen. Die Psychoanalyse befindet sich heute bekanntlich in einem Stadium des Pluralismus von Theorien und Behandlungstechniken, was einerseits ein großer Reichtum bedeutet, komplexe Phänomene wie die emotionale, kognitive und soziale Frühentwicklung von verschiedenen konzeptuellen Perspektiven zu beleuchten. Gleichzeitig ist diese Theorienvielfalt – besonders für Nichtpsychoanalytiker – verwirrend und kann den Eindruck eines eklektischen Durcheinanders vermitteln, in dem man oft vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen bekommt. So hoffe ich, dass durch die knappe Zusammenfassung einiger der relevantesten Theorieentwicklungen der heutigen Psychoanalyse ein erhellender Einblick in aktuelle Annäherungen an die Frühentwicklung gegeben werden kann und die darin enthaltenen Konvergenzen und Divergenzen für den Leser erkennbar werden. Um die Lektüre interessanter zu machen, werden die verschiedenen Theorien der Frühentwicklung immer wieder auf ein ausführliches Fallbeispiel bezogen, auf die Zusammenfassung einer Psychoanalyse mit einem jungen Erwachsenen, dessen offene Gewalt als Jugendlicher u. a. in Zusammenhang mit seinen traumatischen Erfahrungen in seinen ersten Lebensjahren stand (Kapitel 2).
Trotz aller Theorienvielfalt stimmen alle psychoanalytischen Autoren in einem Punkt überein: die ersten Beziehungserfahrungen legen das Fundament einer kreativen oder aber auch einer pathologischen Persönlichkeitsentwicklung. Zu analogen Einschätzungen gelangt nun auch die moderne Hirnforschung, eine weiterere Informationsquelle bei der Reflexion von Frühpräventionen in diesem Buch.
1.4 Embodiment und Neuroplastizität
So berücksichtigten wir bei der Konzeptualisierung der FP interdisziplinäre Überlegungen aus dem aktuellen Dialog zwischen der Psychoanalyse und den Neurowissenschaften, einem Dialog, der im Freud-Jahr auf großes Interesse gestoßen ist. Für die Planung der FP war entscheidend, dass neuere Studien aus dem Bereich der Hirnforschung und der Neurobiologie die psychoanalytische Auffassung in neuer Form bestätigen, wie entscheidend die ersten Beziehungserfahrungen für den menschlichen Säugling sind und in vielerlei Hinsicht die Weichen stellen. Dies ist sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht. Einerseits sind diese frühen Erfahrungen, wie schon die beiden o.e. kurzen Fallbeispiele illustrieren, prägend und legen das psychische, kognitiv-affektive und psychosoziale Fundament: Kinder mit unsicheren Bindungsmustern haben es sowohl bezüglich ihrer intellektuellen, affektiven und sozialen Entwicklung weit schwerer als Kinder, die das Privileg hatten, aufgrund „genügend guter Beziehungserfahrungen“ eine sichere Bindung zu entwickeln. Allerdings – und dies ist die gute Nachricht – sind gerade in den ersten Lebensjahren dank der enormen Neuroplastizität des Gehirns und der Empfänglichkeit der kindlichen Seele für korrigierende emotionale Erfahrungen die Chancen gut, Fehlentwicklungen noch korrigieren zu können, und zwar je früher, desto besser!
Dazu sollen in diesem Buch einige Überlegungen angestellt werden, die allerdings in diesem Rahmen fragmentarisch ausfallen müssen.
Ich selbst kenne den Austausch mit Neurowissenschaftlern aus meinem jahrzehntelangen Dialog mit Forschern der sog. „Embodied Cognitive Science“, die in faszinierender Weise die Thesen des Psychoanalytikers Alfred Lorenzer bestätigen, der bereits in den 1980er-Jahren postulierte, dass soziale Erfahrungen schon während der Schwangerschaft und in den ersten Wochen danach „verleiblichen“, d.h. sich im neuronalen Netzwerk, dem primären und sekundären Repertoir, wie Gerald Edelman dies nennt, niederschlagen (vgl. dazu Kapitel 7.2.3).
Zu analogen Erkenntnissen kommen Studien zur Neuroplastizität des Gehirns. Um nur einleitend ein Beispiel herauszugreifen: In manchen Gebieten, z. B. bezogen auf die Entwicklung des Sehens, existieren sogar sog. „kritische Perioden“. Werden Babys zwischen der 3. und 8. Lebenswoche visuell nicht stimuliert, entwickeln sie keine normale Sehfähigkeit (vgl. Huble und Wiesel, nach Doidge, 2007, S. 51). Dies ist die eine Botschaft, die im Hinblick auf Frühprävention sehr ernst genommen werden sollte. Die zweite Botschaft ist neu und aufregend. Seit etwa 20 Jahren entdecken die Hirnforscher vermehrt die enorme Neuroplastizität des Gehirns: In anderen Worten können problematische, einschränkende Sozialisationserfahrungen bzw. deren Niederschlag im Gehirn durch entsprechend intensive Alternativerfahrungen korrigiert werden. Dies gelingt umso besser, je jünger das Gehirn ist. Ein entscheidendes Experiment, das die Neuroplastizität des Gehirns „bewies“, stammte von dem Forschungsteam Merzenich, Paul und Goodman (1972). Merzenich schnitt die medianen Nervenfasern der Mittelhand eines Affen durch3. Nach zwei Monaten entdeckte er, wie erwartet, dass die Hirnregion, die Signale der medialen Nervenfasern verarbeiten sollte, nicht auf Stimuli der Mittelhand reagierte. Doch machte er eine erstaunliche Entdeckung: „Als er über die Außenseite der Hand des Affen strich – die Region, die ihre Signale durch die Nerven der Speiche und der Elle weitergeleitet werden – da reagierten die medianen Nerven. Die Karten im Gehirn, die für die Nervenleitung der Speiche und Elle zuständig waren, hatten ihre Größe fast verdoppelt und sich auf die mediane Karte des Gehirns ausgedehnt. Zudem waren diese Karten topographisch. Zu jener Zeit nannten Mezernich und Kass diese Veränderungen ‚spektakulär‘ und verwandten das Wort ‚Plastizität‘, um die Veränderungen zu beschreiben. Allerdings setzten sie den Ausdruck in Anführungszeichen.
Das Experiment demonstrierte, dass, falls der mediane Nerv unterbrochen wurde, andere Nerven, die den elektrischen Reiz immer noch erhielten, den ‚unbenutzen Platz‘ in der Karte des Gehirns übernahmen und dort ihren Input verarbeiteten. In Konkurrenz um die Verarbeitungskapazität des Gehirns, schienen die Karten im Gehirn in einer Art Wettbewerb zu stehen und dem Prinzip zu folgen: ‚Benutze es oder verliere es‘ (,use it or lose it‘).
Die kompensatorische Natur der Plastizität geht uns alle etwas an. Es scheint ein endloser Krieg zwischen den Nerven in unserem Gehirn stattzufinden. Falls wir aufhören, mentale Fähigkeiten zu trainieren, vergessen wir sie nicht einfach: der Platz, der dafür in den entsprechenden Karten zur Verfügung steht, wird von anderen Fähigkeiten in Anspruch genommen, die aktiv sind.
Diese kompetitiven Prozesse erklären auch, warum es so schwierig ist, schlechte Gewohnheiten aufzugeben bzw. ‚umzulernen‘. Viele von uns denken immer noch, das Gehirn sei eine Art Behälter, in dem Gelerntes aufbewahrt wird. Wenn wir versuchen, eine schlechte Gewohnheit aufzugeben, denken wir, die Lösung sei, etwas anderes über diese gespeicherte Fähigkeit (in der entsprechenden Karte im Gehirn) zu legen. Aber jedes Mal, wenn wir diese Gewohnheit wiederholen (um sie durch eine bessere zu ersetzen), beansprucht sie erneut die Kontrolle über die entsprechende Karte im Gehirn und verhindert dadurch, dass der Platz, der für Neues zur Verfügung stehen könnte, produktiv – im Sinne einer Veränderung des Verhaltens – genutzt werden kann. Dies ist ein Grund, warum Umlernen oft sehr viel schwieriger ist als das Lernen und auch, warum die frühe Kindheit so entscheidend ist. Es ist das Beste, das Richtige gleich zu lernen und damit zu verhindern, dass es in Konkurrenz mit ‚schlechten Gewohnheiten‘ gelangt, die, wie eben skizziert, einen bestimmten Vorteil aufweisen.“ (S. 59/60, Übersetzung Leuzinger-Bohleber).
Das nächste Experiment machte Mezernich berühmt. Er amputierte den Mittelfinger eines Affen: „Nach einigen Monaten untersuchte er den Affen erneut und stellte fest, dass jene Karte im Gehirn, die für den amputierten Fingen zuständig war, inzwischen verschwunden war. Die Karten der angrenzenden Finger waren in jene Gehirnregion, die ursprünglich für den Mittelfinger verantwortlich war, hineingewachsen. Dies demonstrierte sehr präzise, dass Gehirnkarten dynamisch sind und es einen Wettbewerb um reale Gehirnregionen gibt, sowie dass die Ressourcen im Gehirn nach dem Prinzip ‚Nutze es oder verliere es‘ (,use it or lose it‘) vergeben werden“. (S. 60, Übersetzung M. L.-B.)
Daher legen sowohl das Konzept des Embodiments als auch die eben erwähnten Studien zur Neuroplastizität des Gehirns nahe, dass frühe Präventionen, besonders falls sie mit intensiven Beziehungserfahrungen verbunden sind, negative, ja vermutlich sogar traumatische Erfahrungen mit den ersten Bezugspersonen zwar nicht löschen, aber doch weitgehend durch neue, bessere Erfahrungen in ihrem negativen Einfluss auf aktuelles Denken, Fühlen und Handeln unterbrechen bzw. abmildern oder im besten Falle sogar kompensatorisch ausgleichen können. Daher bietet Frühprävention – nach Auffassung von Forschern sowohl aus dem Gebiet der Embodied Cognitive Science, der neurobiologisch orientierten Hirnforschung, als auch aus der Psychoanalyse und der empirischen Säuglings- und Bindungsforschung – enorme Chancen, die sowohl individuell als auch institutionell und gesellschaftlich genutzt werden sollten.
Solche Überlegungen führten uns übrigens, wie wir dies in anderen Zusammenfassungen der FP bereits ausführlich diskutiert haben (vgl. Leuzinger-Bohleber, Fischmann und Staufenberg, 2006), zu einer skeptischen Einstellung sowohl gegen modische Einheitsdiagnosen wie AD/HS als auch gegen dessen medikamentöse Behandlung durch Ritalin und andere Amphetamine. Zwar kann eine medikamentöse Behandlung nach sorgfältiger fachärztlicher Abklärung in Einzelfällen durchaus indiziert sein, vor allem um eine eskalierende psychosoziale Situation zu unterbrechen. Doch ist als Nachteil zu bedenken, dass das hochwirksame Medikament die individuellen psychosozialen Ursachen der aktuellen Anpassungsstörung des Kindes verdunkelt und dem verstehenden Zugang verschließt. So wird kaum mehr festzustellen sein, ob ein bestimmtes Kind mit seinem unaufmerksamen, hyperaktiven Verhalten auf eine akute oder erlittene Traumatisierung reagiert, manisch einen Verlust einer wichtigen Bezugsperson abwehrt, das Aufwachsen mit einer depressiven Mutter zu bewältigen versucht, als Hochbegabtes Langeweile überspielt, gegen eine ihm fremde Pädagogik protestiert oder wirklich ein hirnorganisches Problem zum Ausdruck bringt. Ritalin hat bei all diesen verschiedenen Kindern den erwünschten Effekt: es wird sozial nicht mehr auffallen, es gliedert sich „störungsfrei“ ein.
Zudem scheint uns eine langfristige Medikamentenvergabe sowohl psychisch als auch hirnphysiologisch eine der wichtigsten Entwicklungschancen zu vergeben, nämlich die Erfahrung, dass ein Kind – aus eigener Kraft bzw. mit Unterstützung ihm zugewandter Bezugspersonen – lernt, mit seinen vorhandenen (psychischen und hirnphysiologischen) Problemen kompensatorisch umzugehen. Dadurch wird weder die (seelische) Resilienz noch die Neoplastizität des Gehirns für eine kompensatorische, produktive Entwicklung des Kindes genutzt. Stattdessen wird es in sein Selbstbild einbauen, dass es für sich und seine Umwelt nur erträglich ist, „wenn es das Medikament geschluckt hat“. Sobald die Wirkung des Medikaments nachlässt, kommt die eigene Unfähigkeit, Affekte, Sinneseindrücke und Phantasien produktiv zu steuern und zu kontrollieren, wieder zum Vorschein. Zugespitzt formuliert nehmen wir dadurch dem Aufwachsenden die Möglichkeit, sukzessiv zum Herrn oder zur Frau seines eigenen Hauses zu werden.
Solche kompensatorischen seelischen und hirnphysiologischen Veränderungen können, so der bisherige Stand des Wissens, allerdings nur durch intensive, emotionale Erfahrungen, z. B. im Rahmen einer (therapeutischen) Einzelbetreuung oder eines intensiven Trainings erreicht werden (vgl. dazu u. a. Doidge, 2007). Doch haben wir versucht zu diskutieren, dass auch die weniger intensiven „Bausteine“ unseres Präventionsprogramms sinnvolle Angebote darstellen. Einmal erreichten sie die Gesamtheit aller Kinder und nicht nur die eben erwähnten, ca. 3 % extrem gefährdeter Kinder mit einem „violent attachment pattern“ (Fonagy, 2007). Alle Kinder, aus verschiedenen familiären und kulturellen Milieus, brauchen empathische Zuwendung, Verständnis, Förderung ihrer individuellen Begabung und psychosoziales Lernen. Die Supervisionen, die wöchentliche Arbeit der Psychologinnen und Pädagoginnen in den Kindertagesstätten, die Elternarbeit sowie das Gewaltpräventionsprogramm FAUST-LOS sowie die Einzeltherapien bei den besonders bedürftigen Kindern führten zu statistisch signifikanten Veränderungen bei der Interventions- verglichen mit der Kontrollgruppe, wie wir unter 4.1 näher ausführen werden.
1.5 Übersicht über das Buch
Oft ist es die intensive klinische Erfahrung mit einzelnen Analysanden, die Psychoanalytiker dazu bringt, sich die Frage zu stellen, ob – beim frühen Erkennen von Fehlentwicklungen in den ersten Lebensjahren – die Weichen hin zu jahrelangem Leiden und hin zu schweren psychopathologischen Störungsbildern hätte verhindert werden können. Wissenschaftlich ist diese Frage bekanntlich nicht zu beantworten. Dennoch sind die klinischen Beobachtungen oft so überzeugend, dass sich mindestens eine „Sicherheit“ einstellt: Frühprävention lohnt sich!
Diese These möchte ich einleitend mit einer Zusammenfassung einer Psychoanalyse mit einem jungen Erwachsenen illustrieren, der zu jenen Adoleszenten gehörte, die sich einer gewalttätigen, rechtsradikalen Gruppe anschließen, Gruppen, die zu Recht Angst und Besorgnis bei uns auslösen und die Eisbergspitze von psychosozialer Desintegration darstellen (Kapitel 2). Die Psychoanalyse erhellte die komplexen Faktoren in der Frühsozialisation von Herrn A., die möglicherweise sowohl seine adoleszente Gewaltbereitschaft als auch seine Fähigkeit, die Chance zu nutzen, sich aus der gewalttätigen Gruppe zu lösen, mitdeterminierten. So dient uns dieses exemplarische Fallbeispiel im folgenden Theorieteil III immer wieder als Illustration des Erklärungsgehalts verschiedener psychoanalytischer Theorien zur Entwicklung in den ersten Lebensjahren.
In Kapitel 4 werden anschließend zwei evaluierte Projekte der Frühprävention vorgestellt und in Kapitel 5 mit ausführlichen Fallbeispielen illustriert. In Kapitel 6 werden abschließend die verschiedenen Zugangsweisen zur Frühprävention in der heutigen Forschungslandschaft der Psychoanalyse verortet und kurz mit einigen wissenschaftstheoretischen und methodischen Anmerkungen verbunden.
1 In der Einleitung beziehe ich mich u. a. auf einen modifizierten Vortrag, der demnächst erscheinen wird (Leuzinger-Bohleber, Fischmann, Vogel, im Druck)
2 Ich danke Prof. Rüger, Angelika Wolff, Claudia Burkhardt-Mussmann und in anderer Weise Heike Schmoll für die gemeinsame Arbeit an einem Forschungsantrag an die Hertie-Stiftung, aus dem einige der folgenden Überlegungen stammen.
3 Ich kann in diesem Rahmen nicht auf die komplexen ethischen Fragen von Tierversuchen (speziell mit Primaten) eingehen, vgl. dazu u. a. Doidge, 2007.
2 Klinischer Einstieg – Verpasste Chancen von Frühprävention aus der Sicht einer exemplarischen Psychoanalyse mit einem jungen Erwachsenen
Es ist selten, dass gewalttätige Jugendliche eine psychoanalytische Behandlung aufsuchen. Auch Herr A. hatte selbst aus dem rechtsradikalen, fremdenfeindlichen und offen gewalttätigen „Clan“ herausgefunden, aber für seinen Kampf gegen offene Gewalt nach außen einen großen persönlichen Preis gezahlt, nämlich den Verlust eines tragenden Identitätsgefühls sowie des Zugangs zu seiner eigenen Emotionalität, der Welt seiner Sehnsüchte und Wünsche und – damit verbunden – den Verlust der Erfahrung von Nähe und Verbundenheit mit anderen Menschen. Dies war der Grund, warum er sich als junger Erwachsener schließlich für eine Psychoanalyse entschloss. Doch warfen die Einsichten in die Lebensgeschichte dieses 28-jährigen Spätadoleszenten viele Fragen auf, die in diesem Buch diskutiert werden sollen: Hätte die kriminelle Entwicklung der Brüder von Herrn A. durch geeignete Frühpräventionen verhindert werden können und wie? Warum konnte sich Herr A. aus eigener Kraft aus der gewalttätigen, rechtsradikalen Gruppe herauslösen und seine Brüder nicht? Welchen Einfluss spielte das Migrantenschicksal des Vaters bei der Entwicklung der Söhne? Etc.
Die folgende, fragmentarische Zusammenfassung des vier Jahre dauernden psychoanalytischen Prozesses mag, so hoffe ich, einen Eindruck davon vermitteln, welch großen therapeutischen Aufwand es im Erwachsenenalter bedarf, um Einsichten in Traumatisierungen und dadurch bedingte Fehlentwicklungen in den ersten Lebensjahren zu gewinnen und – im besten Falle – ansatzweise zu korrigieren. Mit diesem klinischen Einstieg wird auf die individuellen und gesellschaftlichen Chancen von Frühpräventionen verwiesen.