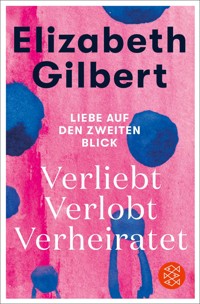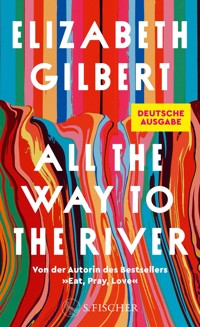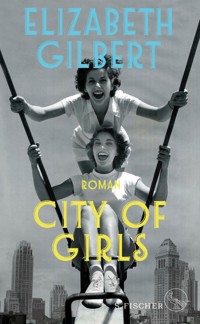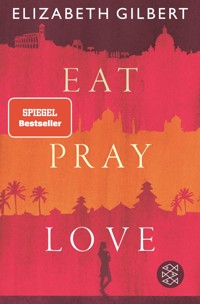12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das umwerfende Debüt von Elizabeth Gilbert, Autorin der Weltbestseller »Eat Pray Love« und »City of Girls« Als Elizabeth Gilberts Debüt erschien, war es der verblüffende Auftritt einer großen neuen Erzählerin. Ihr Erzählband (auf Deutsch ursprünglich unter dem Titel »Elchgeflüster« veröffentlicht) wurde mit dem Pushcart Prize ausgezeichnet, stand auf der Shortlist des PEN/Hemingway Awards und machte deutlich: Hier schreibt eine neue Stimme, von der noch viel zu erwarten sein wird. Mittlerweile ist Elizabeth Gilbert Autorin von Weltbestsellern wie »Eat Pray Love« und »City of Girls« – doch ihre frühen Erzählungen beeindrucken immer noch mit ihrer Pointiertheit, Schärfe und Komik. In ihnen geht es um Esther, die sich als Zauberin mit Wellensittich-Tricks versucht. Um Jean, die in den Bergen von Wyoming dem Flüstern der Elche lauscht. Und um Denny Brown, fünfzehn Jahre alt, der wirklich nicht viel weiß, außer dass er dabei ist, sich in seine Nachbarin zu verlieben. Sie alle lieben vergeblich, treffen die falschen Entscheidungen, werden enttäuscht. Und doch sind ihre Leben erfüllt von kleinen Geheimnissen, überraschenden Begegnungen und unerwarteten Wundern. »Diese Erzählungen haben die Leuchtkraft von Blitzen und sind schneidend wie Rasiermesser.« Annie Proulx
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Elizabeth Gilbert
Die vielen Dinge, die Denny Brown nicht wusste
Stories
Über dieses Buch
Als Elizabeth Gilberts Debüt erschien, war es der verblüffende Auftritt einer großen neuen Erzählerin. Ihr Erzählband (auf Deutsch ursprünglich unter dem Titel »Elchgeflüster« veröffentlicht) wurde mit dem Pushcart Prize ausgezeichnet, stand auf der Shortlist des PEN/Hemingway Awards und machte deutlich: Hier schreibt eine neue Stimme, von der noch viel zu erwarten sein wird. Mittlerweile ist Elizabeth Gilbert Autorin von Weltbestsellern wie »Eat Pray Love« und »City of Girls« – doch ihre frühen Erzählungen beeindrucken immer noch mit ihrer Pointiertheit, Schärfe und Komik.
In ihnen geht es um Esther, die sich als Zauberin mit Wellensittich-Tricks versucht. Um Jean, die in den Bergen von Wyoming dem Flüstern der Elche lauscht. Und um Denny Brown, fünfzehn Jahre alt, der wirklich nicht viel weiß, außer dass er dabei ist, sich in seine Nachbarin zu verlieben. Sie alle lieben vergeblich, treffen die falschen Entscheidungen, werden enttäuscht. Und doch sind ihre Leben erfüllt von kleinen Geheimnissen, überraschenden Begegnungen und unerwarteten Wundern.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Elizabeth Gilbert, geboren 1969, wuchs auf einer Weihnachtsbaumfarm in Connecticut auf. Nach dem Studium in New York arbeitete sie u. a. als Journalistin für die »New York Times« und begann, Bücher zu schreiben. Das »Time Magazine« wählte sie unter die hundert einflussreichsten Menschen der Welt. Der internationale Durchbruch kam 2006 mit ›Eat Pray Love‹, einem Weltbestseller, in dem die Hauptfigur Elizabeth auf Weltreise geht und zu sich selbst findet: Dolce Vita in Italien, Meditation in Indien und das Glück auf Bali. 2010 wurde ›Eat Pray Love‹ mit Julia Roberts in der Hauptrolle verfilmt. Nach »Big Magic« (2015) erschien 2019 ihr Roman »City of Girls«, der wochenlang auf der New York Times-Bestsellerliste stand. Elizabeth Gilbert lebt in New Jersey.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel »Pilgrims« bei Houghton Mifflin, New York
© 1997, Elizabeth Gilbert
Die deutschsprachige Ausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Titel »Elchgeflüster« im Wilhelm Goldmann Verlag, München.
Copyright der deutschen Übersetzung von Helga Schulz:
© 1999, 2009 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Penguin Random House GmbH
Für diese Ausgabe:
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hißmann Heilmann Hamburg
Coverabbildung: Angie Kenber / Bridgeman Images, Berlin
ISBN 978-3-10-491675-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Wanderer
Elchgeflüster
Alice auf dem Weg nach Osten
Ein guter Schütze
Tall Folks
Landung
Dumme Gören
Die vielen Dinge, die Denny Brown nicht wusste
Die Namen von Blumen und Mädchen
Beim Bronx Terminal Vegetable Market
Der berühmte Zigarettentrick
Die wunderbarste Frau
Mit viel Liebe für Mom und Dad
Wenn milder Regen, den April uns schenkt,
Des Märzes Dürre bis zur Wurzel tränkt
Und badet jede Ader in dem Saft,
So dass die Blume sprießt durch solche Kraft;
Wenn Zephyr selbst mit seinem milden Hauch
In Wald und Feld die zarten Triebe auch
Erweckt hat und die Sonne jung durchrann
Des Widders zweite Sternbildhälfte dann,
Wenn kleine Vögel Melodien singen,
Mit offnen Augen ihre Nacht verbringen
– So stachelt die Natur sie in der Brust –:
Dann treibt die Menschen stark die Wallfahrtslust …
GEOFFREY CHAUCER: DIE CANTERBURY TALES
Wanderer
Als mein Alter sie einstellte, fragte ich: »Ein Mädchen?« Ein Mädchen, wo es doch noch gar nicht lange her war, dass eine Frau auf dieser Ranch noch nicht mal als Köchin arbeiten konnte, weil es unter den Cowboys ihretwegen zuviel Schießereien gab. Selbst wenn es sich um hässliche Köchinnen handelte. Oder um alte.
»Ein Mädchen?«, fragte ich.
»Sie ist aus Pennsylvania«, sagte mein Alter. »Sie wird ihre Sache gut machen.«
»Wo ist sie her?«
Als das mein Bruder Crosby rausbekam, erklärte er: »Zeit für mich, mir einen neuen Job zu suchen, wenn meine Arbeit jetzt schon ein Mädchen macht.«
Mein Alter sah ihn nur an: »Ich hab gehört, du bist in dieser Saison noch nicht einmal über den Dutch-Oven-Pass gekommen und hast weder auf deinem Pferd geschlafen noch ein einziges gottverdammtes Buch gelesen. Vielleicht ist es überhaupt an der Zeit, dass du dich nach einer neuen Arbeit umsiehst.«
Er erzählte uns, dass sie irgendwie aus Pennsylvania mit der elendsten Dreckkarre, die er je gesehen hatte, hier aufgetaucht war. Sie bat ihn um fünf Minuten, um ihn nach einem Job zu fragen, aber so lange hat das gar nicht gedauert. Sie hielt ihm ihren Arm hin, um ihn ihre Muskeln fühlen zu lassen, aber das war gar nicht notwendig. Er sagte, sie habe ihm sofort zugesagt. Er vertraue da seinen Augen nach all den Jahren.
»Sie wird dir auch gefallen«, sagte er. »Sie ist so sexy wie ein Pferd. Schön groß ist sie. Und stark.«
»Hast doch selber fünfundachtzig Pferde zu füttern und denkst noch immer, dass Pferde sexy sind«, entgegnete ich, und mein Bruder Crosby meinte: »Ich denke, von dieser Art ›sexy‹ haben wir hier herum wohl genug.«
Sie hieß Martha Knox, war neunzehn Jahre alt und ebenso groß wie ich, besaß kräftige, aber keine dicken Beine, trug Cowboystiefel, die sie gerade erst diese Woche gekauft hatte, wie jeder sehen konnte – die billigsten, die zu haben waren, und überhaupt das erste Paar, das sie besaß. Sie hatte ein starkes Kinn, das nur in Bewegung kam, wenn sich auch ihre Stirn und ihre Nase bewegten, und ihre Zähne waren von der Art, die das ganze Gesicht beherrscht, selbst wenn der Mund geschlossen ist. Und vor allem hatte sie einen dunkelbraunen Zopf, der dick wie ein Mädchenarm mitten an ihrem Rücken herunterhing.
An einem Abend am Anfang der Saison tanzte ich mit Martha Knox. Wir hatten einen freien Tag, um den Berg runterzumarschieren, uns zu betrinken, zu telefonieren, unsere Wäsche zu erledigen und uns zu raufen. Martha Knox war keine gute Tänzerin. Sie wollte überhaupt nicht mit mir tanzen. Das machte sie mir klar, indem sie mir ein paarmal sagte, dass sie nicht mit mir tanzen werde, und als sie es dann schließlich doch tat, wollte sie nicht von ihrer Zigarette lassen. Sie hielt sie in der Hand und ließ den Arm runterbaumeln, so dass er nicht greifbar war. Also behielt ich meine Bierflasche in der Hand, um das auszugleichen, und wir fassten uns nur jeder mit einem Arm. Sie war keine gute Tänzerin, und sie wollte überhaupt nicht mit mir tanzen, aber wir fanden immerhin zu einem schönen langsamen Wiegen miteinander; dabei hatte jeder von uns einen Arm runterhängen, so wie der rechte Arm der Cowboys beim Rodeo oder wie der rechte Arm der Stierreiter, der ins Nichts greift. Sie blickte fortwährend über meine linke Schulter und nirgendwo anders hin, so als wäre sie auf den Teil von sich, der sie mit mir zur guten Tänzerin machte, noch gar nicht gestoßen und wollte ihn auch gar nicht näher kennenlernen.
Mein Alter urteilte über Martha Knox: »Sie ist nicht schön, aber sie versteht sich zu verkaufen.«
Na ja, es stimmte schon, dass ich gern ihren Zopf in der Hand halten wollte. Immer schon hatte ich das vor, gleich als ich ihn das erste Mal sah, und vor allem bei diesem Tanz, aber ich griff nicht danach, und ich stellte auch meine Bierflasche nicht ab. Martha Knox vergab sich nichts.
Wir haben an diesem Abend nicht noch einmal getanzt und auch sonst nicht; es war eine lange Saison, und mein Alter ließ uns alle viel zu hart arbeiten. Es gab dann keine vollen Tage mehr zum Tanzen und Raufen. Und wenn wir mitten in einer harten Woche manchmal wirklich einen Nachmittag frei hatten, gingen wir alle lieber in die Baracke und schliefen; einen festen, totenähnlichen Schlaf in unseren Kojen, in Stiefeln, wie Feuerwehrmänner oder Soldaten.
Martha Knox fragte mich nach Rodeos. »Crosby meint, es ist eine gute Art, zu Tode zu kommen«, sagte sie.
»Die beste, die ich kenne.«
Wir saßen uns bei einem niedrigen Holzfeuer gegenüber, nur wir beide, und tranken. In dem Zelt hinter Martha Knox befanden sich fünf Jäger aus Chicago, sie waren müde oder schliefen schon, wütend auf mich, weil ich es nicht fertiggebracht hatte, sie zu so guten Schützen zu machen, dass sie auch nur einen der Elche erlegen konnten, die wir die Woche über gesehen hatten. In dem Zelt hinter mir waren die Kochherde und die Nahrungsmittel und zwei Schaumstoffkissen mit Schlafsäcken für jeden von uns. Sie schlief unter Pferdedecken, weil das wärmer war, und wir beide betteten uns auf den Jeans, die wir am nächsten Tag anziehen wollten, damit sie dann nicht gefroren waren. Es war Mitte Oktober, die letzte Jagd der Saison; jeden Morgen, wenn wir die Pferde sattelten, hing ihnen der Reif in langen Nadeln von den Mäulern.
»Bist du betrunken?«, fragte ich sie.
»Ich will dir was sagen«, erwiderte sie, »das ist eine verdammt gute Frage.«
Sie sah auf ihre Hände. Sie waren sauber. Trotz all der zu erwartenden Schnittwunden und Verbrennungen waren es saubere Hände.
»Du hast an Rodeos teilgenommen, stimmt’s?«, fragte sie.
»Ja, leider einmal zu oft«, antwortete ich.
»Auf Stieren?«
»Auf Broncos.«
»Nennen sie dich deswegen Buck?«
»Ich werde Buck genannt, weil ich mir als Kind mit einem Jagdmesser ins Bein gestochen habe.«
»Hat’s dich beim Rodeo schon mal erwischt?«
»Als ich an einem Abend dieses Bronco bestieg, wusste ich sofort, gleich als es losging, dass es mich nicht wollte. Es wollte mich zum Teufel schicken, weil ich’s mit ihm versucht hab. Ich bin noch nie auf einem Pferd so in Panik geraten wie auf diesem Bastard.«
»Glaubst du, es wusste Bescheid?«
»Bescheid? Wie konnte es das?«
»Crosby meint, das erste, was ein Pferd tut, ist rauszukriegen, wer auf ihm reitet und wer das Sagen hat.«
»Das ist eine Platte von meinem Alten. Das sagt er, um Typen aus der Stadt zu erschrecken. Wenn die Pferde wirklich so schlau wären, würden sie uns reiten.«
»Das ist Crosbys Platte.«
»Nein.« Ich nahm noch einen Drink. »Das ist auch die Platte von meinem Alten.«
»Du bist also abgeworfen worden.«
»Ja, aber mein Handgelenk hatte sich im Zaumzeug verfangen, und ich bin unterm Bauch von diesem Bastard dreimal um den Ring gezerrt worden. Das hat der Menge gefallen. Dem Pferd auch. Hat mich fast ein Jahr lang ins Krankenhaus gebracht.«
»Gib sie mir.« Sie griff nach der Flasche. »Ich möchte auch mal Broncos reiten«, erklärte sie. »Und ich möchte bei Rodeos mitmachen.«
»Genau das wollte ich damit erreichen«, sagte ich. »Dazu wollte ich dich mit der Geschichte bringen.«
»War dein Dad verrückt?«
Darauf gab ich keine Antwort. Ich stand auf und ging zu dem Baum hinüber, wo das ganze Gerät an den Zweigen aufgehängt war, so wie man die Esssachen vor den Bären schützt. Ich öffnete meinen Hosenschlitz und sagte: »Bedecke deine Augen, Martha Knox, ich lass jetzt das dickste Ding in den Wyoming Rockies raus.«
Sie schwieg, während ich pisste, aber als ich zum Feuer zurückkam, sagte sie: »Das ist Crosbys Platte.«
Ich fand eine Büchse Tabak in meiner Tasche. »Nein, stimmt nicht«, wandte ich ein. »Das ist auch die Platte von meinem Alten.«
Ich klopfte die Büchse an mein Bein, um den Priem zusammenzuschütteln, und nahm dann etwas davon. Es war meine letzte Büchse, sie war fast leer.
»Mein Vater hat das Pferd dann gekauft«, fuhr ich fort. »Er fand den Besitzer und gab ihm doppelt so viel, wie das Mistvieh wert war. Dann holte er es aus der Küchenbaracke, verpasste ihm einen Kopfschuss und vergrub es im Komposthaufen.«
»Du willst mich wohl auf den Arm nehmen«, sagte Martha Knox.
»Erwähne das bloß nicht vor ihm.«
»Himmel, nein. Ich denk nicht dran.«
»Er hat mich jeden Tag im Krankenhaus besucht. Wir haben nicht einmal geredet, so verdammt niedergeschlagen war er. Er rauchte immerzu. Er schnippte die Zigarettenkippen jedesmal über meinen Kopf weg, sie landeten in der Toilette und zischten aus. Ich steckte viele Monate in einer Halskrause und konnte nicht mal meinen Kopf drehen und ihn sehen. Höllisch langweilig. Die Kippen über meinen Kopf in die Toilette fliegen zu sehen war so ziemlich das Einzige, wofür ich lebte.«
»Das ist wirklich langweilig«, sagte Martha Knox.
»Mein Bruder Crosby ließ sich auch gelegentlich sehen – mit Bildern von Mädchen.«
»Klar.«
»Na, war schon okay, sich die anzugucken.«
»Klar. Jeder hatte eine Kippe für dich zum Angucken.«
Sie trank. Ich nahm die Flasche, gab sie ihr wieder, und sie trank mehr. Wir waren von Schnee umgeben. Am Tag, als wir angekommen waren, hatte es erst gehagelt und dann fast jede Nacht geschneit. An den Nachmittagen schmolzen auf der Wiese große Stellen weg und hinterließen kleine weiße Häufchen, die wie Wäsche aussahen. Die Pferde zerteilten sie mit ihren Hufen. Es gab fast kein Gras mehr, und so hatten sie angefangen, nachts wegzulaufen, um sich besseres Futter zu suchen. Wir hängten ihnen deshalb Kuhglocken um den Hals, die einen lauten dünnen Ton abgaben, während sie grasten. Es war ein guter Ton, und ich bemerkte ihn erst, wenn er nicht mehr zu hören war. Diese Stille ohne Geklingel bedeutete, dass keine Pferde mehr da waren, und das konnte mich mitten in der Nacht aufwecken. Wir mussten ihnen dann nachgehen. Doch wir wussten, wo sie hinliefen, und diesen Weg schlugen wir dann auch ein. Martha Knox spürte sie ebenfalls auf, und sie beklagte sich nicht, wenn sie sich in der Kälte mitten in der Nacht anziehen und rausgehen musste, um im Dunkeln dem Glockengeklingel nachzugehen. Es gefiel ihr. Sie lernte es.
»Du kennst doch deinen Bruder Crosby genau?«, fragte Martha Knox. »Er glaubt wirklich, er weiß, wie man mit Mädchen umgeht.«
Ich sagte nichts darauf, und sie fuhr fort: »Aber wie ist das möglich, Buck, wenn es hier überhaupt keine Mädchen gibt?«
»Crosby kennt die Mädchen, er hat in Städten gelebt.«
»Was für Städte? Casper? Cheyenne?«
»Denver. Crosby hat in Denver gelebt.«
»Okay, Denver.«
»Da gibt’s schon ein paar Mädchen in Denver.«
»Sicher.« Sie gähnte.
»Er konnte also in Denver lernen, mit Mädchen umzugehen.«
»Ist mir klar, Buck.«
»Die Mädchen mögen Crosby.«
»Klar.«
»Das tun sie. Ich und Crosby werden in einem Winter mal nach Florida runtergehen und so viel Ehen kaputtmachen, wie wir können. Da unten gibt’s eine Menge reiche Frauen. Eine Menge reiche Frauen, die sich langweilen.«
»Die müssen ja ganz schöne Langeweile haben«, sagte Martha Knox und lachte. »Sie müssen sich absolut zu Tode langweilen.«
»Du magst wohl meinen Bruder Crosby nicht besonders?«
»Ich liebe deinen Bruder Crosby. Warum sollte ich Crosby nicht mögen? Ich finde, Crosby ist der Größte.«
»Schön für dich.«
»Aber er glaubt, er weiß mit Mädchen umzugehen, und das geht mir auf die Nerven.«
»Die Mädchen mögen Crosby.«
»Ich hab ihm mal ein Foto von meiner Schwester gezeigt. Er hat mir erklärt, sie sieht aus, als hätte sie’s mit vielen getrieben. Was ist denn das für eine Art, so was zu sagen?«
»Du hast eine Schwester?«
»Agnes. Sie arbeitet in Missoula.«
»Auf einer Ranch?«
»Nein, nicht auf einer Ranch. Sie ist Stripperin. Sie hasst es, weil das eine Collegestadt ist. Sie sagt, Collegejungs geben kein Trinkgeld, ganz egal, was man ihnen vor die Nase führt.«
»Hast du schon mal mit meinem Bruder Crosby geflirtet?«, fragte ich.
»Hey, Buck«, sagte sie. »Sei doch nicht so schüchtern. Frag schon, was du wissen willst.«
»Ach, Scheiße. Schon gut.«
»Weißt du, wie man mich in der Highschool genannt hat. Fort Knox. Weißt du auch, warum? Weil ich mir von keinem an die Wäsche gehen ließ.«
»Warum nicht?«
»Warum nicht?«
Sie stocherte mit einem Zweig im Feuer herum, dann warf sie ihn hinein. Sie schob den Kaffeetopf von den Flammen weg und klopfte mit einem Löffel dagegen, damit sich der Grund setzte, der angefangen hatte zu kochen. »Warum nicht? Weil ich’s nicht so gut fand.«
»Das ist ein verrückter Spitzname.«
»Buck ist besser.«
»Zugegeben«, sagte ich.
Martha Knox stand auf und ging ins Zelt. Als sie wieder rauskam, brachte sie einen Arm voll Holz mit.
Ich fragte: »Was willst du denn damit machen?«
»Das Feuer ist fast aus.«
»Dann lass es ausgehen. Es ist schon spät.«
Sie gab keine Antwort.
»Ich muss morgen um halb vier aufstehn«, sagte ich.
»Dann gute Nacht.«
»Du musst dann auch aufstehn.«
Martha Knox legte ein Stück Holz auf und setzte sich. »Buck«, meinte sie, »sei kein Baby.« Sie nahm einen langen Schluck und sang: »Mama, mach aus deinen Cowboys keine Babys …«
»Das ist Crosbys Platte«, bemerkte ich.
»Ich möchte dich um was bitten, Buck. Wenn wir hier oben fertig sind, dann lass mich mit dir und Crosby auf die Jagd gehn.«
»Ich glaube nicht, dass mein Alter davon begeistert wäre.«
»Ich hab auch nicht darum gebeten, mit deinem Alten auf die Jagd zu gehn.«
»Es wird ihm nicht gefallen.«
»Warum nicht?«
»Hast du überhaupt schon mal mit einem Gewehr geschossen?«
»Klar. Als ich noch klein war, haben mich meine Eltern den Sommer über nach Montana zum Onkel von meinem Dad geschickt. Ich hab dann meine Angehörigen nach ein paar Wochen angerufen und gesagt: ›Onkel Earl hat eine Kaffeekanne auf einen Baumstamm gestellt und mich darauf schießen lassen, und ich hab das alte Ding sechsmal getroffen.‹ Sie ließen mich dann vorzeitig nach Hause kommen. Das hat mir gar nicht gepasst.«
»Hört sich auch nicht gerade an, als würde dein Alter allzu begeistert davon sein.«
»Um meinen Vater müssen wir uns keine Gedanken machen«, erwiderte sie. »Nicht mehr.«
»Wirklich?«
Sie nahm ihren Hut ab und legte ihn sich aufs Bein. Es war ein alter Hut. Er hatte einmal meiner Cousine Rich gehört. Mein Alter hatte ihn Martha Knox geschenkt. Er hatte ihm an einem Morgen unter dem Dampf aus einer Kaffeekanne eine neue Form gegeben und oben mit einer ordentlichen Falte versehen. Der Hut passte ihr. Er stand ihr.
»Hör zu, Buck«, sagte sie. »Ich hab eine gute Geschichte, sie wird dir gefallen. Mein Dad züchtete Weihnachtsbäume. Nicht sehr viele. Er pflanzte genau fünfzig Stück und ließ sie zehn Jahre wachsen. In unserem Vorgarten. Er beschnitt sie die ganze Zeit mit einer Küchenschere, so wurden sie recht hübsch, aber nur so hoch.«
Martha Knox zeigte mit der Hand etwa drei Fuß hoch über den Boden.
»Das Problem war, dass wir auf dem Land wohnten«, fuhr sie fort. »Alle hatten ein Gehölz im Garten hinter dem Haus. Nie hat in dem Ort jemand einen Weihnachtsbaum gekauft. Das war also keine gute Geschäftsidee – fünfzig perfekte Bäume. Kein großes Geld damit zu machen. Aber das war seine Beschäftigung, und meine Mom ging arbeiten.« Sie nahm ihren Hut vom Bein und setzte ihn wieder auf. »Jedenfalls bot er sie im letzten Dezember zum Verkauf an, aber niemand erschien, und er fand das reichlich sonderbar, wo es doch so hübsche Bäume waren. Er ging dann trinken. Meine Schwester und ich fällten schließlich vielleicht zwanzig von den Dingern. Warfen sie in den Kombiwagen. Fuhren eine Stunde zur Autobahn und fingen an, Autos anzuhalten und die Bäume wegzugeben. Jeder, der hielt, bekam umsonst einen Baum. Es war wie … Na ja, verdammt, es war wie Weihnachten.«
Martha Knox fand eine Zigarette in ihrer Jackentasche und zündete sie an.
»Also«, erzählte sie weiter, »wir fuhren nach Hause. Und dann mein Dad. Er stieß Agnes nieder, holte aus und schlug mir ins Gesicht.«
»Hatte er dich vorher schon mal geschlagen?«, fragte ich. Sie schüttelte den Kopf.
»Und er wird es auch nie wieder tun.«
Sie schaute mich an, kühl und gelassen. Ich sah ihr zu, wie sie zweitausend Meilen von zu Hause ihre Zigarette rauchte, und ich dachte daran, wie sie sechsmal auf die alte Kaffeekanne geschossen hatte. Wir schwiegen lange. Dann sagte ich: »Du hast ihn doch nicht getötet?«
Sie wandte ihren Blick nicht ab, und sie antwortete nicht gleich; aber dann sagte sie: »Doch, ich habe ihn getötet.«
»Herr des Himmels«, murmelte ich schließlich.
Martha Knox reichte mir die Flasche, aber ich wollte nicht trinken. Sie kam herüber zu mir und setzte sich. Sie legte ihre Hand auf mein Bein.
»Herr des Himmels«, wiederholte ich. »Herr des Himmels, verdammt.«
Sie seufzte. »Buck«, sagte sie. »Mein Bester.« Sie tätschelte mein Bein und stupste mich dann. »Du bist wirklich der leichtgläubigste Mensch, den ich auf diesem Planeten kenne.«
»Leck mich doch.«
»Ich habe meinen Dad erschossen und im Komposthaufen vergraben. Sag keinem was davon, okay?«
»Leck mich doch, Martha Knox.«
Sie stand auf und setzte sich wieder auf die andere Seite des Feuers. »Es war trotzdem eine großartige Nacht. Als ich auf der Zufahrtsstraße mit blutiger Nase auf dem Rücken lag. Ich wusste, ich war weg von dort.«
Sie reichte mir wieder die Flasche. Diesmal trank ich. Lange Zeit sprachen wir nicht, aber wir leerten die Flasche, und wenn das Feuer niederbrannte, legte Martha Knox mehr Holz auf. Ich hatte meine Füße so dicht an den Flammen, dass die Sohlen meiner Stiefel anfingen zu qualmen, deshalb rückte ich weg, aber nicht weit. Im Oktober ist es da oben nicht leicht, sich warm zu halten, und ich konnte mich nicht so rasch von dieser Wärme losreißen.
Von der Wiese waren die Glocken der Pferde zu hören, die hin und her liefen, aber nicht fortgingen – Glockengeklingel von grasenden Pferden war gutes Geklingel. Ich hätte jedes Pferd da draußen beim Namen nennen und vermuten können, neben welchem Pferd es stand, weil ich wusste, wie sie sich gern paarten, und ich hätte sagen können, wie sich jedes Pferd ritt und auch wie sich seine Mutter und sein Vater ritten. Es gab noch immer Elche da draußen, aber sie hielten sich jetzt weiter unten auf, wie es auch die Pferde wollten, um bessere Nahrung zu finden. Dickhornschafe, Bären und amerikanische Elche gab es da draußen auch; alle waren auf dem Weg nach unten, und ich horchte nach ihnen allen. Diese Nacht war klar. Keine Wolken, außer den eiligen Wolken unseres eigenen Atems, die beim nächsten Atemzug schon wieder fort waren, und es war hell vom Schein des fast vollkommenen Mondes.
»Hör mal«, sagte ich, »ich dachte daran, ein Stück zu reiten.«
»Jetzt?«, fragte Martha Knox, und ich nickte, aber sie hatte schon gewusst, dass ich »jetzt« meinte, ja, jetzt. Bevor sie überhaupt fragte, sah sie mich schon an und erwog die ganze Sache, vor allem die große Regel von meinem Alten, die da lautete: keine Vergnügungsritte während der Arbeit, niemals. Kein Wettreiten, keine Nachtritte, keine waghalsigen, riskanten Ritte, keine Parforceritte, niemals, vor allem nicht während des Jagdlagers. Bevor sie überhaupt »jetzt?« fragte, hatte sie schon daran gedacht, und sie hatte auch daran gedacht, dass wir müde und betrunken waren. Und im Zelt hinter ihr schliefen Jäger, daran hatte sie ebenfalls gedacht. Und an all das hatte auch ich gedacht.
»Okay«, antwortete sie.
»Hör zu«, sagte ich und beugte mich etwas dichter übers Feuer, das zwischen uns war. »Ich dachte daran, heute abend den Washakeepass raufzureiten.«
Ich beobachtete sie. Ich wusste, dass sie noch nie so weit draußen gewesen war, aber ihr war bekannt, was es bedeutete, denn Washakee war für Meilen der einzige Weg in jeglicher Richtung, um über die Wasserscheide, die Continental Divide, und mitten in die Rockies zu kommen. Mein Bruder Crosby nannte ihn Spine – Grat. Er war eng und vereist, und er schob sich dreizehntausend Fuß in die Höhe, führte aber darüber hinweg und in die Rockies, und so weit war Martha Knox noch nie gekommen.
»Okay«, sagte sie. »Gehn wir.«
»Hör zu, ich dachte daran, dort nicht haltzumachen.«
Sie sah mich immer noch an und änderte dabei nicht ihren Gesichtsausdruck. Es war die Miene eines guten Jägers, der nach einem guten Schuss Ausschau hält. Dann erklärte ich ihr: »Wir nehmen jeder ein Packpferd und alle Lebensmittel und Geräte mit, die raufpassen. Ich reite Stetson, du reitest Jake, und wir kommen nicht zurück.«
»Ich reite Handy.«
»Doch nicht dieses gefleckte Scheusal.«
»Ich reite Handy«, wiederholte sie. Ich hatte vergessen, dass sie meinen Alten überredet hatte, ihr dieses verrückte Pferd zu verkaufen.
»Okay. Aber er ist vollkommen ungeeignet dafür.«
»Was ist mit den Jägern?«
»Sie sind okay, wenn sie nicht ausflippen.«
»Sie werden aber ausflippen.«
»Sie sind okay.«
»Du redest über einen Haufen umherziehendes Volk, Buck«, sagte sie. »Bei diesen Burschen kann man nie so genau wissen.«
»Wenn sie gescheit sind, werden sie sich morgen, sobald sie begreifen, dass wir weg sind, auf den Weg machen. Unsere Spur ist ja markiert wie eine regelrechte Autobahn. Frühestens morgen am späten Abend können sie die Ranch erreichen. Der Forstservice könnte uns dann frühestens am nächsten Tag verfolgen. Wenn wir gleich losreiten, könnten wir zu der Zeit schon neunzig Meilen südlich von hier sein.«
»Sag mir, ob es dir absolut ernst ist«, erklärte Martha Knox. »Ich werde es nämlich tun.«
»Ich schätze, in vier bis fünf Tagen kommen wir bis zur Uintagebirgskette, und wenn sie uns dann nicht vorher geschnappt haben, werden sie es nie schaffen.«
»Okay, tun wir’s also.«
»Dann wenden wir uns nach Süden. Das müssen wir wegen des Winters. Es gibt keinen Grund in der Welt, warum wir nicht in ein paar Monaten in Mexiko sein sollten.«
»Tun wir’s also.«
»Ich hab das alles ausgeknobelt. Wir stehlen Rinder und Schafe und verkaufen sie an all die armseligen kleinen Bergausrüstungsläden, wo keiner Fragen stellt.«
»Buck«, begann sie.
»Und wir reiten in all die winzigen Vorgebirgsstädte in Utah und Wyoming, und wir überfallen Banken. Auf unserem Pferd.«
»Buck«, sagte sie wieder.
»Es muss hundert Jahre her sein, seit jemand auf einem richtigen Pferd eine Bank überfallen hat. Die wissen doch gar nicht, wie sie mit uns fertig werden sollen. Sie werden uns mit Autos jagen, und weg sind wir, über die Schutzgeländer, zurück in die Berge mit all dem Geld. Weg.«
»Buck«, wiederholte sie, und ich antwortete noch immer nicht, aber diesmal hörte ich auf zu reden.
»Buck«, meinte sie. »Das ist doch alles Quatsch.«
»Ich denke, wir können vier bis fünf Monate durchhalten, bis sie uns schließlich niederschießen.«
»Du redest blödsinniges Zeug. Du gehst nirgendwohin.«
»Du glaubst, so was würde ich nicht tun?«
»Darüber rede ich nicht mal mit dir.«
»Du glaubst, ich würde das nicht tun?«
»Du willst dich mit ein paar Pferden davonmachen und zusehen, ob wir da draußen niedergemacht werden? Na schön, ich bin ganz dafür. Aber verschwende keine Zeit mit diesen Räuberpistolen.«
»Na, komm schon«, erwiderte ich. »Komm schon, Martha Knox.«
»Du bist einfach beschränkt. Ja, beschränkt.«
»Du würdest sowieso nicht einfach so abhauen.«
Sie sah mich an, als wollte sie irgendwas Gemeines und Verrücktes sagen, aber sie stand nur auf, goss den Kaffee über das noch verbliebene Feuer, um es auszulöschen.
»Na komm schon, Martha Knox«, wiederholte ich.
Sie setzte sich wieder, aber ich konnte sie nicht gut sehen in der ungewohnten Dunkelheit über der nassen Asche.
»Verschwende nicht wieder so meine Zeit«, erklärte sie.
»Na komm, du kannst doch nicht einfach so abhauen.«
»Und ob ich das kann.«
»Du würdest einfach die Pferde von meinem Alten stehlen?«
»Handy ist verdammt noch mal mein eigenes Pferd.«
»Na komm, Martha Knox«, sagte ich, aber sie stand auf und ging in das Zelt hinter mir. Dann wurde das Zelt von innen erleuchtet, so wie am Morgen, bevor die Sonne aufging, wenn sie ihr Tagesgepäck für die Jagd fertig machte, und ich von der Wiese, wo ich mein Pferd zu satteln begann, sehen konnte, dass im Zelt Licht war, aber nur ganz schwach, denn sie benutzte bloß eine Laterne.
Ich wartete, bis sie schließlich mit der Laterne aus dem Zelt kam. Sie hatte auch ein Zaumzeug dabei, das sie vom Haken neben den Kochherden genommen hatte, wo wir die ganzen Trensen aufhängten, damit die Gebisse nicht vom Tau gefrieren und am Morgen in den Mäulern der Pferde zu Eis würden. Sie schritt an mir vorbei zur Wiese. Wie immer ging sie schnell und wie immer mit dem Gang eines Jungen.
Ich folgte ihr. Dabei stolperte ich über einen losen Stein, dann hielt ich sie am Arm fest. »Du gehst doch nicht allein fort?«, fragte ich.
»Doch, ich gehe. Und zwar nach Mexiko. Mitten in der Nacht. Ich allein mit diesem Zaumzeug.«
Dann sagte sie: »Ich mach nur Spaß, Buck«, obgleich ich ihr nicht geantwortet hatte.
Ich hielt ihren Arm, und wir gingen ein Stück. Der Boden war holprig und an einigen Stellen nass, über anderen lag eine dünne Schneedecke. Wir stolperten über Steine und fielen ineinander, aber wir stürzten nicht, die Laterne half etwas. Wir folgten den Glocken, bis wir bei den Pferden anlangten. Martha Knox stellte die Laterne auf einen Baumstumpf. Wir sahen die Pferde an, und die Pferde sahen uns an. Einige von ihnen entfernten sich wieder, andere gingen zur Seite oder stellten sich hinter uns. Aber Stetson kam herüber zu mir. Ich streckte meine Hand aus, er schnupperte daran und legte sein Kinn darauf. Dann fing er wieder an zu grasen, und die Glocke an seinem Hals klingelte, so als wäre diese Bewegung wichtig gewesen. Aber die Glocken klingelten immer, und es war nichts weiter.
Martha Knox stand zwischen den Pferden und sagte die Dinge, die wir immer zu den Pferden sagten: »Na hey, sachte, Freundchen, ganz ruhig«, so als würden sie die Worte verstehen, obwohl es doch eigentlich nur die Stimme ist, die eine Rolle spielt, und die Worte ganz beliebig sein können.
Sie fand Handy, und ich sah zu, wie sie ihm das Zaumzeug anlegte; die Flecken auf seinem Rücken und Hinterteil in der fast vollkommenen Dunkelheit waren hässlich, wie versehentlich hingestreut, wie Fehler.
Ich ging hinüber zu ihr, sie sprach zu Handy und verschnallte das Zaumzeug an seinem Ohr.
Ich sagte: »Du weißt, dass mein Alter dieses Pferd von seinem Besitzer für hundert Dollar gekauft hat, der Kerl hat es mächtig gehasst.«
»Handy ist der Beste. Sieh dir diese hübschen Beine an.«
»Mein Alter meint, sie hätten ihn Plage nennen sollen.«
»Schön hätten sie ihn nennen sollen«, entgegnete sie, und ich lachte, aber ich lachte zu laut, und Handy warf den Kopf zurück.
»Ganz ruhig«, sagte sie zu ihm. »Na, sachte; ganz ruhig, Junge.«
»Weißt du, warum Indianer mit Appaloosas in die Schlacht ritten?«, fragte ich.
»Ja, ich weiß.«
»Sie waren nämlich brav und hauten wieder ab, wenn sie angekommen waren.«
Martha Knox sagte: »Willst du mal raten, wie oft ich den Witz in diesem Sommer schon gehört habe?«
»Ich kann Appaloosas nicht ausstehen. Keins von ihnen.«
Sie stand neben Handy und strich ihm übers Rückgrat. Dann fasste sie die Zügel und ein Büschel Mähne und schwang sich hinauf, genauso, wie ich es ihr im Juni beigebracht hatte. Er tänzelte ein paar Schritte zurück, doch sie zügelte ihn, und mit einem leichten Druck auf den Hals brachte sie ihn zum Stillstehen.
»Kommst du nun oder nicht?«, fragte sie.
»So viel Geld kannst du mir gar nicht geben, das mich auf diesem gefleckten Bastard zum Reiten verleiten könnte.«
»Steig auf.«
»Er nimmt nicht zwei ohne Sattel.«
»Er nimmt zwei. Steig auf.«
»Ruhig, Junge«, sagte ich und schwang mich hinter Martha Knox hinauf. Er tänzelte zur Seite, ehe ich richtig saß, aber diesmal ließ sie ihn tänzeln; dann schlug sie ihn, und er war schon in einen lockeren Trab gefallen, während ich noch mit beiden Armen ihre Taille umfasste und nach einem Büschel Mähne griff. Sie ließ ihn traben, dann wurde er langsamer und fiel schließlich in Schritt. Sie ließ ihn laufen, wohin er wollte, und er umkreiste zweimal träge die Laterne. Er schnupperte an der Stute, die rasch von ihm fortrückte. Dann ging er zu einem Baum und stellte sich darunter, ganz still.
»Ein toller Ritt«, sagte ich.
Sie schlug ihn, diesmal nicht nur mit einem leichten Stups, sondern ernsthaft, danach galoppierte er los, und nach zwei weiteren Schlägen fing er an zu rasen. Wir waren zu betrunken dafür, und es war zu dunkel dazu, und es gab zu vieles auf dieser Wiese, über das ein Pferd stolpern konnte, aber wir rasten nur so dahin. Seine Glocken und Hufe machten einen ziemlichen Lärm, und sie überraschten die anderen Pferde, die hinter uns auseinanderstoben. Ich hörte, wie ein paar von ihnen uns mit ihrem Glockengebimmel schnell folgten.
Martha Knox hatte die Zügel in der Hand, aber sie gebrauchte sie nicht, mein Hut war fort, der ihre auch, weggeflogen. Vielleicht war Handy gestolpert, oder er war falsch getreten, wie es bei Pferden, die gerne schnell liefen, manchmal vorkam, oder wir saßen nicht richtig, jedenfalls stürzten wir. Da ich sie noch immer umfasst hielt, fielen wir zusammen, so dass wir nicht sagen konnten, wer zuerst fiel oder wessen Schuld es war. Diese Wiese war der beste Ort für die Pferde bei langen Aufenthalten, aber bei dieser Jagd war sie erschöpft. Im nächsten Frühjahr würde es anders sein, bei frischem Gras, nass vom abfließenden Wasser, doch in dieser Nacht war es gefroren und voller Schmutz, und wir schlugen hart auf. Wir fielen auf die gleiche Weise, alle beide. Wir fielen auf unsere Hüften und Schultern. Ich wusste, ich war nicht verletzt, und dachte mir, dass auch sie es nicht war; doch bevor ich fragen konnte, lachte sie schon.
»Oh, Mann«, stöhnte sie. »Verdammt.«
Ich zog meinen Arm unter ihr hervor und rollte mich von der Hüfte auf den Rücken, und sie rollte sich auch auf den Rücken. Wir waren zwar weit entfernt von der Laterne, aber es war Vollmond, und er schien hell. Ich drehte mich um und sah Martha Knox’ Gesicht neben dem meinen. Ihr Hut war fort, und sie rieb sich den Arm, aber sie blickte nirgendwohin, nur gerade zum Himmel hinauf, in einen Himmel, wie wir ihn nicht oft sehen wegen der Bäume oder schlechtem Wetter oder weil wir schlafen oder ins Feuer starren statt dessen.
Handy kam zurück – zuerst seine Glocke, dann sein riesiges Gesicht über unseren Gesichtern, ganz dicht und heiß. Er beschnupperte uns, als wären wir etwas, das er gern haben würde.
»Du bist ein gutes Pferd, Handy«, lobte Martha Knox – nicht mit der Stimme, mit der wir gewöhnlich zu Pferden redeten, sondern in ganz normalem Tonfall, und es war ihr ernst. Ich glaubte nicht, dass sie von mir geküsst werden wollte, aber es stimmt, dass ich sie damals küssen wollte. Sie sah großartig aus. Auf dieser abgestorbenen, gefrorenen Erde sah sie so gut und bedeutend aus wie frisches Gras oder frische Beeren.
»Du bist ein gutes Pferd«, sagte sie noch einmal zu Handy, und es war zu hören, dass sie sich dessen ganz sicher war. Er beschnupperte sie erneut sehr behutsam.
Auch ich blickte nach oben, in den Himmel, und die Sterne sahen eigentlich nicht anders aus als sonst, wenn sie auch irgendwie näher zu sein schienen und fremd. Ich beobachtete sie so lange, bis ich einen von ihnen über uns niedergehen sah, lange und tief. Das beobachtet man bei einem klaren Himmel dort draußen häufig. Aber dieser eine Stern hinterließ einen dünnen Bogen, gleich einer brennenden Zigarette, die über unsere Köpfe geworfen wurde. Wenn Martha Knox das bemerkte, dann nur, als sie schon mit einer Hand nach den Zügeln ihres Pferdes griff, und über so etwas sprach sie nicht.
Elchgeflüster
Benny lebte schon seit über einem Jahr bei Ed und Jean. Seine Mutter war Jeans Schwester, und sie lag noch immer im Krankenhaus in Cheyenne im Koma, weil sie eines Abends auf dem Heimweg von einem Zeichenkursus mit ihrem Auto in einen Schneepflug gerast war. Jean hatte sich, sobald sie von dem Unfall erfuhr, erboten, ihren achtjährigen Neffen zu sich zu nehmen, und die ganze Familie war der Meinung, dass dies die beste Lösung für Benny sein würde. Und wenn die Leute Jean fragten, wo denn Bennys Vater sei, sagte sie nur: »Er ist zurzeit nicht abkömmlich«, so als sei er ein Geschäftsmann, der nicht ans Telefon kommen konnte.
Ed und Jean hatten selbst eine verheiratete Tochter, die in Ohio lebte, und als sie aus der Stadt in die Berghütte zogen, erwarteten sie nicht, diese eines Tages mit einem Kind teilen zu müssen. Doch nun war Benny da, und Jean fuhr ihn jeden Morgen fünf Meilen die unbefestigte Straße hinunter, wo er auf seinen Schulbus traf. Jeden Nachmittag holte sie ihn dann von derselben Stelle wieder ab. Schwieriger war es im Winter wegen des dicken Schnees, den es nun einmal gab, aber sie waren auch damit fertig geworden.
Ed arbeitete für das Fisch- und Wild-Department und fuhr ein großes grünes Lastauto mit dem Staatsemblem an den Türen. Er arbeitete nur noch halbtags und hatte sich in den letzten Monaten so etwas wie einen Bauch zugelegt, rund und fest wie der eines schwangeren Teenagers. Wenn er zu Hause war, hackte und stapelte er Brennholz oder arbeitete an der Hütte. Sie isolierten sie immer noch weiter, ständig entdeckten sie neue Risse, die sie reparierten, um sich noch besser vor dem Winterwetter zu schützen. Im Juli und August kochte und fror Jean Gemüse ein aus ihrem Garten, und wenn sie spazierenging, las sie kleine trockene Zweige vom Weg auf und brachte sie nach Hause zum Feueranzünden. Die Hütte war nur klein und hatte hinten zum Wald hin einen schmalen offenen Vorbau. Jean hatte das Wohnzimmer zum Schlafzimmer für Benny gemacht, und er schlief auf der Couch unter einer Daunendecke.