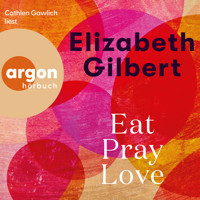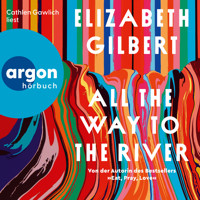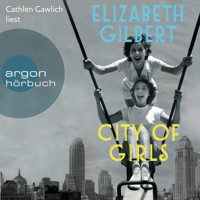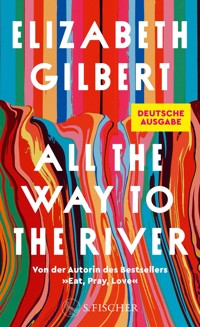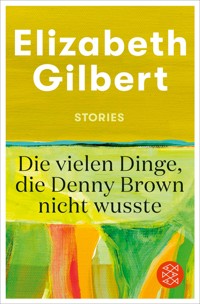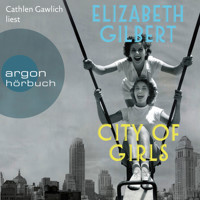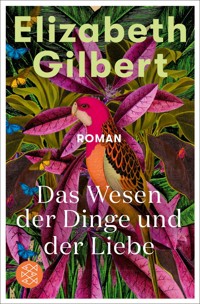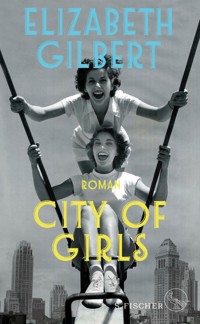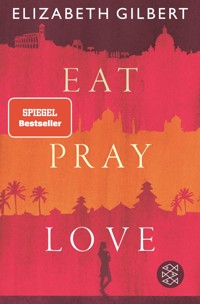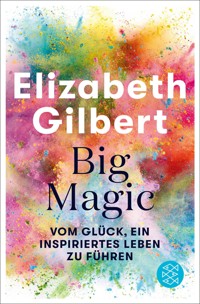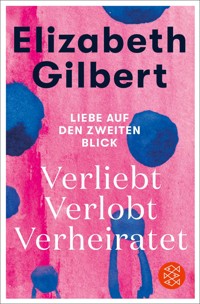
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am Ende ihres Weltbestsellers »Eat Pray Love« traf Elizabeth Gilbert Felipe. Die beiden verliebten sich, schworen einander jedoch, dass sie nie heiraten würden: Nach zwei schlimmen Scheidungen glaubten sie beide nicht mehr an die Ehe. Es kam jedoch anders, denn um gemeinsam in den USA leben zu können, mussten sie heiraten. Ein Zwang, der Elizabeth dazu brachte, über die Ehe nachzudenken. Über die Institution und die Vorstellungen, die mit ihr verbunden sind, in den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Und sie geht mit viel Scharfsinn und Witz den Fragen nach: Verliebt, verlobt, verheiratet – ist es wirklich so leicht? Und wie kann das eigentlich wirklich klappen mit zwei Menschen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elizabeth Gilbert
Verliebt Verlobt Verheiratet
Liebe auf den zweiten Blick
Über dieses Buch
Am Ende ihres Weltbestsellers »Eat Pray Love« traf Elizabeth Gilbert Felipe. Die beiden verliebten sich, schworen einander jedoch, dass sie nie heiraten würden: Nach zwei schlimmen Scheidungen glaubten sie beide nicht mehr an die Ehe. Es kam jedoch anders, denn um gemeinsam in den USA leben zu können, mussten sie heiraten. Ein Zwang, der Elizabeth dazu brachte, über die Ehe nachzudenken. Über die Institution und die Vorstellungen, die mit ihr verbunden sind, in den unterschiedlichsten Ländern und Kulturen. Und sie geht mit viel Scharfsinn und Witz den Fragen nach: Verliebt, verlobt, verheiratet – ist es wirklich so leicht? Und wie kann das eigentlich wirklich klappen mit zwei Menschen?
Erstmals 2010 erschienen, liegt das Buch nun bei FISCHER vor.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Elizabeth Gilbert wurde 1969 geboren. Nach dem Studium in New York arbeitete sie als Journalistin und begann, Bücher zu schreiben. 2006 erschien der Weltbestseller »Eat Pray Love«, der mit Julia Roberts in der Hauptrolle verfilmt wurde. Nach »Big Magic« (2015) erschien 2019 der Roman »City of Girls« und 2025 das Memoir »All the Way to the River«. Elizabeth Gilbert lebt in New Jersey.
Maria Mill lebt als Literaturübersetzerin und Reisebuchautorin in München. Sie hat u. a. Anne Enright, Esther Freud, Martha Grimes, Anaïs Nin und Robert Hughes ins Deutsche übertragen.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Committed: A Sceptic Makes Peace with Marriage« bei Viking, New York.
Copyright © 2010, Elizabeth Gilbert
All rights reserved
Die deutschsprachige Ausgabe erschien erstmals 2010 unter dem Titel »Das Ja-Wort« bei Bloomsbury Berlin.
© der deutschen Übersetzung 2010: Bloomsbury Berlin in der Piper Verlag GmbH, Berlin und München
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hißmann Heilman Hamburg
Coverabbildung: Ruhey / Getty Images
ISBN 978-3-10-491676-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Anmerkung für die Leserinnen und Leser (2009)
1 Ehe und Überraschungen
2 Ehe und Erwartung
3 Ehe und Geschichte
4 Ehe und Verliebtheit
5 Ehe und Frauen
6 Ehe und Autonomie
7 Ehe und Subversion
8 Ehe und Zeremoniell
Danksagung
Zitatnachweis
Para J.L.N. – o meu coroa
Es gibt kein größeres Wagnis als eine Ehe. Doch niemand ist glücklicher als ein glückliches Ehepaar.
BENJAMIN DISRAELI
in einem Brief an Königin Victorias Tochter Louise anlässlich deren Verlobung, 1870
Anmerkung für die Leserinnen und Leser (2009)
Vor einigen Jahren veröffentlichte ich ein Buch mit dem Titel Eat, Pray, Love, in dem ich eine Reise um die Welt schilderte, die ich nach einer schlimmen Scheidung allein unternommen hatte. Als ich das Buch schrieb, war ich Mitte dreißig und schlug damit schriftstellerisch eine völlig neue Richtung ein. Vor Eat, Pray, Love war ich in literarischen Kreisen (wenn überhaupt) als Frau bekannt gewesen, die vorwiegend für und über Männer schrieb. Jahrelang hatte ich als Journalistin für an ein männliches Publikum gerichtete Magazine wie GQ und Spin gearbeitet und meine Beiträge genutzt, um das Thema Männlichkeit aus jedem nur denkbaren Blickwinkel zu beleuchten. Zudem waren auch die Sujets meiner ersten drei Bücher (ob Literatur oder Sach buch) durchgehend Supermachos: Cowboys, Hummerfischer, Jäger, Trucker, Holzfäller …
Damals hat man mir oft erzählt, ich schriebe wie ein Mann. Nun bin ich mir zwar nicht so ganz sicher, was Schreiben »wie ein Mann« überhaupt bedeutet, allerdings glaube ich, dass es stets als Kompliment gemeint ist. Und damals habe ich es mit Sicherheit so verstanden. Für einen meiner GQ-Artikel ging ich sogar so weit, mich eine Woche lang in einen Mann zu verwandeln. Ich schnitt mir die Haare ab, bandagierte mir die Brüste, stopfte mir ein mit Vogelfutter gefülltes Kondom in die Hose und pappte mir ein kleines Bart-Dreieck unter die Unterlippe – und all das nur, um mich irgendwie in die verlockenden Mysterien der Männlichkeit einzufühlen, irgendetwas davon zu begreifen.
Ich sollte hier vielleicht anmerken, dass sich meine Männerfixierung auch auf mein Privatleben erstreckte. Was übrigens häufig zu Komplikationen führte.
Nein – immer, immer führte das zu Komplikationen.
Aufgrund meiner romantischen Verstrickungen und professionellen Obsessionen war ich derart vom Thema Männlichkeit absorbiert, dass ich mich nicht einmal eine Sekunde lang mit dem Thema Weiblichkeit befasste. Ganz sicher aber beschäftigte ich mich nie mit meiner eigenen Weiblichkeit. Und deswegen, wie auch aufgrund eines generellen Desinteresses an meinem eigenen Wohlbefinden, wurde ich nie so recht mit mir selber vertraut. Als mich daher im Alter von etwa dreißig Jahren schließlich eine massive Depression niederstreckte, konnte ich überhaupt nicht begreifen, geschweige denn artikulieren, wie mir geschah. Als Erstes war meine Gesundheit futsch, dann meine Ehe, und dann – eine fürchterliche und beängstigende Zeitlang – auch mein Verstand. Männliche Härte war mir in diesem Moment kein Trost; der einzige Weg, aus dem Gefühlswirrwarr herauszukommen, bestand darin, die Gefühle zuzulassen. Geschieden, todunglücklich und einsam ließ ich alles hinter mir und brach auf zu einem Jahr des Reisens und der Introspektion, fest entschlossen, mich selbst ebenso gewissenhaft zu erforschen, wie ich einst den amerikanischen Cowboy studiert hatte.
Und dann schrieb ich – weil ich Schriftstellerin bin – ein Buch darüber.
Und dann entwickelte sich – weil das Leben zuweilen sehr seltsam ist – dieses Buch zu einem internationalen Megabestseller, und ich musste – nach einem Jahrzehnt, in dem ich ausschließlich über Männer und Männlichkeit geschrieben hatte – entdecken, dass man mich nun als Chick-Lit-Autorin, als Verfasserin seichter Frauenliteratur, handelte. Wobei ich mir ebenfalls nicht recht darüber klar bin, was unter »Frauenliteratur« eigentlich zu verstehen ist. Ziemlich sicher bin ich mir jedoch, dass es niemals als Kompliment gemeint ist.
Wie auch immer, inzwischen fragen mich alle andauernd, ob ich denn nicht etwas vorausgeahnt hätte. Ob ich beim Schreiben von Eat, Pray, Love nicht irgendwie vorausgesehen hätte, wozu sich das Ganze noch auswachsen würde. Nein. Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, ein so überwältigendes Echo vorherzusagen oder gar zu planen. Wenn überhaupt, hatte ich beim Schreiben gehofft, man werde mir nachsehen, überhaupt etwas Autobiografisches geschrieben zu haben. Zwar konnte ich meine Leser an den Fingern einer Hand abzählen, doch es waren treue Leser, und gemocht hatten sie die handfeste junge Dame, die eigensinnige Geschichten über männliche Männer schrieb, die männliche Sachen machten. Ich sah durchaus nicht voraus, dass diese Leser eine ziemlich emotionale, in Ichform verfasste Chronik der Suche einer geschiedenen Frau nach seelisch-spiritueller Heilung goutieren würden. Wenn ich auch hoffte, sie wären großzügig genug, zu begreifen, dass ich dieses Buch aus ganz persönlichen Gründen hatte schreiben müssen und sie es mir durchgehen lassen würden – damit wir uns danach wieder anderen Dingen zuwenden konnten.
Doch so kam es nicht.
(Und nur um das klarzustellen: Auch das Buch, das Sie in Händen halten, ist keine eigensinnige Geschichte über männliche Männer, die männliche Sachen machen. Soll keiner sagen, er sei nicht gewarnt worden!)
Eine andere Frage, die man mir zurzeit ständig stellt, ist die, inwiefern Eat, Pray, Love mein Leben verändert hat. Das ist schwer zu beantworten, das Ausmaß ist so enorm. Dazu ein nützlicher Vergleich aus meiner Kindheit: Als kleines Kind nahmen mich meine Eltern einmal ins Museum für Naturgeschichte in New York mit. Wir standen dort im Saal der Meere. Mein Vater deutete hinauf zur Decke, auf das lebensgroße Modell des großen Blauwals, das über unseren Köpfen hing. Er versuchte mir die Größe des riesenhaften Geschöpfs klarzumachen, doch ich konnte den Wal nicht sehen. Ich stand – wohlgemerkt – direkt unter dem Wal und starrte direkt zu ihm hinauf, aber ich konnte ihn schlicht und einfach nicht »fassen«. Mein Verstand war nicht dafür gerüstet, etwas so Großes zu begreifen. Nur die blaue Decke nahm ich wahr und das Erstaunen auf den Gesichtern der anderen (offenbar passierte da gerade etwas Aufregendes!), der Wal selbst aber überstieg meine Aufnahmefähigkeit.
So geht es mir zuweilen auch mit Eat, Pray, Love. Irgendwann war bei diesem Buch ein Punkt erreicht, wo ich die Dimensionen nicht mehr recht fassen konnte, so dass ich es aufgab und mich anderen Dingen zuwandte. Das Anlegen eines Gartens war hilfreich. Nichts eignet sich besser dazu, wieder einen nüchterneren Blick auf die Dinge zu gewinnen, als Schnecken von den eigenen Tomatenpflanzen zu klauben.
Abgesehen davon hat mich die Frage, wie ich nach diesem Erfolg je wieder unbefangen schreiben sollte, einigermaßen ratlos gemacht. Nicht dass ich mit falscher Nostalgie der literarischen Unbekanntheit nachtrauern wollte, aber früher hatte ich meine Bücher stets in der Überzeugung geschrieben, dass nur wenige Leute sie lesen würden. Im Grunde genommen war dieses Wissen natürlich immer deprimierend gewesen. In einer entscheidenden Weise jedoch war es tröstlich: Falls ich mich einmal zu grauenhaft blamieren sollte, gab es dafür wenigstens auch nur wenige Zeugen. Aber egal, die Frage war nun sowieso theoretischer Natur: Auf einmal hatte ich Millionen von Lesern, die meinem nächsten Projekt entgegensahen. Wie um Himmels willen stellt man es an, ein Buch zu schreiben, das Millionen zufriedenstellt? Ich wollte mich nicht unverhohlen anbiedern, aber ich wollte diese wachen, leidenschaftlichen und zum überwiegenden Teil weiblichen Leser auch nicht einfach so aufgeben – nicht nach all dem, was wir miteinander durchgestanden hatten.
Unsicher, wie ich nun weitermachen sollte, machte ich dennoch weiter. Im Laufe eines Jahres schrieb ich einen kompletten Rohentwurf, 500 Seiten, für dieses Buch – merkte aber gleich nach der Fertigstellung, dass etwas damit nicht stimmte. Es klang nicht nach mir. Es klang nach niemandem. Es klang, als käme es – falsch übersetzt – durch ein Megafon. Ich legte das Manuskript beiseite, warf nie wieder einen Blick darauf und kehrte in meinen Garten zurück, um beschaulich weiter zu stochern, zu graben und zu grübeln.
Um es ganz klar zu sagen, es war dies nicht direkt eine Krise, diese Phase, in der ich nicht wusste, wie ich schreiben oder – zumindest nicht – wie ich natürlich schreiben sollte. Im Übrigen war das Leben wirklich schön, und ich war durchaus dankbar für die persönliche Zufriedenheit und den beruflichen Erfolg und bestimmt nicht drauf und dran, aus dieser Mücke von Problem einen Elefanten zu machen. Ein Problem aber war es sicherlich. Ich begann mich sogar zu fragen, ob ich womöglich schriftstellerisch am Ende war. Keine Schriftstellerin mehr zu sein erschien mir nicht als das Schlimmste – falls es denn mein Schicksal sein sollte, doch ich wusste es einfach noch nicht. Ich musste noch viele Stunden im Tomatenbeet zubringen – mehr will ich nicht sagen –, ehe ich das für mich klären konnte.
Am Ende fand ich einen gewissen Trost in der Erkenntnis, dass ich kein Buch schreiben konnte – oder kann –, das Millionen von Lesern zufriedenstellt. Wenigstens nicht, wenn ich es darauf anlege. Ich weiß einfach nicht, wie man einen populären Bestseller auf Bestellung verfasst. Wüsste ich es, dann – kann ich Ihnen versichern – hätte ich es von Anfang an getan, denn dann hätte ich schon seit langem sehr viel ruhiger und sorgenfreier leben können. Aber so funktioniert das nun einmal nicht – oder wenigstens nicht für Autorinnen wie mich. Wir schreiben nur die Bücher, die wir schreiben müssen oder schreiben können, und müssen sie dann in die Welt entlassen im Bewusstsein, dass alles, was nachher geschieht, uns nichts mehr angeht.
Aus einer Vielzahl persönlicher Gründe war das Buch, das ich in diesem Moment meines Lebens schreiben musste, genau dieses hier – ein weiteres Erinnerungsbuch (mit soziohistorischen Exkursen als Dreingabe!) über meine Versuche, mit der komplizierten Institution der Ehe Frieden zu schließen. Das Thema stand nie zur Debatte; nur fiel es mir eine Zeitlang schwer, meine Sprache zu finden. Am Ende stellte ich fest, dass die einzige Chance – um überhaupt wieder schreiben zu können – darin bestand, dass ich, wenigstens in der Vorstellung, die Anzahl der Menschen, für die ich schrieb, erheblich eingrenzte. So begann ich wieder ganz von vorn. Und ich habe diese Version von Das Ja-Wort tatsächlich nicht für Millionen von Leserinnen geschrieben. Sondern für genau siebenundzwanzig. Die, um es ganz genau zu nehmen, folgende Namen tragen:
Maude, Carole, Catherine, Ann, Darcey, Deborah, Susan, Sofie, Cree, Cat, Abby, Linda, Bernadette, Jen, Jana, Sheryl, Rayya, Iva, Erica, Nichelle, Sandy, Anne, Patricia, Tara, Laura, Sarah und Margaret.
Diese siebenundzwanzig Frauen machen den kleinen, aber maßgeblichen Kreis meiner Freundinnen, weiblichen Verwandten und Nachbarinnen aus. Altersmäßig rangieren sie von Anfang zwanzig bis Mitte neunzig. Eine von ihnen ist zufällig meine Großmutter, eine andere meine Stieftochter. Eine ist meine älteste Freundin, eine andere meine jüngste. Eine ist frisch verheiratet, zwei andere wollen unbedingt unter die Haube; einige haben vor kurzem wieder geheiratet, während eine andere zutiefst dankbar dafür ist, dass sie es nie getan hat, und noch eine andere soeben eine fast zehnjährige Beziehung zu einer Frau beendet hat. Sieben sind Mütter, zwei sind (während ich dies schreibe) schwanger; der Rest ist – aus einer Vielzahl von Gründen und mit den unterschiedlichsten Gefühlen dabei – kinderlos. Manche sind Hausfrauen, manche berufstätig, und zwei von ihnen sind auf bewundernswürdige Weise beides. Die meisten sind weiß, einige schwarz, zwei sind im Nahen Osten geboren, eine ist Skandinavierin, zwei sind Australierinnen, eine ist Südamerikanerin und eine weitere Cajun. Drei sind tiefreligiös, fünf an allem Theologischen gänzlich desinteressiert. Die meisten sind in spiritueller Hinsicht ein wenig konfus; die anderen haben irgendwie über die Jahre ihre ganz eigenen Abkommen mit Gott geschlossen. Sie alle haben einen überdurchschnittlichen Sinn für Humor. Und alle haben irgendwann im Lauf ihres Lebens einen herzzerreißenden Verlust erlitten.
Über viele Jahre habe ich mit der einen oder anderen dieser treuen Seelen bei vielen Tassen Tee und auch Härterem beisammengesessen und mir laut Gedanken über Ehe, Intimität und Sexualität, über Scheidung, Treue und Familie, über Verantwortung und Autonomie gemacht. Dieses Buch basiert auf der Substanz dieser Gespräche. Beim Zusammenstoppeln verschiedener Seiten dieser Geschichte habe ich mich immer wieder dabei ertappt, wie ich tatsächlich laut mit diesen Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen sprach – und dabei auf Fragen antwortete, die zuweilen schon Jahrzehnte zurücklagen, oder selbst neue stellte. Ohne den Einfluss dieser siebenundzwanzig außergewöhnlichen Frauen wäre dieses Buch nicht entstanden, und ich bin ungeheuer dankbar, dass es sie alle gibt. Allein mit ihnen in einem Raum zu sein war mir stets Erbauung und Trost.
ELIZABETH GILBERT
New Jersey, 2009
1Ehe und Überraschungen
~
Die Ehe ist eine polizeilich anerkannte Freundschaft.
ROBERT LOUIS STEVENSON
Eines Spätnachmittags im Sommer 2006 saß ich in einem kleinen nordvietnamesischen Dorf mit einigen Dorfbewohnerinnen (deren Sprache ich nicht verstand) um ein rußiges Herdfeuer und versuchte, ihnen Fragen über die Ehe zu stellen.
Schon mehrere Monate lang war ich damals mit dem Mann, der bald darauf mein Ehemann werden sollte, durch Südostasien gereist. Die angemessene Bezeichnung für eine solche Person wäre wohl »Verlobter« gewesen, doch weder er noch ich fühlten uns besonders wohl mit diesem Wort und benutzten es daher auch nicht. Im Grunde konnte sich keiner von uns beiden so recht mit der Eheidee anfreunden. Denn eine Ehe hatten wir weder gemeinsam geplant, noch hatte jemals einer von uns einen derartigen Wunsch gehegt. Die Vorsehung aber hatte unsere Pläne durchkreuzt, weshalb wir uns nun ziellos durch Vietnam, Thailand, Laos, Kambodscha und Indonesien treiben ließen und uns dabei dringlich – ja verzweifelt – darum bemühten, nach Amerika zurückkehren und heiraten zu dürfen.
Der betreffende Mann war damals bereits mehr als zwei Jahre lang mein Liebhaber, mein Liebster gewesen, und ich werde ihn auf diesen Seiten Felipe nennen. Felipe ist ein freundlicher, liebevoller brasilianischer Gentleman, siebzehn Jahre älter als ich, dem ich auf einer anderen Reise (einer tatsächlich geplanten) begegnet war, die ich einige Jahre zuvor um die Welt unternommen hatte, um mein ernsthaft gebrochenes Herz zu kurieren. Kurz vor dem Ende jener Reise hatte ich Felipe getroffen, der – selber ein gebrochenes Herz pflegend – jahrelang zurückgezogen allein auf Bali gelebt hatte. Ergeben hatte sich daraus zunächst Anziehung, dann ein bedächtiges Werben und schließlich – sehr zu unserem beiderseitigen Erstaunen – Liebe.
Unser Widerstreben gegen die Ehe hatte also nichts mit mangelnder Liebe zu tun. Ganz im Gegenteil, Felipe und ich liebten einander rückhaltlos. Gerne machten wir uns auch alle möglichen Versprechungen, auf immer treu zusammenzustehen. Wir hatten uns sogar schon lebenslange Treue geschworen, wenn auch in aller Stille. Unser Problem war, dass wir beide schlimme Scheidungen hinter uns hatten und derart enttäuscht worden waren, dass allein die Vorstellung einer rechtsgültigen Ehe – egal mit wem, ja nicht einmal mit einem so netten Menschen wie einem von uns – uns mit Furcht und Schrecken erfüllte.
In der Regel sind natürlich die meisten Scheidungen ziemlich grässlich (»Sich scheiden zu lassen«, meinte Rebecca West, »ist in etwa so heiter und nützlich, wie sehr kostbares Porzellan zu zerschlagen«), und auch unsere Scheidungen waren keine Ausnahmen gewesen. Auf der weltweit maßgeblichen Katastrophenskala für schlimme Scheidungen von eins bis zehn (wo eins einer freundschaftlichen Trennung entspricht, und zehn … nun, einer echten Hinrichtung), würde ich meine eigene wohl ungefähr bei sieben Komma fünf ansiedeln. Zwar hatte sie weder zu Selbstmord noch zu Mord geführt, doch abgesehen davon war sie so hässlich gewesen, wie das bei zwei ansonsten durchaus gesitteten Menschen nur denkbar war. Und sie hatte sich mehr als zwei Jahre lang hingezogen.
Was Felipe betraf, so war seine erste Ehe (mit einer klugen und akademisch gebildeten Australierin) schon fast ein Jahrzehnt vor unserer Begegnung in Bali in die Brüche gegangen. Die Scheidung hatte sich damals zwar durchaus harmonisch angelassen, doch der Verlust der Ehefrau (und des Zugangs zu Haus, Kindern und fast zwei Jahrzehnten Lebensgeschichte, die damit verbunden waren) hatte bei dem guten Mann eine bleibende Traurigkeit hinterlassen, die vor allem durch Reue, Isolation und finanzielle Ängste charakterisiert war.
Aufgrund unserer Erfahrungen waren wir also hinsichtlich der Freuden des heiligen Ehebunds beide vorbelastet, besorgt und ausgesprochen misstrauisch. Wie alle, die das düstere Tal einer Scheidung jemals durchschritten haben, hatten Felipe und ich am eigenen Leibe die erschütternde Wahrheit erfahren: nämlich dass jede Liebesbeziehung – versteckt unter ihrer zunächst so schönen Oberfläche – stets die Zutaten zu einer absoluten Katastrophe bereithält. Und gelernt hatten wir auch, dass die Ehe ein Stand ist, in den man viel leichter hinein- als dass man wieder aus ihm herauskommt. Durch keinerlei Gesetz gehindert, kann der unverheiratete Partner eine unglückliche Beziehung jederzeit beenden. Sie aber – die Sie rechtmäßig verheiratet sind und der gescheiterten Liebe entkommen wollen – werden bald genug feststellen, dass ein beträchtlicher Teil Ihres Ehevertrags dem Staat gehört, und dass es zuweilen sehr lange dauern kann, bis der Sie daraus entlässt. Auf diese Weise kann man durchaus Monate oder sogar Jahre in einer lieblosen juristischen Bindung gefangen sein, die sich in der Zwischenzeit eher wie ein brennendes Haus anfühlt. Ein brennendes Haus, in dem Sie, meine Freundin, irgendwo drunten im Keller mit Handschellen an einen Heizkörper gekettet sind und sich nicht losreißen können, während der Rauch immer dichter wird und die Balken herunterkrachen …
Tut mir leid – klingt das alles wenig begeistert?
Ich teile diese unangenehmen Gedanken nur mit Ihnen, um zu erklären, warum Felipe und ich schon zu Beginn unserer Liebesgeschichte einen ziemlich ungewöhnlichen Pakt miteinander schlossen. Wir hatten uns gegenseitig geschworen, niemals und unter keinen Umständen zu heiraten. Wir hatten uns sogar versprochen, niemals unsere Finanzen und weltlichen Besitztümer zu vermengen, nur um den möglichen Alptraum, jemals wieder ein hochexplosives persönliches Munitionsdepot aus gemeinsamen Hypotheken, Verträgen, Besitztümern, Bankkonten, Küchengeräten und Lieblingsbüchern auseinanderklamüsern zu müssen, von vornherein auszuschließen. Nachdem diese Gelöbnisse entsprechend bekräftigt waren, begaben wir uns tatsächlich beruhigt in unsere sorgsam aufgeteilte Beziehung. Denn ebenso wie eine Verlobung vielen anderen Paaren ein umfassendes Gefühl des Schutzes vermittelt, verlieh uns unser Schwur, niemals zu heiraten, all die emotionale Sicherheit, die wir brauchten, um es noch einmal mit der Liebe zu versuchen. Und diese unsere Bindung – die sich bewusst jeder offiziellen Verpflichtung enthielt – hatte etwas so Befreiendes, dass es sich wie ein Wunder anfühlte. Es war, als hätten wir die Nordwestpassage vollkommener Intimität gefunden, etwas, das, wie García Márquez schrieb, »wie Liebe war, aber ohne die Probleme der Liebe«.
Folgendes also hatten wir bis zum Frühjahr 2006 getan: uns um unsere eigenen Angelegenheiten gekümmert und uns unbehelligt und zufrieden ein gemeinsames und doch auch behutsam getrenntes Leben aufgebaut. Und so könnten wir, da wir noch nicht gestorben sind, noch heute leben, wäre uns nicht etwas fürchterlich Ungelegenes in die Quere gekommen.
Das US-amerikanische Ministerium für Heimatschutz trat auf den Plan.
Das Dumme bei Felipe und mir war, dass wir – obwohl wir viele Gemeinsamkeiten und Vorzüge teilten – nicht dieselbe Nationalität besaßen. Felipe war von Geburt Brasilianer, hatte die australische Staatsangehörigkeit und lebte, als wir uns trafen, die meiste Zeit in Indonesien. Ich war Amerikanerin und hatte, von meinen Reisen einmal abgesehen, meistens an der Ostküste der Vereinigten Staaten gelebt. Zunächst sahen wir für unsere staatenlose Liebesgeschichte noch keine Probleme vorher, obgleich wir, im Rückblick betrachtet, eigentlich mit Komplikationen hätten rechnen sollen. Denn wie es das alte Sprichwort so schön ausdrückt: Ein Fisch und ein Vogel können sich zwar durchaus verlieben, doch wo sollen sie leben? Die Lösung des Dilemmas, so glaubten wir, lag darin, dass wir beide wendige Reisende waren (ich ein Vogel, der auch tauchen, Felipe ein Fisch, der auch fliegen konnte), so dass wir zumindest das erste Jahr unserer Liebesgeschichte mehr oder weniger in der Luft verbrachten – indem wir, um zusammen zu sein, über Ozeane und Kontinente hinweghechteten und –flogen.
Unsere Tätigkeiten ermöglichten uns zum Glück ein solch flexibles Arrangement. Als Schriftstellerin konnte ich meine Arbeit überallhin mitnehmen. Als Schmuck- und Edelsteinimporteur, der seine Ware in den Vereinigten Staaten verkaufte, musste Felipe sowieso ständig auf Reisen sein. Blieb uns lediglich, unsere Fortbewegung zu koordinieren. Daher flog ich nach Bali, oder er kam nach Amerika; gemeinsam reisten wir nach Brasilien oder trafen uns dann wieder in Sydney. Ich nahm einen befristeten Job an der Universität von Tennessee an, wo ich Schreibkurse gab, und ein paar merkwürdige Monate lang lebten wir in einem verfallenden alten Hotelzimmer in Knoxville zusammen. (Diese Wohnform kann ich übrigens jedem, der die tatsächlichen Kompatibilitätsverhältnisse einer neuen Beziehung austesten will, nur empfehlen.)
Wir lebten in einem ständigen Stakkato, permanent unterwegs, meistens zusammen, aber immer auf dem Sprung, wie Beobachter in einem dieser seltsamen UN-Schutzprogramme. Unsere Beziehung war – obwohl auf der persönlichen Ebene stets stabil und gelassen – eine andauernde logistische Herausforderung und, bei all den damit verbundenen Interkontinentalflügen, auch verdammt kostspielig. Und seelisch war sie ebenfalls aufreibend. Bei jedem Wiedersehen mussten Felipe und ich aufs Neue miteinander vertraut werden. Stets gab es am Flughafen jenen nervösen Augenblick, wo ich dastand, auf seine Ankunft wartete und mich fragte: Werde ich ihn wohl noch kennen? Wird er mich noch kennen? Nach dem ersten Jahr begannen wir uns beide nach etwas Stabilerem zu sehnen, und Felipe tat den großen Schritt. Er gab sein bescheidenes, aber wunderschönes Sommerhaus auf Bali auf und zog mit mir in ein winziges Häuschen am Rande Philadelphias, das ich kurz zuvor gemietet hatte.
Wenn die Entscheidung, Bali gegen einen Vorort von Philly einzutauschen, auch merkwürdig erscheinen mag, Felipe schwor, dass er des Lebens in den Tropen längst überdrüssig geworden war. Das Leben auf Bali, wo jeder Tag eine angenehme, langweilige Kopie des vorherigen darstelle, so klagte er, sei einfach zu leicht. Er habe schon eine ganze Weile daran gedacht, ihm den Rücken zu kehren – schon ehe er mich überhaupt kennengelernt habe. Sich im Paradies zu langweilen mag für den, der nie wirklich im Paradies gelebt hat, unverständlich erscheinen (ich jedenfalls fand die Vorstellung ein wenig verrückt), doch Balis Traumkulisse hatte sich für Felipe im Lauf der Jahre in etwas bedrückend Eintöniges verwandelt. Nie werde ich einen unserer letzten bezaubernden Abende vergessen, die er und ich zusammen in seinem Cottage verbrachten – wir saßen barfuß und mit taufeuchter Haut von der warmen Novemberluft im Freien, tranken Wein und sahen einen Ozean von Sternbildern über den Reisfeldern flimmern. Während duftende Winde durch die Palmen säuselten und die leise Musik einer fernen Tempelzeremonie von der Brise herübergetragen wurde, schaute Felipe mich an, seufzte und meinte kategorisch: »Ich habe diese Scheiße so satt. Ich kann es kaum erwarten, wieder nach Philly zu kommen.«
Also brachen wir nach Philadelphia (der Stadt der brüderlichen Schlaglöcher) auf. Tatsache war, dass wir beide die Gegend sehr mochten. Unser gemietetes Häuschen lag nicht weit vom Haus meiner Schwester entfernt, deren Nähe im Laufe der Jahre für mein Glück unerlässlich geworden ist, so dass wir uns dort heimisch fühlten. Außerdem erschien es uns nach all unseren gemeinsamen Jahren des Reisens an ferne Orte gut und sogar erholsam, in Amerika zu leben, einem Land, das wir trotz all seiner Mängel immer noch interessant fanden: als schnelles, multikulturelles, in ständiger Entwicklung befindliches, wahnsinnig widersprüchliches, auf kreative Weise herausforderndes und im Wesentlichen lebendiges Land.
Dort in Philadelphia schlugen Felipe und ich also unser Hauptquartier auf und praktizierten mit vielversprechendem Erfolg zum ersten Mal wirkliches häusliches Zusammenleben. Er verkaufte seinen Schmuck; ich arbeitete an Schreibprojekten, für die ich vor Ort bleiben und recherchieren musste. Er kochte; ich kümmerte mich um den Rasen; hin und wieder warf einer von uns den Staubsauger an. Im Haus waren wir gut aufeinander eingespielt, teilten uns ohne Arger und Streit die täglichen Pflichten. Wir waren ehrgeizig, produktiv und optimistisch. Das Leben war schön.
Doch dauerten solche Phasen der Stabilität ja nie lange. Wegen der Auflagen von Felipes Visum waren drei Monate die maximale Zeitspanne, die er sich legal in Amerika aufhalten konnte, eher er sich kurzzeitig in ein anderes Land verabschieden musste. Und so flog er davon, und ich war, während er fort war, mit meinen Büchern und meinen Nachbarn allein. Einige Wochen später dann kehrte er mit einem weiteren 90-Tage-Visum in die Vereinigten Staaten zurück, und wir nahmen unser gemeinsames Leben wieder auf. Der Beweis dafür, wie misstrauisch wir beide langfristigen Bindungen gegenüberstanden, war, dass wir diese 90-Tage-Portionen des Zusammenseins als ideal empfanden: genau die richtige Menge an Zukunftsplanung, die zwei ängstliche Scheidungsopfer bewältigen konnten, ohne sich allzu bedroht zu fühlen. Und manchmal, wenn es mir mein Terminplan erlaubte, begleitete ich ihn sogar auf seinen Visa-Spritztouren ins Ausland.
Dies erklärt, warum wir eines Tages gemeinsam von einer Geschäftsreise in Übersee in die Vereinigten Staaten zurückkehrten und – wegen unserer eigentümlichen Billigtickets und einem Anschlussflug – auf dem Internationalen Flughafen von Dallas/Fort Worth landeten. Ich rückte in der Schlange meiner heimkehrenden Landsleute rasch nach vorn und passierte die Einreisekontrolle als Erste. Als ich mich sicher auf der anderen Seite befand, wartete ich auf Felipe, der mitten in einer langen Schlange von Ausländern stand. Ich beobachtete, wie er sich dem Einwanderungsbeamten näherte, der bald sorgfältig Felipes bibeldicken australischen Pass studierte, jede Seite, jedes Zeichen, jedes Hologramm unter die Lupe nahm. Normalerweise waren sie nicht so gewissenhaft, und ich wurde – so lange, wie sich das alles hinzog – langsam nervös. Ich guckte und wartete, horchte auf das entscheidende Geräusch jeder erfolgreichen Grenzüberschreitung; jenes kräftige, feste Bibliothekarinnen-Tock des Visumsstempels, das einen für gewöhnlich willkommen hieß. Doch es kam nicht.
Stattdessen griff der Einwanderungsbeamte nach seinem Telefon und rief irgendwo an. Augenblicke später erschien ein Beamter in der Uniform des Heimatschutzministeriums und führte meinen Liebsten ab.
Sechs Stunden lang hielten die Uniformierten am Flughafen von Dallas Felipe fest und verhörten ihn. Sechs Stunden, während derer es mir verboten war, ihn zu sehen oder Fragen zu stellen, saß ich in einem Heimatschutz-Wartezimmer – einem nichtssagenden, mit Neonröhren beleuchteten Raum voller besorgter Menschen aus der ganzen Welt – alle gleich starr vor Angst. Ich hatte keine Ahnung, was sie Felipe da hinten antaten oder was sie von ihm wollten. Ich wusste, dass er gegen kein Gesetz verstoßen hatte, doch war dies kein so tröstlicher Gedanke, wie man sich vielleicht vorstellen mag. Dies war die Spätzeit der Präsidentschaft von George W. Bush: nicht gerade der entspannteste Moment der Weltgeschichte, um seinen im Ausland geborenen Liebsten in behördlichem Gewahrsam zu wissen. Ich versuchte, mich mit dem berühmten Gebet der Mystikerin Juliana von Norwich aus dem 14. Jahrhundert zu beruhigen (»Alles wird gut sein, und alles wird gut sein, und aller Art Dinge wird gut sein«), doch ich glaubte kein Wort davon. Nichts war gut. Nicht eine einzige Art von Ding war gut.
Hin und wieder erhob ich mich von meinem Plastikstuhl und versuchte, dem Einwanderungsbeamten hinter der kugelsicheren Glasscheibe weitere Informationen zu entlocken. Doch er ignorierte meine Appelle und spulte jedes Mal dieselbe Antwort ab: »Wenn wir Ihnen etwas über Ihren Freund zu sagen haben, Miss, dann lassen wir Sie das wissen.«
In einer derartigen Situation, wenn ich das sagen darf, gibt es in der englischen Sprache vielleicht kein kraftloseres Wort als boyfriend. Die abschätzige Art, mit der der Beamte dieses Wort aussprach, zeigte schon, wie wenig ihn meine Beziehung beeindruckte. Warum um Himmels willen sollte ein Regierungsangestellter jemals Informationen über einen bloßen Freund, meinen boyfriend, herausgeben? Ich empfand das Bedürfnis, mich dem Einwanderungsbeamten zu erklären, zu sagen: »Hören Sie – der Mann, den Sie da festhalten, ist mir sehr viel wichtiger, als Sie sich auch nur annähernd vorstellen können.« Doch sogar in meinem verängstigten Zustand hatte ich meine Zweifel, ob uns das so viel weiterbringen würde. Falls überhaupt, fürchtete ich, könnte zu viel Druck unangenehme Auswirkungen auf Felipe haben, so dass ich mich – hilflos – zurückhielt. Erst jetzt fällt mir ein, dass ich vermutlich hätte versuchen sollen, einen Rechtsanwalt anzurufen. Aber ich hatte kein Handy dabei und wollte meinen Posten im Warteraum nicht verlassen, auch kannte ich keine Anwälte in Dallas, und es war sowieso Sonntagnachmittag. Wen hätte ich also erreichen können?
Nach sechs Stunden schließlich erschien ein Polizist und führte mich durch mehrere Korridore, durch einen Kaninchenbau bürokratischer Geheimnisse, in einen kleinen, schwach beleuchteten Raum, wo Felipe und der Heimatschutzbeamte saßen, der ihn verhört hatte. Beide Männer wirkten gleichermaßen müde, doch nur einer dieser Männer war der meine – mein Geliebter, das vertrauteste Gesicht auf der Welt für mich. Bei seinem Anblick wurde mir vor Sehnsucht ganz weh ums Herz. Ich wollte ihn anfassen, aber ich spürte, dass das nicht gestattet war, so dass ich stehen blieb.
Felipe lächelte müde und sagte: »Unser Leben, mein Schatz, wird wohl demnächst sehr viel interessanter werden.«
Ehe ich etwas entgegnen konnte, nahm der Verhörbeamte die Sache und eventuelle Erklärungen rasch selbst in die Hand.
»Ma’am«, sagte er, »wir haben Sie herkommen lassen, um Ihnen zu erklären, dass wir Ihren Freund nicht mehr in die Vereinigten Staaten einreisen lassen werden. Wir nehmen ihn in Haft, bis wir einen Flug für ihn haben, einen Rückflug nach Australien, da er einen australischen Pass besitzt. Eine Rückkehr nach Amerika ist im Anschluss daran nicht mehr möglich.«
Meine erste Reaktion war körperlich. Mir war, als sei alles Blut in meinen Adern auf einen Schlag verdampft, und einen Moment lang konnte ich nicht mehr klar sehen. Dann, im nächsten Augenblick, begann mein Verstand wieder zu arbeiten. In Höchstgeschwindigkeit vergegenwärtigte ich mir, was dies tatsächlich bedeutete. Bereits lange vor unserer Begegnung hatte Felipe in den Vereinigten Staaten seinen Lebensunterhalt verdient, indem er mehrere Male im Jahr zu kürzeren Aufenthalten ins Land kam und ganz legal Edelsteine und Schmuck aus Brasilien und Indonesien einführte, um sie auf amerikanischen Märkten zu verkaufen. Amerika hat internationale Geschäftsleute wie ihn stets willkommen geheißen; sie bringen Waren und Geld ins Land und kurbeln die Wirtschaft an. Aber auch Felipe war in Amerika erfolgreich gewesen. Seine (inzwischen erwachsenen) Kinder hatte er mit dem im Lauf der Jahrzehnte in Amerika verdienten Geld auf die besten Privatschulen Australiens geschickt. Obwohl er bis vor kurzem niemals wirklich in Amerika gelebt hatte, war es der Mittelpunkt seines Erwerbslebens. Sein Warenbestand und alle seine Kontakte befanden sich hier. Falls er nie wieder nach Amerika einreisen durfte, war seine Existenz so gut wie vernichtet. Ganz abgesehen davon, dass ich hier in den Vereinigten Staaten lebte, dass Felipe mit mir zusammensein wollte und ich – wegen meiner Familie und meiner Arbeit – immer einen Wohnsitz in Amerika würde haben wollen. Aber auch Felipe gehörte inzwischen zur Familie. Meine Eltern, meine Schwester, meine Freunde, meine Welt hatten ihn rückhaltlos aufgenommen. Wie also sollten wir unser gemeinsames Leben fortsetzen, wenn er nie wieder einreisen durfte? Was sollten wir tun? (»Wo sollen wir beide schlafen?«, heißt es im Text eines traurigen Liebeslieds der Wintu-Indianer. »Am herabgezogenen zerklüfteten Himmelsrand? Wo sollen wir beide schlafen?«)
»Und mit welcher Begründung wollen Sie ihn abschieben?«, fragte ich den Heimatschutzbeamten und versuchte, respekteinflößend zu klingen.
»Strenggenommen, Ma’am, ist das keine Abschiebung.« Anders als ich musste der Beamte nicht versuchen, respekteinflößend zu klingen; er tat es einfach. »Wir verweigern ihm lediglich die Einreise in die Vereinigten Staaten mit der Begründung, dass er Amerika im letzten Jahr zu häufig besucht hat. Zwar hat er die Zeiten auf seinem Visum nie überschritten, doch alle Ein- und Ausreisen deuten darauf hin, dass er stets jeweils drei Monate bei Ihnen in Philadelphia gelebt und dann das Land verlassen hat, um unmittelbar darauf wieder in die Vereinigten Staaten zurückzukehren.«
Dies war kaum zu bestreiten, weil es genau das war, was Felipe getan hatte.
»Ist das denn ein Verbrechen?«, fragte ich.
»Nicht direkt.«
»Nicht direkt oder nein?«
»Nein, Ma’am, es ist kein Verbrechen. Deswegen verhaften wir ihn ja auch nicht. Aber die dreimonatige Visumsfreiheit, die die Regierung der Vereinigten Staaten den Bürgern freundlich gesinnter Länder anbietet, ist nicht für unbefristete fortlaufende Besuche gedacht.«
»Aber das wussten wir nicht«, erwiderte ich.
Nun mischte Felipe sich ein. »Genaugenommen, Sir, hat uns sogar einmal ein Einwanderungsbeamter in New York erklärt, dass ich die Vereinigten Staaten so oft besuchen kann, wie ich will, solange ich nur mein 90-Tage-Visum nicht überschreite.«
»Ich weiß nicht, wer Ihnen das gesagt hat, aber es stimmt nicht.«
Als ich den Beamten das sagen hörte, erinnerte ich mich an die Worte, mit denen Felipe mich einst vor internationalen Grenzübertritten gewarnt hatte: Nimm es nie auf die leichte Schulter, Liebling. Denk immer daran, dass jeden Tag und aus jedem nur möglichen Grund jeder beliebige Grenzposten auf der Welt entscheiden kann, dass er dich nicht hineinlassen will.
»Was würden denn Sie in dieser, in unserer Situation tun?«, fragte ich ihn. Das ist eine Technik, die ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe und immer anwende, wenn ich mit einem tumben Kundendienstler oder einem apathischen Bürokraten nicht weiterkomme. Indem man den Satz so und nicht anders formuliert, fordert man die Person, die alles in der Hand hat, auf, einen Moment lang innezuhalten und sich in das machtlose Gegenüber hineinzuversetzen. Es ist ein subtiler Appell an das Mitgefühl. Manchmal hilft es. Meistens hilft es, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Aber ich wollte einfach nichts unversucht lassen.
»Nun, falls Ihr Freund je wieder in die Vereinigten Staaten zurückkommen möchte, so wird er sich ein besseres, länger gültiges Visum besorgen müssen. Wenn ich Sie wäre, würde ich versuchen, ihm eins zu verschaffen.«
»Okay dann«, sagte ich. »Und wie können wir ihm am schnellsten ein besseres, länger gültiges Visum beschaffen?«
Der Beamte blickte auf Felipe, dann auf mich, dann wieder auf Felipe. »Jetzt mal ehrlich?«, fragte er. »Sie beide müssen heiraten.«
Mir schlug das Herz – fast hörbar – bis zum Hals. Und durch den winzigen Raum konnte ich förmlich spüren, wie Felipes Herz in dumpfem Gleichklang mit dem meinen pochte.
Im Rückblick scheint es wirklich unglaublich, dass mich das überhaupt hatte überraschen können. Hatte ich denn um Himmels willen noch nie von Scheinehen gehört, um an eine Green Card zu kommen? Vielleicht wirkt es ebenso unglaublich, dass mich der Heiratsvorschlag – angesichts der Dringlichkeit der Umstände – eher in Bedrängnis brachte, als dass er mir Erleichterung verschaffte. Ich meine, wenigstens hatte man uns diese Wahl gelassen, nicht wahr? Und dennoch überraschte mich der Vorschlag. Und schmerzte mich. Allein den Gedanken an Ehe hatte ich derart gründlich aus meinem Bewusstsein verdrängt, dass ihn ausgesprochen zu hören nun wie ein Schock auf mich wirkte. Ich fühlte mich traurig, niedergeschlagen, bedrückt und eines wesentlichen Teils meiner selbst beraubt, vor allem aber fühlte ich mich gefangen. Wir waren es beide. Der fliegende Fisch und der tauchende Vogel waren ins Netz gegangen. Und nicht zum ersten Mal in meinem Leben holte meine Naivität mich ein und versetzte mir eine schallende Ohrfeige: Warum war ich nur so dumm gewesen, mir einzubilden, wir könnten ewig und ungestraft so weiterleben, wie es uns passte?
Eine kurze Weile herrschte Schweigen, bis der Verhörbeamte – unsere stummen Weltuntergangsmienen betrachtend – meinte: »Tut mir leid, Herrschaften. Aber was ist denn eigentlich so schlimm daran?«
Felipe nahm seine Brille ab und rieb sich die Augen – ein Zeichen äußerster Erschöpfung, wie ich aus langer Erfahrung wusste. Er seufzte: »Ach, Tom, Tom, Tom …«
Bis zu diesem Moment war mir nicht aufgefallen, dass die beiden sich bereits mit Vornamen ansprachen. Wahrscheinlich passiert das während eines sechsstündigen Verhörs wie von selbst. Vor allem wenn es sich beim Verhörten um Felipe handelt.
»Nein, mal ganz ehrlich – wo liegt das Problem?«, fragte Officer Tom. »Allem Anschein nach haben Sie schon zusammengelebt. Ganz offensichtlich mögen Sie sich, Sie sind mit sonst niemandem verheiratet …«
»Sie müssen wissen, Tom«, erklärte nun Felipe, sich vorbeugend und mit einer Vertraulichkeit, die unsere »amtliche« Umgebung Lügen strafte, »dass sowohl Liz als auch ich wirklich grauenhafte Scheidungen hinter uns haben.«
Officer Tom stieß einen kleinen Laut hervor – eine Art leises, mitfühlendes »Oh …«. Dann nahm auch er die Brille ab und rieb sich die Augen. Automatisch blickte ich auf den dritten Finger seiner linken Hand. Kein Ehering. Ausgehend von dieser nackten linken Hand und seiner reflexhaften Reaktion matten Mitgefühls kam ich zu meiner prompten Diagnose: geschieden.
An diesem Punkt bekam unser Verhör dann etwas Surreales.
»Nun, Sie können ja immer noch einen Ehevertrag machen«, schlug Officer Tom vor. »Ich meine, wenn Sie Angst haben, noch mal das ganze Finanzchaos einer Scheidung durchstehen zu müssen. Oder falls Ihnen die Beziehungsgeschichten Angst machen, wäre Paarberatung vielleicht eine gute Idee.«
Verwundert hörte ich zu. Gab uns ein Beamter desUS-Heimatschutzministeriums nun etwa Eheratschläge? In einem Verhörraum? In den Katakomben des Internationalen Flughafens von Dallas-Fort Worth?
Als ich meine Stimme wiedergefunden hatte, bot ich diese geniale Lösung an: »Wie wäre es, Officer Tom, wenn ich einfach eine Möglichkeit fände, Felipe irgendwie bei mir einzustellen, statt ihn zu heiraten? Könnte ich ihn nicht auch als Angestellten nach Amerika bringen statt als meinen Ehemann?«
Felipe setzte sich kerzengerade auf und rief aus: »Was für eine grandiose Idee, Schatz!«
Officer Tom bedachte uns beide mit einem befremdeten Blick. Er fragte Felipe: »Mal ganz ehrlich, Sie hätten diese Frau lieber zur Chefin als zur Ehefrau?«
»Mein Gott, natürlich!«
Ich spürte, wie Officer Tom sich fast physisch zurückhalten musste, nicht zu fragen: »Was seid ihr bloß für Leute, zum Teufel?« Aber dafür war er viel zu professionell. Stattdessen räusperte er sich und meinte: »Leider ist das, was Sie eben vorgeschlagen haben, in diesem Lande nicht rechtmäßig.«
Felipe und ich versanken – erneut in völligem Gleichklang – in bedrücktem Schweigen.
Nachdem wir lange so dagesessen hatten, meldete ich mich wieder zu Wort. »In Ordnung«, sagte ich resigniert. »Bringen wir es hinter uns. Wenn ich Felipe auf der Stelle, gleich hier in Ihrem Büro, heirate, lassen Sie ihn dann heute noch einreisen? Vielleicht haben Sie ja einen Kaplan hier am Flughafen, der das machen könnte?«
Es gibt Momente im Leben, in denen auch die Gesichter gewöhnlicher Menschen etwas nahezu Göttliches gewinnen, und genau dies geschah nun. Officer Tom – ein müder texanischer Heimatschutzbeamter mit Dienstmarke und Wampe – lächelte mich mit einer Traurigkeit und Güte, einem strahlenden Mitgefühl an, die in diesem muffigen entmenschlichenden Raum völlig fehl am Platz waren. Plötzlich sah er selbst aus wie ein Kaplan.
»Oh neeiiin …«, meinte er sanft. »So geht das leider nicht.«
Wenn ich heute auf all das zurückblicke, ist mir natürlich klar, dass Officer Tom damals schon wusste – und weit besser, als wir es hätten ahnen können –, was mir und Felipe blühte. Er wusste genau, dass die Beschaffung eines offiziellen US-amerikanischen Verlobtenvisums, vor allem nach einem derartigen »Grenzzwischenfall«, kein Honigschlecken sein würde. Officer Tom sah all den Ärger, der nun auf uns zukam, voraus; von den Rechtsanwälten in drei Ländern – zudem auf drei Kontinenten –, die die nötigen Dokumente beschaffen mussten, bis hin zu den bundespolizeilichen Zeugnissen, die man aus jedem Land, in dem Felipe jemals gelebt hatte, benötigte; von den Stapeln persönlicher Briefe, Fotos und anderer vertraulicher Ephemera, die wir nun würden zusammensuchen müssen, um zu beweisen, dass unsere Beziehung real war (einschließlich – aberwitzige Ironie des Ganzen – solcher Belege wie etwa gemeinsamer Bankkonten – Einzelheiten, bei denen wir uns eigens besondere Mühe gegeben hatten, sie getrennt zu halten), bis hin zu den Fingerabdrücken, den Impfungen, den für das Tbc-Screening nötigen Lungenaufnahmen, den Verhören in den amerikanischen Auslandsbotschaften, den Militärunterlagen, die wir auf irgendeine Weise über Felipes fünfunddreißig Jahre zurückliegenden Wehrdienst in Brasilien würden beschaffen müssen; vom schieren Ausmaß und Aufwand an Zeit, die Felipe nun bis zum Abschluss dieses Verfahrens außerhalb des Landes würde zubringen müssen, bis zum Allerschlimmsten, der grässlichen Unsicherheit, nicht zu wissen, ob all diese Anstrengungen letztlich reichen würden – das heißt, nicht zu wissen, ob die Regierung der Vereinigten Staaten (die sich hier mehr oder weniger wie ein strenger, altmodischer Vater aufführte) diesen Mann jemals als Ehemann für mich, ihre eifersüchtig gehütete leibliche Tochter, akzeptieren würde.
Officer Tom also wusste das alles bereits, und die Tatsache, dass er uns für das, was uns nun bevorstand, seines Mitgefühls versicherte, war in einer ansonsten verheerenden Lage eine unerwartet freundliche Wendung. Und die Tatsache, dass ich mir bis zu diesem Augenblick niemals hätte vorstellen können, einen Angehörigen des Heimatschutzministeriums in einem gedruckten Werk für seine menschliche Empfindsamkeit zu loben, wirft nur ein Schlaglicht darauf, wie skurril diese ganze Situation inzwischen geworden war. Aber ich sollte hier auch erwähnen, dass Officer Tom uns einen weiteren freundlichen Gefallen gewährte. (Das heißt, ehe er Felipe in Handschellen legte und ins Dallas County Jail abführte, um ihn über Nacht zusammen mit wirklichen Verbrechern in eine Gefängniszelle zu sperren.) Die Geste, die Officer Tom machte, war folgende: Er ließ uns beide für volle zwei Minuten im Verhörraum allein, so dass wir uns ungestört voneinander verabschieden konnten.
Wenn man nur zwei Minuten hat, um dem geliebtesten Menschen auf der Welt Lebewohl zu sagen, und nicht weiß, wann man sich wiedersieht, kann man, weil man alles auf einmal sagen, tun und klären will, völlig blockiert sein. In unseren zwei ungestörten Minuten im Verhörraum fassten wir daher einen hastigen, atemlosen Plan. Ich würde heimfliegen nach Philadelphia, aus unserem gemieteten Haus ausziehen, sämtliche Möbel einlagern, einen auf Einwanderung spezialisierten Anwalt anheuern und das juristische Verfahren in Gang bringen. Felipe würde selbstverständlich in den Knast wandern. Dann würden sie ihn nach Australien abschieben – auch wenn es sich, streng genommen, nicht um eine rechtskräftige »Abschiebung« handelte. (Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich das ganze Buch hindurch »abschieben« und »Abschiebung« schreibe, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich es sonst nennen soll, wenn ein Mensch aus einem Land geworfen wird.) Da Felipe in Australien weder ein Leben noch eine Wohnung oder eine wirtschaftliche Perspektive hatte, würde er sich so rasch wie möglich bemühen müssen, in ein billigeres Land zu gehen – wahrscheinlich irgendwo nach Südostasien-, und ich würde auf jener Seite der Welt zu ihm stoßen, sobald ich auf dieser die Dinge ins Rollen gebracht hatte. Dort würden wir dann gemeinsam die vorerst noch nicht absehbare Zeit der Unsicherheit abwarten.
Während mir Felipe die Telefonnummern seines Anwalts, seiner erwachsenen Kinder und seiner Geschäftspartner aufschrieb, damit ich alle über seine Lage informieren konnte, kippte ich meine Handtasche aus und suchte fieberhaft nach Dingen, die ich ihm geben konnte, um ihm den Gefängnisaufenthalt zu erleichtern: Kaugummi, mein gesamtes Bargeld, eine Flasche Wasser, ein Foto von uns beiden und meine Flugzeuglektüre, einen Roman mit dem durchaus passenden Titel Die einsamen Schrecken der Liebe.
Dann füllten sich Felipes Augen mit Tränen und er sagte: »Danke, dass du in mein Leben gekommen bist. Egal was jetzt geschieht, egal, wofür du dich als Nächstes entscheidest, du sollst nur wissen, dass du mir die zwei schönsten Jahre meines Lebens geschenkt hast und ich dich nie vergessen werde.«
Blitzartig realisierte ich: Mein Gott, der Mann glaubt tatsächlich, ich könnte ihn jetzt verlassen. Seine Reaktion überraschte und berührte mich, mehr als alles andere aber beschämte sie mich. Seit Officer Tom uns unsere Optionen genannt hatte, war es mir nicht einmal in den Sinn gekommen, Felipe nun lieber doch nicht zu heiraten, er jedoch hatte offenbar damit gerechnet, dass er nun den Laufpass bekam. Er fürchtete tatsächlich, ich könne ihn aufgeben, ihn, pleite und ruiniert, im Stich lassen. Hatte ich einen derartigen Ruf verdient? Kannte man mich (sogar im Rahmen unserer kleinen Liebesgeschichte) als jemanden, der beim ersten Hindernis die Seiten wechselte? Doch waren Felipes Befürchtungen, wenn man meine Vergangenheit berücksichtigte, so völlig aus der Luft gegriffen? Wäre ich in der umgekehrten Situation an seiner Stelle gewesen, hätte ich nie auch nur eine Sekunde lang an der Festigkeit seiner Treue oder seiner Bereitschaft, praktisch jedes Opfer für mich zu bringen, gezweifelt. Konnte er bei mir auf dieselbe Standhaftigkeit zählen?
Wäre diese Geschichte zehn oder fünfzehn Jahre früher passiert, hätte ich – ich muss es gestehen – meinen dermaßen gefährdeten Partner aller Voraussicht nach sitzengelassen. Leider besaß ich in meiner Jugend, wenn überhaupt, nur ein ganz dürftiges Quäntchen Ehre, und flatterhaftes und gedankenloses Verhalten waren gewissermaßen eine Spezialität von mir. Heute ist mir Charakterfestigkeit allerdings wichtig, und sie wird mir mit dem Alter immer wichtiger. In diesem Augenblick also, und mir blieb ja nur noch dieser eine mit Felipe, tat ich das einzig Richtige für diesen Mann, den ich anbetete. Ich schwor ihm – und ich bläute ihm die Worte buchstäblich ein, damit er begriff, wie ernst es mir damit war –, dass ich ihn nicht verlassen, sondern alles Nötige unternehmen würde, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, und dass, auch wenn es in Amerika irgendwie nicht klappen sollte, wir trotzdem zusammenbleiben würden, irgendwo auf der Welt, wo immer das auch sein würde.
Officer Tom kehrte ins Zimmer zurück.
Im letzten Augenblick flüsterte Felipe mir noch zu: »Ich liebe dich so sehr, dass ich dich sogar heirate.«
»Und ich liebe dich so sehr«, revanchierte ich mich, »dass ich sogar dich heirate.«
Dann trennten uns die netten Leute vom Heimatschutz, legten Felipe Handschellen an und führten ihn ab – erst in den Knast und dann ins Exil.
Als ich an jenem Abend allein heimflog zu unserem nun obsoleten kleinen Zuhause in Philadelphia, bedachte ich etwas nüchterner, was ich vor wenigen Stunden versprochen hatte. Überrascht stellte ich fest, dass ich weder heulte noch in Panik geriet; irgendwie schien mir die Situation dazu zu ernst. Stattdessen empfand ich eine wilde Entschlossenheit – ein Gefühl, dass diese Situation mit äußerster Zielstrebigkeit in Angriff zu nehmen sei. Im Laufe nur weniger Stunden war mein Leben mit Felipe – wie von einem großen kosmischen Pfannenheber – fein säuberlich gewendet und auf den Kopf gestellt worden. Und nun, so schien es, waren wir verlobt und würden heiraten. Das war ja nun in der Tat eine seltsame und überstürzte Verlobungsfeier gewesen, die sich allerdings mehr nach Kafka als nach Austen anfühlte. Gleichwohl war sie offiziell – weil sie es sein musste.
Also, sei’s drum. Bestimmt war ich nicht die Erste in unserer Familie, die aus einer schwierigen Situation heraus heiraten musste – wenn es sich auch bei mir zum Glück nicht um eine ungewollte Schwangerschaft handelte. Dennoch, das Rezept war das Gleiche: Schließ den Bund fürs Leben, und tu es rasch. Also würden wir es eben tun. Das eigentliche Problem aber war, wie ich in jener Nacht auf meinem einsamen Heimflug nach Philadelphia erkannt hatte, dies: Ich hatte keine Ahnung, was die Ehe überhaupt war.
Diesen Fehler – eine Ehe einzugehen, ohne auch nur das Geringste von dieser Institution zu begreifen – hatte ich schon einmal in meinem Leben gemacht. Tatsächlich hatte ich mich im völlig unreifen Alter von fünfundzwanzig Jahren, ähnlich wie ein Labrador, der in ein Schwimmbecken hechtet, in meine erste Ehe gestürzt – mit genauso viel Überlegung und Voraussicht. Ein Riesenfehler, wie sich herausstellte. Doch damals, mit fünfundzwanzig, war ich noch so verantwortungslos, dass man mir vermutlich nicht mal die Entscheidung über meine eigene Zahnpasta hätte überlassen sollen, und erst recht nicht die über meine Zukunft, weswegen mich diese Sorglosigkeit, wie man sich vorstellen kann, auch teuer zu stehen kam. Sechs Jahre später hatte ich die bitteren Konsequenzen zu tragen – vor der düsteren Kulisse eines Scheidungsgerichts.
Wenn ich an meinen ersten Hochzeitstag denke, fällt mir Richard Aldingtons Roman Heldentod ein, wo der Erzähler über seine beiden jungen Liebenden an ihrem unglückseligen Hochzeitstag reflektiert: »Ist es überhaupt möglich, all das aufzuzählen, was George Augustus und Isabel nicht wussten, wovon sie keine Ahnung hatten, als sie einander gelobten, ›bis dass der Tod uns scheidet‹?« Auch ich war einst eine glückstrunkene junge Braut ganz ähnlich wie Aldingtons Isabel gewesen, über die er schrieb: »Was sie nicht wusste, umfasste so ziemlich den ganzen Bereich menschlicher Kenntnisse. Die Schwierigkeit wäre nur, herauszufinden, was sie eigentlich wusste.«
Auch nun jedoch – im reiferen und beträchtlich weniger glückstrunkenen Alter von siebenunddreißig – war ich mir durchaus nicht sicher, viel mehr über die Realität der institutionalisierten Beziehung zu wissen als damals. Ich war in der Ehe gescheitert und hatte entsetzliche Angst vor der Ehe, aber ich weiß nicht, ob mich das zu einer Eheexpertin machte; es machte mich lediglich zu einer Expertin des Scheiterns und der Panik, und diese Gebiete sind ja bereits von unzähligen Experten besetzt. Doch das Schicksal hatte nun eingegriffen und verlangte, dass ich heiratete, und ich hatte genug aus meinen Erfahrungen gelernt, um zu wissen, dass man Eingriffe des Schicksals zuweilen als Einladung interpretieren sollte, seine größten Ängste anzugehen oder gar zu überwinden. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass einem das Schicksal – wenn es einen zu etwas drängt, das man stets verabscheut oder gefürchtet hat – zumindest eine interessante Chance einer persönlichen Entwicklung bietet.
Und so dämmerte mir auf diesem Flug von Dallas nach Philadelphia – während meine Welt auf den Kopf gestellt, mein Liebhaber ausgewiesen und wir beide praktisch zum Heiraten verdonnert worden waren – peu à peu, dass ich diese Zeit womöglich nutzen sollte, um irgendwie mit der Ehe Frieden zu schließen, bevor ich mich in eine neue stürzte. Vielleicht war es ja wirklich klug, ein wenig Mühe in die Auflösung des Rätsels zu investieren, was in Gottes Namen und in der Geschichte der Menschen diese berauschende und irritierende, diese widersprüchliche und dennoch hartnäckig sich haltende Institution der Ehe denn nun eigentlich ist.
Und so bin ich dann verfahren. In den nächsten zehn Monaten – in denen ich mit Felipe als entwurzelte Exilantin umherreiste und mich wie eine Irre abmühte, um ihn wieder nach Amerika zurückzubringen, damit wir dort und nur dort heiraten konnten (denn sich in Australien oder sonst irgendwo auf der Welt zu verehelichen, hatte Officer Tom uns gewarnt, würde lediglich das Heimatschutzministerium irritieren und unser Einwanderungsverfahren nur noch weiter verzögern) – war das Einzige, worüber ich nachdachte, das Einzige, worüber ich las und mehr oder weniger auch mein einziger Gesprächsstoff das verwirrende Thema Ehe.
Ich beauftragte meine Schwester daheim in Philadelphia (die praktischerweise Historikerin ist), mir kistenweise Bücher über die Ehe zu schicken. Sie verschiffte sie an Orte auf dem gesamten Globus. Wo immer Felipe und ich uns gerade aufhielten, zog ich mich in unser Hotelzimmer zurück, um mich in sie zu vertiefen, und verbrachte unzählige Stunden in Gesellschaft so hervorragender Gelehrter wie Stephanie Coontz und Nancy Cott – Autorinnen, deren Namen ich zwar nie zuvor gehört hatte, die aber nun zu meinen Heroinnen und Lehrerinnen avancierten. Zugegeben, die ganze Lektüre machte mich zu einer lausigen Touristin. Während dieser vielen Monate des Reisens verschlug es Felipe und mich an viele schöne und faszinierende Orte, doch ich fürchte, ich habe zuweilen nicht sonderlich auf unsere Umgebung geachtet. Das Gefühl von Sorglosigkeit und Abenteuer kam bei all diesen Reisen ja sowieso nicht auf. Eher fühlte es sich wie eine Vertreibung an, eine Hidschra. Zu reisen, weil man nicht mehr nach Hause kann, weil einem der Reisenden die legale Einreise verwehrt bleibt, kann nie ein erfreuliches Unterfangen sein.
Darüber hinaus war unsere Situation auch finanziell nicht erfreulich. Zwar sollte sich Eat, Pray, Love kaum ein Jahr später zu einem lukrativen Bestseller entwickeln, doch war dieses glückliche Ereignis bisher weder eingetroffen, noch rechneten wir je damit. Felipe war inzwischen völlig von seiner Einkommensquelle abgeschnitten, so dass wir beide vom bescheidenen Honorar meines letzten Buchvertrags lebten, und ich wusste nicht, wie lange dieses Geld noch vorhalten würde. Eine Weile, sicherlich – aber nicht auf unabsehbare Zeit. Kurz zuvor hatte ich an einem neuen Roman zu arbeiten begonnen, doch Felipes Ausweisung hatte meine Recherchen und das Schreiben unterbrochen. All dies erklärt, warum wir schließlich in Südostasien landeten, wo zwei genügsame Menschen durchaus von etwa 30 Dollar am Tag leben können. Wenn ich auch nicht behaupten will, dass wir während dieser Exilphase gelitten haben (wir waren ja keine hungernden politischen Flüchtlinge, um Himmels willen), will ich nicht verschweigen, dass es eine überaus merkwürdige und angespannte Art zu leben war, wobei die Unsicherheit des Ausgangs die Merkwürdigkeit und Anspannung nur noch steigerte.
Fast ein Jahr lang zogen wir von Ort zu Ort und warteten auf den Tag, an dem Felipe zu seinem Interview im amerikanischen Konsulat in Sydney einbestellt wurde. Und während wir uns in der Zwischenzeit von Land zu Land treiben ließen, ähnelten wir allmählich immer mehr einem schlaflosen Paar, das sich bemüht, in einem fremden und unbequemen Bett eine erträgliche Schlafposition zu finden. Viele bange Nächte lang lag ich tatsächlich in unzähligen fremden und unbequemen Betten, lag im Dunkeln, kämpfte mich durch all meine Konflikte und Vorurteile über die Ehe, ging im Kopf die gelesenen Informationen durch, durchforstete die Geschichte nach tröstlichen Beispielen.
Ich sollte hier vielleicht von vornherein klarstellen, dass ich meine Studien und Recherchen auf die Ehe in der abendländischen Geschichte beschränkt habe und sich diese kulturelle Begrenzung daher in diesem Buch widerspiegelt. Jeder Historiker oder Anthropologe, der sich mit der Ehe beschäftigt, wird gewaltige Lücken in meinen Ausführungen entdecken, da ich ganze Kontinente und Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte unerforscht lasse, ganz zu schweigen davon, dass ich einige ziemlich lebendige Eheformen (etwa die Polygamie, um nur ein Beispiel zu nennen) unterschlage. Es wäre sicher vergnüglich gewesen, und bestimmt auch sehr lehrreich, mich noch stärker in alle nur denkbaren Heiratssitten auf dieser Erde zu vertiefen, doch dazu fehlte mir einfach die Zeit. Schon allein der Versuch, etwa das komplexe Wesen der Ehe in der islamischen Gesellschaft in den Griff zu bekommen, hätte mir jahrelange Studien abverlangt, wie mir nach der Lektüre nur weniger Bücher zum Thema klar