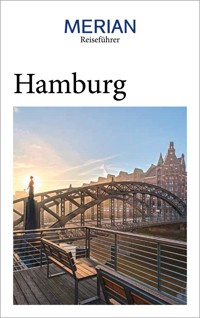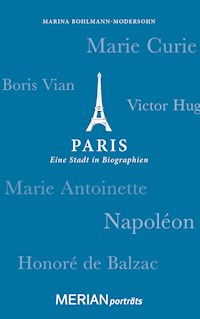7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine ungewöhnliche Frau kämpft um ihren Platz in der Kunst.
Clara Rilke-Westhoff (1878–1954), Tochter aus Bremer Kaufmannsfamilie, war eine der Vorreiterinnen der Frauen in der Kunst. Wie ihre Weggefährtin Paula Modersohn-Becker brach sie mit den Konventionen ihrer Zeit und wählte eine Domäne, die bis dahin vor allem Männern vorbehalten war: die Bildhauerei. Sie geht nach München – um 1900 neben Paris die führende Kunststadt Europas – dann in die Künstlerkolonie Worpswede, arbeitet bei Max Klinger und wird Schülerin Auguste Rodins. Zurück in Worpswede begegnet sie Rainer Maria Rilke. 1901 heiraten die beiden. Zeitlebens leidet die Künstlerin unter dem Spannungsverhältnis ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter und ihrem künstlerischen Schaffen. Heute stehen ihre Skulpturen Seite an Seite mit den Werken Rodins im Pariser Musée d‘Orsay.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Zum Buch
CLARA RILKE-WESTHOFF (1878–1954), Tochter aus Bremer Kaufmannsfamilie und Ehefrau Rainer Maria Rilkes, war eine der Vorreiterinnen der Frauen in der Kunst. Wie ihre enge Freundin und Weggefährtin Paula Modersohn-Becker brach sie mit den Konventionen ihrer Zeit und wählte eine Domäne, die bis dahin vor allem Männern vorbehalten war: die Bildhauerei.
Sie geht nach München – um 1900 neben Paris die führende Kunststadt Europas –, dann in die Künstlerkolonie Worpswede, arbeitet bei Max Klinger und wird Schülerin Auguste Rodins. Zurück in Worpswede begegnet sie einem jungen Dichter, der tief beeindruckt von ihr ist: Rainer Maria Rilke. 1901 heiraten die beiden. Zeitlebens sollte die Künstlerin unter dem Spannungsverhältnis zwischen ihren privaten Lebensumständen, ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter und ihrem künstlerischen Schaffen leiden.
Einfühlsam und basierend auf fundierter Recherche erzählt die Sachbuchautorin Marina Bohlmann-Modersohn (»Paula Modersohn-Becker. Eine Biografie mit Briefen«) das Leben einer zu Unrecht vergessenen Frau, die Porträtskulpturen von großer Ausdruckskraft schuf und zu den wenigen Bildhauerinnen von Bedeutung in der deutschen Kunst der Jahrhundertwende zählt.
Zur Autorin
MARINA BOHLMANN-MODERSOHN, geboren in Bremen, arbeitete nach ihrem Studium an der Sorbonne für die Pariser Redaktion des SPIEGEL. Sie veröffentlichte zahlreiche biografische Essays und ist langjährige MERIAN-Autorin. Sie lebt heute mit ihrer Familie bei Bremen
MARINA BOHLMANN-MODERSOHN
Clara Rilke-Westhoff
Eine Biografie
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright © 2015 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlaggestaltung: semper smile, München, Umschlagmotiv: Paula Modersohn-Becker »Porträt Clara Rilke-Westhoff«, 1905, Hamburger Kunsthalle © akg/picture alliance
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12310-9V002
www.btb-verlag.de
INHALT
KAPITEL I
Oh, München! Diese göttliche Freiheit!
OKTOBER 1896 –MÄRZ 1898
KAPITEL II
Eine Künstlerin muss frei sein … sonst kann sie sich nicht entwickeln
WORPSWEDE – LEIPZIG, FRÜHJAHR 1898 – DEZEMBER 1899
KAPITEL III
Heute war ich wieder bei Rodin im Atelier
PARIS 1899 – SEPTEMBER 1900
KAPITEL IV
Ich habe sehr viel vor
WORPSWEDE 1900
KAPITEL V
Man nennt mich jetzt Frau Rilke
WORPSWEDE, JANUAR 1901 – SEPTEMBER 1902
KAPITEL VI
Ich war meiner Kunst noch nie so nahe wie jetzt
WORPSWEDE 1902
KAPITEL VII
Arbeiten, wie wir noch nie gearbeitet haben
WORPSWEDE – PARIS – ROM 1902 – 1904
KAPITEL VIII
Kann aber mit dem Mutter-Sein nicht so schnell
BREMEN – KOPENHAGEN – FRIEDELHAUSEN – WORPSWEDE 1904 – 1906
KAPITEL IX
Und da reitet man durch die Wüste auf einem Kamel
BERLIN – KAIRO 1906 – 1907
KAPITEL X
Mein Wunsch, Hauptmann zu modellieren
WORPSWEDE – PARIS – BERLIN 1908–1910
KAPITEL XI
Dass ich ein bisschen fester stehe im Leben
MÜNCHEN – PARIS 1911–1913
KAPITEL XII
Paris scheint mir ganz verödet ohne ihn
MÜNCHEN – FISCHERHUDE 1913–1917
KAPITEL XIII
Jetzt wird mir langsam wieder freier und froher
FISCHERHUDE 1918 – 1925
KAPITEL XIV
Einliegend zwei Fotos von einer Büste
FISCHERHUDE 1926 – 1954
ANHANG
PERSONENREGISTER
BILDNACHWEIS
BILDTEIL
KAPITEL I
Oh, München! Diese göttliche Freiheit!
OKTOBER 1896 – MÄRZ 1898
Von jungen Mädchen findet man’s entsetzlich, wenn sie ein Selbst sein wollen, sie dürfen überhaupt nichts sein, im besten Fall eine Wohnstubendekoration oder ein brauchbares Haustier, von tausend lächerlichen Vorurteilen eingeengt.
Franziska zu Reventlow
Siebzehn! Das Bedürfnis, aufzubrechen, um sich weit weg von dort, woher sie stammt, allein und ungestört auf ihre künstlerische Laufbahn vorzubereiten, setzt eine gehörige Portion Selbstvertrauen voraus, viel Mut, einen exzessiven Freiheitsdrang und Neugier auf das Fremde.
Weiß Clara Henriette Sophie Westhoff, wie verbreitet die Vorurteile Frauen gegenüber sind, die Kunst studieren wollen mit dem Ziel, diese zu ihrem Beruf zu machen und damit Geld zu verdienen? Ist ihr bewusst, wie groß die männliche Konkurrenz ist, wie verschworen die Bünde der Meistermaler, die malende junge Frauen als Dilettantinnen verhöhnen und ihnen das Tor zu einem Akademiestudium immer noch verschlossen halten? Kann sie sich ein Bild machen, wie schwierig die Lebensbedingungen speziell für Künstlerinnen sind und schließlich: Wie kaum vereinbar Leben und Kunst?
Doch Fragen solcher Art übersteigen vermutlich ihre 17-jährige Vorstellungskraft, und statt sie sich zu diesem frühen Zeitpunkt ihres jungen Lebens überhaupt zu stellen, packt sie im Oktober 1895 lieber ihre Koffer und freut sich auf das nun beginnende Neue.
Dass der Vater, gebürtiger Bremer und Kaufmann in zweiter Generation, auf den Wunsch seiner einzigen Tochter, Malerin zu werden und für ihre künstlerische Ausbildung nach München zu gehen, mit wohlwollender Akzeptanz reagiert und nicht mit Entsetzen – in der von patriarchalischen Strukturen und moralischen Zwängen geprägten Gesellschaft des deutschen Kaiserreichs ist das keine Selbstverständlichkeit.
Doch Friedrich Westhoff, der seine drei Kinder von früh auf im Zeichnen und Malen unterrichten ließ und selbst in jeder freien Minute hinaus in die Natur ging, um zu malen, fühlt sich der Kunst verbunden, und in der Familie seiner zweiten Ehefrau Johanna Westhoff, geborene Hartung, einer weltoffenen und von bürgerlichen Wertvorstellungen unabhängigen Frau, deren Mutter mit Clara Schumann musizierte, war künstlerische Betätigung ebenso wenig etwas Ungewöhnliches.
Friedrich und Johanna Westhoff haben Vertrauen in die Tochter und glauben an ihr Talent. Das temperamentvolle junge Mädchen wirkt so zielstrebig und entschlossen, dass sie ihr Vorhaben gerne unterstützen wollen. Trotz der vielen Kilometer zwischen Bremen und München und trotz der hohen Ausbildungskosten.
München gilt um 1900 neben Paris als führende Kunststadt Europas. Mit ihren bedeutenden Sammlungen, Museen und Ausbildungsstätten wie der renommierten Akademie der Künste oder der Münchner Damen-Akademie, lockt die alpennahe Residenzstadt nicht nur Maler und Bildhauer von überall her an. Auch Schriftsteller, Musiker, Meister der Lebenskunst und solche, die es werden wollen, lassen sich an der Isar nieder, vorzugsweise in Schwabing, im Norden der Stadt.
Schwabing, eben noch ein winziger Marktflecken inmitten von Wiesen- und Ackerland und erst seit kurzem ein Stadtteil von München, ist ein charaktervolles, idyllisches Viertel. Weitläufiges Grün, schmale, lange Straßen mit Häusern, in denen man preiswerte Zimmer mieten kann, zahlreiche Wirtshäuser; Universität und Kunstakademie sind nicht weit. In der Türkenstraße 28 ist eine Gruppe debattierfreudiger Kleinkünstler eben dabei, sich zu Deutschlands erstem politischen Kabarett »Elf Scharfrichter« zusammenzuschließen, und in der Kaulbachstraße 51a gründet der Verleger Albert Langen mit dem »Simplicissimus« eine satirische Zeitschrift, die vom 1. April 1896 an alle zwei Wochen in München erscheint. Ihr Wappentier ist eine rote Bulldogge. Zähnefletschend fegt das Tier durch die selbstherrlichen Amtsstuben des wilhelminischen Obrigkeitsstaats und entlarvt im Namen von Th. Th. Heine und Olaf Gulbransson, Frank Wedekind, Jakob Wassermann und Ludwig Thoma seine Schwächen: Zensur, Bürokratie, Militär, Parteien, Klerus. Dabei wird selbst die Frauenbewegung, für die München um 1900 ein Zentrum ist, in ihrem Kampf für weibliche Entfaltungsmöglichkeiten und bürgerliche Rechte nicht verschont. So erscheint im »Simplicissimus« ein Text mit einer Karikatur von Bruno Paul, die eine Studentin mit ihrem Lehrer zeigt: »Sehen Sie, Fräulein, es gibt zwei Arten von Malerinnen: die einen möchten heiraten und die anderen haben auch kein Talent.«
Und wer ist dieser junge Autor, den man häufig mit einem Stapel von Manuskripten unter dem Arm in die Kaulbachstraße gehen sieht? Es heißt, er arbeite für Albert Langen als Lektor und schreibe gerade an einem Roman. Schon bald erscheinen die »Buddenbrooks«, und der 26-jährige Thomas Mann jubelt: Die Kunst blüht, die Kunst ist an der Herrschaft … München leuchtet.
•
Oh, München! Diese göttliche Freiheit! Clara Westhoff, seit wenigen Wochen Schülerin der privaten Malschule von Friedrich Fehr und Ludwig Schmid-Reutte in der Theresienstraße 71, ein Riesengebäude mit lauter Maler-Ateliers,besucht von jungen Damen, fühlt sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Unter Münchens Privatschulen, die seit einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden schießen, ist Fehr/Schmid-Reutte die bekannteste und beliebteste. Mit ihrer Aufnahme in die Zeichenklasse von Friedrich Fehr hat Clara Westhoff Glück. Diese gilt als vorzüglich.
Keine Prüfung, keine Mappe, nichts ist nötig, was die Zulassung an privaten Schulen oder so genannten »Damenateliers« bedingte. Begabung hin oder her, die Masse macht’s. »Weiber« zu unterrichten ist ein lukratives Geschäft. Sobald ein junger Künstler die Akademie verlassen hat und seinen Lebensunterhalt noch nicht mit dem Verkauf seiner Bilder bestreiten kann, lehrt er vorzugsweise an einem Damenatelier oder leitet es sogar. Obgleich die Gebühren dort um ein Vielfaches höher sind als die an der staatlichen Kunstakademie, spielt die Qualität des Unterrichts in der Regel eine eher untergeordnete Rolle. Wichtig sind die Umsatzzahlen. Doch Frauen, die sich künstlerisch ausbilden lassen möchten, bleibt nur dieser Weg. Denn sowohl die Münchner Akademie der Künste als auch die anderen großen Kunsthochschulen in Dresden, Düsseldorf und Berlin verwehren ihnen bis auf ganz wenige Einzelfälle den Zugang. Daran wird sich auch in den kommenden zwei Jahrzehnten kaum etwas ändern.
Ich bin sehr froh, in dieser Schule zu sein, berichtet Clara Westhoff nach Hause. Die Eltern sollen es gleich wissen: Sie setze alles daran, erst einmal gründlich zeichnen zu lernen, ehe sie zu malen beginne. Der Fehler der meisten ist, dass sie zu früh anfangen, zu malen, schreibt sie im März 1896 nach Bremen und äußert sich abschätzig über die Damen in ihrer Klasse, die so für sich und ihre Familien etwas malen lernen wollen und deren Arbeiten so für den Haushalt genug, nämlich eher beiläufig ausgeführt würden und sich neben Handarbeit, Musik und Dichtung auf den häuslichen, familiären Bereich beschränkten. Doch natürlich gibt es Ausnahmen. Schnell weiß sie die Dilettantinnen von jenen Mitschülerinnen zu unterscheiden, die ernsthaft an ihrer künstlerischen Karriere arbeiten. Marie Czajkowska gehört dazu. Die polnische Porträt- und Landschaftsmalerin ist ein Jahr jünger als Clara Westhoff und studiert von 1896 bis 1900 ebenfalls bei Fehr/Schmid-Reutte. Die beiden Künstlerinnen werden sich, ohne dass sie es zu diesem Zeitpunkt ahnen könnten, während ihrer weiteren Studien in Paris wiedersehen.
Zwar kommt Friedrich Fehr, sehr jung, süßlich und parfümiert, nur zweimal in der Woche zur Korrektur, doch Clara Westhoff empfindet seine kritische und strenge Art als ehrlich und fühlt sich von ihm ernst genommen: Er kam zu mir, sprach mit mir einen Moment, schob meine Staffelei etwas anders, wischte meinen Anfang wieder weg und zeigte mir, wie man’s machen muss. Fehr hatte die Angewohnheit, mit seinem Daumen hier einen Schatten zu setzen, dort für ein effektvolles Licht zu sorgen. Das motivierte seine Schülerin: Je mehr ich studiere, je mehr ich lerne, je mehr ich sehe, desto mehr angefeuert werde ich.
Bald weiß sie, was ihr besonders liegt. Clara Westhoff zeichnet Porträts und macht Studien nach dem lebenden Modell. Wir zeichnen jetzt im Atelier einen Neger. Sehr interessant und schwer. Ganz andere Gesichts- und Schädelbildung. Am 12. Februar 1896 kann sie Vater und Mutter Westhoff voller Stolz von ihrer Teilnahme an Anatomiekursen berichten, die zu den speziellen Fächern bei Fehr/Schmid-Reutte gehören: Eine tote Menschenhand in Spiritus mit einem ganzen Stück Arm noch dran. Leichenteile. An diesen Anblick müsse sie sich erst gewöhnen, gesteht sie einschränkend ein, doch schließlich sei dieses Fach Teil ihres Studiums. Indem sie sich in dieser Disziplin übt, arbeitet die Malschülerin unbewusst an einer wesentlichen Voraussetzung für ihr späteres bildhauerisches Werk.
Und wie sieht es mit dem Aktzeichnen aus? Dass ein junges Mädchen vor dem nackten Modell arbeitet, gilt als anstößig und unschicklich. Darum ist die Teilnahme am Aktunterricht nicht ohne das Einverständnis der Eltern erlaubt. Zum Glück muss Clara keinen zähen Kleinkrieg mit ihrem Bremer Zuhause führen, um diese Erlaubnis zu erlangen. Vater und Mutter Westhoff geben ihrer Tochter umgehend grünes Licht.
Doch die praktische Ausbildung ist das eine, Museumsbesuche, die Erkundung der Stadt und Ausflüge in die Umgebung das Andere. Sie brauche dringend ein Fahrrad und die zum Radeln geeignete Kleidung, eine Hose und eine Kappe, hatte Clara Westhoff gleich zu Beginn ihrer Münchener Zeit nach Hause geschrieben. Obgleich der Anblick von Frauen in weiten Hosen, die sich allein und vergnüglich auf dem Fahrrad fortbewegen, noch keineswegs alltäglich ist, will sie auch diesbezüglich ihre neue Freiheit genießen, und schon bald kann man das Malweib, ein regelrechtemancipiertes fin-de-siècle-Weib, durch München sausen sehen, ihr Malgepäck auf dem Rücken.
Vor den Toren der Stadt liegt die Künstlerkolonie Dachau und seit bedeutende deutsche Maler, darunter Max Liebermann, Lovis Corinth und Emil Nolde dorthin reisen, um sich vorübergehend von der unberührten Landschaft des Dachauer Mooses inspirieren zu lassen, zieht der kleine Ort auch zahllose Malklassen aus Münchens Damenakademien und Malschulen an. Sepiafarbene Fotos zeigen Scharen junger Frauen in langen Kleidern und breitkrempigen Sonnenhüten, die an ihren Staffeleien stehen und malen.
Auch die Klassen von Fehr/Schmid-Reutte halten sich mehrfach in Dachau auf. Während eines ihrer Ausflüge lernt Clara Westhoff zwei Schriftsteller aus Bremen kennen, Rudolf Alexander Schröder und Alfred Walter Heymel. Gemeinsam mit dem Dresdener Schriftsteller Otto Julius Bierbaum geben sie in München die Monatszeitschrift »Insel« heraus. Für die künstlerische Gestaltung der reich illustrierten Bände haben sie einen jungen Grafiker gewinnen können, der Heinrich Vogeler heißt, ebenfalls aus Bremen stammt und im Begriff ist, sich als Jugendstilkünstler einen Namen zu machen. Außerdem ist er einer der fünf Maler, die unter dem Gruppennamen »Künstler-Verein Worpswede« im Sommer 1895 mit einer umfangreichen Ausstellung in München für Aufmerksamkeit sorgen.
Die »Jahresausstellung von Kunstwerken aller Nationen« im Glaspalast ist ein Großereignis. Allein der imposante Riesenbau aus Gusseisen und Glas mit seinen plätschernden Brunnen und kostbar ausgestatteten Interieurs auf dem Gelände des Alten Botanischen Gartens ist sehenswert und zieht die Menschenmassen an. Die Worpsweder sind mit 50 Gemälden, Aquarellen und Radierungen in einem eigenen Saal vertreten: Mächtige Wolkenformationen türmen sich über der flachen, weiten Ebene; weißstämmige Birken, schlank und frühlingshaft zart oder knorrig krumm, säumen Moorkanäle und sandige Wege oder spiegeln sich in Wassertümpeln; ärmliche Katen liegen windschief und wie geduckt in der Landschaft, ihre Dächer aus Stroh reichen bis auf den Boden.
Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Heinrich Vogeler und Hans am Ende haben die Akademien und ihre Ateliers in Düsseldorf und Karlsruhe verlassen und im norddeutschen Teufelsmoor eine Landschaft gefunden, die sie zum künstlerischen Arbeiten unter freiem Himmel inspiriert, »en plein-air«. Den französischen Malern von Barbizon folgend, wollen sie der großstädtischen Modernität ein Leben in Einfachheit entgegensetzen.
Clara Westhoff kann sich gut an den Verriss der ersten Ausstellung der Künstlergruppe in der Kunsthalle Bremen nur wenige Monate zuvor, im Frühjahr 1895, erinnern. Presse und Publikum hatten die fünf jungen Männer aus dem Moor als »Apostel des Hässlichen« und »Lachkabinett« verspottet. Jetzt, in München, sind die Reaktionen überraschend positiv. Ihre Kunst sprenge die üblichen Sehgewohnheiten, sei neu und originell und setze der klassizistischen Malerei ein Ende, ist sich die Kritik überwiegend einig. Fritz Mackensen, der als Entdecker Worpswedes für die Kunst gilt, erhält für sein monumentales Gemälde »Gottesdienst im Freien« die Goldene Medaille I. Klasse der Künstlergenossenschaft. Das Königreich Bayern kauft von Otto Modersohn das großformatige Gemälde »Sturm im Moor« für die Neue Pinakothek der bayerischen Staatsgemäldesammlungen an. Rezensionen und Beiträge feiern die Ausstellung als »Europäisches Ereignis« und machen die Worpsweder Künstler über Nacht bekannt.
•
In seinem Schwabinger Atelier in der Gabelsbergerstraße sitzt Heinrich Vogeler an einem Großauftrag. Tafelsilber, Tischleuchter und Wandkandelaber sollen das Esszimmer des »Insel«-Herausgebers Alfred Walter Heymel schmücken, der als junger Millionär in einer luxuriös ausgestatteten Wohnung in der nahen Leopoldstraße lebt. Vogeler zeichnet Ranken und Pflanzen, Früchte und Blätter und arbeitet mit der Linie als Ornament: Ein reiches Rosengitter, aus Messing gestanzt, war für die Kaminverkleidung entstanden. Aus flammenden Grasblumen wuchs es auf zu einem wogenden Rhythmus rosenbeladener Böschung.
Über Heymels Reichtum und seine Kostbarkeiten aus aller Welt sind die fantastischsten Gerüchte im Umlauf – altes venezianisches Glas, antike Terrakotten, Meißner- und Sèvres-Porzellan, japanische Holzschnitte und primitive Kunst aus Afrika sollen in seinen Räumen verteilt sein. Bei Heymel kommt im Schein lodernder Kaminfeuer regelmäßig eine kleine Gesellschaft schöner Frauen und auserwählter Musiker und Schriftsteller zusammen. Bald zählt auch ein junger Dichter aus Prag zu dem illustren Kreis. René Maria Rilke hat seine Maturitätsprüfung am Prager Grabengymnasium mit Auszeichnung bestanden und einige Monate Kunstgeschichte, Philosophie und deutsche Literatur an der Karl-Ferdinands-Universität studiert. Ein kleiner, eher zartgliedriger Mann. Sein Gesicht ist blass und schmal und wird von großen, tief liegenden Augen beherrscht, die verwundert und sorgenvoll in die Welt blicken.
Der 21-Jährige hat Heimat und Familie verlassen und will sich in München ganz seiner dichterischen Aufgabe widmen. Da ihn die Geschichte der Bildenden Künste im Zeitalter der Renaissance interessiert, geht er hin und wieder in die Universität und hört Vorlesungen dazu.
•
Um dieselbe Zeit hält sich vorübergehend eine Frau in München auf, die ihren Wohnsitz eigentlich in Berlin hat. Louise von Salomé ist Gast im Hause ihrer engen Freundin Frieda von Bülow in der Schellingstraße. Sie ist 36 Jahre alt, in St. Petersburg geboren, mit dem Orientalisten Friedrich Carl Andreas verheiratet und Schriftstellerin. Eine ungewöhnliche Erscheinung. Groß und schlank mit einer Ausstrahlung, die auf Anhieb besticht. Selbstbewusst, geistreich und herzlich offen, dabei rebellisch und unkonventionell.
Lou Andreas-Salomé hat in Zürich Philosophie, Kulturwissenschaften und Kunstgeschichte studiert. Sie ist viel gereist und als Autorin bereits eine bekannte Größe in Europas intellektuellen Kreisen. Sie kennt August Strindberg und Richard Dehmel persönlich, ist mit Gerhart Hauptmann befreundet, in Wien Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal begegnet, in München Frank Wedekind und Jakob Wassermann. Die Männer lieben sie. Sie sei eine Frau, die Männer sammle wie andere Leute Gemälde, wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Es heißt, Lou Andreas-Salomé knüpfe eine leidenschaftliche Beziehung zu einem Mann, und neun Monate später bringe er ein Buch zur Welt. Zuletzt hat ihre Liaison mit dem achtzehn Jahre älteren Philosophen Friedrich Nietzsche europaweit für einen Skandal gesorgt.
Es ist ein warmer Frühlingsabend im Mai 1897, als Lou Andreas-Salomé anlässlich einer Einladung zum Abendessen bei Jakob Wassermann der deutsch-österreichische Autor René Maria Rilke vorgestellt wird.
René Maria ist augenblicklich fasziniert von der so viel Älteren mit der Aura einer berühmten Literatin. Zufällig habe er kürzlich ihren Essay »Jesus der Jude« gelesen, verrät er ihr noch am Abend ihrer ersten Begegnung in München und gesteht, dass er zwischen ihrem Text und seiner Lyrik auf eine geradezu geheimnisvolle Weise eine tiefe Verwandtschaft spüre.
Beide sehen sich einen Tag darauf im Theater wieder. Erstaunlich, wie viele Leute sie kennt, einflussreiche Leute aus der Kunst- und Kulturwelt. Ich bin mit ein paar Rosen in der Hand in der Stadt und dem Anfange des Englischen Gartens herumgewandert, um Ihnen Rosen zu schenken, schreibt der entflammte Rilke an Lou, ja, statt sie an der Tür mit dem goldenen Schlüssel abzugeben, trug ich sie mit mir herum, zitternd vor lauter Willen, Ihnen irgendwo zu begegnen.
Als die Angebetete den Anfang 20-Jährigen auffordert, strenger mit sich zu sein und disziplinierter zu arbeiten, ist die Folge eine bisher nicht gekannte dichterische Schaffensperiode. Unter Lous Einfluss gleicht sich Rilkes bisher eher nachlässige Handschrift ihrer klaren, deutlichen Schrift an, und als sie sich eines Tages kritisch über seinen viel zu französisch und wenig männlich klingenden Taufnamen »René« äußert, ändert er ihn umgehend in »Rainer« um. Er orientiert sich an den Ideen der Lebensreformbewegung so wie sie, und jedes seiner Liebesgedichte, die später in der Sammlung »Dir zur Feier« zusammengefasst werden, richtet Rainer Maria Rilke von nun an nur noch an Lou Andreas-Salomé.
•
An der Malschule Fehr/Schmidt-Reutte sind die Preise für die Kurse kürzlich schon wieder erhöht worden und das ärgert Clara Westhoff. Für die Zeichenklasse bei Fehr müssen die Schüler jetzt 30 Mark monatlich bezahlen und wenn dann noch die Kosten für den Abendakt in Höhe von 12 Mark dazukommen, macht das insgesamt 42 Mark. Nicht zu vergessen die Anatomie. Das ist doch haarsträubend. Aber man muss nur bedenken, wie billig die Herren studieren, dann kriegt man doch ’ne Wut. Fehr ist ja schlau. (…) Uns hat er sicher, denn wohin sollen wir arme Schlucker uns sonst wenden?
Die inzwischen 19-Jährige erregt sich über so viel weibliche Diskriminierung und will diese Ungerechtigkeit nicht schweigend hinnehmen:
Da existiert eine sogenannte ›Anatomie‹, wo täglich Vorträge für Ärzte sind und wo sie einmal in der Woche für Künstler stattfinden. Und zwar nur für die Akademie und Kunstgewerbeschule und nur für Herren. Jetzt sag mir einer, warum nur für Herren? Das muss anders werden und soll mich nicht wundern, wenn wir’s durchsetzten. Wenn der Staat sich verpflichtet fühlt, für die männlichen Künstler ganz ungeheure Unterstützung zu leisten, warum tut er es nicht für die weiblichen?
Um diese Frage zu klären, macht sich Clara Westhoff auf den Weg zur Behörde. Es dauert lange, bis sie sich endlich zu den Verantwortlichen durchgearbeitet hat, dem bayerischen Minister für Cultus und Unterricht Robert Ritter von Landmann gegenübersteht und ihm ihr Anliegen vortragen kann. Man möge auch Künstlerinnen an den kostenlosen Anatomiekursen teilnehmen lassen, fordert sie. Die Zulassung von Frauen an den Anatomiekursen? Wie lächerlich! Abgesehen davon, dass diese Erlaubnis vermutlich nur weitere emanzipatorische Forderungen zur Folge haben würde, seien die Frauen den harten Anforderungen des Anatomieunterrichts körperlich wie geistig nicht gewachsen. Der Herr Rat war ein kleines Ekel und unseren Plänen entschieden nicht geneigt. Die Malschülerin ist entrüstet über den Schwall an fadenscheinigen Argumenten des Ministers, doch ebenso enttäuscht sie die mangelnde Solidarität ihrer Mitschülerinnen:
Viele Damen wollen so für sich und ihre Familie etwas malen, dann zeichnen sie etwas, fangen dann etwas zu malen an, Aquarell und Öl vielleicht, können dann vielleicht ganz nette Landschaften malen und so für den Haushalt genug. Das kann man in zwei Jahren erreichen. Sie können dann aber nichts ordentlich.
Eine von denen, die den Zeichen- und Malunterricht vor allem als Vorbereitung auf die Ehe betreiben, will sie nicht sein, das schwört sich Clara Westhoff. Wenn sie sich zur Künstlerin ausbilden lässt, dann mit dem Ziel, die Kunst zu ihrem Beruf zu machen.
•
Regelmäßig erkundigt sich Friedrich Westhoff bei seiner Tochter, wie es ihr gehe und ob die Ausbildung sie weiterbringe. Schließlich halte sie sich schon seit nahezu zwei Jahren in München auf. Seiner Bitte, Proben ihrer künstlerischen Arbeit nach Bremen zu schicken, damit er sich zu Hause ein Bild machen könne, entgegnet sie:
Du schreibst, ich möchte Zeichnungen mitschicken, ich habe aber meine letzten alle in München gelassen. Ich hätte sie schon geschickt, aber sie sind nicht so vorteilhaft zum Zeigen und das kommt daher, weil sie anders gemacht sind, als meine früheren. Ich hätte eigentlich vorgehabt, sie Dir zu schicken, aber sie sehen wirklich nicht danach aus. Wißt Ihr, ich bin doch noch nicht fertig im Studium, sondern in einer Art Übergangsstadium.
15. Mai 1897
Vor allem hat sie durch die Begegnung mit einem jungen Bildhauer eine künstlerische Disziplin kennen gelernt, die sie gedanklich nicht mehr loslässt. Ignatius Taschner hat an der Münchener Kunstakademie Grafik, Illustration und Bildhauerei studiert und arbeitet jetzt in einem eigenen Atelier. Er soll für die alljährliche Ausstellung im Glaspalast ein Porträt einreichen und bittet Clara Westhoff, ihm Modell zu sitzen. Bei meinem Bildhauer habe ich schon gesessen, berichtet sie euphorisch nach Hause, das Porträt habe bereits Ähnlichkeit, der Mensch ist riesig talentiert. Taschners Können beeindruckt die 19-jährige Malschülerin und sie freut sich darüber, dass sein Porträt von ihr im Sommer 1897 im Glaspalast ausgestellt wird.
Wie soll es nun weitergehen? Auf die Briefe des Vaters, der seine Tochter daran erinnert, dass sich ihre Lehrzeit in München und seine damit verbundene finanzielle Unterstützung nun langsam dem Ende nähere, kann sie nur mit der Bitte antworten: Habt weiterhin Geduld mit mir! Während des Sommers lernt sie fünf Monate bei dem Landschaftsmaler Bernhard Buttersack, Gründungsmitglied der »Münchner Secession« und im Glaspalast mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet. Er hat vor den Toren Münchens in Haimhausen ein geräumiges Atelierhaus und unterrichtet dort Privatschüler im Malen.
Hoffentlich erwartet Ihr auch nicht,dass ich Euch etwas arbeite, entschuldigt sie sich angesichts des nahenden Weihnachtsfestes vorbeugend, Handarbeiten tue ich ja nie, aber malen und zeichnen kann ich Euch auch nichts. Es kränkt mich selbst tief, aber ich kann nichts dabei machen. Das, was ich arbeite, ist noch nicht zum Verschenken, ich kann doch nichts verschenken, was nicht gut ist und deshalb keine Existenzberechtigung hat.
Seitdem Clara Westhoff die Bilder der Worpsweder Maler im Glaspalast sah, zieht es sie gedanklich immer wieder in ihr heimatliches Land um Bremen, und sie sehnt sich danach.
Schon als Kind fühlte sie sich dem Sommersitz der Familie vor den Toren der Stadt viel mehr verbunden als dem engen Giebelhaus in der Bremer Wachtstraße. Wie gut kann sie sich an die zahlreichen Wochenenden und langen Ferienaufenthalte in Oberneuland erinnern, an den großen Garten mit den hohen Bäumen, und wie sehr genoss sie die Wintermonate, wenn der kleine Fluss Wümme über die Ufer stieg und Wiesen und Felder überschwemmte. Dann breiteten sich blanke Wasserflächen aus, und war es ein sehr kalter Winter, froren sie zu und man konnte auf Schlittschuhen bis in das nicht weit entfernte Worpswede laufen.
Im Dezember 1897 fasst Clara Westhoff sich ein Herz und radelt in die Gabelsbergerstraße zu Heinrich Vogeler, den sie über eine gemeinsame Bremer Tanzstundenfreundin flüchtig kennt. Sie möchte mehr über die aktuelle Situation in Worpswede wissen, und er müsste genau der Richtige sein, ihr Auskunft zu geben. Vogeler erzählt, dass er nach dem Tod seines Vaters Geld geerbt und sich dafür in Worpswede einen alten Bauernhof gekauft habe, den er gerade zu einem Atelierhaus um- und ausbauen lasse. Er berichtet auch von den zahlreichen Malerinnen, die inzwischen in Worpswede lebten und sich bei Fritz Mackensen, Fritz Overbeck und Otto Modersohn künstlerisch ausbilden ließen.
Nach diesem Besuch bei Heinrich Vogeler steht für Clara Westhoff fest, dass sie München bald verlassen und für ihre weitere künstlerische Ausbildung nach Worpswede gehen wird.
Vogeler erinnerte sich später:
Ich hatte sie lange nicht gesehen, jetzt sah ich ihr schmal aufgebautes Gesicht wie zum ersten Mal, ein paar widerspenstige Locken drängten sich an den Schläfen vor unter dem Kranzgewinde von wildem Hopfen. Weiß war ihr Kleid. Die großzügigen Bewegungen hätten die einer Diana sein können. Ich dachte, der müsste man einen Wurfspeer in die Hand geben; ihre lockeren, kraftversprechenden Bewegungen würden sich dann bis in die Fersen des elastischen Körpers straffen, der alles in die Wucht des Speeres treibt, einem fernen Ziele zu.
KAPITEL II
Eine Künstlerin muss frei sein … sonst kann sie sich nicht entwickeln
WORPSWEDE – LEIPZIG FRÜHJAHR 1898 – DEZEMBER 1899
Es war unter uns Studentinnen Grundsatz … uns in keiner Weise von anderen jungen Mädchen zu unterscheiden … jede als männlich zu deutende Note in der äußeren Erscheinung … sollte vermieden werden.
Ricarda Huch
Für die Kleinbauern im Moor ist es seit Generationen die reine Plackerei. Tag für Tag die bleischwere Erde aus den tiefen Wassergräben schaufeln und sie mit kräftigem Schwung hoch an die Oberfläche werfen. Die feuchte Masse auf ebenem Boden verteilen und mit den Füßen platt stampfen, bis sie fest geworden und wie ein Fladen geformt ist. Beten, dass es nicht regnet, damit die Erde nicht wieder aufweicht. Hoffen, dass die Sonne nicht zu sehr brennt, damit der Torf nicht zerbröckelt. Schließlich ziegelgroße Stücke schneiden und sie zu Pyramiden schichten. Wieder und wieder umschichten, damit sie der Wind von allen Seiten erreichen kann. Diese Arbeit wird vorwiegend von den Frauen verrichtet, wenn sie in ihrer rauchigen Kate nicht kochen, Kinder nähren, Besen binden oder Strümpfe stricken.
Bis es Spätsommer und der Torf gut durchgetrocknet ist, vergehen Monate. Dann sammeln sich die Torfkähne mit ihren mächtigen schwarzen Segeln auf den zahlreichen Kanälen rund um Worpswede und werden beladen. Für den Transport ihrer kostbaren Fracht nach Bremen auf den Flüssen Hamme und Wümme brauchen sie oft mehrere Tage.
Als Häuser kann man die fensterlosen Katen nicht bezeichnen, in denen die meisten Moorbauern leben, häufig Tagelöhner oder ehemalige Gefangene mit ihrer Familie. Wände aus gestapelten Torfsoden, das Dach aus Stroh oder Schilf. Es reicht bis auf den Boden, Gras wächst darauf, Moos und hin und wieder eine kleine Birke. Am offenen Feuer wird gekocht. Weil die Kate keinen Schornstein hat, sondern nur eine kleine Tür, schwängern Rauchschwaden die stets feuchte Luft. Ein seitlicher Verschlag schützt Ziegen, Schafe oder manchmal auch eine magere Kuh vor Kälte und Regen.
Westerwede, Weyerdeelen, Mevenstedt, Hüttenbusch heißen die Moorkolonien rings um den 700-Seelen-Ort Worpswede. Eine Kirche mit angeschlossenem Friedhof, eine Grundschule, eine Apotheke, ein Bahnhof. Am Ortseingang eine kleine Bäckerei mit Gastwirtschaft; dort kann man auch preiswerte Zimmer mieten. Im Hotel »Stadt Bremen« quartierten sich Fritz Mackensen und Otto Modersohn ein, als sie rund ein Jahrzehnt zuvor zum ersten Mal gemeinsam nach Worpswede kamen.
Weit geht der Blick von der 50 Meter hohen Sanddüne Weyerberg über das Land. Pappeln und weißstämmige Birken säumen die Chausseen. Flächen von bräunlich-schwarzem Moor und hellen Sandböden wechseln mit Kartoffel- und Buchweizenfeldern. Auf blühenden Obstwiesen rund um die prächtigen Bauernhöfe weidet wohlgenährtes Vieh.
Clara kann sich nicht sattsehen an der Großartigkeit des Himmels mit seinen wechselvollen Wolkenformationen und atmosphärischen Stimmungen. Manchmal, bei Sonnenuntergang, leuchtet er in goldenem Kupferrot. Worpswede!
Der städtische Malschulenbetrieb in München ist schnell vergessen. Die Zwanzigjährige empfindet die Landschaft als heimatlich und verwandt. Als ein schönes köstliches Geschenk! Wie den Anbruch eines unaufhörlichen Sonntags.
Im Frühjahr 1898 wird sie Schülerin von Fritz Mackensen. Der erfolgreiche Maler mit den kantigen Gesichtszügen und dem gezwirbelten Oberlippenbart gilt als die repräsentative Persönlichkeit der Künstlerkolonie und ist in Bremens gutbürgerlichen Häusern als Porträtist gefragt. Auf seinen großformatigen Bildern sind vorwiegend Worpsweder Bauern zu sehen, oft eingebunden in Genreszenen aus ihrem Lebensalltag, der von harter Feldarbeit geprägt ist.
Clara Westhoff schätzt den professionellen Unterricht ihres Lehrers. Er ist geregelt und streng und verlangt ein aufmerksames, detailgenaues Studium der menschlichen Figur. Ich freue mich auch, dass Du mal mit Mackensen gesprochen hast und dadurch hoffentlich über mein Talent und den Ernst meines Strebens etwas beruhigt bist, schreibt sie dem Vater, tief zufrieden darüber, in Worpswede sein und unter Mackensens Anleitung weiterlernen zu dürfen.
Glaubt man den Beobachtungen Heinrich Vogelers, der Mackensen Hand in Hand mit Clara über den Weyerberg spazieren sah, muss den Lehrer schon bald eine besonders enge Freundschaft mit seiner Schülerin verbunden haben.
Im September 1898 stößt eine weitere junge Frau zu dem Malschülerinnenkreis um Fritz Mackensen.
Die aus Dresden gebürtige und in Bremen aufgewachsene Paula Becker hat ihre Lehrzeit an der Berliner Zeichen- und Malschule vor kurzem beendet und jetzt den dringenden Wunsch, ihre Studien im Kreis der Künstler in Worpswede fortzusetzen.
Gemeinsam mit ihrer Berliner Studienkollegin Paula Ritter war sie während ihrer Semesterferien im vergangenen Sommer schon einmal dort gewesen und hatte die Wochen als Göttertage empfunden.
Worpswede,Worpswede, Worpswede! klingt es schwärmerisch in ihrem Tagebuch, in dem sie Birken, Kiefern und alte Weiden besingt und das Wunderland, das Götterland und seine großen Männer preist, die Maler, in deren Ateliers sie ein und aus gehen durfte. Wenn man es zu etwas bringen will, muss man den ganzen Menschen dafür hingeben, weiß die 22-Jährige früh, dankbar für die elterliche Unterstützung ihres Vorhabens.
Paula Beckers Erscheinung und Wesen wissen die Herzen ihrer Mitschülerinnen Clara Westhoff, Marie Bock und Ottilie Reylaender im Nu zu erobern. Es ist ihre gerade Haltung, die sie beeindruckt, der ernste und entschlossene, dabei warmherzige Blick. Dazu ihr kupferfarbenes, volles Haar, das in der Mitte gescheitelt, locker zurückgelegt und in drei großen Rollen tief im Nacken aufgesteckt war, so dass es in seiner Schwere als ein Gegensatz wirkte gegen das leichte, helle Gesicht mit der schön geschwungenen, fein gezeichneten Nase, das sie mit einem genießerischen Ausdruck wie über eine Oberfläche hinaufhob und aus dem einen die sehr dunklen, blanken braunen Augen klug und belustigt anfunkelten, wie sich Clara Westhoff erinnerte.
In den großformatigen Aktzeichnungen bäuerlicher Menschen, die unter Fritz Mackensens Leitung entstehen, finden sich im Ansatz bereits jene großen, zusammenfassenden Körperformen, die sich in Paula Beckers späterem Werk zum Monumentalen steigern.
Zwei- bis dreimal in der Woche besucht Mackensen die Ateliers seiner Schülerinnen, korrigiert, gibt Anregungen. Seine kritischen Äußerungen ihren Arbeiten gegenüber mag Clara Westhoff im ersten Augenblick als kränkend empfinden. So wirft er ihr vor, viel zu sehr im Münchner Lehrsumpf festgefahren! zu sein, keinerlei Fortschritte im Zeichnen zu machen. Siemüsse viel freier werden, fordert er und gibt ihr den Rat, neben dem Zeichnen plastisch zu arbeiten. Doch nicht kleinformatig, wie es die Damenakademien üblicherweise zu lehren pflegten, sondern möglichst groß, lebensgroß. Fritz Mackensen ist von der bildhauerischen Begabung seiner Schülerin überzeugt und will sie fördern. Schon im August 1898 wendet sie sich in einem Brief aus Worpswede an die Mutter nach Bremen:
Ich möchte Dich vielmals bitten, mir noch einmal Ton zu bestellen. Ich möchte Georg gern modellieren und Mackensen sagt, ich müsste das in Lebensgröße. So klein, davon hätte ich nicht genug, lernte nicht genug dabei und es wäre auch viel zu schwer. Da muss ich wohl noch einen ganzen Zentner Ton haben.
Nur wenige Monate später, an ihrem 20. Geburtstag im November, muss sie dem Vater noch etwas erzählen, das sie mit ganz besonderer Freude erfülle: Ich bin nämlich ganz mit mir ins Klare gekommen, dass ich Bildhauer werden will. Ich bin darüber sehr glücklich.
Wählt sie bewusst den Begriff Bildhauer statt Bildhauerin? Klingt die männliche Form weniger verfänglich als die weibliche? Wer kann sich schon vorstellen, dass eine Frau mit Hammer und Eisen in einen massiven Block aus Naturstein oder Marmor schlägt, um daraus in tage-, wochen- oder gar monatelanger Schwerarbeit ein Relief zu formen, einen Kopf oder gar einen lebensgroßen Akt?
•
Von Clara Westhoffs Wohnung im Zentrum des Dorfes bis zum Armen- und Arbeitshaus, wo die Alten und Gebrechlichen aus den Moorhütten leben, junge Mütter mit ihren unehelichen Kindern und ehemalige Strafgefangene, ist es nur ein Katzensprung.
Ich bekomme jetzt wieder jemanden vom Armenhaus, da brauche ich natürlich nicht so viel zu zahlen, versucht sie ihren Eltern den Vorteil der preiswerten Armenhäusler als Modelle gegenüber den teureren Lohnarbeitern deutlich zu machen, denn wenn ich einen Tagelöhner, einen Mann habe, der noch arbeiten kann, so muss ich ihm natürlich Tagelohn bezahlen, er sitzt dafür aber auch beinahe neun Stunden. Morgens von acht bis zwölf und mittags von zwei bis sieben.
Ohne eine Vorzeichnung zu machen, modelliert die junge Bildhauerin im Herbst 1898 eine Armenhäuslerin, die ihr gegenüber auf einem Stuhl sitzt, direkt aus Gips: der magere Oberkörper bis zum Brustansatz nackt, das Gesicht hohläugig mit großer Nase und leicht geöffnetem Mund, die Stirn in Falten und das dünne Haar im Nacken geknotet. Einfühlsam, doch ohne sentimentale Verklärung gibt sie die Physiognomie der alten, von mühsamer Landarbeit gezeichneten Worpswederin wider. Ihr Porträt wirkt derbe und abschreckend. Doch es ist auch gar nicht ihr Ziel, den bürgerlichen Kunstgeschmack zu treffen. Eher liegt ihr der Hinweis auf das soziale Unrecht am Herzen. Vor allem geht es ihr darum, zu üben. Sehen üben. Üben, den Bau, die Form und die Fläche des menschlichen Körpers zu erfassen und Neugier auf seine Persönlichkeit zu entwickeln.
Mit dem »Porträt der Alten« schafft Clara Westhoff ihre erste Plastik und erfährt damit ihre erste Anerkennung als Bildhauerin.
Künstlerische Einflüsse des belgischen Bildhauers Constantin Meunier auf ihre Arbeit sind unverkennbar. Sie hatte in München und Dresden Ausstellungen von ihm gesehen, außerdem scheint Familie Westhoff wohl einige seiner Plastiken besessen zu haben: Ich habe aber etwas gelernt von Meunier, hoffentlich wird es sich bald zeigen, notiert Clara nur wenige Monate nach der Entstehung der »Alten« im Zusammenhang mit ihrer eigenen bildhauerischen Entwicklung. Sie weiß, dass sie sich auf einem schmalen Grat zwischen Eigenständigkeit und Konvention bewegt. Ebenso ist ihr bewusst, dass die Nähe zu den Arbeiten ihres Lehrers, zu Mackensen, noch viel zu groß ist.
Paula Becker berichtet im Dezember 1898 nach Bremen: Da ging mir heute ein Licht auf bei Fräulein Westhoff. Die hat jetzt eine alte Frau modelliert, innig, intim. Ich bewundere das Mädel, wie sie neben ihrer Büste stand und sie antönte. Die möchte ich zur Freundin haben. Groß und prachtvoll anzusehen ist sie und so ist sie als Mensch und so ist sie als Künstler.
•
Eine Schwarz-Weiß-Fotografie, auf der zwei sitzende junge Frauen im Profil zu sehen sind, einander zugewandt, im Gespräch. Lebhafter Gesichtsausdruck, dunkles, hochgestecktes Haar, helle Kleidung. Sie sind beide um die zwanzig, haben früh den Aufbruch gewagt, in München und Berlin studiert und das Ziel, sich allen herrschenden Vorurteilen zum Trotz in der Kunstwelt zu behaupten und die Kunst zu ihrem Beruf zu machen. Wir haben uns gern und achten uns und lernen viel voneinander, notiert Paula Becker in diesen Tagen über ihre beginnende Freundschaft zu Clara Westhoff.
Paula Becker und Clara Westhoff in Beckers Atelier in Worpswede, 1898
© Paula Modersohn-Becker-Stiftung, Bremen
Ich glaube, bei Künstlerinnen ist es sehr schwer, dass sie es zu etwas bringen, viel schwerer als bei Männern, ahnt die junge Bildhauerin und fährt in ihrem Brief vom 24. Mai 1899 an die Eltern fort: Daher hat es auch noch so wenig wirklich tüchtige Frauen gegeben. Also ich meine tüchtig in dem anderen Sinne, nicht als Frau tüchtig – sondern als Künstler oder überhaupt als Mensch im Beruf. Unter welchen Bedingungen die Frauen nun eigentlich was leisten können, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass ich was leisten will.
Paula Becker geht es ähnlich. Ihre schöpferische Ungeduld fasst sie in der folgenden Tagebuchnotiz zusammen: Ich will immer weiter, weiter. Ich kann die Zeit nicht erwarten, daß ich was kann.
Neben der wachsenden Vertrautheit zwischen den beiden Künstlerinnen entwickeln sich auch immer herzlichere Beziehungen zu den Malern: Es gab gestern ein kleines Fest im Atelier von Otto Modersohn, berichtet Paula Becker Worpswede-trunken über den Abend bei Otto und Helene Modersohn, Schummerbeleuchtung mit Papierlaternen. Zwei gedeckte Tische, einen für die Erwachsenen und einen Kindertisch. Am letzteren Fräulein Westhoff und ich, Vogeler, der junge Mackensen und Alfred Heymel.
Als Mackensen im Oktober 1898 eine gemeinsame Reise zur Ausstellung mit 123 Gemälden von Rembrandt in das Rijks Museum nach Amsterdam vorschlägt, ist Clara Westhoff neben Otto Modersohn, Heinrich Vogeler und Marie Bock auch mit dabei: Das war eine großartige Reise, eine Pilgerfahrt zu Rembrandt (…) Diese Rembrandt-Ausstellung war ein Ereignis für mich, ich habe riesig viel davon gehabt und dadurch gelernt.
Was lesen junge deutsche Künstler und Intellektuelle um die Jahrhundertwende? Vorzugsweise die skandinavischen Autoren: Ibsen, Strindberg, Björnson, Hamsun, Jens Peter Jacobsen. Sein tragischer Liebesroman »Niels Lyhne«, von Stefan Zweig als der »Werther seiner Generation« gerühmt, wird auch in Worpswede verschlungen. »Es war die große Traurigkeit, dass eine Seele immer allein ist. Jeder Glaube an Verschmelzung zwischen Seele und Seele war eine Lüge«, lautet einer der letzten Sätze im Buch des dänischen Schriftstellers, bezeichnend für die schwärmerisch-gefühlvolle Gestimmtheit während des Fin de Siècle.
Speziell für Künstlerinnen aus aller Welt gehörte das Tagebuch der Marie Bashkirtseff ins Reisegepäck, wenn sie sich auf den Weg nach Paris machten. Die Aufzeichnungen der mit 26 Jahren jung verstorbenen Tochter aus reicher ukrainischer Adelsfamilie, die in Westeuropa lebte, waren 1897 auf Deutsch erschienen.
Bashkirtseff formuliert darin ihr Streben nach künstlerischem Ruhm und gesellschaftlicher Karriere in größtmöglicher Freiheit und Unabhängigkeit von häuslicher Bevormundung. Als Malschülerin an der privaten Pariser Académie Julian beschreibt sie detailliert die dort herrschende Atmosphäre. Es gibt ein großformatiges Bild von ihr, das den Blick in das Atelier bei Julian zeigt: Mehr als ein Dutzend modisch gekleideter oder in Malkittel gehüllter Frauen mit imposanten Frisuren oder Hüten sitzen vor ihren Staffeleien, ins Gespräch vertieft oder in konzentrierter Betrachtung des männlichen Aktmodells vor ihnen auf dem Podest.
•
Obgleich Fritz Mackensens Arbeitsweise sich von der Clara Westhoffs unterscheidet und ihre »Alte« seinen Vorstellungen streng genommen nicht entspricht, überzeugen ihn ihre bildhauerische Begabung und die künstlerische Qualität ihrer Skulpturen immer mehr. Er macht sich Gedanken, wie er ihr weiterhelfen kann. Es dürfte doch kein Problem sein, ihr eine Lehrzeit bei dem Bildhauer Max Klinger in seinem Atelier in Leipzig zu ermöglichen.
So fordert Mackensen seine Schülerin auf, sich um eine Einladung zur Deutschen Kunstausstellung in Dresden im April 1899 zu bemühen. Er selbst und die anderen Worpsweder Künstler werden auch daran teilnehmen, und vor allem wird Max Klinger mit zahlreichen Skulpturen vertreten sein. Es wäre also naheliegend, Clara Westhoff bei dieser Gelegenheit Max Klinger vorzustellen.
Klinger gehörte mittlerweile zu den führenden modernen Künstlern in Deutschland. Er war Mitglied der Königlichen Akademie der Künste in Berlin und seit 1897 Professor an der Akademie der grafischen Künste in Leipzig. In jungen Jahren hatten ihn seine Grafikzyklen bekannt gemacht. Inzwischen lag der Hauptschwerpunkt seiner Arbeit auf der Malerei und Bildhauerei.
Könnte ihr zu diesem Zeitpunkt ihrer Ausbildung etwas Besseres passieren? Zu Klinger zu kommen, das ist ja ein fabelhaftes Glück für mich, notiert die junge Bildhauerin voller Vorfreude auf die Möglichkeit einer Lehrzeit in Leipzig: Wenn man bedenkt, was ein Mann wie Klinger alles anfängt – das ist ja unheimlich – und da ist man wirklich beneidenswert, wenn man Gelegenheit haben kann, das in der Nähe zu sehen und womöglich da mitzuarbeiten.
Noch ehe sie den Künstler persönlich kennenlernt, kann Clara Westhoff sich schon ein ungefähres Bild von ihm machen, denn Paula Becker, die Klinger über ihren Vater kannte, hatte ihr erzählt, dass er einen rötlichen Bart und stets eine braune Joppe trage und einer von diesen Souveränen, und dabei gütig sei. Paula hatte ihn im Frühjahr 1898 während eines Aufenthalts in Leipzig in seinem Riesenatelier besucht und war von seiner Persönlichkeit tief beeindruckt: Wenn ich an jenen Blick denke, den er mir vor drei Jahren zum Abschied gab; ich war so sehr unreif, so sehr unfertig und sehr unergiebig. Und sein Blick war, als ob er mir leise das Haar streichelte.
Doch mag er auch noch so »gütig« wirken: Es ist kein Geheimnis, dass Max Klinger Frauen nicht zutraut, in der Bildhauerei Gutes zu leisten. Er hält sie zwar nicht für grundsätzlich unschöpferisch, doch für ihn sind sie körperlich schwache Wesen ohne handwerkliches Können und Geschick. Und so setzt keine Schülerin ihren Fuß über die Schwelle seines Ateliers, der er zuvor nicht ganz deutlich gemacht hätte, wie schwer, eigentlich gar nicht zu bewältigen die Bildhauerei für eine Frau sei.
Clara Westhoff am 1. Juni 1899 an den Vater nach Bremen: Klinger hat sich eine Personalbeschreibung machen lassen, von wegen der Marmorblöcke. Da hat Mackensen gesagt, ich wöge 160 Pfund, worauf Klinger sehr beruhigt gewesen sein soll.
Unermüdlich macht Mackensen seine Umgebung und interessierte Käufer, die ihn in seinem Atelier besuchen, auf die Begabung der jungen Bildhauerin aufmerksam:
Und es ist wirklich rührend, wie er für mich sorgt. Erstens, dass ich bei Klinger ankomme – dann, dass er meine Büste ausstellt und den Leuten noch besonders zeigt und dann führt er doch jeden Menschen, der nach Worpswede kommt, in mein Atelier. Neulich erst wieder einen Konsul Susemiehl aus Bremen und jetzt Carl Hauptmann, den Bruder von Gerhart Hauptmann.
Ihr Brief aus Worpswede vom 4. Mai 1899 an die Eltern klingt voller Selbstvertrauen und Zuversicht:
Ich habe das Gefühl, als ob Mackensen mich bald entlässt – obgleich das ja immer überlegt werden muss – denn er kann mir immer sehr viel sagen. Jedenfalls bin ich ihm ganz ungeheuer dankbar und kann das nicht genug betonen. Denn es ist ganz allein Mackensens Verdienst, wenn ich es binnen einem Jahr dazu gebracht habe, dass ich vollständig weiß, was ich brauche und muss und will. Und dass ich nicht im Mindesten mehr das Gefühl habe, in meiner Kunst von irgendjemand abhängig zu sein.
Dresden, im April 1899. Clara Westhoff ist tatsächlich zur Deutschen Kunstausstellung eingeladen worden und kann jetzt zum ersten Mal öffentlich als Künstlerin auftreten.
Sie zeigt ihr »Porträt der Alten«. Die Arbeit wirke, äußert sie, ganz merkwürdig zwischen all den anderen, vorwiegend neobarocken und neoklassizistischen Plastiken, darunter auch Skulpturen von Max Klinger.
Wie aufregend der Augenblick, als Fritz Mackensen am Tag der Eröffnung Max Klinger zu Clara Westhoffs Bildnisbüste führt. Der 42-jährige Bildhauer äußert sich lobend über die antiakademische Arbeit der jungen Worpsweder Künstlerin und erklärt sich ohne Umschweife bereit, sie in seinem Leipziger Atelier arbeiten zu lassen. Wieder zurück in Worpswede teilt sie den Eltern mit: Ich will hier keine neue Arbeit mehr anfangen, denn dazu will ich auch erst in der Technik ganz und gar bewandert sein.
Sie glaube, es sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt, zu Klinger zu gehen, fährt sie in ihrem Brief fort und weist darauf hin, dass sie vor ihrer Abreise noch eine Arbeit abschließen möchte, mit der sie bereits begonnen habe. Es drehe sich um ein Porträt von Fräulein Becker, ihrer Freundin:
Ich glaube, es wird gut. Da ist mir nämlich eine ganz andere Aufgabe gestellt worden wie sonst. Deshalb bin ich auch gestern elendiglich in die Brüche gegangen. Heute habe ich nochmals angefangen und ich glaube, jetzt krieg ich es und darüber bin ich riesig froh. Ich möchte nun etwas ganz Feines daraus machen und möchte es auch gern in diesen Tagen fertig kriegen.
Clara Westhoff formt Paula Beckers Büste in Gips: die helle Schulterpartie leicht gebogen und auf dem dunkel getönten Sockel wie losgelöst, Hals und Kopf mit dem kräftigen Haarknoten nach vorn gestreckt, der Ausdruck des feingliedrigen Gesichts aufmerksam und voller Energie. Ein Porträt, das schwerelos wirkt und zugleich von vibrierendem Leben erfüllt ist.
•
Als Clara Westhoff im August 1899 in Klingers Atelier in Leipzig zu arbeiten beginnt, darf sie von Glück reden, dass er sie für begabt hält und trotz seiner grundsätzlichen Skepsis Bildhauerinnen gegenüber ernst nimmt.
So habe er ihr schon am ersten Tag ein Stück Marmor zur Verfügung gestellt, damit sie es bearbeite, nur um mal Hammer und Meißel in der Hand zu haben und er wollte sehen, wie ich mich dabei benähme, berichtet sie hochgestimmt nach Bremen. Selbst wenn sie auch nicht »direkt« Klingers Privatschülerin ist und bei seinen bildhauerischen Projekten mitarbeiten darf, so hat sie doch die Möglichkeit, sich den ganzen Tag in seiner Nähe aufzuhalten und unter seiner Aufsicht arbeiten: Ich finde es riesig nett, dass ich direkt für mich unter Anleitung Klingers eine Studie in Marmor mache, nachher weiß ich von allem Bescheid und kann allein weiterfinden (…) Das Studium auf diese Weise – ohne direkt Schülerin zu sein, macht sehr viel Freude.
Und dieses von Mackensen vermittelte Studium ist kostenlos. In ihren Briefen nach Hause ist an keiner Stelle von einem Unterrichtsgeld die Rede, das Klinger der jungen Worpsweder Künstlerin in Rechnung gestellt haben könnte. Im Gegenteil. Indem er seinen Freund und Kollegen Carl Ludwig Seffner beauftragt, Clara Westhoff den Umgang mit dem Punktiergerät beizubringen, erweist Klinger sich als ausgesprochen großherzig. Seffner führt sie in die Technik des Steinhauens ein und macht sie mit den verschiedenen Gussverfahren vertraut: Seffner und seine Arbeiter haben mir gestern das Abgießen meiner Hand gezeigt, notiert die 21-Jährige, bevor sie beginnt, diese in Marmor zu übertragen. Am 9. August schreibt sie an die Eltern nach Bremen:
Und jetzt stehe ich in einem anderen der unteren Räume von Klingers Atelier und punktiere meine in Gips abgegossene Hand aus dem Stein heraus; was gar keine leichte Arbeit ist. Klinger sagt, er hätte mir den Block nur zum Abschrecken gegeben und wundert sich sehr über meine Konsequenz und Ausdauer, mit der ich mir die Hände zerschlage.
Handwerkliches Geschick, körperliche Kräfte, Durchhaltevermögen. Max Klinger ist beeindruckt. Seine positive Reaktion auf ihre Arbeit wirkt anregend. Jetzt reizt es sie, ihre künstlerische Begabung mit einer Plastik unter Beweis zu stellen, die ihr ganz allein, ohne Hilfe und außerhalb von Klingers Atelier gelingen soll. Und so entsteht an ein paar Augustabenden im Sommer 1899 das Tonmodell eines Knabenreliefs, das für Überraschung und Anerkennung sorgt. 26. August 1899:
Nun habe ich unterdessen, nach einigen Modellschwierigkeiten – der Junge wollte nicht Akt stehen – ein Relief modelliert, nebenbei zu Hause (…) Seffner sagte, ich soll das Relief mit zu Klinger bringen (…) Gestern Abend um sieben Uhr war das Stelldichein. Beide Herren waren schon da, als ich kam und auf meine Anmeldung kamen sie sogleich herunter. Und da hat ihnen dann das Relief sehr gefallen. Nun habe ich aber, glaube ich, dadurch ihr ganzes Interesse erobert, denn sie waren alle beide ganz Feuer und Flamme, sagten, das Relief wäre reizend komponiert etc. (…) Klinger hat mir (…) gestern besonders nett die Hand gedrückt und mir gesagt, dass ich so viel Ausdauer und Geschick bewiesen hätte –, »Talent haben Sie, das ist keine Frage, aber lernen müssen Sie noch viel«. Und komponiert wäre das Ding reizend, ganz famos und Stimmung hätte es. – Natürlich war dennoch vieles, was anders sein muss – aber das fehlt nur an der Zeichnung, an der Wiedergabe der Knochen und Gelenke – so einiges, was ich ja aber auf jeden Fall lerne – und schon gelernt habe.
Noch am selben Tag lässt sie Vater und Mutter Westhoff in Bremen wissen:
Mein Plan ist der, nach Fertigstellung des Reliefs wieder nach Worpswede zu gehen, – aber vorher Klingers Interesse soweit zu wecken, dass er mir erlaubt, ihm von dort aus, immer mal was von meinen Sachen zu schicken oder auf irgendeine Art zu zeigen, um seinen Senf zu hören.
Wieder nach Worpswede gehen? Nein! Ganz entschieden rät Max Klinger der jungen Künstlerin von ihrem Plan ab. Nein, auf keinen Fall zurück nach Worpswede! Die Herren dort hätten ganz andere Interessen als sie, begründet er seinen Einwand und legt ihr ans Herz, nach Paris zu gehen, an die Privatakademie Julian, wo sie auch als Frau studieren könne. Schließlich sei sie noch jung, müsse Aktzeichnen üben, anatomische Studien machen, sich mit gleichaltrigen Künstlern austauschen.
Doch wie soll das alles in die Realität umzusetzen sein? Wie zu finanzieren? Natürlich weiß sie, dass ein längerer Aufenthalt in der französischen Hauptstadt ohne die materielle Unterstützung ihrer Eltern undenkbar ist. Doch Friedrich Westhoff, der an das künstlerische Können seiner Tochter inzwischen kaum mehr glaubt, ist ungeduldig geworden. Er hält ihre Ausbildung nach den Lehrjahren in München und Leipzig für endgültig beendet und will ihr keine monatlichen Wechsel mehr zahlen. Willensstark, wie sie ist, setzt Clara alles daran, ihn umzustimmen. Paris! Klinger hat recht. Sie muss nach Paris. Und sie muss es schaffen, parallel zu ihrem Studium auf irgendeine Weise Geld zu verdienen.
Am 3. September 1899 schreibt sie aus Leipzig nach Bremen: Ich habe schon gedacht, wenn Du Vater, es willst, würde ich ein Porträt von Großmama machen und vielleicht noch einige, um sie auszustellen, um eventuell einige Bestellungen auf Porträts zu bekommen, damit ich erst mal was verdiene. Selbst wenn sie sich diesbezüglich dem Publikumsgeschmack anpassen und auf Kompromisse einlassen müsse – das Wichtigste wäre doch einfach nur, dass sich die Plastiken auf dem Markt gut verkauften und weitere Aufträge und Verkäufe nach sich zögen.
Zurück in Bremen, beginnt Clara unverzüglich mit der Arbeit an dem Porträt ihrer Großmutter Laura Westhoff. Doch unter dem Druck einer eher unerfreulichen Stimmung zu Hause misslingen ihre ersten Porträt-Versuche.
Ich bin überzeugt, dass diese Arbeit mir viel besser geglückt wäre, hätte ich diese Arbeit früher (…) in aller Ruhe angefangen. Die richtige Ruhe hatte ich doch nicht, als ich so plötzlich anfing, rechtfertigt sie sich. Ich will nächsten Montag früh morgens (…) gleich zu Großmama und lasst mich nur ganz gewähren – jetzt ist ja die Hauptsache, dass Großmama gut wird.
In Gedanken bereits auf dem Weg nach Paris, geht Clara Westhof jetzt täglich in das Haus ihrer Großmutter. Geduldig sitzt die alte Dame ihrer Enkelin Modell, die sich allmählich in die erzählenden Konturen des ihr so vertrauten Gegenübers hineinzusehen und -zufühlen versucht. Zahlreiche Falten und Furchen durchziehen Laura Westhoffs schmales Gesicht mit den eingefallenen Wangen und der hohen Stirn, die von einem Witwenhäubchen gekrönt wird. Eine große Brosche schließt den Kragen ihres Kleides. Clara stellt sie ganz naturalistisch dar. Schließlich gelingt ihr eine Physiognomie, die trotz ihrer Greisenhaftigkeit und Verbrauchtheit die Autorität und Würde einer Frau aus dem Großbürgertum ausstrahlt.
•
Auf Veranlassung von Gustav Pauli, Direktor der Bremer Kunsthalle, hat Clara Westhoff kurz vor Weihnachten 1899 die Gelegenheit, dort drei Porträtbüsten auszustellen. Paula Becker zeigt zwei Bilder und zahlreichen Studien, Marie Bock ebenfalls einige ihrer Arbeiten. Bevor der in Bremen tonangebende Kunstkritiker und Maler Arthur Fitger zu einem niederschmetternden Verriss gegen die beiden Malerinnen und ihre »unqualifizierten Leistungen« ausholt, erwähnt er die Plastiken von Clara Westhoff und betont ihr »ausgesprochenes Talent«. Doch gleichzeitig empört es ihn, dass »Anfänger bereits mit ihren Studien die Ausstellungen unsicher machen« und so äußert er sich am 13. Dezember 1899 über sie: Die Künstlerin ist, wie wir hören, eine noch sehr junge Dame; dafür scheint uns ihre Kunst schon ein bisschen reichlich dreist. Dreistigkeit steht nur ganz kleinen Kindern wohl, hernach, und namentlich junge Mädchen, kleidet eine zarte Schüchternheit viel anmutiger, bis dann bei reiferen Jahren die kindliche Dreistigkeit als jugendliche Kühnheit wieder hervortreten und alle Herzen bezaubern mag.
Dass Clara Westhoff und ihre Kolleginnen mit ihrem frühzeitigen Auftritt ein Tabu durchbrachen und statt Schüchternheit Selbstbewusstsein zeigten, ärgerte Fitger, der ein Gegner der Worpsweder und aller Modernen war. Erbaulich, repräsentativ, gut und wahr; so sollte seiner Auffassung nach die Kunst sein. Eine schöne Landschaft, ein erzählendes Genrebild. Das Suchende, nach Ausdruck und Form Tastende lehnte er ebenso ab wie das Neue und Irritierende.
Fitger war mit seinem konservativen Kunstgeschmack nicht allein. So hatten Presse und Öffentlichkeit die erste Ausstellung der Worpsweder 1895 in der Bremer Kunsthalle als »schlechten Scherz« verspottet und die tonige Farbgebung ihrer Malerei als »schmutzige Flecken« kritisiert. Noch viele Jahre später musste ein Museumsmann aus München feststellen, dass es in der Hansestadt nach wie vor genügend Leute gab, auf die der Name Worpswede wirkte »wie auf den Bullen das rote Tuch«.
Es gab hingegen auch Stimmen, die mit den Angriffen des Bremer Kritikerpapstes auf die jungen Künstlerinnen nicht einverstanden waren. So setzte sich der Worpsweder Maler Carl Vinnen Ende Dezember 1899 für die »armen Worpsweder Damen« ein: »Schon kürzlich hatte unsere Landsmännin Fräulein Westhoff das Unglück, sich eine Zurechtweisung zuzuziehen für dieselben Arbeiten, über die Max Klinger in Dresden in Gegenwart des Schreibers dieser Zeilen sich nicht nur höchst anerkennend äußerte, sondern welche ihn auch bewogen hatten, dieselbe als Schülerin anzunehmen. Hoffen wir, dass diese Anerkennung sie ein klein wenig für die Aufnahme in ihrer Vaterstadt entschädigen möge«.
Doch zu diesem Zeitpunkt hat Clara Westhoff ihre Vaterstadt Bremen längst verlassen und ist, vier Wochen bevor sich Paula Becker auf den Weg in die französische Metropole macht, bereits in Paris.
KAPITEL III
Heute war ich wieder bei Rodin im Atelier
PARIS 1899 – SEPTEMBER 1900
Im Atelier verschwindet alles; man hat weder einen Namen, noch eine Familie, man ist nicht mehr die Tochter seiner Mutter, man ist man selbst, ist ein Individuum, das die Kunst vor sich hat und sonst nichts. Man fühlt sich so zufrieden, so frei, so stolz! Endlich bin ich so, wie ich es seit langem sein wollte: Ich habe es mir so lange gewünscht, dass ich es noch gar nicht glauben kann.
Marie Bashkirtseff