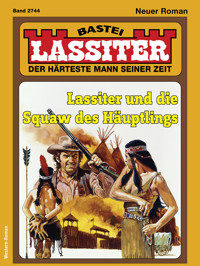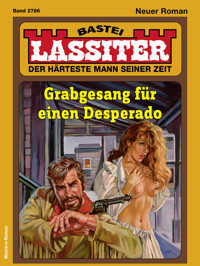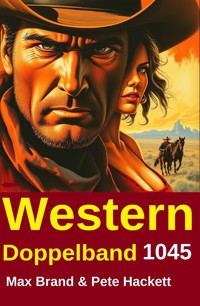4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Sammelband zur großen Western-Saga von Pete Hackett!
Ken Clayton, ein einsamer Mann steht am Scheideweg und muss sich seinem Schicksal und seiner Vergangenheit stellen.
Hart, historisch genau, mit faszinierender Detailkenntnis der amerikanischen Wildnis und mit aufrechten, mannhaften Charakteren.
Als Town Marshal Ken Clayton die vier heruntergekommenen Kerle an seinem Büro vorbei reiten sah, ahnte er nicht, dass ihr Erscheinen in Topeka einen Wendepunkt in seinem Leben darstellen sollte.
Die Kerle gefielen dem sechsundvierzigjährigen Gesetzeshüter nicht. Es waren Sattelstrolche, Burschen, die es an keinem Ort längere Zeit hielt, die sich oftmals einfach nahmen, was ihnen gefiel und die sich meistens hart am Rande der Gesetzlosigkeit bewegten.
So beginnt diese faszinierende Western-Saga aus der Feder eines Top-Autors.
Cover: Steve Mayer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Clayton - ein Mann am Scheideweg: Die ganze Western Saga
Band 1-7
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenClayton - Ein Mann am Scheideweg -
Sammelband 1 bis 7
Western von Pete Hackett
Pete Hackett Western-Sammelband - Deutschlands größte E-Book-Western-Reihe mit Pete Hackett's Stand-Alone-Western sowie den Pete Hackett Serien "Der Kopfgeldjäger", "Weg des Unheils", "Chiricahua" und "U.S. Marshal Bill Logan".
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Band 1
Als Town Marshal Ken Clayton die vier heruntergekommenen Kerle an seinem Büro vorbei reiten sah, ahnte er nicht, dass ihr Erscheinen in Topeka einen Wendepunkt in seinem Leben darstellen sollte.
Die Kerle gefielen dem sechsundvierzigjährigen Gesetzeshüter nicht. Es waren Sattelstrolche, Burschen, die es an keinem Ort längere Zeit hielt, die sich oftmals einfach nahmen, was ihnen gefiel und die sich meistens hart am Rande der Gesetzlosigkeit bewegten.
Es war ein warmer Tag im Mai des Jahres 1881. Seit drei Jahren trug Ken Clayton in Topeka den Stern des Town Marshals. Vorher hatte er in einer Reihe von wilden Städten mit eisernem Besen gekehrt. Innerhalb kürzester Zeit hatte er auch in Topeka für Ruhe und Ordnung gesorgt und das Gesindel, das in der Stadt für Angst und Schrecken sorgte, mit Pulverdampf und Blei zum Teufel gejagt. Das hatte ihm den traurigen Ruhm eingebracht, ein unschlagbarer Kämpfer zu sein.
Die vier Reiter verschwanden aus dem Blickfeld des Town Marshals. Er blieb dennoch am Fenster stehen und schaute versonnen nach draußen. Immer öfter dachte er zurück, und den Nebeln der Vergangenheit entstiegen die verschiedensten Bilder. Da war eine kleine, beschauliche Stadt, die den Namen Great Bend trug, und da war das hübsche Gesicht einer jungen Frau namens Faye Donovan. Sie hatte ihn angefleht, in Great Bend zu bleiben, doch er wollte hinaus in die Welt und Abenteuer erleben. Es war über zwanzig Jahre her, und viele Jahre lang waren sowohl Great Bend als auch Faye Donovan bei Ken Clayton in Vergessenheit geraten. Jetzt aber stürmte die Erinnerung immer öfter und immer intensiver auf ihn ein.
Seufzend wandte er sich ab, ging hinter seinen Schreibtisch und setzte sich. Das gleichmäßige Ticken des Regulators an der Wand war das einzige Geräusch in dem düsteren Raum. Es war später Nachmittag. Clayton holte eine Kladde aus dem Schreibtischschub und griff nach dem Federhalter, der neben einem Tintenglas auf dem Schreibtisch lag. Er begann seinen täglichen Bericht niederzuschreiben. Seit Monaten hieß es: Der Tag verlief ohne besondere Vorkommnisse. An diesem Tag schrieb Ken Clayton darüber hinaus in das Buch, dass vier Fremde in die Stadt gekommen waren, bei denen es sich möglicherweise um Banditen handelte. Die Feder kratzte über das Papier, immer wieder tauchte Clayton sie in die Tinte.
Spürte er, dass die vier Fremden richtungweisend für seine Zukunft waren? War es eine Art sechster Sinn, der ihm sagte, dass mit ihnen der Verdruss nach Topeka gekommen war? Möglicherweise nur unterbewusst. Als Clayton die Ankunft der vier Fremden vermerkte, leitete ihn kein besonderer Wille. Es war eine Beobachtung, die er für wichtig hielt und die er deshalb schriftlich fixierte.
Jemand klopfte gegen die Tür, und ehe Clayton ihn auffordern konnte, einzutreten, wurde die Tür schon geöffnet und ein bärtiger Mann streckte den Kopf durch den Türspalt. „Guten Tag, Ken. Hast du die vier Kerle gesehen, die vor wenigen Minuten in die Stadt gekommen sind?“
„Ja, Jonas. Was ist mit ihnen?“
„Ich bin ihnen auf der Straße begegnet und einer hat mich gefragt, ob Ken Clayton noch Stadtmarshal ist.“
Die Brauen des Town Marshals schoben sich zusammen, über seiner Nasenwurzel bildeten sich zwei senkrechte Falten, und er biss sekundenlang die Zähne zusammen, sodass die Backenknochen in seinem kantigen, schmalen Gesicht hart hervortraten. „Stellten sie sonst noch Fragen?“, erkundigte sich Clayton.
„Nein. Als ich bejahte, sagte er Kerl lediglich, dass sie richtig seien. Dann ritten sie weiter zum Long Rider Saloon.“
„Hast du dir ihre Gesichter angeschaut?“, fragte Clayton.
„Natürlich habe ich sie gesehen, aber sie ritten sofort weiter …“
„Komm herein, Jonas, und schau dir die Steckbriefe an. Vielleicht erkennst du den einen oder anderen der Kerle wieder.“
Nach dem letzten Wort holte Ken Clayton einen dünnen Packen Steckbriefe aus der Schublade. Jonas Benton kam ins Büro, drückte die Tür hinter sich ins Schloss, dann nahm er sich die Steckbriefe vor. Jeden einzelnen las er, betrachtete die Konterfeis eingehend, und als er durch war, schüttelte er den Kopf. „Ich kann keinen von ihnen erkennen, Ken.“
„Es ist gut, Jonas. Vielen Dank.“
Nachdem Jonas Benton das Office verlassen hatte, holte Ken Clayton eine Schrotflinte aus dem Gewehrschrank, lud beide Läufe und verließ das Büro. Auf seinem Weg zum Saloon begegnete er nur wenigen Passanten. Hinter dem einen oder anderen Fenster konnte er den hellen Fleck eines Gesichts erkennen. Aufrecht und furchtlos schritt Ken Clayton am Rand der Fahrbahn in Richtung des Saloons, in dem er das Quartett vermutete. Seine Sohlen mahlten im Staub, und der Staub puderte seine Schuhe. Er trug die Shotgun links am langen Arm. Der Handballen seiner Rechten streifte den Knauf des schweren 45er Coltrevolvers, der im offenen Holster tief an seiner rechten Hüfte hing.
Etwas regte sich im Hintergrund seines Bewusstseins – es entzog sich jedoch seinem Verstand. Da war nur eine Ahnung – und an ihrem Ende stand etwas Dunkles, Unheilvolles.
Am Holm vor dem Long Rider Saloon standen die vier verstaubten und verschwitzten Pferde. Müde ließen sie die Köpfe hängen, mit den Schweifen schlugen sie nach den Blut saugenden, lästigen Bremsen an ihren Flanken. Ken Clayton schaute sich die Brandzeichen der Tiere an. Er kannte sie nicht. Entschlossen trat er auf den Gehsteig, stieg nach wenigen Schritten die vier Stufen zum Vorbau des Saloons hinauf und schritt zur grün gestrichenen Pendeltür. Seine Schritte erzeugten ein trockenes Hämmern auf den Vorbaubohlen. Ohne im Schritt zu stocken betrat der Town Marshal den Schankraum. Hinter ihm schlugen die Batwings der Tür quietschend und knarrend aus.
Einen Schritt hinter der Tür hielt er an. Die vier Kerle lümmelten an einem Tisch. Andere Gäste waren um diese frühe Abendzeit nicht im Saloon. Der Keeper schenkte hinter dem Tresen Bier in Glaskrüge. Die Blicke, mit denen die vier Männer Ken Clayton maßen, waren stechend, zugleich aber forschend und prüfend. Es war, als nähmen sie Maß.
Groß und hager stand der Town Marshal vor der Pendeltür, die sich beruhigt hatte. Bekleidet war er mit einem dunkelbraunen Anzug und einem weißen Hemd, seine Schnürsenkelkrawatte war von rubinroter Farbe, seine rauchgrauen Augen zeigten nichts als steinerne Ruhe. „Ihr habt euch nach mir erkundigt“, rief er grollend und schaute von einem zum anderen. Seinen Blick konnte man als unergründlich bezeichnen.
Einer, ein dunkelhaariger Mann von etwa dreißig Jahren, stoppelbärtig und verstaubt, in dessen Gesicht ein unstetes Leben unübersehbare Spuren hinterlassen hatte und um dessen Mund ein brutaler Zug lag, fragte: „Bist du Ken Clayton?“
„Ja.“
Jetzt zeigte der Dunkelhaarige ein kantiges Grinsen. „Du hast einen Ruf wie Donnerhall, Clayton. Dein Name ist sogar über die Grenzen Kansas’ hinaus bekannt. Eine lebende Legende bist du. Man behauptet, dass du weder mit dem Colt noch mit dem Gewehr zu schlagen bist.“
Ken Claytons düstere Ahnung begann Formen anzunehmen. Bitterkeit stieg in ihm hoch. Er presste die Lippen zusammen, sodass sie nur einen dünnen, blutleeren Strich bildeten, dann stieß er hervor: „Und deswegen seid ihr hier, wie? Wollt ihr euch davon überzeugen, ob ich wirklich unschlagbar bin?“
„Man Name ist Larry Wood“, erklärte der Dunkelhaarige. „Das sind meine Freunde Dave Burton, John McClure und Anthony Potts.“ Nacheinander wies er mit dem Kinn auf seine Begleiter. Keiner von ihnen war älter als dreißig. Und jedem standen Verkommenheit, Niedertracht und Skrupellosigkeit ins Gesicht geschrieben.
„Schön, Wood. Ich kenne jetzt eure Namen. Die Antwort auf meine Frage bist du mir allerdings schuldig geblieben.“
„Der Mann, der dich im Revolverkampf besiegt, erlangt Berühmtheit“, versetzte Wood und grinste schief.
„Traurige Berühmtheit“, gab Ken Clayton zu verstehen. „Und er wird keine Ruhe finden. Denn es wird immer jemand geben, der einen berühmten Kämpfer besiegen will, um selbst Ruhm einzuheimsen. Merk dir eines, mein Freund: Nicht die Schnelligkeit und Treffsicherheit mit einer Waffe machen einen guten Mann aus. Und die Waffe – sie ist immer nur so gut – oder so schlecht wie der Mann, der sie in den Händen hält. Ich gebe dir und deinen Freunden den Rat, auszutrinken, auf die Pferde zu steigen und Topeka zu verlassen. Lasst die verrückte Idee, hier zu Berühmtheit zu gelangen, sausen. Es ist keine echte Berühmtheit, und wie ich schon sagte …“
„Du bist alt, Clayton!“, unterbrach Larry Wood den Town Marshal. „Vielleicht ist es auch die Angst, die dich so sprechen lässt. Hat dich der Mut verlassen? Man sagt dir nach, dass du ein eisenharter, kompromissloser Kämpfer wärst, einer, der in die Hölle reitet und dem Satan ins Maul spuckt. Stimmt das alles etwa gar nicht? Bist du ein Feigling geworden, der sich hinter dem Stück Blech an der Jacke verkriecht?“
Herausfordernd starrten die Kerle den Gesetzeshüter an.
Ken Clayton spürte, dass sie Worten nicht zugänglich waren. Er sagte grollend: „Ihr seid Dummköpfe, denn ihr sucht die Gefahr. Kennt ihr das Sprichwort: Wer die Gefahr sucht, kommt in ihr um? Es beinhaltet ein hohes Maß an Wahrheit. Sicher, Wood, ich bin gut und gerne fünfzehn Jahre älter als du, und vielleicht bin ich mit sechsundvierzig alt. Du, Wood, wirst dieses Alter nicht erreichen, wenn du nicht sehr schnell einen anderen Weg einschlägst. Das gilt auch für deine Freunde. Darum beherzigt meinen Rat und verlasst Topeka. Ich vertrete hier das Gesetz, und ich werde ihm Geltung verschaffen, wenn jemand der Meinung ist, es mit Füßen treten zu müssen. War das klar genug?“
„Sicher, Clayton, sicher.“ Larry Wood nickte wiederholt und sein Grinsen wurde breiter und herausfordernder. „Die Frage ist nur, wie du dem Gesetz Geltung verschaffen möchtest, wenn du tot bist.“
„Noch lebe ich, Wood“, erwiderte Ken Clayton und schaute den Burschen mit stählerner Härte im Blick an. Nach diesen Worten verließ der Town Marshal rückwärtsgehend den Saloon. Draußen atmete er auf. Ken Clayton gab sich keinen Illusionen hin: Die nächste Zukunft würde wenig erfreulich werden für ihn. Die vier Narren würden ihn zwingen, zu kämpfen. Er verspürte Widerwillen.
*
Um 19 Uhr löste der Nachtmarshal Ken Clayton ab. Er ging nach Hause. Seine Frau Joana hatte das Abendessen zubereitet. Sie nahmen gegenüber am Tisch in der Küche Platz, nachdem Clayton die Jacke ausgezogen, die Krawatte abgenommen und den Revolvergurt abgeschnallt hatte.
Den Clayton schien ausgesprochen in sich gekehrt zu sein. Er hatte sich vorgenommen, Joana nichts von den vier Ankömmlingen zu erzählen, denn er wollte sie nicht beunruhigen. Joana und er waren seit dreizehn Jahren verheiratet. Ohne zu murren war sie ihm in all die wilden Städte gefolgt, in der er als zähmende Hand die Ruhe und den Frieden herstellte.
Joana hatte mageres Fleisch gebraten und frisches Brot gebacken. Dazu gab es Bohnen und Bratkartoffeln. Nachdem sie den Teller ihres Mannes gefüllt hatte, sagte sie: „Es hat sich mit der Schnelligkeit eines Lauffeuers in der Stadt verbreitet, Ken. Ich kenne dich und weiß, dass du mit mir nicht darüber sprechen möchtest. Ich will nicht, dass du dich den vier Strolchen zum Kampf stellst. Sie sind ehrgeizig und das Wort Fairness kennen sie wahrscheinlich gar nicht.“
Ken Clayton stieß scharf die Luft durch die Nase aus. „Was soll ich denn tun, Joana? Soll ich die Stadt verlassen und warten bis das Quartett wieder verschwunden ist?“ Er lachte gallig auf. „Das wäre meinem Ansehen hier in der Stadt sicher nicht förderlich.“
„Denkst du, es fördert dein Ansehen, wenn sie dich erschießen?“
„Seit zwanzig Jahren vertrete ich in verschiedenen Städten das Gesetz, Joana“, murmelte er. „Es war nicht immer einfach, und ich hatte es oftmals mit Kerlen von einem Kaliber zu tun, denen die vier Strolche wahrscheinlich nicht einmal das Wasser reichen können. Trotzdem bin ich sechsundvierzig Jahre alt geworden.“
„Irgendwann findet jeder seinen Meister.“
Clayton zuckte mit den Schultern. „Ich muss es auf mich zukommen lassen.“ Er schnitt ein Stück Fleisch ab und schob es sich in den Mund, begann zu kauen und hoffte, dass mit seinem letzten Satz das Thema beendet war.
„Ja, du bist sechsundvierzig, und von den Strolchen ist keiner dreißig. Gewiss tragen sie ihre Schießeisen nicht nur zur Dekoration herum. Das sind Halsabschneider, die mit allen schmutzigen Wassern gewaschen sind und denen nichts heilig ist. – Du musst mit dem Town Mayor sprechen, Ken. Er muss eine Bürgerwehr auf die Füße stellen, die dir gegen die vier Coltschwinger beisteht. Du hast viel für diese Stadt getan. Nun ist es an der Zeit, dass sie zu dir steht.“
Clayton schluckte den Bissen hinunter. „Ich glaube nicht, dass sich auch nur ein einziger Mann in der Stadt bereit erklärt, eine Waffe in die Hand zu nehmen und gegen ein paar Revolvermänner anzutreten. Der Weg wäre umsonst, Joana, und die Aktion wäre für mich wahrscheinlich die größte Enttäuschung meines Lebens.“
„Wenn du nicht zum Bürgermeister gehst, dann suche ich ihn auf!“, stieß Joana Clayton im jähen Entschluss hervor.
„Lass mich essen, Joana, ich habe Hunger.“
„Iss! Und wenn du gegessen hast, machst du dich auf den Weg.“
„Es ist sinnlos …“
„Du musst es versuchen, Ken.“ Joana sprach eindringlich, verlieh ihren Worten Nachdruck und nahm den Blick nicht vom Gesicht ihres Mannes, als wollte sie damit Druck auf ihn ausüben.
Ken Clayton begriff, dass seine Frau nicht umzustimmen war. Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, und sie würde nicht nachgeben, bis sie ihrem Willen Geltung verschafft hatte.
Er liebte Joana. Sie war zehn Jahre jünger als er und verströmte etwas, das ihn vom ersten Augenblick an in ihren Bann gezogen hatte. Sie war nicht schön, sie war aber auch nicht hässlich. Ich Gesicht bestach nicht so sehr durch seine Regelmäßigkeit, sondern durch seine Wärme und Fraulichkeit, die es verstrahlte. Joana hatte brünette Haare, die sie hochgesteckt trug. Ihr Kleid betonte ihre schlanke Taille.
Ken Clayton nickte und sagte: „Na schön, Joana, ich werde den Bürgermeister aufsuchen. Doch solltest du dir keine Hoffnung machen.“
Die Frau kniff die Augen etwas zusammen. „Du willst ja gar nicht, dass dir jemand hilft!“, brach es plötzlich über ihre zuckenden Lippen.
„Ich will nicht, dass Bürger von Topeka gefährdet und vielleicht sogar getötet werden, Joana. Ich bin der Town Marshal, die Stadt bezahlt mich dafür, dass ich für Ordnung sorge. Es ist meine Pflicht, die Bürgerschaft zu beschützen, nicht sie einer Horde schießwütiger Pilger auszuliefern.“
„Nein, Ken. Es ist dein Stolz – dein verdammter, falscher Stolz. Du hast deine Angelegenheiten schon immer alleine geregelt, und das willst du auch in Zukunft nicht ändern. Es ist dein Stolz – und er wird irgendwann dein Untergang sein.“
Joana schluchzte trocken. Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Ken Clayton beugte sich etwas über den Tisch und tätschelte ihren Handrücken. „Ich gehe nach dem Essen zu Miller und rede mit ihm. Ich verspreche es dir, Joana. Soll ich dir etwas sagen?“
Fragend fixierte sie ihn.
„Ich habe es schon seit geraumer Zeit satt, den Stern zu tragen und denke immer öfter an die kleine Stadt Great Bend, die ich vor über zwanzig Jahren verlassen habe. Wir haben genügend Geld gespart, Liebste. Und für einen Mann in meinem Alter ist es an der Zeit, sich einen Platz zu suchen, an dem er ohne Pulverdampf und Blei in Ruhe leben kann. Ich habe fünf Jahre lang im Store als Helfer gearbeitet und eine Menge über den Beruf des Kaufmanns gelernt. Wir könnten in Great Bend ein Geschäft eröffnen und unabhängig von unserem Ersparten für unser Auskommen sorgen.“
Joana wischte sich die Tränen aus den Augen und lächelte. „Das ist ein guter Vorschlag, Ken. Du machst mich damit glücklich. Ich wäre sofort dabei. Wenn es nach mir ging, könnten wir schon morgen Topeka verlassen.“
Ken Clayton lachte. „So schnell geht es nicht, Joana“, wehrte er dann ab. „Ich muss meinen Vertrag mit der Stadt kündigen, wir müssen unser Haus verkaufen, wir brauchen ein Fuhrwerk, mit dem wir unseren Hausrat befördern können, und, und, und.“
Ihr Lächeln war wieder wie weggewischt. „Du willst die Sache mit den vier Kerlen erledigen, nicht wahr?“
Auch Ken Clayton wurde wieder ernst. „Nur selten ist es einem Mann gelungen, seiner Vergangenheit zu entfliehen. Sie holt ihn immer wieder ein. Und wenn Larry Wood und seine Komplizen das Gefühl haben, dass ich vor ihnen geflohen bin, stärkt das ihr Selbstbewusstsein, und sie werden mir folgen – wohin ich auch gehe. Daher muss ich erst einen Schlussstrich ziehen, ehe wir Topeka verlassen.“
„Ich habe Angst“, murmelte die Frau, und ihre Stimme klang gepresst. „Ich hatte immer Angst um dich, Ken. Doch diesmal ist dieses Gefühl ganz besonders intensiv.“
„Ich spreche mit dem Town Mayor“, versicherte Ken Clayton.
Nach dem Essen verließ er sein Haus. Es war noch hell, aber die Sonne stand schon tief und die Schatten waren lang. Sein Ziel war das Haus des Bürgermeisters.
*
Es war dunkel, als Ken Clayton nach Hause zurückkehrte. Seine Frau erwartete ihn in der Küche. Das Licht der Laterne, die über dem Tisch von der Decke hing, spiegelte sich in ihren Augen und ließ sie glitzern.
Ken Clayton hängte seinen Hut an den Haken neben der Tür und zog die Jacke aus. Der erwartungsvoll-fragende Blick Joanas weckte in ihm ein Gefühl des Unbehagens. Er nahm den Patronengurt ab, rollte ihn zusammen und legte ihn auf ein Bord. Dann sagte er: „Ich wusste es, Joana. Miller hat es abgelehnt, eine Bürgermiliz zusammenzustellen. Er begründet es damit, dass er nicht berechtigt sei, das Leben der Bürger in die Waagschale zu werfen. Er schlug mir vor, mich selbst mit den verschiedenen Leuten zu unterhalten und sie um Unterstützung zu bitten.“
Jeder Zug im Gesicht der Frau drückte Enttäuschung aus, da waren aber auch Unglaube und Betroffenheit. „Und?“, entrang es sich ihr.
„Ich war bei Saddler, bei Hanson, bei Thompson und bei Draeger. Jeder von ihnen lehnte ab. Draeger wies mich sogar aus seinem Haus und rief mir hinterher, dass er einer von denen sei, die mich bezahlen und dass es nicht seine Aufgabe sei, für mich die heißen Kastanien aus dem Feuer zu holen.“
„Diese feigen Ratten!“, entfuhr es der Frau. „Warum hast du Miller nicht den Stern vor die Füße geworfen, Ken? Diese Stadt ist es nicht wert, dass du deine Haut für sie zu Markte trägst.“
„Es gibt einen Vertrag, Joana. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemals vertragsbrüchig werde. Ja, ich gebe Topeka den Stern zurück. Aber erst muss die Sache mit Larry Wood und seinen Kumpels erledigt sein.“
„Sie werden dich töten. Auf deinen Stern spucken sie. Das sind ehrlose, skrupellose Halunken. Ken, du darfst dich ihnen nicht ausliefern. Im Stall stehen zwei Pferde. Ich kann reiten. Packen wir unser Geld und ein paar andere Habseligkeiten in Satteltaschen und verlassen wir diese Stadt. Ich pfeife auf das Haus und den Hausrat. Gegebenenfalls können wir das Zeug zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen.“
Joana sprach eindringlich, geradezu flehend.
„Ich kann es nicht“, murmelte Ken Clayton. „Noch niemals bin ich weggelaufen, Joana. Würde ich es tun, käme ich mein Leben lang nicht darüber hinweg.“
Es klang abschließend und endgültig.
Joana kannte ihren Mann und gab es auf, ihn beeinflussen zu wollen. Es fiel ihr schwer, und das Herz drohte ihr in der Brust zu zerspringen. Aber sie schwieg.
In der Nacht fand Ken Clayton kaum Schlaf. Nie zuvor in den Jahren, in denen er in Topeka das Gesetz vertrat, hatte er die Bürgerschaft um Hilfe gebeten. Konsequent, kompromisslos, unduldsam und mit unbeugsamer Härte war er den Weg gegangen, den ihm sein Vertrag, der Stern und sein Diensteid vorschrieben. Wie oft hatte er sein Leben in die Waagschale geworfen? Er schalt sich einen Narren, weil er verschiedene Leute um Hilfe angegangen hatte. Und er verspürte tief sitzende Enttäuschung. Ihre Ablehnung hatte ihm die Augen geöffnet.
Als er sich am Morgen von Joana verabschiedete, um seinen Dienst anzutreten, klammerte sie sich an ihn, als wollte sie ihn nie wieder los lassen. Er küsste sie auf den Mund. „Alles wird gut, Joana. Ich verspreche es dir.“
Dann verließ er das Haus. Zurück blieb eine verhärmte Frau, die die Sorge um ihren Mann zerfraß. In dieser Stunde verfluchte sie den Stern, dem er so treu ergeben war. Und sie verfluchte seinen Ehrenkodex, der ihm vorschrieb, sich der Auseinandersetzung mit den vier Revolverhelden zu stellen, sie verfluchte auch seinen Stolz, der ihn möglicherweise in den Untergang trieb.
Im Marshal’s Office traf Ken Clayton auf den Nachtmarshal. Es war ein Mann von zweiunddreißig Jahren, er wirkte drahtig und sehr geschmeidig. Sein eckiges Kinn verriet Durchsetzungsvermögen und Energie, der Zug um seinen Mund Entschlossenheit. Sein Name war Jesse Myer.
„Guten Morgen, Ken“, erwiderte Myer den Gruß des Town Marshals. „Ich kann dir melden, dass es keine besonderen Vorkommnisse in der Nacht gegeben hat.“
„Prima, Jesse. Dann geh nach Hause und leg dich aufs Ohr. Heute Abend musst du wieder fit sein.“
„Ich hab mir die vier Kerle etwas näher angeschaut, Ken“, erklärte Jesse Myer. „Sie haben im Long Rider Saloon gesessen, bis dieser schloss. Ich sage dir, Ken, die vier gehören zur ganz besonders üblen Sorte. Ihr Anführer hat großkotzige Reden geschwungen. Er sprach von Ruhm, Anerkennung und Respekt, die man ihm entgegenbringen würde, wenn er den legendären Ken Clayton im Kampf besiegt. Er ist fest entschlossen …“
„Es sind vier großspurige Grünschnäbel“, gab der Town Marshal zu verstehen. „Sollten sie es versuchen, werden sie ihr blaues Wunder erleben.“
Myer musterte Ken Clayton forschend. „Ich nehme dir diese Gelassenheit nicht ab, Ken“, murmelte er. „Die Sicherheit, die du an den Tag legst, ist aufgesetzt. Es sind keine großspurigen Grünschnäbel, es sind Kerle, die wahrscheinlich tödlicher sind als die Cholera. Ich gehe mit dir auf die Straße, Ken. Und sei es nur, um dir den Rücken frei zu halten.“
„Ich habe keine Ahnung, wenn die Kerle aktiv werden“, versetzte Ken Clayton. „Auch kann ich nicht auf sie losgehen und sie verhaften, denn ich habe nichts in den Händen gegen sie. Wessen soll ich sie anklagen? Also müsste ich sie sehr schnell wieder laufen lassen. Was wäre dadurch gewonnen? Nichts – gar nichts. Es ist so - ich muss ihnen den nächsten Zug überlassen. Es kann sein, dass sie es heute schon versuchen, vielleicht versuchen sie auch, mich mürbe zu machen und warten bis morgen oder übermorgen.“
„Zur Hölle, Ken, es gefällt mir nicht …“
Clayton winkte ab und unterbrach mit dieser Geste den Nachtmarshal. „Mir auch nicht, Jesse. Aber du kannst nicht in den nächsten vierundzwanzig, sechsunddreißig oder achtundvierzig Stunden meinen Aufpasser spielen. Was meinst du, wie lange dein Körper mitspielen würde? Also geh nach Hause und schlaf dich aus.“
„Wahrscheinlich hast du recht, Ken. Gib auf dich acht.“
Jesse Myer versetzte dem Town Marshal einen leichten Klaps auf den Oberarm, dann verließ er das Office.
Ken Clayton holte sich die Schrotflinte aus dem Gewehrschrank und lud sie. Es handelte sich um eine Parkergun, deren Doppellauf und Kolben verkürzt worden waren. Auf kurze Distanz eine absolut tödliche Waffe. Er schob die Waffe auf dem Rücken hinter den Patronengurt. Dann griff er sich die Winchester und hebelte eine Patrone in den Lauf.
Clayton ging hinaus auf den Vorbau und trat an das Geländer heran, schwenkte seinen Blick die Straße hinauf und hinunter und registrierte, dass die Stadt seltsam ruhig war. Um diese Zeit öffneten normalerweise die Geschäfte, Männer verließen ihre Häuser um ihrem Tagwerk nachzugehen, Kinder liefen lärmend zur Schule am südlichen Stadtrand.
Das war der Alltag.
Heute war alles anders. Topeka schien den Atem anzuhalten. Es war wie die Ruhe vor dem Sturm. Ken Clayton spürte die bösen Impulse, die die Ortschaft durchströmten. Unheil und Verderben … Ganz deutlich fühlte er den Pulsschlag der tödlichen Gefahr.
Dem Fegefeuer seiner Gedanken ausgesetzt stieg er vom Vorbau und wandte sich nach rechts. Seine Schritte waren kurz und abgezirkelt. Das Gefühl von Einsamkeit und Alleingelassensein verdrängte er. Er war auf Kampf eingestellt. Das Unabänderliche vor Augen war er ruhig und kalt wie ein Eisblock.
Als ein Mann aus einer Gasse trat und zur Mitte der Main Street ging, wusste Ken Clayton, dass die Stunde der Entscheidung angebrochen war. Die Kerle wollten keine Zeit verlieren. Er hielt an.
Der Town Marshal schaute nach links und nach rechts, und er sah einen weiteren der Kerle mit einem Gewehr im Hüftanschlag in einer Passage stehen. Und nun erschien auf dem Dach des Long Rider Saloons ein dritter Mann. Von ihm waren über dem Rand der falschen Fassade nur der Kopf und die Schultern zu sehen.
Ken Clayton gab sich keinen Illusionen hin. Ihm stand ein Kampf auf Leben und Tod bevor. Dieses Mal hatte er es nicht mit ein paar Revolvercowboys zu tun, sondern mit ausgekochten, hart gesottenen Coltschwingern, die nur aus Unerbittlichkeit, Skrupellosigkeit und unmenschlicher Brutalität zusammengesetzt waren.
Wo war Larry Wood? Ihn konnte der Town Marshal nirgends entdecken. Doch ihn stufte er als den gefährlichsten Mann der Bande ein.
Die Atmosphäre war angespannt und gefährlich und kaum noch zu ertragen. Die Situation erforderte einen raschen Entschluss. Und Ken Clayton handelte. Er warf sich zu Boden und rollte herum. Gewehre peitschten. Die Detonationen erhoben sich, stießen durch die Stadt und zerflatterten über den Dächern.
Clayton sah den Burschen vor sich zu Boden gehen und wandte sich dem Kerl in der Passage zu. Er war wieder ein Stück weitergerollt. Seine Kugel riss den Burschen von den Beinen. Wieder wälzte sich der Town Marshal herum, um sich dem Gegner auf dem Dach des Saloons zuzuwenden. Doch da peitschte an anderer Stelle ein Gewehr und der Bursche verschwand hinter der Fassade.
Ken Clayton riss den Kopf herum und sah in einer Gassenmündung Joana stehen, die in diesem Moment das Gewehr senkte.
„In Deckung, Joana!“, brüllte Clayton entsetzt, und seine Stimme überschlug sich. „Wood ist noch …“
Wieder knallte ein Gewehr. Joana zuckte zusammen, ihr Mund öffnete sich wie zu einem stummen Schrei, sie taumelte zwei Schritte nach vorn und brach zusammen.
Ken Clayton schnellte auf die Beine und rannte Haken schlagend zu seiner Frau hin. Der Knall eines Schusses wurde über ihn hinweggeschleudert, die Kugel prallte von einer Mauer ab und quarrte als Querschläger über die Straße. Auch die nächste Kugel verfehlte ihn.
Clayton erreichte die Gassenmündung und ging hinter der Hausecke in Deckung. „Joana!“ In seiner Stimme lagen Entsetzen und Fassungslosigkeit.
Stille hatte sich, nachdem der Town Marshal in Deckung gegangen war, in den Ort gesenkt wie ein Leichentuch. Joana lag reglos mit dem Gesicht nach unten im Staub.
Ken Clayton ließ seinen Blick schweifen. Mitten auf der Straße lag einer der Coltschwinger und rührte sich nicht. Der zweite lag in der Passage, und auch von ihm ging kein Lebenszeichen aus.
Fiebernde Ungeduld erfüllte den Town Marshal. Die Ungewissheit, ob seine Frau lebte oder nicht, drohte ihn zu übermannen. Er setzte alles auf eine Karte und erhob sich. Staub rieselte von seiner Kleidung, er blutete am linken Oberarm. Eine Kugel hatte ihm eine Furche gezogen. Er ging zu Joana hin und kniete bei ihr ab. Nichts geschah. „Joana …“ Er drehte sie auf den Rücken. Ihre Lider zuckten, sie öffnete die Augen, ihre Lippen bewegten sich. „Ken, ich – ich konnte doch nicht zusehen …“
Joanas weitere Worte kamen nur als unverständliche, gurgelnde Laute über ihre Lippen. Aus ihrem rechten Mundwinkel sickerte ein Blutfaden. Sie röchelte, bäumte sich auf, fiel zurück und ihr Kopf rollte auf die Seite. Blicklos starrten ihre Augen den Town Marshal an.
Ken Clayton empfand das alles wie einen Alptraum. Er strich sich mit einer fahrigen Geste über die Augen, als wollte er die Bilder, die sich ihm darboten, wegwischen. Jeglichen Gedankens, jeglichen Willens beraubt drückte er sich hoch. Eine unsichtbare Hand schien ihn zu würgen, sein Herz raste, sein Atem ging stoßweise. Menschen kamen aus ihren Häusern. Ein Durcheinander von Stimmen erfüllte plötzlich die Straße. Es erreichte bei Ken Clayton nur den Rand seines Bewusstseins. Aber er spürte etwas – es kam tief aus seinem Innersten und er war dagegen machtlos. Es war Hass –grenzenloser, brennender Hass. Er kam in schnellen, giftigen Wogen, kalt und stürmisch wie ein alles vernichtender Blizzard.
Wie von Schnüren gezogen setzte sich der Town Marshal in Bewegung. Und als er auf die Schulter an Schulter stehende Menge zuging, die im Kreis um ihn und seine leblose Frau herumstand, riss er sich mit einem Ruck den Stern von der Jacke und schleuderte ihn zu Boden. Das Symbol des Gesetzes, das Ken Clayton würdig und mit Stolz getragen hatte, versank im Staub. Von ihm ging etwas aus, das die Menschen bewog, auseinander zu treten und eine Gasse zu bilden. Es war der kalte Hauch des Todes. Wer Ken Clayton in die Augen schaute, konnte erkennen, dass in diesen Minuten etwas in ihm abgestorben war. Und so manchem lief ein eisiger Schauer den Rücken hinunter.
*
Ken Clayton wurde vom Hass regelrecht aufgefressen. Es war ein Hass, der keine Zugeständnisse, kein Entgegenkommen und keine Gnade kennen würde, und er konzentrierte sich auf Larry Wood. Dem Banditen war die Flucht aus der Stadt gelungen. Jetzt ritt Ken Clayton nach Westen. Er folgte der Spur des Mörders seiner Frau, die sich deutlich im kniehohen Gras abzeichnete.
Ken Clayton sah Larry Wood, als dieser aus einer Hügellücke galoppierte. Nahezu gleichzeitig nahm der Bandit seinen Verfolger wahr. Sofort drehte er ab und jagte wieder zwischen die Hügel. Ken Clayton hinterher. Wood nötigte sein Pferd einen Hang hinauf, aus dem sich Felsklötze erhoben und auf dem niedriges, aber dichtes Strauchwerk wuchs. Auf dem Kamm des Hügels boten ebenfalls Felsbrocken und ein turmartiger Felsen Schutz.
Ken Clayton hielt an. Sein Auge folgte über die Zieleinrichtung der Winchester dem Banditen. Wood musste immer wieder Hindernissen ausweichen. Mal ließ er das Pferd schräg den Hügel hinauf gehen, dann peitschte er es wieder in gerader Linie empor. Immer wieder glitten die Hufe des Tieres aus. Losgetretenes Geröll rollte den Abhang hinunter. Das Pferd bockte des Öfteren hinten hoch, wenn es auf den Hanken einzubrechen drohte.
Ken Clayton zog durch. Die Winchester schleuderte ihr Krachen hinter Wood her. Wood verschwand vom Pferd und robbte hinter einen Felsblock. Zwei Atemzüge später legte er die Winchester auf und zielte sorgfältig.
Ken Clayton aber war schon vom Pferd gesprungen und verschwunden, als hätte ihn die Erde verschluckt. Wood schob den Kopf etwas über den Felsen und tauchte sofort wieder ab. Denn unten, hinter einem der Findlinge, krachte Ken Claytons Winchester. Die Kugel schrammte über den Fels und zog eine helle Spur. Das Geschoss wurde mit durchdringendem Heulen abgelenkt.
„Du erwischt mich nie, Clayton!“, brüllte Wood und seine Stimme war vom Hass geradezu verzerrt. Er jagte einen Schuss in die Tiefe. „Du fährst von hier aus direkt in die Hölle. Mein Wort drauf.“
Ken Clayton gab keine Antwort. Ein mitleidloser Zug hatte sich Bahn in seine Miene gebrochen, seine Augen blickten hart wie Stahl, und sein Verstand arbeitete präzise. Ihn erfüllte das grimmige und ungeduldige Verlangen, Larry Wood unerbittlich zur Rechenschaft zu ziehen.
Er kroch im Schutz der Büsche seitwärts davon und arbeitete sich hangaufwärts. Dann galt es, ein Stück Terrain ohne den geringsten Schutz zu überwinden. Clayton zögerte. Fünfzehn Yards etwa, auf denen er dem Gewehr Woods vollkommen schutzlos ausgeliefert war. Zehn Sprünge - und jeder konnte der letzte sein. Schließlich setzte Ken Clayton alles auf eine Karte, schnellte hoch und hetzte los.
Schon peitschten die Gewehrschüsse den Abhang herunter. Blei schlug um Ken Clayton herum ein. Eine Kugel strich sengend über seinen Oberschenkel. Eine andere zupfte an seiner Jacke. Seine Lungen pumpten. Keuchend warf er sich schließlich hinter den Felsen zu Boden und riss das Gewehr hoch.
Er feuerte dreimal. Die Detonationen rollten den Hang hinauf und stießen über den Banditen hinweg. Das Feuer wurde sofort mit wilder Verbissenheit erwidert. Die Schüsse peitschten und verdichteten sich zu einem einzigen, lauten Donner. Das Trommelfell betäubende Quarren der Querschläger zog durch die Täler, brüllend hallten die Echos von den Hängen wider.
Dann trat Stille ein.
Ken Clayton lugte über seine Deckung hinweg.
Die nächste Deckung war zehn Schritte entfernt. Er peilte sie an. Es war ein dichtes Gebüsch, zwischen dem einige Felsbrocken lagen. Eine lebensgefährliche Deckung. Aber er musste das Risiko eingehen, denn er durfte sich nicht hier hinter dem Felsen festnageln lassen.
Also setzte er zum Spurt an. Geduckt lief er im Zickzack auf die Büsche zu, die ihm als einzige Schutz boten. Mit einem Hechtsprung warf er sich dahinter.
Die Kugeln peitschten durchs Strauchwerk, konnten ihm aber nichts anhaben, denn er lag hinter dem Wurzelstock, in den sich die eine oder andere Kugel bohrte und den Strauch erschütterte. Zweige und Blätter regneten auf Ken Clayton herunter.
Clayton hielt nach der nächsten Deckungsmöglichkeit Ausschau. Er hatte sich schon fast zwei Drittel des Abhangs empor gearbeitet.
Wood sah seinen Gegner zu einem Felsen hetzen und feuerte. Ken Clayton verschwand. Es gelang ihm, sich ein weiteres Stück hangaufwärts zu kämpfen. Der Schweiß rann Ken Clayton in die Augen und ließ sie brennen, sein Hals war wie ausgedörrt. Schließlich kauerte er schwer atmend hinter einem Felsbrocken. Sein Herz raste und in seinen Ohren dröhnte das Blut. Er wartete, bis sich der Herzschlag wieder etwas normalisiert hatte, dann holte er eine Schachtel Patronen aus der Jackentasche und fing an, das Gewehr nachzuladen.
Patrone um Patrone drückte Ken Clayton in den Ladeschlitz der Winchester. Dann war der Patronenschacht voll. Er repetierte, spähte über den Felsen, äugte nach der nächsten Deckung und schnellte in die Höhe. Mit langen Sätzen hetzte er geduckt auf den Felsbrocken zu, hinter dem er Schutz finden wollte.
Bei Wood begann das Gewehr zu dröhnen.
Am Felsen vorbei starrte Ken Clayton nach oben. Dann kroch er seitwärts davon, und das Gestrüpp verbarg ihn vor Woods Blicken.
Ken Clayton hatte den Hügel ein ganzes Stück umrundet. Er befand sich jetzt seitlich von Wood und machte sich an das letzte Stück des Aufstiegs. Unablässig sicherte er nach oben. Auch hier gab es Gestrüpp und Felsbrocken, die sporadisch aus der Erde ragten und Schutz boten. Er glitt von Deckung zu Deckung, schnell und lautlos wie ein Schatten, wartete, witterte und gehorchte seinen Instinkten. Und sie ließen ihn nicht im Stich. Als er hinter einem der Felsen hervortrat, mit den Augen die nächste Deckungsmöglichkeit anpeilend, nahm er oben bei einem der Felsen die flüchtige Bewegung wahr. Wood hatte wahrscheinlich Ken Claytons Absicht durchschaut und die Stellung gewechselt. Ken Clayton drückte sich ab, und Wood fand nicht mehr die Zeit, sich auf das jäh veränderte Ziel einzustellen. Seine Kugel klatschte gegen Felsgestein, meißelte einen wahren Hagel von Splittern los und jaulte mit durchdringendem Heulen als Querschläger davon.
Ken Clayton stand jetzt vollkommen deckungslos auf dem Abhang, breitbeinig und leicht in der Mitte nach vorne geknickt, als suchte er festen Stand. Er schoss aus der Hüfte. Seine Winchester spuckte Feuer, Rauch und Blei. Oben taumelte mit einem erschreckten Aufschrei Larry Wood hinter seiner Deckung in die Höhe.
Der Bandit hatte Ken Claytons Kugel in den linken Oberarm bekommen. Der pulsierende Schmerz, der ihn hochgetrieben hatte, verzerrte sein staubverklebtes Gesicht, in das der perlende Schweiß helle Spuren zeichnete.
Die beiden Feinde standen sich ungeschützt gegenüber. In Woods Miene wüteten Schmerz, Schock und tödlicher Hass. Jeder blickte in die Mündung des anderen.
Das Aufblitzen in Larry Woods Augen war wie ein Signal. Ken Clayton ließ sich einfach fallen. Als er am Boden lag, hatte er durchgeladen. Woods Schuss peitschte, der Knall wurde über Ken Clayton hinweggeschleudert, und in das Krachen hinein brüllte sein Gewehr auf. Wood erhielt einen Schlag vor die Brust und wankte zwei Schritte zurück. Seine Lippen sprangen auseinander und ein abgerissener Ton brach aus seiner Kehle. Fast zeitlupenhaft langsam drückte er den Ladebügel durch. Dann donnerte noch einmal sein Gewehr.
Ken Clayton war zur Seite gerollt. Aber Woods Kugel fuhr schräg zum Himmel. Der Bandit wankte, seine Fäuste öffneten sich, die Winchester klatschte auf den Boden, und seine Hände verkrampften sich vor der Brust. Er taumelte zum Felsen und lehnte sich dagegen.
Ken Clayton stemmte sich hoch. Das Gewehr schussbereit an der Hüfte stieg er langsam den Hang hinauf. Ungläubig und mit herausquellenden Augen starrte ihm Wood entgegen. Seine Hände waren rot von seinem Blut. Seine Lippen formten tonlose Worte. Plötzlich brach ein Schwall Blut aus seinem Mund, er kippte nach vorn und schlug der Länge nach aufs Gesicht. Seine Beine zuckten noch einmal - dann lag Wood still.
Ken Clayton wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß aus den Augenhöhlen. Mit dem Fuß drehte er den leblosen Banditen auf den Rücken. In Woods gebrochenen Augen las Ken Clayton nur eine absolute Leere – die Leere des Todes.
Ken Clayton lehnte sein Gewehr an den Felsen und holte Woods Pferd, dann wuchtete er den Leichnam quer über den Pferderücken. In der Satteltasche fand er einige Schnüre, mit denen er Wood festband. Das Tier scheute, als ihm der süßliche Blutgeruch in die Nase stieg. Der Blutgeruch zog auch Schwärme von Mücken an.
Ken Clayton nahm sein Gewehr, legte es sich auf die Schulter und führte das Pferd am Kopfgeschirr den Hang hinunter. Unten saß er auf. Das Tier mit dem toten Banditen an der Longe machte er sich auf den Rückweg.
*
Als Ken Clayton nach Topeka zurückkehrte, hatten sich die Menschen wieder verlaufen. Nur einige kleine Gruppen standen beisammen und diskutierten die Ereignisse des Morgens. Jetzt richtete sich ihre Aufmerksamkeit auf Clayton, der jedoch keinen von ihnen beachtete. Auch der Stadt gab er Schuld am Tod Joanas. Niemand wagte ihn anzusprechen, als er mit versteinertem Gesicht mitten auf der Fahrbahn zum Haus des Bestatters ritt.
Er stellte die Pferde an den Hitchrack, band sie fest und betrat die Werkstatt. Auf zwei Böcken stand ein Sarg aus gehobelten Fichtenbrettern, in den der Undertaker mit seinem Gehilfen den Leichnam Joanas gelegt hatte. Lange starrte Ken Clayton in das wächsern anmutende Gesicht seiner Frau. Der Bestatter stand bei seinem Werktisch und beobachtete Clayton. Er wirkte betreten.
Es überstieg Ken Claytons Verstand. Er wollte mit Joana nach Great Bend gehen und dort ein Geschäft eröffnen. Den Revolvergurt wollte er für alle Zeiten an den Nagel hängen. Niemals mehr sollte Joana Angst um ihn haben müssen. Nun stand er vor den Trümmern dieser Illusion von Glück, Ruhe und Frieden. Er haderte mit dem Schicksal.
Nach einer ganzen Weile eiste er seinen Blick von dem erstarrten Gesicht los, das er so sehr geliebt hatte, und richtete ihn auf den Bestatter. „Draußen am Holm steht ein Pferd mit der Leiche Larry Woods. Kümmere dich darum.“ Er wies auf den Sarg. „Ich schätze, du willst ihn ins Leichenschauhaus bringen und meine Frau aufbahren.“
„Richtig, Ken. Ich werde sie …“
„Nichts wirst du, Carradine. Lediglich den Sarg wirst du schließen. Ich hole ihn später ab. Was bekommst du für den Sarg?“
Der Bestatter nannte den Preis, dann fragte er: „Was hast du vor, Ken. Willst du Joana nicht hier in Topeka beerdigen?“
„Nein.“ Clayton schwang herum und stapfte aus der Werkstatt. Am Zaumzeug führte er sein Pferd in den Stall bei seinem Haus, holte sämtliches Geld, das sich im Haus befand, und begab sich zum Mietstall. Dort erwarb er ein leichtes Fuhrwerk und ein Pferd. Die Fragen des Stallmannes beantwortete er nicht. Mit dem Wagen fuhr er zur Werkstatt des Bestatters und bat diesen, ihm zu helfen, den in der Zwischenzeit geschlossenen Sarg mit dem Leichnam seiner Frau auf die Ladefläche zu heben. Er fuhr das Fuhrwerk ebenfalls zu seinem Haus, ließ es dort stehen und begab sich zur Bank, um sein und Joanas Konto aufzulösen. Nachdem ihm sämtliches Geld ausbezahlt worden war und er es in seiner Satteltasche verstaut hatte, verließ er die Bank.
Einige Menschen, die sich im Freien befanden, beobachteten ihn. Er schlug die Richtung zu seinem Haus ein. Drei Männer kamen ihm entgegen. Claytons Blick wurde eisig, sein Gesicht wirkte wie aus Granit gemeißelt. Es waren Ward Miller, der Town Mayor und zwei weitere Mitglieder des Bürgerrats. Als sie aufeinander trafen, hielten sie an und Miller sagte: „Das mit deiner Frau tut uns leid, Ken. Wir alle mochten Joana und …“
„Spar dir deine Worte, Miller!“, schnitt Ken Clayton dem Bürgermeister schroff das Wort ab. „Die Kugel, die Joana tötete, kam zwar aus Larry Woods Gewehr, aber diese Stadt trägt eine große Mitschuld an ihrem Tod.“
„Das ist doch Unsinn, Ken!“, presste Miller hervor. „Es war dein Kampf. Warum hat Joana eingegriffen? Verdammt, Ken, sie hat das Schicksal herausgefordert und …“
Ken Clayton machte einen schnellen Schritt nach vorn und schlug zu. Er hatte ganz einfach die Beherrschung verloren. Seine Nerven lagen blank. Er traf den Bürgermeister mitten im Gesicht und aus dessen Nase schoss sofort das Blut. Mit einem Aufschrei taumelte er zurück. Clayton setzte ihm nach, packte ihn mit beiden Händen an der Jacke, zog ihn mit einem Ruck ganz dicht an sich heran und knirschte: „Sie hat eingegriffen, weil die Stadt jämmerlich versagt hat, Miller. Ihr seid nichts als feige Ratten, und du, Miller, bist die Oberratte. Joana würde noch leben, wenn ihr nicht so kläglich versagt hättet.“
Blut rann über Millers Mund und sein Kinn und tropfte auf seine Brust. Seine Augen schwammen in einem See von Tränen, die ihm der Schmerz hinein trieb. Mit zuckenden Lippen entrang es sich ihm: „Bist du verrückt geworden, Clayton? Du – du hast mich geschlagen? Großer Gott, das wirst du bereuen.“
Ken Clayton war voll auf den Town Mayor konzentriert, und so entging es ihm, dass sich von allen Seiten die Männer näherten, die beobachtet hatten, wie er Miller ins Gesicht schlug. Der Ausdruck in ihren Gesichtern verhieß wenig Gutes.
„Willst du mir drohen, Miller?“, grollte Clayton und versetzte dem Town Mayor einen derben Stoß, der diesen zurücktaumeln und Halt suchend mit den Armen rudern ließ. „Zur Hölle mit dir! Du …“
Ken Clayton brach ab, als er von hinten gepackt und zurückgerissen wurde. Die Arme wurden ihm brutal auf den Rücken gedreht, und plötzlich war er von fast einem Dutzend Männern umringt. Die Kerle, die seine Arme festhielten, drohten sie ihm aus den Schultergelenken zu kugeln. Er machte das Kreuz hohl, um dem Schmerz etwas entgegenzuwirken.
„Du bist einen Schritt zu weit gegangen“, fauchte ein Mann mittleren Alters. „Außerdem schlucken wir es nicht, dass du uns die Schuld am Tod deiner Frau zurechnest. Es war dein Kampf, Clayton, du bist hier als Revolvermarshal aufgetreten, und es war vermessen, von uns zu fordern, eine Waffe in die Hand zu nehmen und dich vor den vier Halunken zu schützen.“
Der Mann schlug zu und hämmerte Clayton die Faust in den Leib. Clayton krümmte sich, ein dumpfer Laut kämpfte sich in seiner Brust hoch und erstickte in seiner Kehle.
Übelkeit schwappte in Ken Clayton hoch, der Magen krampfte sich ihm zusammen, und er spürte, wie die Verzweiflung in ihn hineinkroch.
Links und rechts wurde er festgehalten. Unerbittliche Griffe pressten ihm die Arme auf den Rücken. Er war nicht fähig, sich zu rühren. Und plötzlich tauchte der Town Mayor neben dem Schläger auf, schob diesen zur Seite und stieß mit hassverzerrter Stimme hervor: „Er gehört mir – ganz allein mir.
Millers Faust zuckte hoch. Clayton wollte instinktiv ausweichen, aber der Griff der Männer, die ihn festhielten, lockerte sich nicht. Der unbarmherzige Schlag traf ihn. Sein Kopf ruckte in den Nacken. Der Schmerz stach wie Nadeln in seinem Schädel.
Millers Hiebe kamen schnell und sicher. Ken Clayton hatte das Empfinden, das Kinn würde ihm zertrümmert. Nur noch verschwommen nahm er seine Umgebung wahr. Er wankte zwischen den Kerlen, die ihn gepackt hielten. Die Schwäche kroch wie flüssiges Blei durch seinen geschundenen Körper.
Für einen Augenblick flackerte das Feuer des Widerstandes in ihm auf, er zerrte und riss und warf sich hin und her. Aber es gelang ihm nicht, sich den stahlharten Fäusten zu entwinden. Ein wuchtiger Schlag traf ihn.
Er spürte nicht mehr, wie sie ihn losließen und er schwer auf der Straße landete. Eine gnädige Ohnmacht umfing ihn.