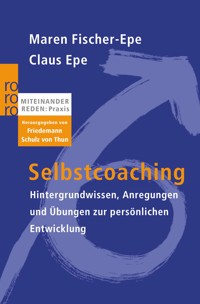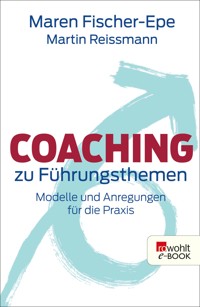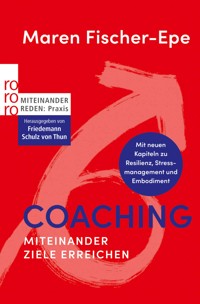
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Praxisnah und kompakt: die wichtigsten Haltungen, Modelle und Werkzeuge der Kommunikationspsychologie und des Coachings Maren Fischer-Epe hat ihr Standardwerk überarbeitet und zu einem aktuellen, unverzichtbaren Leitfaden für alle gemacht, die sich mit Coaching beschäftigen − sei es als Anfänger:innen oder als erfahrene Praktiker:innen. Innerhalb des Coaching-Prozesses entsteht eine dynamische Interaktion, die weit über ein bloßes Gespräch hinausgeht. Coaches setzen gezielt erprobte Methoden ein, um das Potenzial ihrer Klient:innen zu entfalten und nachhaltige Veränderungen zu fördern. Doch welche Strategien erweisen sich dabei als besonders nützlich? Welche Haltung muss der Coach entwickeln? Wie können Kontextverständnis, Rollenklarheit, Selbstreflexion und Selbstverantwortung gefördert werden? Das zeigt Maren Fischer-Epe in ihrem Buch. «Maren Fischer-Epe vermittelt die Grundlagen des Coachings auf eine außerordentlich fundierte, klare und zugängliche Weise und gibt ihr reichhaltiges Wissen und ihre jahrelange Erfahrung praxisorientiert weiter. Sehr verdient ist dieses Buch zu einem Standardwerk geworden. Die Lektüre ist ein echter Gewinn – vor allem auch in der Ausbildung für Coaches.» Friedemann Schulz von Thun
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maren Fischer-Epe
Coaching: Miteinander Ziele erreichen
Über dieses Buch
Praxisnah und kompakt
Wie gutes Coaching gelingt, zeigt Maren Fischer-Epe in diesem Buch. Welche Strategien erweisen sich als besonders nützlich? Welche Haltung muss der Coach entwickeln? Wie können Kontextverständnis, Rollenklarheit, Selbstreflexion und Selbstverantwortung gefördert werden? Die Autorin bietet durchdachte Antworten und gibt wertvolle Impulse für die eigene Coaching-Praxis.
«Maren Fischer-Epe vermittelt die Grundlagen des Coachings auf eine außerordentlich fundierte, klare und zugängliche Weise und gibt ihr reichhaltiges Wissen und ihre jahrelange Erfahrung praxisorientiert weiter. Sehr verdient ist dieses Buch zu einem Standardwerk geworden. Die Lektüre ist ein echter Gewinn – vor allem auch in der Ausbildung für Coaches.» Friedemann Schulz von Thun
Vita
Maren Fischer-Epe, Jahrgang 1953, ist Diplompsychologin. Sie studierte Germanistik, Pädagogik, Sport und Psychologie und war zehn Jahre systemische Familientherapeutin und Lehrtrainerin in der Ausbildung von Beratern, Therapeuten und Supervisoren. Danach arbeitete sie in der Personal- und Organisationsentwicklung sowie in der Ausbildung von Führungskräften, Personalentwickler:innen und Berater:innen zum Coach.
In Zusammenarbeit mit Friedemann Schulz von Thun entwickelte sie bereits in den 1990er Jahren Coaching-Konzepte für die Unternehmenswelt. Daraus entstand zunächst das Buch «Coaching: Miteinander Ziele erreichen», später ergänzt um «Selbstcoaching: Hintergrundwissen, Anregungen und Übungen zur persönlichen Entwicklung» (zusammen mit Claus Epe) sowie «Coaching zu Führungsthemen: Modelle und Anregungen für die Praxis» (zusammen mit Martin Reissmann).
Mehr zur Autorin erfahren Sie unter www.fischer-epe.de.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2025
Copyright © 2002, 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung zero-media.net, München
ISBN 978-3-644-02408-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Einführung von Friedemann Schulz von Thun
Eine Erkenntnis hat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend durchgesetzt: In einer komplexer und volatiler werdenden Herausforderungswelt, wo das Fachliche und das Menschliche, das Strategische und Zwischenmenschliche in komplizierter Wechselwirkung stehen und zuweilen tüchtig durcheinandergeraten können, wo manche Probleme sich als Dilemmata erweisen, mit ständiger Gefahr des Zwiespalts und der Polarisierung – in einer solchen Herausforderungswelt ist es nicht gut, nur den eigenen spontanen Impulsen und Reflexen, den angestammten Verhaltensmustern und Gefühlen ausgeliefert zu sein. Es braucht in schwierigen Momenten den Raum für kundige Reflexion, Selbst- und Systemreflexion. Und weil sich diese Erkenntnis durchgesetzt hat, ist Coaching mehr und mehr zu einer Selbstverständlichkeit gelingender Professionalität geworden. Dabei hat sich auch die Kunst der Reflexion enorm weiterentwickelt – diesen Entwicklungen wird die Neuauflage gerecht.
Professionelles Coaching erfordert eine flexible Rollenvielfalt: Je nach den Umständen sind Coaches einfühlsame Klärungshelfer, anschauliche Lehrerinnen, besonnene Beraterinnen, anteilnehmende und ehrliche Mitmenschen, effektive Trainer, kurzum Mut machende Entwicklungshelfer zur Selbsthilfe und immer verschwiegene Vertraute.
Dazu kommt ein Arbeitsverständnis, das tiefschürfende Problemanalysen zwar nicht ausklammert, aber doch den Schwerpunkt mehr auf Ziele und Lösungen legt; das die Schwächen und Entwicklungsrückstände des Klienten zwar nicht tabuisiert, aber doch vor allem seine Stärken und Fähigkeiten betont und herausarbeitet; das die Belastungen und Nöte des Klienten nicht verleugnet und schönredet, aber in erster Linie nach neuen Perspektiven sucht.
Wenn es gut läuft, geht der Klient nicht nur gut beraten aus den Sitzungen hervor, sondern auch gestärkt und ermutigt, mit neu erworbenen Kompetenzen der Situationsdiagnose, der Selbstklärung und Selbstberatung, der Kontakt- und Problemlösefähigkeit. Der Coachee soll nicht nur lernen, wie ein Hochleistungssportler schneller, höher und weiter zu springen. Er soll die Ziele, die er sich setzt, auf Verträglichkeit überprüfen, das heißt, in der Lebensbalance bleiben oder sie zurückgewinnen. Hier braucht der Coach jene Weisheit, die nicht jedes Ziel einfach zu erreichen hilft, sondern das Ziel selbst, von einer höheren Warte aus, in Frage zu stellen wagt.
Um ein solches Coaching leisten zu können, reicht es nicht, das Herz am richtigen Fleck zu haben – obwohl auch dies eine wichtige und weithin unterschätzte Schlüsselqualifikation darstellt. Folglich öffnet Maren Fischer-Epe ihren reichhaltigen professionellen «Werkzeugkoffer». Dabei verbindet sich ihr kommunikationspsychologischer Hintergrund mit einer fundierten Kenntnis der Rollenanforderungen und Spielregeln im Management und ihrer langjährigen Erfahrung mit Veränderungsprozessen in der Unternehmenswelt.
1992 habe ich gemeinsam mit Maren Fischer-Epe den Seminarbaustein «Methoden der Einzelberatung und des Coachings» im Rahmen unserer Fortbildungsreihe für Berater und Trainer konzipiert und geleitet. Ich suchte und fand damals eine Spezialistin, die zweifach beheimatet war: in der Seele des Menschen ebenso wie im Feld der Hierarchien und Rollen, Strukturen und Organisationen. Diese zweifache Beheimatung ist das Besondere an dem hier vorgestellten Coaching-Verständnis. Es wird der Tatsache gerecht, dass der Klient, die Klientin zugleich Profi und Mensch ist. Der Profi will und muss sich auf dem Feld der Leistung bewähren, er sucht nach tauglichen Instrumenten und Vorgehensweisen, um seine Wirksamkeit und Perfektion zu steigern. Der Mensch sucht nach Sinn und Lebensbalance, nach Selbstverwirklichung in seiner einmaligen Existenz. Beide «Auftraggeber» sitzen dem Coach gegenüber, und dieser darf keinen von beiden aus dem Auge verlieren. Nicht selten steht er vor der Aufgabe, sie wieder miteinander auszusöhnen.
Ich freue mich sehr, dass mit diesem Buch die Erkenntnisse vieler Jahre praktischer Coaching-Erfahrung für den Anwender anschaulich und präzise verdichtet vorliegen.
Besonders gefällt mir, dass Maren Fischer-Epe ihre «Werkzeuge» mit ansprechender Prägnanz vorstellt und gleichzeitig den «verantwortlichen Einsatz» dieser Werkzeuge in Abhängigkeit von mancherlei Umständen demonstriert und reflektiert. Wohltuend und weise ist in diesem Zusammenhang auch der wiederkehrende Absatz über «Chancen und Gefahren».
In den neu aufgenommenen Kapiteln wird deutlich, wie sich das methodische Vorgehen der Autorin im Laufe der letzten Jahre erweitert hat: Sie rückt die Verbindung von Reflexion, Körpererleben und emotionaler Bedeutung noch stärker ins Zentrum und zeigt, wie im Coaching Stress bewältigt und auf kreative Weise persönliches Wachstum und Resilienz gefördert werden können.
Vorbemerkung
Liebe Leserin, lieber Leser,
als dieses Buch 2002 zum ersten Mal publiziert wurde, war das Thema Coaching in der Unternehmenswelt noch ein Randphänomen. Heute gehört es als externe oder interne Beratungsleistung zum Standardrepertoire so gut wie jeder Personalentwicklung.
Parallel zu dieser Entwicklung ist der Coaching-Markt unübersichtlich gewachsen, und der Begriff «Coaching» wird inzwischen für höchst unterschiedliche Beratungsanlässe und Entwicklungsvorhaben reklamiert – zuweilen auch für unseriöse Angebote von Motivationsgurus und Heilsversprechern, die wenig mit dem zu tun haben, was ich unter Coaching verstehe.
Um beurteilen zu können, was sich jeweils hinter dem Begriff «Coaching» verbirgt, sollten wir fragen: Mit welchem Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund, mit welchem Menschenbild und mit welcher Intention wird jeweils gearbeitet?
In meinem Berufsfeld, dem der Personal- und Organisationsentwicklung, soll Coaching den Raum öffnen für ein vertieftes Verständnis von Konflikten, für neue Perspektiven und Wachstumspotenziale, für sinnvolle Ziele, stimmige Lösungsideen und -strategien.
Ein gutes Coaching-Gespräch fördert Kontextverständnis, Rollenklarheit, Selbstwirksamkeit und Selbstverantwor-tung.
Coaching bietet damit – trotz manchem begrifflichen Missbrauch – einen höchst wirkungsvollen Rahmen für Lernen und persönliches Wachstum. Daran hat sich bis heute nichts geändert.
Die dafür erforderliche Dialog- und Feedbackkompetenz ist nicht an ein bestimmtes Berufsbild gebunden, und sie wird zunehmend auch zum kritischen Erfolgsfaktor in allen (Führungs-)Rollen und Arbeitsfeldern, in denen Selbstverantwortung und eigenständige Lösungskompetenz gefordert sind und das Potential von Einzelnen und Gruppen aktiviert werden soll.
In dieser Neuausgabe ist einiges ergänzt, was inzwischen in meiner Coachingpraxis eine größere Bedeutung gewonnen hat – und auch manches gekürzt, was ich aus heutiger Sicht verzichtbar finde.
lnsgesamt habe ich die Verbindung von Reflexion, emotionaler Beteiligung und Körpererleben noch stärker ins Zentrum gerückt – ebenso wie die Betonung von Stärken und Ressourcen, positiven Emotionen und Sinnerleben im Coaching.
Neu aufgenommen bzw. komplett überarbeitet sind die Kapitel 2.6.2 «Den Körper als Ressource nutzen: Embodiment», 2.6.3 «Resilienz und persönliche Entwicklung fördern», 2.7.5 «Stress regulieren», 2.7.6 «Lösungsblockaden überwinden», 3.3 «Die Grenze zwischen Coaching und Therapie wahren», 3.4. «Herausforderungen beim Online-Coaching», 5. «Coaching-Kompetenz in der Führungsrolle» sowie 6.3 «Essentials».
Wenn Sie Fragen haben oder mir ein Feedback geben möchten, schreiben Sie gern an [email protected].
1 Coaching: Begriff und Verständnis
1.1 Coaching-Begriff
Coaching ist ein schillernder Begriff, der in unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt wird. Ursprünglich bedeutet Coach «Kutsche», das Wort ist in der englischen Sprache seit 1556 nachgewiesen und kommt aus dem Ungarischen. Das Bild der Kutsche vermittelt einen wesentlichen Kern von Coaching: Die Kutsche ist ein Hilfsmittel, ein Beförderungsmittel, um sich auf den Weg zu machen und ein Ziel zu erreichen.
Im Jahr 1848 taucht das Wort dann erstmalig in der Bedeutung eines privaten Tutors für Studierende auf und wurde zunächst nur umgangssprachlich im universitärem Kontext gebraucht. Im sportlichen Bereich wird seit 1885 in England und den USA von Coaching gesprochen; inzwischen wird der Begriff im Englischen im allgemeinen Sinn des Unterweisens, Anleitens und Beratens verwendet.
Zunächst ist die Bedeutung des Coaching über den Leistungssport einer breiteren Öffentlichkeit vermittelt worden. Im Sport steht Coaching für eine umfassende Betreuung von Spitzensportlern, die weit über ein reines Training der körperlichen Leistungsfähigkeit hinausgeht. Der Coach arbeitet mit psychologisch fundierten Trainingsmethoden:
Vielleicht haben Sie schon einmal im Fernsehen Bobfahrer:innen vor einer Fahrt durch den Eiskanal beobachtet. Sie stehen in einer Reihe, haben die Augen geschlossen und schaukeln nach links, rechts, vor und zurück, als wären sie bereits im Rennen. Gedanklich sind sie das auch. Sie stellen sich mental und körperlich genau und konzentriert auf die Bewegungsabläufe in der Bahn ein und imaginieren den Bewegungsablauf, der sich im Training als optimal herausgestellt hat. Sie versuchen also, sich auf Erfolg zu programmieren. Das ist ein Beispiel für ein mentales Training, wie es ein Coach im Sport anleiten könnte. Neben solchen psychologisch-fundierten Trainingsmethoden bietet Coaching im Sport aber noch mehr: Es hilft, Ängste zu überwinden, Blockaden abzubauen, persönliche Erfolgsstrategien zu entwickeln, Erfolge zu genießen und Misserfolge zu verkraften.
In amerikanischen Unternehmen bezeichnet Coaching seit den 1970er Jahren gleichzeitig auch einen personen- und entwicklungsorientierten Führungsstil, mit dem Mitarbeitende zur Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit und zur persönlichen Weiterentwicklung angeregt werden sollen.
Dieser Gedanke wurde in Deutschland seit Mitte der 1980er Jahre unter dem Begriff «Führungskraft als Coach» weiterentwickelt. Die Forderung, dass Führungskräfte ihre Mitarbeitenden nicht nur fachlich anleiten, sondern auch entwicklungsunterstützend «coachen» sollen, hatte sich zunächst besonders im Vertrieb etabliert und von dort dann zunehmend auf alle Führungsbereiche ausgeweitet.
Heute gehören Coaching-Kompetenzen zum Standardrepertoire für Führungskräfte und Projektverantwortliche. Wenn Sie mit dieser Frage befasst sind, finden Sie Anregungen dazu im Kapitel 5.
Parallel zur Idee der Führungskraft als Coach hat sich in Deutschland «Coaching» seit Mitte der 1980er Jahre auch als Bezeichnung für eine professionelle, zunächst überwiegend externe Beratung für Führungskräfte durchgesetzt.
Während es in der Pionierphase vor allem um die Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen einzelner Führungskräfte ging, hat sich die Anwendungslandschaft inzwischen deutlich erweitert: Im Rahmen von Umstrukturierungen, strategischer Neuausrichtung und Fusionen hat sich Coaching in vielen Unternehmen als Konzept für die systematische Entwicklung von Schlüsselpersonen und ganzen Führungsteams etabliert. Überall dort, wo sich Führungskräfte und Projektverantwortliche mit veränderten Rahmenbedingungen und Rollenanforderungen konfrontiert sehen, ist Coaching heute ein selbstverständlicher Bestandteil der Personalentwicklung.
Der Begriff Coaching steht für Entwicklung und Leistungssteigerung. Das ist vermutlich der Grund dafür, dass er für nahezu jegliche Form von Training und Beratung verwendet und vermarktet wird: Wenn das Verhalten vor der Fernsehkamera trainiert wird, wird es zum «TV-Coaching». Wenn man sich auf Konfliktgespräche vorbereitet, geht es um «Konflikt-Coaching». Teamentwicklung wird zum «Team-Coaching». Wenn eine Unternehmensberater:in mit einem Hierarchen spricht, wurde er «gecoacht» usw. Eine Freundin wurde von dem behandelnden Physiotherapeuten damit überrascht, dass er sie gerne «ganzheitlich coachen» wollte. Paartherapie wird zum «Paar-Coaching», Erziehungsberatung zum «Erziehungs-Coaching». Überall findet man Angebote für «Life-Balance-Coaching», «Power-Coaching» oder «Body-Coaching». Die kreative Verwendung des Begriffs schafft für den Nutzer einige Verwirrung. Umso notwendiger scheint es, zu hinterfragen, was jeweils mit Coaching gemeint sein soll.
1.2 Mein Coaching-Verständnis
Unter Coaching verstehe ich eine Kombination aus ressourcen- und lösungsorientierter Beratung, persönlichem Feedback und praxisorientiertem Training. Im Coaching werden Fragestellungen behandelt, die die berufliche Aufgabe und Rolle sowie die Persönlichkeit der Coachee betreffen. Dabei können die Themenfelder ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel:
die Entwicklung geeigneter Führungs- und Problemlösungsstrategien,
die Rollenklärung und Positionsbestimmung in Konflikten und schwierigen Entscheidungssituationen,
die persönliche Arbeitsorganisation und das Selbstmanagement,
die persönliche Motivation und Entwicklung der beruflichen Karriere,
das Umgehen mit Macht und Einfluss
Auftritt und Wirkung in der Kommunikation und Kooperation,
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, Resilienz und Work-Life-Balance.
Coaching als Beratung im Spannungsfeld von Rolle und Person
Bei der Bearbeitung dieser Themen geht es immer gleichzeitig um zwei Perspektiven: Person und Rolle. Wir suchen im Coaching nach Lösungen, die den Rollenanforderungen gerecht werden und gleichzeitig zur Person passen.
Klärungshilfe, Supervision und Coaching sind Formen von Prozessberatung, die helfen, Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen, ohne als Expert:in Lösungen vorzugeben. In diesem Sinn ist Coaching eine professionelle Reflexions- und Entwicklungshilfe mit dem Ziel, Handlungsalternativen und eigenständige Lösungen zu entwickeln. Dabei bleibt die Selbstverantwortung der Coachee zu jedem Zeitpunkt gewahrt. Ein Coach leistet Hilfe zur Selbsthilfe in einem partnerschaftlichen Dialog.
Als Coach helfe ich bei der Suche nach stimmigen Zielen und angemessenen Lösungswegen, fördere Zuversicht und persönliche Entwicklung. Der Coaching-Prozess ist zielorientiert und zeitlich befristet.
Hier schließt sich der Kreis zur oben beschriebenen sprachlichen Wurzel des Coaching-Begriffs als sinnvolle Metapher: Eine Kutsche ist ein Hilfsmittel, ein Beförderungsmittel, um auf den Weg zu kommen und ein Ziel schneller und bequemer zu erreichen als zu Fuß. Die Fahrgäste nutzen dieses Hilfsmittel, entscheiden aber selbst über die Richtung bzw. das Reiseziel. Der Kutscher kennt die Wege, kann Entfernungen und Reisezeiten einschätzen, sorgt für die Qualität des Vorankommens und für angemessene Pausen.
1.3 Anlässe für Coaching-Anfragen
Es sind oft äußere Anlässe, die zu einem Coaching führen. In den meisten Fällen steht eine Entscheidung an, oder es wird ein neues Rollenverhalten verlangt. Die Coachee hat in der Regel schon verschiedene andere Versuche unternommen, um ihre Probleme zu lösen oder ihre Fragen zu beantworten. Erst wenn diese Antworten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wie Büchern, KI, Gesprächen mit Freunden, Ehepartnern und Kolleg:innen oder durch Seminarbesuche nicht gefunden werden und wenn der Handlungsdruck steigt, wächst auch die Bereitschaft, sich ein Coaching zu suchen. Anlässe für Coaching-Anfragen lassen sich grob in drei Felder einteilen:
1. Veränderungen der Rahmenbedingungen und Rollenanforderungen
Hierzu gehören zum Beispiel:
Umstrukturierung, neue Rechtsform, Fusion, Verkauf des Unternehmens, Umorientierung zum Profit-Center, Generationswechsel,
neue Produktionsverfahren, neue Produkte, neue Technologien, veränderte Innenpolitik des Unternehmens,
Beförderung, neue Führungsaufgabe, Versetzung, Kündigung, Stellenwechsel.
Ein Beispiel für diesen Zugang zum Coaching: Herr A, 36, war bisher vor allem für anspruchsvolle IT-Projekte verantwortlich. Nun wird ihm im Rahmen der Fusion seiner Firma mit einem größeren Unternehmen die Position als Bereichsleiter in dem neu entstehenden übergeordneten IT-Bereich angeboten. Ein Karrieresprung über zwei Ebenen ist in der konservativ-hierarchisch orientierten Kultur beider Unternehmen bisher unüblich. Aufstiege erfolgen in diesen Unternehmen in geregelten Schritten und sind unumkehrbar. Wenn man in einer Führungsposition scheitert, gab es bisher keinen Weg zurück. Herr A ist sich nicht sicher, ob ein solcher Schritt nicht zu «anmaßend und zu gefährlich» ist. Im Coaching möchte er klären, wie er auf das Angebot reagieren will.
2. Kritische Situationen und Konflikte
Hierzu gehören zum Beispiel:
Kommunikations- und Kooperationsprobleme im Team oder mit einzelnen Mitarbeitenden bzw. Kund:innen,
akute oder festgefahrene Konflikte zwischen Führungskräften oder ganzen Unternehmensbereichen,
Kommunikations- und Kooperationsprobleme mit der eigenen Führungskraft oder mehreren Hierarchien.
Ein Beispiel für diesen Zugang zum Coaching: Der Leiter eines Produktionsbereichs in einem Elektronik-Konzern, Herr B, bekommt von seinem Chef den Hinweis, er würde sich gegenüber seinen Mitarbeitenden und Führungskolleg:innen zu wenig durchsetzen. Nachdem er zehn Jahre erfolgreich eine Fabrik im Ausland geleitet hat, ist er irritiert und verärgert über diese Rückmeldung. Sein Chef hat ihm empfohlen, in einem Coaching herauszufinden, wie er sein Verhalten verändern könne. Er spricht einen von ihm akzeptierten Personalentwickler des Unternehmens an und bittet um die Empfehlung eines Coaches.
3. Fragen der persönlichen Entwicklung
Hiermit sind alle Anliegen gemeint, in denen die Coachee von sich aus ein neues Verhalten lernen oder eine innere Einstellung verändern möchte. Auslöser können zwar auch hier veränderte Rahmenbedingungen oder Konflikte sein, der Fokus liegt aber von vornherein und bewusst stärker auf dem Wunsch nach persönlicher Entwicklung, zum Beispiel bei
komplexen Entscheidungsprozessen,
Fragen der persönlichen Positionierung und Karriere, beruflicher Umorientierung oder Vorbereitung auf den Ruhestand,
seelischen oder körperlichen Symptomen von Überforderung, Überarbeitung, Sinn- und Motivationsverlust.
Auch hierzu ein Beispiel: Frau C, die Leiterin der Personal- und Organisationsentwicklungsabteilung eines männerdominierten Beratungsunternehmens, erlebt, dass ihre Arbeit zwar materiell großzügig unterstützt wird, ihre Projekte aber in Leitungsmeetings immer wieder unterschwellig entwertet und vom Top-Management inhaltlich nicht wirklich unterstützt werden. Während sie diese Situation einige Jahre lang «wegstecken konnte, weil die Resonanz von Kolleg:innen und Mitarbeitenden immer sehr positiv war», reagiert sie nun zunehmend «allergisch» und mit Motivationsverlust. Sie möchte herausfinden, ob es geeignetere Strategien im Umgang mit ihrem Top-Management gibt und wie sie sich wieder motivieren kann. Im Coaching merkt sie bald, dass es um die viel grundsätzlichere Frage geht, ob das Arrangement noch ihren Wünschen und ihrem Selbstverständnis entspricht, und dass sie neue Kompetenzen und Einstellungen entwickeln muss, um ihre Leistungsmotivation dauerhaft wiederzugewinnen.
Die drei Beispiele zeigen, dass die Anliegen hinter den Coaching-Anfragen mehrere Aspekte gleichzeitig berühren können. Coaching kann oft nur eine Ergänzung zu weiteren Personal- oder Organisationsentwicklungsaktivitäten sein und sollte mit ihnen Hand in Hand gehen.
1.5 Der Ablauf eines Coaching-Prozesses
Der Coaching-Prozess lässt sich in drei Phasen gliedern: die Auftragsklärung im Vorfeld, die Coaching-Gespräche und im Anschluss daran die Auswertung des Prozesses.
Die Auftragsklärung im Vorfeld dient der ersten Überprüfung, ob die angestrebten Ziele im Rahmen eines Coaching angemessen erreicht werden können bzw. welche flankierenden Absprachen oder anderen Maßnahmen noch getroffen werden müssen. Dies gilt besonders, wenn das Coaching vom Unternehmen finanziert wird und mit expliziten oder impliziten Aufträgen empfohlen oder verordnet wurde.
Nach der Auftragsklärung beginnen die eigentlichen Coaching-Gespräche. Der Coaching-Prozess ist immer zeitlich befristet und wird nach einer vereinbarten Frist ausgewertet. Im Gespräch unterscheide ich vier Phasen:
Kontakt finden und Orientierung schaffen
Situation und Ziele herausarbeiten
Lösungen entwickeln
Transfer sichern
Je nach Stadium im Coaching-Prozess sind diese vier Phasen im Gesprächsablauf unterschiedlich gewichtet und betont.
Nachdem die Gespräche abgeschlossen sind, verabreden Coach und Coachee einen angemessenen Zeitraum, in dem die Erkenntnisse, Lösungsideen, Maßnahmen und Veränderungen im Arbeitsalltag umgesetzt und integriert werden können. Bei einer Auswertung des Coaching wird dann überprüft, inwieweit die angestrebten Ziele tatsächlich erreicht werden konnten, und der persönliche Lernprozess wird gewürdigt.
In Kapitel 4 finden Sie eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Phasen im Coaching.
1.6 Grundlagen und Grundannahmen
In diesem Buch werden in erster Linie das konkrete Vorgehen im Coaching und das dafür erforderliche Handwerkszeug beschrieben.
Vorgehensmodelle und Tools sind jedoch lediglich die sichtbare Oberfläche eines Coaching-Ansatzes. Darunter liegen Theorien und Grundannahmen. Sie sind die Basis für die ausgewählten Methoden und Modelle.
Wenn Sie zu einem Coach gehen, werden Sie schnell merken, wie Sie sich behandelt fühlen, ob ein partnerschaftlicher Dialog entsteht, ob Sie ehrliche Antworten auf Ihre Fragen bekommen, ob Sie sich in Ihrem persönlichen Entwicklungsprozess unterstützt fühlen, ob Sie Raum bekommen, sich mit Ihren noch ungeordneten Fragen und Gedanken auszubreiten. Nach einiger Zeit werden Sie vermutlich ebenfalls wissen, ob und in welcher Weise Ihr Coach Sie bei Ihrer Suche nach Lösungen unterstützt. Vielleicht erkennen Sie auch, welche Vorstellung Ihr Coach allgemein von Lernen und Veränderung hat, welche Bedeutung rationales Verstehen oder Emotionalität für ihn zu haben scheint. Irgendwann können Sie sogar etwas darüber sagen, welche Auffassung Ihr Coach über das Erkennen von Wahrheit oder Wirklichkeit hat.
All dies könnte man für persönliche Eigenschaften des Coach halten. Es sind jedoch auch die erlebbaren Auswirkungen von Modellen und Theorien, die seinem oder ihrem Coaching-Ansatz zugrunde liegen. Im Folgenden möchte ich Sie deshalb mit den basalen Annahmen und Theorien meines Coaching-Verständnisses vertraut machen. Es hat sich in der Zusammenarbeit mit meinen Kolleg:innen im Beraterteam entwickelt und leitet unser Handeln im Coaching und in der Prozess-Beratung.
Mein Coaching-Verständnis …
… ist systemisch. Menschen, ihr Verhalten, ihr Erleben und ihre Ziele sind nur im Kontext ihrer sozialen Bezüge und Rollen, ihrer Kommunikation und Interaktion zu verstehen. Das Zusammenspiel von Menschen in Organisationen lässt sich erst vor dem Hintergrund bestehender Strukturen, Hierarchien, Aufgaben, Grenzen, Regeln begreifen. Im Coaching fördere ich daher eine mehrperspektivische Betrachtungsweise, um der Komplexität der Fragestellungen gerecht zu werden, um Interaktionen in ihren Wirkungen und Wechselwirkungen zu verstehen und angemessene Lösungen erarbeiten zu können.
… ist psychologisch. Ich gehe davon aus, dass das Erleben und Verhalten von Personen maßgeblich durch ihre Persönlichkeit und ihre individuelle Lern- und Entwicklungsgeschichte geprägt sind. Die systemische und die psychologische Perspektive haben in meinem Coaching-Verständnis den gleichen Stellenwert.
… ist konstruktivistisch. Ich sensibilisiere unsere Coachees dafür, dass ihre Sicht der Dinge weder objektiv noch im allgemeinen Sinne wahr sein kann. Dieselbe Situation wird von verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen. Wahrnehmung ist mehr und etwas anderes als die bloße Aufnahme äußerer Geschehnisse. Wahrnehmung ist ein aktiver Konstruktionsprozess auf der Grundlage individueller Lebenserfahrung und gegenwärtiger Motivationslage.
… ist phänomenologisch. Ich ermutige unsere Coachees, ihre subjektiven und sinnlichen Erfahrungen bewusst wahrzunehmen und für ihre Entscheidungen und Zielfindungen zu nutzen. Dazu hinterfrage ich voreilige Schlüsse, Verallgemeinerungen, Interpretationen, Glaubenssätze und Theorien.
… ist entwicklungsorientiert. Menschen sind von ihrem Wesen her kreativ, neugierig und auf der Suche nach für sie passenden Zielen, Lösungen und Verbesserungen. Ich bin überzeugt, dass Menschen sich lebenslang verändern können.
… basiert auf humanistischen Grundwerten wie Verantwortung, Freiheit, Achtsamkeit, Würde und Toleranz. Ich ermutige meine Coachees, Verantwortung für sich und ihr Lebensumfeld zu übernehmen, bewusste Entscheidungen zu treffen, die Konsequenzen zu bedenken und für eigene Entscheidungen und Handlungen einzustehen. Als Coach verpflichte ich mich, mit transparenten, nachvollziehbaren Methoden und Interventionen zu arbeiten, die für den Coachee zugleich nützlich und verständlich sind.
… ist dialogisch. Ich bin überzeugt, dass ein partnerschaftlicher, wertschätzender, im Idealfall intersubjektiver Dialog zwischen Coach und Coachee entwicklungsfördernd ist. Ich achte die Individualität meiner Coachees und respektiere, dass sie sich in Persönlichkeit, Ansichten, Werten, Bedürfnissen und Zielen von anderen Menschen unterscheiden.
… nutzt fundierte und nachvollziehbare Erklärungsmodelle der Neurowissenschaften über Wahrnehmungen, Gefühle, Gedächtnis, Lernen sowie über bewusste und unbewusste Verhaltenssteuerung.
… integriert Interventionstechniken aus unterschiedlichen Beratungsschulen, soweit diese in ihren erkenntnistheoretischen, anthropologischen und ethischen Grundannahmen miteinander vereinbar sind. Zum Beispiel nutze ich Erkenntnisse, Modelle und Methoden aus der systemisch-lösungsorientierten Beratung, der Kommunikationspsychologie, aus Rollenspiel, Psychodrama und Gestalttherapie (z.B. Spiegeln, Rollentausch, innerer Dialog, Arbeit mit kreativitätsfördernden Medien), der Positiven Psychologie, dem mentalen Training, aus dem Embodiment etc.
2 Coaching: Werkzeugkoffer
Vorbemerkung
Wann haben Sie sich das letzte Mal zu einer persönlichen Frage beraten lassen? Lassen Sie sich überhaupt beraten? Und wenn ja, gehen Sie dann eher zu Profis oder eher zu Freund:innen? Oder gehören Sie zu den Menschen, die sowieso alle Probleme selbst lösen?
Ich möchte Sie bitten, für einen Moment innezuhalten und eine kleine Gedankenreise zu unternehmen: Versuchen Sie sich an Situationen zu erinnern, in denen Sie ein Coaching hätten brauchen können oder in denen Sie sich wirklich professionelle Hilfe gesucht haben … Und jetzt erinnern Sie sich bitte an ein gutes Beratungsgespräch oder stellen es sich vor. Was war hilfreich für Sie? So wie Sie sich kennen, was brauchen Sie von einem Coach? Was tut Ihnen gut? Vielleicht erinnern Sie sich auch an schlechte Erfahrungen? Was hat Sie gestört oder Ihnen sogar geschadet? Wenn Sie ein Fazit ziehen: Was ist für Sie ganz persönlich das wichtigste Kriterium dafür, ob ein solches Gespräch hilfreich und nützlich für Sie wird?
Diese Frage habe ich immer wieder zu Beginn eines Coaching oder in Ausbildungsgruppen für Coaches gestellt. Die Antworten ähneln sich: Es sind keineswegs die Techniken und gewieften Interventionen, die an erster Stelle als hilfreich genannt werden, sondern vielmehr die Grundhaltung und die prinzipielle Dialogfähigkeit des Coaches. Die meisten Menschen wünschen sich zunächst ein aufrichtiges und wohlwollendes Interesse. Sie wollen nicht bewertet und nicht mit Ratschlägen überhäuft werden. Dann erst kommen die Wünsche nach anregenden Fragen und inhaltlichen Stellungnahmen, nach Strukturierungsvorschlägen und Lösungsideen. Wichtig ist also eine wertschätzende und partnerschaftliche Grundhaltung. Diese Haltung äußert sich in der Bereitschaft, sich als Coach für den Menschen mit seinem Anliegen zu interessieren und sich auch selbst als Person zu zeigen. Beide Seiten müssen sich ergänzen: Wenn ich mich nicht für die Coachee interessiere oder mich selbst zu stark in den Mittelpunkt stelle, werde ich nicht viel erfahren. Wenn ich mich ausschließlich für mein Gegenüber interessiere, dabei aber selber als Person unsichtbar bleibe, gerät das Interesse zum distanzierten Ausforschen, und mein Gegenüber fühlt sich als Objekt behandelt.
Ebenso wichtig ist die Bereitschaft, dem Coachee in seine Erlebniswelt zu folgen und gleichzeitig das Gespräch zu führen. Auch hier müssen sich beide Aspekte wechselseitig ergänzen: Wenn ich nicht bereit bin, dem Coachee zu folgen und mich auf seine Sprache, seine Verarbeitungsweise und seine Bewertungen einzulassen, wird Coaching schnell zum Machtkampf um Richtig und Falsch. Wenn ich als Coach aber immer nur den Gedankengängen meines Gegenübers folge und keine gezielten Angebote zur Strukturierung mache oder Anregungen gebe, werden die meisten Menschen sich zwar gut verstanden fühlen, aber wenig Neues entdecken.
Um auf der Basis dieser dialogischen Grundhaltungen gezielt handeln zu können, braucht man Handwerkszeug: Erklärungsmodelle, Beratungsmethoden und Interventionstechniken, d.h. einen Werkzeugkoffer, in dem verschiedene Gebrauchsanweisungen und konkrete Werkzeuge übersichtlich sortiert und leicht zu finden sind.
Für den folgenden Werkzeugkoffer unterscheide ich sieben Kompetenzfelder:
Zuhören und Stellung nehmen
Den Überblick behalten
Lösungsorientiert vorgehen
Rollen und Aufgaben klären
Kommunikation reflektieren
Die psycho-logische Welt erklären
Themenzentriert vertiefen
Coaching-Werkzeugkoffer
Zu diesen Kompetenzfeldern werde ich jeweils diejenigen Erklärungsmodelle, Beratungsmethoden und -techniken beschreiben, die sich in der Ausbildung von Coaches besonders bewährt haben.
Ob sich solche «Werkzeuge» für die Anwendung im Coaching eignen, prüfen wir in unserem Ausbilderteam, indem wir uns immer wieder fragen:
Ermöglichen sie einen partnerschaftlichen Dialog?
Bleibt die Selbstverantwortung des Coachee gewahrt?
Leisten sie Hilfe zur Selbsthilfe?
Fördern sie die Suche nach stimmigen Zielen und angemessenen Lösungswegen?
Fördern sie Zuversicht, Selbstwirksamkeit, souveränes Handeln und persönliche Entwicklung?
2.1 Zuhören und Stellung nehmen
2.1.1 Aktiv zuhören
Das aktive Zuhören bezeichnet eine wertschätzende Grundhaltung und die dazugehörige Gesprächstechnik. Man schafft einen wohlwollenden und angstfreien Rahmen, in dem sich die Coachee öffnen und ihre subjektiven Sichtweisen darstellen kann. Als Coach halte ich mich mit eigenen Stellungnahmen zurück und verzichte auf Deutungen und frühe Konfrontationen ebenso wie auf aktive Lösungsangebote. Ich versuche also, den Coachee sowohl rational als auch emotional zu verstehen und dies im Gespräch durch verbale Zusammenfassungen und nonverbale Gesten auch zu zeigen. Auf diese Weise entschleunigt und vertieft sich das Nachdenken, die Perspektiven werden weiter und es wird möglich, eigene Lösungen zu entwickeln.
Das aktive Zuhören wurde erstmals von Carl R. Rogers beschrieben (Rogers 1983ff.). Schulz von Thun unterscheidet zusammenfassend drei Ebenen des aktiven Zuhörens (vgl. Schulz von Thun u.a., 2000, S. 70ff.):
1. Ebene: Wertschätzendes Interesse
Hier signalisiere ich als Coach wohlwollendes Interesse und helfe mit öffnenden und aufmunternden Fragen, ins Gespräch zu kommen und konkreter zu werden:
Erzählen Sie mal, wie es dazu gekommen ist …
Ich würde gerne wissen, wie …
Mich würde interessieren …
Dann konzentriere ich mich aufs Zuhören und folge der Coachee. Die Grundbotschaft lautet:«Ich bin ganz Ohr.» Das Zuhören auf dieser Ebene wird körpersprachlich und mit kleinen verbalen Signalen zum Ausdruck gebracht: «Ja», «Mhm», «Verstehe» usw.
2. Ebene: Inhaltliches Verständnis
Dann versuche ich als Coach, die Kernaussagen auf den Punkt zu bringen, indem ich die wichtigsten Inhalte mit eigenen Worten zusammenfasse und dadurch überprüfe, wieweit ich die Coachee verstanden habe:
Ich würde gern kurz zusammenfassen, was ich bisher verstanden habe …
Wenn ich Sie richtig verstehe …
Antwortet die Coachee verbal oder nonverbal mit dem Tenor: «Ja, genau!», kann die Reise weitergehen. Wenn nicht, stimmt das Verständnis noch nicht, und die Coachee kann die Dinge richtigstellen. Dieser Schritt stärkt die Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Besonders wichtig ist diese Ebene des aktiven Zuhörens bei chaotischen und diffusen Situationsbeschreibungen und Problemschilderungen.
3. Ebene: Emotionales Verständnis
Hier geht es um die Fähigkeit, meinem Gegenüber aus dem Herzen zu sprechen. Als Coach versetze ich mich in die Situation der Coachee und versuche, ihre Gefühlslage auf den Punkt zu bringen. Das können offensichtliche Gefühle sein, die die Coachee im Gespräch schon angedeutet hat. Das können aber auch Empfindungen sein, zu denen sie noch keinen direkten Zugang hat und die sich bisher möglicherweise nur durch Mimik, Gestik oder Stimmführung mitgeteilt haben:
«Nach drei erfolglosen Klärungsversuchen haben Sie jetzt eigentlich keine Lust, nochmal die Initiative zu ergreifen – jetzt soll Herr Meier mal selber zusehen, wie er ohne Ihre Unterstützung klarkommt. Sie haben Ihren Beitrag geleistet!»