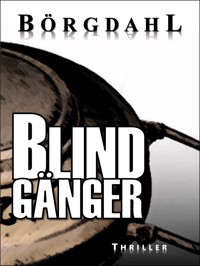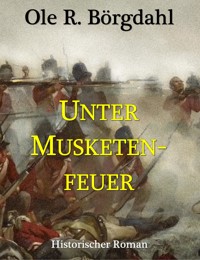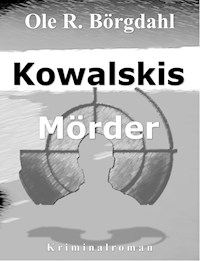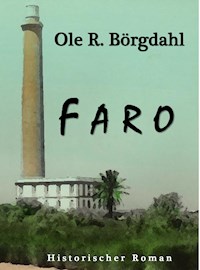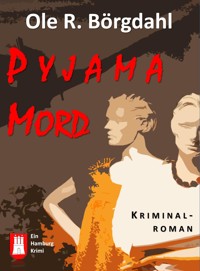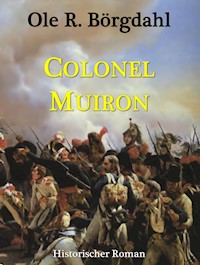
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Falk-Hanson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wurde der ehemalige französische Kaiser auf Saint Helena durch einen Doppelgänger ausgetauscht? Konnte Napoléon Bonaparte in einem Fischerboot von der Insel fliehen, um im Atlantik von seinen Anhängern auf ein Schiff gerettet zu werden? Planen seine engsten Vertrauten Napoléon in einem südamerikanischen Staat an die Spitze einer Revolution gegen das spanische Vizekönigreich zu setzen? Oder ist Louisiana das Ziel des Colonel Muiron, wie sich Napoléon schon in der Vergangenheit nannte? Falk Marten Hanson und seine Kameraden verlassen Saint Helena, um genau diese Fragen zu beantworten. Die Reise geht über Brasilien und Chile zum Pazifik. Falk und sein Freund Marc Ligne durchqueren Panama und gelangen über Kuba nach New Orleans. Hier treffen sie endlich auf Colonel Muiron.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ole R. Börgdahl
Colonel Muiron
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1 Das Buch
2 Prolog
3 Atlantik
4 Recife
5 Chile
6 Pazifik
7 Panama
8 New Orleans
9 Demopolis
10 Champ d’asile
11 Mobile
12 Epilog
13 Nachtrag
Impressum neobooks
1 Das Buch
.
Colonel Muiron
.
Wurde der ehemalige französische Kaiser auf Saint Helena durch einen Doppelgänger ausgetauscht? Konnte Napoléon Bonaparte in einem Fischerboot von der Insel fliehen, um im Atlantik von seinen Anhängern auf ein Schiff gerettet zu werden. Planen seine engsten Vertrauten Napoléon in einem südamerikanischen Staat an die Spitze einer Revolution gegen das spanische Vizekönigreich zu setzen? Oder ist Louisiana das Ziel des Colonel Muiron, wie sich Napoléon schon in der Vergangenheit nannte?
Falk Marten Hanson und seine Kameraden verlassen Saint Helena, um genau diese Fragen zu beantworten. Die Reise geht über Brasilien und Chile zum Pazifik. Falk und sein Freund Marc Ligne durchqueren Panama und gelangen über Kuba nach New Orleans. Hier treffen sie endlich auf Colonel Muiron.
Vierter Band der historischen Falk-Hanson-Reihe.
2 Prolog
.
.
Ich wusste nicht, wer noch lebte, ich wusste nicht, ob ich noch lebte, als plötzlich alles vom tobenden Meer umspült war. Das Wasser lief aber schnell wieder ab. In der Dunkelheit erkannte ich eine offene Stückpforte, die mir ungewöhnlich breit vorkam. Erneut rauschte Meerwasser über das Deck, ein gewaltiger Brecher war über uns gekommen. Ich spuckte, schüttelte mich und spürte erst jetzt meine Benommenheit. Und ich spürte, dass ich taub war. Alle Geräusche, das Strömen des Wassers, das Ächzen des Holzes und die Schreie der Männer hörte ich wie durch einen Nebel. Wieder stürzte das Meerwasser über mich, raubte mir für Sekunden auch den Sehsinn. Ich wollte meine Umgebung ertasten, hatte aber in meinem rechten Arm kein Gefühl mehr. Mit dem Linken fasste ich mir an die Brust und dann an die Schulter und weiter bis zum Ellenbogen.
Mein rechter Arm war noch dort wo er hingehörte, als ich ihn ertastete, durchlief mich allerdings ein stechender Schmerz. Ich wollte mich erheben, wurde aber zurückgehalten. Sofort griff ich mit der Linken an meine Oberschenkel, stieß dabei aber auf einen Körper, der über meinen Beinen lag. Die dünnen Arme, die schmale Taille, ich zog Philippe zu mir heran, spürte das Heben seines Brustkorbes. Und dann stöhnte er. In der Dunkelheit konnte ich ihn nicht untersuchen, seine Unversehrtheit nicht feststellen. Ich sank wieder in mich zusammen, ließ einen weiteren Sturzbach über uns ergehen und spürte, wie die Planken unter mir vibrierten.
Ich hatte die Augen geschlossen, öffnete sie wieder, holte tief Luft und blickte mich um. Alles war nur schemenhaft, aber dann sah ich ein schwaches Licht, das näherkam, stockte, sich wieder von mir fortbewegte, für einen Augenblick ganz verschwand und dann erneut auftauchte. Jetzt kam es näher, hatte mich entdeckt, und dann waren da zwei, drei Lichter. Eine Laterne wurde neben mir abgestellt, jemand beugte sich über Philippe und mich. Plötzlich durchschüttelte es den Rumpf, doch der Mann über uns blieb standhaft.
Ich blickte in sein Gesicht. Micha hob Philippes Körper an, übergab ihn an einen zweiten Mann, kümmerte sich dann wieder um mich. Er half mir auf, stützte mich, brachte mich zu einer Treppe und hinauf an Deck. Micha verschwand, aber da war Karl neben mir, kümmerte sich schon um meinen Arm.
»Philippe!«, rief ich.
In meinem Mund schmeckte ich Salz. Ich musste mich sofort übergeben. Karl drehte meinen Kopf zur Seite und als es vorbei war, wischte er mir das Gesicht ab.
»Philippe?«, wiederholte ich. »Was ist mit Philippe?«
»Es geht ihm gut, er ist bewusstlos, aber nicht verletzt.«
Karl wandte sich ab, gab Zeichen, man packte mich vorsichtig, half mir auf und geleitete mich über Deck. Achtern lagen Tücher, Decken und Reste der Segel, ein Lager für die Versehrten. Vier, fünf Mann kauerten dort bereits und auch Philippe, neben den ich gesetzt wurde. Er regte sich jetzt, stöhnte. Ich ergriff seine Hände. Karl untersuchte ihn noch einmal, beugte sich dann über einen Mann links neben mir. Gischt spritzte auf, der Schwall war erneut ein Deck tiefer eingeströmt. Ich hoffte nur, dass man inzwischen alle Leute dort herausgeholt hatte. Karl drückte mich nieder, verhinderte es, dass ich mich wieder aufrichtete. Und dann überkam mich eine große Müdigkeit, mir wurde schwarz vor Augen. Ich wollte noch dagegen ankämpfen, aber es gelang mir nicht.
Alles war weg, ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Waren eine oder zwei Stunden vergangen oder nur dreißig Minuten? Ich erwachte aus der Ohnmacht, die fast drei Stunden angedauert hatte, wie ich später erfuhr. Und dann, von einer Sekunde auf die andere, kam das Bewusstsein zurück. Im ersten Moment glaubte ich nicht, dass das Geschehene die Wirklichkeit war. Ich fror, hatte schrecklichen Durst. Die Erinnerung kroch mit unheimlicher Geschwindigkeit in mein Hirn. Alles stand klar vor mir. Philippe war über Bord gegangen, ich wollte ihn den Fluten entreißen und so bot auch ich meine Seele den Elementen an. Wir waren längst verloren, mit jeder Sekunde entfernte sich die Faucon von uns. Wellen griffen gierig nach uns, wollten uns in die ewige Tiefe ziehen. Doch ich hielt unser beider Körper über Wasser. Und wie durch ein Wunder kehrte die Faucon zurück. Unsere Wiedergeburt hatte jedoch einen hohen Preis. Alles hatte sich auf unsere Rettung konzentriert und das Schiff damit der Gefahr ausgesetzt, in der die Faucon jetzt umgekommen war.
Ich schreckte hoch, so brutal war die Erinnerung. Ich lag nicht mehr an Deck, sondern in meiner Kajüte, die ich mir mit weiteren Verletzten teilte. Plötzlich standen zwei Männer vor mir, einer ging in die Hocke. Ich erkannte Björn, neben ihm Victor. Ich wurde immer klarer, der Schleier hob sich nun endgültig, die Gedanken kehrten zurück, die Gedanken, die dem Schiff und der Mannschaft gelten mussten. Björn sah mich immer noch an, begriff dann, dass er mich ansprechen konnte.
»Wir sind aufgelaufen, sitzen fest, aber nicht fest genug. Die schwere See zieht am Rumpf der Faucon. Ich befürchte, neben den Felsen, auf denen wir liegen, geht es tausende Fuß in die Tiefe. Das ist hier so mit dem Land im Ozean, mit dem Land, das es eigentlich nicht geben darf.«
»Kann sie nicht mehr schwimmen?«, fragte ich und richtete mich etwas auf. Der Schmerz schoss in meinen Arm, aber ich ignorierte ihn. »Was ist mit dem Rumpf?«
Victor hockte sich jetzt auch zu mir hinunter. »Am Bug ist alles eingedrückt und aufgerissen, wir würden sinken wie ein Stein, sobald wir in tieferes Wasser geraten. Das Schiff liegt jetzt auf Grund, also auf einer Felsnase oder so, vielleicht sechs Fuß tief. Das Wasser schießt ein, läuft aber auch wieder ab. Es sind bereits drei Mann an Land gegangen und vertäuen die Faucon so gut es geht.«
»Wir wissen aber nicht, was das Unwetter noch anrichtet«, sagte Björn. »Wir wissen nicht, ob die Seile halten. Wir können nur hoffen, dass der verdammte Sturm nachlässt.«
Ich nickte. »Gut, kann man das Leck flicken?«
Victor überlegte. »Wir haben viel Material verloren, wir müssten an anderer Stelle vom Schiff Holz abschlagen …« Er zögerte. »Jetzt wüsste Hauke, was zu tun ist, verdammt.«
Ich verstand nicht. »Hauke, was ist mit Hauke? Er ist doch nicht über Bord gegangen?«
Karl kniete jetzt auch neben mir. »Einige Männer haben es nicht geschafft.«
»Was soll das heißen?«
Karl nickte in Richtung Großmast. »Draußen haben wir unsere Toten hingelegt«
»Wie viele?« rief ich mit schriller Stimme.
»Sieben und zwei Mann sind über Bord gegangen, da kommt wohl jede Hilfe zu spät.«
»Wer, verdammt, wer?«
»Hauke, Sten, drei von Micha Kameraden und zwei von den Leuten aus Lübeck, liegen alle da drüben und wenn wir die anderen beiden Jungs nicht noch irgendwo an Bord finden …«
»Ich will sie sehen«, rief ich und begann schon mich aufzurappeln.
Karl und Victor halfen mir. Wir gingen zum Großmast und wieder wurde der Rumpf der Faucon durchgeschüttelt, als wenn mich eine unheimliche Macht hindern wollte, zu meinen Leuten zu gelangen.
In meinem soldatischen Leben hatte ich schon viele Verbandsplätze gesehen, wo die anonyme Masse überwiegt, wo der Tod in jedem Gesicht gleich aussieht. Dies gilt aber nur, wenn man die Männer, die Kameraden zu Lebzeit nicht gekannt hat. Das, was sich mir am Großmast bot, war eine völlig andere Szenerie. Ich war monatelang mit diesen Männern gesegelt, hatte mit ihnen auf engstem Raum zusammengelebt, kannte ihre Namen und zumeist auch ihre Geschichte. Und dann waren da noch meine Freunde. Sten, der unter mir gedient hatte, der mir ein enger Kamerad und Freund war. Gleiches galt für Hauke. Wir beide hatten Leben gerettet, Menschen aus einem brennenden Haus geholt. Und jetzt war ich für Haukes Tod verantwortlich, für Stens Tod und auch für den Tod der anderen fünf Männer, die mir gefolgt waren, für die ich die Verantwortung trug.
Aber Tod ist nur ein Wort, ein endgültiger Zustand. Ich fragte mich, wie die Männer umgekommen waren. Erst jetzt sah ich ihre zerschundenen Körper, das Blut in ihren Gesichtern, an Armen und Beinen. Hätte ich sie retten können, wenn ich zur Stelle gewesen wäre, hätte ich sie retten können, wenn diese Mission niemals unternommen worden wäre?
»Hauke und Sten sind unter die Kanonen geraten«, erklärte Björn. »Im Batteriedeck hat sich beim Aufprall gegen den Felsen alles gelöst. Philippe und du, ihr hattet verdammtes Glück. Ein weiterer Mann wurde zerquetscht, die übrigen vier sind im Orlopdeck ertrunken.«
*
Meine Kajüte war in den nächsten zwei Tagen das Krankenlager. Karl hatte Arm- und Beinverletzungen, Schnitt- und Schürfwunden und Kopfwunden zu behandeln. Bei mir kam noch ein Fieber dazu, mit dem mein Körper auf die Unterkühlung reagierte, die ich erlitten hatte, als Philippe und ich mehr als eine halbe Stunde in den kalten Fluten geschwommen waren. Glücklicherweise fehlte Philippe gar nichts. Er musste sich ausschlafen, war aber nicht verletzt oder von Krankheit ergriffen.
Am dritten Tag leerte sich meine Kajüte. Am Nachmittag erhob ich mich ebenfalls, befreite mich aus meiner Hängematte und trat mit wackeligen Beinen an Deck. Der Sturm hatte einen heftigen Wind zurückgelassen. Am Himmel zogen Wolken vorüber, schnell strömend, und bildeten immer neue Wolkengebirgsformationen, bis schließlich der erste Sonnenstrahl blendend in meine Augen fuhr. Nach dieser hoffnungsvollen Blendung, suchte mein Blick sofort den Leichenplatz. Die schmerzliche Erinnerung war wieder da und ließ sich nur schwer vertreiben. Der Tod war allerdings bereits in eine Ordnung gebracht, die Männer lagen nicht mehr offen an Deck, sondern waren säuberlich in die Schiffssärge eingenäht. Weißes Segeltuch, die beste Qualität, der Saum sorgfältig und schnurgerade und alles voller Würde.
Karl hatte mir die Seebestattung bereits angekündigt. Ich bestand darauf teilzunehmen, mit in eines der Boote zu gehen und meinen Freunden und Kameraden die letzte Ehre zu erweisen. Karl konnte und durfte mich nicht aufhalten. Die Faucon hatte zwei unbeschädigte Boote, eine Barkasse und eine kleinere Jolle. Beide waren schon zu Wasser gelassen, als man die verschnürten Körper nach unten hievte und hineinlegte. Dazu vier Mann in jedem Boot an den Riemen, Björn und ich als Geleit. Der traurige Rest meiner Mannschaft stand an der Reling. Als wir gut hundert Yards hinaus auf die noch kabbelige See gepullt hatten, begannen die Männer an der Reling in tiefem Bass zu summen.
Die Totenfeier hatte begonnen. Björn sprach ein Seemannsgebet, das ich besser hätte nicht machen können. Hauke wurde als erster dem ewigen Meer übergeben. Ich vermutete, dass man ihm zwanzig Pfund an Kanonenkugeln mitgegeben hatte, denn das Segeltuch glitt schnell in die Tiefe. Gleiches geschah bei meinen anderen Kameraden und so fanden alle ihr Grab und ließen uns andere zurück. Den Ort der Bestattung, die mit dem Sextanten ermittelte Position, notierte ich später im Logbuch der Faucon, das ich noch immer besitze.
Nachdem die Angelegenheit des Todes geregelt war, mussten wir uns wieder um das Leben kümmern. Ich hatte mir die Faucon noch nicht in Gänze angesehen, wurde erst an diesem Nachmittag herumgeführt. Das Batteriedeck war inzwischen aufgeräumt worden. Hier muss ich jetzt die Position der Faucon beschreiben. Wir lagen auf einem Unterwasserfelsvorsprung der Insel. An Steuerbord ragte eine Steilwand auf, die den abgeknickten Großmast stützte. An Backbord befand sich die Wasserseite. Auf dem Batteriedeck waren drei Kanonen über Bord gegangen und hatten über die Länge von vier Stückpforten die Beplankung fortgerissen. Durch diese Öffnung kam auch jetzt immer wieder ein Wasserschwall, wenn sich eine vom Meer kommende Welle zu sehr aufgebaut hatte.
Victor erklärte, dass dieser Schaden ihm nicht so viel Sorge bereitete. Wir gingen daher zwei Decks tiefer und nach vorne Richtung Bug. Es sah auf den ersten Blick aus wie ein unterirdischer, mit Wasser gefluteter Tunnel. Ich ging in die Knie und sah am Ende des vermeintlichen Tunnels das ins Wasser dringende Sonnenlicht. Ich konnte erahnen welch ein Schaden am Bug vorlag. Wäre der Rumpf nicht aufgesetzt gewesen, gäbe es für die Faucon kein Halten mehr. Ich sah regelrecht, wie das Wasser einströmen würde und alle Abteilungen überflutete. Die Faucon war kein Schiff mehr und das sagte ich Victor auch.
»Ich habe doch einen Plan«, war daraufhin seine Antwort.
»Dazu brauchen wir aber eine Werft, um deinen Plan umzusetzen. Solche Schäden kann man nur in einer Werft beheben und selbst dort wird man seine Schwierigkeiten haben.«
»Ich habe doch schon alles vermessen, aber lass uns bitte wieder hinaufgehen, dort habe ich meine Zeichnungen.«
Wir gingen hinauf und in meine Kajüte, setzten uns an den Tisch und ich ließ Victor erklären.
»Wir formen den Bug nicht mehr neu aus, nicht mehr so, wie er gewesen ist. Wir schließen das Leck, wir setzen Querbalken, die wir beplanken und wasserdicht ausstopfen.«
»Dann ist der Rumpf aber kein Rumpf mehr, dem Schiff fehlt die Linie, das Wasser staut sich am geraden Bug, wir können keine Manöver mehr fahren, weil die Faucon dem Ruder nicht mehr gehorchen wird.«
»Das weiß ich doch, das weiß ich doch, darum formen wir den Bug neu aus. Wir setzen auf den Flicken ein senkrechtstehendes Dach, dichten es so weit wie nötig ab und erhalten wieder die Linie, die wir brauchen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Das wird uns bei drei, vier Knoten abreißen, das wird uns abreißen, sobald wir die erste Wende vollführen. Weißt du, wie viel Kraft so ein Bug aufnehmen muss?«
»Das ist mir doch bewusst, das weiß ich doch. Wir werden einen sehr stabilen Bug bauen, ihn gut befestigen, aber wir werden vorsichtig segeln müssen, vielleicht nur mit zwei Knoten, aber wir werden von hier fortkommen.«
Ich ließ Victors Worte auf mich wirken, schaute mir auch noch einmal seine Zeichnung an. Auf einem zweiten Blatt hatte er das gesamte Schiff skizziert und die Stellen eingetragen, an denen es Beschädigungen gab. Das hatte er von Hauke gelernt. Ich kniff die Augen zusammen. Dann wollte ich mich auch mit Karl und Björn beraten, sie hatten neben Victor immer noch die besten Kenntnisse über Schiffbau, wobei ich auf Karls Einschätzung von Kräften und deren mathematische Berechnung hoffte. Wenn Karl eine Konstruktion abnahm, den rechnerischen Beweis lieferte, dass alles halten würde, konnte ich bedenkenlos Victors Plan folgen.
Es schien mir dann aber, dass Victor bereits selbst mit seinen Mitstreitern gesprochen hatte. Karl und Björn forderten mich auf, Vertrauen zu haben, es war die einzige Möglichkeit, das Schiff wieder seetüchtig zu bekommen. Und außerdem, so beteuerte Karl, hätten wir immer noch die beiden Boote, die Barkasse und die Jolle, in der leicht alle verbliebenen Besatzungsmitglieder untergebracht werden konnten. Dieses letzte Argument beendete die Diskussion.
Eine halbe Stunde später ging ich noch einmal über das Schiff. Victor nahm bereits Maß, denn er musste sich für sein Vorhaben an den Aufbauten der Faucon bedienen. In der zweiten Phase sollte das Schiff zu dem an Gewicht verlieren. Wir würden also einiges auf der Insel zurücklassen müssen. Darüber dachte ich aber noch nicht nach. Victor hatte drei Matrosen, die ihm bereits assistierten, während der Rest der Mannschaft in ihren Hängematten lag oder sich in den Schatten des Schanzkleides zurückgezogen hatte. Ich sprach jeden Mann kurz an, fragte nach seinem Befinden, ging dann aber schnell durch die Reihen.
Ich traf schließlich auf Micha und seine zwei Kameraden. Obwohl die Seebestattung ja schon stattgefunden hatte, führten sie eine Art Messe aus, wie mir Micha erklärte. Ich setzte mich dazu, betete mit meinen russischen Kameraden und ließ mir die Lebensgeschichten der verunglückten Männer erzählen. Ich erfuhr, dass bei dem einen Kinder und eine Witwe zurückblieben und dass bei dem anderen eine alte Mutter vergeblich auf die Rückkehr des einzigen Sohnes warten würde.
Ich zog mich schließlich in meine Kajüte zurück, wo Philippe auf mich wartete. Ich hatte ihn den ganzen Tag vernachlässigt und spürte jetzt, dass er meine Nähe brauchte. Wir sprachen noch zwei Stunden über alles, über Schuld und Schicksal, über den Lauf der Dinge, den niemand beeinflussen konnte. Bei diesem Gespräch spürte ich, dass Philippe kein Kind mehr war.
*
Am nächsten Morgen widmete ich meine Gedanken das erste Mal der Insel, auf der wir gestrandet waren. Bislang kannte ich von dem Island nur eine schroffe Felswand, die dreißig oder vierzig Yards über der Faucon aufragte. Ich unternahm daher noch am Vormittag eine Expedition mit unserer Jolle. Karl und Philippe begleiteten mich und dazu noch drei der Lübecker Matrosen, unter ihnen der junge Tamme, der uns über Matheos tragischen Tod berichtet hatte.
Wir nahmen genug Wasser und Proviant mit, stießen uns von der Faucon ab und setzten gleich Segel. Zunächst ließ ich ein paar hundert Yards aufs offene Meer hinausfahren. Aus der Ferne wirkte die Insel ebenso trostlos, wie aus unmittelbarer Nähe. Wir überblickten einen Küstenstreifen, der weithin aus schroffen, hohen Klippen bestand. Auf der Südseite der Insel war kein Strand auszumachen, keine Möglichkeit anzulanden.
»Dort brennt ein Feuer«, rief Tamme und zeigte zu den Wolken, die sich über der Insel formiert hatten.
Im ersten Moment war ich mir nicht sicher, aber dann sah auch ich, wie der grauschwarze Schleier weit hinter den Felsen aufstieg und sich dort mit den Wolken vermischte, bei denen es sich wohl doch um keine Wolken handelte. Karl hatte schließlich eine Antwort auf das Phänomen.
»Natürlich, wir sind auf einer Vulkaninsel gestrandet. Wir müssen davon ausgehen, dass der Vulkan noch brennt.«
»Und was bedeutet das für uns«, fragte ich.
Karl zuckte mit den Schultern. »Ich habe gelesen, dass die Bewohner auf solchen Inseln jahrhundertelang unbehelligt mit ihrem Vulkan gelebt haben. Der Rauch muss kein schlechtes Zeichen sein und so stark scheint er ja auch nicht hervorzutreten.«
»Pompeji wurde durch einen Vulkan zerstört«, sagte Philippe.
»Da hast du recht. Du hast in der Schule den Tacitus gelesen?«
Philippe nickte.
»Aber hier haben wir nicht den Vesuv vor uns, der seit Jahrtausenden existiert«, erklärte Karl. »Diese Vulkaninsel gibt es noch nicht sehr lange und vielleicht wird sie auch sehr bald wieder untergehen.«
»Was soll das heißen?«, fragte ich. »Was heißt bald?«
»Ein Jahr, zehn Jahre oder auch nur einen Monat«, sagte Karl, als hätte diese Tatsache keinerlei Bedeutung für unsere momentane Situation.
»Und was passiert, wenn die Insel untergeht?«
»Da sollte man nicht in der Nähe sein.« Karl machte eine Pause. »Aber wir wissen ja gar nicht genau, was hier los ist, wo der Rauch wirklich herkommt und was er bedeutet.«
»Dann müssen wir uns das jetzt ansehen«, entschied ich.
Tamme saß an der Pinne. Ich gab Befehl, wieder näher auf die Insel zuzuhalten, dabei aber um die westliche Spitze herumzusegeln. Wir entfernten uns von der Faucon, bis wir nicht einmal mehr ihre Masten sehen konnten. Die Küste der Insel blieb schroff, aber die Felsen ragten schon nicht mehr so hoch auf. Ein Anlegeplatz für die Jolle war aber noch lange nicht in Sicht, es gab nirgends einen Strand oder wenigstens eine flache Steinkante.
In der Zwischenzeit schätzte ich die Größe der Insel ab. Auf der Südseite, an der wir gestrandet waren, nahm ich eine Länge von etwa einer Meile an. Nach Westen hin verlief die Küste für mindestens zwei Meilen in einem Halbkreis. Dann ein scharfer Knick, die Felsen waren hier flacher, liefen Richtung Osten immer mehr aus. Eine zerklüftete Ebene, an deren Kante wir die Jolle anlegen lassen konnten. Zwei der Matrosen blieben im Boot, nur Tamme begleitete Karl, Philippe und mich.
Wir kamen gut voran, das Gelände war flach, der Boden eben, ja sogar an einigen Stellen glatt. Als wir uns nach zweihundert Yards zur Küste umdrehten, stellten wir allerdings fest, dass es einen nicht unerheblichen Anstieg gegeben hatte. Dann spürten wir dies auch beim Gehen. Wir standen am Fuße eines Berges, der auf direktem Wege nicht zu ersteigen war. Wir hielten uns diagonal, um die Steigung erträglich zu machen. Karl bückte sich immer wieder nach Gesteinsbrocken und zeigte sie uns.
»Ich kenne jemanden in München, der viel für diese Steine geben würde«, erklärte Karl. »Das muss alles noch ganz frisch sein, erst vor wenigen Wochen erkaltet.«
»Das sind also keine gewöhnlichen Steine?«, fragte ich.
»Ganz und gar nicht. Gut, man findet Vulkangestein überall auf der Welt, aber selten so frisches.«
Karl bückte sich und zerschlug einen der Steine auf dem Boden. Er zeigte uns die Bruchfläche. »Das sind Mineralien aus dem Inneren der Erde. Andesit, Basalt, Obsidian und viele mehr. Vor ein paar Jahren habe ich etwas über den Basaltstreit gelesen.«
»Und was ist das schon wieder?«, fragte ich.
»Ja, das ist sehr interessant, denn eine Reihe von Gelehrten meint, dass der Vulkanismus völlig unbedeutend ist und dass sich die Welt, die Steine, Felsen und Berge durch Sedimentation gebildet haben, Schicht für Schicht über einen unermesslich langen Zeitraum. Vulkane sind zwar existent, wie wir hier sehen, aber unbedeutend. Hier jedenfalls hat ein Vulkan die Insel erschaffen. Und auf unserer Reise haben wir doch viele weitere solcher Inseln gesehen, auch wenn sie viel älter waren als diese. Warum sollen dann nicht auch ganze Kontinente aus Vulkanen geboren worden sein?«
Ich schüttelte den Kopf. »In einer Studierstube mag dies ein anregendes Gespräch ergeben, doch hier vor Ort ist es mir egal, wie diese Insel entstanden ist, die plötzlich auf unserem Weg lag. Lass uns also schauen, ob sich hier etwas Verwertbares findet.«
Karl zuckte mit den Schultern, steckte den Stein in seine Tasche und wir setzten unseren Weg fort. Dann bereute ich es, dass ich Karls Erklärungen abgetan hatte, denn plötzlich stach uns ein widerlicher Geruch entgegen. Schwefel! So konnte es nur in der Hölle stinken. Karl bückte sich erneut.
»Oh, oh, das fühlt sich nicht gut an. Noch fünfzig Yards weiter und wir versengen uns die Füße.«
Ich tastete ebenfalls am Boden und tatsächlich spürte ich die Wärme. Es war nicht unangenehm, sondern eher ungewöhnlich. Karl erbat sich mein Utzschneider Fernrohr, um es auf die vor uns liegende Bergkuppe zu richten.
»Da!«, rief er plötzlich. »Habe ich es mir doch gedacht, eine Rauchfahne. Da brodelt etwas, fürchte ich.«
Ich bekam das Fernrohr zurück und tatsächlich konnte ich ebenfalls den schwachen Schleier erkennen. Es schien zu pulsieren, war dann für mehr als eine Minute gar nicht mehr zu sehen, um erneut zu erscheinen.
»Was brodelt da?«
»Der Vulkan selbstverständlich, Tamme hatte recht. Dies alles hier ist noch sehr jung. Vielleicht hat sich die Insel erst vor wenigen Monaten aus dem Meer erhoben. Sie ist zudem recht klein und könnte noch erheblich zulegen.«
»Was heißt das, erheblich zulegen?«, fragte ich.
»Gut, der Schlot raucht ja bereits. Ich sage ein neues Aufbegehren voraus. Der Vulkan ergießt sich über das, was er bereits erschaffen hat. Das Material erstarrt, darüber wird weiteres Gestein gelegt. Die Insel wird breiter, gewinnt an Umfang, bis dann der Vorgang beendet ist, bis sich die unterirdische Welt schließlich beruhigt hat.«
»Und wann?« Ich starrte wieder hinauf auf die Bergkuppe.
»Ja das …« Karl überlegte. »Ein Jahr, ein Monat, zwei Wochen, das kann man nicht sagen, ich bin ja auch kein Vulkangelehrter.«
»Zwei Wochen«, rief ich. »Karl, wir sitzen hier fest. Ich weiß nicht, ob die Faucon in zwei Wochen wieder schwimmt.«
»Naja, ich denke nicht wirklich, dass es schon in zwei Wochen losgeht. Man müsste sich mal im Krater umsehen.« Er deutete auf die Bergkuppe.
Ich schaute mich um. Fünfzig oder höchstens hundert Yards voraus stieg der Berg bereits sehr steil an. Wir hatten keine Möglichkeit dort hinauf zu gelangen. Karl schien meine Gedanken erraten zu haben.
»Wir gehen um den Kegel herum. Bestimmt gibt es auf der anderen Seite einen Einbruch. Dort ist es einfacher, an den Kraterrand zu gelangen.«
Und so machten wir uns auf den Weg, Karl voran, Philippe, Tamme und ich hinterher. Philippe bückte sich mehrmals, sammelte Steine ein, die er in seine Jacke wickelte. Langsam wurde es auch von oben warm, die Wolkendecke hatte aufgerissen, die Sonne brannte auf uns nieder und erhitzte den dunklen, fast schwarzen Boden unter unseren Füßen noch mehr. Jetzt war deutlich zu sehen, wie die Steine an einigen Stellen glitzerten, die Lavaschmelze war zu glasartigen Strukturen erstarrt.
Tamme trug den großen Wasserschlauch. Bei einer kurzen Pause tranken wir alle, entledigten uns weiter unserer Jacken und Blusen und krempelten uns die Ärmel auf. Es wurde mit der Zeit anstrengend, zumal der Weg wieder anstieg. Wir erreichten ein Steingebilde, das es zu überklettern galt. Karl suchte allerdings einen Weg daran vorbei und fand auch einen Durchschlupf. Wir folgten ihm. Es war eine enge Spalte, die sich aber nach wenigen Yards wieder öffnete. Und schon lag eine Rinne vor uns.
Wir befanden uns am Nordufer der Insel. Tatsächlich war der Berg, der Vulkankegel, an dieser Seite eingebrochen. Die Rinne stieg zwar ebenfalls an, doch nur sehr leicht und war somit einfach zu begehen. Jetzt sahen wir auch wieder den Rauch, der am Ende der Rinne aufstieg. Es qualmte regelrecht. Der Wind, der die Vulkanwand hinunter wehte, drückte den Rauch nieder und verwirbelte ihn.
Wir machten uns auf den Weg zum Krater. Die Rinne mochte fünfzig, sechzig Yards breit sein. Ihr Boden war zerklüfteter als der Boden auf der Westflanke des Vulkans. Als wir schon ein Stück geschafft hatten, wehte uns unvermittelt der Rauch entgegen, hüllte uns kurz ein und zwang uns zum Husten. Es roch nach etwas Verbrannten, das ich nicht einordnen konnte. Und schon schlug uns ein fauliger Schwefelgeruch entgegen. Die Abwinde befreiten uns aber schnell wieder.
Dann bemerkte ich, wie eine Hitze von unten aufstieg. Ich bückte mich, legte die flache Hand auf den Boden und erschrak. Es war beachtlich heiß. Karl hatte dies auch entdeckt und lotste uns an den Rand der Rinne, wo die Bodenhitze deutlich abnahm. Wir gingen weiter, noch gut zweihundert Yards und erreichten endlich den zerklüfteten Kraterrand.
Der Blick hinein ergab zunächst ein harmloses Bild. Scharfe Felsen, Risse, Spalten, der aufsteigende Rauch, der immer wieder verwirbelt wurde. Ich spürte plötzlich, wie mir der Schweiß über das Gesicht lief. Ich wischte mir mit der Hand über die Stirn. Meine Haut war sehr warm und sofort erkannte ich, dass die Hitze aus dem Kraterboden emporstieg und uns einhüllte. Ich trat zwei Schritte zurück und sofort wurde es kühler.
Karl hatte ein paar Steine aufgesammelt, aber nicht, um sie zurück zum Schiff mitzunehmen. Er schleuderte einen faustgroßen Brocken hinein in den Krater, dessen Grund nicht mehr als fünfzig Yards unter uns lag. Ich beobachtete die Flugbahn des Steines genau, er prallte auf, sprang aber nicht wie erwartet wieder in die Höhe, sondern büßte überraschend schnell von seiner Geschwindigkeit ein. Ein zweiter Stein aus Karls Hand flog hinab, der gleiche Effekt war auszumachen.
Das reichte Karl aber noch nicht. Er machte sich schon an einem dicken Brocken zu schaffen, den er niemals aufzuheben vermochte, weshalb er ihn auch zum Rand des Kraters rollte. Philippe und Tamme halfen ihm und schon kullerte das Ding die innere Kraterwand hinunter, löste einige kleinere Steine und prallte schließlich auf die untere Ebene auf. Augenblicklich verlor er jedwede Bewegung, schien in den Boden einzusacken.
»Das habe ich mir gedacht«, kommentierte Karl sein Experiment. »Das da unten ist noch gar nicht vollständig erstarrt. Wahrscheinlich brodelt es noch in der Tiefe. Deshalb ja auch der Rauch und der Gestank und die Hitze. Wer weiß, wann diese Insel das Licht der Welt erblickt hat und ich fürchte, ihre Geburt ist noch nicht abgeschlossen. Das ist jetzt der Beweis.«
»Und was bedeutet das für uns?«, fragte ich.
»Wir sollten die Faucon so schnell wie möglich wieder flottbekommen. Und dann bitte ich darum, dass wir noch einige Zeit in der Nähe segeln. Vielleicht wird uns ja das große Glück zuteil, einen veritablen Vulkanausbruch zu erleben.«
Mir wurde es am Kraterrand mittlerweile zu heiß. Wir machten uns sofort auf den Rückweg. Karl hatte so begeistert über einen Vulkanausbruch gesprochen, mir konnte das nicht gefallen. Es schien ja bereits im Krater zu brodeln, wir saßen auf einem Pulverfass fest. Zwei Stunden später versammelte ich Karl, Jörgen und Björn in meiner Kajüte. Victor kam ebenfalls dazu, weil er jetzt der wichtigste Mann war.
»Was ist, wenn es heute Nacht losgeht?«, fragte Jörgen.
Karl schüttelte den Kopf. »Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe schon einiges über Vulkane gelesen. Es gibt Vorzeichen, die ich noch nicht sehe.«
»Was für Vorzeichen?«
»Eruptionsbeben«, erklärte Karl. »In einem Vulkan tief in der Erde ist es so heiß, dass das Gestein schmilzt, es wird zu einer zähen Masse, die wie Wasserdampf in einer Röhre aufsteigen will. Nun ist Wasserdampf geschmeidig, während geschmolzenes Gestein zäh ist, sich reibt. Dies führt zu Beben an der Erdoberfläche, das würden wir …«
Karl stockte, wir alle verharrten, denn so unheimlich es klingt, kaum hatte er es ausgesprochen, ging ein Zittern durch das Schiff. Es war nicht wie das Auftreffen einer schweren See, es war wie sehr schnelles, mechanisches Zittern, wie von einem unruhig laufenden Rad. Es dauerte nicht mehr als zehn Sekunden.
»Das kennen wir schon«, sagte Björn und Victor stimmte ihm zu. »Zunächst hatten wir Angst, der Rumpf würde sich bewegen.«
»Ich kenne das nicht«, rief Jörgen. »Warum hat man mir nicht Bescheid gesagt?«
»Weil du den ganzen Tag in deiner Hängematte gelegen hast, da bekommt man dieses feine Zittern nicht mit, obwohl es diesmal etwas heftiger war, als die Male zuvor.«
»Karl, jetzt sag nicht, der Vulkan bricht bereits aus?«, fragte ich.
»Das kann ich doch nicht vorhersagen. Ich habe so etwas doch auch noch nie am eigenen Leibe erlebt, nur darüber gelesen habe ich. Der Ausbruch kündigt sich mit Beben an, aber wie heftig diese Beben sein müssen, bevor es losgeht, kann ich nun wirklich nicht abschätzen.«
»Ich bin mal mit einem gefahren«, sagte Björn, »der hat in der Karibik einen Vulkanausbruch erlebt, da gab es vorher keine Anzeichen, das ging ganz unvermittelt los, hat er behauptet. Die Einheimischen wussten zwar, dass ihr Berg unheimlich ist, geahnt hat da aber keiner was.«
»Wir werden es schon rechtzeitig merken«, versuchte Karl zu beschwichtigen. »Und wenn es losgeht, wird es uns nicht so schnell treffen. Falk, du hast doch selbst gesehen, dass der Vulkan bereits einen Abfluss hat. Wenn er Lava ausspuckt, dann fließt die an der anderen Inselseite ab.«
Unheimlich! Das Wort unheimlich beschrieb es sehr genau. Die Insel, der Berg, erschienen mir wie eine unberechenbare Bestie. Mein Schiff war ein Wrack, wir konnten auf ihm nicht entkommen, nicht sofort. Und dann dieses Zittern der Felsen. Ich begann genau darauf zu achten, versuchte mir Regelmäßigkeiten einzuprägen, kannte auch nach zwei Tagen keine Gewöhnung an das Phänomen, wie es offensichtlich meine Leidensgenossen schafften, die weiterhin ihrer Arbeit nachgingen. Ich konnte nicht viel tun, Victor hatte das Kommando. Überall um mich herum wurde gesägt und gehämmert.
Anfangs ging ich jede Stunde hin, um mir den Fortschritt anzusehen, dann beschäftigten mich meine eigenen Planungen. Was würde passieren, wenn wir die Faucon nicht rechtzeitig wiederherstellten, wenn wir es nicht schafften, sie seetüchtig zu machen? Wir hatten die Barkasse und die Jolle. Das kleinere Segelboot fasste höchstens sieben Mann, so dass die Barkasse für siebzehn Mann reichen musste. Für Gepäck und Ausrüstung blieb nicht viel Platz. Ich überlegte, kein Gepäck, ausschließlich nützliche Dinge, wie Essbares und Wasser mitzunehmen.
Aber wir benötigten auch Segel und Ersatzsegel, mindestens drei Paar Ruder je Boot. Und den Sextanten und Werkzeug, vielleicht doch etwas Kleidung, falls die Männer nass wurden, sich umziehen mussten. Andererseits konnten sie auch nackt warten, bis ihre Sachen wieder trocken waren. Die Witterung war nicht kalt in diesen Breiten. Wir konnten also auf Kleidung verzichten. Was fehlte noch? Ich begann eine Liste anzufertigen. Angelgerät, falls uns die Nahrung ausgehen sollte, Töpfe und Gefäße zum Auffangen des Regenwassers, falls es notwendig war unser Trinkwasser aufzufüllen.
Am Ende rief ich Björn und Jörgen zu mir, um ihnen meinen Plan mitzuteilen. Ich wollte die Barkasse und die Jolle bereithalten für den Notfall. Die Boote sollten beladen werden, so dass wir nur noch einsteigen mussten. Björn war davon überzeugt, dass die Faucon bald wieder schwimmen würde. Wir holten Victor und Karl in unsere Konferenz. Karl wollte seine Notizen mitnehmen, was ich sofort verbot. Dann die Frage, wie lange die Reparatur noch dauern würde.
Victor hatte offenbar ein Stück seines Optimismus verloren, er zögerte. »Es ist doch mehr am Rumpf zu Bruch gegangen, als ich vermutet habe. Die Struktur, ich bin mir nicht sicher, ob die Struktur hält. Der Kiel muss stabilisiert werden, sicher ist sicher. Wir brauchen dazu mehr Holz. Die Faucon wird danach über Deck nicht mehr so aussehen wie zuvor.«
»Ich habe es mir angesehen und rechne gerade die Stützbalken aus«, ergänzte Karl.
»Wie lange, wie lange braucht ihr noch?«, wiederholte ich. »Und vor allem, wie lange hält diese Insel noch?«
»Da sehe ich nicht so schwarz.« Karl überlegte, wie er es formulieren sollte. »Also, wenn hier alles noch viel heftiger wackelt, dann müssen wir uns Sorgen machen, dann würde es bald losgehen mit dem Ausbruch. Für unsere Arbeiten aber brauchen wir höchstens noch zehn Tage.«
»Zehn Tage, aber die sind sofort vorüber, sobald es hier so richtig wackelt.« Ich schüttelte den Kopf. »Können wir die Faucon nicht früher zum Schwimmen bringen und sie später vollständig seetüchtig machen, wenn wir einen größeren Abstand zur Insel haben?«
»Ich fürchte, genau das dauert zehn Tage«, druckste Victor. »Wir können die Reparatur am besten von außen vornehmen, das geht auf See ja nicht.«
»Zehn Tage, zehn Tage. Könnt ihr es nicht in sieben schaffen?«
Karl legte mir eine Hand auf den Arm. »Falk, wir haben alle ein gutes Gefühl, dass es uns gelingt, die Faucon zu reparieren. Im Notfall nehmen wir die beiden Boote. Wir sind also in jede Richtung abgesichert.«
3 Atlantik
.
.
Ich schämte mich etwas über die Unruhe, die ich verbreitete. In den nächsten Tagen versuchte ich daher mehr Gelassenheit auszustrahlen. Dann trat allerdings etwas ein, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Tamme und zwei seiner Kameraden hatten den großen Felsen erklommen und sahen von oben auf die Faucon herunter. Ein weiterer Matrose hatte den Fockmast geentert und unterhielt sich von dort mit den Dreien. Plötzlich hallte ein Ruf auf Deck nieder. Björn sprach mit dem Mann im Mast und eilte dann zu mir.
»Ein Segel am Horizont.«
Diese Nachricht verbreitete sich schnell an Bord. Björn, Karl und ich machten uns auf den Weg, erkletterten den Felsen und erreichten etwas außer Atem die drei Entdecker. Das Segel war mit bloßem Auge zu erkennen und als ich mein Utzschneider ansetzte, konnte ich bereits die Konturen des Rumpfes ausmachen. Angestrengt versuchte ich auch die Beflaggung zu erkennen, was mir aber noch nicht gelang.
»Der wird die Insel meiden«, sagte Björn, »der wird einen Bogen darum segeln.«
»Wir können Holz heraufbringen und ein Feuer machen«, schlug Tamme vor.
Ich schüttelte den Kopf. »Das ist zwar keine schlechte Idee, aber ein Feuer auf einem Vulkan wirkt doch wohl eher abschreckend. Ich würde dann jedenfalls Reißaus nehmen.«
»Wir haben doch Feuerwerk an Bord«, rief Tamme.
»Feuerwerk?«, wiederholte Björn, »davon wüsste ich aber.«
»Wir haben das früher selbst gebastelt«, fuhr Tamme fort. »Das ist ganz einfach. Wir haben doch ein Fass Kupferasche für Signalschüsse. Wir müssen es nur mit weniger Schwarzpulver mischen, als bei einem Kanonenschuss. Wir wickeln die Mischung in Papier ein, versehen das Ganze mit einer Lunte und stecken es auf einen Stock. Und schon haben wir blaues Feuerwerk.«
Ich sah Karl an, der kurz überlegte. »Haben wir tatsächlich Kupferasche an Bord?«
»Ja, tatsächlich ein ganzes Fass, ein kleines Fass«, bestätigte Björn.
»Also«, sagte Karl, »mit dem Schwarzpulver sollten wir sehr vorsichtig sein, die Menge muss genau abgewogen werden, ansonsten sprengt sich der Mann in die Luft, der die Lunte entzündet.«
»Dann sollten wir alles holen und hier nach oben bringen«, gab ich Befehl.
Und so geschah es auch. Karl und ich blieben auf dem Ausguck. Nach zwanzig Minuten kehrten Björn und die Matrosen zurück. Einer hatte das Fässchen mit der Kupferasche geschultert, ein zweiter trug einen abgefüllten Sack mit dem Pulver. Björn hatte ein paar Blatt Papier und ein Dutzend dünner Holzstäbe dabei, während Tamme die Lunten beisteuerte.
Ich sah noch einmal durch mein Fernrohr. Das Schiff am Horizont war nähergekommen, Tauwerk und Segel waren jetzt besser zu erkennen, boten aber einen merkwürdigen Anblick. Es sah fast so aus, als hingen einige der Tücher in Fetzen von den Rahen. Es gab nur zwei vollständige Segelflächen. Das Schiff schien ein-, zweimal zu schlingern.
Ich wurde wieder abgelenkt, weil meine Männer über die Mischung für die Raketen diskutierten. Karl setzte sich schließlich durch, rollte aus einem Stück Papier einen langen Zylinder, verdrehte den oberen Rand zu einer Spitze, die er mit einem Metalldraht fixierte. In das offene Ende des Zylinders gab er schließlich die Mischung, stopfte alles mit einem dickeren Stück Holz, platzierte die Lunte, die er ebenfalls mit einem Draht sicherte.
»Und das soll funktionieren?«, fragte ich. »Meine Congreve’schen Raketen sahen da aber etwas anders aus.«
»Das kann sein, aber wir wollen ja keinen Sprengkörper verschießen, sondern nur eine blaue Leuchtspur erzeugen.«
»Dann lasst mal sehen.«
Björn klemmte einen der Holzstäbe in eine Felsspalte. Karl setzte wieder den Draht ein und befestigte den Papierzylinder damit am Stab. Wir gingen alle ein Paar Schritte zurück, als Karl die Lunte entzündete. Er selbst eilte daraufhin zu uns und suchte sogar hinter meinem Rücken Deckung. Die Spannung stieg, wir sahen die glühende Lunte noch dicht am Papierzylinder, dann ein mäßig lauter Knall, eine blauschwarze Rauchwolke, die träge in der Luft hing und gleich sofort von der nächsten Windböe verwirbelt wurde. Der Holzstab klemmte noch immer in der Felsspalte, war aber an seinem anderen Ende etwas verkohlt.
»Vielleicht stimmt die Mischung nicht«, meinte Björn.
Karl schüttelte den Kopf, machte sich aber sofort wieder an die Produktion einer zweiten Rakete. Das Blau war diesmal intensiver, aber das mit der Rakete funktionierte wieder nicht, es fehlte am richtigen Austritt der heißen Pulvergase. Der Papierzylinder explodierte einfach nur und gab keinen Vorschub, so wie ich es bei der Congreve’schen Rakete mit ihrem Metallkorpus erreicht hatte. Ich gab Karl einen dritten Versuch, der ebenfalls erfolglos blieb, und fällte dann eine Entscheidung. Mit dem Utzschneider suchte ich das herannahende Schiff, das seinen Kurs gehalten hatte. Es war in keinem guten Zustand, soweit ich dies aus der Entfernung beurteilen konnte. Wahrscheinlich war es ebenfalls in den großen Sturm geraten, der uns selbst auf diese Insel geworfen hatte.
»Wir nehmen die Jolle und fahren ihr entgegen?«, rief ich und hatte mich schon in Bewegung gesetzt, den Abstieg zurück zur Faucon zu unternehmen.
Karl und Tamme blieben noch kurze Zeit zurück. Sie akzeptierten nicht, dass ihre Rakete ein Misserfolg war. Ich gab Befehl, die Jolle zu bemannen und bevor wir ablegten, sprang auch Karl mit an Bord. Wir fuhren hinaus, entfernten uns zwei Meilen von der Insel und begannen zu Kreuzen. Mit dem Fernrohr fand ich das Schiff zunächst nicht. Die Jolle hatte keinen so stabilen Mast, als dass man ihn als Ausguck erklimmen konnte.
Dann aber sah ich die Gischt am Bug. Sie hatten etwas Ruder gegeben und näherten sich damit unserer Insel sogar an. Wir hielten unseren Kurs und preschten auf sie zu. Ich klammerte mich an unseren Mast und begleitete das Manöver mit dem Fernrohr im Anschlag. Ich konnte kaum Besatzung auf dem fremden Schiff ausmachen. In den Rahen hing niemand, obwohl die Segel längst hätten gerafft werden müssen, denn der Wind hatte deutlich zugenommen. Dies hatte für uns Vorteile und so kamen wir schnell näher.
Mich wunderte, dass man uns noch nicht entdeckt hatte. Am Ruder standen zwei Mann, die aber nicht nach uns sahen. Björn hatte unsere Sprechtrompete zur Hand und rief das fremde Schiff an. Wir kreuzten noch zwei Mal vor ihrem Bug und gingen dann Breitseite an Breitseite. Erst jetzt tauchte jemand an der Reling auf und gestikulierte wild. Björn benutzte weiterhin die Sprechtrompete und wir sahen, dass der Mann an der Reling verstanden hatte. Ein zweiter Mann tauchte auf und hatte jetzt ebenfalls ein Gerät zur Sprachverstärkung in der Hand.
Er benutzte es, aber wir verstanden nichts. Und wir sahen, wie es den Mann anstrengte zu sprechen. Er setzte erneut an und diesmal gelang es ihm besser. Dennoch waren es mehr abgehackte Worte, unterbrochen von sekundenlangen Erholungspausen. Karl brachte es schließlich auf den Punkt.
»Verdammt, die haben das Fieber an Bord.«
»Das Fieber?«, wiederholte ich. »Sag ihnen doch, dass du Arzt bist.«
Karl sah mich an. »Ich fürchte, es ist etwas Ernsteres als das Fieber. Schau dir die Leute da vorne genauer an. Und ich denke, sie wissen es selbst.«
»Was wissen sie selbst?« Ich verstand nicht.
»Es ist die Pest«, rief Björn plötzlich.
Karl nickte. »Arme Teufel.«
Björn hatte bereits die Pinne in der Hand und wir drifteten vom Rumpf des fremden Schiffes weg, blieben aber noch auf gleicher Höhe. Für den Moment war ich ratlos. Die Hoffnung hatte sich zerschlagen, Hilfe zu bekommen. Ich dachte darüber nach, was ich von der Pest wusste. Es waren nur Schauergeschichten aus längst vergangenen Zeitaltern. Später sollte mich Karl weiter aufklären. In Europa schien die Krankheit besiegt, letzte Pestilenzen gab es im vorherigen Jahrhundert in vielen Ländern und auch in meiner Heimat und sogar im fernen Moskau. Über den Verlauf der Krankheit selbst wusste Karl nicht viel, was mit ein Grund dafür war, dass wir uns nicht erlauben konnten, der Besatzung des fremden Schiffes zu helfen.
Genau dies machte mich nachdenklich. Vielleicht gab es doch Rettung, vielleicht war die Krankheit heilbar, man musste es nur versuchen. Karl wetterte dagegen und ich musste ihm schließlich glauben. Aber auch die Kranken selbst hatten sich offenbar schon aufgegeben. Wir riskierten weiteren Kontakt aus der Ferne, boten Lebensmittel und Wasser an und ein Schmerzmedikament, dass Karl hergestellt hatte. Das fremde Schiff blieb in der Nähe, wir setzten Fässer mit unseren Gaben aus, die sich die Mannschaft angelte. Mehr war nicht möglich.
Am nächsten Morgen wollten wir erneut nach dem Befinden der Mannschafft fragen, aber das Schiff war fort. Erleichterung bei meinen Leuten, ein gemischtes Gefühl bei mir. Es war bereits später Nachmittag an diesem Tag, als Rauchschwaden über die Insel zogen. Wir befürchteten ein Rumoren des Vulkans, obwohl wir kein Beben spürten, das eigentlich zu erwarten war. Daher bestiegen wir die Jolle und segelten zur Erkundigung der Ursache um die Insel herum.
Da lag das Unglücksschiff, war schon fast niedergebrannt, schwamm nur noch auf den Resten seines Rumpfes. Das helle, starke Feuer fand aber weiterhin Nahrung. Ich konnte nur hoffen, dass es die Besatzung schon hinter sich hatte und dass der Tod Erlösung war. Wir blieben eine ganze Stunde, bist alle Reste vom Ozean verschluckt waren. Eine kleine, wabernde Rauchwolke, dann nichts mehr. Zurück auf der Faucon ging noch zwei Tage die Angst um, dass wir uns ebenfalls angesteckt haben könnten. So mussten wir die eine Hoffnung auf Rettung fahren lassen, um uns auf die nächste vorzubereiten.
*
Victor gab zweimal am Tag Bericht, während Karl schon an dem Problem tüftelte, die Faucon von den Felsen zu bekommen, auf denen der Rumpf auflag. Unsere Insel kannte keinerlei Tide. Das Meer lag gut zwei Fuß unterhalb der Felsen. Seit Ende des Sturms gab es zwar oft Wellen, die hochschwappten, aber niemals unseren Rumpf umspülten, noch in der Lage waren, ihn zu heben. Jörgen kam mit der Idee, das Schwarzpulver einzusetzen und wenigstens den Felsengrund zu schwächen, damit das Gewicht der Faucon die dann übriggebliebenen Reste selbst wegdrückte, um so ins Meer zu rutschen. Ein riskanter Plan, den ansonsten niemand gutheißen konnte, obwohl ich mir noch einmal alles genau erklären ließ.
Björn begann schließlich das Wetter zu beobachten und meinte, dass wir ohnehin Sturmsaison hätten. Ein Unwetter, wie jenes, dass uns in die missliche Lage gebracht hatte, konnte durchaus in den nächsten zwei oder drei Wochen erneut auftreten. Mir schien die Wetterlage dagegen zu gut zu sein. Es war relativ windstill, es gab kaum Wolken am Himmel und die Sonne brannte vom Morgen bis in den Abend auf uns nieder. Aber gerade dies sollte laut Björn das Zeichen für einen Wetterumschwung sein.
Derweil hatte Karl alles Material zum Bau von Flaschenzügen zusammengesucht und sich auch von unserem Tauwerk entsprechende Längen ausgesucht. Da einer unsere Masten nicht mehr taugte, stand ihm die gesamte Takelage zur Verfügung. Victor wurde jedoch unruhig, als Karl begann, seine Seile zu spannen, denn der Rumpf der Faucon war längst noch nicht seetüchtig.
Das Treiben der Mannschaft hatte aber dafür einen großen Vorteil, alle waren beschäftigt. Dennoch sollte sich schließlich der Einsatz von Schwarzpulver, die Hoffnung auf schlechtes Wetter oder die Konstruktion raffiniert kombinierter Flaschenzüge erübrigen. Die Insel selbst wollte uns nämlich loswerden. Wir hatten uns längst an die kleinen Beben gewöhnt und nahmen auch den leichten Schwefelgeruch, der allgegenwärtig in der Luft hing, nicht mehr wahr. Wir waren Teil dieses Naturereignisses geworden und es hätte noch Wochen und Monate so weitergehen können, wenn der Vulkan nicht einen anderen Plan für uns gehabt hätte.
In der Nacht, gut vierzehn Tage nach der ungewollten Strandung, prasselte eine Art Hagel auf unser Deck. Ich war der Letzte, der hinzukam. Im Licht der Laternen war ein feiner Gries aus Gestein zu sehen und eine schmierig schwarze Schicht, die alles bedeckte. Karl strich mit der Hand über die Reling, zerrieb den aufgenommenen Belag zwischen den Fingern und roch daran.
»Das ist Asche, Vulkanasche.«
Kaum hatte er dies ausgesprochen, begann der Ascheregen erneut. Wir wichen zurück, wollten dem Material entgehen, was aber nicht gelang. Karl streckte den Kopf in die Höhe und roch in den Ascheregen hinein, bis er zu husten begann.
»Das kommt aus dem Inneren der Erde. Ich wette, auf der anderen Seite der Insel speit der Krater jetzt Lava aus. Wir müssten mal hinaufsteigen und schauen, ob wir das Glimmen sehen können.«
»Es leuchtet doch schon«, rief Tamme und zeigte in den Himmel über der Felswand.