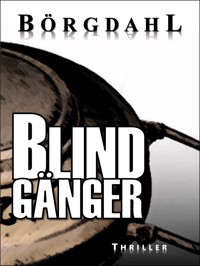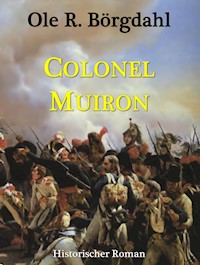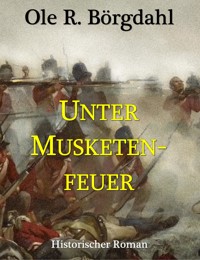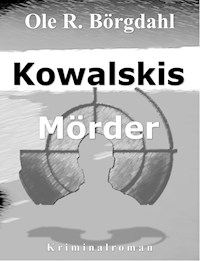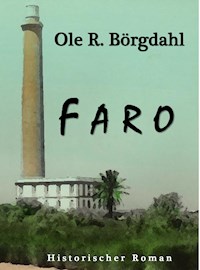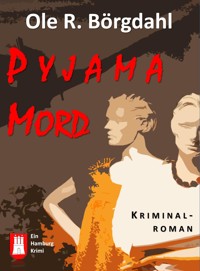Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer ist das kleine Mädchen mit dem Sonnenhut, woher stammt das geheimnisvolle Gemälde, wurde es wirklich von einem Jahrhundertgenie erschaffen? Das Kunst- und Auktionshaus Blammer in München übernimmt den Auftrag zur Versteigerung, doch es ist schwerer als gedacht. Alle Indizien sprechen für die Echtheit des Gemäldes, aber es gibt einfach keinen Herkunftsnachweis, es gibt keine Spur von dem Bild hin zu dem großen Meister. Der Rechtsanwalt Georg Staffa macht sich auf die Suche. Seine Recherche führt ihn bald aus Europa in eine Welt, die er vorher nicht kannte, führt ihn fort von dem Gemälde, hin zu Menschen, deren Geschichte und Schicksal der Schlüssel zu dem Geheimnis ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ole R. Börgdahl
Fälschung
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Buch
Prolog
Das Bild
Nuku Hiva
Der Auftrag
Die Recherche
Wohin die Spuren führen
In der Südsee
Julie
Der Herkunftsnachweis
Fälschung
Mit der Kunst am Ende
Epilog
Impressum neobooks
Das Buch
.
Fälschung
.
Wer ist das kleine Mädchen mit dem Sonnenhut, woher stammt das geheimnisvolle Gemälde, wurde es wirklich von einem Jahrhundertgenie erschaffen? Das Kunst- und Auktionshaus Blammer in München übernimmt den Auftrag zur Versteigerung, doch es ist schwerer als gedacht. Alle Indizien sprechen für die Echtheit des Gemäldes, aber es gibt einfach keinen Herkunftsnachweis, es gibt keine Spur von dem Bild hin zu dem großen Meister. Der Rechtsanwalt Georg Staffa macht sich auf die Suche. Seine Recherche führt ihn bald aus Europa in eine Welt, die er vorher nicht kannte, führt ihn fort von dem Gemälde, hin zu Menschen, deren Geschichte und Schicksal der Schlüssel zu dem Geheimnis ist.
Prolog
.
.
Er saß hoch oben auf seiner Veranda und aß Brei aus einer Schüssel. Seine helle Hose war schmutzig und voller Flecken, sein Hemd hatte Schweißränder, sein Gesicht sah frisch aus, seine Haare waren noch nass. Er war erst vor wenigen Minuten von dem kleinen Teich gekommen. Er war geschwommen, vorsichtig. Es war eine Wohltat, auch gegen die Hitze des Tages.
Sie ging zu Fuß über den ausgetretenen Pfad, der von der Straße kam. Sie musste aufpassen, dass sie mit ihrem Kleid nicht im Gestrüpp hängenblieb. Sie trug das braune Kleid, in dem er sie schon am Strand gesehen hatte. Ihre dunkelblonden Haare waren hochgesteckt, von einer silbernen Spange gehalten. Einige Strähnen hatte sie nicht bändigen können, sie hingen ihr wirr vor der Stirn. Ihren Hut hatte sie abgenommen. Dennoch war ihr Gesicht blass, als wenn sie sich immer sorgfältig vor der Sonne schützte. Den Hut hielt sie in der rechten Hand und wedelte sich damit Luft zu.
Er beobachtete sie, wie sie auf jeden Schritt achtete. Sie hatten schon öfter miteinander gesprochen, natürlich am Strand und auch einmal in der Siedlung, vor der Polizeistation. Sie hatte sein Haus fast erreicht. Er stellte die Schüssel auf den Boden und erhob sich von seinem selbstgeschnitzten Hocker. Sie blieb stehen, blickte nach oben und lächelte. Dann sah sie sich um. Hinter Bäumen wurden weitere Häuser sichtbar, Schweine durchwühlten das Erdreich, Hühner scharrten in der Nähe. Es roch nach Erde und nach Vieh. Der Boden war feucht. Es war hier anders als in der Siedlung, die eigentlich keine Siedlung mehr war, sondern immer mehr zur Stadt wurde. Unter ihren Schuhen bildete sich eine kleine Pfütze. In der Nacht hatte es wieder stark geregnet.
»Bonjour, Madame. Wie geht es den Ihren?«, sagte er und bot ihr mit einer Handbewegung an, auf die Veranda zu kommen.
Sein Haus war auf ein langes, schmales Podest gesetzt, das gut fünf Fuß über dem Boden schwebte. Unter dem Podest gab es einen Verschlag, in dem ein Karren stand. Sie zögerte kurz, trat dann aber doch an die steile Treppe, die hinauf zur Veranda führte. Sie hatte keine Mühe mit den schlecht gearbeiteten Stufen. Oben angekommen blickte sie sich noch einmal um. Hinter der Veranda schloss sich eine Hütte an. Sie blickte nur kurz hinüber. Er lächelte verlegen, drehte sich um und ging vorsichtig ein paar Schritte, um einen zweiten Hocker zu holen, der in einer Ecke der Veranda stand. Er humpelte wieder etwas stärker als sonst. Sie sah auf seinen verletzten Fuß, der mit einem schmutzigen Stück Stoff verbunden war. Er bot ihr den Hocker an, aber sie schüttelte den Kopf.
»Wie lange haben Sie das schon? Ich kenne Sie gar nicht ohne diesen Verband.«
»Es ist eine Geschichte, die ich Ihnen nicht erzählen kann«, sagte er bedächtig. »Es hat sich in den Kreisen zugetragen, in denen Sie nicht verkehren, Madame. Entschuldigen Sie, wenn ich nicht darüber spreche.«
Sie nickte. »Warum lassen Sie Ihre Verletzung nicht im Hospital versorgen?«
»Danke für Ihr Mitgefühl. Ich bin schon öfter Gast bei den Herren und Damen der Kirche gewesen, doch momentan, wie soll ich es sagen, haben wir eine kleine Meinungsverschiedenheit, nichts Bedeutendes, das Übliche, wenn man mit einem Menschen wie mir zu tun hat.«
»Ich kenne nur die Geschichte mit Claverie, mit ihm haben Sie doch Schwierigkeiten, dachte ich.«
»Schwierigkeiten mit Claverie.« Er lachte. »Ich glaube es ist ein Spiel. Ich spiele mit Claverie und er spielt mit mir, obwohl ich sagen muss, dass es mir manches Mal wehtut, wo es ihn einfach nur zu ärgern scheint, den Herrn Polizeiunteroffizier.«
»Ich hörte aber, Sie setzen sich für die Menschen hier ein, obwohl ich es damit wohl beschönige. Sie wiegeln die Leute gegen die Obrigkeit auf. Die Kinder sollen nicht mehr in die Missionsschulen gehen und Claverie wird von Ihnen lächerlich gemacht, ist seine Reaktion da nicht verständlich?«
»Verständlich, wer versteht mich denn, oder die Menschen hier. Wir befinden uns nicht mehr im Mittelalter. Es muss keine Rasse mehr unterjocht oder bevormundet werden. Wenn dies hier einmal Frankreich ist, dann sind es französische Bürger, die hier vor ein Gericht gezerrt werden, wegen moralischer Nichtigkeiten. Natürlich kämpfe ich dagegen, aber Claverie, mit dem ist es noch wieder anders, denke ich. Er hält mich eben für unbequem und obszön, wie wohl die meisten, der so genannten zivilisierten Leute hier.«
»Obszön«, wiederholte sie. »So, meinen Sie. Das war mir noch gar nicht zu Ohren gekommen.«
»Es ist aber so, zumindest sagen das die Leute, die mich zu kennen glauben. Darum freue ich mich zwar, dass Sie mich besuchen, Madame, ich möchte Sie aber auch warnen, Ihres Rufes wegen.«
»Das ist mir egal«, lachte sie. »Es wird mir nicht mehr lange nachhängen, wenn überhaupt.« Sie machte eine kurze Pause. »Wir werden in ein paar Wochen nach Tahiti zurückkehren«, sagte sie dann mit fröhlicher Stimme.
»Oh, das ist schade, Madame, auch Ihres Mannes wegen. Ich habe mich immer gut mit ihm vertragen, wie überhaupt mit allen Militärangehörigen hier auf der Insel, Sie waren immer mehr auf meiner Seite, sie sind mir näher als die Gendarmen, als die Pfaffen, als all diese moralischen Leute.«
»Warum bleiben Sie dann hier«, sie sah wieder auf seinen bandagierten Fuß. »Auf Tahiti würden Sie auch besser versorgt als in diesem tropischen Klima.«
Er zögerte, wollte etwas sagen, schwieg dann aber doch.
»Noch besser würde Ihnen aber Frankreich bekommen«, erwiderte sie in das Schweigen.
Sie sahen sich sekundenlang an, dann setzte er sich langsam auf seinen Hocker. »Es ist schon mein achtes Jahr in diesem Teil der Welt. Nicht, dass mir die Zeit schwer wiegt, aber ich hatte bereits den Gedanken fortzugehen, nach Frankreich, wie Sie es vorschlagen.«
Sie sah noch einmal hinunter auf seinen Fuß und dann wieder in sein Gesicht. »Es wäre wirklich besser für Sie, ich meine Frankreich oder aber ein europäisches Klima.«
»Man hat mich beschworen, es nicht zu tun«, sagte er nachdenklich. »Man gab mir zu verstehen, es sei gut, dass ich von der Welt verschwunden bin und dass ich dadurch die Unantastbarkeit der großen Toten besäße. Man hat mich beschworen und es hat mich ermutigt, auszuharren.«
Sie sah ihn noch eindringlicher an. »Wer hat Ihnen diesen falschen Rat gegeben?«
»Es war mehr als ein Rat«, antwortete er euphorisch. »Sehen Sie mich an, ich gelte in Frankreich bereits als Vergessener, als Mythos, können Sie sich das vorstellen, ich ein Mythos. Fragen Sie die Leute aus dem Dorf, sie wissen nicht einmal, was das ist, ein Mythos, sie kennen nur ihre Götter und ein Gott bin ich wahrlich nicht. Ich bekäme auch noch weit mehr Ärger mit den Pfaffen, wenn ich die Schäflein überzeugte, ich wäre einer.«
»Wenn es so ist, wenn es Ihre Entscheidung ist, dann will ich Ihnen nicht auch noch einen Rat geben, wenn ich es nicht schon getan habe.«
»Danke Madame, ich danke Ihnen, ich danke Ihnen für Ihren Rat und Ihre Fürsorge, einem alten Wilden gegenüber.« Er zögerte. »Aber nun bin ich begierig zu erfahren, was Sie zu mir führt, was kann ich nun für Sie tun, Madame. Ich glaube nicht, dass Sie gekommen sind, um sich von mir zu verabschieden, auch wenn ich es sehr anständig von Ihnen fände.«
Sie nahm jetzt doch auf dem Hocker Platz, den er ihr angeboten hatte. »Ich habe meiner Cousine nach Paris geschrieben und nach Ihnen gefragt. In Paris kennt man Sie.«
Er blickte sie an, als wenn es ihm gleichgültig sei, sagte aber nichts darauf.
»Sie haben Eindruck hinterlassen«, berichtete sie weiter. »Aber davon konnten Sie dort wohl nicht leben. Ich hörte auch, dass Sie in Staatsdiensten hierhergekommen sind.«
Jetzt wurde er aufmerksam, er lächelte. »So, dann kennen Sie mich doch ganz gut. Das mit dem Staatsdienst war einer meiner Irrtümer und es ist schon so lange her. Außerdem war das auf meiner ersten Reise. Ich bin noch einmal wieder nach Paris zurückgekehrt, um endgültig einen Schlussstrich zu ziehen und auch weil ich von dem, was Ihre werte Cousine zu wissen glaubt, damals nicht viel gespürt habe. Es war eher ein Fiasko, das ich vergessen möchte, weil es einem Mann wie mir eigentlich nichts bedeuten sollte.« Er zögerte erneut. »Ich hoffe ich langweile Sie nicht mit meinen Lebensbeichten?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nein«, sagte sie schnell. »Sie stammen doch auch aus Paris, das interessiert mich.«
»Da muss ich Sie enttäuschen Madame. Ich bin zwar in Paris geboren, aber ich bin kein Kind dieser Stadt. Meine ersten Windeln wurden zwar noch in Paris gewechselt, aber dann wurde ich mitgenommen, hinaus in die Welt, nach Südamerika, nach Peru.«
Sie sah ihn erstaunt an. »Dann waren Sie schon immer ein Reisender und es ist weniger die Pflicht, die Sie hierher geführt hat.«
»Nein, ich bin ganz sicher kein Reisender, nicht so wie Sie es meinen, eher ein Flüchtender. Paris und Europa haben mir schon vor langer Zeit ein Stechen verursacht und ich habe das Gefühl, es geht langsam wieder los. Ich bin deswegen sogar hierher geflüchtet, aber es ist wie ein böser Geist, wie ein Gespenst, es folgt mir, fürchte ich.«
Sie starrte ihn an, als wenn sie ihn nicht verstanden hätte. »Wir sollten lieber über den Grund meines Kommens sprechen«, sagte sie schließlich.
Erst jetzt sah er, dass sie etwas mitgebracht hatte. Ihre Tasche hatte er vorher schon gesehen, aber nicht was sich darin befand. Sie holte beides hervor und packte es nacheinander aus. Das eine lehnte sie an einen Pfosten der Veranda, das andere behielt sie in der Hand. Er blickte abwechselnd zu ihr und zu dem Verandapfosten, als sähe er die Bilder das erste Mal.
»Ich glaube, ich kann erraten, was Sie von mir wollen«, sagte er bedächtig. »Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, es schnell fertigzubekommen. Ich brauche meine Zeit, jetzt mehr als früher.«
Sie schüttelte den Kopf. »Wir sind bestimmt noch einen Monat hier und dann können Sie es uns auch nachschicken, wenn Sie noch mehr Zeit benötigen.«
*
In den letzten drei Wochen hatte sie ihn mehrmals besucht, immer im Abstand von ein paar Tagen. Heute saß er konzentriert an einem krummen Holztisch auf seiner Veranda und schrieb etwas. Ein Stapel Papiere lag auf dem Tisch, beschwert mit einem Stein, gegen den leichten Wind, der vom Meer her kam. Das Blatt, auf dem er etwas notierte, war eng beschrieben und kräuselte sich bereits.
Sie stieg wieder hinauf auf die Veranda. »Was schreiben Sie da?«, fragte sie neugierig.
Er hatte ihr Kommen diesmal nicht bemerkt, hob überrascht den Kopf und sah sie an. »Sie haben mir neuen Schwung gegeben, Madame«, sagte er zögerlich. »Von dem Geld, das ich schon von Ihnen bekommen habe, konnte ich neues Papier kaufen. Es war mir vor einem Monat ausgegangen.« Er überlegte und hielt dabei den Stift in die Höhe. »Ich hätte auch Feder und Tinte kaufen können, aber Graphit ist billiger und ich kann es auch für Ihren Auftrag verwenden.«
»Sie schreiben Briefe, vielleicht an Ihre Frau und die Kinder«, sagte sie und trat näher an den Tisch heran.
»Nein, bestimmt nicht, keine Briefe, keine solchen Briefe mehr, schon lange nicht mehr und ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich es nicht tue. Was ich schreibe, wird alle Briefe ersetzen, denke ich. Aber vielleicht wird es auch niemanden interessieren und meine Kinder werden es verachten und nicht lesen. Ich glaube ich schreibe es für mich selbst.«
»Sie haben Kinder?«, fragte sie, dann stutzte sie. »Natürlich, das Mädchen, die junge Frau, ich hörte es. Sie ist niedergekommen.«
»Nein, nein, oder doch«, sagte er hastig. »Natürlich ist es auch eines meiner Kinder, die ich genauso liebe, wie die anderen, aber ich meine mehr meine erwachsenen Kinder, die mich nicht mehr kennen, die nicht mehr wissen, was aus ihrem Vater geworden ist, die es auch nicht wissen wollen.« Er stutzte erneut. »Es nicht mehr wissen können, weil sie...«
»Entschuldigen Sie, ich wollte nicht...«, sagte sie und stockte.
»Es ist schon gut. Ich hatte eine erwachsene Tochter, darum war der Schmerz auch so groß.«
»Der Schmerz, was ist passiert, hat sie sich von Ihnen losgesagt?«
»Losgesagt«, wiederholte er. »Es war eine Krankheit. Aus meiner Kindheit habe ich in Erinnerung, dass schon meine Großmutter an einer Krankheit gestorben ist, an Typhus. Sie hieß Flora, sie war eine unbequeme Frau, so wie ich ein unbequemer Irrer bin. Es liegt wohl in der Familie, auch das mit der Krankheit. Ich hatte nie Gelegenheit, mir darüber eine eigene Meinung zu bilden. Ich habe meine Großmutter nämlich nicht gekannt, sie mich allerdings auch nicht, sie starb Jahre vor meiner Geburt. Die Tragödien wiederholen sich.«
»Und Ihre Tochter starb ebenfalls an Typhus, oder wollen Sie nicht darüber sprechen?«
»Ich kann über alles sprechen«, sagte er laut. »Ich habe den Schmerz besiegt. Es war kein Typhus, jeder hat seine eigene Krankheit. Es war Tuberkulose, so hat man es mir zumindest geschrieben. Es war ein kurzer Brief aus Dänemark, kennen Sie Dänemark?«
Sie nickte. »Dänemark«, wiederholte sie.
Sie schwiegen einige Zeit, dann sah sie auf den Stapel Papier. »Soll das ein Tagebuch werden?«
»Das ist gut erraten«, antwortete er. »Ja, es könnte so etwas wie ein Tagebuch sein. Es sind Erinnerungen. Wissen Sie, ich habe Abenteuer erlebt, noch in jungen Jahren, ich bin zur See gefahren, ich war auch beim Militär. Ich habe dann ein bürgerliches Leben geführt, habe gelitten und gehofft, bis heute und auch heute immer noch. Es kommt jetzt aus meiner Feder, oder besser gesagt aus diesem Grafit. Ich schreibe auch über das hier, ich glaube, Sie kommen auch darin vor, aber keine Angst, ich nenne ihren Namen nicht.«
»Darf ich es lesen?«, fragte sie und beugte sich schon über den Tisch.
Er zog das Blatt schnell an sich. »Entschuldigen Sie Madame, es ist nicht so gut und es ist noch nicht fertig und ich glaube, Sie kommen doch nicht darin vor.«
Er stand auf, nahm den Stein vom Papierstapel und schob das Blatt zu den anderen. Er wickelte eine Schnur um den Stapel und verschwand in seiner Hütte. Sie blieb zurück und sah ihm nach.
»Brauchen Sie noch Geld?«, fragte sie, als er schließlich wieder auf die Veranda zurückkehrte.
»Hundert Francs, bitte«, antwortete er sofort. »Oder besser hundertfünfzig?«
Sie überlegte. »Dann bekommen Sie am Ende aber nur noch fünfzig Francs von mir.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich brauche noch vier Wochen. Wollen Sie wieder nachschauen, wie weit ich bin?«
»Natürlich«, antwortete sie. »Es ist aber kein Misstrauen.«
»Ich weiß, Madame. Ich weiß es mittlerweile«, sagte er mit ruhiger, überlegter Stimme. »Kommen Sie bitte mit.«
Er stieg von der Veranda, so gut er es mit seinem Fuß vermochte und ging voran. Er konnte heute etwas besser laufen als sonst, aber er humpelte immer noch. Sie folgte ihm.
»Es ist heute ein schöner trockener Tag«, sagte er und drehte sich dabei zu ihr um. »Ich habe das gute Wetter genutzt, kommen Sie es steht dort auf der Lichtung.«
Es waren gut hundert Yards bis zur Lichtung, auf deren rechter Seite sich weit hinten das Meer öffnete.
»Ich habe heute Morgen daran gearbeitet. Es macht mir immer mehr Freude. Wissen Sie Madame, ich bin im letzten Jahr hierher geflüchtet. Das letzte Jahr war schwierig für mich. Ich habe mich mit meinem Schaffen hier noch nicht zurechtgefunden, auch fehlte mir das Geld. Mein Tatendrang ist zwar schon wieder erweckt, aber den richtigen Schwung haben nur Sie mir gegeben, mit Ihrem Auftrag. Ich bin jetzt viel euphorischer. Ich habe auch einige neue Vorschläge. Ich habe Sie ja vor meinen Ideen gewarnt, wenn ich erst einmal wieder in meinem Element bin.«
»Arbeiten Sie immer hier?«, fragte sie.
Sie sah sich um. Es war ein heller Platz. Er hatte sich neben das Gestell gehockt und verzog das Gesicht. Der Fuß schmerzte kurz, als er in die Knie ging. Er erhob sich schnell wieder.
»Und, was sagen Sie, entspricht es Ihren Vorstellungen? Hier am Rand, sehen Sie das.« Er zeigte auf mehrere Stellen.
Sie trat näher heran. »Schön, es ist in Ordnung, Sie können es so lassen«, bestätigte sie.
Er spürte, dass sie von dem, was er ihr zeigte, nicht sehr beeindruckt war. Sie interessierte sich nur für eines. Sie ging einige Schritte zurück und betrachtete sich das Werk. Sie flüsterte etwas, das er zwar nicht verstand, aber an ihren Lippenbewegungen erraten konnte.
»Vier Wochen sagten Sie?«
»Höchstens, Madame, Sie sehen ja selbst«, sagte er zufrieden.
»In zwei Wochen fahren wir zurück. Sie werden es mir also bestimmt nachschicken müssen.«
Sie zog einen Zettel aus ihrer Handtasche und suchte auch nach dem Geld darin. Sie gab ihm den Zettel und ein paar Franc-Scheine in die Hand.
Er sah sich die Adresse an. »Ich werde es fertigmachen, Madame, in drei oder vier Wochen.«
»Ich gebe Ihnen jetzt alles Geld, das wir vereinbart haben und noch ein wenig mehr, wenn Sie es noch verpacken.«
Er nickte und sah auf die Franc-Scheine und auf den Zettel.
*
Als sie die Insel verließen, hatte er am Rande der Bucht auf einem Stein gesessen und das Auslaufen des Schiffes beobachtet. Madame hatte ihn erkannt und einmal kurz zu ihm hinübergesehen. An diesem Tag blieb er noch eine gute Stunde auf seinem Stein sitzen, bevor er durch die Siedlung schritt. Er vermied es, an der Kapelle vorbeizugehen. In dem kleinen Laden war er seit einigen Wochen wieder ein gern gesehener Gast. Er kaufte fünf Graphitstifte und zwei Dutzend Blatt Papier. Das Schreibpapier hatte er mittlerweile aufgebraucht. Sie hatte ihm extra Geld für den Versand dagelassen. Es reichte für eine sorgfältige Verpackung. Er gönnte sich einen Besuch in der Taverne. Es war später Nachmittag, nicht zu früh für ein Glas.
Am nächsten Tag ging er nicht zur Taverne. Er saß am Nachmittag auf seinem Stein in der Bucht und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Er hatte festgestellt, dass es ihn inspirierte. In der Nähe des Anlegers spielten einige Kinder. Er dachte sofort an die beiden kleinen Mädchen. Er überlegte, welcher Tag war, welches Datum, aber es war nicht wichtig. Er sah mit geschlossenen Augen in die Sonne, die Wärme war herrlich. Er vergaß seine letzten Gedanken, er hatte neue Projekte. Er konnte wieder malen. Er malte den Strand mit Reitern, er malte die Menschen hier und er malte mystische Dinge voller symbolhafter Kraft. All das gab ihm neuen Schwung und dieser Schwung würde sich gegen etwas Verhasstes richten, etwas, das hier nicht hingehörte, hier in dieses Paradies, das schon keines mehr war. Er wollte sich auf die Seite der Unterdrückten, der Bevormundeten schlagen, wie er es schon des Öfteren getan hatte, immer zum Unwillen der Obrigkeit. In diesem Moment sah er aufs Meer hinaus. Er war nicht der Erste, der die Rauchsäule am Horizont entdeckt hatte. Die Post, dachte er, endlich.
Das Bild
.
.
Die Heizungen im Verwaltungsgebäude des Kunst- und Auktionshauses Blammer waren vollends aufgedreht. Es war immer noch sehr kalt draußen. Es hatte wenigstens nicht mehr geschneit. Der letzte Schnee war bereits Ende Februar geschmolzen. Es gab aber keine Garantie, dass sich in München jetzt langsam milderes Wetter durchsetzte. Simon Halter schaute auf den Kalender, der neben seinem Schreibtisch an der Wand hing.
»Heute ist der 16.«, sagte er zu Heinz Kühler, »dann haben wir ja noch die ganze Woche Zeit.« Er sah auf das untere Kalenderblatt und stutzte. »Was bedeutet denn diese kleine Zahl da vor dem Datum?«
Heinz Kühler trat neben seinen Chef und sah auf das Kalenderblatt. »Das ist ein Countdown. Es sind noch sechshundertsiebenundfünfzig Tage bis zum Millennium.«
»Millennium«, wiederholte Simon Halter gedehnt. »Wir haben doch erst 1998, wer denkt da schon an das Jahr 2000.« Er schüttelte den Kopf. Dann wandte er sich um und schaute noch einmal zu den Unterlagen auf dem Besprechungstisch. »Wir sollten das hier auf morgen verschieben«, sagte er schließlich.
Heinz Kühler nickte und schob die Blätter wieder zusammen, die auf dem Tisch verteilt lagen. Das Telefon klingelte. Simon stand auf und ging zu seinem Schreibtisch. Am Blinken des Apparates sah er, dass der Anruf aus dem Nebenraum, von seiner Sekretärin kam. Während er den Hörer abnahm, blickte er Heinz Kühler an, der sich ebenfalls von seinem Platz erhoben hatte. Die beiden Männer waren etwa gleich groß. Simon war aber deutlich kräftiger, was auch daran lag, dass Heinz Kühler sehr schlank war, ja beinahe hager wirkte.
»Bitte!«, rief Simon ins Telefon und versuchte dabei freundlich zu klingen.
»Ihre Frau ist gleich hier«, meldete sich seine Sekretärin. »Ihre Frau sagte etwas von Autoschlüssel tauschen.«
»Ach ja, danke Frau Hoischen, ich weiß Bescheid.« Simon legte den Hörer wieder auf die Gabel.
»Meine Frau«, sagte er zu Heinz Kühler, der schon in Richtung Bürotür gegangen war. »Sie holt heute Besuch vom Flughafen ab, darum tauschen wir die Wagen, hätten wir eigentlich auch schon heute Morgen machen können, aber, vergessen.« Er zuckte mit den Schultern.
Dann klopfte es, die Tür öffnete sich und Colette Halter betrat das Büro. »Bonjour, ich störe hoffentlich nicht?« Es geht auch ganz schnell, dann bin ich wieder fort.«
»Bonjour, Madame Halter, Comment allez-vous«, begrüßte Heinz Kühler die Frau seines Chefs.
Sie lächelte ihn an. »merci très bien et vous, Monsieur Kühler.«
»Oh, danke mir geht es gut, nur zu viel Arbeit, Sie kennen ja Ihren Mann«, lachte er.
Colette lächelte zurück und wandte sich dann ab. Sie ging ihrem Mann entgegen. Sie küssten sich auf die Wangen und Simon gab seiner Frau im Tausch die Schlüssel seines Wagens.
»Merci, au revoir«, bedankte sie sich, drehte sich um und verließ auch sofort wieder den Raum.
Die beiden Männer sahen ihr noch nach, bis die Tür ganz verschlossen war. Simon ging wieder zurück an seinen Schreibtisch und setzte sich in den Bürosessel.
»Irgendetwas wollte ich noch«, überlegte er laut. »Egal, vergessen, vielleicht fällt es mir später noch ein.«
Heinz Kühler nickte kommentarlos, ging zur Tür und verließ ebenfalls den Raum. Er beeilte sich. Insgeheim hoffte er, vielleicht doch noch ein paar Worte mit Colette Halter sprechen zu können, wenn sie noch im Vorzimmer war. Er sah sich im Büro um. Frau Hoischen saß an ihrem Platz. Sie beugte sich über ein Schriftstück, so dass ihr eine graue Haarsträhne ins Gesicht fiel. Von Colette Halter war nichts mehr zu sehen. Heinz Kühler verließ das Vorzimmer und ging auf den Flur hinaus. Er sah in Richtung Treppenhaus, aber auch hier war sie nicht mehr zu sehen. Schade, dachte er. Er ging in sein eigenes Büro und trat an eines der Fenster, die zur Straße hinausgingen. Simon Halters Kombi rangierte gerade auf dem Hof und fuhr Richtung Tor. Colette Halter hatte ihr Cabriolet dafür auf dem Parkplatz der Geschäftsführung zurückgelassen.
*
Florence Uzar hatte zwei anstrengende Wochen in Paris hinter sich. Es war eine Geschäftsreise, der Besuch eines Kongresses mit angeschlossener Messe. Bevor sie Europa wieder verließ, plante sie noch zwei Tage in München, bei einer Freundin zu verbringen. Über das Wochenende war sie aber noch in Paris geblieben. Am Montagvormittag startete sie vom Flughafen Charles-De-Gaulle in die bayrische Hauptstadt. Das erste Mal seit zwei Wochen hatte sie wieder ihr Gepäck bewegt, das zuvor träge in ihrem Pariser Hotelzimmer verstaut war. Der Taxifahrer zum Flughafen hatte ihr die Koffer noch auf einen Trolley geladen, den sie dann selbst zur Abfertigung schob. In der Schlange vor ihr stand ein junger Mann, der fast einen ganzen Kopf kleiner war als sie. Florence war stolz auf ihre gut eins achtzig. Sie hatte nie Probleme mit ihrer Größe gehabt. Während des Studiums wurde sie wegen ihres Aussehens sogar einmal von einem Fotografen auf der Straße angesprochen. Er gab ihr seine Visitenkarte und forderte sie auf, sich bei ihm zu melden. Er sprach davon, wie fotogen sie sei, mit ihrem wundervollen rotbraunen Haaren und davon, dass sie tolle Augen hätte, tolle grüne Augen. Sie war damals mit einer Kommilitonin in Nantes unterwegs. Die Freundin bedrängte sie noch Tage später, sich bei dem Fotografen zu melden. Florence hatte damals aber kein Interesse an der Sache und bezweifelte auch, dass der Mann ein richtiger Fotograf war. Sie hatte nie bei ihm angerufen und es auch nie bereut.
Der junge Mann, der vor ihr am Flugschalter stand, drehte sich zu ihr um und lächelte sie zaghaft an. Nach einer Viertelstunde hatte sie endlich ihr Gepäck eingecheckt. Zwei Stunden später kamen ihr die beiden Koffer und die große Reisetasche dann auf dem Kofferband im Münchner Franz-Josef-Strauß-Flughafen wieder entgegen. Ein Mitreisender half ihr, das Gepäck auf den Trolley zu wuchten. Seine Frau musste ihn aber erst dazu auffordern. Florence bedankte sich auf Deutsch. Einige wenige Worte sprach sie und ein »Dankeschön« gehörte auch dazu. Als sie den Ausgangsbereich betrat, sah sie Colette bereits winken. Florence musste nicht durch den Zoll und konnte ihre Koffer direkt in die Wartehalle schieben. Colette kam ihr entgegen. Sie hatten sich jetzt bestimmt mehrere Monate nicht gesehen. Florence kam jedes Jahr ein- oder zweimal nach Europa, fast immer stand auch ein Besuch in München auf ihrem Programm. Bevor Colette etwas sagte, umarmte sie die Freundin. Sie küssten sich auf die Wange, dreimal, so wie es in Frankreich üblich ist. Neben ihnen stand ein älteres Ehepaar und beobachtete interessiert die Szene. Was die beiden Frauen sich dann erzählten, verstand das Paar aber nicht mehr.
»Mon dieu, zwei Koffer, die hattest du aber beim letzten Mal nicht dabei, oder«, stellte Colette fest.
Florence sah zu ihrem Gepäck. »Und dann habe ich ja noch die große Tasche«, sagte sie in einem bewusst trotzigen Ton. Sie lachten.
»Beinahe hätte ich dich mit meinem Cabriolet abgeholt. Simon ist heute Morgen doch mit seinem Wagen in die Firma gefahren. Er hatte nicht mehr daran gedacht. Wir haben dann vorhin noch getauscht.«
»Und wie geht es ihm und dem Jungen?«
»Ich glaube Simon ist ganz froh, dass er mich heute Abend los ist. Es gibt irgendein Fußballspiel. Da braucht er sich noch nicht einmal um Marc zu kümmern. Die sitzen dann beide vor dem Fernseher und schauen es zusammen an.«
»Wie praktisch für alle.« Florence lächelte und stöhnte dann augenblicklich. »Hast du wieder ein Programm gemacht? Das letzte Mal waren es meine härtesten Tage hier in München, darum habe ich mich auch schon in Paris mit allem eingedeckt. Den orangen Koffer habe ich auch erst vor drei Tagen gekauft.«
»Das ist aber dumm«, sagte Colette und verzog zum Spaß enttäuscht den Mund. »Jetzt wollte ich hier mit dir ordentlich shoppen gehen und du bist mit dem Thema schon durch. Na gut, wir werden sehen. Für morgen Nachmittag habe ich jedenfalls etwas Besonderes und es wird dich überhaupt nicht anstrengen. Warst du schon einmal in einem Wellnesstempel?«
Florence schüttelte den Kopf. Sie waren inzwischen losgegangen. Sie schoben den Trolley in Richtung Ausgang. Colette ging neben ihr und erzählte weiter.
»Ich mache es seit einigen Monaten, es ist herrlich. Massagen und kalte und heiße Bäder und noch einiges mehr. Nur die Sauna ist nichts für mich. Ich habe es zweimal probiert. Am schönsten ist der Ruheraum, einfach nur hinlegen und keiner stört dich mehr. Man muss sich natürlich schon einen Nachmittag freinehmen. Einmal im Monat gehe ich hin, wenn ich es schaffe auch zweimal.«
Colette hatte den Wagen direkt neben dem Flughafengebäude abgestellt. Eine Politesse überprüfte bereits die Fahrzeuge, die auf dem Parkstreifen standen.
»Lass uns schnell machen«, flüsterte sie Florence zu. »Ich habe zwar einen Parkschein, aber der dürfte mittlerweile abgelaufen sein. Simon hat kein Verständnis für Knöllchen.«
Colette öffnete die Heckklappe des Kombis und sie wuchteten gemeinsam die beiden Koffer in den Wagen. Die Reisetasche schob Florence auf die Rücksitzbank. Die Politesse schrieb gerade eine Anzeige für einen Opel, der unmittelbar hinter ihnen parkte. Noch bevor sie damit fertig war, fuhr Colette aus der Parklücke und entkam noch rechtzeitig.
»Marc ist heute nach der Schule erst noch bei seinen Großeltern«, erklärte sie. »Mein Schwiegervater holt ihn ab. Wir laden eben schnell aus und dann geht es gleich weiter, in die Stadt, zum Kaffeetrinken.«
Florence nickte zustimmend. Die Fahrt nach München-Forstenried dauerte fast eine Dreiviertelstunde, dafür wohnten die Halters aber auch im Grünen. Die beiden Frauen trugen die Koffer ins Haus und ließen sie erst einmal in der Diele stehen.
»Simon soll sie dir auf dein Zimmer bringen, wenn er heute Abend kommt. Ich werde ihm einen Zettel hinlegen.«
»Die Tasche bringe ich gleich hinauf«, sagte Florence. »Dann kann ich mich eben noch frisch machen. Die Zeit haben wir doch noch, oder?«
»Mach ganz in Ruhe«, erwiderte Colette. »Ich will auch noch einmal nach oben ins Bad.
Sie gingen die Treppe hinauf in den ersten Stock. Florence kannte sich im Hause der Halters aus. Bei ihren Besuchen hatte sie immer dasselbe Gästezimmer. Es lag über der angebauten Garage und hatte sogar ein eigenes Bad.
Eine halbe Stunde später saßen die beiden Frauen schon wieder im Auto und fuhren in Richtung Innenstadt. Colette hatte ein Lieblingscafé am Odeonsplatz. Sie parkten in einer Seitenstraße auf einem Garagenhof, nur wenige Meter von dem Lokal entfernt. Der Parkplatz gehörte Freunden und Colette konnte ihn manchmal tagsüber nutzen. Florence kannte das Café bereits. Sie war bei ihren Besuchen in München mehrmals mit Colette dort gewesen. Sie fanden auch wieder einen Tisch am Fenster, direkt zum Odeonsplatz hin. Das Café war zu dieser Tageszeit schon gut besucht, trotzdem kam die Bedienung sofort und nahm ihre Bestellung auf.
»Es ist noch etwas kalt zu dieser Jahreszeit«, sagte Colette. »Im Sommer kann man so schön draußen auf dem Platz sitzen. Ich weiß gar nicht, warst du jemals im Sommer hier bei mir in München?«
Florence überlegte. »Ich weiß, dass wir einmal mit Simon im Englischen Garten waren und wir haben garantiert in einem Bierlokal draußen gesessen. Ich weiß aber nicht mehr, wie lange das schon her ist. Wir haben dieses Weizenbier getrunken, das es doch tatsächlich auch in einigen Hotels auf Tahiti gibt. Ich habe es letztes Jahr gesehen und konnte es kaum glauben.«
»Und hast du es probiert?«, fragte Colette erstaunt.
Florence schüttelte den Kopf. »Ich trinke eigentlich kein Bier und bayerisches Bier trinke ich dann auch nur hier in München oder eben in Deutschland, ich finde, das passt besser zusammen.«
Colette stimmte ihr zu. Der Kaffee und zwei große Stücke Erdbeertorte wurden gebracht. Die Frauen hatten sich extra Vollmilch und keine Kondensmilch für ihren Kaffee bestellt. Sie schenkten sich selber ein und genossen den ersten Schluck.
»Was macht die Schule?«, fragte Florence.
»Es ist keine Schule, es ist eine Akademie, eine internationale Wirtschaftsakademie«, antwortete Colette betont.
»Oh, entschuldige, natürlich, eine Wirtschaftsakademie.« Sie lachten. »Und, was ist nun damit, gibst du noch Unterricht?«
»Ja und es macht wirklich Spaß. Die meisten Stunden gebe ich zwar am Nachmittag, was wegen Marc nicht ganz so günstig ist, aber er wird immer selbstständiger, so dass ich ihn auch mal am Nachmittag alleine lassen kann. Wenn ich Glück habe, bekomme ich aber bald eine Berufsschulklasse und der Unterricht ist dann auch vormittags.«
»Das hätte ich nie gedacht, du als Lehrerin«, sagte Florence und schüttelte den Kopf.
»Bin ich ja eigentlich auch nicht. Ich beherrsche den Stoff und kann ihn wohl einigermaßen gut rüberbringen und außerdem sind meine Schüler ja auch keine Kinder mehr.«
»Und was waren noch einmal deine Fächer?«, fragte Florence.
»Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen. Und ich habe auch weiterhin einen Französischkurs. Das war überhaupt der Grund, weswegen ich den Job damals bekommen habe. Sie suchten für die Akademie Leute, die auf Französisch und Englisch unterrichten können.«
»Na, das ist ja dann schon toll, wenn es dir auch Spaß macht.«
Colette nickte und nahm noch einen Schluck Kaffee. »Wie sieht es bei dir zu Hause aus?«, fragte sie, nachdem sie die Tasse wieder abgesetzt hatte. »Was machen deine Eltern und dein Bruder mit seiner Familie?«
»Meinen Eltern geht es noch recht gut. Mein Vater ist im Januar fünfundsiebzig geworden. Diesmal musste er feiern. Wir hatten viele Gäste und fast zwei Wochen volles Haus. Wer uns von außerhalb besucht, für den lohnt es meistens nicht, nur ein paar Tage zu bleiben. Mein Onkel ist extra aus San Francisco hergeflogen und es sind auch viele Freunde aus Tahiti gekommen.«
»Wie weit ist es von Tahiti zu euch auf die Marquesas? Ich weiß nur noch, dass wir damals endlos lange über das offene Meer geflogen sind, in dieser komischen kleinen Propellermaschine.«
Florence lachte. »Nach Tahiti sind es schon gut tausendfünfhundert Kilometer und dazwischen ist wirklich nicht viel. Bei uns ist das Meer eben überall und das Land nirgends.«
Colette überlegte. »Das sind schon ganz schöne Strecken, tausendfünfhundert Kilometer von hier in Richtung Norden und du bist irgendwo in Schweden oder Norwegen und in der anderen Richtung landest du vielleicht schon in Afrika.«
»Wenn mein Bruder seinen Plan wirklich in die Tat umsetzt und mit seiner Familie nach Tahiti zieht, dann wird es für meine Eltern nicht leicht, ihre Enkel regelmäßig zu sehen«, sagte Florence nachdenklich.
»Du hattest davon geschrieben«, sagte Colette. »Ich erinnere mich. Er wollte eine Apotheke in Papeete übernehmen.«
Florence nickte. »Ja, und auf dem Geburtstag hat sich dieses Thema noch ein bisschen mehr verdichtet. Er hat mit einem Freund meines Vaters gesprochen, der diese Apotheke besitzt und der sich gerne zur Ruhe setzen möchte. Es wird wohl Ende des Jahres über die Bühne gehen, so wie es aussieht.«
»Seit wann lebt ihr eigentlich auf den Marquesas?«, fragte Colette. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass du einmal erzählt hast, dein Vater stamme aus Brest.«
»Oh, da liegst du falsch, das war nicht mein Vater, sondern mein Urgroßvater«, erklärte Florence. »Das Ganze ist schon Geschichte, tiefste Familiengeschichte. Meine Eltern und alle meine Großeltern sind auf Tahiti geboren. Mein Urgroßvater war der Einwanderer aus Brest. Meine Urgroßmutter stammte aus Straßburg, sie haben sich auf Tahiti kennengelernt. Meine Urgroßeltern müssen so um die Jahrhundertwende in die Südsee gekommen sein. Mein Urgroßvater hat auch die Apothekertradition der Familie Uzar begründet. Er war schon ausgebildeter Apotheker, als er sich in Papeete niederließ. Er hatte aber erst eine Art Kolonialwarengeschäft, das wohl sehr gut lief. Er hat in seiner Anfangszeit sogar auf den Marquesas gehandelt. Dann hat er sich an seine beruflichen Wurzeln erinnert und eine der ersten Apotheken auf Tahiti eröffnet, zunächst noch in den Räumen seines Kolonialwarengeschäfts. Später hatte er zeitweise sogar drei Geschäfte auf Tahiti besessen. Er hatte nur einen Sohn, dafür aber drei Töchter. Mein Großvater hat dann eine der Apotheken weitergeführt, zusammen mit seinen beiden Söhnen. Mein Onkel ist zunächst auf Tahiti geblieben. Er ist dann aber nach Kalifornien ausgewandert, als mein Großvater gestorben ist. Mein Vater hatte sich damals schon auf den Marquesas umgesehen und als das Krankenhaus ausgebaut wurde, hat er dort seine eigene Apotheke eröffnet. Du weißt ja, ich bin auf den Marquesas geboren.«
»Dann steckt also eine Menge Tradition in eurer Familie, Giftmischertradition«, spaßte Colette. »Was wird denn nun daraus, wenn dein Bruder fortgeht?
»Die Apotheke werde ich dann wohl alleine weiterführen müssen. Ich bin schließlich auch Pharmazeutin. Verkaufen kommt nicht infrage, von irgendetwas muss ich ja schließlich auch leben. Vielleicht suche ich mir noch jemanden, der mich vertritt und ein wenig die Arbeit meines Bruders übernimmt. Vielleicht schaffe ich es aber doch ganz allein, wir haben ja schließlich auch ein paar Angestellte.«
»Dann bist du also bald nur noch mit deinen Eltern auf Nuku Hiva? Oder hat sich in deinem Liebesleben endlich etwas getan?« Colette lachte.
»Nein hat es nicht«, sagte Florence genervt.
Sie wusste schon, was jetzt wieder kommen würde. Sie hatte diese Gespräche schon öfter mit Colette geführt. Es war sicherlich lieb gemeint.
»Und wenn du dir hier einen netten Apotheker anlachst«, begann Colette auch schon. »Einer, der mit auf die Marquesas kommt, dann hast du doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.«
»Ich liebe deine konstruktiven Vorschläge«, lachte Florence. »Hör bitte auf!«
»Nein tue ich nicht. Irgendjemand muss dich doch beraten, wo du da in der tiefsten Südsee alleine herumhängst. Was ist denn mit diesen vielen Ärzten in eurem Krankenhaus? Ist da denn niemand für dich dabei?«
»Ich denke diese Geschichte habe ich hinter mir«, sagte Florence vorwurfsvoll.
Colette fiel es sofort wieder ein. Eigentlich hatte sie dieses Thema gar nicht ansprechen wollen. Es war ihr im Eifer einfach nur so herausgerutscht.
»Entschuldige«, sagte sie leise. »Ich habe nicht nachgedacht, aber wo wir schon dabei sind, hast du von Philipp mal wieder etwas gehört?«
»Ja, er arbeitet jetzt sogar in Paris, aber ich habe ihn in den vergangenen zwei Wochen nicht getroffen und auch nicht mit ihm telefoniert. Wir haben unseren Kontakt auf das Schreiben von E-Mails reduziert und das auch nur alle paar Monate.«
Colette wollte das Thema wechseln, aber nicht so richtig. Sie wollte nur nicht mehr an Philipp erinnern.
»Aber ich finde du brauchst doch einen Mann, auch wenn es mit dem einen nicht geklappt hat. Zum Glück wart ihr nicht verheiratet und hattet auch keine Kinder. Meine Cousine hat sich letztes Jahr scheiden lassen, das war ein Theater. Aber egal, du musst dich an die Touristen halten, die bei euch vorbeikommen.« Colette lachte über ihre eigene Bemerkung.
»Weißt du, ich muss gar nichts«, sagte Florence trotzig und lachte ebenfalls. »Ich muss höchstens diesen Kuchen hier essen. Erdbeeren sind doch was Herrliches.«
»Schade«, seufzte Colette, »im Sommer gibt es hier an jeder Ecke ganz Frische. Diese hier stammen bestimmt aus Spanien oder aus der Dose.«
Florence hatte jetzt bewusst selbst ein anderes Thema angeschlagen. Colette merkte schließlich, dass sie ihre Freundin zu nerven begann. Sie fand es nur immer wieder schade. Sie selbst war schon seit zehn Jahren mit Simon verheiratet. Ihr Sohn war neun. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass Florence nicht auch eine eigene Familie wollte. Noch war es ja nicht zu spät, dachte sie.
*
Es ging schon auf den Nachmittag zu. Simon sah sich seinen Terminkalender an. Er wollte wissen, was ihn heute noch erwartete. Normalerweise würde ihn Frau Hoischen gleich daran erinnern, sofern etwas Wichtiges unmittelbar anstünde. Sein elektronischer Kalender kündigte einen Termin für 14:00 Uhr an. Er sah zur Messinguhr auf seinem Schreibtisch, er hatte noch knapp zwanzig Minuten. Den Termin hatte er nicht selbst in den Kalender eingetragen. Die Notiz dazu lautete knapp und kurz: »Herr E. Linz, Angebot Versteigerungsobjekt, Beratung!« Die wenigen Worte sagten alles. Ein Kunde wollte etwas zur Auktion geben und für diesen Kunden war das Haus Blammer bisher nicht tätig gewesen, ansonsten hätte Frau Hoischen eine entsprechende Notiz gemacht. Ein neuer Kunde, nichts Ungewöhnliches. Der Mann wollte ein Kunstobjekt vorstellen und sich zunächst einmal beraten lassen. Simon überlegte. Er griff zum Telefon und drückte die Taste für sein Vorzimmer. Frau Hoischen nahm nicht ab, sondern kam nach wenigen Augenblicken zur Tür herein, was sie häufiger tat, wenn ihr Chef allein im Büro war. Sie hasste es, mit ihm zu telefonieren, wenn er nur wenige Meter von ihr entfernt in einem anderen Raum saß.
Simon sah zu ihr auf und tippte mit dem Finger auf den Bildschirm seines Computers. »Der Termin mit diesem Herrn Linz?«, fragte er. »Um was für eine Art Objekt geht es da, hat er etwas dazu gesagt?«
Frau Hoischen überlegte. »Nein, ich erinnere mich nicht, dass Herr Linz gesagt hätte, worum es ging. Ich habe natürlich auch nicht gefragt. Ich habe den Termin aber auch nicht gleich bestätigt, wenn Sie sich erinnern. Ich habe Sie vorgestern noch gefragt, ob es in Ordnung geht, weil ja sonst Herr Kühler die Neukunden übernimmt.«
Simon sah sie an. Er brauchte einige Sekunden um sich zu erinnern. »Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein, Sie haben mich vor zwei Tagen gefragt. Gut, dann ist es auch egal. Der Mann kommt ja ohnehin gleich, dann werde ich schon erfahren, worum es geht.«
Eine Viertelstunde später wurde der Besucher in Simons Büro geführt. Frau Hoischen schloss sofort wieder die Tür hinter sich. Edmund Linz war groß und schlank. Simon schätzte ihn auf Anfang bis Mitte fünfzig. Er hatte schwarzes Haar, das aber schon stark ergraut war. Er trug einen braunen Holzkoffer in der linken Hand. Simon erhob sich und ging um seinen Schreibtisch herum. Edmund Linz kam ihm einige Schritte entgegen. Sie gaben sich die Hand und sahen sich dabei in die Augen.
»Danke, dass Sie so schnell für mich Zeit gefunden haben.«
»Für uns ist das natürlich selbstverständlich, wir sind schließlich immer interessiert, zu hören, was man uns anbieten möchte. Bitte, nehmen Sie doch Platz.«
Simon deutete auf den Besprechungstisch, sie setzten sich. Dann klopfte es noch einmal an der Tür und Frau Hoischen betrat den Raum. Sie brachte Geschirr und eine Kanne Kaffee.
»Sie trinken doch Kaffee?«, fragte Simon.
»Sehr gerne, sehr aufmerksam von Ihnen.«
Edmund Linz lächelte Frau Hoischen an, die die Tassen und Untertassen auf die Plätze am Tisch verteilte und noch den Kaffee einschenkte, bevor sie das Büro wieder verließ. Simon wartete, bis sein Gast den ersten Schluck genommen hatte.
»Es geht also um ein Kunstobjekt und Sie wünschen eine Beratung, wenn ich richtig verstanden habe?«
Edmund Linz nickte.
»Bevor wir darüber reden, interessiert es mich natürlich, wie Sie auf unser Haus gekommen sind?«
Simon begann seine Kundengespräche fast immer mit dieser Frage, um erst einmal eine vertraute Atmosphäre zu schaffen, wie er meinte. Eigentlich interessierte ihn die Antwort nur am Rande. Irgendwie war dieser Edmund Linz auf Blammer gekommen, entweder über Freunde oder Bekannte oder ganz banal über das Branchenverzeichnis.
»Oh!«, Edmund Linz überlegte. »Das weiß ich gar nicht so genau. Ich kannte Ihre Firma, das heißt, ich bin an dem Gelände schon öfter vorbeigekommen und Ihr Firmenschild sagt ja deutlich, was hier in diesen Gebäuden vor sich geht. Und jetzt wo ich voraussichtlich die Dienste eines Auktionshauses benötige, bin ich eben auf Sie gekommen. Es war also Zufall, reicht Ihnen die Begründung?«
»Kein Problem«, antwortete Simon. »Dann können wir ja gleich zur Sache kommen. Sie benötigen also die Dienste eines Auktionshauses. Geht es um ein Objekt, das Sie unter Umständen veräußern wollen?«
Edmund Linz griff schweigend zum Boden. Den Holzkoffer hatte er neben seinem Stuhl abgestellt. Er holte ihn jetzt hervor und legte ihn auf den Besprechungstisch. Passend zu dem braunen Holz besaß der Koffer Messingbeschläge, die sich an den Ecken und den Seiten befanden. Simon sah gespannt zu, wie Edmund Linz die Schnappverschlüsse des Holzkoffers öffnete und den Deckel hochklappte und ihn auf der Tischplatte ablegte. Der Inhalt des Koffers war von einem Samttuch abgedeckt. Edmund Linz sah Simon an.
»Ich möchte ein Ölgemälde verkaufen«, sagte er nach kurzem Schweigen. »Ich möchte es von Ihnen versteigern lassen. Es ist mir wichtig, den höchstmöglichen Preis zu erzielen, darum bin ich zu Ihnen gekommen.«
Simon nickte. Er sah auf den Koffer, der zwar größer war als ein normaler Aktenkoffer, aber immer noch so klein, dass das Bild darin nicht sehr groß sein konnte. Es kam selten vor, dass dem Hause Blammer ein einzelnes Bild angeboten wurde.
»Es geht aber nur um ein Objekt, um das, was Sie hier mitgebracht haben?«, fragte Simon dann auch.
»Ja!«, Edmund Linz zögerte. »Ist das ein Problem?«
»Im Prinzip nicht. Wenn wir es versteigern, werden wir natürlich noch andere Objekte in die Auktion nehmen müssen, die zu Ihrem Bild passen, es sei denn, Sie haben hier einen Rembrandt oder Picasso. Mit so einem Bild machen wir natürlich eine One-Man-Show, quasi eine Ein-Bild-Show, Sie verstehen?« Simon lachte über seine eigene Bemerkung.
»Ich verstehe«, sagte Edmund Linz emotionslos.
Er zog das Tuch fort, das auf dem Bild im Koffer lag und zeigte mit dem Finger in die untere rechte Ecke. Simons Lippen zuckten kurz. Er hatte eigentlich einen Spaß machen wollen. Er schaute gebannt auf die Signatur, ohne sich überhaupt das Motiv des Gemäldes genauer anzusehen. Dann schüttelte er wortlos mit dem Kopf. Beide Männer schwiegen noch einige Sekunden.
»Sie wollen nicht sagen, dass das Bild hier echt ist?«, fragte Simon mit fester Stimme.
»Doch, das will ich«, antwortete Edmund Linz selbstsicher. »Hier, bedienen Sie sich, sehen Sie es sich bitte in Ruhe an.«
Edmund Linz schob den Koffer über den Tisch. Es gab ein Geräusch von den Messingbeschlägen, die über die Tischplatte kratzten. Simon beugte sich kurz über den Koffer, dann hielt er in seiner Bewegung inne, stand plötzlich auf und ging zum Fenster, um die Jalousie herunterzulassen. Bevor er sich wieder setzte, schaltete er noch eine Batterie von Strahlern ein, die in die Decke über dem Besprechungstisch eingelassen waren. Er zog den Holzkoffer noch dichter vor seine Brust. Seine Augen wanderten über das Bild und versuchten alle wesentlichen Merkmale zu erfassen. Er sagte fast zwei Minuten lang gar nichts, er schaute einfach nur. Er fixierte schließlich noch einmal die Signatur des Gemäldes.
»Darf ich es herausnehmen?«, fragte er und unterbrach damit das Schweigen.
»Ja, bitte.« Edmund Linz zögerte. Er sah Simon wieder direkt in die Augen. »Es ist wunderbar, nicht wahr?«
Simon zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Ihre Frage amüsiert mich«, sagte er mit ruhiger, aber weiterhin fester Stimme. »Haben Sie irgendwelche Unterlagen zu dem Bild, woher haben Sie es, gibt es irgendwelche Belege, Zertifikate, Untersuchungsberichte, gibt es irgendetwas, das beweist, ob das, was ich hier vor mir habe echt ist?«
»Ich habe das Gemälde vor sieben oder acht Jahren erworben«, antwortet Edmund Linz selbstbewusst. »Ich habe es privat gekauft. Ich habe nicht gefragt, warum es zu haben ist und wem es gehört hat. Natürlich musste ich auch prüfen, ob es echt ist. Ich habe die gleichen Fragen gestellt, wie Sie jetzt auch. Ich habe mich aber nicht um irgendwelche fremden Unterlagen gekümmert. Ich habe selbst eine Materialanalyse vorgenommen, mit den damals gängigen Untersuchungen, Authentizität der Farben und der Leinwand, Sie verstehen. Ich habe die Analysen in meinem eigenen Labor durchführen lassen, ich habe sie sogar zum Teil selbst durchgeführt. Ich habe meine Ergebnisse aber natürlich nicht beglaubigen lassen, ich bin ja kein unabhängiger Sachverständiger.«
»Sie haben die Analysen selbst durchgeführt?« Simon sah ihn zweifelnd an.
»Wenn man es kann«, antwortete Edmund Linz. »Ich bin Chemiker. Solche Analysen gehörten zwar nicht zu meinem täglichen Geschäft, aber so kompliziert ist das alles nicht, wenn man sich auskennt. Ich habe vor allem die Pigmente identifiziert, die in den Farben verwendet wurden und natürlich das Bindemittel. Ich habe meine Ergebnisse mit den Analysen verglichen, die von Ölgemälden gemacht wurden, die als echt anerkannt sind. Ich habe an meinem Bild nichts Unstimmiges gefunden. Die Chemie betrügt nicht.«
»Gut, und was haben Sie noch oder war das alles?« Simon sah ihn kritisch an, als wenn er das Gespräch eigentlich gleich beenden wollte.
»Nicht, dass Sie jetzt überrascht sind, aber ich besitze die Expertise eines Kunsthistorikers.«
»Aber das waren nicht auch zufälligerweise Sie selbst.« Simon lächelte. »Entschuldigen Sie die Bemerkung. Wer ist der Mann oder die Frau, ich meine Ihr Experte und was hat er oder sie gesagt, haben Sie etwas Schriftliches?«
»Kennen Sie Professor Lehner aus Augsburg?«, fragte Edmund Linz, ohne zu zögern. »Ich habe beim Erwerb des Bildes eine Expertise von ihm erhalten. Sein Fazit war eindeutig. Stil und die Maltechnik sind authentisch. Wenn ich dann noch meine Laborergebnisse nehme, denke ich, dass es Beweise genug sind, um die Echtheit des Bildes zu garantieren.«
»Professor Lehner ist mir in der Tat bekannt. Er hat früher mehrfach für unser Haus gearbeitet. Er ist allerdings vor zwei oder drei Jahren verstorben. Seine Expertisen sind natürlich über jeden Zweifel erhaben. Hat er das Bild gekannt, ich meine hat er in seiner Expertise auch auf Ausstellungen und Galerien hingewiesen, in denen das Bild früher ausgestellt war.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Edmund Linz.
»Für jede Expertise wird immer auch eine Recherche vorgenommen. Zum Beispiel gehört es zum Steckbrief der Mona Lisa, wann es im Schloss Amboise, in Fontainebleau, in Versailles und schließlich im Louvre zu sehen war und wie es im Laufe der Zeit an diese Orte gelangt ist. Sie verstehen, was ich meine, hat Professor Lehner auch einen Herkunftsnachweis erstellt oder vorgelegt?«
»Einen Herkunftsnachweis?«, wiederholte Edmund Linz. »Professor Lehner hat in seinem Gutachten über die Ausführung des Bildes geschrieben. Er hat Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen mit anderen Werken des Künstlers festgestellt. Ich habe ihn später einmal getroffen und mit ihm das Gutachten durchgesprochen aber wir haben nicht darüber geredet, ob das Gemälde jemals irgendwo ausgestellt war. Damals konnte ich ihm übrigens auch den Laborbericht zeigen und er war zufrieden.« Edmund Linz stutzte. Dann besann er sich wieder und fuhr fort. »Die Mona Lisa ist fast vierhundert Jahre alt, da kommt einiges an Historie zusammen.« Er zeigte auf die Signatur des Gemäldes im Holzkoffer. »Wer weiß denn heute noch, an wen er alles seine Bilder verschenkt hat. Professor Lehner und ich haben zwar darüber gesprochen, woher das Bild stammen könnte, aber ich glaube wir waren uns einig, dass es schon immer in Privatbesitz war und daher nicht zu den ganz berühmten Werken zählt, die jeder gleich erkennt. Professor Lehner hatte zumindest keine Probleme damit.«
»Es war van Gogh«, sagte Simon.
»Bitte?« Edmund Linz hatte nicht verstanden.
»Van Gogh hat seine Bilder verschenkt«, erklärte Simon. »Van Gogh hat in seinem Leben, wenn überhaupt, höchstens zwei oder drei Bilder verkaufen können.«
Edmund Linz nickte zustimmend. »Wie ich Ihnen gesagt habe, das Gemälde hier stammt aus Privatbesitz. Ich war selbst Sammler. Ein Sammler zeigt zwar gerne seine Schätze, manchmal will er sie aber auch ganz für sich selbst haben und scheut die Öffentlichkeit.«
Simon stand auf, um die Jalousie wieder zu öffnen und die Deckenstrahler auszuschalten. Es wurde bereits recht warm am Besprechungstisch, eine Wärme, die auch für das Ölgemälde nicht gut sein konnte. Als er sich wieder gesetzt hatte, faltete er die Hände und stützte sein Kinn ab. Er sah seinen Gast einige Sekunden lang schweigend an.
»Gut«, sagte er schließlich und atmete dabei bedächtig aus. »Professor Lehner hat wahrscheinlich angenommen, dass die Recherche nach einem Herkunftsnachweis für Sie nicht relevant ist. Sie sagten ja selbst, dass Sie Sammler sind.«
Edmund Linz schüttelte mit dem Kopf. »Natürlich hat mich die Herkunft des Gemäldes in gewisser Weise interessiert. Ich habe selbst nach dem Bild gesucht, nicht professionell. Ich habe vor allem in Kunstbüchern und Zeitschriften nachgesehen, aber nichts gefunden, was ja nichts heißen muss. Mir ist das Ölgemälde aus Privatbesitz angeboten worden, darum denke ich, dass es wohl niemals in einer Ausstellung oder Galerie zu sehen war.«
»Schade, wirklich schade«, bedauerte Simon. »Ich hoffe nicht, dass Sie recht haben. Ein Herkunftsnachweis findet sich leider zumeist in Ausstellungs- und Galeriekatalogen. Sicherlich ist das keine grundsätzliche Bedingung, um die Herkunft zu beweisen. Es gibt natürlich auch andere Quellen, zum Beispiel in Aufzeichnungen, die der Künstler selbst hinterlassen hat oder in Briefen, in denen die Vorbesitzer über ihre Sammlungen schreiben und das Bild erwähnen und es Zeugen gibt. Hier finden sich dann Hinweise, die zu weiteren Indizien für die Herkunft führen. Zeitzeugen sind da natürlich der beste Beweis, sofern sie noch leben.« Simon überlegte kurz. »Von wem haben Sie das Gemälde denn erworben, vielleicht kenne ich den Sammler, vielleicht besitzt er noch Unterlagen, von denen Sie nichts wissen?«
»Ich kenne weder den Vorbesitzer noch den Verkäufer. Es klingt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich habe das Bild anonym erworben. Alle Beteiligten, einschließlich mir, hatten damals kein Interesse daran, dass der Kauf öffentlich wird, Sie verstehen.«
Simon sah Edmund Linz jetzt eindringlich an. »Das ist gefährlich«, sagte er schließlich. »Das Bild kann ja auch aus einem Diebstahl stammen, haben Sie das wenigstens überprüft?«
Edmund Linz lachte auf. »Natürlich habe ich mich umgehört, bevor ich gekauft habe«, erklärte er. »Damals konnte ich aber keinen Hinweis finden, dass dieses Bild irgendwo gestohlen wurde. Wenn es die Mona Lisa wäre, hätte ich es nicht genommen, ich hätte vielleicht sogar die Polizei verständigt oder einfach nicht geglaubt, dass es echt ist.«
»Es gibt auch Leute, die die Mona Lisa nehmen würden«, sagte Simon. »Das war dem Louvre bewusst, als das Bild 1911 gestohlen wurde und darum haben sie es ein Jahr später sogar aus ihrem Katalog genommen.«
»Der Louvre?«, wiederholte Edmund Linz, als wenn er nicht verstanden hätte. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein, mein Bild ist kein Diebesgut, ich bin mir sicher, ich habe es geprüft.«
»Ich glaube kaum, dass Sie die richtigen Quellen hatten, um hundertprozentig auszuschließen, dass es nicht doch gestohlen ist.«
Edmund Linz sah ihn an und zuckte mit den Schultern.
»Wir haben die Möglichkeit«, sagte Simon. »Wir müssen sie haben, um zu verhindern, dass wir zum Hehler werden. Sie sagten, dass Sie das Bild seit sieben Jahren besitzen?«
Edmund Linz nickte. »Ich muss überlegen, es können jetzt auch schon acht Jahre sein, ja im April werden es acht Jahre.«
»Und haben Sie es in dieser Zeit nie versichert?«, fragte Simon nachdenklich.
Edmund Linz schüttelte den Kopf. »Ich hatte noch drei weitere Kunstwerke, müssen Sie wissen. Zwei Bilder von Paula Becker-Modersohn und eines von Heinrich Vogeler. Für die hatte ich schon Policen und die Versicherung hat sich natürlich vergewissert, dass ich alles unternommen habe, damit den Bildern in meinem Haus nichts passiert. Sie verstehen, Diebstahl und Brandschutz. Dieses Gemälde habe ich nicht mehr versichern lassen, es kam erst später dazu. Ich habe es mit den anderen Bildern in meinem Salon hängen gehabt. Für mich war das Sicherheit genug.«
»Bei meiner Frage ging es nicht um den Schutz des Gemäldes. Die Versicherung hätte das Bild bestimmt genau auf seinen Wert hin überprüft, bevor Sie eine Police bekommen hätten. Unter Umständen hätte die Versicherung nach einer Echtheitsbestätigung recherchieren lassen, wo Sie doch selbst keine richtigen Unterlagen besitzen. So etwas hätte uns die Sache jetzt einfacher und auch billiger machen können.«
»Und ich wäre das Bild jetzt bestimmt schon los«, sagte Edmund Linz gereizt. »Ich bin derzeit in einer finanziell misslichen Lage. Ich kann von Glück reden, dass meine Gläubiger nichts von diesem Schatz hier wissen. Es ist nicht so, dass ich jemandem etwas schuldig bleiben wollte, aber meine anderen Bilder sind bei der Auflösung meines Haushalts und der anschließenden Zwangsversteigerung weit unter Wert verkauft worden. Diesen Fehler möchte ich nicht noch einmal machen. Das Gemälde hier konnte ich vorerst noch retten, um es jetzt richtig zu Geld zu machen. Darum bin ich hier, wie ich Ihnen ja schon eingangs erklärt habe.«
Simon schüttelte den Kopf. »Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, wird es aber auch irgendwann einmal bekannt, wer ein solches Bild anbietet, vorausgesetzt, es ist wirklich echt. Wir können Sie nicht vor Ihren Gläubigern schützen, das ist nicht unsere Aufgabe.«
Edmund Linz starrte ihn an. »Aber unser Gespräch hier wird doch von Ihnen, wie soll ich sagen, diskret behandelt?«
»Ich weiß nichts von Ihren Problemen und auch Ihre Gläubiger sind mir soweit egal«, erklärte Simon. »Solange Sie nicht von der Polizei gesucht werden, sind Sie ein ganz normaler Kunde und es ist selbstverständlich, dass unsere Unterhaltung hier in diesen vier Wänden bleibt, das versichere ich Ihnen.«
»Es ist auch alles nicht so, wie es sich anhört«, sagte Edmund Linz beschwichtigend. »Ich habe einen großen Teil meiner Schulden ja auch schon bezahlt und die restlichen Forderungen sind gestundet. Ich muss jetzt nur die Möglichkeit haben, einen vernünftigen Preis zu erzielen, dann bin ich sogar wieder im Plus, ich hoffe sogar deutlich im Plus und kann einen Neuanfang machen. Sie sehen, es hängt eine Menge für mich davon ab, darum ist es mir auch wichtig, festzustellen, ob ich hier bei Ihnen richtig bin.«
»Was erwarten Sie jetzt von uns?«, fragte Simon.
»Nehmen Sie das Bild und verkaufen Sie es für mich, bestmöglich. Mir ist dabei nur eines wichtig, dass mein Name vorerst nicht ins Spiel kommt, und zwar solange, bis keine Instanz mehr zugreifen und sich in unser Geschäft einmischen kann. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihre Provisionen bei solchen Geschäften haben. Ich biete Ihnen für Ihre Dienste und natürlich auch für Ihre Diskretion mehr als die üblichen Prozente.«
Simon lächelte. »Um Ihren Namen brauchen Sie sich zunächst keine Gedanken zu machen. Ein Vertrag mit uns bedeutet, dass Sie auf der ganzen Linie von uns vertreten werden. Ihr Name wird auch vorerst nirgends auftauchen. Das Haus Blammer steht sozusagen vor Ihnen und schützt Ihre Interessen.« Er machte eine kurze Pause. »Ich habe allerdings ein anderes Problem. Gewinne und Provisionen sind nicht alles, wofür unsere Geschäftsprinzipien stehen. Wir sind ein seriöses Haus. Unsere Kunden, die in den von uns veranstalteten Auktionen Objekte ersteigern, gehen davon aus, dass alles korrekt ist. Wenn wir einen Caspar David Friedrich anbieten, dann ist es auch garantiert ein echter Friedrich. Genauso muss das mit Ihrem Gemälde laufen. Wenn wir uns nicht sicher sind, lassen wir die Finger von dem Geschäft, egal wie hoch unsere Provisionen sein werden.« Wieder machte Simon eine kurze Pause. »Und dann muss Ihnen doch auch klar sein«, sagte er ernst, »dass wir Ihr Bild nicht einfach so anbieten können. Die Fehlenden, oder sagen wir, die unvollständigen Dokumente sind wirklich ein Problem, vorerst zumindest.«
»Das verstehe ich nicht, Sie reden von Dokumenten. Ich dachte es würde Ihnen lediglich ein Herkunftsnachweis für das Bild fehlen?«, fragte Edmund Linz.
»Zunächst einmal müssen wir die Laboranalyse wiederholen, aber diesmal mit einem beeideten Untersuchungsbericht, mit Stempel und so. Als Zweites muss das Gemälde einem noch lebenden Kunsthistoriker vorgelegt werden, am besten einem Fachmann zum Thema Expressionismus oder für das neunzehnte Jahrhundert. Und dann kommt noch der schwierigste Teil, wir brauchen einen Herkunftsnachweis, am besten von einer Galerie oder aus einer Ausstellung. Schön wäre es, wenn wir einen Katalog fänden, in dem unser Gemälde abgebildet ist.«
»Und wenn es keine Ausstellung gab?«, fragte Edmund Linz mit leicht provozierender Stimme. »Die erneuten Laboruntersuchungen und das Gutachten sehe ich ja ein und akzeptiere ich auch, aber wenn es nun wirklich keine Ausstellung gegeben hat, wenn das Bild also seit seiner Entstehung nur im privaten Umfeld aufbewahrt wurde, wie die letzten acht Jahre in meiner Villa, was ist dann? Ich habe das Bild zwar Freunden gezeigt, aber keiner hat Fotos für einen Katalog gemacht oder gar einen Artikel darüber geschrieben, was für eine tolle Kunstsammlung ich besitze. Was ist, wenn das gleiche für alle Vorbesitzer des Gemäldes gilt, wenn auch sie ihren Schatz für sich behalten und versteckt haben?«
Edmund Linz redete sich beinahe in Rage. Nachdem er geendet hatte, schwiegen die beiden Männer und sahen sich nur über den Besprechungstisch hinweg an. Simon räusperte sich schließlich. Er legte die Hände auf die Tischplatte und beugte sich nach vorne, in Richtung seines Gastes.
»Ich bin mir sicher«, sagte er beschwichtigend. »Ich bin mir wirklich sicher, dass es irgendein anderes Dokument gibt, aus dem hervorgeht, dass dieses Bild echt ist. Soweit ich es beurteilen kann, sieht das hier nicht wie eine Fälschung aus.«
Edmund Linz zögerte kurz. »Gut, ich verstehe, Sie brauchen eben noch diesen Herkunftsnachweis, bevor Sie das Bild einer Auktion zuführen, aber was schlagen Sie vor, wie soll ich an so etwas herankommen?«
»Ich sage ja nicht, dass Sie es sein müssen, der einen Herkunftsnachweis besorgt. Wir sind ein Kunst- und Auktionshaus und haben unsere Methoden und Quellen.«
Er stand vom Besprechungstisch auf und ging zu seinem Schreibtisch. »Sie haben nichts dagegen, wenn ich einen meiner Mitarbeiter dazuhole?«
Edmund Linz schüttelte den Kopf. Simon drückte auf eine Taste seines Telefons und nahm den Hörer ab.
»Frau Hoischen, suchen Sie Herrn Kühler und fragen Sie ihn, ob er kurz zu mir ins Büro kommen kann.« Er legte den Hörer wieder auf. »Herr Kühler ist mein Stellvertreter.«
Edmund Linz nickte, schien aber schon in Gedanken zu sein. Simon sah ihn noch kurz an, ging dann aber zum Fenster und zog erneut die Jalousie herunter. Er schaltete auch die Deckenstrahler wieder ein und setzte sich schließlich an den Besprechungstisch zurück. Der Holzkoffer lag direkt vor ihm. Er hob das Bild heraus, um es flach auf die Tischplatte zu legen. Er sah sich das Gemälde noch einmal genau an. Dann klopfte es auch schon an der Tür und Heinz Kühler betrat den Raum.