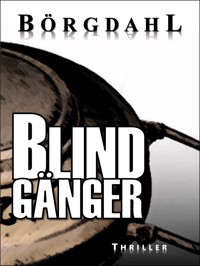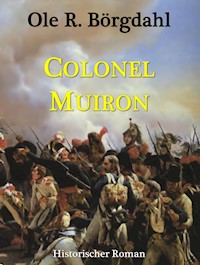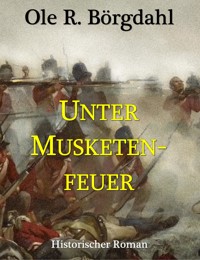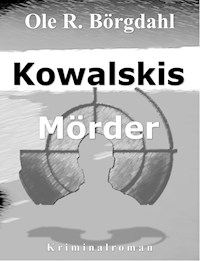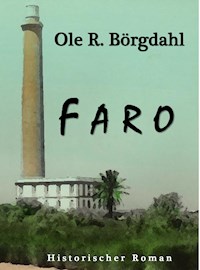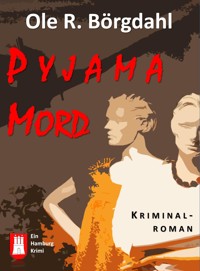Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: 2
- Sprache: Deutsch
Welches Geheimnis verbirgt die schöne Bellevie? Kapten Falk Marten Hanson hat nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Er muss zurück nach Paris, wo die Sieger die Abdankung Kaiser Napoléon Bonapartes verhandeln. Als Falk nach Versailles zurückkehrt, ist Bellevie verschwunden. Seine Suche nach ihr ist vergebens und er fragt sich, ob er sie jemals wiedersehen wird, als er sich erneut im Sog der Ereignisse des Jahres 1814 befindet. Schweden gehört nicht zu den Signaturmächten, die Napoléon in die Verbannung nach Elba schicken und so bekommt Falk einen besonderen Auftrag. Er folgt dem Kaiser von Elba ins Exil und erlebt auf der friedlichen Mittelmeerinsel einen Menschen, der nach außen hin geläutert scheint, in dem aber immer noch der Tatendrang des Imperators brodelt. Beinahe wird Falk zum Instrument von Napoléons Flucht. Dann beginnt in Frankreich die Herrschaft der Hundert Tage, während Falk schließlich ins heimatliche Lomma zurückehrt. Er glaubt schon, seine Zeit der Abenteuer sei vorüber, da ereilt ihn der Ruf seines ehemaligen Kommandanten. Falk wird als Beobachter nach Brüssel geschickt. Am Vorabend von Waterloo bricht er zu dem kleinen Dorf Ligny auf, in dem sich Napoléon und Feldmarschall Blücher gegenüberstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 641
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ole R. Börgdahl
Der Kaiser von Elba
Falk-Hanson-Reihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Das Buch
Prolog
Stunde der Royalisten
Elba
Die Gärten von Elba
Die Faucon
Flucht von Elba
Wieder in der Heimat
Waterloo
Personenverzeichnis
Impressum neobooks
Das Buch
.
Der Kaiser von Elba
.
Welches Geheimnis verbirgt die schöne Bellevie? Kapten Falk Marten Hanson hat nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. Er muss zurück nach Paris, wo die Sieger die Abdankung Kaiser Napoléon Bonapartes verhandeln. Als Falk nach Versailles zurückkehrt, ist Bellevie verschwunden. Seine Suche nach ihr ist vergebens und er fragt sich, ob er sie jemals wiedersehen wird, als er sich erneut im Sog der Ereignisse des Jahres 1814 befindet. Schweden gehört nicht zu den Signaturmächten, die Napoléon in die Verbannung nach Elba schicken und so bekommt Falk einen besonderen Auftrag. Er folgt dem Kaiser von Elba ins Exil und erlebt auf der friedlichen Mittelmeerinsel einen Menschen, der nach außen hin geläutert scheint, in dem aber immer noch der Tatendrang des Imperators brodelt. Beinahe wird Falk zum Instrument von Napoléons Flucht. Dann beginnt in Frankreich die Herrschaft der Hundert Tage, während Falk schließlich ins heimatliche Lomma zurückkehrt. Er glaubt schon, seine Zeit der Abenteuer sei vorüber, da ereilt ihn der Ruf seines ehemaligen Kommandanten. Falk wird als Beobachter nach Brüssel geschickt. Am Vorabend von Waterloo bricht er zu dem kleinen Dorf Ligny auf, in dem sich Napoléon und Feldmarschall Blücher gegenüberstehen.
Zweiter Band der historischen Falk-Hanson-Reihe.
Prolog
.
.
Mit einem Satz stand ich mitten im Zimmer und wusste sofort, dass ich einen Fehler begangen hatte. Ich wurde von hinten ergriffen, starke Arme legten sich um meinen Leib, drückten zu, ließen mir keinen Spielraum, meine Stichwaffe einzusetzen. Ich spürte, dass man mir die Luft nehmen wollte. Eine dritte Hand war plötzlich an meinem Gürtel, zog eine der Pistolen heraus. Mit letzter Kraft wand ich mich, verschaffte mir etwas Freiheit, die mir aber sofort genommen wurde. Dann blickte ich plötzlich in das Gesicht einer Frau, die drei, vier Yards von mir entfernt in einen Sessel gedrückt saß. Sie hatte tiefblaue Augen, in denen das Entsetzen stand, was ihre Schönheit aber bei weitem nicht entstellte. Dunkelbraunes, langes Haar umrahmte ihr blasses Gesicht und fiel ihr über Schultern und Dekolleté. Zu ihren Füßen kauerte ein Junge von zehn, zwölf Jahren, der seinen Peiniger hasserfüllt ansah. Der Mann bedrohte Mutter und Kind mit einer scharf blitzenden Sichel.
Mir war nicht gleich bewusst, warum ich das alles so deutlich sah, bis mich die Laterne blendete, die mir jetzt direkt ins Gesicht gehalten wurde. Dies veranlasste mich, einen weiteren Befreiungsversuch zu unternehmen. Ich stemmte mich gegen den Fußboden, warf meinen Kopf zurück. Ein Schuss zerriss jedes andere Geräusch in dem Raum. Es war ohrenbetäubend. Glühende Pulverreste verbrannten mir sofort das Gesicht, Rauch stach mir in die Augen. Eine warme, zähe Flüssigkeit rann mir von der Schläfe über das Gesicht. Ich roch Blut, ein metallischer Geschmack im Mundwinkel, aber ich verspürte überhaupt keinen Schmerz. Das Licht blendete mich plötzlich nicht mehr und ich machte einen letzten Versuch mich zu wehren.
Ich stemmte mich erneut gegen den Fußboden, drückte mich diesmal aber nach hinten und spürte überhaupt keinen Widerstand mehr. Der Griff um meinen Leib hatte sich längst gelockert. Ich stolperte rückwärts, verlor das Gleichgewicht, landete mit dem Rücken auf einem Körper und rutschte sofort seitlich ab. Dies war mein Glück, denn sofort drang die Spitze der Sichel in den Körper des Mannes ein, der mich noch Sekunden zuvor von hinten festgehalten hatte. Die Laterne stand jetzt am Boden, erhellte nur die Stiefel und die Beine des Angreifers, der die Waffe aus dem Leib seines toten Kameraden zu lösen versuchte.
Ich schaffte es auf die Knie, wurde gewahr, dass ich mein Schwertbajonett noch immer fest in der Rechten hielt und setzte es auch sofort ein. Mein Gegner war blitzschnell, sah meinen Schlag kommen, ließ den Griff der noch feststeckenden Sichel los, kam auf die Beine und zog etwas aus seinem Gürtel. Der Mann befand sich weiterhin im Schein der Laterne, die aber nur seine Beine und den Unterleib erhellte. Dann sah ich die Mündung einer Pistole auf mich gerichtet, die im selben Moment nach oben gerissen wurde. Der Schuss löste sich, etwas rieselte von der Decke. Es folgte ein derber Fluch auf Französisch. Erst jetzt begriff ich, was passiert war. Der Junge war aufgesprungen, hatte sich von hinten gegen die Knie des Angreifers geworfen und ihn zu Fall gebracht. Jetzt aber war das Kind in großer Gefahr. Die Frau schrie auf, als der Angreifer mit der schweren Pistole nach dem Jungen schlagen wollte.
Ich konnte das Schwertbajonett nicht einsetzen, ohne nicht auch den Jungen in Gefahr zu bringen. Ich hielt es daher zur Seite weg, sprang mit der Schulter voran auf die ungeschützte Flanke des Angreifers zu und traf ihn schwer auf seine Rippen. Er brüllte vor Schmerz, denn ich hatte ihm bestimmt zwei oder drei Knochen gebrochen. Kraftlos wollte der Mann jetzt mit der Pistole nach mir schlagen. Ich aber schob mich weiter zwischen ihn und den Jungen und konnte endlich mit dem Schwertbajonett zustoßen. Ich rammte dem Angreifer den schweren Griff mitten ins Gesicht. Der Schlag traf Nase und Augenpartie, ein weiterer Knochen brach, Blut spritzte und der Mann war endgültig außer Gefecht gesetzt, ja sogar auf der Stelle tot, da ich ihm den Schädel zertrümmert hatte.
Ich sah mich sofort nach dem Jungen um, der wie erstarrt mit dem Rücken zu mir hockte. Ich folgte seinem Blick. Erst jetzt kam mir noch einmal alles ins Bewusstsein, alles, was sich ereignet hatte, seitdem ich vor weniger als einer Minute ins Zimmer gestürmt war. Während die Frau und der Junge mit der Sichel bedroht wurden, hatte mich ein zweiter Mann von hinten gepackt und ein Dritter es geschafft, mir die Pistole aus dem Gürtel zu winden. Meine Gegenwehr löste den Schuss aus dieser Pistole und streckte den Mann nieder, der mich umklammert hielt. Und jetzt war es der dritte Angreifer, der ein scharfes Messer an die Kehle der Frau gesetzt hatte. In der rechten Hand umklammerte er sogar noch die verschossene Pistole, die er mir zuvor entwendet hatte und die er, obwohl sie nutzlos war, drohend auf mich richtete.
Ich erstarrte, als ich sah, wie sich die scharfe Klinge in der Hand des Angreifers gegen den ungeschützten Hals der Frau drückte und an der Schneide ein erster Blutstropfen hervortrat. Ich war entsetzt, aber mein Gegenüber musste darin meine Entschlossenheit vermutet haben. Sein Blick wanderte kurz über den Boden, zu seinen niedergestreckten Kameraden. Seine Messerhand zuckte, aber anstatt den tödlichen Schnitt auszuführen, nahm er die Klinge etwas zurück. Ein weiterer, diesmal hektischer Blick nach links zum Fenster und schon hatte er zum Sprung angesetzt, wollte fliehen, drehte sich mit der Schulter zur Scheibe und wollte hindurchstürzen.
Bei mir löste dieses Handeln jedoch einen Instinkt aus oder war es ein Reflex oder von beidem etwas oder etwas ganz Anderes? Ich ließ das Schwertbajonett aus meiner rechten Hand fallen und noch bevor es den Boden erreichte, zog ich mit der Linken meine zweite Pistole aus dem Gürtel. Zum Glück hatte ich die Waffe nicht schon eingesetzt und so war noch dieser eine Schuss frei. In Fortsetzung einer fließenden Bewegung ging ich in die Hocke, spannte mit der rechten Hand den Hahn, zielte in Richtung Fenster und drückte den Abzug durch. Als mein rechtes Knie den Fußboden berührte, verhüllte mir bereits der Pulverrauch die Sicht auf die Szene.
*
Eine halbe Stunde später wurde ein verängstigtes Dienstmädchen, das sich in einer Mansarde unter dem Dach versteckt hatte, nach zwei Gärtnern geschickt. Die Männer stellten keine Fragen, als sie mir dabei halfen, die fünf Leichen, die der nächtliche Überfall hervorgebracht hatte, in die Scheune umzulagern. Wir trennten dabei den unglücklichen Diener von den Körpern des Räuberpacks.
Als dies erledigt war, fing ich auch mein Pferd wieder ein und fand nahe am Haus einen offenen Unterstand, der für die Nacht reichen musste, denn in der Scheune konnte ich das Tier schlecht unterbringen, das schon unruhig wurde, als es den Tod nur witterte, was für ein Militärpferd keine empfehlende Eigenschaft war. In der Zwischenzeit hatte sich die Hausherrin mit dem Jungen, ihrem Sohn, ins obere Stockwerk zurückgezogen, wofür ich durchaus Verständnis zeigte. Ihren Namen und den genauen Ort, an dem ich mich befand, erfuhr ich zunächst nur über das Dienstmädchen. Und so hielt ich einen Moment inne und überdachte die Ereignisse dieses Tages.
Ich hatte mich am 3. April des Jahres 1814 preußischen Truppen angeschlossen und war von Paris kommend in die Stadt Versailles eingeritten. Die Schlacht um die französische Hauptstadt war bereits am 31. März von der Koalition entschieden worden, dies jedoch ohne den l'Empereur Napoléon Bonaparte im Felde besiegt zu haben. Und so gab es Gerüchte, Napoléon würde zu einem Befreiungsschlag aufmarschieren, um noch die Wende zu erreichen. Dies war dem Kaiser der Franzosen durchaus zuzutrauen und so gingen die Preußen in die Offensive. In Versailles jedoch, trafen sie auf eine verlassene Garnison und hatten selbst das Problem, die eigenen, zahlreichen Truppen in dem eher kleinen Ort unterzubringen. Und so streifte ich an diesem Abend durch den Park von Versailles, selbst auf der Suche nach einem nächtlichen Logis.
Im Verlaufe dieser Suche kam es dazu, dass ich zum Retter von Madame Durant und ihres Sohnes wurde, dessen am Rande des Versailler Parks gelegenes Herrenhaus das Ziel einer mörderischen Räuberbande geworden war. Die Schurken hatten sich in der Residenz des Parkverwalters reiche Beute versprochen, was sich für sie aber nicht ergab. Und so kam ich noch gerade rechtzeitig, um eine Entführung oder gar eine Ermordung zu verhindern.
Das Dienstmädchen holte mich schließlich wieder aus meinen Gedanken zurück. Auf Wunsch von Madame Durant, wie sie ausdrücklich betonte, war bereits etwas für mich vorbereitet. Ich bekam in der Küche eine warme Mahlzeit und mir wurden meine Wunden versorgt, die ich bei dem Kampf davongetragen hatte. Hierbei handelte es sich um eine harmlose Schnittwunde am Arm und um ein paar Pulververbrennungen im Gesicht, die allerdings sehr schmerzhaft waren. Das Dienstmädchen hatte mit derartigen Verletzungen offenbar ihre Erfahrungen und bestrich die Verbrennungen mit einer dicken Salbe und legte auch noch Verbände darüber an. Auf diese Weise gestärkt und versorgt wartete im Erdgeschoss die Hausbibliothek auf mich, wo mir eine Bettstatt auf einem breiten Sofa hergerichtet war.
Am nächsten Morgen stand ich schon früh auf, um mich der Angelegenheit weiter anzunehmen. Noch vor dem Frühstück und noch bevor ich der Hausherrin meine Aufwartung machen konnte, suchte ich einen der preußischen Kommandeure auf, die jetzt in Versailles etwas zu sagen hatten. Ich erfuhr, dass in den Tagen der Auflösung das Chaos in Versailles ausgebrochen war. Es gab unter den Franzosen keine Zuständigkeiten mehr, die Polizei war mehrheitlich ins Feld gezogen, um die Hauptstadt zu verteidigen, was bekanntermaßen nicht gelungen war. Die Besatzer hatten jetzt das Heft in die Hand zu nehmen, solange, bis wieder Ordnung herrschte.
Ich kehrte also mit einem preußischen Trupp zum Herrenhaus zurück und uns wurden die Leichen der Räuber abgenommen und der Vorfall in den Akten verzeichnet, die tatsächlich auch in dieser Übergangszeit existierten. Die Leiche des unglücklichen Dieners, dessen Ermordung ich unmittelbar mit angesehen hatte, war längst von seinen Angehörigen abtransportiert worden. Im Herrenhaus selbst war geputzt worden, um die Spuren des Überfalls zu tilgen. Und in dem Raum, in dem der Hauptkampf stattgefunden hatte, waren alle Fenster aufgerissen, das eine notdürftig geflickt, wobei es immer noch stark nach Lauge roch.
Als ich mich dort schließlich niedersetzte, kam das Dienstmädchen mit einem Tablett herein, knickste und gab mir die Ankündigung, dass die Herrin nun ebenfalls gleich erscheinen wolle. Dann deckte sie ein kleines Tischchen ein, stellte zwei Tassen, Teller, Gabeln, Teelöffel darauf und schließlich eine Platte mit Gebäck sowie eine kleine Kanne, die einen herrlichen Duft nach frischem Kaffee verströmte. Das Mädchen zog sich zurück und ich war versucht, etwas Gebäck zu nehmen. Ich beherrschte mich, lehnte mich in meinem Stuhl zurück und schlug die Beine übereinander.
So musste ich noch gut zehn Minuten warten, als es schließlich an der Tür klopfte, die sich gleich darauf öffnete. Ich richtete mich erst in meinem Stuhl auf, erhob mich dann aber sofort, als die Hausherrin eintrat. Sie schob den Jungen vor sich her, der eine tiefe Verbeugung machte. Ich erwiderte die Verbeugung und zog sofort einen Sessel an das gedeckte Tischchen.
»Nein, bitte nicht diesen!« Madame Durant seufzte. »Entschuldigen Sie, aber dieses Möbel werde ich entsorgen lassen.«
Ich verstand sofort, denn der Sessel war jener, in dem Madame Durant auf so schändliche Weise festgehalten und gequält worden war. Ich schob das Möbel in die äußerste Ecke des Raumes, sah mich stattdessen nach zwei Stühlen um und bot Mutter und Sohn die neuen Plätze an.
»Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.«
Sie ließ ihren Sohn auf einem der Stühle Platz nehmen, trat selbst aber vor mich und reichte mir die Hand.
»Ich muss mich Ihnen doch zunächst einmal vorstellen und mich entschuldigen, dass ich gestern nicht mehr auf Ihre Nachricht geantwortet habe, Herr Kapten Hanson.« Sie räusperte sich. »Mein Name ist Bellevie Charlotte Durant und das ist mein Sohn Philippe.«
Der Junge erhob sich hastig von seinem Stuhl und machte erneut einen Diener und setzte sich wieder. Madame Durant lächelte über den Eifer ihres Sohnes.
»Philippe ist sehr beeindruckt von Ihrer Tat.«
»Oh, Madame, ich glaube, ich muss mich eher bei Philippe bedanken. Die Pistole des Schurken war bereits auf mich gerichtet, als durch sein Eingreifen der tödliche Schuss umgelenkt wurde.« Ich verbeugte mich vor dem Jungen, der verlegen seine Mutter ansah.
Madame Durant schüttelte den Kopf. »Nein, wir sind in Ihrer Schuld, da Sie es gewagt haben … aber ich will es mir nicht wieder in Erinnerung rufen, es hat uns doch sehr mitgenommen, weshalb wir uns auch so schnell zurückgezogen haben.«
»Ich bitte Sie, Madame, dafür habe ich vollstes Verständnis, es war auch für mich ein aufregendes Ereignis. Ich habe mir erlaubt, der Obrigkeit Bericht zu erstatten. Dieser Ort hier steht unter Kriegsrecht und ich möchte nicht, dass Sie noch weitere Unannehmlichkeiten haben, wenn hier eine Untersuchung stattfindet.«
»Eine Untersuchung?«, wiederholte Madame Durant. »Ich verstehe nicht.« Sie räusperte sich und wandte sich an ihren Sohn. »Philippe, würdest du bitte zu Julie in die Küche gehen. Sie darf dir zu essen geben, wenn du hungrig bist.«
Der Junge gehorchte sofort, erhob sich von seinem Stuhl, vollzog einen weiteren, artigen Diener in meine Richtung und verließ den Raum. Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, sah Madame Durant mich wieder an, wobei sie einen ernsten Gesichtsausdruck annahm.
»Glauben Sie, dass wir Schwierigkeiten bekommen? Es sind immerhin Menschen gestorben, der arme Paul, ich weiß gar nicht, was ich seiner Familie sagen soll. Er hat eine alte Mutter, für die er gesorgt hat und …« Sie stutzte. »Entschuldigen Sie, aber mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf.«
»Nein, nein, das ist schon in Ordnung, dafür habe ich vollstes Verständnis, Madame, und darum habe ich die Angelegenheit für Sie auch schon geregelt, wenn das überhaupt möglich ist.«
»Ich weiß nicht, es ist alles so schrecklich. Wir haben kein Geld und es gibt auch nichts von Wert im Haus und dafür musste der arme Paul sterben und nicht nur er.«
»Es ist Krieg«, sagte ich. »Machen Sie sich keine Gedanken, warum das geschehen ist, es hätte jeden treffen können. Es wird sicher noch etwas dauern, bis die Zeiten wieder ruhiger werden.«
Sie nickte, sah mich dabei mit ihren hellblauen Augen eindringlich an, so dass ich beinahe verlegen wurde.
»Aber verzeihen Sie«, sagte sie plötzlich. »Ich habe noch gar nicht gefragt, wie es Ihnen geht. Sie wurden verletzt, ich sehe doch die schlimmen Verbrennungen in Ihrem Gesicht. Sie müssen mir sagen, was Sie sonst noch im Kampf mit diesen Männern davongetragen haben.«
»Es ist nicht so schlimm.« Ich berührte die Stellen in meinem Gesicht. Die Verbände hatte ich bereits abgenommen, aber es haftete noch die Salbe auf meiner Haut.
»Nein, es ist schlimm, ich sehe es doch.« Sie überlegte. »Ich habe bereits erfahren, dass die Preußen in Versailles sind, Truppen, sehr viele Soldaten, und alles sucht Quartier. Wenn es Ihnen genügt, können Sie sich auch in den kommenden Nächten in der Bibliothek einrichten.«
»Das kann ich nicht annehmen«, sagte ich, ohne es wirklich so zu meinen. »Ich finde ganz bestimmt woanders Quartier und außerdem werde ich bald wieder nach Paris beordert. Ich gehöre schließlich nicht zu Barclay de Tollys Leuten.«
»Sie sind Schwede, Herr Kapten, stehen denn auch schwedische Truppen in Paris?«
»Die Koalition steht in und vor Paris«, antwortete ich zögerlich, weil ich sofort an ein Verhör dachte, aber dennoch davon überzeugt war, dass Madame Durants Frage harmlos war. »Sie wissen sicherlich, dass die Koalition aus Russen, Preußen, Österreichern und auch aus Schweden besteht.«
Sie nickte zögerlich. »Ich bin nicht so gut informiert, wie Sie vielleicht glauben. Und ich biete Ihnen Quartier aus Selbstschutz. Mit Ihnen im Haus fühlen mein Sohn und ich uns sicherer. Sie können auch einige Ihrer Leute in der Scheune unterbringen, das wäre mir sogar sehr recht.«
»Dann sage ich zu, muss Ihnen aber leider mitteilen, dass ich alleine bin. Aber was heißt alleine, die preußische Armee sorgt hier jetzt für Ordnung, wenn es notwendig ist. Und falls ein Großteil der Kontingente auch abgezogen wird, weil Ihr Kaiser noch nicht kapituliert hat, dann verbleiben aber immer noch genug Truppen in Versailles.«
»Der Kaiser, Napoléon Bonaparte? Dann ist der Krieg noch nicht vorüber?«
»Ich versichere Ihnen, Madame Durant, es ist vorüber, es ist nur noch eine Sache von Verhandlungen. Napoléon hat die Bedingungen für einen Frieden ganz sicher schon erhalten, aber das ist Politik, von der ich auch nicht viel verstehe. Die nächsten Tage werden ganz sicher Klarheit über die Zukunft Frankreichs bringen.«
»Die nächsten Tage?« Sie nickte. »Dann müssen Sie bis dahin zusagen, meinem Sohn und mir beizustehen und bei uns Quartier nehmen. Bitte, Herr Kapten Hanson, sagen Sie zu.«
*
Es fiel mir nicht schwer, ihrer Bitte zu entsprechen, denn Madame Bellevie Durant war wirklich eine sehr schöne Frau und erinnerte mich schon bei unserer ersten dramatischen Begegnung an eine unglückliche Liebe, der ich wenige Monate zuvor in Lübeck nachgehangen hatte. Damals war ich Louisa Brinckhoff in der Buchhandlung ihres Vaters begegnet, hatte mich sofort in sie verliebt, musste dann aber schmerzlich feststellen, dass sie sich bereits einem anderen Mann versprochen hatte.
Und dies nicht genug, verstand Louisa mein ungeschicktes Werben falsch und zog mich in eine Intrige hinein. Denn Louisas Auserwählter, den ich damals so beneidete, fand bei ihrem Vater keine Zustimmung. So wurde ich als Bräutigam ausgegeben, um den Vater zu erpressen, weil ich mit meiner Frau selbstverständlich von Lübeck in meine schwedische Heimat ziehen würde. Und genau diese Trennung von der Tochter sollte für den Vater schlimmer sein, als einen nicht standesgemäßen Schwiegersohn zu akzeptieren.
Ich ließ mich auf Louisas Spiel ein, trat dann aber von der Bühne dieses im Grunde gemeinen Stücks ab. Ich musste Lübeck für ein paar Wochen verlassen, um an der Belagerung Glückstadts teilzunehmen. Nach meiner Rückkehr erfuhr ich, dass die Dinge einen ganz anderen Lauf genommen hatten. Louisa hatte mit ihrer wahren Liebe Lübeck verlassen, war vor dem Vater geflüchtet, der seinerseits das Paar in Richtung Berlin verfolgte. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem auch ich Lübeck endgültig verlassen musste, erfuhr ich nicht, was aus dem Drama geworden war.
Und jetzt war es Madame Durant, die mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Sie hatte das gleiche faszinierende Blau in ihren Augen wie jene Louisa Brinckhoff und auch dieses üppige, dunkle Haar, das bei ihr allerdings nicht tief schwarz, sondern dunkelbraun war und dabei im Sonnenlicht in einem reizvollen Rotton glänzte. Aber was machte ich da, dass ich es wagte, die beiden Frauen miteinander zu vergleichen, dass ich überhaupt einen Gedanken daran verloren hatte. Obwohl es Louisa bei weitem nicht an Selbstbewusstsein und Zielstrebigkeit gemangelt hatte, fehlte ihr doch etwas. Und dieses Etwas konnte ich anfangs nicht greifen, dann fiel mir der Wesenszug dieses Unterschieds jedoch ein. Madame Durant war reifer und dadurch unerreichbar für mich. Dies lag nicht alleine daran, dass sie mit Philippe bereits einen zehnjährigen Sohn hatte. Es gab noch weitere Merkmale dieser Reife, die ich nicht in Worte fassen konnte. Alles jedoch mündete in eine Form der Bewunderung, die ich für diese Frau entwickelte und die es mir immer schwerer machte, mich in ihrer Gegenwart unbefangen zu verhalten. Ich musste immer mehr eine Verlegenheit überspielen, die ins Unermessliche anwuchs, wenn sie mir während unserer Spaziergänge näherkam oder wenn sie mich sogar das eine oder andere Mal berührte, wenn sie mich auf etwas aufmerksam machen wollte.
Noch am Tag nach dem Überfall machten wir nämlich einen Spaziergang durch den Petit Parc von Versailles. Sie zeigte mir die Gärten und Anlagen und da ich wenig davon verstand, führte sie ihre Erklärungen weiter aus. Versailles war ein großangelegter Barockgarten mit dem flachen, nur niedrig bepflanzten Parterre, auf dem auch an diesem Tag zahlreiche Gärtner und Gehilfen ihrer Arbeit nachgingen. Madame Durant begrüßte die Leute und wurde selbst dabei mit höflichem Diener oder Knicks geehrt. Die Männer und Frauen hatten Respekt vor ihr, was mich ebenfalls beeindruckte und sie noch ferner von mir rückte.
Danach lernte ich, was ein Boskett, ein Lustwäldchen, ist und so hatte das Labyrinth aus Bäumen seine Erklärung. Es blieb allerdings nur bei der Erklärung, weil mir Madame Durant vor allem die große Orangerie zeigen wollte. Denn hier züchtete sie sogar selbst einige Blumensorten, die gerade jetzt mit dem beginnenden Frühling kräftig wuchsen und auch schon in Blüte standen, und dies ein, zwei Wochen vor der Zeit, weil die Pflanzen im Garten der Orangerie in Gewächshäusern gezogen wurden.
Madame Durant war also Floristin und ich nahm an, sie belieferte mit ihrem Betrieb die nahe Hauptstadt. Ich beließ es bei meiner Annahme, fragte sie nicht weiter nach ihrer Profession, weil ich auch nicht zu viel von ihr erfahren wollte, was meine Schwärmerei für sie abrupt hätte beenden können. Und so hörte ich ihr nur zu, wie sie mir ihre Blumen erklärte, obwohl ich mich für dieses Fachgebiet bisher noch nie ernsthaft interessiert hatte. Jetzt jedoch bekamen die Farben und die Düfte der Blumen für mich eine ganz andere Bedeutung.
Der Nachmittag ging viel zu schnell dahin und wir kehrten zum Herrenhaus zurück, wo uns Philippe euphorisch begrüßte. Ich hätte gerne noch mit Mutter und Sohn den Nachmittagsimbiss eingenommen, den das Dienstmädchen Julie für uns vorbereitet hatte, aber es kam anders. Im Haus erwartete mich eine Nachricht und zwang mich zu einem Besuch beim Standortkommandanten. Ich ließ mir also mein Pferd satteln, um den Hin- und Rückweg möglichst schnell zu absolvieren, aber es nützte nichts, denn ich wurde bei einer Besprechung festgehalten, bei der ich als passiver Vertreter des schwedischen Teils der Koalition auftrat. Den Begriff des passiven Vertreters verwendete man mir gegenüber, weil die letzte Phase des Krieges gegen Napoléon von Preußen, Russen und Österreichern ausgetragen wurde.
Als ich mit der beginnenden Nacht wieder im Herrenhaus eintraf, waren Madame Durant und ihr Sohn längst zu Bett gegangen. Julie bereitete mir aber noch ein Nachtmahl zu, mit dem ich mich in die Bibliothek zurückzog. Da meine Gedanken immer wieder zu Madame Durant wanderten und ich den Tag, den ich mit ihr verbracht hatte, noch einmal Revue passieren ließ, wollte ich mich schließlich doch ablenken. Ich wandte mich also den Büchern zu, die sehr zahlreich auf drei hohen Regalwänden des Raumes verteilt waren. In der ersten Stunde war ich noch eifrig bemüht, die botanischen Werke zu verstehen, um vielleicht mit dem neuen Wissen bei einem weiteren Besuch in der Orangerie zu glänzen. Dann wurde mir aber doch schnell langweilig und meine Gedanken wanderten erneut zu der schönen Bellevie. Ich legte mich schließlich auch zur Ruhe und schlief ein, in Erwartung und Vorfreude auf den nächsten Tag.
*
Das Frühstück nahm ich ganz alleine ein. Ich ließ mir Zeit, in der Hoffnung auf Gesellschaft, die aber ausblieb. Erst als ich mir eine letzte Tasse Kaffee einschenkte, kam ich auf den Gedanken, das Dienstmädchen Julie nach ihrer Herrin zu fragen. Meine Überraschung war sehr groß, als ich erfuhr, dass Madame Durant schon sehr früh aufgestanden und längst zur Orangerie gegangen war, um dort die Arbeiten zu beaufsichtigen. Jetzt hatte ich es natürlich sehr eilig, ebenfalls aufzubrechen, als Philippe in die Küche gestürzt kam.
»Monsieur Hanson!«, platzte es aus ihm heraus, als er mich sah. Er war etwas außer Atem und musste sich erst sammeln, bevor er weitersprach. »Ponto stirbt.«
»Ponto«, wiederholte ich und dachte an ein Pferd.
»Er ist ganz heiß und hechelt so fürchterlich«, fuhr Philippe fort. »Bitte kommen Sie mit, Sie müssen helfen, ihn zu retten.«
Philippe hatte schon meine Hand ergriffen und zog mich halb aus meinem Stuhl. Ich stellte schnell die noch volle Kaffeetasse auf den Küchentisch und folgte dem Jungen, der mich wieder losgelassen hatte und vorausgeeilt war. Wir rannten aus dem Haus und Philippe führte mich zur Scheune und hinein in die hinterste Ecke. Dort kniete er sich schließlich ins Stroh, etwas seitlich, so dass ich auch noch Platz neben ihm fand. In dem fahlen Licht erkannte ich den zusammengekrümmten Körper eines Hundes.
»Oh Gott, er atmet schon nicht mehr«, rief Philippe entsetzt.
Ich berührte das struppige Fell, legte meine Hand auf den Bauch des Tieres und benötigte einige Sekunden um einen schwachen Herzschlag zu ertasten.
»Wir brauchen Licht, wir müssen mehr sehen«, sagte ich, griff unter das Stroh und hob die arme Kreatur auf.
Vorsichtig ging ich durch die Scheune ins Freie, gefolgt von Philippe, der dann noch einmal umkehrte und weiteres Stroh vom Boden aufnahm. Er rannte an mir vorbei, blieb auf dem Hof stehen. Ich trat mit meiner gebrechlich wirkenden Last in die Sonne und sah mich um.
»Zur Tränke, leg das Stroh davor«, rief ich.
Philippe breitete eine Lage aus, rannte dann sofort wieder in die Scheune und kam mit weiterem Stroh zurück, das er zusammengerafft vor seiner Brust trug. Als er die Unterlage vollständig ausgepolstert hatte, legte ich den Hund darauf, der mittlerweile aus seiner Schlaffheit erwacht war und instinktiv begann meine Hände zu lecken. Dies währte aber nicht lange und der jetzt zitternde Körper sank ganz aufs Stroh zurück.
»Was ist mit ihm?«, fragte Philippe aufgeregt. »Ich will nicht, dass er stirbt, er darf nicht sterben?«
Ich schüttelte den Kopf und begann das Tier zu untersuchen. Mit den Händen tastete ich den Bauch und den ganzen Rumpf ab und suchte nach Verletzungen. Ich erinnerte mich an unseren alten Hofhund auf dem Anwesen meiner Eltern in Lomma, der vor Jahren von einem ausgewachsenen Elch einen bösen Tritt erhalten hatte. An unserer Küste kamen Elche nur selten vor, dennoch hatte sich seinerzeit ein riesiger Bulle auf unseren Hof verirrt, wo er gebührend empfangen wurde. Der Elch ließ sich aber nicht vertreiben, teilte vielmehr selbst aus und erwischte den alten Pelle, als dieser sich in einer Hinterhand des ungebetenen Gastes verbeißen wollte.
Die Sache endete dann doch mit dem Abzug des Elchs, den wir später auch nie wieder in unserer Gegend zu sehen bekamen. Auf der Verlustliste stand jedoch unser armer Pelle. Wir brachten ihn ins Dorf zum Barbier, der bei den Bauern auch das Vieh behandelte. Und das, was ich jetzt mit Philippes Hund anstellte, hatte ich bei unserem Barbier in Lomma gelernt. Da ich nirgendswo Blut oder eine offene Wunde sehen konnte, tastete ich nach inneren Verletzungen, fand aber an Rumpf und Gliedern nichts. Zum Schluss nahm ich mir den Kopf vor. Ponto öffnete noch einmal kurz die Augen und ein leises Winseln war zu vernehmen, das aber sofort wieder erstarb.
Auf der Schädeldecke, etwas tiefer neben dem linken Ohr wurde ich schließlich fündig. Ich machte eine Wölbung aus, eine Beule, die von weichem, beinahe schwammigem Gewebe umschlossen war. Ich vermutete eine Ansammlung von Blut, gequetschte Adern, wie sie nach einem kräftigen Schlag beim Menschen zu sichtbaren, blauen Flecken führten. Und wenn es ein sehr heftiger Schlag war, sogar zu Knochenbrüchen. Ich war jetzt sehr vorsichtig, weil ich annehmen musste, dass der arme Ponto einen Schädelbruch erlitten hatte. Ich suchte nach Hinweisen, drückte sanft und dennoch mit ausreichender Kraft, aber zum Glück gab der Knochen an keiner Stelle nach.
Ich deutete auf die Beule an Pontos Schädel, die Philippe jetzt auch sehen konnte. »Wie ist das passiert?«
»Ich weiß es nicht, ich habe ihn so gefunden, er lag hinter den Büschen dort.«
Philippe zeigte in die Richtung. Es war in etwa die Stelle, an der ich den toten Hund gefunden hatte, unmittelbar bevor ich mich in den Kampf gegen die Räuberbande stürzte. Ich war mir sicher, dass der Hund tot war, und zwar mit aufgeschlitztem Bauch, da ja auch mein Pferd beim Geruch des Blutes zurückscheute. Oder hatte ich mich geirrt, war das Ponto, der aber noch lebte?
»Lag da nicht auch ein toter Hund, dort vor dem Gebüsch?«, fragte ich Philippe.
Er nickte. »Das war einer der Jagdhunde. Die Meute ist vor ein paar Tagen abgezogen, sie haben ihn zurückgelassen und jetzt ist er tot.«
Ich verstand zwar nicht genau, was Philippe meinte, ich hatte mich aber wenigstens nicht geirrt. Jetzt widmete ich mich wieder dem armen Ponto, dessen Augen zu flackern begannen. Sie hatten ihn offensichtlich nicht mit ihren Messern erwischt, ihm dafür aber einen heftigen Schlag auf den Kopf zugefügt. Ich konnte keinen Knochenbruch feststellen, aber das bedeutete nicht, dass die Verletzung harmlos war. Pontos Zustand jedenfalls schien sehr ernst zu sein. Ich legte meine Hand noch einmal auf seinen Brustkorb und spürte wie das Herz in einem Moment raste und im nächsten fast still zu stehen schien.
»Lass ihn uns wieder in die Scheune bringen«, sagte ich schließlich zu Philippe. »Er sollte sehr viel Ruhe bekommen. Suche eine geschützte, versteckte Ecke und stelle ihm reichlich Wasser hin. Vielleicht musst Du ihm auch zu trinken einflößen. Zu essen benötigt er vorläufig nicht, es sei denn, er kann wieder auf eigenen Beinen stehen.«
Während Philippe in der Scheune alles vorbereitete, tastete ich Ponto ein zweites Mal ab, fand außer der Beule am Kopf erneut keine anderen Verletzungen. Ich streichelte das braungraue, zottelige Fell als Philippe wieder zu mir stieß, damit wir Ponto umbetten konnten.
»Was ist das für eine Rasse?«, fragte ich.
»Ein Laekenois, ein Hirtenhund, er kommt aus dem Wallonischen. Mein Großvater hat ihn mir geschenkt, er darf nicht sterben.«
»Er wird auch nicht sterben«, sagte ich. »Du musst ihn jetzt in Ruhe lassen und nur darauf achten, dass er sein Wasser bekommt.«
Ich wusste nicht, ob mein Rat das Leben des Hundes rettete, aber ich spürte, dass meine Worte Philippe beruhigten. Ich ließ mir die Stelle in der Scheune zeigen und legte Ponto dort nieder. Philippe stellte eine flache Schüssel vor die Schnauze des Hundes und füllte sie bis zum Rand mit frischem Wasser aus dem Brunnen im Hof. Wir standen noch ein paar Minuten andächtig vor Pontos Lager, zogen uns dann zurück. Philippe ging ins Haus, während ich mich zu einem Spaziergang Richtung Orangerie aufmachte.
*
Ich hoffte Madame Durant in der Orangerie anzutreffen, unternahm vorher aber noch einen Umweg über das Schloss Versailles, da ich mich bei der preußischen Kommandantur nach neuen Befehlen erkundigen wollte. Ich befand mich immer noch in der Rolle eines Beobachters. Die Gemeinsamkeit zwischen mir und den Preußen unter Generalfeldmarschall Barclay de Tolly bestand allerdings darin, dass wir zur Nordarmee unter dem schwedischen Kronprinzen Karl Johann gehörten, dem ehemaligen französischen Maréchal Jean Baptiste Bernadotte, meinem zukünftigen König.
Versailles war weiterhin vom Korps Bülow besetzt. In einem Seitenflügel des Schlosses waren einige Büros eingerichtet und mir kam die rege Geschäftigkeit der Stabsoffiziere sehr bekannt vor. Ich traf auf einen jungen Hauptmann, der mich über die Lage in Kenntnis setzte. Paris war gefallen und in der Hand der Koalition. Dies hatte ich selbst miterlebt, hatte selbst im Gefecht gestanden, aber wir hatten nicht gegen den Kaiser der Franzosen gekämpft, sondern gegen seine Maréchaux de Marmont und Mortier, die noch rechtzeitig in die Hauptstadt zurückgekehrt waren, um uns die Einnahme von Paris mit viel Blut bezahlen zulassen.
»Bonaparte sitzt jetzt und heute in Fontainebleau«, klärte mich der Hauptmann auf. Er legte eine Karte auf den Tisch und wir beugten uns darüber.
»Wie weit ist das?«, fragte ich.
»Gut fünfunddreißig Meilen von Paris entfernt. Es reicht also ein Tagesmarsch und die Schlacht entbrennt von neuem.«
Der Hauptmann tippte mit der Spitze eines Brieföffners auf die Karte und zog einen Bogen.
»Wir könnten ihm den Weg abschneiden, aber wie es derzeit aussieht, also was wir so aus Fontainebleau hören …« Er zögerte.
»Sie können frei sprechen«, forderte ich ihn auf, »ich gehöre zu Major Kungsholms Leuten.«
Er nickte. »Jedenfalls haben wir Nachrichten aus Fontainebleau. Napoléon hat seine Maréchaux um sich versammelt, die, die es noch zu ihm geschafft haben. Jedenfalls scheint sich die Lage zu verändern.«
»Was meinen Sie damit?«
Der Hauptmann zog eine Depesche aus der Schublade des Schreibtisches und gab sie mir. Während ich las, klärte er mich über den Inhalt auf.
»Ney hat sich ihm entgegengestellt. Sein Kaiser wollte gegen Paris ziehen, aber Ney hat auf ihn eingeredet. Ich denke sie haben Napoléon die Gefolgschaft verweigert. Es gibt keinen Marsch auf Paris, wir bleiben weiter hier und warten ab.«
»Und Sie meinen nicht, dass das eine Finte ist?« Ich bemühte die Karte. »Ein Gewaltmarsch, ein großer Bogen, das sind höchstens sechzig Meilen, die ein Napoléon in zwei Tagen schafft. Er kommt dann von Norden nach Paris und wir rennen von Versailles aus ins Leere.«
Der junge Hauptmann schüttelte den Kopf. »Unsere Nachrichten sind sicher. Napoléon soll bereits an den Bedingungen arbeiten, unter denen er der Koalition eine Abdankung anbietet.«
Ich zögerte, nickte dann aber. »Sie werden recht haben. Ich muss jetzt auch Korrespondenz mit meinem Vorgesetzten halten. Vielleicht bekomme ich neue Befehle oder ist schon etwas für mich eingegangen?«
»Mir liegt nichts vor und der Bote aus dem Hauptquartier ist heute Morgen bereits da gewesen. Wenn Sie sich beeilen, lasse ich ihn zurückhalten, damit er etwas von Ihnen mitnehmen kann.«
Der Hauptmann deutete auf einen der Schreibtische und bot mir dort neben einem Platz auch Papier, Feder und Tinte an. Ich setzte mich auch sofort hin und begann meinen Eindruck von der Lage in Versailles niederzuschreiben. Alles andere, was ich von dem Hauptmann erfahren hatte, brauchte ich nicht zu berichten, da ich davon ausging, dass diese Nachrichten längst Major Kungsholm und den Stab des Kronprinzen erreicht hatten.
Ich beendete mein Schriftstück, schlug es ein und verwendete ein Siegel unserer preußischen Verbündeten. Ich war dabei, als der Bote meinen Brief in seiner Dokumententasche verstaute und der Mann sofort sein Pferd bestieg und losritt. Ich verabschiedete mich vom Hauptmann und trat endlich meinen Weg zur Orangerie an. Ich fand einen Durchgang, kam hinter das Schloss und nahm eine der flachen Treppen, die links und rechts hinunter auf die Ebene des Orangeriegartens führten.
Ich befürchtete schon, Madame Durant nicht mehr anzutreffen. Und ich musste sie tatsächlich in dem Gewirr aus Gängen und Gewächshäusern suchen. Denn obwohl ich nach ihr fragte, erhielt ich nur unzureichend Auskunft von den zumeist sehr zurückhaltenden Arbeitern, denen ich in den Anlagen begegnete. Ich fand Bellevie schließlich an einem Tisch sitzend, der im Freien vor einem großen Beet mit frühblühendem Lavendel aufgebaut war.
Sie schrieb irgendwelche Zahlen in eine Liste und ich beobachtete sie dabei einige Minuten. Sie war so auf ihre Schreibarbeit konzentriert, dass sie mich nicht gleich bemerkte. Daher hatte ich Gelegenheit ihr schönes Gesicht zu betrachten, das umrahmt von ihrem rotbraunen Haar Anmut und etwas Edles ausstrahlte, was mir zu beschreiben schwerfiel. Dann blickte sie auf und ich bildete mir ein, dass ihre blauen Augen zu strahlen begannen. Ihr Lächeln aber, nahm mir plötzlich jeden Mut. Ich wurde sogar verlegen und begann sie unbeabsichtigt anzustarren. Und ich hoffe nicht, dass es so aussah, als sei ich entrückt, obwohl ich mich genauso fühlte.
»Sie kommen spät«, sagte sie zu mir.
Ich zögerte kurz, fand dann aber wieder zu mir selbst. »Oh, haben sie auf mich gewartet?«
»Nein, nein, aber Philippe hat sie wohl überholt. Er war vor zehn Minuten hier und suchte sie. Er war sicher, sie seien vom Haus Richtung Orangerie gegangen, als er sie das letzte Mal gesehen hat.«
»Ach so, ja, das ist auch ganz richtig, dann bin ich aber doch zum Schloss hoch. Ich hatte Pflichten, Sie verstehen?«
»Selbstverständlich hat ein schwedischer Offizier Pflichten«, sagte Madame Durant und lächelte.
Ich war versucht, ihr von den Neuigkeiten zu berichten, davon, dass der Krieg ein Ende gefunden hatte und dass Napoléon Bonaparte, dass ihr Kaiser, zur Abdankung bereit sei. Ich unterließ es, da es mir nicht angebracht erschien. Sie hatte keinen Grund, sich darüber zu freuen, dass man ihre Nation besiegt und ihren Herrscher erniedrigt hatte.
»Was sind denn Ihre Pflichten, Madame Durant?«, fragte ich stattdessen.
Sie lächelte erneut. »Mir sind die Bücher anvertraut, obwohl ich gar nicht weiß, wie es hier jetzt weitergehen soll. Meine Vorgesetzten, wenn ich sie so nennen darf, haben diesen Ort nämlich auch verlassen. Das Schloss und die Gärten sind ohne Führung und ich denke, obwohl ihre Armee in Versailles jetzt für Recht und Ordnung sorgt, hat sie doch im Moment wohl wenig Interesse an unseren Blumen und Gehölzen. Leider ist nicht Winter, sondern ganz im Gegenteil eine sehr entscheidende Gartenzeit, so dass ich hier nichts ruhenlassen kann.«
»Das ist doch eine herrliche Pflicht, Blumen und Garten«, sagte ich euphorisch. »Sie müssen mir glauben, dass mich das sehr interessiert. Als ich vor wenigen Tagen erfuhr, dass es nach Versailles geht, habe ich mich schon darauf gefreut, den Park zu sehen. Und Ihre Führung gestern hat mir bewiesen, wie recht ich hatte.«
Dies war eine Lüge, die ich aber überhaupt nicht bereute, denn Madame Durant schenkte mir ein weiteres Lächeln, herzlicher als das vorherige.
»Sie müssen mir zeigen, was sie hier noch alles machen«, legte ich nach. »Meine Mutter hat uns Kinder schon früh zur Gartenarbeit erzogen, wofür ich ihr ewig dankbar bin.«
Meine zweite Lüge war noch ungeheuerlicher. Es war genau das Gegenteil. Mein älterer Bruder Elias und ich wurden zum Unkraut jäten gepresst. Meine Mutter bewirtschaftete einen recht großen Küchengarten. Wir hassten es, dort zu arbeiten, machten alles nur nachlässig, bis unsere Mutter es endlich mit uns aufgab.
Meine Lügen konnten jetzt und hier von Madame Durant nicht entlarvt werden. Ich sah neben einem Beet einen Spaten stecken und zog ihn aus dem Erdreich.
»Hätte ich mehr Zeit, würde ich mich liebend gerne hier austoben und ihnen selbstverständlich zur Hand gehen.«
Sie lachte. »Dafür gibt es im Park genügend Personal, aber wenn sie sich austoben müssen, wird es sicherlich Gelegenheit dazu geben. Meine Arbeit an diesem Ort sieht etwas anders aus.«
»Das müssen Sie mir unbedingt erklären«, sagte ich und trat endlich näher.
Den Spaten hielt ich dabei noch in der Hand, legte ihn aber gleich ins Gras, als Madame Durant einen zweiten Stuhl aufklappte, der an dem Tisch lehnte, an dem sie vor ihren Listen saß. Ich überwand meine Verlegenheit jetzt vollständig und schon saß ich neben ihr, so dicht, wie bei unseren bisherigen Gesprächen es noch nie der Fall war. Den wunderbaren Duft, den ihr Haar verströmte, hatte ich zuvor schon wahrgenommen. In diesem Moment jedoch traf er mich so angenehm und intensiv, dass ich erneut weiche Knie bekam und meine Verlegenheit zurückkehrte.
Sie deutete auf das Blatt Papier, an dem sie schrieb, und wollte mir die Bedeutung der Zahlen erklären. Ich hörte aber nur auf ihre Stimme und blickte seitlich auf ihren Mund und die sich bewegenden Lippen. Ich hatte Angst, mich zu vergessen und sie genau dort zu küssen. Ich musste mir schnell etwas überlegen, um nicht doch noch das Unverzeihliche zu tun.
»Das ist sehr interessant, aber können Sie mir nicht zuvor hier alles zeigen. Ich möchte unbedingt sehen, was es in der Orangerie an Pflanzen und Bäumen gibt.«
Zusätzlich rettete ich mich, indem ich sofort aufsprang und beinahe den Klappstuhl umgerissen hätte.
Sie sah mich zunächst verwundert an, nickte dann aber. »Gut, ich sitze selbst schon viel zu lange hier, machen wir also eine Begehung.«
In der folgenden Stunde hörte ich ihr kaum zu, oder nein, ich lauschte ihrer Stimme, ich mochte den Klang ihrer Stimme. Sie bemühte sich in meiner Gegenwart immer besonders deutlich und etwas langsamer zu sprechen, als sie es tat, wenn mit sie Philippe sprach oder Anweisungen an das Dienstmädchen gab. Ich bildete mir schon ein, dass mein Französisch gut war, und ich versuchte auch schneller zu sprechen, meine Worte besser zu betonen, aber es gelang mir vielleicht nicht so recht. Es kam sogar zwei-, dreimal vor, dass sie mich sehr charmant korrigierte, was mir jedes Mal einen Stich versetzte, weil ich so gerne bei ihr Unterricht genommen hätte.
Ich folgte ihr also durch diesen alten Gärtnertempel, wie sie ihn selbst bezeichnete, und suchte nach Gelegenheiten, ihr Fragen zu stellen. Natürlich wollte ich mehr über sie erfahren. Und das Dringendste, wo war ihr Mann, wo war Philippes Vater, war Bellevie überhaupt verheiratet. In der vergangenen Nacht war ich schwer eingeschlafen, hatte gegrübelt, hatte mir eine Vita für Bellevie erdacht, die meiner Sehnsucht förderlicher war. So stellte ich mir vor, dass sie nicht Philippes Mutter, sondern Tante war, dass sie den Jungen in den Kriegswirren bei sich aufgenommen hatte. Sie war die unverheiratete Tante. Mit diesen Gedanken, mit dieser Wunschvorstellung war ich eingeschlafen und am Morgen war ich davon überzeugt, von Bellevie und mir geträumt zu haben.
Ich blieb feige, während mir die Orangerie ausführlich gezeigt wurde, ich aber nichts davon mitbekam. Eine Sache merkte ich mir dann aber doch, weil Bellevie die Existenz eines Mannes andeutete, ohne direkt von ihm zu sprechen. Es gab jemanden, für den sie arbeitete, wobei sie keine Untergebene war. Vielleicht hatte ich es auch falsch verstanden. Jedenfalls begriff ich, dass der große Park nach und nach umgestaltet werden sollte und dass Bellevie die Auswahl der Anpflanzungen plante. Daher auch ihre Listen. Sie sprach sogar von der Rodung des Jagdwaldes, der dem Park angeschlossen war.
Dann war die Führung beendet und ich hätte mich so gerne wieder neben Bellevie an den Schreibtisch gesetzt. Es hätte sich nicht gehört und ich hatte auch keinen Grund dazu, außer meiner Verliebtheit, die sich noch einmal steigerte. Bellevie erinnerte schließlich daran, dass Philippe mich gesucht hatte. Ich konnte mir schon denken warum und erzählte ihr von Ponto, aber sie kannte die Geschichte bereits. Und so verabschiedete ich mich von ihr und war überglücklich, dass sie in Aussicht stellte, am späten Nachmittag gemeinsam einen Imbiss einzunehmen. Sie wollte bis dahin zurück im Herrenhaus sein.
*
Ich hatte natürlich mit Befehlen von Major Kungsholm gerechnet und so verließ ich nach drei schönen aber auch leidvollen Tagen die Stadt Versailles Richtung Paris. Beim Abschied von Bellevie und Philippe versicherte ich, in den nächsten Tagen zurück zu sein, dabei wusste ich wirklich nicht, ob ich dieses Versprechen einhalten konnte, denn noch war ich Angehöriger einer Armee. Ich trug weiterhin die preußischen Farben, als ich nach einem Zwölfmeilenritt in Paris eintraf. Es gab vor den Toren der Stadt noch immer russische Posten und ich wurde dort trotz meiner Papiere aufgehalten.
Bevor ich einen Boten in die Stadt schicken konnte, um Major Kungsholm über meine Ankunft zu informieren, traf ich auf einen Freund, mit dem ich erst wenige Tage zuvor gegen die französischen Verteidiger gekämpft hatte. Micha rief nach meinem Namen, als ich mich gerade vor eine Bank gehockt hatte, deren Sitzfläche ich als Schreibunterlage verwenden wollte. Ich sah auf, musste meine Augen mit der Hand gegen Sonne abschirmen, doch Micha, der hoch zu Ross saß, schob sich in die mich blendenden Strahlen und grinste über das ganze Gesicht. Michael Wassiljewitsch Kapusta, mein Kampfgefährte mit dem russischen Vater und der schwedischen Mutter, trug den Arm in der Schlinge. Ich erhob mich wieder und er glitt geschickt vom Pferd und umschlang mich mit dem gesunden Arm.
Ich löste mich wieder von ihm und sah ihn an. »Micha, was machst du für Sachen? Was ist mit deinem Arm?«
Er wiegelte ab. »Nur etwas verrenkt. Der Pöbel in den Straßen von Paris lauert uns bei Nacht auf, da haben wir ihnen eine Lektion erteilt. Aber sprich, wie ist es dir bisher ergangen?« Er deutete auf mein Gesicht. »Hast du deinen Kopf in ein Wachfeuer gehalten?« Er lachte.
Ich berichtete ihm in kurzen Worten von meinem Abenteuer in Versailles und ich erzählte ihm auch von Bellevie, wobei ich hier wohl zu schwärmerisch klang.
Er schüttelte den Kopf. »Die Dame hat es dir offenbar angetan.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Sie ist verheiratet, hat einen Sohn. Sie ist wohl auch älter als ich. Ihr Mann wird bei Napoléons Truppen in Fontainebleau sein und ich hoffe, dass ich nicht noch gegen ihn kämpfen muss. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich in die Stadt muss, und zwar zur schwedischen Delegation.«
Micha grinste. »Na ich weiß nicht.« Er überlegte, ließ zu meiner Beruhigung das Thema ruhen. »Du willst in die Stadt und sie lassen dich nicht«, stellte er fest. »Dann hole schon mal dein Pferd, ich regele das für dich.«
Und das tat Micha auch. Fünf Minuten später hatten wir den Posten hinter uns gelassen und Micha betätigte sich als Stadtführer. Es war zwar erst wenige Tage her, dass ich selbst auf Erkundung in Paris war, aber seither hatte sich einiges getan. Die Vertreter der Sieger waren in die Stadt eingezogen. Selbstverständlich hatte der russische Zar Alexander sein Hauptquartier in Paris eingerichtet, aber auch offizielle Delegationen der Österreicher, Preußen und Schweden unterhielten ihre Stabsquartiere. Micha wusste daher, wo er mich abliefern musste. Ich wunderte mich allerdings über die großzügige Stadtvilla, die einen riesigen Park besaß, der auf der einen Seite bis an die Seine heranreichte.
Am Eingangsportal standen wieder russische Posten, weil nur der Zar seine Truppen in die Stadt ließ. Diesmal hatte ich aber keine Probleme Einlass zu finden. Ich verabschiedete mich von Micha, aber nicht, bevor er mich noch zu einem Fest einlud, das am Abend stattfinden sollte. Auf einem kleinen Zettel schrieb er mir die Adresse auf und ich musste ihm versprechen, in jedem Fall zu kommen.
Ich ritt schließlich durch den Park, die geschwungene Auffahrt empor. Auf dem Giebel des großen Hauses wehten die schwedischen Farben und ich nahm instinktiv den Hut ab, da ich glaubte, dass der Kronprinz persönlich zugegen war. Zehn Minuten später wurde ich nicht von Major Kungsholm, sondern von Överste Kungsholm empfangen, der seinen neuen Rang erst seit zwei Tagen innehatte, aber immer noch die alten Abzeichen trug. Ich gratulierte ihm und erfuhr darüber hinaus, dass Karl Johann erst in einigen Tagen in Paris erwartet wurde.
»Er muss sich etwas zurückhalten«, erklärte mir Överste Kungsholm. »Es werden immer noch Stimmen laut, die behaupten, dass Bernadotte seinen einstigen Herrn auf dem französischen Thron belassen will. Derzeit steht dem aber Zar Alexander entschieden entgegen. Zum Glück haben wir gewisse Kontakte ins russische Hauptquartier …«
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber das verstehe ich nicht. Wir kämpfen doch Seite an Seite, warum wird dann nicht auch mit allen Nachrichten offen umgegangen?«
Överste Kungsholm lächelte. »Mich wundert, dass Sie diese Frage stellen. Überlegen Sie doch einmal. Napoléon hat Moskau angezündet, so hat Zar Alexander allen Grund hart gegenüber Frankreich und seinem Kaiser zu sein. Preußen hat ohnehin noch ein Hühnchen mit Napoléon zu rupfen. Dies ist die eine Seite, wobei ich nicht behaupte, dass sich Preußen und Russland grün sind. Aber das ist ja noch nicht alles. Was hat Kaiser Franz von Österreich vor? Sieht er jetzt die Chance, einen ungeliebten Schwiegersohn loszuwerden oder geht ihm Familienbande über alles. Eine einfache Scheidung ist nicht die Lösung, wo es jetzt den kleinen Napoléon Franz Joseph Karl gibt.«
Ich nickte. »Das verstehe ich.«
»Ja, aber verstehen Sie auch unsere Seite?«, fuhr Överste Kungsholm fort. »Der Kronprinz ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das ist zumindest unsere Ansicht. Und auch wenn Bernadotte zwischen Vergangenheit und Zukunft zu trennen vermag, zählt dies alles nichts gegen die Meinung der anderen. Wir haben schon einmal über dieses Thema gesprochen, Sie erinnern sich? Karl Johann ist zu franzosenfreundlich, aber was sollte er anderes sein, er ist ja Franzose, das kann er nicht abschütteln. Dennoch wird er seine Pflicht erfüllen.«
»Was ist mit den Briten?«, fragte ich.
»Die Briten, die werden auch noch ihre Rolle spielen. Die spanische Frage ist ja so gut wie geklärt. Ich bin aber froh, dass die Briten nicht hier auch schon mitmischen.«
»Dann zerbricht die Koalition?«
»Sie haben recht, dass könnte der Außenstehende denken, wenn er das, was ich gesagt habe, näher betrachtet und seine Schlüsse zieht. Aber Sie können versichert sein, nach außen hin und an der Oberfläche ist die Koalition einig gegen Napoléon Bonaparte. Im Inneren, tief drinnen, finden allerdings die heftigsten Kämpfe statt.«
»Kämpfe?«, wiederholte ich.
»Ja, es sind regelrechte Kämpfe, und zwar um Informationen, um Nachrichten. Oft ist es entscheidend, eine Nachricht schon dreißig Minuten früher als die Gegenseite zu haben. Aber warum erzähle ich Ihnen das alles, das können Sie sich ja selbst denken.«
Överste Kungsholm öffnete die schwarze Aktenmappe, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag und zog ein einzelnes Stück Papier hervor. Ich sah, dass es eine Handschrift trug, die an einigen Stellen verschmiert war. Der Överste ahnte, dass ich dieses Detail bemerkt hatte.
»Dies hier wurde in aller Eile abgeschrieben, was durchaus auch verdächtig sein kann, weil der Schreiber vielleicht für die Gegenseite arbeitet und mit Absicht etwas ausgelassen oder neue Inhalte hinzugefügt hat.«
»Sie machen mich neugierig«, sagte ich.
»Genau das sollten Sie auch sein. Aber ich verrate Ihnen, was das ist. Napoléon hat dem Zaren seinen Willen mitgeteilt. Ney und MacDonald und Général Caulaincourt sind heute Vormittag in die Stadt gekommen. Das wurde natürlich geheim gehalten. Der Zar hat sie gleich wieder nach Fontainebleau zurückgeschickt, und zwar mit einem glatten Nein.«
»Nein wozu?«
Överste Kungsholm lächelte und zitierte aus dem Schriftstück, das er noch in der Hand hielt. »Napoléon willigt ein, zugunsten seines dreijährigen Sohnes Napoléon Franz Joseph Karl Bonaparte abzudanken. Die Kaiserin Marie-Louise soll dabei als Regentin des unmündigen Kindes eingesetzt werden. Das ist alles und für den Kaiser der Franzosen ein großer Schritt. Er wird allerdings nicht damit durchkommen, wie wir bereits wissen. Natürlich werden alle Beteiligten der Koalition von dieser Entwicklung unterrichtet, aber das dauert noch, während wir schon Bescheid wissen …«
»Und dieses Wissen nutzen«, erlaubte ich mir, den Satz zu beenden.
»Ganz recht. Wir werden selbst nach Fontainebleau reisen.«
»Dann brechen wir sofort auf?«
»Nein, das wäre zu auffällig«, erklärte Överste Kungsholm. »Es reicht, wenn wir morgen Abend ankommen.«
*
Es war mir ganz recht, den Tag noch in Paris verbringen zu können, obwohl mich Överste Kungsholm nicht sofort gehen ließ, denn zwischen uns fiel zum ersten Mal der Begriff Nachrichtendienst, der nicht so verschwörerisch wie Geheimdienst klang. Der Överste erzählte mir nur, dass er Kontakt zum schwedischen Geheimdienst hatte, dass er auf niedrigster Stufe eingebunden war und ich auf noch niedrigerer Stufe ebenfalls dazugehören sollte. Es ging lediglich um Hilfsdienste und keinesfalls um richtige Spionage. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen, schließlich wollten wir uns nach Fontainebleau begeben, dorthin, wo sich auch Napoléon Bonaparte aufhielt. Ich verstand nur, dass wir die Aufmerksamkeit auf uns lenken sollten, so dass die richtigen Geheimagenten unentdeckt blieben.
Gegen fünf Uhr verließ ich die Stadtvilla. Mein Pferd blieb jedoch bei guter Versorgung in den Stallungen des Quartiers und so schlenderte ich zu Fuß durch den Park. Draußen vor dem Tor mit dem Wachposten suchte ich in meiner Kleidung nach Michas Zettel. Einer der Soldaten warf einen Blick auf die Notiz und erklärte mir sogleich, wie ich die Anschrift finden konnte. Auf den Straßen war nicht viel los und so kam ich gut voran. Ich verlief mich allerdings noch zweimal, wagte es aber nicht, einen Pariser Bürger anzusprechen, da ich ja eine fremde Uniform trug und die Blicke ohnehin auf mich gerichtet schienen.
Als ich fast da war, hörte ich schon ein Rufen. Ich sah mich um, dann nach oben zu einer der Fensterreihen im zweiten Stock des Hauses, und da winkte Micha. Er gab Zeichen und lotste mich zu einem Tor, durch das es in einen Innenhof ging. Ich sollte dort eine Stiege finden und so war es auch. Micha und seine Kameraden bewohnten das ganze Obergeschoss des Hauses. Die Unterbringung war so großzügig, dass immer nur zwei Männer in einem Zimmer logierten. Micha zeigte mir alles und stellte mich seinen Kameraden vor. Und da erkannte ich einige Gesichter wieder, Soldaten, mit denen ich vor ein paar Tagen gegen Paris gezogen war. Ich erfuhr auch, dass die Eskadron keine Verluste erlitten hatte. Es gab ein paar Verletzte und tatsächlich sah ich einige von Michas Kameraden mit Verbänden an Armen, Beinen und Kopf.
»Wir feiern heute ein Fest«, erklärte Micha schließlich, der seinen Arm nicht mehr in der Schlinge trug.
»Das hört sich gut an und wo geht es hin?«
»Nirgends, wir bleiben hier. Wir werden den Hof schmücken, warten noch auf ein paar Gäste und schließen dann das Tor ab.«
Bei dem Wort Gäste zwinkerte er mir zu und ich verstand gleich, was er meinte.
»In Paris gibt es so wunderschöne Frauen. Wir haben ein paar eingeladen, du wirst begeistert sein.« Micha schnalzte mit der Zunge.
Mir war schon klar, von was für Damen er sprach. Während meines Kriegszuges war mir diese Art von Einladung in so mancher kleinen und großen Stadt begegnet. Ich selbst hatte bisher noch nie davon Gebrauch gemacht. Und ich hatte auch diesmal vor, das Trinken, Tanzen und Lachen mit Michas weiblichen Gästen zuzulassen, mehr allerdings nicht. Unwillkürlich musste ich an Bellevie denken, obwohl sie mit dieser Entscheidung nichts zu tun hatte.
Ich bot mich schließlich an, beim Aufbau des Festes zu helfen. Fast das gesamte Mobiliar aus dem oberen Stockwerk wurde nach unten in den Hof gebracht, Stühle, Tische, Bänke und sogar ein paar teure, lederne Sessel. Ich beobachtete, wie eine riesige Feuerstelle mitten auf dem Hof eingerichtet wurde. Ein ganzer Wagen Brennholz kam hereingefahren, wurde von einem Teil der Männer entladen und von zwei weiteren fachmännisch gestapelt. Als es darum ging, ein Metallgestell über der Feuerstelle aufzurichten, half ich wieder mit. Zu meiner großen Überraschung wurde dann ein ganzer Ochse in den Hof gebracht. Das Tier war bereits gehäutet, ausgenommen und kopflos und so wurde es aufgespießt und gleich darauf das Feuer angefacht.
Eine halbe Stunde später durchzog ein herrlicher Duft den Hof und nicht nur mir lief das Wasser im Munde zusammen. Die Vorbereitungen zum Fest gingen weiter und da das Mobiliar aus der Unterkunft nicht reichte, wurden noch zwei Wagenladungen mit Tischen und Bänken hinein in den Hof gefahren. Dann kamen weitere Speisen, Brot, gekochte Kartoffeln, sogar mehrere Töpfe Reis, je zwei Säcke Rote Bete und Kartoffeln und reichlich anderes Gemüse wie Zwiebeln, Weißkohl, Karotten und Tomaten. Auf einer zweiten Feuerstelle wurde ein Wasserkessel angeheizt und ich ließ mir die Zubereitung von Borschtsch erklären, bei dem Schmand oder saure Sahne nicht fehlen durfte.
Ich merkte nicht, wie die Zeit verging. Es dämmerte bereits, als einige von Michas Kameraden zu ihren Instrumenten griffen. Trommeln, Gitarren und vor allem Fiedeln. Die ersten Lieder wurden angestimmt, als vom bereits geschlossenen Tor ein Raunen zu mir drang. Die weiblichen Gäste waren eingetroffen. Die Musik spielte kurz lauter auf, die Männer gruppierten sich auf der einen Seite des Hofs, die etwa dreißig bis vierzig Damen auf der anderen Seite. Jemand sprach eine Begrüßung aus, dann Jubel und Lachen und die Gruppen vermischten sich. Die Damen wurden an die Tische geführt, es wurden ihnen Teller gereicht, aufgetragen und das Essen begann, begleitet von Musik.
Micha und ich schauten uns noch um. Es waren überwiegend junge Frauen gekommen, nicht zu leger aber auch nicht zu zugeknöpft gekleidet. Es waren durchaus recht hübsche Damen darunter und zwei von ihnen entdeckten Micha und mich. Sie lächelten uns an, fanden durch die Menge den Weg zu uns und blieben zögerlich vor uns stehen.
»Die wollen tanzen«, sagte Micha zu mir und schon hatte er die hübschere von beiden an den Händen gepackt und führte sie in Richtung Musik.
Ich zögerte noch, was mein Fehler war, denn ein schlanker Kavallerist kam mir zuvor. Er grinste mich an, machte eine entschuldigende Geste und war schon mit der Dame verschwunden. Ich grollte ihm nicht, denn, wenn ich gewollt hätte, wäre später auch ein Tanz für mich dabei gewesen. Die Tanzpaare wechselten häufig, bis die Musik eine Pause machte. Der Ochse verlor immer mehr an Gewicht und ich labte mich ebenfalls kräftig an dem gut gerösteten Fleisch. Der Borschtsch schmeckte mir anfangs nicht so gut, was sich änderte, nachdem ich von Bier auf einen russischen Kartoffelschnaps umgestiegen war, den mir Micha immer reichlich nachschenkte.
Zum Glück konnte ich ihn noch rechtzeitig aufhalten, mich vollends betrunken zu machen. Ich genoss das Fest, die ausgelassene Freude der Soldaten, das gute und reichliche Essen. Und zu später Stunde hatten sich immer mehr Pärchen gebildet, die sich dezent zurückzogen. Mehr will ich darüber nicht berichten, nur dass sich Micha und ich und eine kleine Gruppe der Übriggebliebenen bei Klampenmusik Geschichten erzählten. Es ging natürlich um den Krieg, um die Verteidigung der russischen Heimat. Ich erfuhr mehr über die Schlachten und über den Triumph, den der Zar letztendlich über den großen Napoléon errungen hatte. Ich selbst erzählte von meiner Gefangenschaft in Erfurt und von meiner Flucht. Die Kameraden stießen daraufhin immer wieder mit mir an, allerdings mit Bierhumpen und nicht mit dem teuflischen Schnaps.
Mit der Zeit ebbte das Fest ab. Gegen Mitternacht zogen sich immer mehr von Michas Kameraden zurück. Und auch mir wurde eine Lagerstatt im Haus angeboten, doch ich erklärte, ins schwedische Hauptquartier zurückkehren zu müssen. Micha wollte mich unbedingt begleiten und schon schloss sich ein Dutzend der noch verbliebenen Männer an. Wir hatten zwar kräftig getrunken, aber waren während der Erzählungen unserer Kriegserlebnisse wieder weitgehend nüchtern geworden. Unser kleiner Tross marschierte durch die Pariser Gassen und Straßen und ich kann behaupten, dass wir nicht allzu laut waren, was dennoch nicht angemessen für die späte oder vielmehr frühe Stunde schien.
Erst als wir in die Nähe einer noch geöffneten Kneipe kamen, wurden unsere Stimmen übertönt. Eine Gruppe Männer stand vor dem Etablissement, trinkend, rauchend und diskutierend. Es wurde Französisch gesprochen. Die Männer in meiner Gruppe verstummten daraufhin sofort. Wir hielten uns auf der gegenüberliegenden Straßenseite dicht an der Häuserfront, begannen regelrecht zu schleichen, wurden aber entdeckt.
Ein erster Ruf hallte über die Straße. »Vive l'empereur Alexandre, vive l'empereur de Russie!«
Die Männer jubelten tatsächlich, aber wir trauten dem Frieden noch nicht. Der Jubelschrei wurde wiederholt und dann bekannte sich die Gruppe zu ihrer eigenen Gesinnung.
»Vive le comte de provence!«
Was ich da hörte war eine Keimzelle des Weißen Terrors, wie er in den kommenden Jahren immer wieder gegenüber den Bonapartisten aufflammte. Der Weiße Terror sollte die Rache der Königstreuen vor allem gegen die Befürworter und Anhänger Napoléons sein. Der Comte de Provence war kein anderer als der künftige französische König, der aus dem Hause Bourbon stammte.
Överste Kungsholm hatte mir von den Überlegungen berichtet, die im Lager der Koalition diskutiert wurden. Die Österreicher wären Napoléons Vorschlag der Abdankung noch am ehesten gefolgt, indem sie den Sohn aus beiden Geschlechtern auf dem französischen Thron sahen. Zar Alexander hatte sogar unseren Kronprinzen genannt, der geboren als Jean-Baptiste Bernadotte in den frühen Jahren des französischen Kaiserreichs ein Weggefährte Napoléons war. Alexander hatte oft aber nicht nur eine Meinung und so war auch beim ihm das Geschlecht der Bourbonen auf der Liste. Dies hatte er gemeinsam mit den Briten erdacht, die in der siegreichen Koalition aber nur eine Nebenrolle spielten. Die Verdienste der Briten wurden jedoch immer größer, da ihre Erfolge in Spanien und Portugal mehr und mehr ins Bewusstsein rückten.
Der letzte französische König, der unglückliche Ludwig XVI., hatte zwei Brüder, die für eine Restauration der Bourbonen Herrschaft in Frankreich als Anwärter bereitstanden. Louis Stanislas Xavier, eben jener Comte de provence, wurde von den Briten auf dem Thron gesehen, während Alexander den etwas jüngeren, aber vitaleren Charles-Philippe favorisierte. Und genau in jenen frühen Tagen des April 1814 schlug die Waage in Richtung des Comte de provence aus, dem späteren Ludwig XVIII. Diese Zusammenhänge wurden mir allerdings erst einige Wochen später bewusst, und ließen mich das, was in jener Nacht passierte im Nachhinein einordnen.