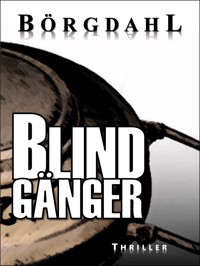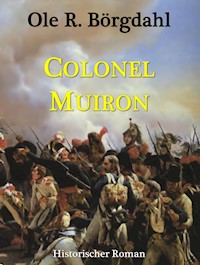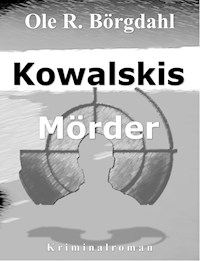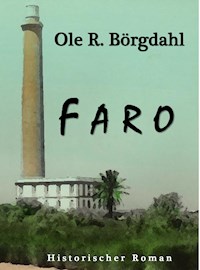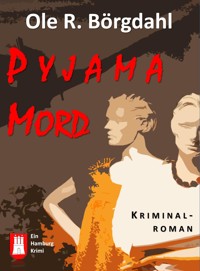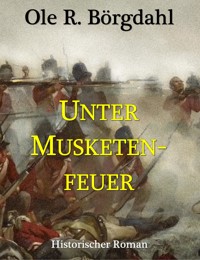
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Falk-Hanson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Falk Marten Hansons Zukunft im schwedischen Lomma ist vorbestimmt. Sein älterer Bruder Elias erhält die Schiffswerft des Vaters, Falk selbst soll die Ziegelei seines kinderlosen Onkels übernehmen. Doch bevor es soweit ist, formiert sich im Jahre 1813 erneut eine Koalition, bestehend aus Russland, Preußen, Österreich und Schweden, gegen den französischen Kaiser Napoléon Bonaparte. Als die Kampfhandlungen des Frühjahrs durch einen befristeten Waffenstillstand unterbrochen sind, stößt Falk zum Stab des schwedischen Kronprinzen Karl Johann. Falk ist in den Krieg gezogen, um Abenteuer zu erleben, findet sich dann aber auf einem langweiligen Schreiberposten wieder. Seine Lage ändert sich erst, nachdem alle Verhandlungen gescheitert sind und der Krieg gegen Napoléon wieder aufgenommen wird. Und zu seinem großen Glück wird Falk zur Truppe der Meldereiter versetzt. Auf dem langen Weg nach Paris erlebt er mit Großbeeren, Dennewitz und schließlich Leipzig seine ersten großen Schlachten und darüber hinaus so manches Abenteuer. Erster Band der historischen Falk-Hanson-Reihe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ole R. Börgdahl
Unter Musketenfeuer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1 Das Buch
2 Prolog
3 In der Nordarmee
4 Großbeeren
5 Dennewitz
6 Leipzig
7 Krieg gegen Dänemark
8 Kosakenwinter
9 Von Châtillon nach Paris
Impressum neobooks
1 Das Buch
.
Unter Musketenfeuer
.
Falk Marten Hansons Zukunft im schwedischen Lomma ist vorbestimmt. Sein älterer Bruder Elias erhält die Schiffswerft des Vaters, Falk selbst soll die Ziegelei seines kinderlosen Onkels übernehmen. Doch bevor es soweit ist, formiert sich im Jahre 1813 erneut eine Koalition, bestehend aus Russland, Preußen, Österreich und Schweden, gegen den französischen Kaiser Napoléon Bonaparte. Als die Kampfhandlungen des Frühjahrs durch einen befristeten Waffenstillstand unterbrochen sind, stößt Falk zum Stab des schwedischen Kronprinzen Karl Johann. Falk ist in den Krieg gezogen, um Abenteuer zu erleben, findet sich dann aber auf einem langweiligen Schreiberposten wieder. Seine Lage ändert sich erst, nachdem alle Verhandlungen gescheitert sind und der Krieg gegen Napoléon wieder aufgenommen wird. Und zu seinem großen Glück wird Falk zur Truppe der Meldereiter versetzt. Auf dem langen Weg nach Paris erlebt er mit Großbeeren, Dennewitz und schließlich Leipzig seine ersten großen Schlachten und darüber hinaus so manches Abenteuer.
Erster Band der historischen Falk-Hanson-Reihe.
2 Prolog
.
.
Mit der Flut und einer ordentlichen Brise zog die Kalmar an diesem frühen Julimorgen aus dem Hafen von Malmö auf die offene See. Ich war der einzige Passagier auf der kleinen Brigg, die eine Ladung von nicht ganz zweihundert Tonnen Mehl beförderte. Sowohl das Mehl, als auch meine Person, waren auf dem Weg in den Krieg gegen die Vorherrschaft Frankreichs über Europa. Die Kalmar sollte am späten Abend dieses Tages in Stralsund einlaufen.
Ich stand auf dem Achterdeck schräg hinter dem Rudergänger und beobachtete, wie die Seeleute aus den Höhen der Masten zurückkehrten. Die Kalmar hatte reichlich Tuch gesetzt, was mir die Absicht des Kapitäns bestätigte, die Fahrt zu beschleunigen, um nicht doch noch nachts in einen unbeleuchteten Hafen einlaufen zu müssen. Und so betrat der Kapitän jetzt auch das Achterdeck und begutachtete die gesetzten Segel. Er wandte sich daraufhin zum Rudergänger, kontrollierte den Kurs und gab dann seine Anweisungen an die Bootsmänner, die Mittschiffs ihre Leute auf Trab hielten. Der Kapitän sah schließlich zu mir. Ein strenger Blick, er schien nämlich nicht erfreut, mich auf dem Achterdeck zu sehen. Wir hatten vor der Abfahrt kurz gesprochen und ich hatte gemerkt, dass er den Umgang mit Passagieren, mit Zivilisten nicht gewohnt war.
Ich nahm den Auftritt des Kapitäns zum Anlass, mich zurückzuziehen. Auf der Kalmar wurde mir natürlich kein Logis zugewiesen, dafür war unsere Reise zu kurz. Ich hatte meinen Seesack im Vorschiff verstaut und so verließ ich das Achterdeck und machte mich auf den Weg dort hin. Ein Matrose rempelte mich an und ich glaubte, es war Absicht, aber ich nahm es hin, sah mir den Kerl noch nicht einmal richtig an. Im Vorschiff lehnte ich mich dann an Steuerbord auf die Reling, an der Stelle, an der ich auch mein Gepäck zwischen Schanzkleid und Decksplanken verkeilt hatte. Später würde ich mich genau an dieser Stelle langlegen und so die Zeit totschlagen.
Doch jetzt war mein Blick auf die offene See gerichtet und ich begann in meinen Gedanken zu versinken. Wie lange hatte ich auf diesen Augenblick, auf diese Reise gewartet. Wie hatte sich mein vorbestimmter Weg geändert. Oder lag nur eine kurze Episode vor mir, wollte mir mein Vater diese eine Freiheit geben, damit nach meiner Rückkehr das Feuer in mir endgültig erloschen und ich bereit und fähig für die Aufgaben war, die zu Hause zu meiner Bestimmung gehörten.
Die Werft meines Vaters war meinem älteren Bruder Elias versprochen. Er hatte längst den ersten Schritt getan, dieses Erbe anzutreten. Er führte die Bauaufsicht, war Herr über die Werkstätten, ging voll und ganz in der Arbeit auf. Er besaß nicht meine Leidenschaft für das Abenteuer, war bodenständig, seit einigen Jahren verheiratet und Vater einer Tochter. So sah sein Glück auf Erden aus.
Also war das Erbe des Vaters vergeben und so wäre für mich der Weg frei gewesen, meinen eigenen Zielen und Träumen zu folgen. Doch schon vor sehr langer Zeit wurde anders entschieden. Mein Onkel Victor Lund, der mit einer Schwester meines Vaters verheiratet war, besaß eine gewaltige Lehmgrube, deren Erträge in der eigenen Ziegelei verarbeitet wurden. Onkel und Tante waren kinderlos und hier sollte ich das Erbe antreten, eine Fabrik leiten, in die nächste Generation überführen.
Elias und ich waren auf unsere Bestimmungen vorbereitet worden, waren gemeinsam drei Jahre in Stockholm zur Schule gegangen, hatten das ehrwürdige Laboratorium mechanicum besucht, hatten alles gelernt, was die heimischen Gewerke der Werft und der Ziegelei uns nicht beibringen konnten. Mathematik, Geodäsie, Geographie, Baukunst, Mechanik, Maschinenkunde und vieles mehr. Mich hätte es damals schon zum Militär gezogen, um eine gleiche und bessere Ausbildung zu erhalten, denn die Ingenieurskunst findet sich von ihren Grundlagen bis zur Vollendung in den Ingenieurscorps, bei den Artilleristen, den Festungs-, Wege- oder Brückenbauern.
Ich wäre auf diese Weise meinem Abenteuer nähergekommen und in die Kriege gegen Russland und Dänemark gezogen. Elias und ich hatten es uns gerade in Stockholm eingerichtet, hatten die vom Vater ausgesuchte Unterkunft bezogen, begannen uns in der Schule zurechtzufinden, als nun das Jahr 1808 mit dem Zwischenfall an der Grenze zu Finnland begann. Ich hatte schon nach einem Weg gesucht, mich unseren Truppen anzuschließen, hatte einen Plan, zum finnischen Oulu überzusetzen und an den Schlachten teilzunehmen. Die Gefechte bei Pyhäjoki, Siikajoki, Revolax und Pulkkila, deren Namen erst Monate später im Lande bekanntwurden, wären meine Feuerprobe und vielleicht auch mein Tod geworden.
Und dann bedrohte Dänemark, von Seeland aus, schwedischen Boden. Hier ließ sich auch Elias mitreißen. Die königlich-schwedische Südarmee stand zwischen Malmö und Helsingborg und war bereit, unsere schonische Heimat zu verteidigen. Für uns waren es unruhige Wochen in Stockholm. Wir wollten uns einziehen lassen, fassten dann aber den Entschluss, selbst ins Aufmarschgebiet zu reisen und uns dort anzudienen. Erneut war der Gang der Ereignisse schneller als unser Handeln. Eine britische Flotte, unsere Verbündeten, verhinderte den dänischen Landgang, der über den Öresund angedacht war. Wochen später erklärten uns die Briefe des Vaters die Lage in der Heimat. Der dänische Krieg fand weit oben in Norwegen statt und brachte am Ende für keine Seite einen Sieg.
Anders sah es mit dem russischen Krieg aus. Unser König verlor Finnland. Und dazu kam, dass mein Studium in den Jahren von 1808 und 1809 gelitten hatte, und das, obwohl ich in keinen der Kriege gezogen war. Elias hatte in dieser Zeit mehr Disziplin bewiesen. Ich musste einiges aufholen, was mir auch gelang, blieb dennoch ein Jahr länger als der Bruder in unserer Hauptstadt. Und als ich das Ende meiner Ausbildung erreicht hatte, konnte ich das erlernte Wissen sogleich anwenden. Mein Vater ließ es zu, dass ich doch noch zu den Soldaten ging. Ich unterschrieb für sechs Monate beim Kanalbau, reiste von Stockholm nach Mem und ließ mir die Landvermesserausrüstung in die Hand drücken. Und während ich den Verlauf des wichtigen Göta-Kanals präzisierte, begannen hinter mir die Soldaten zu graben. Ich war wie ein Heerführer ihnen immer voraus.
Die Arbeit befriedigte mich erstaunlicherweise sehr und füllte den Rest des Jahres 1811 aus. Ich hatte bereits die Papiere zur Unterschrift vor mir, um für ein weiteres halbes Jahr zu verlängern, als ein Brief meines Vaters neue Pläne notwendig machte. So blieb ich nach dem Weihnachtsfest in Lomma, meinem Geburtsort. In der wirtschaftlich schwierigen Zeit nach den Kriegen, waren die großen Betriebe in Malmö eine schwere Konkurrenz für die Werft meines Vaters. Elias war kein Kaufmann, dafür aber der bessere Ingenieur. So kam mir die Aufgabe zu, für Verträge zu sorgen. Ich ging dabei auch den Weg über den Öresund nach Seeland, weil sich das Verhältnis zu Dänemark etwas stabilisiert hatte. Dennoch war Feindseligkeit zu spüren, wo immer ich den Mut hatte aufzutreten.
Mut kann aber etwas bewirken und so zog ich Aufträge in unsere Werft, die Elias nicht glücklich machten. Er musste all sein Talent aufbringen, um die Versprechen einzulösen, die ich den neuen Kunden gegeben hatte. Die Hanson-Werft musste drei Frachtsegler in vier Monaten bauen, einen davon als Zweimaster. Es wurde eng auf der Werft, wir warben Arbeiter aus Malmö an, bezahlten gut, um überhaupt Leute zu finden. Im Mai bekamen wir dann Besuch aus Göteborg, der uns die Aufträge für zwei weitere Frachtsegler daließ, die bis zum September fertig sein mussten. Wie mir unter vorgehaltener Hand mitgeteilt wurde, sollten diese Schiffe nach Sankt Petersburg fahren, um die Beute der Franzosen abzuholen.
Es war seit Anfang des Jahres 1812 kein Geheimnis mehr, dass l'Empereur sich auf das russische Reich stürzen wollte. Die Welt und einige Investoren erwarteten einen großen Sieg. Ich hatte mich monatelang nicht mit Politik beschäftigt, doch plötzlich war wieder dieses Feuer da. Und ich fühlte mich mehr der französischen Sache verbunden, seit unser Thronfolger ein Franzose war.
Kronprinz Karl Johann, bürgerlich geboren als Jean-Baptiste Bernadotte, ein ehemaliger Maréchal d’Empire und mit Wohlwollen Napoléons, zum Nachfolger unseres Königs gewählt und seit Ende des Jahres 1810 adoptierter Sohn. Seither versuchte ich mein Französisch zu perfektionieren, hatte mich seinerzeit in Stockholm in den Clubs und Kreisen aufgehalten, in denen man die Muttersprache unseres künftigen Herrschers sprach. Und ich hatte ihn in Stockholm auch einmal leibhaftig gesehen, zwar nur aus der Ferne, aber das hatte gereicht, um in mir eine Verbindung aufzubauen.
Die hohe Politik geht allerdings Wege, die sich dem gemeinen Volk erst erschließt, nachdem das Weltgeschehen seine Richtung bereits geändert hat. Im Jahre 1812 war ich der festen Überzeugung, Schweden stehe kompromisslos an Frankreichs Seite. Ich wollte mich daher auch der Grande Armée anschließen, deren Truppen in unseren pommerschen Besitzungen standen und dort wohl auf den Marschbefehl in Richtung des russischen Reiches warteten. Ich wusste damals nicht, dass dies schon der Bruch zwischen Bernadotte und Napoléon war, denn unser Kronprinz vertrat selbstverständlich schwedische und damit eigene Interessen.
Das Feuer in mir nahm mir die Sicht auf diese Dinge. Ich hatte meine Pflicht gegenüber Vater und Bruder erfüllt und schiffte mich ohne großen Abschied zu Malmö ein. Und so ereignete es sich, dass ich mich schon einmal auf dem Weg nach Stralsund befand, um in einen Krieg zu ziehen, und das nur wenige Monate zuvor. Ich bin damals allerdings weder in Stralsund noch in einem Krieg angekommen, obwohl ich Überlebender eines Gefechts war.
Es wird ein britisches Kriegsschiff gewesen sein, das unter falscher Flagge in der baltischen See operierte. Ich hatte die Ereignisse an Bord meines Schiffes erst wahrgenommen, als eine Breitseite des Gegners unser Deck verwüstete. Es führte schnell zum Enterkampf, an dem ich mich beteiligen wollte. Doch ehe es dazu kam, noch bevor ich eine Waffe fand und zur Hand nahm, ereignete sich eine gewaltige Explosion. Meine Erinnerung daran kam erst wieder zurück, als ich im Wasser treibend im Nichts erwachte. Der Pulvergeruch war noch schwach in der Luft zu schmecken, ansonsten waren das Meer und der Horizont leer.
Es war von beiden Schiffen oder gar von anderen Überlebenden des Unglücks nichts zu sehen. Ich gelangte später zu der Überzeugung, dass mein Schiff selbst ein Pulverfass gewesen war, was der Gegner nicht wusste und was beiden Kontrahenten zum Verhängnis geworden war. Da waren mir die zweihundert Tonnen Mehl doch lieber, auf denen ich jetzt saß, obwohl ich mich erinnere, dass es einmal in der Nähe von Helsingborg eine Staubexplosion in einer Mühle gab.
Ich trieb damals also hilflos in der kalten See und nur durch großes Glück gab das Meer ein paar Trümmer zurück, die aus den Tiefen des Seemannsgrabs an die Oberfläche gelangten. Darunter war ein fast unversehrtes Beiboot, das zu meiner Rettung wurde. Unter großen Mühen richtete ich das Boot wieder auf, gelangte hinein und trieb auf die dänische Küste zu. Ich landete auf der Insel Møn und schaffte es von dort über Kopenhagen nach Malmö zurück. Zehn Tage nach meiner Abreise meldete ich mich wieder bei meinen Angehörigen. Zurecht verlangte mein Vater, dass ich aus diesem Vorfall lerne. Ich blieb seither in Lomma, arbeitete an der Seite meines Bruders und bekam aus sicherer Entfernung die politischen Veränderungen des Weltgeschehens mit.
*
Ich hatte mich inzwischen auf Deck im Schatten des Schanzkleides ausgestreckt. Mein Seesack diente mir als Kopfstütze. Die Bewegungen des Schiffes waren ruhig, die Mannschaft nicht mehr so beschäftigt, wie zu Beginn der Fahrt. Als ich gerade einmal wieder die Augen geschlossen hatte, spürte ich, wie sich jemand neben mich stellte und leicht gegen meine Stiefelsohlen trat. Ich blickte auf, sah die Gestalt eines Mannes mit Mütze und dunkler Weste, der mich kopfschüttelnd betrachtete.
»Hast mich vorhin nicht erkannt, was?«, sagte er vorwurfsvoll.
Ich richtete mich auf, als er in die Hocke ging. Ich schüttelte den Kopf. Er nahm die Mütze ab. Erst jetzt konnte ich sein Gesicht richtig sehen, ich versuchte mich zu erinnern. Er kam mir jedoch zuvor.
»Björn Holm, ich bin auf der Odette gefahren, war einer von Lars Söders Piraten.«
Und jetzt erkannte ich ihn. Björn Holms Familie stammte aus Lomma, sein Vater war einer unserer Zimmerleute. Den Sohn hatte es aber zur Handelsmarine gezogen. Mir war schon bekannt, dass er schließlich auf der Odette angeheuert hatte.
»Piraten?«, wiederholte ich leise.
Er grinste. »Du weißt doch, was wir gemacht haben.« Björn Holm sah sich kurz um. »Aber dass das hier keiner mitbekommt.« Er zögerte kurz, sah sich noch einmal um. »Du hast ihm doch damals auch geholfen, dem Lars?«, sagte er.
Ich überlegte. »Du meinst die Sache mit der Miliz?«
»Ja, das mit den verdammten Bluthunden. Vor zwei Jahren war das. Wir hatten unser Schmuggelgut gerade gelöscht. Lars hatte noch etwas in Malmö zu erledigen. Da hat ihn wohl jemand verpfiffen. Er ist nicht am Treffpunkt erschienen, da sind wir mit der Odette wieder raus aufs Meer.«
»Stimmt, ich habe ihm geholfen«, sagte ich zögernd.
Und natürlich erinnerte ich mich sofort an jene Nacht. Ein Zufall, dass ich überhaupt zu Besuch in Lomma war. Ich hatte mir vom Kanalbau eine Woche frei genommen. Es war schon nach zehn an diesem Abend. Ich wohnte in einem Nebengebäude auf dem Anwesen meiner Eltern, hatte bereits das Licht gelöscht und mich zu Bett begeben. Ich kann nicht sagen, woher Lars Söder wusste, dass er mich dort und an diesem Tag antreffen würde. Sein leises Klopfen holte mich aus einem merkwürdig unruhigen Schlaf. Ich erkannte ihn nicht sofort, als ich ihm die Tür öffnete.
Lars Söder stammte aus Malmö. Elias und ich hatten ihn aber erst in Stockholm kennengelernt, in unserem ersten Jahr auf dem Laboratorium mechanicum. Er war älter als Elias und ich. Er schloss die Schule lange vor uns ab und fuhr zur See. Erst später hörten wir, dass er sein eigenes Schiff hatte, die Odette. Der verbotene Handel war sein Geschäft, er soll sogar bis nach Amerika gefahren sein, brachte Kaffee, Tee, Tabak und Zucker mit. Bis zum Jahr 1811 konnte er seine Waren gefahrlos in Schweden anlanden. Das Risiko bestand nur, auf dem Weg dorthin abgefangen zu werden. Doch dann war auch das Königreich Schweden gezwungen, härter gegen Schmuggler vorzugehen, die Kontinentalsperre Napoléons durchzusetzen. Dem fiel Lars Söder zum Opfer.
In seiner Not und um der Verfolgung zu entgehen, zog er mich in die Sache hinein. Ich war natürlich bereit ihm zu helfen, nachdem er mich geweckt und mir seine Situation geschildert hatte. Er wollte ein Pferd, um zu entkommen. Ich konnte ihn aber nicht alleine gehenlassen, und so begleitete ich ihn. Wir ritten an der Küste entlang Richtung Norden. Wir versuchten Lars’ Verfolgern zu entkommen. Es gelang nicht. Die Miliz war vorbereitet, rückte auch von Helsingborg aus gegen den Schmuggler vor. Die Musketen krachten bereits hinter uns. Im schnellen Galopp erreichten wir wieder mehr Abstand zur Infanterie der Verfolger.
Lars strebte einem Treffpunkt zu. Er glitt schließlich vom Pferd, verabschiedete sich und stürzte ins Meer. Ich begriff es erst nicht, dann sah ich auf dem Wasser kurz ein Laternenlicht aufflackern. Draußen wartete ein Kutter und noch weiter draußen lag ganz sicher die Odette. Lars musste ein guter Schwimmer sein, um sich zu retten. Ich konnte ihm dabei nicht mehr helfen, ich musste mich selbst in Sicherheit bringen.
Ich nahm sein Pferd am Zügel und ritt in die Brandung hinein, damit sich für die Verfolger die Hufspuren verloren. Ich legte gut dreihundert Yards an der Küste entlang zurück. Erst dann ging ich wieder über den Strand auf das höhergelegene Land und in den Schutz eines Wäldchens. Ich konnte sie von dort aus gut sehen. Sie hatten Laternen und erkannten die Stelle, an der ich mit den Pferden ins Wasser gegangen war. Die Infanterie stellte sich zu Schützenreihen auf, Befehle wurden gegeben und erneut krachten die Musketen.
Ich schätzte die Zeit ab und fragte mich, ob Lars seinen Kutter erreicht hatte. Auf dem Meer war nichts zu sehen. Die Miliz schoss weiter, noch drei, vier Salven. Eine zweite Abteilung suchte den Strand ab. Die Laternen zeigten mir an, wo sich die Männer bewegten. Sie suchten weit ab von meinem Versteck und so blieb ich noch.
Es musste eine halbe Stunde vergangen sein, seit Lars über das Wasser entkommen war. Die Suchtrupps waren wieder zu den Schützen gestoßen, die Miliz hatte sich am Strand in Formation aufgestellt. Die Leute waren schon Abmarsch bereit, als es auf dem Meer plötzlich einen Lichtblitz gab, dem sofort ein Donnern folgte. Ich konnte das Pfeifen hören, dann klatschte die Kanonenkugel, die augenscheinlich von der Odette abgefeuert worden war, nur zehn, zwanzig Yards von der Brandungslinie entfernt ins Wasser. Die Infanterie begann zu rennen. Es machte für sie keinen Sinn, den Angriff mit ihren Musketen zu beantworten. Sie liefen eher Gefahr, weiteres Kanonenfeuer auf sich zu ziehen.
Ich blieb eine weitere halbe Stunde in meinem Versteck und sah auf dem Meer tatsächlich noch einmal einen Laternenschein. Der Moment reichte aus, um zu sehen, dass die Odette unter Segeln stand und sich von der schwedischen Küste entfernte.
»Dann stimmt es, dass du ihm den Hals gerettet hast«, stellte Björn Holm fest. »Er hat damals keinen Namen genannt ...«
»Es ging mir aber doch auch um meine Sicherheit«, unterbrach ich ihn. »Sie hätten das Pferd gefunden und wären dann auf uns gekommen, wenn ich Lars alleine hätte reiten lassen.«
Björn Holm nickte. »Das mag sein. Am Ende hat es ihn dann doch erwischt, ihn, alle Kameraden und die Odette auf den Grund des Meeres gebracht. Eine unserer Fregatten, ein Riese, gegen den die Odette keine Chance hatte. Die Bulletins haben ja alles groß gefeiert. Und heute pfeifen wir auf das was der Franzose sagt und helfen den Engländern und den Russen wo wir nur können. Es hat Lars zu früh erwischt.«
»Und du bist entkommen?«, fragte ich.
»Schicksal. Ich bin von Bord, hatte mir das Bein gebrochen. Einen Monat später ist es dann passiert.«
»Und jetzt?«
»Führe ich ein ruhiges Leben«, sagte Björn Holm. Er zögerte ein, zwei Sekunden. »Ich dachte du seist bald Herr über die Ziegelei und jetzt gehst du zu den Soldaten?«
»Woher weißt du das?«, fragte ich.
»Man hört, was man hört. Du folgst dem Kronprinzen gegen diesen verdammten Napoléon.«
»Das werden wir noch sehen, ob es überhaupt wieder zum Krieg kommt«, antwortete ich ausweichend.
»Der Krieg geht weiter, ist ja nur ein Waffenstillstand.« Björn Holm lächelte. »Der Napoléon sammelt jetzt seine Kräfte und schlägt dann wieder zu, wie schon im Frühjahr. Da wird auch der Bernadotte, dieser andere Franzose, nichts daran ändern können.«
»Was weißt du denn davon?«, fragte ich vorsichtig.
»Was soll ich wissen.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich weiß, dass die Preußen und die Russen in Sachsen stehen. Denen kam der Waffenstillstand ganz recht, aber das wird ihnen am Ende nichts nutzen, auch wenn wir ihnen mit den dreißigtausend Mann zur Seite eilen, die erst kürzlich ausgehoben wurden.«
»Dann bin ich wohl einer von den dreißigtausend«, sagte ich schnell.
»Das ist doch mein Reden. Aber du brauchst mir nicht zu sagen, warum du das machst, ich glaube ich weiß das schon.«
Björn Holm lächelte mich an und ich kommentierte seine letzten Worte nicht weiter. Er erhob sich unvermittelt, nickte mir zu und ging über das Deck nach Achtern. Er ließ mich mit meinen Gedanken zurück, denn jetzt kamen mir noch einmal die Umstände meiner Reise in den Sinn. Was hatte ich selbst unternommen und was waren die Konsequenzen.
Ich hatte schon im letzten Jahr einen Freund meines Vaters konsultiert, ihn um sein Protegieren gebeten, mich in eine militärische Stellung zu bringen. Ich wusste von Anfang an, dass dies nicht ohne den Segen meines Vaters gehen würde und so dauerte es noch, bis eine Entscheidung fiel. Die Politik spann sich inzwischen weiter. Erst Ende März dieses Jahres erschienen die Nachrichten in den seriöseren Gazetten. Im Vertrag zu Örebro hatte Jean-Baptiste Bernadotte den Bruch mit Napoléon endgültig vollzogen. Schweden verpflichtete sich, der Koalition gegen Frankreich beizutreten. Für den bevorstehenden Feldzug sollten von unserer Nation eben diese dreißigtausend Mann gestellt werden. Dies ließ mich noch einmal aufbegehren und ich schrieb zwei Briefe an den Freund meines Vaters.
Aber ich hörte wieder lange nichts, dafür verfolgte ich die Kriegsnachrichten, die in diesem Frühjahr nicht sehr hoffnungsvoll ausfielen. In der Schlacht bei Großgörschen waren Preußen und Russen an Mannschaftsstärke gegenüber den Franzosen weit unterlegen, hatten aber die zahlenmäßig größere Artillerie. Napoléon hatte am Ende zwar die höheren Verluste, holte aber dennoch den Sieg und brachte das Königreich Sachsen wieder unter seine Herrschaft. Den Koalitionstruppen blieb nur die Flucht über die Elbe nach Schlesien.
Über die Schlacht bei Bautzen, die ebenfalls von den Preußen und Russen gegen Napoléon und seinem Maréchal Ney bestritten wurde, hörte ich erst, als bereits der Waffenstillstand vom 4. Juni bekanntgeworden war. In Bautzen hatten die Franzosen abermals mit ihrer überlegenen Armee gewonnen, dennoch fragte sich jeder, warum es nicht das Ende der Koalition bedeutete und es noch zur befristeten Niederlegung der Waffen gekommen war. Es gab in den Zeitungen tatsächlich wilde Spekulationen, die mich aber nicht kümmerten, denn ich war fest davon überzeugt, dass ein Frieden bevorstand.
Und dann hieß es plötzlich, dass man mich für Stabsaufgaben in die neue Armee einberufen wolle. Es waren jetzt nicht mehr nur die ursprünglichen dreißigtausend Schweden, sondern unter dem Kronprinzen Karl Johann wurde die neue Nordarmee formiert, in der auch viele tausend Preußen, Russen und sogar einige Briten dienten.
Ich nahm dieses Angebot an, ohne zu wissen, welche Aufgaben mich in einem Stab erwarteten. Die Musterungsrolle, die mir meinen ersten militärischen Rang zuwies, trug ich bei mir, zusammen mit dem Befehl, dass sich Fänrik Falk Marten Hanson zwischen dem 6. und 8. Juli des Jahres 1813 in Stralsund bei der Eskadron des Kaptens Graf Claus von Hammar einzufinden habe.
3 In der Nordarmee
.
.
Ich hatte noch ein paar Stunden geschlafen und ließ mich auch vom Treiben auf dem Schiff nicht stören. Als ich mich endlich erhob ging der späte Nachmittag bereits in den Abend über. Günstige Winde hatten die Kalmar weit gebracht. Am Horizont glaubte ich einen Küstenstreifen zu erkennen. Ich bückte mich nach meinem Seesack fischte mein gutes Fernrohr heraus. Ich zog es ganz aus und richtete es nach vorne und tatsächlich erkannte ich weit vor uns im Süden eine flache, gerade Küstenlinie. Ich schwenkte mein Teleskop nach Osten und folgte dem fernen Ufer. Ich hatte mich mit der Geographie der Region beschäftigt und meinte auf die Insel Hiddensee zu blicken, an die sich Rügen und weiter im Osten der Bodden mit der Zufahrt nach Stralsund anschlossen.
Und ich wurde bestätigt, als die Kalmar jetzt den Kurs änderte und nach Südosten einschwenkte. Ich stellte mein Fernrohr scharf und war erneut beeindruckt, wie präzise die Linsen gefasst waren und der Mechanik des Tubus folgten. Einige Segelboote fuhren dicht vor der Küste und als ich mich konzentrierte, glaubte ich einzelne Matrosen erkennen zu können. Ich rieb mir noch einmal das rechte Auge, so dass mein Blick erneut klarer wurde.
Ich setzte mein Fernrohr schließlich ab und wog es anerkennend in der Hand. Ich fuhr mit dem Daumen über den tief eingravierten Namen des Optikers. Die Manufaktur Utzschneider war für seine präzisen Gläser bereits weltbekannt. Ein junger Mann wie ich hätte sich ein solches Instrument keinesfalls leisten können, wenn genau dieses Fernrohr nicht seine eigene Geschichte gehabt hätte, die mir jetzt wieder in den Sinn kam.
Karl Ludwig Müller stammte aus München, aber das hatte ich damals noch nicht gewusst, als ich ihm in Stockholm das erste Mal begegnete. Ich saß in der Schänke des Gasthauses, in dem ich hoch unter dem Dach auch ein Zimmer gemietet hatte. Zu dieser Zeit war ich schon aus der Wohngemeinschaft mit meinem Bruder ausgezogen, weil meine Schwägerin nach Stockholm gekommen war. Als richtiger Studiosus zog ich zum Lernen die lebhafte Wirtsstube meiner stickigen, engen Unterkunft vor. Ich hatte sogar meinen Stammplatz in einer Ecke des Lokals. Wer mich kannte, ließ mich in Ruhe, sofern ich über meinen Büchern gebeugt saß oder in meinen Notizen schrieb.
An diesem Tag war allerdings nicht viel Betrieb und dennoch setzte sich ein neuer Gast direkt an meinen Tisch. Ich konzentrierte mich weiter auf eine Zeichnung, die ich gerade anfertigte und beachtete meinen Tischnachbarn nicht weiter. Ich nahm allerdings wahr, dass er zu essen begann und sich immer ein Stück in meine Richtung reckte während er genüsslich kaute. Ich richtete mich schließlich auf, um ebenfalls einen Schluck aus meinem Wasserglas zu trinken.
»Zum Wohl, mein Herr, darf ich mich kurz vorstellen, Müller, Karl Ludwig aus dem fernen Königreich Bayern.« Er lächelte und prostete mir mit seinem Bierhumpen zu. »Ich hoffe, ich störe Sie nicht bei Ihrer Arbeit?«
Er deutete auf die Zeichnung, die vor mir lag. Erst jetzt fiel mir auf, dass sein Schwedisch recht holprig klang und er ein paar deutsche Wörter an Stellen verwendete, an denen er die schwedische Übersetzung offenbar nicht kannte.
»Sie scheinen ja auf dem richtigen Weg zu sein«, fuhr er zögerlich fort, als ich nicht antwortete.
In der Tat war ich etwas verblüfft, nickte nur und sah auf meine Skizze, die mir selbst allerdings nicht so gut gefiel.
»Wenn Sie das Prinzip der Sekantensteigung verstanden haben«, versuchte Karl Ludwig Müller es weiter, »und dann Delta x und Delta y immer weiter und weiter schrumpfen lassen, dann erreichen Sie doch die Tangentensteigung. Sie müssen es nur noch eintragen.«
Er deutete erneut auf meine Zeichnung und ich blickte ebenfalls auf das Blatt. Ich überlegte, nahm dann das Lineal und zog immer noch wortlos eine Tangente an den Kurvenpunkt, dessen Steigung ich berechnen wollte.
Karl Ludwig Müller nickte. »Das wäre die geometrische Lösung, die Sie jetzt mit dem Lineal vermessen können.« Er stutzte. »Sie sind aber wohl kein Mathematiker?«
Ich nutzte diese Frage, um mein Schweigen endlich zu beenden und um mich selbst vorzustellen. Dabei sprach ich auf Deutsch mit ihm. »Falk Marten Hanson, Student am Laboratorium mechanicum, an dem Techniker ausgebildet werden. Die Mathematik ist für uns nur ein Werkzeug, so sagen es zumindest meine Professoren.«
Karl Ludwig Müller schien erleichtert und antwortete in seiner Muttersprache. »Ein Schmied muss nicht nur wissen, welche Form er dem Eisen zu geben hat, er muss auch den Hammer beherrschen, der die Form erzeugt.«
»Ich nehme die Mathematik schon sehr ernst«, erwiderte ich. »Allerdings lerne ich nur das für meinen Beruf später notwendige.«
»Und das entscheiden Sie jetzt schon, wo Sie die Schönheit der Mathematik noch gar nicht gesehen, entschuldigen Sie, begriffen haben?«
Ich war verblüfft, aber auch sehr neugierig, was mir Karl Ludwig Müller sonst noch mitzuteilen hatte. Ich bestellte mir ebenfalls ein Bier und eine Mahlzeit und wir verloren an diesem Nachmittag schnell die Zeit aus den Augen. Die Mathematik war inzwischen sein Fachgebiet, die Optik seine Leidenschaft, aber dennoch war Karl Ludwig Müller studierter Mediziner, obwohl er schon seit Jahren nicht mehr praktiziert hatte. Und so blieben zunächst die Mathematik und die Optik unsere Gesprächsthemen. Folglich trafen wir uns auch an den folgenden Tagen, um unsere Diskussionen fortzuführen. Allerdings waren es keine richtigen Diskussionen, sondern vielmehr Nachhilfestunden für mich. Und wir wechselten dabei immer häufiger ins Schwedische, weil er darauf bestand, die Sprache besser verstehen und sprechen zu wollen.
Da ich als Studiosus in der Regel viel Zeit übrighatte, fiel es mir erst nach einigen Tagen auf, dass Karl Ludwig Müller offenbar keinem Gewerbe nachging. Ich sprach ihn schließlich darauf an und erst dann erfuhr ich, wer er war und welche Absichten ihn nach Stockholm geführt hatten. Er arbeitete für das Mathematisch-Feinmechanische Institut, das mir durchaus als Hersteller präziser Optiken und Messinstrumente bekannt war, das ich aber damals dem preußischen Berlin und nicht dem bayrischen München zugeordnet hätte.
»In London konnte ich nicht länger bleiben, weil mein bayrischer König längst ein Verbündeter Napoléons ist«, erklärte mir Karl Ludwig Müller. »So bin ich fast zwei Jahre in München geblieben und habe dort an der Konstruktion unserer Instrumente mitgearbeitet. Dann aber ist ein sehr verehrter Kollege, der das Institut hier in Stockholm vertreten hat, ganz plötzlich verstorben. Ich habe mich angeboten, seinen Platz einzunehmen und so bin ich in diese an sich sehr schöne Stadt gekommen.«
»Ja aber, wenn man Ihren Kollegen kannte und doch wohl schätzte, warum haben Sie nicht auch Fuß fassen können?«, fragte ich.
Er zuckte mit den Schultern. »Die Stelle war ein halbes Jahr vakant, es gab keinen Kontakt zu unseren Kunden. Dieser Fehler wurde natürlich von unserer Seite, vom Institut begangen. In München konzentriert man sich sehr auf die Wissenschaft und weniger auf das Geschäftliche, obwohl Herr von Utzschneider Unternehmer und Geldgeber ist. Hinzu kommt, dass Stockholm, ja dass Schweden, nicht unser bedeutendster Markt ist. Zudem produzieren wir viel für Frankreich.« Karl Ludwig Müller seufzte. »Und so bin ich fast nur vor verschlossene Türen gelaufen.«
Ich überlegte. »Mikroskope, Teleskope für Sternwarten, das sind doch spezielle Geräte, die nur wenige Menschen handhaben können und noch weniger Institutionen benötigen. Welches Ihrer Instrumente wäre denn für jedermann geeignet?«
»Jedermann?«, wiederholte Karl Ludwig Müller und schüttelte den Kopf. »Es geht um die optischen Wissenschaften, nicht um Farbenspiele mit Prismen für Kinder oder Gaukler.«
»Das meine ich nicht mit Jedermann«, sagte ich schnell. »Sie haben doch bestimmt einen Musterkoffer mit Linsen oder kleineren Instrumenten dabei. Was beinhaltet der, was kann man davon gebrauchen, wenn man kein Botaniker ist oder keine Sternwarte betreibt?«
»Vielleicht wären das unsere sehr guten Handteleskope, aber die sind genauso exklusiv und in der Anschaffung teuer, wie alle unsere Instrumente. Es braucht Kontakte und offene Türen und an beiden fehlt es mir.«
»Haben Sie ein solches Handteleskop dabei?«
Mit dieser Frage von mir nahm für Karl Ludwig Müller der Aufenthalt in Stockholm eine neue Richtung. Er wollte es erst nicht akzeptieren, wollte die großen Errungenschaften auf dem Gebiet der modernen Optik vertreiben und bezeichnete das Utzschneider-Fernrohr sogar als unwürdiges Abfallprodukt. Ich widersprach ihm heftig und das war auch gut so. In den nächsten Wochen hatte ich einen ausgezeichneten Lehrer der Mathematik und lernte diese Disziplin sehr lieben.
Auf der anderen Seite unterstützte ich Karl im Vertrieb der Utzschneider-Fernrohre. Ich besaß als Sohn eines Werftbesitzers einen großen Bekanntenkreis unter schwedischen Kapitänen und Schiffsoffizieren. Ich gab Karl die Möglichkeit, hier sein Fernrohr zu präsentieren und beschwor ihn, bei diesen Gelegenheiten nichts über seine optischen Spezialgeräte zu erwähnen. Der Utzschneider war nicht allen Seeleuten bekannt, aber man überzeugte sich der Qualität dieser Fernrohre. Was den Erwerbspreis der Instrumente betraf, hatte ich mit Karl auch vorher gesprochen. Er sollte bei der Kalkulation zunächst von einer guten Stückzahl ausgehen und den daraus resultierenden Rabatt direkt an die ersten Käufer weitergeben.
An dieser Stelle merkte ich, dass Karl kein Kaufmann war, und so verhielt er sich zögerlich, wollte Rücksprache mit seinem Institut in München halten, was aber zu lang gedauert hätte. Ich drängte ihn selbst zu kalkulieren und zu entscheiden. Die einzige Depesche, die er nach Bayern sandte, war eine Bestellung von einhundert Utzschneider-Fernrohren mit besonderer Dringlichkeit, obwohl die Instrumente zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verkauft waren. Wenigstens verstand Karl, dass ein Kapitän nicht wochenlang warten wollte, wenn man ihn für ein Fernrohr begeistert hatte.
Wir mussten also warten bis die Lieferung eingetroffen war, denn Karls Musterkoffer enthielt zwar ein Fernrohr, aber dieses war die sehr teure Premiumausführung mit besonders präzisen, achromatischen Linsenpaaren und einer extrem feinen Mechanik. Das Mathematisch-Feinmechanische Institut hatte noch eine einfachere Version im Angebot, die aber immer noch die Fernrohre anderer Hersteller um Längen schlug. Einen Tag, nachdem die ersten fünfzig dieser Instrumente in Stockholm eintrafen, konnte ich eine Gesellschaft potentieller Kunden zusammenbringen.
Als Ort der Veranstaltung hatte ich gleich den Hafen gewählt und ein großes Zelt gemietet. Ich hatte zwei Dutzend Seeoffiziere vom Kapitän bis zum Kadetten eingeladen, die wiederum in Begleitung weiterer Interessierter eintrafen, so dass sich das Zelt mit annähernd hundert Personen füllte. Karl hatte einige Experimente vorbereitet, um die Präzision seiner Fernrohre zu demonstrieren. Am Ende des Vortrages ging ich dann noch gruppenweise und mit einigen Utzschneider-Fernrohren ausgerüstet in den Hafen.
Die Demonstration fand großen Anklang. Es meldeten sich sofort elf Seeoffiziere und ein Kapitän, denen Karl unverzüglich ihr Fernrohr aushändigen konnte, obwohl nicht alle sofort den Kaufpreis entrichteten, dies aber in den nächsten Tagen vollständig nachholten. Und darüber hinaus gingen weitere Bestellungen bei Karl ein, so dass er eine gute Woche nach unserer ersten Veranstaltung alle fünfzig Fernrohre der ersten Lieferung an den Mann gebracht hatte.
Karl bekam zum Glück recht schnell Nachschub aus München und so konnten wir noch weitere Demonstrationen veranstalten, bei denen die Teilnehmerzahlen sogar noch stiegen. Am Ende kannte ich noch die wenigsten der Interessenten persönlich, so sehr hatte sich die Qualität des Utzschneider-Fernrohrs herumgesprochen. Der wichtigste Punkt war aber, dass sich Karl in Stockholm etablieren konnte und Zugang zu Instituten und Behörden bekam, denen er jetzt auch seine Teleskope, Mikroskope und optischen Spezialgeräte anbieten konnte.
Meine Mission war damit erfüllt, ich beherrschte die mathematischen Künste sehr vorzüglich und Karl sprach inzwischen ein passables Schwedisch. Wir hielten unsere Freundschaft zwar aufrecht, beendeten aber unsere geschäftlichen Beziehungen. Ich hatte immer auf eine Entlohnung verzichtet, ja darauf bestanden, dass mir Karl nichts schuldig war. Es muss aber an ihm genagt haben, denn eines Tages machte er mir ein großzügiges Geschenk. Wir trafen uns zu dieser Zeit noch zwei-, dreimal in der Wirtschaft, in der wir uns kennengelernt hatten. An diesem Tag war er vor mir dort angekommen, hatte einen Platz gewählt und Getränke und Speisen bestellt, die bereits auf dem Tisch serviert waren, als ich ankam. Und auf dem Tisch lag noch etwas, das Karl vor mich schob, als ich mich gesetzt hatte. Ich öffnete das feine Lederetui und fand darin das besondere Utzschneider-Fernrohr aus Karls Musterkoffer.
Ich wollte mich schon wehren, aber Karl ließ es nicht zu. Seit diesem Tage vor gut vier Jahren besaß ich ein Fernrohr, das sich auf wenige Zoll zusammenschieben ließ, aber in voller Länge ein hochpräzises Instrument war. Und jetzt stand ich hier an der Reling der Kalmar, hielt mein Fernrohr vors rechte Auge und dachte an diese Geschichte und fragte mich, was Karl Ludwig Müller heute machte, denn er verließ Stockholm nach zwei Jahren wieder und auch wenn wir uns danach noch geschrieben haben, versiegte der Kontakt, als auf dem Kontinent erneut der Krieg ausbrach.
*
Ich verstaute mein Utzschneider-Fernrohr erst wieder in meinem Seesack, als wir bereits in die Hafenbefestigungen der schwedischen Stadt Stralsund einliefen. Wir schrieben den 7. Juli des Jahres 1813. Es war siebenunddreißig Minuten nach neun, als ich von Bord ging. Der Kapitän hatte mir dann doch noch die Freundlichkeit erwiesen und eine Pension empfohlen, die ich mit geschultertem Gepäck erreichte. Das Zimmer war ordentlich. Es gab warmes Wasser, das man mir in einer Karaffe aufs Zimmer brachte und es gab saubere Wäsche und nachdem ich mich frisch gemacht hatte, ein ordentliches Abendbrot.
Am nächsten Morgen war ich der erste Gast, der die Pension verließ. Ich brauchte mich nicht lange durchzufragen, es gab kaum schwedische Truppen in der Stadt und noch bevor ich die Garnison erreichte, traf ich auf das Lager der Eskadron des Grafen von Hammar. Ich wunderte mich allerdings sehr, weniger als zwanzig Reiter vorzufinden. Die Leute hatten in der Nacht offensichtlich unter freiem Himmel kampiert. Es gab eine Feuerstelle, an der die Reste des Frühstücks bereits zusammengeräumt waren. Ich sah mich unter den Männern um und erkannte an der Uniform schnell den Eskadronführer. Ich trat auf ihn zu und reichte ihm meine Rolle.
»Herr Kapten Graf von Hammar?«, fragte ich salutierend.
Er nickte. »Kapten von Hammar stimmt schon, aber der Graf, das ist mein Vater und wenn er nicht mehr ist, wird es mein älterer Bruder sein. Mit wem habe ich das Vergnügen?«
Der Kapten glaubte sich einem Zivilisten gegenüber, da ich noch keine Uniform trug. Ich deutete auf meine Rolle, die er noch nicht entgegengenommen hatte und klärte ihn auf.
»Fänrik Falk Marten Hanson.« Ich salutierte erneut und fuhr fort. »Ich bin gestern Nacht aus Malmö eingetroffen und habe den Befehl, mich der Eskadron des Herrn Kaptens anzuschließen.«
»Nicht so förmlich, ich weiß ja Bescheid.« Kapten von Hammar musterte mich noch einmal. »Sie sind der Nachzügler, nicht wahr? Der Stab ist ja schon längst unterwegs. Sie wissen wo es hingeht?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin erst seit wenigen Tagen in der Armee. Es gab noch nicht die Gelegenheit, mir ausführliche Befehle zu erteilen.«
»Und eine Uniform hat man ihnen auch noch nicht verpasst«, stellte der Kapten fest, »oder ist Ihr Schneider nicht rechtzeitig fertig geworden?«
»Mein Schneider?« Ich zögerte. »Entschuldigung, davon weiß ich nichts. Ich glaubte, Uniform und Waffen von der Garnison hier in Stralsund zu erhalten.«
»Ja, ja, das ist schon richtig.« Kapten von Hammar überlegte. »Sie würden allerdings besser von Ihrem Stab ausgerüstet, wenn wir erst einmal in Trachenberg sind. Ihre Stiefel sind ja zu gebrauchen.« Er deutete auf mein Schuhwerk. »Und Hose und Rock kann ich Ihnen für den Ritt dorthin stellen. Haben Sie einen Degen oder Säbel?«
»Nein, Herr Kapten.«
»Den müssten Sie sich als Offizier später selbst anschaffen. So eine Waffe ist etwas sehr Persönliches. Ich kann Ihnen allerdings eine Kavalleriepistole anbieten.« Er machte eine Pause. »Ein Pferd haben Sie natürlich auch nicht dabei, nehme ich an?«
»Nein, Herr Kapten. Säbel oder Degen und ein Pferd müsste ich mir hier in Stralsund noch besorgen. Vielleicht können Sie mir dabei helfen?«
Jetzt schüttelte Kapten von Hammar den Kopf. »Dafür ist keine Zeit. Wir müssen in einer halben Stunde aufsitzen. Sie können eines der Ersatzpferde reiten.«
*
Und so geschah es auch. Wir räumten das Lager in der vorausgesagten Frist, nachdem ich gerade noch Zeit hatte, mich umzukleiden. Hose und Rock passten. Meine eigenen Sachen hatte ich in der Satteltasche verstaut, dort wo auch die Pistole steckte, die ich nicht lud. Mit dem mir zugeteilten Pferd, einem gutmütigen Fuchs, schloss ich mich der Eskadron an, die Mangels Stärke eigentlich keine war. In der geordneten Hektik des Aufbruchs hatte ich allerdings nicht die Zeit, meine neuen Kameraden kennenzulernen und es schien auch nicht üblich zu sein, denn außer dem Kapten und mir gab es keine weiteren Offiziere in der Truppe. In meinem bisherigen zivilen Leben kannte ich so gut wie keine Standesunterschiede. Die Stellung meiner Familie definierte sich über die finanziellen Möglichkeiten und nicht über die Herkunft. Diese Möglichkeiten hatten zwar in den vergangenen beiden Jahren etwas gelitten, aber noch immer bestanden Beziehungen zu höheren Kreisen, denen ich meine neue Stellung zu verdanken hatte.
Es war sicherlich ungewöhnlich, ohne jegliche militärische Erfahrung in Offizierskreise aufgenommen zu werden, wobei ich als Fänrik eher Anwärter auf eine derartige Laufbahn war. Die Ausbildung zum Offizier sollte ich dabei nicht in einer Kaserne oder Garnison, sondern in einer kriegerischen Auseinandersetzung erhalten. Dies war nichts Ungewöhnliches und so begann ich mich in meiner Rolle zurecht zu finden, so lange unser Ritt dauerte.
Am ersten Tag erreichten wir die Ufer des Stettiner Haffs. Ich schätzte die zurückgelegte Strecke auf vierzig Meilen. Kapten von Hammar kündigte an, dass wir am nächsten Tage an die sechzig Meilen schaffen müssten und verordnete daher eine frühe Rast in der Nähe eines Fischerdorfes.
Die Männer bauten das Biwak auf, versorgten die Pferde, richteten eine große Feuerstelle ein und begannen zu kochen. Zwei junge Kavalleristen gingen ins Dorf und kamen nach einer halben Stunde in Begleitung zurück. Das Abendessen wurde gebracht, frischer Fisch, am selben Tag von den Einheimischen aus dem Haff gezogen. Dazu gab es Bohnen und Mais aus dem Marschproviant.
Als es dämmerte waren fast alle Schlafplätze belegt. Der Kapten hatte die Wachen eingeteilt, die über die Nacht aus je zwei Mann bestehen sollten. Ich saß mit dem Kapten zusammen vor der fast heruntergebrannten Kochstelle, die über Nacht nur als kleines Wachfeuer weiterbrennen sollte. Er bot mir Tabak an und wir stopften unsere Pfeifen.
»Sie haben sich gut gehalten«, begann der Kapten, nachdem er einen tiefen Zug genommen hatte. »Ich gehe davon aus, dass Sie derartige Tagesritte nicht unbedingt gewohnt sind, wobei die nächsten Etappen noch anstrengender werden.«
»Ja, es war sicher die längste Strecke, die ich bisher am Stück auf dem Rücken eines Pferdes zurückgelegt habe, aber bei meinen Vermessungsarbeiten für den Kanalbau musste ich des Öfteren auch längere Strecken absolvieren, um meinen jeweiligen Einsatzort zu erreichen. Zwar keine Tagesritte, aber vier, fünf Stunden im Sattel waren es oft schon, von daher hat mich der heutige Tag angestrengt, aber mehr auch nicht. Ja und das Campieren unter freiem Himmel bin ich ebenso gewohnt.«
»Ich kenne mich nicht mit Kanälen aus, die sind sicherlich sehr nützlich. Wo wurde Ihr Kanal denn gegraben, in der Heimat?«
»Ja, in der Heimat, aber er ist noch lange nicht fertig, das wird noch Jahre dauern. Später verbindet er die beiden Meere miteinander, Ost und Nord, und wird die Passage durch den Öresund erheblich verkürzen.«
»Verstehe und Sie stammen auch von dort, aus Malmö?«
»Aus der Nähe von Malmö, Lomma heißt der Ort, Herr Kapten.«
Er schüttelte den Kopf. »Nie gehört, was nichts heißen muss. Ich selbst stamme aus der Stockholmer Linie der von Hammars, falls es Sie interessiert.«
»Durchaus, ich habe drei Jahre in Stockholm gelebt, die Ausbildung zum Ingenieur dort absolviert.«
Kapten von Hammar nickte. »Einer meiner Brüder dient noch heute bei den Pionieren. Vielleicht haben Sie ihn ja kennengelernt, ein großer schlaksiger Kerl, der mir ein wenig ähnlich sieht.« Er lachte.
»Ich bedaure, Herr Kapten, Ihren Herrn Bruder kenne ich leider nicht. Ich habe auch nicht beim Ingenieurcorps gedient, sondern bin auf eine private Schule gegangen.«
»Ach, ich vergaß, Sie haben Ihre militärische Laufbahn ja gerade erst begonnen, was kein Vorwurf sein soll. König und Kronprinz freuen sich immer über Verstärkung, Herr Fänrik. Und wenn Sie einen ordentlichen Beruf erlernt haben, um so besser. Streben Sie denn eine Versetzung in die technischen Truppen an?«
»Entschuldigung, was verstehen Sie unter Versetzung?«
»Na ich meine, im Stab zu dienen ist zwar eine große Ehre, aber kann dann doch nicht Ihren Fähigkeiten entsprechen.«
»Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, Herr Kapten. Mein Wunsch war es, in den Militärdienst einzutreten. Ich gebe zu, man hat sich an höherer Stelle für mich verwendet und so bin ich jetzt hier. Ich habe zwar auch eine Zukunft in der Heimat, aber ...«
»Und Sie ziehen dieser Zukunft einen Krieg vor«, unterbrach mich Kapten von Hammar. »Was ist das denn für eine Zukunft, wenn ich fragen darf. Als Berufssoldat interessiert mich natürlich die zivile Welt, aus der Sie kommen.«
Jetzt erzählte ich von der väterlichen Werft und der Fabrik des Onkels, in der man mich nach meinem Abenteuer zurückerwartete. Ich schilderte alles in den Farben, die ich sonst nicht sah, was man gegenüber Außenstehenden in der Regel tat.
»Dann sind Sie in der gleichen Situation wie ich selbst«, resümierte Kapten von Hammar. »Der erstgeborene erhält Titel und Ämter. In Ihrem Fall handelt es sich um eine Werft, die Ihr Bruder übernimmt. Haben Sie denn noch weitere Geschwister?«
»Oh ja, drei Schwestern, Hedda, Ida und Eva und dazu zwei weitere Brüder, Hendrik und Leif. Hendrik ist der drittälteste, danach kommen die Mädchen und zum Schluss der Nachzügler Leif, der im Herbst erst zehn wird.«
»Lassen Sie mich raten«, sagte der Kapten. »Wenn Sie das Erbe Ihres Onkels nicht annehmen, warum auch immer, wird Hendrik an Ihre Stelle treten?«
»Das könnte schon sein«, antwortete ich und dachte kurz über die doch offensichtliche Schlussfolgerung des Herrn Kaptens nach.
»Und, haben Sie ein Mädchen oder sind Sie gar verheiratet?«, fragte Kapten von Hammar unvermittelt. »Ich hoffe, ich bin nicht zu indiskret.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich war verlobt, bis vor einem halben Jahr ...«
»Oh, das tut mir leid«, unterbrach mich der Kapten.
»Bitte? Ach so, nein, nicht was Sie denken. Wir haben die Verlobung gelöst. Madelaine und ich waren uns einig, auch wenn wir es uns bis heute nicht persönlich gesagt haben.« Ich hielt kurz inne, weil mir einfiel, dass ich Madelaine erst vor wenigen Tagen gesehen hatte. »… aber ihre Eltern, ihr Vater, wollten das alles nicht akzeptieren«, fuhr ich fort.
Und dann erzählte ich Kapten von Hammar meine Geschichte, obwohl er eigentlich ein Fremder für mich war. Ich ging ein paar Jahre zurück, noch weit vor die Zeit, als ich zum Studium in Stockholm lebte. Madelaine van Saamten war die Tochter eines Kaufmanns, der sein Kontor in Malmö betrieb. Es gab immer schon Geschäftsbeziehungen zwischen unserer Werft und dem Kontor van Saamten und so kannten sich auch die Familien privat. Es gab Sonntagsbesuche und Einladungen zu Festen. Ich erinnere mich seit frühster Kindheit daran und so lange kannte ich Madelaine auch bereits, die die einzige Tochter und das einzige Kind ihrer Eltern war. Als Junge empfand ich noch ganz anders für Madelaine, aber eines bewunderte ich schon damals und das war ihr langes blondes Haar, das sie mal als Pferdeschwanz, mal als dickgeflochtenen Zopf trug. Ich wollte dieses wunderbare Haar immer anfassen, aber ich traute mich nicht, es ihr zu sagen und dies vor allem aus Angst vor Zurückweisung. Und so wurde Madelaine tatsächlich ein höheres Wesen für mich, obwohl ich ganz zu Beginn noch nicht die Augen und Gefühle für Mädchen besaß.
Aber es wurden sich auch auf anderer Seite Gedanken über Madelaine und mich gemacht. Meine Eltern waren an sich gegen arrangierte Hochzeiten, weil auch ihre eigene Beziehung aus Zuneigung füreinander entstanden war. Und so hatte es mein Vater mehr als Spaß empfunden, als Madelaines Vater eine Verbindung der beiden Familien vorschlug. Da waren Madelaine und ich immer noch halbe Kinder und die Einlösung des Versprechens in weiter Ferne.
Dann kam aber die Zeit, dass meine Gefühle für Madelaine tatsächlich stärker wurden. Es war bei einem der regelmäßigen Besuche in Malmö, als sich für mich alles veränderte. Ich verliebte mich in dieses Mädchen, wenn ich überhaupt damals den Unterschied zwischen Liebe und einer Schwärmerei kannte. Einige Wochen blieb es mein Geheimnis, obwohl ich Madelaine mehr als einmal Zeichen meiner Zuneigung gab. Sie reagierte einfach nicht darauf, wusste offenbar von nichts, so glaubte ich zumindest.
Es kam die Zeit, dass ich in einen regelrechten Liebeskummer verfiel. Ich begleitete meine Familie nicht mehr zu den sonntäglichen Treffen nach Malmö, machte mich rar. Aber dann kam ein Tag, an dem mich mein Vater mit einem geschäftlichen Auftrag zum Kontor van Saamten schickte. Ich war nicht darauf vorbereitet, Madelaine dort anzutreffen. Und es passierte sogar, dass man uns in dem Büro ihres Vaters für kurze Zeit alleine ließ. Dann war es wie ein Schlag. Unter einer Baumwollhaube trug sie ihr Haar an diesem Tag offen und als sie sich über die Papiere beugte, die ich mitgebracht hatte, wurde ihr Gesicht von kräftigen blonden Strähnen eingerahmt und da machte mein Herz einen Sprung. Ich ließ allen Gefühlen freien Lauf, riskierte alles, berührte ihre Hand, die gerade die Feder greifen wollte, und gestand ihr meine Liebe.
Ich rechnete mit Zurückweisung und Ablehnung, mit einem Entsetzen ihrerseits, doch es kam zu meinem großen Glück ganz anders. Sie erhob sich von ihrem Platz am Schreibtisch und warf sich mir in die Arme. Wir wagten nicht, uns zu küssen und so hielten wir uns nur ein, zwei Minuten engumschlungen. Wir lösten uns noch rechtzeitig, bevor ihr Vater das Büro betrat. Von einem Moment auf den nächsten taten wir, als wäre nichts geschehen und dies hielten wir auch die nächsten Tage durch, wann immer wir uns sahen und dabei nicht alleine waren.
Dies ging ein paar Wochen so, bis meine Mutter das Geheimnis erriet. Ich offenbarte mich ihr, was eine große Erleichterung war. Doch meine Not war unbegründet. Ich weiß nicht, ob Madelaine sich ihren Eltern ebenfalls anvertraute, aber eines Sonntags im Spätsommer brachte ihr Vater es auf den Tisch. Er erinnerte an das Verlobungsversprechen und so wurde es zwischen unseren Familien abgemacht. In den folgenden Monaten stellte ich allerdings fest, dass eine heimliche Liebe viel einfacher war, als in gewisser Keuschheit auf das Einlösen des Heiratsversprechens zu warten.
Madelaine und ich vermieden es die erste Zeit, uns alleine zu sehen. Wir tauschten nur oberflächliche Zärtlichkeiten aus, benahmen uns so sittsam, wie wir glaubten, uns benehmen zu müssen. Dann fanden wir aber den Mut und die Wege, uns von diesen selbstauferlegten Einengungen zu lösen. Hier begann meine glücklichste Zeit, die fast drei Jahre anhielt, bis ich zusammen mit meinem Bruder zum Studieren nach Stockholm ging. Madelaine blieb zurück in Malmö. Wir hatten uns immer von Angesicht zu Angesicht alles gesagt und dann war ich gezwungen ihr Briefe zu schreiben, die aber ohne große Leidenschaft blieben, da ich nicht wusste, ob es Mitleser gab.
Die Reise von Malmö nach Stockholm war lang und beschwerlich und so kam es, dass mich Madelaine nicht ein einziges Mal dort besuchte. Ich selbst war anfangs noch alle paar Wochen zu Hause, dann wurden es sogar Monate. Und es gab ja noch die größeren Familienfeiern, auf denen Madelaine und ich uns begegneten. Hier war aber auch nicht der Ort, um unsere Liebe aufzufrischen, die sich langsam abzukühlen begann. Den Eindruck des Abkühlens hatte zumindest ich, auch wenn Madelaines Vater bei den Treffen immer mal wieder das Thema Heirat ansprach und dass ich doch wohl genug studiert hätte und später ohnehin meine Leute für das Technische haben würde. Er spielte auf die Ziegelei meines Onkels an, deren Übernahme durch mich längst Familienplan war.
In dieser Zeit beneidete ich meinen Bruder, der bereits verheiratet war. Seine Frau Clara hatte mehr als ein Jahr mit ihm zusammen in Stockholm gelebt. Es war die Zeit, als ich längst ein eigenes Zimmer in einem anderen Stadtteil hatte und es war die Zeit, in der Karl Ludwig Müller und ich das Geschäft mit den Fernrohren aufzogen. Und so kam es, dass mein Bruder und ich mehr und mehr getrennte Wege gingen. Wir sahen uns nur noch in der Studierstube des Laboratoriums mechanicum oder bei den Vorträgen der Professoren oder alle zwei, drei Wochen, wenn mich meine Schwägerin bekochte.
Eines Tages kehrte Clara nach Lomma zurück. Ich dachte erst, dass sie zu Hause einen längeren Besuch geplant hatte, aber dann erfuhr ich den wahren Grund. Elias und Clara erwarteten ein Kind. Ich zog wieder zu meinem Bruder, der Stockholm drei Monate später endgültig verließ, um zu seiner Frau zurückzukehren. Jetzt erkannte ich, dass Elias in den beinahe drei Jahren viel fleißiger gewesen war als ich. Er hatte seine Prüfungen längst abgelegt, die Schule mit Auszeichnung beendet. Ich selbst hatte noch reichlich nachzuholen. Dazu musste ich aber erst einmal meinen Lebenswandel ändern. Ich nahm mir vor, nicht mehr so oft auszugehen, was mir anfangs schwerfiel.