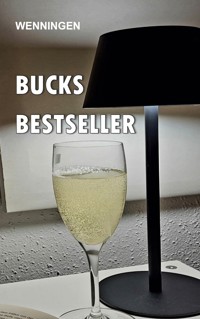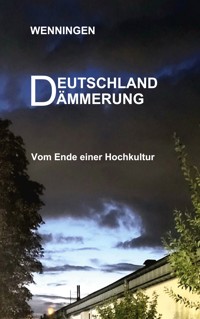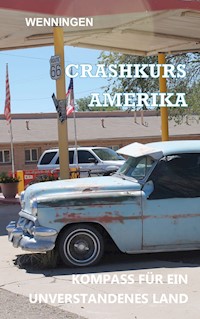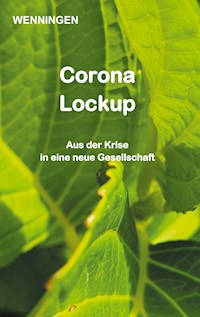
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 22. März 2020 wurde in Deutschland der Lockdown beschlossen. Daraus folgten die massivsten Einschränkungen für unsere Gesellschaft seit Ende des 2. Weltkrieges: Kontaktsperren, Reisebeschränkungen, flächendeckende Schließung von Schulen, Kindergärten, Geschäften, Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Der Grund: Das sogenannte Corona-Virus. Dieses Buch schildert die Beobachtung eines Phänomens, das die Welt unvorbereitet in eine der größten Krisen unserer Zeit gestürzt hat und gleichzeitig die Chance für gesellschaftliche Erneuerung bietet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Originalausgabe:
Sollte diese Publikation Links und Hinweise auf
Webseiten Dritter enthalten, übernehmen wir für deren
Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen
machen, sondern lediglich auf deren Stand zum
Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
„Alles, was gegen die Natur ist,
hat auf die Dauer keinen Bestand.“
Charles Darwin
Inhalt:
Vorwort: Ein Unbekannter aus Fernost
Der Pandemie-Schock
1.1 Chronik des Ausbruchs
1.2 Wanted Covid-19!
1.3 Letzte Ausfahrt Lockdown
1.4 Europa maskiert sich
1.5 Fluch der Globalisierung
Zwischen Hysterie und Hoffnung
2.1 Nährboden für Verschwörer
2.2 Showdown der Virologen
2.3 Der WiSo-Crash
2.4 Digitales Desaster
2.5 Der schmale Grat der Politik
Die neue Normalität
3.1 Zwischen Lockdown und Lockerung
3.2 Langsamer, tiefer, kürzer
3.3 Mensch als Teil der Natur
3.4 Das alte, neue Miteinander
Lockup in eine neue Gesellschaft
4.1 Ein Virus als Lehrmeister
4.2 Erkenntnisse für die Gesellschaft von morgen
Literaturverzeichnis
Vorwort: Ein Unbekannter aus Fernost
Köln, Rosenmontag, 24.Februar 2020: Es herrscht ausgelassene Stimmung in der Karnevalshochburg am Rhein. Jecken schunkeln, bützen, singen in prallgefüllten Kneipen und Sitzungssälen. Der beliebte Gerstensaft macht in den lokaltypischen 0,2er Stangen die Runde. Entlang der Straßen drängeln sich Kostümierte im Kampf um Blumen und Pralinen um die besten Plätze.
Dass sich die lustige Meute der Karnevalisten nur wenige Wochen später erneut mit Maske in der Öffentlichkeit wiederfinden würde, hat mit Heiterkeit wenig zu tun. Statt lockerem Brauchtum ist es dieses Mal Pflicht. Aus körperlicher Nähe ist 1,5 Meter Mindestabstand geworden. Die Gaststätten sind zu, den frisch gezapften Gerstensaft gibt es nur noch abgefüllt im Getränkehandel. Die stimmungsvolle Live-Musik ist tabu und lediglich über digitale Medien zu beziehen. Innerhalb von nur zwei Monaten hat sich das gesellige Freizeitverhalten ins krasse Gegenteil verkehrt. Der Grund: ein unsichtbarer Gast aus Fernost, ein partycrashender Spielverderber der übelsten Sorte.
Von den Almsausen österreichischer Ski-Hotspots, über die oberpfälzischen Starkbierfeste bis zu den rheinischen Karnevalspartys – die ausgelassenen Feier- und Reiseaktivitäten unserer Mitbürger haben ein Problem offenbart, das wir hierzulande in sicherer Ferne wähnten: CORONA. Anstelle des beliebten mexikanischen Partygebräus hat sich der Begriff als das heimtückischste Grippevirus unserer Zeit in den Sprachgebrauch eingeschlichen.
Bis Anfang 2020 schien die Gefahr durch einen globalen Krankheitserreger mit unserem modernen Gesellschaftsbild quasi unvereinbar. Eine digitalisierte Gesellschaft, in der einer aktuellen Virensoftware auf dem Heim-PC höhere Bedeutung beigemessen wird als der jährlichen, saisonalen Grippeschutzimpfung. Moderne Pandemien, ob Schweinegrippe, Vogelgrippe oder SARS, konnten uns in dem „Schneller-Höher-Weiter“ nach mehr Globalität, Individualität und Wohlstand nicht aufhalten. Wir wähnten uns unverwundbar, bis ein neuartiger Krankheitserreger aus der chinesischen Metropole Wuhan den kompletten Planeten in Schockstarre versetzt hat. Die Verheißungen der globalisierten Welt mit grenzenlosem Mobilitäts- und Freiheitsgefühl haben uns als Individuen die Grenzen aufgezeigt.
Ende September 2020 waren weltweit mehr als 30 Millionen Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Rund 1 Million fielen den Folgen der Erkrankung zum Opfer – verteilt auf alle Kontinente mit Schwerpunkten in Europa, den USA und zuletzt Südamerika. Ob Wuhan, Bergamo, New York oder Rio, die verstörenden Bilder von überfüllten Krankenhäusern mit beatmeten Intensivpatienten, ausgestorbene Innenstädte als Folge eines flächendeckenden Lockdowns zeigten weltweit bedrückende Parallelen. Grenzen zwischen Staaten, Kulturen, Religionen und Weltanschauungen verschwammen. Auch in der Krise blieb die Weltgemeinschaft globalisiert.
Was Politiker, Klimaaktivisten und Organisationen über Jahrzehnte vergeblich versucht hatten, ist letztlich einem Grippevirus gelungen. Der „Unbekannte aus Fernost“ hat die Welt auf Linie gebracht, zu globalem Handeln gezwungen. Der Lockdown wurde zur Ultima Ratio und trieb die verunsicherten Gesellschaften wie Lemminge vor sich her.
Nach Wochen des Zitterns und der Unsicherheit schienen insbesondere in Europa die ergriffenen Schutzmaßnahmen Wirkung zu zeigen. Die Infektionszahlen sanken und ließen die Hoffnung auf baldige Rückkehr in die alte Normalität aufkeimen. An einem Punkt, zu dem die Corona-Krise hierzulande von politischen Entscheidern als beherrschbar eingestuft wurde und erste Lockerungen Einzug hielten, scheint nun die Zeit reif, die Dinge grundsätzlicher zu hinterfragen.
Wie gut sind wir auf derartige Angriffe „unsichtbarer Gegner“ vorbereitet? Haben wir in Anbetracht der unbekannten Bedrohung angemessen reagiert oder sind wir schlichtweg hysterisch geworden? Wie wägen wir wirtschaftliche, ökologische und soziale Interessen künftig gegeneinander ab? Setzen wir die Prioritäten in unserem Denken und Handeln an der richtigen Stelle? Wie werden sich Kontaktverhalten und Kommunikation in Zukunft verändern? Wird es eine neue Kultur des Umgangs miteinander geben (müssen)? Und wenn ja, wie sieht das Zukunftsmodell unserer Gesellschaft aus?
Dies sind nur einige der Fragen, die uns die Corona-Krise mit auf den Weg gegeben hat. Viele dieser Fragen waren schon vorher relevant und haben nun neue Dynamik gewonnen. In diesem Buch soll weder eine wissenschaftliche Abhandlung des Corona-Risikos noch eine philosophische Betrachtung seiner Phänomene vertieft werden. Es ist vielmehr der Versuch, auf Basis der Beobachtungen den Finger in die Wunde zu legen und Antworten für unser künftiges Zusammenleben als Gesellschaft zu finden.
Köln, im September 2020
1. Der Pandemie-Schock
1.1 Chronik des Ausbruchs
Während sich hierzulande Massen von Menschen über die Weihnachtsmärkte schoben, gab es in China die ersten Toten. Seit Dezember 2019 hat eine weitere Stadt traurige Berühmtheit erlangt und als Katastrophenschauplatz einen dauerhaften Imageschaden davongetragen. Lockerbie, Tschernobyl, Fukushima - und jetzt Wuhan. Während es sich bei den dreien Erstgenannten um eher unscheinbare Provinznester handelt, zählt die Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hubei mit ihren 11 Millionen Einwohnern zu den bedeutendsten Industriezentren Asiens. Seit Dezember 2019 ist Wuhan nun auch als Brutstätte des Corona-Virus in aller Munde.
Wir wussten frühzeitig Bescheid, die Chinesen selbst wohl noch etwas früher. Doch der Bremsweg zwischen Wissen und Handeln ist mitunter lang. Als die Bilder der ersten Viruserkrankten zum Jahreswechsel die Nachrichten zu dominieren begannen, hielt sich unsere Betroffenheit in Grenzen. Zu weit weg, zu unreal und alles schon mal dagewesen, waren die reflexartigen Antworten. Hatten wir uns an die in gewisser Regelmäßigkeit auftretenden Ausbrüche diverser Viruserkrankungen nicht schon irgendwo gewöhnt? Auch zu Beginn dieses neuen Vorfalls blieb der Begriff Pandemie als Bedrohungsszenario zunächst ein Fremdwort.
Vorboten der Corona-Pandemie:
Die gegen Ende des 1. Weltkrieges grassierende „Spanische Grippe“ mit mehr als 50 Millionen Toten kennen wir nur aus Erzählungen. Sie gilt als die erste große Pandemie der Neuzeit, bei der die Infektion eines durch Tiere übertragenen Influenza-Virus verheerende Wirkung hatte.
Der dieser Pandemie zugrundeliegende Subtyp des Influenza-A-Virus mit der Bezeichnung H1N1 ist uns als Auslöser der sogenannten „Schweinegrippe“ in den Jahren 2009 / 2010 zuletzt begegnet.1) Im Gegensatz zu üblichen saisonalen Grippeviren war der zum Teil schwere Verlauf gerade bei jüngeren Patienten untypisch. Mit weniger als 20.000 Toten weltweit (258 davon in Deutschland) ist das Ausmaß der Schweinegrippe-Pandemie schnell in Vergessenheit geraten.2)3) Die empfohlene Schutzimpfung wurde von der Bevölkerung nur zurückhaltend angenommen.
Der größte pandemische Zwischenfall unserer Generation, an den sich nur noch ältere Mitbürger erinnern können, ist die „Asiatische Grippe“ der Jahre 1957/1958.4) Dem aus einer Kombination eines menschlichen mit einem Geflügelpestvirus entstandenen Erreger fielen von China ausgehend weltweit etwa 2 Millionen Menschen zum Opfer. Die Zahl von rund 30.000 Grippetoten in Deutschland wurde bis zum heutigen Tag bei allen folgenden Pandemien nicht mehr erreicht.5)
Das „Corona-Virus“ hat sich im Jahr 2003 während der sogenannten „SARS-Pandemie“ erstmalig aus der Deckung gewagt.6) Dem durch den sogenannten SARS-CoV-Erreger ausgelösten „Schweren Akuten Atemwegssyndrom“ sind statistisch nachweisbar weltweit 774 Menschen zum Opfer gefallen.7) Seine Verbreitung von Südchina ausgehend in nahezu alle Teile der Welt sorgte kurzzeitig für mediale Aufmerksamkeit.8)
Das pandemische Ausmaß von SARS war auf einen chinesischen Hochzeitsgast zurückzuführen, der Ende Februar 2002 in einem Hongkonger Hotel verweilte.9) Binnen 24 Stunden wurden zwölf der internationalen Hotelgäste infiziert, die das Virus in der Folge über die chinesischen Staatsgrenzen hinaus in die Welt trugen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren weltweit mehr als 4.000 SARS-Erkrankungen auf den Hongkonger Hotelgast zurückzuführen. Zwei Wochen nach seinem schicksalhaften Hotelbesuch verstarb der „Superspreader“ in einem nahegelegenen Hospital.10)
Die Nachwirkungen der SARS-Pandemie sind nicht nur aufgrund der vergleichsweise geringen Todeszahlen überschaubar geblieben. Bereits im Frühsommer 2003 hatte das Virus derart an Kraft verloren, dass der Suche nach einem Impfstoff keine Priorität mehr eingeräumt wurde. Am 19. Mai 2004 hatte die WHO die SARS-Pandemie auch offiziell für beendet erklärt. Als Konsequenz richtete die chinesische Regierung ein Frühwarnsystem zur Weiterleitung von Seucheninformationen an eine zentrale Meldestelle bei der nationalen Gesundheitskommission ein.
15 Jahre später schienen sämtliche Vorkehrungen und Vorsätze der SARS-Pandemie vergessen. Ein naher Verwandter unter der Bezeichnung SARS-CoV-2 sollte die Weltgemeinschaft förmlich überrumpeln und auf eine existenzielle Probe stellen.
Dezember/Januar 2019/2020:
Bis Mitte Januar 2020 wurde den Ereignissen in Zusammenhang mit der Grippeepidemie rund um Chinas Industriemetropole Wuhan keine weitreichende Beachtung geschenkt. Das Problem blieb ein Chinesisches über dessen regionalen Ursprung und Verlauf eifrig spekuliert wurde. Auffällig war eine relativ hohe Zahl an Lungenentzündungen, die nach Aussage des chinesischen Arztes Li Wenliang auf das Schwere Akute Atemwegssyndrom SARS hindeuteten.11) Diese Aussage wurde von offizieller Seite dementiert, die von einem bislang unbekannten, uncharakterisierten Krankheitserreger ausging.
Eine Mensch-Zu-Mensch-Übertragung wurde zunächst ausgeschlossen. Nach ersten Vermutungen soll das Virus über einen Zwischenwirt aus dem Tierreich auf den Menschen übertragen worden sein. Als Reaktion wurde der für seine Lebendtierverkäufe bekannte Wuhaner Fischmarkt am 1. Januar 2020 geschlossen. Erst später wurde bekannt, dass der erste identifizierte Patient diesen Markt nicht besucht hatte, worauf sich Zweifel und Spekulationen hinsichtlich des Übertragungsweges mehrten. Gerüchte kamen auf, dass das Virus bereits im Dezember 2019 entdeckt worden war und die Kommunistische Partei Chinas zur Verschleierung einen Abbruch von Tests sowie die Vernichtung von Proben angeordnet hatte.12)
Nachdem die bekannten Erreger MERS-CoV und SARS-CoV ausgeschlossen werden konnten, meldeten die chinesischen Behörden am 7. Januar ein neuartiges Corona-Virus als mögliche Krankheitsursache mit der provisorischen Bezeichnung „2019 n-CoV“. Das Virus sollte von nun an unter der offiziellen Bezeichnung SARS CoV-2 als Auslöser der Lungenkrankheit COVID-19 die Runde machen. Nachdem mehrere Krankenhausangestellte mit dem neuartigen Virus infiziert worden waren, bestätigten die chinesischen Behörden am 20. Januar, dass eine Mensch-Zu-Mensch-Übertragung möglich sei. Noch zwei Tage zuvor waren in Wuhan rund 40.000 Familien bei den Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest zusammengekommen.13)
Am 13. Januar war das neue Corona-Virus erstmalig in Thailand bei einer Reisenden aus Wuhan nachgewiesen worden. Wenige Tage später wurden analoge Fälle aus Japan und Südkorea gemeldet. Am 23. Januar wurde in den USA der erste Corona-Fall außerhalb Asiens bekannt. Damit hatten die chinesischen Behörden ihr Exklusivrecht am Management der Epidemie verloren. Nach offiziellen chinesischen Angaben wurden am 26. Januar in der gesamten Volksrepublik 2.744 Infektionsfälle gemeldet.
Am gleichen Tag stufte das Robert Koch-Institut (RKI) die Krisenprovinz Hubei als Risikogebiet ein. Drei Tage zuvor hatte China mit der Einstellung sämtlicher Verkehrsverbindungen die Abriegelung Wuhans veranlasst. Die chinesische Regierung sprach nun auch offiziell von einer ernsten Situation und ließ mit der Absage der Neujahrsfeierlichkeiten und der Anordnung einer Massenquarantäne für die gesamte Provinz Hubei ab dem 29. Januar Taten folgen.14) An jenem Tag wurde die Zahl der Infizierten auf 9.700 nach oben korrigiert. Die offizielle Todeszahl von 213 ließ auf eine Sterberate von rund 2% schließen. Aufgrund einer wachsenden Verbreitungsgefahr rief die WHO am 30. Januar die internationale Gesundheitsnotlage aus.15)16)17)
Februar 2020:
Anfang Februar standen mehr als 60 Millionen Chinesen unter Quarantäne. Die Provinz Hubei war hermetisch abgeriegelt, auch Nachbarprovinzen wurden von den Behörden streng kontrolliert. Alle nicht wesentlichen öffentlichen Orte wurden geschlossen und Massenveranstaltungen untersagt. Zutritt zu Apotheken und Supermärkten war nur nach Messung der Körpertemperatur erlaubt. Zufahrten zu Dörfern und Gemeinden wurden gesperrt, um unkontrollierte Verbreitungen zu verhindern. Zeitgleich lief eine mehrtägige Tür-Zu-Tür-Erfassungsaktion an mit dem Ziel, alle bisher unerkannten Fälle zu identifizieren.18)
Die Rigorosität der chinesischen Quarantänemaßnahmen blieb auch in anderen Ländern nicht unbemerkt. Nachdem in Südkorea Ende Januar die ersten Fälle identifiziert wurden, stiegen die Infektionszahlen im Februar auch dort sprunghaft an. Bis Ende des Monats wurden mehr als 3.000 Infektionsfälle registriert.19) Dies war zu jenem Zeitpunkt die weltweit stärkste Ausbreitung des Corona-Virus außerhalb Chinas. Durch ein umfangreiches Massentestprogramm, die frühzeitige Verwendung von Smartphone-Apps und die Einrichtung von Sonderüberwachungszonen gelang es zügig, die Infektionszahlen in Grenzen zu halten.20) Neben Staaten wie Singapur, Taiwan und Vietnam galten die südkoreanischen Eindämmungserfolge als Vorbild für andere betroffene Nationen.
Ein Sonderfall war das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das Ende Februar im japanischen Hafen von Yokohama anlegte.21) Mit 712 nachgewiesenen Infektionen unter den Passagieren hatten sich verbliebene Zweifel an einer geringen Ansteckungsgefahr quasi von selbst erledigt.22) Während die strengen Quarantänemaßnahmen Chinas ab Mitte Februar in Form sinkender Neuinfektionszahlen offenbar Wirkung zeigten, war das Corona-Virus bereits auf dem Weg gen Westen und traf dort auf ein völlig unvorbereitetes Europa.
In Deutschland hatte man die Entwicklungen in Fernost mit aufmerksamer Distanz zur Kenntnis genommen. Als ein Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto im oberbayerischen Stockdorf Ende Januar positiv auf das Virus getestet wurde, schlugen die Gesundheitsbehörden Alarm. Neben dem Mitarbeiter, der sich bei einer aus Shanghai angereisten, chinesischen Kollegin angesteckt hatte, wurden 13 weitere Infektionen bei Kollegen und Angehörigen nachgewiesen. Plötzlich war die ob-skure Bedrohung real geworden. Doch die bayerischen Gesundheitsbehörden handelten geistesgegenwärtig, schickten die Infizierten in Quarantäne, verfolgten Infektionsketten nach und konnten eine weitere Verbreitung verhindern.23)
Schlagartig stieg das öffentliche Interesse an der neuartigen Erkrankung. Man wusste aufgrund bisheriger Erfahrungen, dass die Corona-Sterblichkeit nicht über der „normaler“ Grippeerkrankungen liegt und hauptsächlich ältere bzw. vorerkrankte Patienten betrifft. Auch die Krankheitsverläufe der „Webasto-Gruppe“ verliefen ohne größere Komplikationen und führten dazu, das zum Monatsende alle Infizierten gesund entlassen werden konnten. Damit hatte der Corona-Schock seinen augenblicklichen Schrecken bis auf Weiteres verloren.
Nachdem das Robert Koch-Institut (RKI) Ende Januar eine starke, weltweite Verbreitung ausgeschlossen hatte, bestand auch für die hiesige Bevölkerung wenig Anlass, auf die liebgewonnenen saisonalen Freizeitvergnügen zu verzichten. Es war die Woche vom 19. bis 26. Februar, in der die Corona-Epidemie in Europa ihren entscheidenden Schub erhalten sollte.
Im Mailänder Guiseppe-Meazza Stadion fand am 19. Februar das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem spanischen Vertreter FC Valencia statt. Unter den 44.000 Zuschauern waren auch 2.500 Gästeanhänger anwesend. Von den Heimfans kamen mehr als 500 aus der Region Val Seriana, die sich wenig später zu einem Corona-Hotspot entwickeln sollte. In der Tat kam es rund zwei Wochen nach dem Spiel in der Region rund um Bergamo zu einem sprunghaften Anstieg der Infiziertenzahlen. Damit wird dieser Begegnung als sogenanntes „Spiel Null“ entscheidender Einfluss für die Pandemieentwicklung in Italien und nicht zuletzt auch in Spanien eingeräumt.24)
In Italien kam es ab dem 22. Februar zu ersten lokalen Schließungen von Schulen und Gaststätten sowie zur Verhängung regionaler Ausgangssperren. Ende des Monats war der erste „Corona-Lockdown“ eines europäischen Landes mit einer stufenweisen Lahmlegung des öffentlichen Lebens besiegelt. Nachdem die Infektionszahlen vierstellige Werte erreichten, sah sich Italien gezwungen, der chinesischen Abschottungsstrategie zu folgen, um im großen Stile Menschenleben zu retten.25) Von da an richtete sich auch unser Blick sorgenvoll auf die Ereignisse jenseits der Alpen.
Quasi zeitgleich zu den Entwicklungen in Italien machten sich mit Beginn der Karnevalswoche Tausende Hobbyskifahrer auf den Weg in die alpenländischen Wintersportorte. Wer auf Spaß nicht verzichten wollte, fand sich in den beliebten Tiroler Hotspots Ischgl und St. Anton wieder, wo die internationale Skisaison seit Ende Januar in vollem Gange war. Nachdem mehrere isländische Ischgl-Touristen positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, geriet die Aprés-Ski-Region schlagartig in den Blickpunkt des Interesses. Mit der Rückreisewelle ab Ende Februar wurde das Virus ungehemmt in die letzten Winkel des europäischen Kontinents gespült. Nach einer Spiegel-Recherche sollen alleine mit einem Aufenthalt in Ischgl weltweit rund 11.000 Corona-Infektionen in Verbindung stehen.26)
Das dritte kritische Ereignis betrifft die daheimgeblieben rheinischen Frohnaturen. Während der üblichen Feierlichkeiten zwischen Weiberdonnerstag und Karnevalsdienstag rund um die Hochburgen Köln und Düsseldorf ist enger Körperkontakt quasi Programm. Eine Verbreitung möglicher Grippeviren wird billigend in Kauf genommen und führt ab Aschermittwoch regelmäßig zu vollen Arztpraxen.