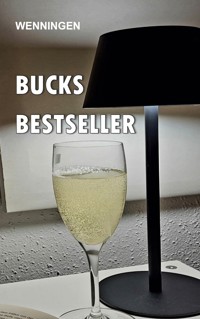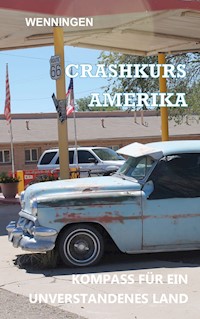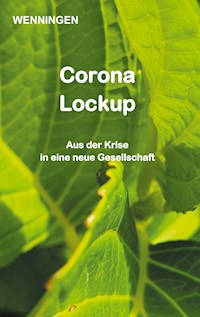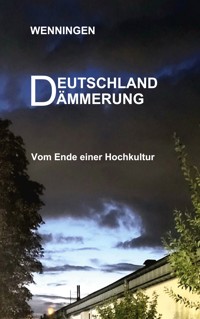
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es dämmert in Deutschland. Das Land der Dichter und Denker droht im Konzert von Globalisierung, Digitalisierung und sozialen Spannungen aus den Fugen zu geraten. Während wir in Europa schwächeln, sind andere Regionen und Kulturkreise auf dem Vormarsch. Ist die Zeit der abendländischen Hochkultur vorbei? Bleibt der moderne Mensch im Zeitalter künstlicher Intelligenz überlebensfähig? Im Zentrum dieser Entwicklungen scheinen der deutschen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Antworten zu fehlen. "Deutschland Dämmerung" beschreibt die Entwicklung eines Landes, das nach Jahrzehnten des Wohlstandes seinem Niedergang entgegensteuert. Die Suche nach einem Ausweg ist das Gebot der Stunde...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Originalausgabe:
Sollte diese Publikation Links und Hinweise auf Webseiten Dritter enthalten, übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese, mit Hinweis auf den Stand der Veröffentlichung, nicht zu eigen machen.
„Denn, ihr Deutschen,
auch ihr seid tatenarm und gedankenvoll.“
Friedrich Hölderlin
INHALTSVERZEICHNIS:
Prolog: Denk ich an Deutschland…!
Woher wir kommen
Als Geiz noch nicht geil war
Das Erbe der Gastarbeiter
Die Marke „Made in Germany“
Safety Last
Analoger Abgesang
Wer wir sind
Von der Globalisierung zur Mangelwirtschaft
Günstiger ist das neue besser
Grundversorgung auf der Kippe
Ritter ohne Rüstung
Klimachaos und Verkehrsirrwege
Zwischen Leit- und Willkommenskultur
- Eine „Hausordnung“ für Deutschland
Moralische Überanstrengung und Erregungskultur
Die Macht der digitalen Visionäre
Wohin wir gehen
Dystopie 2050
Das Ende der neuzeitlichen Hochkultur?
Parteienstaat adé?
Ausweg Verzichtgesellschaft
Epilog: Zukunft hat ihren Preis
Prolog: Denk ich an Deutschland…!
Freundlich lächelt der Apotheker zurück: „Ich kann Ihnen das Normale oder das Complex-Pulver anbieten. Wann wir das Hauptpräparat wieder bekommen, kann ich noch nicht sagen.“ Schon über mehrere Wochen wurde berichtet, dass Basismedikamente wie Ibuprofen, Buscopan oder verschiedene Antibiotika in hiesigen Apotheken nicht zu beziehen sind. Am Beispiel des Aspirin-Plus-C-Mangels fügte sich die substanzielle Medikamentenknappheit nahtlos in Reihe der aufkommenden Versorgungsengpässe des Jahres 2022 ein.
Erdgas, Erdöl, Strom – jahrzehntelange Selbstverständlichkeiten wurden im Schatten des Ukrainekrieges quasi über Nacht zu knappen Gütern. Sparappelle der Politiker mit Blackoutszenarien ließen Horrorvisionen von frierenden Bürgern in winterlich kalten Wohnungen aufkommen. Bereits während der Corona-Krise der Jahre 2020 bis 2022 wurden wir auf Mangellagen trainiert und Verbrauchsgüter des täglichen Bedarfs – vorzugsweise Toilettenpapier, Speiseöl, Milch oder Mehl - zu begehrten Bunkerartikeln.
Bereits mit der Flüchtlingswelle des Jahres 2015 wurden Mangellagen in anderen Bereichen augenscheinlich. Integration, Bildung, innere Sicherheit und die chronische Schwäche des bürokratieüberladenen Arbeits- und Sozialsystems sind trotz des mütterlichen Beruhigungsslogans „Wir schaffen das“ an ihre Grenzen gelangt.
Migration, Corona, Ukrainekrieg – ein Muster deutet sich an. Deutschland, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, scheint im Krisenmodus aus der Balance zu geraten und mitunter nicht einmal die Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung sicherstellen zu können. Und das in einer Generation, die als die Wohlhabendste, Liberalste und Privilegierteste in der Geschichte Deutschlands gelten darf. Jahrzehntelange Wohlstandsmehrung und ein Höchstmaß an persönlicher Freiheit scheinen schleichend und unbemerkt eine negative Kehrseite zu Tage gefördert zu haben.
Doch es wäre schlichtweg zu einfach, Fehler im System ursächlich auf die Existenz externer Krisen zu schieben. Viele der in Deutschland wahrnehmbaren Probleme scheinen hausgemacht und Ergebnisse bewusster bzw. unterlassener Entscheidungen. Deutschland, der aufstrebende Musterknabe der Nachkriegsjahre – das im Ausland um seine Stärke beneidete Wirtschaftswunderland – ist angesichts schleichender Zerfallserscheinungen zu einem Zerrbild geworden.
Zerrbild, Zerfall? Das mag auf den ersten Blick übertrieben und hysterisch anmuten. Richtig ist, dass sich das Land der Dichter und Denker eine Substanz aufgebaut hat, von der andere Länder nur träumen können. Doch genau dieses Deutschland lebt seit rund 3 Jahrzehnten von seiner Substanz und genau diese beginnt, an verschiedenen Ecken brüchig zu werden. Ein Blick in den Motorraum des äußerlich immer noch schmucken Flitzers gibt Aufschluss.
- Deutschland hat ein massives Rentenproblem, das vor dem Hintergrund eines antiquierten Umlagesystems eine Generation verarmter Senioren zu produzieren droht. Jener Systemfehler wird regelmäßig durch Milliarden aus dem Bundeshaushalt zugekleistert.
- Deutschland hat ein Bildungsproblem, das sich mangels qualifizierten Lehrpersonals von den Grundschulen bis in den Hochschulbereich durchzieht und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland Schaden zufügt. Der Charakter bundesdeutscher Schulen ähnelt – mehr als ein Jahrhundert nach Ende des deutschen Kaiserreiches - in seinen Grundzügen inhaltlich wie äußerlich immer noch dem preußischer Erziehungsanstalten.
- Deutschland hat ein unterbelichtetes Gesundheitssystem, das am deutlichsten in dem sichtbar um sich greifenden Pflegenotstand zum Ausdruck kommt. Der Boom privater, ambulanter Pflegedienste kann die stationäre Misere in deutschen Kliniken und Pflegeeinrichtungen nicht überdecken.
Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass gerade die schützenswerten Gruppen unserer Gesellschaft – Alte, Junge und Schwache – aus dem Blick geraten sind und durch den Wohlstandsrost zu fallen drohen. Doch es gibt ein weiteres Problem, das genau die Mitte der Gesellschaft betrifft.
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist nur auf den ersten Blick entspannt. Die niedrige Arbeitslosenquote – Resultat eines aufgeblähten Niedriglohnsektors – dient als soziale Beruhigungspille. Im Jahr 2022 bekleidete Deutschland als europaweit stärkste Volkswirtschaft bei den Durchschnittseinkommen nur den 11. Platz und muss sich unter anderem hinter seinen Nachbarländern Dänemark, Niederlande und Österreich einordnen1). Ein Lohn, der nicht zum Leben reicht und einen Zweit- oder Drittjob erfordert, mag gut für die Statistik sein, verkennt aber das dahinterliegende Einzelschicksal.
Der Rückgang der Reallöhne ist ein längerfristiges strukturelles Phänomen, das erst durch den Inflationsschub des Jahres 2022 in das Bewusstsein gerückt ist. Neben schwindender Kaufkraft befördert dies ein weiteres Problem: Den Mangel an Fachkräften, der die sinkende Attraktivität des Standortes Deutschland im internationalen Vergleich widerspiegelt. Geringe Verdienstaussichten in Verbindung mit hohen bürokratischen Hindernissen sind neben der sprachlichen Hürde ausschlaggebend dafür, dass Deutschland von ausländischen Fachkräften als wenig attraktiv empfunden wird. Insbesondere die skandinavischen Länder haben uns als Zielorte für Fachkräfte vornehmlich aus dem asiatischen Raum den Rang abgelaufen.
Dennoch kommen Menschen immer noch gerne nach Deutschland. Wer durch Krieg oder Verfolgung seine Heimat verloren hat, findet in Deutschland mit seinen liberalen Einwanderungsbestimmungen einen guten Zufluchtsort. Auch Zuwanderern auf der Suche nach wirtschaftlich besseren Perspektiven ist das deutsche Transfersystem an Sozialleistungen nicht unbekannt. Die medial propagierte Willkommenskultur des Jahres 2015 hatte auf Menschen in Not in den Wirren der Migrationskrise magische Anziehungskraft, ganz im Gegensatz zu denen, die sich aus einer gesicherten Existenz heraus als Fachkräfte bewerben und eine dauerhafte Anstellung suchen.
Auch in der Unternehmenswelt hat sich im Zuge von Globalisierung und Digitalisierung einiges verändert. Unter den TOP-30 der weltweit umsatzstärksten Unternehmen liegt mit Volkswagen liegt nur ein deutsches Unternehmen.2) Dass Europa und im Kern Deutschland den Zug der Digitalisierung offenbar verschlafen hat, lässt sich mitunter an der Marktkapitalisierung als Kennzahl ablesen. Hier haben die Unternehmen der New Economy das Sagen. Unter den 100 Unternehmen mit dem weltweit höchsten Marktwert liegen – mit Apple und Microsoft an der Spitze - nur 16 Europäer. Der einzige Vertreter Deutschlands, der Softwarehersteller SAP, rangiert auf einem traurigen 93. Platz.3)
Auch politisch ist in Deutschland nach Abebben der Einheitseuphorie der 1990er-Jahre mittlerweile Ernüchterung eingekehrt. Das ehemalige Schwergewicht im Herzen Europas scheint seine Führungsrolle nicht mehr wirklich anzunehmen und lässt sich von seinen EU-Partnern gerne vor sich hertreiben. Nach Abschaffung der Wehrpflicht und einem substanziellen Kahlschlag der Bundeswehr ist Deutschland quasi verteidigungsunfähig und zum Bittsteller in Sachen Sicherheit und militärischer Unterstützung geworden. Das zauderhafte Verhalten der politischen Führung hat sich in der Ära von Angela Merkel bis Olaf Scholz zu einem Markenzeichen deutscher Außen- und Verteidigungspolitik entwickelt.
Innenpolitisch fällt auf, dass nach Jahren der sozialen Ruhe das Protestverhalten in Deutschland wieder an Dynamik gewonnen hat. Migrations- und Integrationsprobleme, Klimaschutz oder die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben eine Streitkultur gefördert, die nicht selten in blindwütige Aggression gegen staatliche Institutionen und Ordnungskräfte umgeschlagen ist. Militante Ökoaktivisten, gewaltbereite Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger, kriminelle Clans oder hassverbreitende, antiisraelische Demonstranten mögen ideologisch nichts bis wenig miteinander gemein haben. Sie alle eint jedoch eine Grundeinstellung: Der Disrespekt gegenüber Staat und öffentlicher Ordnung, deren demokratische Legitimation mit Füßen getreten wird. Am Ende bleibt die Frage, wie lange ein ausgezehrter und chronisch unterbesetzter Polizeiapparat dem Aggressionsdruck zur Verteidigung der Demokratie noch standhalten kann.
Nicht zu vergessen, die gut gemeinte „Doppelwende“ in Energie und Verkehr. Dass der Klimaschutz in den Köpfen der Menschen einen gesteigerten Stellenwert besitzt und die Bereitschaft zu Verhaltensänderungen befördert hat, ist eine großartige Errungenschaft. Eine Verkehrswende ist allerdings nicht damit vollzogen, in Innenstädten vor dem Hintergrund eines dysfunktionalen öffentlichen Nahverkehrs Autospuren in Fahrradwege „umzulackieren“. Ebenso wenig scheint es zielführend, in Phasen der Energieknappheit aus ideologischen Gründen verfügbare und bewährte Energieträger aufzukündigen. In beiden kritischen Infrastrukturen – Energie und Verkehr – scheint die Umsetzung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes zur langfristigen Sicherung einer intakten Grundversorgung außer Sichtweite.
In Anbetracht der genannten Defizite wird oft reflexartig geantwortet, dass die Gesamtsituation in Deutschland immer noch komfortabler ist als in weiten Teilen der Welt inklusive der europäischen Nachbarn. Dies mag gerade mit Blick auf die sich radikalisierenden politischen Lager unserer EU-Partner ein Fakt sein. Doch es geht hier nicht um Ist-Stände und Momentaufnahmen. Es geht um Entwicklungen. Und diese zeigen in Deutschland in großen Teilen steil nach unten. Auch dies wäre in Anbetracht der bereits erwähnten „deutschen Substanz“ noch kein Problem, sofern es sich hier um eine kurzfristige Tendenz mit Aussicht auf Trendumkehr handeln würde. Doch eine Abflachung der Trendkurve, geschweige denn eine Trendwende, ist gegenwärtig nicht zu erahnen.
„Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht…“. Jene „Nachtgedanken“, die der deutsche Dichter Heinrich Heine im Jahr 1844 aus seinem Pariser Exil angesichts einer aus den Fugen geratenen Weltordnung formulierte, scheinen knapp 200 Jahre später neue Aktualität zu erhalten. Auch heute stehen wir von einer weiteren viel zitierten Zeitenwende, in der das über Jahrzehnte etablierte Deutschland seinen angestammten Platz in der Weltgemeinschaft zu verlieren droht.
Dieses Buch ist nicht als wissenschaftliche Abhandlung über die ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Veränderungen zu verstehen, die Deutschland im Verlauf der letzten 3 Jahrzehnte durchlebt hat. Es ist vielmehr ein Kondensat aus Beobachtungen, Erfahrungen und Erkenntnissen eines Bundesbürgers, der als Kind der 1970er-Jahre, als junger Erwachsener in den 80ern und 90ern und als sogenannter „Best-Ager“ in den 2000er+-Jahren, substanzielle Veränderungen wahrgenommen hat. Die erlebten Veränderungen erregen Besorgnis und stellen die berechtigte Frage, wo die Reise am Ende hinführt. Noch ist nicht Nacht in Deutschland, aber die Dämmerung hat schon eingesetzt.
Woher wir kommen
Als Geiz noch nicht geil war
Man mag sich die Frage stellen, ob es einen bestimmten Punkt gab, ab dem das alles zu kippen begann. Ab dem Deutschland das Heft des Handelns aus der Hand gegeben und sich seiner eigenen Tugenden entledigt hat. Tugend ist ein gutes Wort, das im aktuellen Sprachgebrauch aus der Zeit gefallen scheint und in einer liberal-toleranten Gesellschaft um seine Daseinsberechtigung kämpft.
Tugendhaftigkeit beschreibt einen Wertekanon, der Kindern der 1960er, 70er und 80er-Jahre vermittelt worden ist, und auf dem deren Elterngeneration aus den Trümmern des 2. Weltkrieges ein beispielloses Wirtschaftswunder geschaffen hat. Klassische bürgerliche Tugenden wie „Ordentlichkeit“, „Sparsamkeit“, „Reinlichkeit“ und „Pünktlichkeit“ werden heute ein bis zwei Generationen später eher als uncoole Spießereigenschaften belächelt. Um einer begrifflichen Entfremdung entgegenzuwirken, macht es Sinn, den Blick auf die Tugend etwas genauer zu schärfen.
Nach ethischer Definition bedeutet Tugend „eine als wichtig und erstrebenswert geltende Charaktereigenschaft, die eine Person befähigt, das sittlich Gute zu bewirken“.4) Was als „wichtig und erstrebenswert“ gilt, ist letztlich von den Maßstäben abhängig, die eine Gesellschaft an sich selbst anlegt. Der Fokus auf das „sittlich Gute“ ist im Laufe der Jahrzehnte nach und nach durch das „wirtschaftlich Vorteilhafte“ ersetzt worden.
Auch von den sogenannten himmlischen Tugenden der „Demut“, „Mildtätigkeit“, „Keuschheit“, „Geduld“, „Mäßigung“, des „Wohlwollens“ und „Fleiß“ sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur Fragmente übriggeblieben. Wer demütig und mildtätig durchs Leben geht, gilt gemeinhin als weich und droht, durch den Rest der Gesellschaft übervorteilt zu werden. „Keuschheit“ und „Mäßigung“ haben in einer reizgetriggerten Konsumgesellschaft schon lange keinen Platz mehr und gehören ins Reich der klösterlichen Isolation. Wer „Geduld“ als hervorstechende Eigenschaft für sich postuliert, wird schnell als Phlegmatiker abgestempelt und fällt bei Vorstellungsgesprächen gerne durch den Rost. „Ungeduld“ hingegen kennzeichnet den Macher und wird mit einem Augenzwinkern als Gestaltungstrieb positiv verbucht. „Wohlwollen“ ist in einer zunehmenden Neidgesellschaft schlichtweg aus der Mode gekommen und kämpft als Sekundärtugend um seine Daseinsberechtigung. Die einzig zeitstabile Kategorie ist der Fleiß, mit dem sich selbst bei minderer Begabung – damals wie heute – gesetzte Ziele erreichen lassen.
Die Habgier ist eine himmlische Untugend und eng verwandt mit dem Geiz. Geizverhalten äußert sich in einer übertriebenen Sparsamkeit, mit dem Unwillen andere teilhaben zu lassen.5) Das Teilen zählt zu den Lernstandards kindlicher Erziehung und packt die Entwicklung des Geizes in einem frühen Stadium an der Wurzel – sollte man meinen. Interessanterweise ist das kindlich erworbene Verhaltensmuster zu teilen, nicht besonders formstabil. Schon der heranwachsende Jugendliche wird als Teil der Leistungsgesellschaft trainiert, die Ellenbogen auszufahren, um sich im Wettbewerb mit Gleichaltrigen Vorteile zu verschaffen. Spätestens im Berufsleben ist es mit der generösen Verteilung an gleichgesinnte Mitstreiter und potenzielle Konkurrenten vorbei.
Fast jeder kennt es aus der eigenen Kindheit. Da gab es den geizigen Verwandten, Bekannten oder Nachbarn, der stets den „Igel in der Tasche“ hatte, sich auf Kosten anderer durchgeschnorrt hat und vor dem Bezahlen rechtzeitig verschwunden war. Der Geizige war in seinem Umfeld stets geächtet und galt für die aufwachsende Generation als abschreckendes Beispiel. Wie konnte sich vor diesem Hintergrund das einst geächtete Geizverhalten zu einer salonfähigen Charaktereigenschaft herausbilden?
Im Laufe der Jahre hat sich der konsumgetriggerte Egoismus zu einer universellen Hetzjagd nach persönlichen Vorteilen fortentwickelt. Man war darauf bedacht, clever, gewieft und der trägen Masse einen Schritt voraus zu sein, ohne jedoch in den Verdacht zu geraten, als geizig dazustehen. Eine gesellschaftlich entscheidende Wende ereignete sich im Oktober 2002. Im Rahmen einer von der Hamburger Werbeagentur Jung von Matt entwickelten, breit angelegten Werbekampagne ging die Elektronikhandelskette Saturn mit einem Slogan ins Rennen, der das alte Werteverständnis auf den Kopf stellen sollte. „Geiz ist geil“ hieß die Devise, mit der Kunden zum Kauf von Produkten zu Schnäppchenpreisen animiert werden sollten.6) Der von manchen erwartete moralische Sturm der Entrüstung über die öffentliche Verherrlichung einer Untugend blieb aus. Nun hatte man es endlich Schwarz auf Weiß. Es wurde nicht nur toleriert, sondern offen gefordert, dem eigenen Vorteil und damit verbundenen Unwillen zu teilen, Vorrang zu gewähren. Auf diese Weise wurde einer historisch verpönten Charaktereigenschaft der Weg in den gesellschaftlichen Wertekanon geebnet.
Dem Elektronikriesen den schwarzen Peter für die Auswüchse moralischer Verrohung zuzuschieben, ist an dieser Stelle zu einfach. Die Kampagne traf auf eine Geisteshaltung zu einem Zeitpunkt, als das Geizverhalten die gesellschaftliche Ächtung bereits abgestreift und der moralische Kompass seine Positionierung verloren hatte. 10 Jahre zuvor hätte Saturn mit jenem Slogan sehr wahrscheinlich noch einen Sturm der Entrüstung geerntet. Nun wurden die Schleusen für ungebremstes Abzockverhalten und die Kultivierung einer Geiz-istgeil-Mentalität geöffnet.
Abgesehen von der katholischen Kirche, die auf den Geiz als Sündenmotiv verwies und über ihre Hilfsorganisation Adveniat mit der Gegenkampagne „Geiz ist gottlos“ reagierte, blieb die Öffentlichkeit vergleichsweise gelassen.7) Auch andere europäische Länder übernahmen die Kampagne, in dem sie den Slogan geringfügig abwandelten (Niederlande: „Geizig macht glücklich“; Frankreich: „Je geiziger, desto schlauer“). Die Tolerierung des Geizverhaltens als Begleiterscheinung einer globalisierten Weltwirtschaft ist somit kein exklusiv deutsches Phänomen.
Ein komplementärer Faktor zu der Entwicklung des Geizverhaltens auf der Verbraucherseite ist die Preisdifferenzierung auf der Seite der Anbieter. Die „One-Offer-One-Price-Regel“, wie wir sie bis in die 1980er-Jahre hinein kannten, hat bis auf wenige Ausnahmen ausgedient. Ob Flugpreise, Bahntickets, Handytarife oder die wöchentlichen Rabattschlachten der Handelsketten, der frühe Vogel fängt den Fisch und lässt den trägen Mitstreiter als Dummen zurück. Irgendwo ist immer Black Friday, zu dem man dem neu kultivierten Geizverhalten ungehemmt frönen kann. Die heile Welt der Einheitspreise ist Vergangenheit. Als einsames Relikt hat die gesetzlich geregelte Buchpreisbindung im Einzelhandel noch Bestand.
Das Ausmaß der Preisdifferenzierung geht in Einklang mit einer massiven Veränderung der Anbieterlandschaft. Bis in die 1990er-Jahre gab es in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens monopolähnliche Strukturen. Die Staatsmonopole in den Versorgungsbranchen Energie, Schienenverkehr und Telekommunikation waren prominente Beispiele für eine einheitliche und damit nicht-diskriminierende Preisbildung. Die staatlich verordneten Preise für Strom und Telefonieren (23 Pfennig für ein 8 minutiges Ortsgespräch) wurden als fair empfunden und standen außerhalb jedes kritischen Diskurses.
Es brauchte rund 10 Jahre, um die heile deutsche Versorgungswelt auf links zu drehen. Im Jahr 1994 wurde das monopolisierte Streckenangebot mit der Privatisierung der Deutschen Bundesbahn – zumindest theoretisch - den Gesetzen des Marktes preisgegeben. 1998 kam mit der Liberalisierung des Strommarktes und der Abschaffung des Telekommunikationsmonopols der nächste Schritt, der in die Gründung der Bundesnetzagentur mündete. Ein Jahr darauf erfolgte mit dem Börsengang die Privatisierung der Deutschen Post. Seit dem Jahr 2004 können auch Gaskunden ihren Versorger frei wählen.
Was wie ein befreiender Schritt in Richtung Anbietervielfalt und Marktpreisfairness anmutet, hat zu einer Intransparenz mit einem Hauen und Stechen um die besten Angebote geführt. Dies war die Geburtsstunde der Vergleichsportale – allen voran Verivox und Check24 -, die ihrerseits als privat organisierte Kapitalgesellschaften objektive Angebotsvergleiche suggerieren. Die Kritik der Verbraucherzentralen und Stiftung Warentest als öffentliche und gemeinnützige Wächter der Anbieterneutralität ließ nicht lange auf sich warten. Private Kündigungsdienste wie Aboalarm sind die vorläufige Endstufe dieser Entwicklung.
Die Frage, ob die Grundversorgung der Bevölkerung In Sachen Energie, Transportlogistik und Telekommunikation liberalisiert und damit dem freien Spiel der Märkte ausgesetzt sein sollte, darf man getrost kritisch diskutieren. Dafür spricht zunächst einmal, dass durch den Wegfall des öffentlichen Preisdiktats ein Gefühl der fairen Preisbildung zugunsten des Verbrauchers entsteht. Auf der anderen Seite läuft der Preis lebensnotwendiger Güter und Dienstleistungen Gefahr, zum Spielball der Spekulation zu werden. Dies hat zwangsläufige Auswirkungen auf die Bereitstellung des Angebotes. Die „gefühlte Temperatur“ sagt zumindest, dass sich seit Beginn der Liberalisierung das Preis-Leistungsverhältnis bei den Bahnverbindungen und der Energieversorgung eher verschlechtert hat. Was sagt die Realität?
Blicken wir zurück in die Vergangenheit. Seit dem Jahr 1954 war der Normalpreis einer Bahnfahrt 2. Klasse für längere Strecken (>100 km) über 2 Jahrzehnte quasi unverändert geblieben. Im Jahr 1974 lag der Ticketpreis bei 12 DM und sollte sich in den darauffolgenden 2 Jahrzehnten bis zum Jahr 1994 verdoppeln. Alleine bis zum Jahr 1984 stieg der Fahrpreis um 67% an, in der zweiten Dekade bis zum Beginn der Privatisierung im Jahr 1994 um weitere 20%. Nach der Privatisierung sollte sich der Preisanstieg bis zum Jahr 2004 mit einem Wert von 18 % weiter verlangsamen.8) Auch wenn sich die Preisentwicklung von 2004 bis heute wieder etwas beschleunigt hat, kann festgehalten werden, dass die „Privatisierung“ der Deutschen Bahn nicht als Trigger überdurchschnittlich gestiegener Ticketpreise in Frage kommt.
Doch dieser auf den ersten Blick positive Privatisierungseffekt ist nur die halbe Wahrheit. Von einer reinrassigen Privatisierung kann im Falle der Deutschen Bahn keine Rede sein.9) Nach Umwandlung der Deutschen Bundesbahn in die Deutsche Bahn AG befindet sich das Unternehmen weiterhin in Staatsbesitz. Der Börsengang wurde mehrfach aufgeschoben und zuletzt im Jahr 2011 vor dem Hintergrund unsicherer Renditeerwartungen abgesagt. Das Schienennetz und die Bahnhöfe sind unverändert staatlich und nicht in die AG eingeflossen. Durch die Bestimmung der Trassenpreise ist es der Bahn zudem gelungen, Konkurrenten aus dem liberalisierten Markt herauszuhalten und insbesondere im Fernverkehr als Monopolist zu agieren. Eine Monopolstellung in einem (teil)privatisierten Markt ist eine gefährliche Kombination, die sich trotz weitgehend stabiler Preise im Regelfall auf die Qualität des Angebotes auswirkt.
Um für den angestrebten Börsengang gute Renditezahlen präsentieren zu können und letztlich den Bund als Anteilseigner zufrieden zu stellen, wurden Einsparungen bei Wartung und Modernisierung bis hin zu Streckenschließungen vorgenommen. Dazu der fehlende Druck durch Konkurrenten und im Handumdrehen ist aus einem defizitären aber weitgehend zuverlässigen Staatsunternehmen ein kundenferner Renditeoptimierer geworden. Heute ist der Reformstau bei der Modernisierung des Streckennetzes sowohl im öffentlichen Nahals auch im Fernverkehr immens und steht der Realisierung der angestrebten Verkehrswende entgegen.
Doch hat was hat dies mit dem Thema Geiz zu tun? Obwohl sich die Bahnpreise im Durchschnitt seit der Privatisierung vergleichsweise moderat entwickelt haben, zahlen viele Kunden deutlich mehr. Mangels Konkurrenz von außen hat die Bahn den Preiswettbewerb ins eigene Unternehmen verlagert. Sparpreise, Frühbucherrabatte und die Einführung der Bahncard in ihren verschiedensten Varianten sorgen für Preisvorteile, die durch den spontanen Gelegenheitsfahrer finanziert werden. Im Zuge dieses intransparenten Tarifdickichts blicken nur noch die Versierten, Geschickten und gut Informierten durch, um ihre Schnäppchen auf Kosten der Allgemeinheit abzugreifen. Die aus dem Einzelhandel stammende „Geiz-ist-geil-Mentalität“ hat längst die Versorgung mit Basisdienstleistungen erreicht.
Bei der Energieversorgung ist der Fall etwas anders gelagert. Blicken wir auch hier in die Vergangenheit. Bis zur Ölkrise der Jahre 1973/74 waren die Strompreise in Deutschland kontinuierlich gefallen. Auf wenn sich die Preise seitdem im Steigflug befinden, lag der Anstieg bis zum Jahr 2000 immer noch unterhalb der Inflationsrate und der Entwicklung der durchschnittlichen Bruttolöhne.10) Nachdem im Zuge der Liberalisierung des Strommarktes im Jahr 1998 neue Wettbewerber zugelassen wurden, stiegen die Strompreise in ungeahnte Höhen. In den Jahren 2000 bis 2014 verdoppelte sich der Preis für die Kilowattstunde (kWh) auf einen Wert von 29,37 ct.. Drückt man die Preise in Arbeitseinheiten aus, so mussten Beschäftigte im Jahr 2000 für 1.000 kWh erzeugten Strom 12,2 Stunden arbeiten. Im Jahr 2014 waren es bereits 18,1 Stunden.1) Reflexartig kommt man zu dem Schluss, dass die Privatisierung zu einer Verteuerung der Stromversorgung und einer Benachteiligung der Verbraucher geführt hat. Doch auch hier lohnt ein genaueres Hinsehen.
Der Strompreis ist zu einem nicht unerheblichen Teil ein politischer Preis. Mit der Stromsteuer, Konzessionsabgabe, KWKG-Umlage, Umlage nach § 19 der Strom-Netzentgeltverordnung, Offshore-Netzumlage, Umlage für abschaltbare Lasten und der (vorübergehend ausgesetzten) EEG-Umlage hat die Politik nicht weniger als 7 verschiedene Abgaben geschaffen, die auf Basis des Jahres 2022 einen Anteil von rund 30% des Gesamtpreises ausmachen. 22% entfallen auf Netzentgelte und Gebühren, so dass am Ende nur knapp die Hälfte des Preises reine Beschaffungskosten sind. Als Topping kommt für alle Bestandteile noch die Mehrwertsteuer hinzu.12)
Die Situation scheint paradox. Trotz Privatisierung hat der Staat seinen Einfluss durch Abgabenerhöhungen ausgeweitet. Von einem Strompreis in Höhe von 32,7 ct. blieb den konkurrierenden privaten Stromanbietern im Jahr 2022 nur ein Betrag von 14,46 ct., der für Preisdifferenzierungen in Frage kommt. Dennoch lassen die Privatanbieter nichts unversucht, um Stromkunden über ein ausgeklügeltes Rabattsystem von Sofort- und Neukundenboni, Laufzeitgarantien, Online-Rabatten und Ökotarifen auf ihre Seite zu ziehen. Ohne die Aufklärungsarbeit der bereits genannten Vergleichsportale ist es kaum möglich, Preisvorteile zu erspähen und den Intransparenzen Herr zu werden. Der Sprunghafte, Wechselbereite, der auf seinen jährlichen Kündigungsvorteil lauert, wird belohnt, während der träge Bestandskunde massive Tarifzuschläge erntet. So darf sich der geile Geizige beim morgendlichen Trockenrasieren regelmäßig als stolzer Abzockgewinner fühlen.
Auch beim Gas oder der Telefonie haben wir es mit teilliberalisierten Märkten zu tun, bei dem sich Privatanbieter am Tropf der großen Netzbetreiber mit komplexen Tarifangeboten um die Kundengunst bewerben. Auch hier sind es die Schnellen, Findigen und Wechselbereiten, die zu Lasten der treuen Kunden das Rennen machen. Festzuhalten bleibt, dass die Privatisierung und Preisdifferenzierung im Versorgerbereich gesamtgesellschaftlich keine spürbaren Vorteile gebracht hat, durch die Kultivierung des Geizverhaltens Spaltung befördert und vor dem Hintergrund der aktuellen Lage um die Energiesicherheit zu hinterfragen ist.
Kehren wir zurück zum Einzelhandel. Wer seine Kindheit in den 1970er und 80er-Jahren in Westdeutschland verbracht hat, wird sich insbesondere in der Vorweihnachtszeit an zwei Dinge erinnern: Den OTTO-Katalog und den obligatorischen Gang durch die Warenhäuser von Karstadt, Kaufhof und Hertie. Die Nostalgie in Ehren kommt seit jener Zeit die Geschichte der Warenhäuser in Deutschland einem Sterben auf Raten gleich. Mit dem Ende von Hertie und Karstadt als eigenständige Unternehmen ist eine mehr als hundertjährige Warenhausdynastie beendet worden. Beide Unternehmen sind durch Übernahme des Konkurrenten Kaufhof in der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH aufgegangen, die ihrerseits, von massiven Filialschließungen betroffen, um ihr Überleben kämpft. Auch der Kultkatalog des Hamburger Versandhauses ist mittlerweile Geschichte und ging im Jahr 2019 zum letzten Mal in Druck.
Zu jener Zeit ging es beim Kauf von Waren seltenst um den günstigsten Preis. Nach Belieben wurde die Bestellkarte des Kataloges ausgefüllt und mit Vorfreude auf die Lieferung gewartet. Die seinerzeit noch liebevoll ausgestatteten Spielwarenabteilungen der Kaufhäuser waren Erlebnislandschaften, die den Warenpreis als Kriterium in den Hintergrund treten ließen. Ob Barbie-Puppe, Skateboard, Roller-Blades oder Carrera-Bahn, jene Kultobjekte der 70er und 80er-Jahre sprachen für sich und entbehrten jeglicher Preisdiskussion. Es war schlichtweg unvorstellbar, für den Kauf eines dieser Objekte durch diverse Warenhäuser zu tingeln, um die eine oder andere Mark zu sparen. Preise wurden als einheitlich und gottgegeben hingenommen. Man kaufte mit Freude und wenn das Geld nicht reichte, wurde es aufgeschoben statt aufgehoben. Das Kauferlebnis wurde zur Krönung zielgerichteten Sparens.
„…dann gehen wir morgen zu Feldhaus.“ So sprach die Mutter und wie auf Knopfdruck wurden selbst die verhaltensauffälligsten Sprösslinge für einige Stunden zu Musterkids. Ein Besuch bei Feldhaus war für viele Jahrzehnte ein wahr gewordener Kindertraum. Die Kölner Spielwarenkette, im Jahr 1839 gegründet, hatte ihr einzigartiges Konzept über eine Handvoll Filialen in Westdeutschland zum Erfolg geführt.13) Es waren die liebevoll dekorierten Schaufenster, die Appetit auf spielerische Entdeckungsreisen machten. Hinter der Eingangstür grüßte ein übergroßer, freundlicher Steiff-Teddy. Für die Leckermäulchen gab es eine Softeisstation und ein Crépesfenster. Aus dem 1. Stock – dort wo die höherwertigen Modellartikel von Märklin oder Revell schlummerten - führte eine Rutsche zurück in den Eingangsbereich.
Doch auch der Kindertraum von einst ist mittlerweile ausgeträumt. Im Jahr 1996 wurde das Familienunternehmen in die SF Spiel + Freizeit Handelsbetriebe GmbH integriert, um mit Hilfe zentraler Logistik Kosteneinsparungen zu erzielen. Doch die horrenden Innenstadtmieten und rückläufige Umsätze im Zuge eines veränderten in Richtung digitale Elektronik laufenden Spielverhaltens versetzten Feldhaus 10 Jahre später den Todesstoß. Im Jahr 2006 waren 167 Jahre Kaufhausgeschichte beendet und die Magie des Kauferlebnisses endgültig verflogen.
In der Warenwelt von heute ist jene romantisch anmutende Magie einem rationell-ökonomischen Bestellvorgang gewichen. Mit einigen wenigen Clicks wird das preisoptimierte Objekt just-in-time geliefert, bei Nichtgefallen retourniert und in den nächsten Bestellvorgang überführt. Angetrieben durch den Motor der Digitalisierung hat die Geiz-ist-Geil-Mentalität den Warenhandel gekapert und seiner naiven Romantik beraubt. Die Funktionalität regiert und zieht ihren Reiz aus dem Streben nach Perfektion, das sich in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen bemerkbar macht.
Mit dieser kommerziellen Entwicklung hat sich quasi parallel auch das Erscheinungsbild unserer Städte verändert. Ebenso hat die Gesellschaftsstruktur seit den 1970er-Jahren einen fundamentalen Wandel erfahren. Diese Veränderungen über eine Wegstrecke von 4 Jahrzehnten sind frappierend und verdienen einen tieferen Blick.
Das Erbe der Gastarbeiter
Seit dem Erscheinen der ersten Gastarbeiter Mitte der 1950er-Jahre hat sich das von Flucht und Vertreibung gebeutelte Nachkriegsdeutschland zu einem Einwanderungsland entwickelt. Dies geschah und geschieht auf der Grundlage einer Willkommenskultur, die auf Zuwanderer eine natürliche Anziehungskraft ausübt. Die Motive für Migration sind vielschichtig und haben die Gesellschaft über die Jahre von Grund auf verändert. Jene Veränderungen haben über die Zeit ihre Schattenseiten hinterlassen, die sich heute in einer zum Teil hitzigen Integrationsdebatte entladen. Ghettobildung, mafiaähnliche Strukturen und Clankriminalität werden als Beispiele einer verfehlten Einwanderungspolitik kontrovers diskutiert. Was heute als Gesellschaftsproblem offenkundig ist und die Überforderung der Politik darlegt, hat einst als romantische Win-Win-Situation begonnen.
Die CDU-geführte Bundesregierung Konrad Adenauers hatte früh erkannt, dass für den Wiederaufbau Deutschlands ein entscheidendes Manko bestand: es fehlten Arbeitskräfte. Insbesondere im Bergbau, Bauwesen und in der industriellen Fertigung war der Mangel an inländischen Arbeitern allgegenwärtig. Im Jahr 1955 wurde mit der italienischen Regierung das erste Anwerbeabkommen unterzeichnet, das den geordneten Zuzug von Arbeitskräften regeln sollte.14) Dies geschah in beidseitigem Einvernehmen, da die italienische Regierung damit die Hoffnung verband, ihr Handelsbilanzdefizit gegenüber Deutschland zu reduzieren.
Schnell machte der Begriff des „Gastarbeiters“ die Runde, der bei der Masse der deutschen Bevölkerung zunächst positive Assoziationen auslöste. Zum einen suggerierte der Begriff „Gast“ einen nur vorübergehenden Aufenthalt, der keine tiefergehenden Integrationsbemühungen erforderte. Zum anderen waren „Arbeiter“ in Deutschland Mangelware und daher zum Aufbau des deutschen Wirtschaftswunders hochwillkommen. Frei nach dem Motto „wenn die Party zu Ende ist, geht der Gast nach Hause“, sagt auch der „Mario“ nach getaner Arbeit „Arrivederci“ und geht zurück nach „Bella Italia“. Unter diesen Prämissen wurden Heerscharen freundlicher Italiener mit blumigen Empfängen an deutschen Bahnhöfen begrüßt.
Geplant war zunächst, nach sorgfältiger Vorauswahl geeignete Saisonarbeiter für die Landwirtschaft und das Gaststättengewerbe zu akquirieren und Arbeitsverträge für die Dauer von maximal 12 Monaten zu gewähren. Doch der Hunger nach „günstigen“ Arbeitskräften sollte sehr zügig auch die anderen Branchen ereilen. Alleine im Jahr 1965 fanden 270.000 Arbeitskräfte aus Italien den Weg in deutsche Arbeitsverhältnisse, bevor diese Zahl ab den 1970er-Jahren wieder zurückging. Die zwischenzeitliche Rezession und das unklar geregelte Thema des Familiennachzuges führten dazu, dass die hauptsächlich aus dem strukturschwachen Süditalien stammenden Gastarbeiter in Deutschland keine dauerhafte Bleibe fanden. Mit Begriffen wie „Itaker“ und „Spaghettifresser“ wurde die Toleranzgrenze innerhalb der deutschen Bevölkerung auf abwertende Art und Weise verdeutlicht. Von den rund 4 Mio. italienischen Arbeitsmigranten kehrten rund 90% wieder in ihr Heimatland zurück. Ein Großteil der Verbliebenen konnte als selbstständige Unternehmer einen in Deutschland bis heute beliebten Gastronomiezweig aufbauen.
Bereits in den 1960er-Jahren wurde klar, dass das italienische Experiment des vorübergehenden Aufenthalts und der Beschäftigung in ausgewählten Branchen das deutsche Aufbauproblem nicht lösen kann. Im Schnellverfahren wurden weitere Abkommen mit Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963) und Jugoslawien (1968) geschlossen, die ihrerseits bereitwillige Arbeitskräfte entsandten. Während den griechischen Gastarbeitern der Familiennachzug gewährt wurde, blieben die Einreise- und Arbeitsbestimmungen für Türken und Marokkaner als Nichteuropäer zunächst strikt. Insbesondere marokkanischen Gastarbeitern, die sich in der Bergbau- und Tiefbaubranche als zähe Arbeitskräfte erwiesen, wurden strenge Gesundheitsprüfungen auferlegt, Familienzusammenführungen untersagt und die Verlängerung der Aufenthaltsfrist über einen Zeitraum von 2 Jahren hinaus verweigert.15)