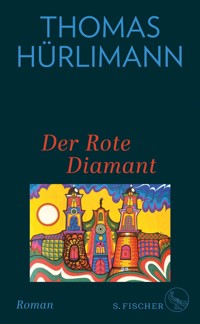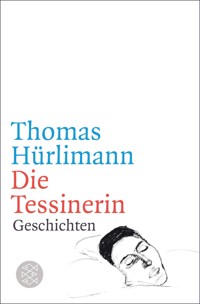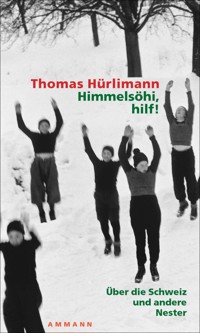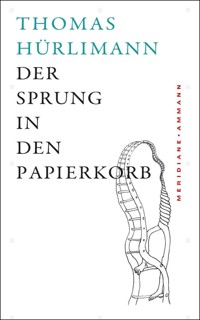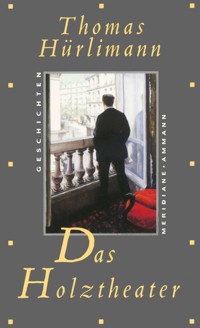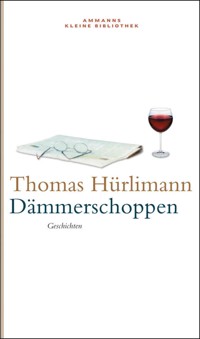
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichten und Novellen zeigen Thomas Hürlimann auf der Höhe seines Könnens. In der Titel-Erzählung sitzt der alte Gottfried Keller auf einer Hotelterrasse über dem Vierwaldstättersee bei einem Dämmerschoppen. Als auf einmal die Höhenfeuer zu lodern beginnen, will er von einem hochnäsigen Oberkellner wissen, was das Land zu feiern habe. Den siebzigsten Geburtstag eines abgetakelten Dichters, antwortet der Ober. In anderen Erzählungen erfahren wir, wie Thomas Bernhard und Rolf Hochhuth während einer Bahnfahrt den Plan fassen, miteinander ein Theater zu bauen. Oder wie der nimmermüde Goethe unter dem staunenden Blick seines Schreibers und Kofferträgers Frunz die Schweiz vermisst. Und wie die schöne Serviertochter Lo im Urner Trachtenrock mit der Titanic untergeht. Hürlimanns Meisterstücke verschweigen die Katastrophen und Tücken der Welt keineswegs, doch tauchen sie die Menschen und die Natur in ein mildes, versöhnliches Abendlicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Thomas Hürlimann
Dämmerschoppen
Geschichten
Über dieses Buch
Diese Geschichten und Novellen zeigen Thomas Hürlimann auf der Höhe seines Könnens. In der Titel-Erzählung sitzt der alte Gottfried Keller auf einer Hotelterrasse über dem Vierwaldstättersee bei einem Dämmerschoppen. Als auf einmal die Höhenfeuer zu lodern beginnen, will er von einem hochnäsigen Oberkellner wissen, was das Land zu feiern habe. Den siebzigsten Geburtstag eines abgetakelten Dichters, antwortet der Ober. In anderen Erzählungen erfahren wir, wie Thomas Bernhard und Rolf Hochhuth während einer Bahnfahrt den Plan fassen, miteinander ein Theater zu bauen. Oder wie der nimmermüde Goethe unter dem staunenden Blick seines Schreibers und Kofferträgers Frunz die Schweiz vermisst. Und wie die schöne Serviertochter Lo im Urner Trachtenrock mit der Titanic untergeht. Hürlimanns Meisterstücke verschweigen die Katastrophen und Tücken der Welt keineswegs, doch tauchen sie die Menschen und die Natur in ein mildes, versöhnliches Abendlicht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Covergestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490331-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
I
Dämmerschoppen
Erster Akt
Zweiter Akt
Dritter Akt
Vierter Akt
Fünfter Akt
Das Holztheater
Im Dichtergarten von Cadenabbia
Lehrjahre eines Unterdozenten
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Heimatluft
Augenmensch und Hörnlimann
II
Schweizerreise in einem Ford
Onkel Egon und der Papst
Die Erst-August-Rede
Der Tunnel
L’heure fédérale auf der Titanic
III
Der Vestiaribruder
Die digitale Diktatur
Der Herr des Raumes
IV
Begegnung
Frau Lorentzen
V
L’esprit de l’escalier
Das Schiff
Nachwort
Quellenhinweise
I
Dämmerschoppen
Novelle
Erster Akt
Am Vorabend seines siebzigsten Geburtstages saß hoch über dem Vierwaldstätter See der Dichter Gottfried Keller auf einer Hotelterrasse, trank eine Flasche Gumpoldskirchner und sah in die Dämmerung hinaus. Hier oben kannte ihn niemand. Der Seelisberg, mitten in der Innerschweiz auf einer steil abfallenden Felsflanke gelegen, war ein vornehmer Luftkurort und wurde von Herrschaften aus ganz Europa, ja sogar aus Übersee, aber kaum von Schweizern besucht. Keller hob das Glas. Der Juliabend war lau, der Wein gut, mit jedem Schluck fühlte er sich wohler. Morgen würde er siebzig Jahre alt, ein runder Geburtstag, das größte Fest seines Lebens, er jedoch, der Jubilar, hatte all seinen Gratulanten ein Schnippchen geschlagen. Es war ihm gelungen, im Grand-Hotel »Sonnenberg« unter falschem Namen abzusteigen. Er trank das Glas in einem Zug leer und stellte sich in wachsender Frohlaune vor, wie die Männerchöre und Fackelstudenten ihre Lieder und Hochrufe vor seiner Zürcher Wohnung ins Leere jubeln würden: Keller hervor, hurra! hurra! hurra!
Am Fuß der Flanke, bei der Rütliwiese, tutete ein Dampfer. Dann erklang ein helles Lachen – zwei Mädchen, ihm einen Gruß zunickend, verschwanden im Hotel. Ach, ich alter Hund, dachte Keller, wie bin ich froh, daß mich die Flöhe der Leidenschaft nicht mehr jucken.
Oft kam die Schwermut mit einbrechender Dämmerung, deshalb war Keller entschlossen, seiner Gicht zum Trotz, noch eine Weile zu sitzen, zu trinken. Er fürchtete sich vor der pompösen Leere seines Zimmers. Dort würde er auf dem Doppelbett liegen, nicht viel größer als ein Kind, er würde die Decke betrachten und das im Dunkel sich auflösende Tapetenmuster, und dann, plötzlich, würde auf der Fußlade der Bettstatt sein schwarzer Vogel hocken, die Schwermut.
»Es timmeret«, bemerkte jetzt, ihm einschenkend, ein langbeiniger Herr Ober. Er war aus dem Innern herangestelzt, nun stellte er die Flasche auf den Beitisch zurück, räusperte sich in einen weißen Handschuh hinein und erwartete wohl, daß ihn der Gast in eine Unterhaltung zöge. Keller hütete sich. Das war ein Hiesiger, ein Innerschweizer. Ihm, dem Stadtzürcher, waren Leute dieses Schlages fremd. Vor Zeiten hatten sie ihr Land den Vögten abgenommen, sie waren ihre eigene Herrschaft geworden, und heute? – heute krochen sie hinter Komtessen her, hinter Bank- und Schlotbaronen, immer darauf bedacht, ein Trinkgeld zu kassieren. Die einst mächtigen Bauern hatten sich zu Knechten deformiert, zu Kellnern und Caddies.
Unter der zarten, letzten Himmelshelle schien das Land weit und groß und grau zu werden. Von den tiefer gelegenen Alpen tönte das Läuten der Herden herauf, und ein Senn mit kräftiger Stimme, die ein Holztrichter noch verstärkte, leierte seinen Betruf in den Abend hinaus. Der befrackte Ober stand jetzt an der Terrassenbrüstung; er schien dem Dampfer zuzusehen, der tief unter ihm den See durchfuhr.
Ich bin, sagte sich Keller, ein Greis. Er saß in einem Korbstuhl, die kurzen Beine von einem Plaid verdeckt, und trank, trank hastig, er trank, um froh zu bleiben, heiter. Es war kühl geworden, es wurde dunkel. Nur der See, als vermöchte er aus eigener Kraft zu leuchten, lag wie ein Spiegel aus Silber in der Tiefe einer gründunklen Schattenlandschaft. Keller lächelte. Er war alt, doch nicht verbittert. Er war allein, doch nicht einsam. Der Vogel, wagte er zu denken, hatte ihn zwar gestreift, doch nicht gepackt. Heute, am Vorabend seines Geburtstages, ließ ihn die Schwermut in Ruhe. Der Herr Ober steifte den Rücken, drehte sich um und sah herüber. Er schien etwas sagen zu wollen. Keller duckte sich. Aus dem Himmel schwand das letzte Licht. Kein Stern, kein Mond. Irgendwo wurde ein Fenster geschlossen, ein Vorhang gezogen, und das Bimmeln der Herden tönte dumpf und fern.
Da, plötzlich, geschiehts –
Das nachtdunkle Land erwacht, die Seedörfer und Seitentäler beginnen zu läuten, nah ein Knistern, ein Geprassel, ein Feuer lodert auf, ein Höhenfeuer, und schon stehen alle Flanken, alle Gipfel in Flammen – das große Naturtheater der Innerschweiz hat sich mit einem Schlag illuminiert.
Sofort war es mit Kellers Frohlaune vorbei. »Was händ ächt die Tuble wider z fyre!« knurrte er.
Der Ober kam näher. »Ein Dichtergeburtstag!«
»Wie bitte?« Keller verschluckte sich.
Ja, fuhr der Ober leise fort, kaum zu glauben, doch leider die Wahrheit, mit diesem Aufwand an Holz, Feuer und Geläute werde ein gewisser Keller, Gottfried, Dichter aus Zürich, zum Siebzigsten geehrt und gefeiert – reichlich übertrieben, wie er, der Herr Wendelin, finde.
»So, so«, machte Keller.
Und Herr Wendelin, mit hämischem Unterton: »TRINKT, O AUGEN, WAS DIE WIMPER HÄLT, VON DEM GOLDENEN ÜBERFLUSS DER WELT!«
Keller riß die Brille ab, drückte Daumen und Zeigefinger gegen die Augen, aber er wußte, er sah es: Das war kein Traum, kein Suffgebilde, dieser Herr Ober, der ihn so frech und abschätzig zitiert hatte, stand lang und ein wenig nach Schweiß riechend neben seinem Stuhl. In dieser Tonart, erklärte er nun, pflege der Jubilar zu dichten, der zitierte Vers habe heute morgen in allen Zeitungen gestanden. Trinkende Augen! Haltende Wimpern! Also ihm, dem Herrn Wendelin, sei das zu verstiegen und zu altmodisch, lyrisches Geflitter von gestern.
Der Dichter, für den das Land die Glocken erschallen und die Gipfel wie Fackeln leuchten ließ, griff mit alterszittriger Hand nach dem Glas. Sollte er lachen oder heulen? Der Ober nahm die leere Flasche vom Tisch und sah ihn fragend an.
»Ja«, sagte Keller, »bringed no e Guttere!«
Er krallte seine Finger in die korbige Lehne. Ihm schwindelte. Jetzt war er da – der Vogel war da. »Habt Ihr nicht verstanden?« rief Keller mit verzweifelter Kraft, »no e Guttere, noch eine Flasche, und zwar rasch!«
Auf seinen dünnen Beinen stakste der Ober davon. Ein kalter Luftzug, der vom See herauf und über die Terrasse stieg, ließ seine Frackschöße flattern. Keller schnaufte. Was tun? Fliehen!
Zu spät. Schon stand der Ober wieder bei ihm, zog nah an Kellers Ohr den Korken aus der Flasche und meinte keck, das sei kein schlechter Tropfen, dieser Gumpoldskirchner.
»Drum suuf en«, sagte Keller.
Zweiter Akt
Wendelin Lymbacher, von der vornehmen Welt »Herr Wendelin« gerufen, war stolz, im Grand-Hotel »Sonnenberg« (»Europas größte derartige Anlage«) dienen zu dürfen. Hier lernte man die Crème de la crème kennen, Grafen, Barone, Geheime Oberjustizräte und sogar einen Selfmademan aus dem fernen Amerika, den Reverend Douglas Forrest mit Gattin aus Clifton, Cincinnati. Ja, die seltsamsten Gäste logierten hier oben. Eine Madame Schilizizi mit Familie und Bedienung aus Petersburg saß während des ganzen Tages in einer lauschigen Naturnische; ein Baron von Steffens hielt sich ausschließlich zwischen den Spiegelwänden des Konversationszimmers auf und sah sich gelangweilt beim Gähnen zu; und Campell, ein Colonel aus London, schien es offensichtlich zu genießen, in der Tiefe der Felsenkeller tagtäglich eine Molkenkur zu absolvieren. Sonderlinge, gewiß, aber alle, mochten sie erstklassiger Adel sein, wie Conte Cesare del Mayo aus Milano, oder als Künstlerin weltberühmt, wie das Fräulein von Brausewetter (mit Bedienung) aus Königsberg, alle strebten sie nach dem Five o’clock auf ihre Zimmer, um sich für das Abendessen umzuziehen. Nur dieser eine nicht, der Zwerg im Korbstuhl. Der war hocken geblieben. Herr Wendelin räusperte sich – der Korbstuhl tat keinen Wank.
Er war nämlich hier, wie man soeben erfahren hatte, hier im Hotel, er selbst, Gottfried Keller, der jubilierende Nationaldichter. Angeblich unter falschem Namen abgestiegen, eine typische Künstlerlaune und natürlich darauf berechnet, daß man den hohen Gast früher oder später erkennen würde. Dann, so der Plan der Direktion, wollte man den angenehm Überraschten auf die Terrasse führen, damit er das Läuten vernehme und die Feuer schaue, die die Heimat zu seinen Ehren entzündet hatte.
Herr Wendelin räusperte sich erneut, lauter jetzt, der Alte jedoch – er schien nichts zu merken, nichts zu hören. Er hockte ganz und gar am falschen Platz. Ein veritables Hindernis, wie Sous-Chef Müller gesagt hatte. Bevor man den Dichter auf die Terrasse bitten konnte, mußte der Knurrhahn im Korbstuhl entfernt werden.
Noch einmal sich räuspern? Es war unter seiner Würde. Zudem hatte er Arbeit genug. Er, der Herr Wendelin, war der Längste der ganzen Brigade und gelangte als einziger, ohne eine Leiter ersteigen zu müssen, zum Draht hinauf, der über der Terrassenbrüstung gespannt war. Jetzt zündete er einen ersten Lampion an, klappte ihn zur Kugel auf und hakte die, sich reckend, an den Draht. Dann warf er einen Viertelblick über seine Schulter. Der Alte war ein Landsmann. Das erklärte, warum er die Ordnung des Hauses so dreist mißachtete – Schweizer kamen nur selten auf den Seelisberg, sie fühlten sich unter den Großen der Welt nicht wohl. Könnte, schätzte Herr Wendelin, ein alter 48er sein; bärtig, das Gesicht zerknittert, und den Wein soff er wie das Braunvieh Wasser. Herr Wendelin schüttelte sich. Gottseidank, diese Typen traten allmählich ab. Sie hatten zwar den neuen Bundesstaat gegründet und eine freiheitliche Verfassung in Kraft gesetzt, aber den Geist, der ihrer Schöpfung entsprungen war, verstanden sie nicht. Gerade sie, die für die Liberalität auf die Barrikaden gestiegen waren, warnten nun griesgrämig und besserwisserisch vor dem Verganten der Freiheit; sie polterten gegen die Eisenbahn, die die Landschaft verschandele, und in den erhabenen Grand-Hotels – man soll es nicht für möglich halten! – sahen sie Gesslerische Trutzburgen, die die Schweizer zu Lakaien verkrümmten, zu Lohn- und Trinkgeldempfängern der internationalen Adels-, Fabrik- und Kapitalherren.
Nein, entschied Herr Wendelin, mit so kurzen Beinen ersteigt man keine Barrikaden, ein alter Revolutionsheld war das nicht. Eher sah er einem Künstler ähnlich, vielleicht einem Landschaftsmaler.
Nun, er mußte den Brummli von der Terrasse schaffen, und zwar so diskret als möglich. Die Kellersche Verszeile hatte ihm mißfallen. Daran, dachte Herr Wendelin, ließe sich anknüpfen. Er trat neben den Korbstuhl und fragte, ob der Herr den allseits Gefeierten kenne, vielleicht sogar gelesen habe. Eine Weile blieb es still. Dann ein böses Geknurr, unverständliche Flüche, und wieder: Stille.
Ein sonderbarer Patron, dachte Herr Wendelin, höchste Zeit, daß er ihn los wurde.
Dritter Akt
Verkehrte Welt! Keller kochte. Er hatte allen Feierlichkeiten, den Reden und Gesängen entfliehen wollen, und jetzt thronte er wie ein Buddha inmitten des großartigsten Ehrenspektakels, ließ sich von den Höhenfeuern beglänzen, von den Kirchtürmen beschallen, und zu allem Überfluß schien sich auch noch das Hotel an dem Affenzirkus beteiligen zu wollen. Unten im Garten Schritte, Getuschel, und der Ober, diese unsägliche Jammergestalt, hatte eine Lampiongirlande in den Nachthimmel eingezogen.
Immer lief alles verkehrt. Er, der Zwerg, war zeit seines Lebens wie ein Köter um die längsten Weiber herumgestrichen. Er, der Lyriker, hatte einen vielhundertseitigen Roman geschrieben, und zwar – das war das Allerschlimmste! – in zwei verschiedenen Fassungen. Dabei war er tatsächlich zum Epiker geworden, aber die literarische Welt – o Verkehrtheit ohne Ende! – hatte sich natürlich entschlossen, ihn nur als Novellenheini ernst zu nehmen. Die Leute von Seldwyla, Schöpfungen seiner Jugend, liefen ihm nach wie gestutzte Pudel.
Der Ober rührte sich nicht. Keller blinzelte zu ihm hoch. Das Peinliche war: Der Mann hatte recht. AUGEN, MEINE LIEBEN FENSTERLEIN, GEBT MIR SCHON SO LANGE HOLDEN SCHEIN, LASSET FREUNDLICH BILD UM BILD HEREIN. Den Herrn Ober ließen sie herein und diese verfluchte Innerschweizer Nachtwelt, die ihn, den Nationaldichter, feierte. Keller verkroch sich in den Korb. Wie hatte sein Freund Storm über das ABENDLIED geschrieben? Das sei »reinstes Gold der Lyrik, die schönste Frucht Ihres Alters, mein lieber Keller«. Lüge war’s, Kitsch, Gouvernantenpoesie.
In den Tälern verklang das Geläute. Im nahen Feuerstoß fraßen sich die Flammen knisternd durch dürres Geäst, Funken spritzten ab und versprühten wie kleine Milchstraßen. Keller blickte ihnen nach. Die Schwester, die er lange gepflegt hatte, war tot. Die Mutter war schon lange tot. Auch seine Verlobte: tot und begraben – sie hatte sich umgebracht, kurz vor der Heirat. Er war ein alter, einsamer Tropf. GOLDENER ÜBERFLUSS? Keller seufzte. Nein, grau war die Welt, grau das Leben, und das Alter eine einzige Plage. Er hatte keine Familie, keine Freunde … und plötzlich, von einer Sekunde zur andern, war Keller wach, hellwach, nüchtern: Niemand konnte wissen, daß er hier oben steckte. Wie, zum Teufel, war er aufgeflogen? Etwa durch den Ober? Hatte der Lange ihn erkannt?
Keller wollte ihn ansprechen, aber der Ober, einem Rasiermesser ähnlich, klappte in einen Winkel von 90 Grad. Er verbeugte sich vor einer Gästeschar, die, »Ah!« und »Oh!« rufend, aus dem Innern hervorrauschte.
»Was sagen Sie zu diesem Panorama?«
»Schlichtweg imposant!«
»Glücklich die Republik«, näselte ein Herr, »die ihren Sänger so feurig zu ehren versteht. Haben Sie ihn gelesen, Baronin?«
»Seine Lyrik.«
»Gewagt!«
»Aber poetisch. Wo ist Graf Rantzau? Er wollte uns begleiten.«
»Fürchte«, sagte eine britische Zunge, »der Graf haben noch an der Bar zu tun.«
Und alle verschwanden sie in den unteren Garten hinab, die Herren mit Zigarren, die Damen in seidene Schals gewickelt, und zwei rotgewandete Pagen trugen wie Ministranten einen Stoß Notenblätter hinter ihnen her.
Keller zog am Frackschoß des Langen. »He«, sagte er, »von wem habt ihr eigentlich erfahren, daß er hier ist, dieser Keller?«
Der Ober verharrte noch immer in seiner Verbeugung.
Vierter Akt
Herr Wendelin verharrte noch immer in seiner Verbeugung und sog den Parfümduft ein, der den Damen wie eine Schleppe nachflog. Wie hatte Colonel Campell eben bemerkt? »Fürchte, der Graf haben noch an der Bar zu tun.« Es durchschauerte ihn. Graf Rantzau war ein Säufer, der um diese Zeit kaum noch stehen konnte, und Colonel Campell bemerkte leichthin, »der Graf haben an der Bar zu tun«. That’s it, dachte Herr Wendelin, das war die Sprache der großen Welt: Man säuft nicht, man hat an der Bar zu tun. Er nahm sich vor, die Redeweise par occasion anzuwenden, und löste die Verbeugung langsam auf. Da erst bemerkte er, daß an seinem Frack gezogen wurde, heftig jetzt, was fiel ihm ein, dem Zwerg? Wollte er ihn rupfen?
»Wie händ iher gmerkt, daß er da obe isch, de Chäller?«
»Vom Berner Bundesrat«, sagte Herr Wendelin.
Dann bückte er sich zum Ohr des Alten und fuhr leise fort, fast flüsternd: Vom Berner Bundesrat, der hohen Landesregierung, sei ein Telegramm eingetroffen, an Keller adressiert, den allseits gefeierten Federhelden. Daraus schließe man, daß der Genannte hier sei, unter falschem Namen natürlich, inzwischen jedoch – er warf einen Blick in die hell erleuchtete Halle hinein – inzwischen stünde man kurz davor, dem Dichter auf der Terrasse einen festlichen Empfang zu bereiten. Herr Wendelin räusperte sich. Der Empfang, wiederholte er, finde hier statt. Hier draußen. Auf der Terrasse. Keine Reaktion. Da tippte er dem Alten auf die Schulter. »Uussuufe!« sagte Herr Wendelin.
Endlich schien der Brummli zu kapieren. Er nahm die Brille ab und blickte mit großen, nassen Augen zu ihm auf.
Ein Zwerg, gewiß, aber das Haupt, dachte Herr Wendelin, war imposant, schlichtweg imposant. Der da – ein Künstler? Nein, weder ein Revolutionsheld noch ein Landschafter. So, dachte er, sieht der eidgenössische Beamte aus. Mißtrauisch die Äuglein, die Brust schmal, die Beine kurz, aber im Sitzen, hinter Pulten verschanzt, wuchs diese Sorte zu einer gewissen Würde auf, die sogar ihn, den Herrn Wendelin, beeindrucken konnte. Es tat ihm jetzt leid, daß er den Gast so hart bedrängt hatte. Er nahm die Flasche und goß das Glas noch einmal voll. Dabei deutete er mit dem Kopf zur Halle hin. Die hatte sich inzwischen gefüllt, alles war bereit – Gäste, Direktion, Personal –, dem Dichter zu huldigen. Einer nur, ein einziger, schien sich um die Aufregung nicht zu scheren. Mitten auf der Terrasse hatte er sich in den Korbstuhl gebettet, süffelte den Wein, brummelte vor sich hin. Es war kühl geworden. Trotzdem brach Herrn Wendelin der Schweiß aus, der Kragen wurde ihm eng – Huerestärnesiech, was soll ich denn tun? Den Korbstuhl zur Brüstung tragen und auskippen? Die Lampions gaukelten und schaukelten. Auf den Höhen loderten die Feuer, und eintönig läutete nah und fern das weidende Vieh.
Beamter hin oder her, er mußte jetzt weg, der verfluchte Sesselhocker! So einer gehörte auf ein Schützenfest, verzipfeltes Nastuch auf den Grind, Bierhumpen in die Hand, das war Volk, dachte er, Plebs, auf einem Dichterempfang, Monsieur, haben wir nichts verloren! Herr Wendelin wollte den Mann gerade am Kragen packen, da war jene Dame, die sich vorhin nach dem Grafen Rantzau erkundigt hatte, aus dem Garten zurückgekehrt, auf Zehenspitzen und offenbar kurzsichtig, denn sie näherte sich, unentwegt auf den Brummli starrend, dem Korbsessel, schlug plötzlich die Hände zusammen und blieb stehen, wie angewurzelt: »Nein!« entfuhr es der Dame. Dann rauschte sie davon, in die Halle hinein. Herr Wendelin glotzte ihr nach; zum Denken kam er nicht. Sous-Chef Müller, von der Dame aufgescheucht, schoß heraus, mit den Armen fuchtelnd und die Augen verdrehend, und auch Müller schien mit all seinen Zuckungen den Brummli zu meinen, den Knurrhahn im Korbsessel.
Der da –?