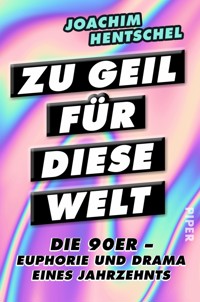19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Während der Kalte Krieg in den 1980ern immer kälter wurde, taute die Stimmung im deutsch-deutschen Kulturaustausch auf. Rockbands wie City, Pankow und die Puhdys wurden unter strengen Auflagen auf BRD-Tour geschickt, Karat traten in der «ZDF Hitparade» auf, und mit ihrem Song «Über sieben Brücken musst du geh'n» landete Peter Maffay einen Hit und schickte Westmark-Tantiemen nach Ost-Berlin. Plötzlich blühte der kulturelle Grenzverkehr: Es ging um Devisen und Propaganda. Joachim Hentschel beleuchtet erstmals die Hintergründe: Welche Rolle spielten die Stasi, die DDR-Künstleragentur, die Jugendorganisation FDJ, bundesdeutsche Plattenfirmen und Impresarios? Und führte der deutsch-deutsche Kulturhandel der 1980er am Ende zu Mauerfall und Wiedervereinigung?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Joachim Hentschel
Dann sind wir Helden
Wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde
Über dieses Buch
Welche Rolle spielte der Rock ’n’ Roll im Kalten Krieg? Welche Botschaften schmuggelten die Songs von Ost nach West (und zurück)? Brachte die Popmusik am Ende die Berliner Mauer zu Fall?
Ein aufregendes, großteils unbekanntes Stück deutscher Kulturgeschichte wird in diesem Buch zum ersten Mal beleuchtet: der musikalische Austausch, der in den 70ern und 80ern zwischen DDR und BRD hin- und herging. Um den «Sonderzug nach Pankow», die Westauftritte von City und Karat und die illegalen Ostkonzerte der Toten Hosen herum blühte ein reger Grenzverkehr, der von Geld, Strategie und Propaganda handelte – und vom Kampf um Freiheit.
«Die Geschichte, wie wir die ersten Löcher in die Mauer reinsangen – endlich hat sie jemand aufgeschrieben.» Udo Lindenberg
«Joachim Hentschel erzählt und lässt erzählen, welche grotesken Blüten Ideologien in der Kultur treiben können. Im Guten, im Schlechten und dazwischen.» Marion Brasch
«Man sollte die Kraft der Gefühle, die Musik auslösen kann, niemals unterschätzen. In diesem Buch steht, warum.» Klaas Heufer-Umlauf
Vita
Joachim Hentschel, Jahrgang 1969, hat als Journalist und Autor für zahlreiche Print-, Online- und Rundfunkmedien gearbeitet. Seine Beiträge erschienen unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, in Rolling Stone, Wired, GQ, Vanity Fair, Der Spiegel und Business Punk, waren im Deutschlandfunk und auf Arte zu hören und zu sehen. In seinem Buch «Zu geil für diese Welt» (2018) beschäftigte er sich mit der Kultur der 90er-Jahre und den Folgen der Wiedervereinigung. Er lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Franziska Söhner
Coverabbildung Harald Hauswald/OSTKREUZ
ISBN 978-3-644-01197-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Eines schönen Tages spürst du Türen
Was dich lockt, geschieht davor
Eines Tages wirst du an Zuhause denken
Gingst du wirklich fort?
Barbara Thalheim, «Abschied von den Eltern»
Ihr habt doch eigentlich alles – und doch immer nur Angst.
Marius Müller-Westernhagen in «Der Mann auf der Mauer»
Ich, ich glaub’ das zu träumen
Die Mauer im Rücken war kalt
Schüsse reißen die Luft
Doch wir küssen, als ob nichts geschieht.
David Bowie, «Helden»
1.«Haben wir auch Wessis hier? Geil!»
Bei einem Großfestival im November 1989 ziehen Musikfans aus DDR und BRD die Wiedervereinigung vor – und blicken zurück auf 40 Jahre Grenzverkehr
Heute, mehr als 30 Jahre später, könnte man sich fast einbilden, man habe die Bilder alle selbst geträumt. Die Stadt, gespenstisch erleuchtet, mitten in der Nacht. Die Lederjacken, Anoraks und schmutzoliven Uniformen. Die Leute, die mit überraschten Grenzbeamten schnell eine rauchen. Die Autoschlangen und Menschentrauben mit Vokuhila-Haaren, die verwackelten Freudenschreie und schnell auf Kissenbezüge gemalten Begrüßungssprüche.
Die Szenen vom November 1989 in Berlin sind immer wieder gelaufen: im schlaflosen N24-Nachtprogramm, in Shows mit Wolfgang Lippert oder Oliver Geissen zu immer schrägeren Jubiläen. In Dokumentationen auf Netflix, die von der Treuhand, der Stasi oder dem Agentenschmuggel erzählten wie von altem Spuk. Wieder und wieder, bis man immun war gegen die Emotionen, um die es ja eigentlich ging.
Wir sahen die zweifelnden Augen der DDR-Bürgerinnen und -Bürger, die sich ernsthaft fragten, ob es hier, an der frisch geöffneten Berliner Mauer, nicht gleich eine Katastrophe geben würde. So wie beim Volksaufstand vom 17. Juni 1953 oder bei den Demonstrationen am Platz des Himmlischen Friedens in Peking, wo nur fünf Monate vorher die Panzer aufgefahren waren. Dann die Erleichterung, die hochgehaltenen Ausweise, die Blitzlichter. Die Vorschlaghämmer, mit denen Brocken aus dem sogenannten antifaschistischen Schutzwall herausgehauen wurden, der niemanden je vor irgendetwas beschützen musste oder konnte.
Manche schrien sich heiser. Sprangen auf Trabi-Dächern auf und ab, verniedlichten diktatorische Politiker zu Witzfiguren und umgekehrt. Freundeten sich für den Rest des Lebens mit Unbekannten an, die sie nie mehr wiedersahen. Und plötzlich, ganz plötzlich war es wieder hell.
An die Öffnung der DDR-Grenzen denkt man natürlich nicht nur viel, viel lieber als an den Mauerbau vom August 1961, knapp 28 Jahre und drei Monate vorher. Die Befreiungsbewegung von ’89 produzierte zudem, und das ist gar nicht selbstverständlich, auch die entschieden stärkeren Bilder. Szenen, die bald ein Eigenleben führten. Die das Superkomplizierte leicht greifbar machten und am Ende zu Wandmalereien in der Ost-West-Erlebnisgastronomie wurden, denn bald kamen die Touristen.
«Joyous East Germans Pour Through Wall», titelte die New York Times am Samstag, dem 11. November 1989. «Einigkeit und Recht und Freiheit: Deutschland umarmt sich», formulierte die Bild feierlich. Nur das Neue Deutschland, die parteieigene DDR-Tageszeitung, sah die Dinge nüchterner. «Schritte zur Erneuerung – Aktionsprogramm der SED» war hier die Wochenend-Headline. Daneben, kleiner: «Innenminister Friedrich Dickel zu den neuen Reiseregelungen». Endlich die lang erwarteten Expertentipps zum Mauerfall.
«Konzert für Berlin»: das Megaevent, an das sich kaum jemand erinnert
Aber selbst drei Tage danach gab es in beiden Teilen Berlins noch genug Menschen, die gar nicht mitbekommen hatten, dass die Grenzen geöffnet waren und eine Ära der autoritären, freiheitsberaubenden Politik auf ihr Ende zulief. Leute, die auf so interessante Nachrichten nicht gefasst gewesen waren. Oder die schlicht keinen Fernseher hatten.
Rosi zum Beispiel. Rosi war Schlagzeugerin beim Westberliner Musikkabarett Zwei Drittel, wohnte in der Prinzessinnenstraße im alternativen Kreuzberg. Am Sonntag, dem 12. November, klingelte es frühmorgens bei ihr. Vor der Tür: Thomas May, ein Freund von drüben. May, Kulturaktivist in Halle an der Saale, hatte Rosis Gruppe kurz vorher auf einer kleinen DDR-Tournee begleitet. Jetzt stand er hier im Kreuzberger Treppenhaus, mit seiner Frau und der fünfjährigen Tochter, plötzlich und unangekündigt.
«Och, seid ihr endlich abgehauen!», rief Rosi zur Begrüßung. Natürlich war sie überrascht, aber über Ungarn oder die Botschaften geflüchtete Ostdeutsche waren zu der Zeit nichts Ungewöhnliches.
«Nee, Rosi, die Grenzen sind offen», sagte May.
«Was? Hab ich gar nicht mitbekommen.»
May, 28, gelernter Tischler, seit sechs Jahren sogenannter kulturpolitischer Mitarbeiter und Konzertorganisator im großen Jugendklubhaus Philipp Müller in Halle, war mit seiner kleinen Familie schon um fünf Uhr früh aufgebrochen, per Zug. Am Tag drei nach der Maueröffnung wollten sie Westberlin sehen und gingen an der Oberbaumbrücke über die Sektorengrenze. Der Stopp bei Rosi sollte der Start in einen Tag sein, danach Ku’damm, Zoo und Sightseeing. Doch er bekam schnell einen neuen Drall.
Nach dem Frühstück begann die Gastgeberin herumzudrucksen. Sosehr sie sich über den Besuch freue, sie müsse jetzt leider weg. Heute gebe es ein großes, etwas seltsames Nachmittagskonzert, das der Sender Freies Berlin über Nacht angesagt hatte. In der Deutschlandhalle, der 10000er-Arena in Berlin-Wilmersdorf, in der sonst Shows von Tina Turner, Queen oder David Bowie stattfanden. Sie, Rosi, habe dort eine Verabredung und einen Backstage-Ausweis.
Das könne nur das Mauerfall-Festkonzert sein, meinte May. Rosi griff zum Telefon, rief ihren SFB-Kontakt an. Alles klar, die Gäste dürften mitkommen, meldete sie wenige Minuten später. Und es ging los.
Das «Konzert für Berlin» war von den Veranstaltern innerhalb von zwei Tagen zusammengeklöppelt worden. Als Feierstunde und offiziell erstes Rockfestival aller Zeiten, bei dem ein aus BRD und DDR gemischtes Publikum ein Programm mit knapp 20 Bands, Künstlerinnen und Künstlern aus West und Ost sehen konnte, ohne dass dafür irgendwelche Tricks, Schmuggeleien oder Kaderprivilegien nötig waren. (Wahrscheinlich hatte es eine solche Konstellation schon vorher gegeben, 1973 bei den Weltjugendfestspielen in Ostberlin, 1988 bei der Friedenswoche der Berliner Jugend in Weißensee oder beim Festival des politischen Liedes, aber wie gesagt: Hier war es nun endlich offiziell und Teil des Mottos.)
Das halb improvisierte, latent politisch oder historisch aufgeladene Großmusikfestival war damals eine Kulturtechnik, die bei Hörerschaft und Organisatoren gut eingeübt war. Vier Jahre vorher hatte in London und Philadelphia das «Live Aid»-Weltkonzert stattgefunden. Ein Jahr später wurde in der Nähe des oberpfälzischen Wackersdorf das riesige Festival gegen den Bau einer atomaren Wiederaufbereitungsanlage gefeiert, 1988 in London die Geburtstagsshow für den inhaftierten südafrikanischen Oppositionshelden Nelson Mandela. Für die Redakteure des Westberliner Radio-Jugendmagazins S-F-Beat, die am Freitag die Idee dazu hatten, am Morgen nach dem Mauerfall, muss es logisch gewesen sein: Was Bob Geldof kann, können wir auch, und irgendwas machen müsse man ja auf jeden Fall.
Den Vorschlag, das kurzfristige Event am Reichstag zu feiern, lehnte das Berliner Ordnungsamt ab – zu nah am Grenzübergang, zu viel Drängel- und Chaosgefahr. Die Deutschlandhalle wiederum, schön weit weg Richtung Messegelände und Grunewald, stand am Sonntag noch leer. Da der SFB nicht als Veranstalter auftreten durfte, sprang die Zetka Show & Concert GmbH ein, die Firma des Rockimpresarios Reinhard «Conny» Konzack. Konzack betrieb unter anderem das als Konzertsaal hoch angesehene Kant Kino, managte zeitweise Bands wie Die Ärzte, Ideal und Extrabreit.
Erst am Samstagabend wurde das «Konzert für Berlin» im Radio und Fernsehen angekündigt. Die Organisatoren wollten verhindern, dass sich zu viele Leute in München, Köln, Jena oder Dresden in die Autos setzten und auf den Fernstraßen, die ohnehin schon vom neuen, großen Grenzverkehr verstopft waren, die letzten Lücken zustöpselten. Vielleicht ist das im Rückblick ein Grund dafür, dass das Festival später nie so richtig den Weg in den Kanon der deutschen Popgeschichte fand. Es war wie beim Mauerfall: Viele bekamen gar nicht mit, dass es stattfand. Teilweise bis heute nicht.
Mehr Gitarren, noch mehr Tränen und noch viel mehr Ansprachen
Am Sonntagmorgen war der Himmel über Berlin blau, der Nieselregen, der die Woche über gefallen war, hatte sich vertröpfelt. Der TV-Übertragungswagen des SFB fuhr zur Philharmonie am Potsdamer Platz, denn dort startete um 11 Uhr das erste, das andere Begrüßungskonzert. Daniel Barenboim, aus Argentinien stammender Superstardirigent, war zufällig für Plattenaufnahmen in der Stadt. Spontan dirigierte er die Philharmoniker, es gab Beethovens Klavierkonzert Nr. 1, dazu die Siebte Symphonie, vor vollem Haus. Klassische Musik hatte auch früher beim Ost-West-Dialog eine große Rolle gespielt, auch weil sie im Umgang meist unverfänglicher war als Rockmusik.
Barenboim hatte eine Bedingung gestellt. Er werde nur auftreten, zudem ohne Gage, wenn sichergestellt sei, dass die verwöhnten Westberliner den Ostdeutschen nicht die Plätze wegnehmen würden. Am Einlass der Philharmonie mussten die Leute ihre Papiere vorzeigen. Nur wer einen DDR-Ausweis hatte, durfte eintreten. «Ich muss sagen, das sind die glücklichsten Tage meines Lebens», erklärte ein weißhaariger Besucher vor den SFB-Kameras, schwer schluckend. «Wissen Sie, die Höchststrafe, die man in einem zivilisierten Land bekommen kann, sind 25 Jahre, und wir hatten 28 Jahre und drei Monate … ich habe Beethoven noch nie so gehört!» Dann zog er sein Taschentuch heraus. Es wurde insgesamt viel geweint in diesen Tagen.
Bei aller Empathie: Die wenigsten Westmenschen konnten sich vorstellen, wie absolut ausgeschlossen für Musikfans in der DDR allein die Idee gewesen war, ihre Lieblingskünstler einmal live zu sehen. Außer, sie gehörten zur wirklich kleinen Gruppe der reisefähigen Privilegierten. Oder sie hatten das Glück, dass ihre Favoriten sich tatsächlich auf den komplizierten, undankbaren Weg nach Ostdeutschland machten, wie 1988 Depeche Mode, Bruce Springsteen oder Rio Reiser. Obwohl man selbst dann oft nur mit guten Beziehungen an eine Karte kam.
Zwischen ein und zwei Uhr nachmittags begann das zweite Mauerfallfestival, die große Entwöhnung vom erlittenen Mangel, draußen in der Deutschlandhalle. Einen zweiten TV-Übertragungswagen wollte der SFB dafür nicht losschicken, stattdessen wurden die Hörerinnen und Hörer aufgefordert, die Radios ins Fenster zu stellen und laut aufzudrehen. Der Journalist Holger Senft kam eigentlich nur deshalb in die Halle, weil man für einen Nachrichtenbeitrag ein paar Konzerteindrücke brauchte. Als Senft die Stimmung erlebte unter den zeitweise bis zu 15000 euphorisch dampfenden Menschen, schnüffelte er Geschichte und ließ den Kameramann alles filmen, was er erwischen konnte. 1989 gehörte es noch nicht zum Usus, zu jeder Pudelausstellung und jedem Keksewettbacken eine abendfüllende Making-of-Doku zu drehen. Dass zumindest Teile des Konzerts auf Film erhalten sind, verdankt die Nachwelt dem tapferen Reporter.
«Wir hatten am Abend vor dem Mauerfall im Pariser Olympia gespielt, in der Nacht gefeiert und erst am nächsten Morgen im Frühstücksraum mitbekommen, was passiert war», erinnert sich Campino, Sänger der Toten Hosen aus Düsseldorf, die in der Deutschlandhalle dabei waren. «Also beschlossen wir, nicht nach Hause zu fahren, sondern gleich nach Berlin. Man konnte in diesen Tagen eine kollektive Glückseligkeit spüren, wie ich sie vorher oder nachher selten erlebt habe. Natürlich ist das dann schnell gekippt. Die Leute fingen ja bald wieder zu nörgeln an.»
«In meinem Gehirn ging damals alles durcheinander, lauter Kurzschlüsse», sagt Dirk Zöllner, der mit seiner Ostberliner Band Die Zöllner als DDR-Vertreter auftrat. «Allein das Gefühl, eine West-Coladose aufzumachen, war fantastisch. Ich habe zehn Stück ausgetrunken, bis mir richtig schlecht war. Wir waren direkt nach den Toten Hosen dran, und auch die waren völlig breit. Das Konzert war wie ein Rausch. Ich war überzeugt: Jetzt beginnt die Weltkarriere.»
«Als zwischendurch alle gemeinsam auf der Bühne standen, die DDR-Kollegen und wir aus dem Westen, mit Joe Cocker in der Mitte, und alle zusammen ‹With A Little Help From My Friends› sangen, das war schon ein unglaublicher Moment», sagt Wolfgang Niedecken, Sänger der Gruppe BAP aus Köln. «Das war Gänsehaut der Extraklasse.»
BAP, deren groß geplante DDR-Tour fünf Jahre vorher in letzter Minute geplatzt war, begrüßten das Publikum mit einem Rock-’n’-Roll-Refrain, der für die gesammelten zivilen Widerstandsbewegungen der zu Ende gehenden 80er-Jahre stand: «Plant uns bloß nit bei üch en!». Nina Hagen sang madonnenhaft «Ave Maria», die Sänger Gerulf Pannach und Christian Kunert, die nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 beide ins DDR-Gefängnis kamen und später in den Westen abgeschoben wurden, führten ein eigens geschriebenes Stück auf: «Der Tag, an dem die Mauer fiel». Melissa Etheridge spielte, die Gruppe Pankow auch. Udo Lindenberg dichtete sein notorisches «Sonderzug nach Pankow», das 1983 zu einer popdiplomatischen Ost-West-Krise geführt hatte, einmalig um: «Man glaubt es ja kaum, es ist ja alles wie ein schöner Traum.»
Das Gerücht ging um, Bruce Springsteen würde spielen, aber er kam nicht. «Meine fünfjährige Tochter wurde mit Smarties versorgt, die die Musiker für sie vom Catering klauten», erinnert sich Thomas May, der Besucher aus Halle, der sich backstage wie im Paradies fühlte, mit all den Künstlern, die er für sein Jugendhaus nie hatte buchen können. «Irgendwann stand Heinz Rudolf Kunze neben mir und heulte Rotz und Wasser.» Jetzt weinten die Wessis also auch noch.
50000 Leute sollen, alle Fluktuationen zusammengerechnet, in den elf Stunden dabei gewesen sein. An einer Stelle verkündete der Moderator Steffen Simon in die jubelnde Brandung hinein, dass draußen in der wirklichen Welt gerade der DDR-Verteidigungsminister Heinz Keßler die Aufhebung des Schießbefehls an der deutsch-deutschen Grenze verkündet habe. Der frühere Staatschef Erich Honecker hatte das zwar schon im April 1989 angeordnet, aber schriftlich lag es erst jetzt vor.
Silly, die erhabene Synthesizer-Salonpop-Band, deren Musik so viele durch die letzten Vorwendejahre geleitet hatte, betrat die Bühne mit einer ganz anderen Ansage. «Wo sind überhaupt die ganzen Ossis?», schnodderte Sängerin und DDR-Idol Tamara Danz in den Saal hinein. Und, als die zurückjohlten: «Haben wir auch Wessis hier?» Es waren mehr. «Geil!» Bevor sie losspielten, schlug Danz vor, die Reste der Mauer einfach an reiche Interessenten zu verkaufen und das Geld zu teilen. Dass die Trümmer 30 Jahre später als Denkmäler vor der früheren Präsidentenbibliothek Ronald Reagans, der CIA-Zentrale in Langley oder dem Pissoir eines Las-Vegas-Casinos stehen würden, ahnte sie wahrscheinlich nicht.
Es waren die ersten Versuche einer Völkerverständigung Auge in Auge. Der Abendstar Joe Cocker war zu dem Zeitpunkt schon wieder ausgeflogen. Er stand im dänischen Aarhus auf der Bühne, bei einem Konzert, das länger im Voraus fixiert worden war als das Ende des Ostblocks.
Und noch ein Abschied: Auch die Rock-’n’-Roll-Zeit geht zu Ende
Wenn man sich heute die Mitschnitte vom 12. November 1989 anschaut, kommt einem noch eine ganz andere Theorie in den Sinn, eine weitere mögliche Erklärung dafür, dass das «Konzert für Berlin» historisch ein bisschen verschüttging. Dann erkennt man nämlich, dass bei diesem großen Spätachtziger-Rock-’n’-Roll-Zirkus, mit dem hier der Abschied vom Mauerstaat gefeiert wurde, auch eine ästhetische Ära zu Ende ging.
Man sieht die Filzhüte, die Haarmähnen und Versicherungsvertreter-Bärte, die in der deutschen Szene beliebt waren, vor allem bei Bassisten und Keyboardern. Die Jacketts, die hochgekrempelten Hemdsärmel und Schweißbänder, die mit höchstem Stolz getragen wurden. Man hört die breit bretternden Gitarren und die Keyboards, die wie Verlautbarungsfanfaren gellten. Das Röhren der Sängerinnen und Sänger, dem man im letzten Moment einen fast schon trotzigen Unterton anzuhören glaubt.
Noch einmal zelebrierten die Künstler hier den Zustand, der im Lauf der 80er-Jahre bereits zu zerbröckeln begonnen hatte, angefressen und abgelöst durch MTV-Videos und neue, hybride Pop-Identitäten. Es waren die finalen Wallungen einer Art von Rockmusik, die sich ihrer alten, hohen Bedeutung noch uneingeschränkt sicher war. Die von ihrem Monopol lebte, die bevorzugte Überbringerin oder sogar Stifterin aller revolutionären, gegenkulturellen Botschaften zu sein. Mitte der 50er war sie inthronisiert worden, in den 60ern hatte sie ihre Glanzphase erlebt. Die großen westlichen Jugendkulturen waren so überhaupt erst zur Welt gekommen.
Die Ära des Kalten Kriegs, den ein US-amerikanisch dominierter Westen und ein sowjetisch angeführter Osten gegeneinander kultivierten – sie wird, zufällig oder nicht, immer auch beinahe deckungsgleich als die große, gloriose Periode des Rock ’n’ Roll in Erinnerung bleiben.
Sieben Wochen nach dem «Konzert für Berlin» gingen die 80er-Jahre zu Ende. Gut fünf Jahre später, am 25. November 1994, bebte dieselbe Deutschlandhalle im Rhythmus der «Mayday»-Massenparty «The Raving Society». Unter anderem legten die Techno-DJs Westbam, Marusha und Luke Slater auf, zusammengezählt 34000 Leute tanzten dazu. Eine Welt, die kaum wiederzuerkennen war. Auch wenn die ersten Versprengten von 1989 da schon forderten, die Mauer doch bitte wieder aufzubauen.
Herr Westernhagen spielt seine fieseste Rolle
Der Musiker und Schauspieler Marius Müller-Westernhagen war am 12. November übrigens nicht in Berlin, auch wenn einige Quellen es behaupten (er gab an dem Tag ein Konzert in Mainz). Einer seiner Songs gehört dennoch fest zu den Wendezeit-Erinnerungen, an denen viele sich noch Jahrzehnte später festkrallen konnten. Westernhagen, damals Anfang 40, war auf dem Sprung vom eher straßenköterhaften Rockbeißer zum manteltragenden Stadionstar mit kleiner Sonnenbrille. «Freiheit» hieß das Stück, das er während seiner Herbsttournee in aufgeheizten Hallen sang. Eine an sich kleine, nur zum Klavier gesungene Ballade, die den Moment monumentaler und umarmender einfing als alle anderen.
Die Kapelle, rumtata
Und der Papst war auch schon da
Und mein Nachbar vorneweg
Freiheit, Freiheit ist die Einzige, die fehlt
Der Umsturz, der Westernhagen zum Text seines schon 1987 erschienenen Liedes inspiriert hatte, war ein alles andere als friedlicher gewesen. Bei einer Fahrt durch Paris hatte er einen Spruch aus der Zeit der Französischen Revolution aufgeschnappt, mutmaßlich aus einem Werk des Historikers François-Auguste Mignet. Es ging um die Enkel, die auf den Gräbern der Alten tanzen, um die finstere, überkommene Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Daraus entwickelte er den Text.
Zunächst wurde das Lied kaum wahrgenommen. Eine Liveaufnahme vom Konzert in Dortmund, das er elf Tage nach dem Mauerfall gespielt hatte, erschien 1990 auf Platte, kurz vor der Wiedervereinigung, und wurde schnell radiobekannt. Die gefühlsduselige und zugleich zukunftsängstliche Stimmungslage machte «Freiheit» größer und größer.
«Songs nehmen ja immer ein Eigenleben an, und wenn du Glück hast, ist es gut», kommentierte Westernhagen in einem Spiegel-Interview. «Freiheit» wurde, noch langfristiger als David Hasselhoffs notorisches «Looking For Freedom», zu einer der Hymnen des neu vereinten Deutschlands. Bald konnten die Leute sogar den Mittelteil mitsingen: «Freihei-ei-ei-ei-eit!»(Auch 2021 noch, als das Stück unfreiwillig zum Themensong vieler Impfgegner-Demos gemacht wurde.)
1990 hatten die meisten schon vergessen, dass derselbe Westernhagen neun Jahre vorher einen ganz anders gelagerten Kommentar zum Thema West-Ost abgegeben hatte. «Von drüben» hieß der Song, der 1981 erschienen war. In dem lustig dahertrabenden Country-Folk-Stück schauspielerte der Künstler eine für ihn ungewöhnliche Rolle: die der fiktiven Gerti, einer Liedermacherin aus der DDR.
Die Geschichte, die der Song erzählt: Gerti ist im Osten zwar ein Star, siedelt in den frühen 80ern aber in die BRD über, weil sie endlich Geld und wahre Anerkennung verdienen will. Sie nutzt aus, dass die Schwestern und Brüder im Westen oft auch Mittelmäßiges ehrfürchtig hochjubeln, wenn es von drüben kommt – solange sie es als tapfere poetische Wortmeldung aus dem Unrechtsstaat verstehen können, dem Land des unfairen Alltags und der unterdrückten Möglichkeiten.
Ich bin sehr natürlich, das schreibt auch der Stern
Ich krieg auch ’nen Preis von der Akademie
Fast wie bei uns, doch da bekam ich den nie
Jetzt wer’n se blöd gucken, da drüben die Herrn
singt Westernhagen als Gerti, die in ihren Songs zwar Position für Menschenrechte bezieht, in Wahrheit aber nur geldgierig die Dummheit und den Selbsthass der bundesdeutschen Bildungsbürger und Linksfolkloristen ausnützt. Am Ende kündigt sie sogar noch an, ihre Schwester Helga nachzuholen, eine Discosängerin aus Leipzig. Der Start einer kleinen Ost-West-Kulturinvasion.
Und wenn du dann kommst, dann geh’n wir zum Biermann
Und rufen die Jungs bei der Industrie an
Denn Mädels wie dich, die nehmen die gern
Wolf Biermann, Sänger und Dichter, gebürtiger Hamburger, war 1976 nach 23 freiwilligen, mehr oder weniger überzeugten Jahren in der DDR ausgebürgert und praktisch ausgesperrt worden, ein Ereignis, das auf beiden deutschen Seiten ein Erdbeben bedeutete. Auch dem besagten Stern war das damals eine Titelgeschichte wert. Überschrift: «Rotkehlchen ohne Nest».
Mit ihm wollte Westernhagen sich sicher nicht anlegen, als er «Von drüben» schrieb, dieses auch für seine Verhältnisse atemberaubend bösartige Lied. Ein reales Vorbild für Gerti könnte Veronika Fischer gewesen sein, die damalige Nummer-eins-Popsängerin der DDR, die von seiner Plattenfirma WEA intensiv umworben wurde. Anfang 1981 folgte sie dem Ruf aus Westdeutschland, aber da war Westernhagens Lied längst fertig.
Bettina Wegner könnte ebenfalls ein Modell für die Gerti-Figur gewesen sein. Wegner, Aktivistin und Sängerin, war 1978 durch eine Ausgabe des ZDF-Politikmagazins «Kennzeichen D» im Westen prominent geworden. «Szenen einer Hauptstadt» hieß die Ausgabe, für die der TV-Journalist Dirk Sager durch ein weitgehend tristes, problembeladenes, dennoch keck zivilcouragiertes Ostberlin fuhr. Er ließ Passantinnen, Schrebergärtner, Gemüseverkäuferinnen und Bauarbeiter erzählen und machte auch in der schönen Neubauwohnung in der Leipziger Straße halt, die Wegner mit ihrem damaligen Mann bewohnte, dem Schriftsteller Klaus Schlesinger.
Von einem Fenster aus schaute man über die Mauer aufs Hauptquartier des Springer-Verlags. Vom anderen aufs Zentralkomitee der Staatspartei SED, symbolträchtiger ging es kaum. Wegner, damals 30, mit Zöpfen, Jeansrock und dunkelblauem T-Shirt, erzählte vor der Kamera erfrischend rotzig von ihren zermürbenden Bemühungen, im Osten offene Literaturlesungen zu veranstalten. Sang anschließend zur Gitarre ein Lied, das in der Sendung komplett gezeigt wurde: «Sind so kleine Hände, winz’ge Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann» und so weiter.
«Kinder» hieß das Stück. Nach der Sendung erschien es in der BRD auf Schallplatte, wurde im Jahr drauf ein riesiger Erfolg und unerwarteter Radiohit. Bald sangen es sogar andere Künstler nach, wenn auch in modifizierten Versionen, von der Braunschweiger Punkband Daily Terror («Sind so kleine Biere») bis zum Komiker Otto Waalkes («Sind so kleine Schnäpse»). Das zugehörige Wegner-Album errang mit einer Viertelmillion verkaufter Exemplare gleich eine Goldene Schallplatte, auch Ende der 70er nicht alltäglich für eine derart reduzierte Chanson-LP. Im Begleittext, der hinten auf der Hülle stand, nannte der Autor der westlichen Plattenfirma CBS die Sängerin einen «Geheimtip unter den kritisch-politischen Liedermachern in der DDR».
Ein reichlich euphemistischer, fast zynischer Ausdruck dafür, dass Wegner als Schikane für ihre politischen Aktionen im Osten zu der Zeit praktisch Auftrittsverbot hatte. Öffentlich konnte sie nur unter Decknamen oder in Kirchen singen, die vor dem Zugriff von Stasi und Polizei halbwegs sicher waren. Auch das Erfolgsalbum «Sind so kleine Hände» war in der DDR natürlich nicht legal erhältlich. Die Veröffentlichung von – bis zu ihrer Ausbürgerung 1983 – vier Alben im Westen ließ der Staat trotzdem zu, einfach, indem er sie nicht verhinderte. Einen beträchtlichen Teil der D-Mark-Devisen, die Wegner durch Plattenverkäufe und GEMA-Einnahmen generierte und die für Radio- und Fernseheinsätze fällig wurden, behielten die Behörden beim Transfer freilich ein und führten sie guten, sozialistischen Zwecken zu.
Westernhagens Ossi-Satire, die wohl unter anderem auf Wegner und ihren Erfolg abzielte, kam 1981 in der BRD nicht allzu gut an. Er selbst sagt, einige Radiosender hätten das Lied auf ihre schwarzen Listen gesetzt, weil sie befürchteten, mit der Ausstrahlung die weiterhin fragile Annäherung zwischen den zwei deutschen Staaten zu stören. Der prominente Bochumer Rockjournalist Wolfgang Welt war deutlicher in seiner Kritik, bezeichnete den Song in einem Text für die Ruhrgebiets-Stadtzeitschrift Marabo als «Stück Scheiße». Das Gerti-Lied sei «an Erbärmlichkeit nicht zu übertreffen und dürfte im Auftrag von Axel Cäsar Springer entstanden sein», schrieb Welt. «Gerd Löwenthal und alle anderen Rechtsaußen werden sich freuen.»
Löwenthal, grimmiger Journalist und Moderator des «ZDF-Magazins», war als artikulierter Antikommunist und Gegner der westöstlichen Entspannungspolitik bekannt, die 1969 mit Willy Brandts Kanzlerschaft begonnen hatte. Der Springer-Verlag galt mit seinen Zeitungen Bild und B.Z. als Kampagnenführer gegen die Annäherung, als Gegner aller daraus abgeleiteten bundesdeutschen Zugeständnisse gegenüber Ostberlin und letztlich Moskau. Bis August 1989, also drei Monate vor der Mauerfallnacht, schrieben die Springer-Medien den anderen Staat grundsätzlich in Anführungszeichen: «DDR».
Symptomatisch für die Stimmung, die in Westdeutschland bis in die 80er hinein herrschte, steht ein Vorfall vom Oktober 1959. Damals hatte der ARD-Entertainer Hans-Joachim Kulenkampff zu Beginn seiner Sendung «Quiz ohne Titel» auch die Zuschauer «in der DDR» begrüßt. Das Problem: Er hätte laut öffentlich-rechtlicher Sprachregel eigentlich «in der sogenannten DDR» sagen müssen, ließ das entscheidende Adjektiv aber weg. Die anschließenden Beschwerden von Zuschauern und Bundestagsabgeordneten aller Parteien gerieten so massiv, dass sich der Intendant des Hessischen Rundfunks gezwungen sah, eine Untersuchung zu starten. Das Ziel: der Beweis, dass Kulenkampff kein von der SED finanzierter Kuckuck sei.
Ein paar hilfreiche Statistiken zu Freundschaft und Neid
Einen ähnlich veranlagten Eklat löste der 1976 aus der DDR ausgesiedelte Schriftsteller und Regisseur Thomas Brasch aus, als er im Januar 1982 in München den Bayerischen Filmpreis entgegennahm. In seiner Galarede dankte Brasch unter anderem der Filmhochschule der DDR, die ihn ausgebildet hatte. Dafür gab es aggressive Buhrufe und Aufruhr im Saal. Der Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß schickte Brasch, als der mit dem Preis und steinernem Gesichtsausdruck die Bühne verließ, noch eine maliziöse Oberlehrerphrase hinterher: «Ich danke Ihnen, dass Sie sich als lebendiges Demonstrationsobjekt der Liberalitas Bavariae hier vorgestellt haben!» Mit anderen Worten: dass wir auch solche Querulanten prämieren, ehrt uns am Ende mehr als Sie.
Strauß war es dann allerdings, der kurz darauf zwei bundesdeutsche Milliardenkredite für die klamme DDR an allen Bedenkenträgern vorbeipeitschte, nicht nur in Bayern, und auch dafür gab es tieferliegende Gründe. Die Jahrzehnte der deutschen Teilung waren, aus dieser lebenspraktischen Sicht betrachtet, eine oft bizarr widersprüchliche Zeit.
Der Wunsch nach einer Wiedervereinigung hatte unter den Westdeutschen nie wieder so starken Zuspruch genossen wie Anfang der 50er-Jahre, also kurz nach der Teilung. Frühe, technisch noch nicht perfekte Umfragen ergaben in der Bundesrepublik Zustimmungswerte von bis zu 96 Prozent. In den 70ern und 80ern pendelte sich die Quote der Einheitsbefürworterinnen und -befürworter dann relativ konstant auf um die 70 Prozent ein.
1987 fragte das Institut Infratest zusätzlich nach den Gründen für die jeweilige Meinung. Die meistgenannten Argumente der Wessis für eine Wiedervereinigung: die Fortführung einer nationalen deutschen Tradition, die Schaffung gerechter Lebensbedingungen und der Frieden in Europa. Ein Drittel führte äußerst selbstlos an, sie seien nur deshalb für die Einheit, weil sie vermuteten, die Mehrheit der DDR-Bürger würde sich nach ihr sehnen.
Aber stimmte das? Repräsentative Meinungsforschung gab es im Osten jedenfalls nicht. Allerdings hatten die Strategen von Infratest in den späten 60ern, im Auftrag von Herbert Wehner, dem SPD-Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, einen Behelfsansatz gefunden: die sogenannten Stellvertreter-Umfragen. Das Prinzip: Anstatt Menschen aus der DDR direkt zu interviewen, was ja nicht ging, ließ man Menschen antworten, die privat oder beruflich viel im Osten waren, gutes Hintergrundwissen und enge Kontakte hatten.
Was die alles andere als astreine Methode ergab, für die rund 1200 Interviews pro Jahr geführt wurden: In den zwei Jahrzehnten vor dem Mauerfall soll in der Tat eine stetig wachsende Mehrheit im Osten die BRD als Staat mit besseren Lebensbedingungen gesehen haben, abgesehen von Punkten wie Arbeitnehmerschutz, Ausbildungsoptionen und Wohnungsmarkt. 1978 fanden 57 Prozent der Ostbürger, dass es im Westen mehr gesellschaftliche Gerechtigkeit und bessere Chancen gebe. 1989 waren es laut der Erhebung sogar schon 74 Prozent.
Als im Dezember 1989 – nach Helmut Kohls berühmtem, mit einer listigen Überrumpelungsgeste im Bundestag präsentiertem Zehn-Punkte-Programm – diese Wiedervereinigung tatsächlich debattiert wurde, meldeten die Meinungsforscher von Infas Überraschendes: Plötzlich gaben nur noch 26 Prozent der DDR-Bürger an, eine Einführung des Kapitalismus zu wünschen, also eine Vereinigung nach westlichen Standards. 46 wollten stattdessen lieber ein gemischtes System, 21 eine Form von demokratischem Sozialismus. Bei der ersten freien Volkskammerwahl gut drei Monate später schlugen sich die Wünsche nach einem neuen, eigenen Weg schon wieder weniger deutlich nieder. Das CDU-geführte Bündnis Allianz für Deutschland lag mit mehr als 48 Prozent der Stimmen vorn. Alles passierte Schlag auf Schlag, und offenbar hielt keine Meinung mehr länger, als es unbedingt nötig war.
«Unsere Leute wollen die soziale Sicherheit, Geborgenheit, sichere Arbeitsplätze und Ausbildung von uns», soll im September 1988 Harry Tisch, Politbüromitglied und langjähriger Vorsitzender der DDR-Einheitsgewerkschaft, bei einer SED-internen Sitzung gesagt haben. «Und die Kaufhäuser aus der BRD.»
Oder eben auch die Musik, das Fernsehen, das Theater und die Bücher, denn zumindest hier gab es ja – anders als beim politischen System – kein reines Entweder-oder. Man konnte Thomas Lücks schmissigen New-Wave-Hit «Hobbykosmonaut», die Leipziger Punkband L’Attentat und den westfälischen Hamburger Udo Lindenberg gleichzeitig gut finden, konnte Christoph Hein und die Österreicherin Ingeborg Bachmann lesen, Jörg Fauser und Brigitte Reimann. Es war denkbar, den schillernden Progressivrock von Panta Rhei, Conny Bauers Free-Jazz-Posaune oder den heiteren Nihilismus der Band Feeling B ähnlich hoch zu schätzen wie alles, was via Bundesrepublik aus der weiten, westlichen Welt verfügbar gewesen wäre – und effektiv auch war, die ganzen über 40 Jahre lang, via Westrundfunk, Schmuggel oder sogar als offizielle DDR-Lizenzveröffentlichungen. Also dann doch, allem Gerede über die intellektuelle Isolation des Ostens zum Trotz, relativ barrierefrei.
Ein Freund, der in den 80ern im Berliner Oststadtteil Hohenschönhausen aufwuchs, erzählte mir einmal, wie er als kleiner Junge mit den Eltern Herbsturlaub in der Uckermark machte. Auf dem Zimmer im FDGB-Erholungsheim Friedrich Engels am Templiner Lübbesee gab es einen kleinen Fernseher. Dort wurde er an einem verduselten Oktobernachmittag im Jahr 1984 ungläubig Zeuge davon, wie die Puhdys im Westfernsehen auftraten. Seine Puhdys, seine Band, die kindlichen Genossen, in bunten 80er-Klamotten auf der Studiobühne der ZDF-«Tele-Illustrierten». Auch wenn er die Farben nur ahnen konnte, denn das Gerät zeigte Schwarz-Weiß.
Er habe gar nicht begriffen, wie das überhaupt gehen könne, meint er rückblickend. Wie die Puhdys denn rübergekommen seien in diese andere Welt, ins Fernsehen der verbarrikadierten BRD. Er war aber auch ein bisschen stolz darauf. Den kompletten Kulturschock hätte er bekommen, wenn er gewusst hätte, dass die Band im West-TV, das er hier auf dem Ostfernseher guckte, ein Lied spielte, das der Rundfunk und das Fernsehen der DDR für alle eigenen Kanäle gesperrt hatte. Einfach deshalb, weil es darin zu explizit um Deutschland ging. Der Titel des Songs, den die Puhdys 1984 im ZDF spielten: «Ich will nicht vergessen».
Denke ich an Deutschland und an dich, mein Kind
an alle, die in uns’rer Zeit geboren sind
Denk ich an die Leute drüben und hier
an die, die mit uns gemeinsam die Ängste besiegen
Ich will nicht vergessen, ich will nicht vergessen
Ich will nicht vergessen, was einmal war
Oft rätselhaft, immer brisant: DDR-Kultur mit BRD-Augen gesehen
Den Totschlagspruch «Geh doch nach drüben, wenn es dir hier nicht passt!» hörte man in der BRD noch bis weit in die letzte Kalter-Krieg-Dekade hinein, wenn man sich allzu undankbar gegenüber der Marktwirtschaft oder der Nato-Schutzmacht USA zeigte. Der Gemeinschaftskundelehrer brachte uns bayerischen Gymnasiasten Mitte der 80er noch bei, dass diese deutsche Wiedervereinigung, von der in der Präambel des Grundgesetzes so schön fantasiert wurde, garantiert niemals kommen würde.
Und trotzdem wurde jedes Jahr am 17. Juni, dem Datum des Volksaufstandes von 1953, der wirklich schwer verständliche Tag der deutschen Einheit gefeiert. Man bekam den großformatigen diplomatischen Ringkampf um die DDR-Tourneen von Udo Lindenberg und BAP mit. Man las von Mauertoten, wusste, was die Stasi war, hatte eine ungefähre Vorstellung von der Sturheit und Linientreue der SED-Führung, die sich symbolhaft in Erich Honeckers Brillengestell materialisierte und sich am Ende sogar dem ikonenhaften, eigentlich unwiderstehlichen Öffner und Spätachtziger-Posterboy Michail Gorbatschow verweigerte.
Im Frühjahr 1987 verbrachten wir mit der Klasse im Rahmen der obligatorischen Berlinfahrt einen Tag im Ostteil der Stadt. Man hatte uns vorher eingebläut, nicht mit Privatpersonen Geld zu tauschen und keine Kugelschreiber zu verschenken. Alle hatten ein bisschen Angst, irgendetwas falsch zu machen. Wir schauten uns den Pergamonaltar an, aßen in der Rotisserie am Alexanderplatz (die im Laufe dieses Buches noch mehrfach zum historischen Schicksalsort werden wird). Gaben die 25 Mark Zwangsumtausch für Klaviernoten und das «Kommunistische Manifest» aus und waren alle erleichtert, als uns die sauren Grenzer abends am Bahnhof Friedrichstraße ohne Diskussion wieder zurückfahren ließen.
Und trotzdem, trotz dieses Grabens, der durch den Nato-Doppelbeschluss und die Aufrüstung zwischen Ost und West in den 80ern gefühlt immer größer und feuergefährlicher wurde, gab es da ein Gefühl von tiefer Verbindung, das uns nicht losließ. Eine Neugier, eine zarte Abhängigkeit, eine selbst bei uns satten West-Teenagern vorhandene Ahnung, dass diese DDR auch etwas mit uns zu tun hatte, ziemlich viel sogar. Dass es da ein altes, verschüttetes Geheimnis gab, von dem man andeutungsweise in den Geschichtsbüchern las, das sich aber allein dadurch nicht erklären ließ.
Wir lasen Ulrich Plenzdorfs «Die neuen Leiden des jungen W.», fanden die Hauptfigur Edgar Wibeau wahnsinnig cool und wussten nicht, dass Plenzdorf auch Songtexte für die Puhdys geschrieben hatte. Wir hörten Karat, die noch rätselhaftere Apokalypse-Songs spielten als unsere eigenen Bands, auch wenn sie vielen damals zu bieder und pompös waren. Wir wussten, wo Nina Hagen herkam, die uns mit ihren Fernsehauftritten schockierte und böse verzauberte. Wir lachten darüber, wie sich die Regisseure der US-Klamotte «Top Secret» eine alberne, von Lederhosentölpeln, Folterknechten, bärtigen Sportlerinnen und Freiheitsmilizen bevölkerte DDR vorstellten, denn sie wussten noch weniger als wir. Und wir ahnten nicht mal, dass der Komiker Didi Hallervorden die Idee für seinen berühmten «Palim Palim»-Sketch mit der Flasche Pommes frites Anfang der 70er dem DDR-Entertainer Heinz Quermann abgekauft hatte. Am Telefon, für angeblich 500 Westmark, was für einen so platten Gag sogar noch relativ viel gewesen wäre.
«Wir leben im Westen, im Westen ist’s am besten, lieber blau als grau», sang die Ruhrpottband Extrabreit mit brutzelndem Sarkasmus. Den Grauschleier, den viele vor allem über Städten wie Leipzig, Gera und Bitterfeld vermuteten, kannten auch Westkids gut genug, aus Düsseldorf, Kassel oder den Mittelzentren, in denen sie groß wurden. Und dass die Deutsche Demokratische Republik auf ihre spezielle Art durchaus ein poppiges Land sein konnte, hatte man spätestens im Juni 1974 bei der bundesdeutschen Fußballweltmeisterschaft gesehen. Von allen Teilnehmerländern, deren Folkloregruppen bei der Eröffnungsfeier im Frankfurter Waldstadion aus überdimensionalen Fußbällen stiegen, hatte allein die DDR einen echten, zeitgenössischen Entertainer geschickt. Superstar Frank Schöbel sang, im himmelblauen Jackett, mit Tänzerinnen und Tänzern der Berliner Oper und im strömenden Regen die Feiertagshymne «Freunde gibt es überall».
Die bundesdeutschen Gastgeber hatten für den Festakt dagegen eine Trachtengruppe aus Winningen an der Mosel aufgestellt. Der 1:0-Sieg, den die DDR neun Tage später gegen die BRD-Mannschaft erreichte, wurde hier quasi schon showbusinesstechnisch vorweggenommen.
Leider stand der popkulturelle Austausch zwischen den zwei deutschen Staaten bis 1989 stets unter allerhöchstem PR-Druck. Zumindest nach außen hin musste alles immer so freundlich und tadellos korrekt wie möglich aussehen. Man sprach im hohen diplomatischen Ton miteinander, schrieb Amtspost mit steilen Metaphern. Versuchte nach Kräften, niemanden zu verärgern, um bloß keine Chancen für den nächsten Versuch zu schmälern.
Die Tourneen in beide Richtungen, die Fernsehauftritte, die Songs und Schallplatten, die Fotos, Interviews, Statements, Kollaborationen und Aktionismen waren in Wahrheit ein hohes Politikum, ein Tanz auf dem Eis – auch deshalb, weil sie deutlich gefährlicher und brisanter waren als die bald ritualisierten Turnierteilnahmen von Sportlern oder Konzertreisen klassischer Orchester. Westliche Rockmusik im Osten oder östliche im Westen hatte immer ein Moment der Unkalkulierbarkeit. Fest stand nur: Hätten die Verantwortlichen den Grenzverkehr aus Furcht ganz abgeschnitten, wäre ihnen das Schlamassel noch härter um die Ohren geflogen. Denn nicht nur die jungen Leute machten ihre Ansprüche immer deutlicher.
Es ging um Devisen und Propaganda, versteckte Signale und wirtschaftliche Interessen. Um Imagebildung nach innen und zonenübergreifende Netzwerkpflege in die Welt hinein. Um die Besetzung der ideologischen Leerstellen, die es auf beiden Seiten gab. Irgendwann dann auch darum, für den Fall der Fälle, also für die von unserem Lehrer als aussichtslos eingestufte Öffnung der Grenzen, sicherheitshalber schon die richtigen Freundinnen und Freunde auf der jeweils anderen Seite zu haben.
Die meisten dieser Geschichten über Einladungen und Ausladungen, Handel und Zensur, Knallköpfe und Strategen, Liebe und Beamtentum, berauschte Verbrüderungen und folgenschwere Pannen, Missverständnisse, glückliche Zufälle, Skandale und erhabene Momente lagern mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung relativ gut versteckt in Tagebüchern, obskuren Sammelordnern und Geschichten, die isoliert voneinander existieren, als vereinzelte Anekdoten. Obwohl es einen starken roten Faden gibt, der durch alle von ihnen hindurchläuft.
Was in den kommenden Kapiteln alles passieren wird
Das ist die Idee dieses Buches. Es ist ein Versuch, den fehlenden Bogen zu schlagen und den Musik- und Kulturaustausch endlich als eigenen Handlungsstrang zu erzählen. Als das, was er von den ersten größeren Lockerungen der 70er an bis zur Wende effektiv war: ein Komplex, der sich nach speziellen, komplexen Gesetzen entwickelte, mit Logik und Widersprüchen, Kunst und Paragrafen. Eine eigene Geschichte, die immer eng an der seltsamen Evolution des deutsch-deutschen Verhältnisses entlanglief. An manchen Stellen warf sie ein besonders scharfes Licht darauf. An anderen trieb sie die große Entwicklung sogar selbst mit voran.
Der Gemeinplatz, die DDR habe im Hinblick auf Popkultur in akuter Mangelwirtschaft gelebt und immer nur sehnsüchtig nach Westen geblickt, wird dabei ebenso schnell widerlegt werden wie das Sprichwort von der ständigen Arroganz der BRD. Zwei mögliche Missverständnisse müssen trotzdem vorab geklärt werden: In der Entertainmentbranche der 70er- und 80er-Jahre waren Männer deutlich präsenter als Frauen, noch mehr als heute. Das macht sich zwangsläufig in der Palette der Protagonistinnen und Protagonisten bemerkbar. Zudem darf im Lauf der Geschichte nie vergessen werden, dass gerade die reisefähigen Stars und Musikfunktionäre in der DDR bestimmte Privilegien genossen, von denen der Rest der Landes nur träumte. Mit Verallgemeinerungen sollte man daher vorsichtig sein.
Alle Interviews, die in dieses Buch einflossen, fanden zwischen Februar und Dezember 2021 statt, einige per Videokonferenz oder Telefon, die meisten bei persönlichen Treffen, zwei per E-Mail-Austausch. Das heißt: Der russische Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 war noch nicht abzusehen. In einige Bewertungen der Wendezeit wäre er sonst wohl eingeflossen.
Die Frage, ob und wie die Rockmusik ganz konkret dazu beigetragen haben könnte, dass sich Anfang der 90er der Eiserne Vorhang wieder öffnete und die Menschen im sogenannten Ostblock zumindest vorübergehend ihre zivilen Freiheiten zurückbekamen, ist oft hin- und herjongliert worden, in Essays, schnellen Zeitungsartikeln und langwierigen Studien. «Was nicht verboten ist, ist erlaubt», das alte rechtsstaatliche Prinzip wurde vom russischen Präsidenten Michail Gorbatschow in den Vorwendejahren prominent zitiert. Unter diesem Motto konnte so auch die lange blockierte US-Popkultur in der Sowjetunion stattfinden, 1987 mit Billy Joels berühmter Russlandtournee, im August 1989 mit den Scorpions, Bon Jovi und anderen beim Friedensfestival in Moskau, und so weiter.
«Rock ’n’ Roll trug dazu bei, dass die Leute ihr Vertrauen in den Staat verloren, und ohne Vertrauen ist es immer sehr schwer, ein System am Laufen zu halten», sagt der US-Politikwissenschaftler Joseph S. Nye Jr. in Jim Browns Dokumentarfilm «Free to Rock: Wie Rock ’n’ Roll die Mauer zum Fallen brachte»von 2017. Mit anderen Worten: Die Rockmusik könnte hier wie ein Perpetuum mobile der Befreiung gewirkt haben, das einerseits alle legalen Kanäle nutzte, um das Publikum im Osten zu finden – und dabei zugleich die Einfallstüren, die es benutzte, immer weiter öffnete und aufbrach.
«Soft Power» hat Nye das Phänomen genannt. Er meint damit die Kräfte des Wandels, die eher die Mentalitäten und den Alltag einer Nation berühren und somit anderen Gesetzen folgen als die politische Diplomatie. Ein großartiger Podcast des Journalisten Radden Keefe befasste sich 2020 sogar mit der These, der US-amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA habe den Welthit «Wind of Change» bei den Scorpions in Auftrag gegeben, um mit seiner Hilfe im Osten letzte Widerstände gegen den Umsturz zu lösen. Die größte Erkenntnis, die am Ende seiner Recherche stehen bleibt: Auch wenn sich die Verschwörung natürlich nicht beweisen lässt, sie wäre eine gute Idee gewesen.
Der Popvisionär David Bowie blickte auf die Berliner Mauer durch ein Fenster der Kreuzberger Hansa-Studios, als er im Sommer 1977 seine großsymbolische Hymne «Heroes» schrieb und sang. Darin geht es ums Fliegen und Küssen, um die Überwindung von Grenzen, vor allem um das große, etwas salbungsvolle Gefühl von Allmacht, das einen dabei ergreifen kann. «Dann sind wir Helden für diesen Tag», sang Bowie in der parallel veröffentlichten deutschsprachigen Version. Und genau so kamen sich wohl die Ossis und Wessis vor, als sie im November 1989 beim Mauerfallkonzert zusammen sangen. «With A Little Help From My Friends», Arm in Arm, oben auf der Bühne die Stars mit Joe Cocker und unten im Saal die Leute, während sich alle gegenseitig vollschwitzten.
Wie Heldinnen und Helden kamen sie sich in dem Moment vor, wie Teile einer Gemeinschaft, die das Unmögliche in die Tat umgesetzt hatte, ohne sich um seine Unmöglichkeit zu scheren. Der kurze Augenblick, in dem sie damit wirklich recht hatten, fühlte sich wunderbar an.
2.In Unterwellenborn steht ein Hofbräuhaus
Deutschland ’83: Wie sich die Spider Murphy Gang ausgerechnet während eines riskanten Nato-Mänovers aufmacht, den Rock ’n’ Roll in die DDR zu tragen
So viel Spaß wie heute, an diesem verregneten Donnerstag im Herbst 1983, hatten die jungen Leute an diesem Ort schon lange nicht mehr. Das riesenhafte Standbild, das mitten im Zentrum von Karl-Marx-Stadt steht, wie ein Elefantenfuß, der vom Himmel kam, soll eigentlich ein Denkmal der feierlichen Innenschau sein. Ein majestätischer Gedenkstein, der alle, die an ihm vorbeigehen, bei Ehr und Gewissen packt.
Das Karl-Marx-Monument, 1971 eingeweiht, ein inklusive Sockel über 13 Meter hoher Bronzeklops, guckt die Leute streng und bohrend an. Vor dem Donnerkopf, der für die staatstragende, gewissermaßen heilige Idee steht, versammeln sich regelmäßig die Fahnen- und Festzüge. Auch zur Jugendweihe, dem zwischen Ostern und Pfingsten geklemmten Quasi-Segensfest für die DDR-Achtklässler, müssen die Teenager hier auflaufen, unterm Arm die Festhandbücher «Weltall Erde Mensch», «Der Sozialismus, deine Welt» oder «Vom Sinn unseres Lebens».
Bei allem Respekt: Die Freude ist an diesem Ort meistens gespielt, die Anspannung hoch. Sehr lange dachten die Deutschen sogar, der Marx-Kopf, genannt «Nischel», wäre mit 7,1 Metern Durchmesser die größte Porträtbüste der Welt. Bis 2011 leider irgendwer herausbekam, dass der Lenin im sibirischen Ulan-Ude die ganze Zeit über 60 Zentimeter größer gewesen war.
Aber, wie gesagt: An diesem Donnerstag ist die Stimmung am Denkmal heiter, fast turbulent. Die Wagenkolonne, angeführt von einer gelben Mercedes-Limousine mit westdeutschem Kennzeichen, M für München, hält kurz hinter der Straßenkreuzung. Die fünf jungen Männer, die als Erstes aus dem Benz und einem der nachfolgenden schwarzen Audis herausspringen, beeilen sich, so gut sie können.
Was ist los? Eine bayerische Band ist im November 1983 nach Karl-Marx-Stadt gekommen, auf Konzertfahrt. Und hier macht sie einen Zwischenstopp.
Einer der Musiker, in dunkler Lederjacke und Jeans, mit Lockenspitzen, die in 80er-Schmutzblond gefärbt sind, hechtet mit Anlauf aufs Podest. Der Mann heißt Gerhard Gmell, Künstlername Barny Murphy, damals 29, er ist der Gitarrist der Gruppe. Eine riskante Aktion, in mehrerlei Hinsicht, denn gern gesehen wird das nicht, und er scheint es zu merken. Murphy hüpft wieder herunter, schließt sich der Formation an, die vor dem Monument posiert. Er ganz links, daneben Schlagzeuger Franz Trojan, Keyboarder Michael Busse, Sänger und Bassist Günther Sigl, rechts außen Tour-Saxofonist Willy Ray Ingram. Sie knautschen sich aneinander, verbiegen sich komödiantisch.
Die Spider Murphy Gang, zu dem Zeitpunkt eine der erfolgreichsten Popbands der Bundesrepublik Deutschland, hat jetzt und hier den genau besten Ort für ein Gruppenfoto gefunden. Spontan, in Karl-Marx-Stadt, früher und dann später wieder Chemnitz genannt, bei schlechtem Wetter in der fünftgrößten Stadt der Deutschen Demokratischen Republik. Dass rund 35 Jahre später viele beim Anblick der Szene instinktiv an den Rechtsmob denken werden, der sich Ende August 2018 hier versammeln wird, um scheinheilige Solidarität mit einem getöteten Deutsch-Kubaner zu zeigen, hat mit dieser Geschichte zwar nichts zu tun. Vergessen lässt es sich aber nicht mehr.
Die im Tross mitreisenden Fotografen, alle von Zeitungen und Zeitschriften aus Westdeutschland, von der Münchener Abendzeitung, Pop/Rocky, Bild + Funk, der Neuen Revue und Bild, gehen in die Knie, zeigen ihre Sprungreflexe. Ja, das ist das Bild schlechthin. Die Spider Murphys treffen Marx. Der Ideologe guckt sauer. Die Band findet es lustig.
Schließlich sind die Spider Murphys hier auf einer prinzipiell fröhlichen Mission. Endlich wird ihr lange geplantes Manöver Wirklichkeit, die DDR-Tournee, ein Ding zwischen Guerilla-Happening und Diplomatie, das viele Verantwortliche auf beiden Seiten wie einen Staatsbesuch behandeln. Anfang November 1983 spielt die Gang aus München acht DDR-Konzerte im Zeitraum von elf Tagen, von Glauchau in Sachsen bis Gera in Thüringen. Eine Gastspielreise, wie die Stasimänner sagen würden, die überallhin mitschleichen, in ihren Ladas hinterherknattern und alle Episoden später sauber in die Schreibmaschinen tippen werden. Kein Konzert in Ostberlin, übrigens. Aus komplizierten Gründen.
Es hat bis dahin schon ein paar vereinzelte Shows oder Fernsehauftritte westdeutscher Pop- oder Klassikkünstlerinnen und -künstler in der DDR gewesen. Zudem kleine Tourneen von Acts aus anderen Ländern des sogenannten NSW, des Nicht-Sozialistischen Wirtschaftsgebiets, zum Beispiel von Smokie und Middle Of The Road aus Großbritannien oder den französischen Les Poppys. Die hessische Beatles Revival Band war hier. Außerdem das progressive Synthesizer-Trio Tangerine Dream, bei dem zum Glück niemand irgendwelche Texte singt, die subversiv sein könnten.
Trotz allem ist das hier also eine Premiere. Es ist das erste Mal, 34 Jahre und rund drei Wochen nach Gründung der DDR, 22 Jahre und knapp drei Monate nach dem Bau der Berliner Mauer, dass eine westdeutsche Rock-’n’-Roll-Band eine richtige DDR-Tour spielen darf. Eine Gruppe mit eigenen, deutschsprachigen Songs, der die höchste Aufmerksamkeit der Medien gilt. Sie könnte beim ausgehungerten Publikum in der Tat für ein kleines bisschen Krawall sorgen.
«So, grüß euch Gott miteinander, servus!», sagt Sänger Günther Sigl am Anfang des ersten Konzerts zu den rund 600 Leuten im Theatersaal Glauchau, die schon gewaltig vorgeglüht haben und ihren ganz eigenen Rhythmus klatschen. «Ihr seid’s ja scho so in Stimmung, da brauch’mer ja gar nimmer spiel’n!» Aber sie spielen. «Der Reißverschluss bleibt zua» heißt der erste Song. Obwohl sich, wenn man so will, der Reißverschluss gerade ein Stückchen weit geöffnet hat.
Zugegeben, die DDR-Tour der Spider Murphy Gang wird in der offiziellen Geschichtsschreibung ähnlich selten groß erwähnt wie das «Konzert für Berlin» von ’89. Die Band gilt nicht als sonderlich subversiv, der Fall war seinerzeit wenig umstritten. Und trotzdem ist er, quasi zum Einstieg in die Materie, ein exzellentes Beispiel dafür, wie der west-östliche Kulturhandel funktionierte. 1983, mitten in der ärgsten Phase des deutsch-deutschen Annäherungs-Abstoßungs-Spiels.
Ein Jahr für Kriegsspiele, Menschenketten und falsche Tagebücher
Es ist bis dahin schon ein Jahr vieler dramatischer Verwirrungen gewesen, eine Art Nussschalen-Version des gesamten Kalten Kriegs. Im März haben Neuwahlen in der BRD dem frisch ins Amt gekommenen CDU-Kanzler Helmut Kohl auch noch die stabile Mehrheit im Parlament gebracht, mit 48,8 Prozent für die CDU/CSU, sieben Prozent für den Koalitionspartner FDP. Kurz danach eskaliert die sogenannte Flick-Affäre ein weiteres Mal, die politische Geschichte über Steuerhinterziehungen, Schmiergelder und einen Stasiagenten im Bundestag. Es kommt zu Anzeigen gegen diverse Strippenzieher und amtierende wie ehemalige Regierungsköpfe. Helmut Kohl muss alles umständlich wegregieren.
Im April gibt es gleich zwei rätselhafte Vorfälle, bei denen Westbürger während der Formalitäten zur Einreise in die DDR an Herzschlägen sterben. Es folgen diplomatische Strafmanöver, Staatstermine werden abgesagt, auf beiden Seiten. Derweil kommen die Schriftsteller Günter Grass, Stephan Hermlin, Ulrich Plenzdorf und noch weitere in Ostberlin zum offiziellen, deutsch-deutschen, wenn auch von heftigstem Knatsch bestimmten Literatursymposium zusammen.
Mitte September wird Richard von Weizsäcker zum Termin beim DDR-Staatschef Erich Honecker eingeladen. Er ist der allererste Westberliner Bürgermeister, dem dieses Protokoll zuteilwird. Das Tapetenmuster im Schloss Niederschönhausen strahlt grell, der Händedruck zwischen von Weizsäcker und Honecker wirkt im Vergleich umso stabiler.
Knapp drei Wochen später gibt Honecker dann in einer Interviewrunde mit österreichischen Reportern zum ersten Mal schriftreif zu, dass die rund 60000 SM-70-Selbstschussanlagen an der DDR-Grenze wirklich existieren und nicht nur eine westliche Propagandatheorie sind. Und er verkündet, man habe bereits begonnen, sie zu entfernen.
Dass am ersten Weihnachtstag der 21-jährige Ostberliner Handwerker Silvio Proksch an der Mauer stirbt, hat mit den Schussanlagen nichts zu tun. Proksch wird, als er abends beim Bürgerpark Pankow über den Todesstreifen auf die Mauer zuläuft, von einem Grenzsoldaten zielsicher in Hüfte und Schenkel geschossen. Man lässt ihn zunächst einmal liegen und bluten. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus ist Proksch schon tot. Die Familie bekommt den Leichnam nie zu sehen. Der Schütze kriegt eine Verdienstmedaille.
Auch sonst passiert 1983 viel Verstörendes. Im Mai sind die angeblich vom Magazin Stern sichergestellten Hitler-Tagebücher als Fälschungen enttarnt worden. Im Juni bringt der Spiegel zum ersten Mal eine Titelstory über die Immunschwäche Aids: «Die rätselhafte Krankheit».
Zur selben Zeit kommt «War Games» in die Kinos. Die United-Artists-Produktion dreht sich um einen jungen Computerhacker in Seattle, der durch ein mit dem heimischen Akustikkoppler angezapftes Online-Simulationsspiel beinahe den dritten Weltkrieg zwischen USA, Russland und ihren Verbündeten auslöst. «War Games» landet in Amerika auf Platz fünf der erfolgreichsten Kino-Ereignisse des Jahres, knapp hinter der dritten «Krieg der Sterne»-Episode und dem Boulevard-Ulk «Tootsie», vor «Lockere Geschäfte» mit dem damals (wie der Mauertote Silvio Proksch) 21-jährigen Tom Cruise und dem aktuellen James-Bond-Film «Octopussy», der teilweise in Karl-Marx-Stadt spielt. Gedreht worden sind die Szenen im englischen Peterborough. Der Marx-Kopf ist daher nicht im Bild.
In der Bundesrepublik ist «The Day After – Der Tag danach» der fünfterfolgreichste Film des Jahres, eine US-Kriegsseifenoper über einen russischen Atomschlag und seine Folgen. Das Plakat zeigt einen schaurigen Special-Effects-Atompilz, der Film wird zum großen Thema in Presse und Fernsehmagazinen. In der DDR wird derweil die große Fernsehserie «Einzug ins Paradies» produziert, die sich ums staatliche Wohnungsbauprogramm dreht und die Schicksalsgeschichten von fünf Familien im Plattenbau in Berlin-Marzahn miteinander verknotet. Das Ergebnis wird im Staatlichen Komitee für Fernsehen und im ZK-Sekretariat für Agitation so kontrovers debattiert, dass es erst 1987 ins Fernsehen kommt.
Ist das wirklich das Jahr, in dem man als lustige bayerische Band nach drüben fahren will, zur prophylaktischen Handreichung? Der Kalte Krieg ist jedenfalls gerade dabei, sich um einige zusätzliche Eisfachstufen zu verfrosten.
Die unscharfe Angst wird plötzlich so greifbar, dass sie die Leute aufweckt und zum öffentlichen Demonstrieren motiviert, in beiden Teilen Deutschlands. Manchmal in Form von echtem zivilem Ungehorsam, manchmal als inszenierte Geste. «Europa darf kein Euroshima werden» ist das Motto der Demo von 100000 Menschen in Dresden, die von der Regierungspartei SED selbst für den 13. Februar 1983 organisiert wird, dem Jahrestag der ersten Bombardierung durch die Alliierten. Es geht um die Konsequenzen des knapp vier Jahre alten Nato-Doppelbeschlusses, der unter anderem vorsieht, dass US-amerikanische Pershing- und Cruise-Missile-Atomraketen in Westeuropa aufgestellt werden sollen, ein Schachzug zur Abschreckung, als Antwort auf die russische Mittelstreckentechnologie.
Kurz vor der zugehörigen Bundestagsentscheidung wird in der BRD der sogenannte «Heiße Herbst» zelebriert. Der Höhepunkt: Am 22. Oktober demonstrieren rund 1,3 Millionen in Bonn, Hamburg und Westberlin gegen eine Entscheidung für deutsche Raketenstandorte. Die süddeutsche Menschenkette reicht über 100 Kilometer weit, von Neu-Ulm bis Stuttgart. Der Spruch des Tages, abgewandelt nach Bertolt Brecht: «Stellt euch vor, es ist Krieg, und keiner geht hin.»
Am 22. November 1983 stimmt der Bundestag trotzdem für die Bewaffnung, mit 286 gegen 226 Stimmen. Die Sowjetunion setzt die in Genf laufenden Abrüstungsverhandlungen daraufhin aus. Wenige Tage später rollen US-Nuklearsprengköpfe in die Bundesrepublik ein.
Am 7. November, dem Tag, bevor die Spider Murphy Gang in Rostock ihr insgesamt sechstes DDR-Konzert spielt, startet zudem an diversen Orten Europas das streng geheime Nato-Militärmanöver «Able Archer 83». Es ist die Kommandoübung, in der ein möglicher Atomkrieg einmal trocken durchgespielt werden soll. Jahre später wird bekannt, dass es dabei beinahe zur Totalkatastrophe gekommen wäre. Die Simulation wirkt auf einige Verantwortliche beim sowjetischen Geheimdienst derart authentisch und überzeugend, dass sie die ersten Vorbereitungen für einen hundertprozentig echten Gegenschlag einleiten lassen.
Die Geschichte des Films «War Games», den sich das deutsche Kinopublikum derweil mit Cola und Eiskonfekt anschaut, findet parallel also wirklich statt, ohne dass es jemand mitbekommt. Die Spider Murphy Gang hätte den Ausbruch des Dritten Weltkriegs um ein Haar auf Tour in der DDR erlebt, ausgerechnet. Die deutsche Fernsehserie «Deutschland 83», die auf der Story der «Able Archer»-Affäre basiert, wird 2015 bis in die USA weiterverkauft werden.
Eine Rockband muss an vieles denken, bevor sie nach Osten geht
«Für uns war es damals ja gar nicht vorstellbar, dass sich irgendwann etwas an diesem verfahrenen Weltzustand ändern könnte», sagt Günther Sigl heute, der Sänger, Bassist und Hauptsongschreiber der Spider Murphy Gang. «Es gab zwei deutsche Staaten, das war wie in Stein gemeißelt. Für eine bundesdeutsche Rockband wie uns war es ja tendenziell einfacher, in Japan, Brasilien oder den USA zu spielen als in der DDR. Unsere Tour war für die Autoritäten wohl auch so etwas wie ein Versuchsballon.»
Wenn man verstehen will, was an der Idee für eine solche Tour zu der Zeit so einzigartig war, muss man an zwei Dinge denken. Erstens: Künstlerinnen und Künstler aus westlichen Ländern, ganz besonders aus Westdeutschland, konnten 1983 nicht einfach direkt mit Konzertveranstaltern oder Agenturen in der DDR kommunizieren und verhandeln, wie es in der kapitalistischen Welt üblich war, wenn man auf Tour gehen wollte. Für Ostdeutschland brauchte man die offizielle Einladung von einer der dazu befugten Institutionen – zum Beispiel von der staatlichen Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend (FDJ), von der Künstleragentur, einer Art Behörde, die in beide Richtungen alle West-Ost-Kulturreisen steuerte und absegnen ließ, oder auch direkt vom Palast der Republik in Ostberlin. Ohne die Initiative der politisch befugten Stellen war kein Auftritt möglich, zumindest kein legaler.
Dazu kam etwas, das häufig übersehen wird: Eine Westband, die eingeladen wurde, musste in einer solchen Reise auch selbst den nötigen Sinn sehen. Sie musste entscheiden, ob sie sich das diplomatische und bürokratische Tamtam ans Bein binden wollte, das ihr dabei blühte, die Durchleuchtung durch die Staatssicherheit, die Kontrolle von Songtexten und so weiter. Relevante Gagen oder nachhaltigen Ruhm, also eine systemgemäße Gegenleistung, die den Einsatz gerechtfertigt hätte, versprach ein DDR-Gastspiel Anfang der 80er-Jahre ganz sicher nicht. Jedenfalls nicht nach den Kriterien der westlichen Kultur-Wertschöpfung.
Daheim in der Bundesrepublik hatte die Spider Murphy Gang damals alles erreicht, was man als Band mit so scharf zugespitztem Genre schaffen konnte. Gestartet war sie als Tanzkapelle in München-Schwabing, die in den mittleren bis späten 70ern in Liveclubs und den Kneipen amerikanischer Besatzungssoldaten alte Rock-’n’-Roll-Hits spielte. Schon 1982 hatten die vier, nachdem sie mit eigenen, von Sigl bauernschlau getexteten Songs beim Kölner Musikkonzern EMIElectrola untergekommen waren, dann schon zwei Goldene und eine Platinschallplatte in der Bilanz. Über eine Million Platten hatten sich verkauft, den Spider-Murphy-Kinofilm sahen 1983 rund 250000 Menschen.
Allein das Album «Dolce Vita» und die berühmte Single «Skandal im Sperrbezirk» standen beide je zwei Monate lang auf Nummer eins der Charts. Am 2. August 1982 trat die Band in einer Folge der «ZDF Hitparade» mit Dieter Thomas Heck gleich zweimal auf, mit verschiedenen Songs. Zu «Wo bist du?» hampelten sie in Tracht und mit volkstümlichen Instrumenten als Oktoberfestgruppe zum Playback. Sie waren gleichzeitig Pop- und Schlagerstars, die sich eine Zeit lang fast alles erlauben konnten.
Im «Sperrbezirk»-Song, inspiriert durch Erik Silvesters 70er-Schlager «Skandal um Rosi», erzählte Sigl vom vergeblichen Bemühen der Münchener Autoritäten, anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 die Innenstadt vom Prostitutionsgewerbe zu säubern. In «Schickeria» spottete er relativ explizit über den Schwabinger Jetset, und im weniger bekannten Stück «Freizeit 81» sang er über die gleichnamige ultralinke Aktionsgruppe, die in München mehrere Brandanschläge auf Banken und öffentliche Gebäude verübt hatte. Die Geschichten klangen hier zwar mehr wie lustig aufgespießte Lokalmeldungen, aber wenigstens vibrierten sie ein wenig mit der Wirklichkeit.
Politische Sympathie oder Sendungsbewusstsein seien allerdings kein Grund dafür gewesen, dass die Band zum Höhepunkt ihres Ruhms ausgerechnet in der DDR auftreten wollte, sagt Sigl. Sie hätten schlicht so viel Fanpost aus dem Osten bekommen, wo der Bayerische Rundfunk in grenznahen Regionen gut zu empfangen war. «Wir wollten gern für die Leute spielen, aber auf keinen Fall auf ideologische Mission gehen», betont er. Und nennt dann ganz nebenbei noch einen anderen Beweggrund, der für die West-Ost-Reisen vieler Musiker eine Rolle spielte, die man nie vergessen darf: «Für uns war es ja auch gute Promotion.»
Also: Promotion im eigenen Land, die eine solche Ostmission in jedem Fall bedeutete. Ein grenzüberschreitendes Manöver, ein Bruder- und Schwesterngruß in die andere Hälfte Deutschlands, eine unterhaltsame Unze Ostpolitik brachte 1983 viele gute Überschriften in der News- und Musikpresse, dazu mindestens einen Filmbericht im «heute journal» und ein paar bestens platzierte Artikel in der Bild. Eine Story, die in enorm guter Farbe strahlte, wenn man es schaffte, sie halbwegs unfallfrei zu erzählen.
Fährt die Spider Murphy Gang denn nun – oder doch nicht?
Aber wie sollte der Kontakt nach Osten hergestellt werden, dorthin, wo die übliche Infrastruktur des Showbusiness nicht hinreichte? Spider-Murphy-Manager Jürgen Thürnau musste an einen früheren guten Arbeitskontakt denken, einen wichtigen Lieferanten des Hannoveraner Plattenladens, in dem er nach der Lehre einen Job gehabt hatte. Peter Schimmelpfennig, ein ausgefuchster, mittlerweile in Westberlin ansässiger Musikmanager, hatte sich inzwischen auf den Kulturaustausch zwischen DDR und BRD spezialisiert. Er vermittelte große Ostbands wie die Puhdys, Karat und City an westliche Konzertveranstalter, brachte über sein Label Pool ihre Platten in der Bundesrepublik heraus.
Vielleicht könnte er ja der Gang helfen, die Sache umzudrehen: Musik auch in die Gegenrichtung zu transportieren, von Ost nach West. Thürnau rief an, Schimmelpfennig wurde aktiv und ließ die Kontakte spielen (wir werden ihn später im Buch noch näher kennenlernen). Als Jürgen Thürnau im Januar 1983 zur jährlichen Musikmesse MIDEM nach Cannes fuhr, hatte er dort tatsächlich eine offizielle Verabredung mit Egon Werther, dem stellvertretenden Generaldirektor der Künstleragentur der DDR. Wortlaute sind nicht überliefert, aber das Gespräch verlief unproblematisch. Man ging bestens gelaunt auseinander.
In den kommenden Wochen warteten die Münchener auf den Anruf aus Ostberlin, auf die finale Bestätigung für ihre Tour. Aber sie kam nicht.
Womöglich waren es zwei weitere Ereignisse im eh schon newslastigen Jahr ’83, die letztendlich für die Spider Murphy Gang arbeiteten. Am 29. Juni übernahm die Regierung in Bonn die Bürgschaft für einen Kredit über eine Milliarde D-Mark, den die Staatsführung der DDR zu der Zeit dringend brauchen konnte. Anders war der Staatshaushalt, der in feuerroten Zahlen steckte, nicht mehr aktionsfähig zu halten, im Jahr darauf folgte noch ein zweiter BRD-Kredit.
Der eher unwahrscheinliche Hauptinitiator auf bundesdeutscher Seite war – wir hatten es vorher schon kurz von ihm – Franz Josef Strauß, bayerischer Ministerpräsident und erklärter Antikommunist. Strauß musste sich für den Coup auch gegen die eigenen politischen Freunde umständlich verteidigen. Angeblich löste er damit sogar einige CSU-Austritte aus, die über Umwege zur Gründung der rechtsradikalen Partei Die Republikaner führen sollten. In der neuen, überraschenden Rolle als Freund der DDR und Honecker-Anwalt überzeugte Strauß nur die wenigsten Beobachter so wirklich.
Auch wenn sich die Motivationen auf beiden Seiten bald als scheinheilig herausstellen sollten: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Einladung an die Rock-’n’-Roll-Gruppe aus Bayern als kleine, freundschaftliche Begleitgeste der DDR hinzukam. Ein Zugeständnis, das die Verantwortlichen nicht sonderlich viel kostete.
Vertreter der Jugendorganisation FDJ hatten beim staatlichen Komitee für Unterhaltungskunst zuletzt darauf gedrängt, mehr publikumswirksame Westkünstler ins Land zu bringen. Es gab schwierige Verhandlungen mit Udo Lindenberg, der am 25. Oktober einmalig im Ostberliner Palast der Republik spielen würde und ebenso ein Tourneekandidat war wie der Sänger Peter Maffay oder die Kölner Rockband BAP