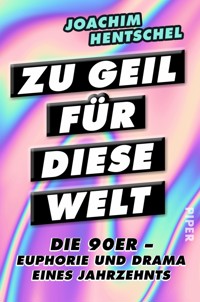
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die 90er-Jahre sind nicht nur Piercing und Techno, Buffalo-Schuhe und Neonazis. Dieses stilprägende Jahrzehnt ist zum Scharnier zwischen zwei Zeitaltern geworden: Seine Bewohner vollzogen die Deutsche Einheit, erfanden das Internet, bewunderten die totale Sonnenfinsternis, feierten die Loveparade in Berlin, jubelten den Spice Girls und Nirvana zu, schufen einen nie gekannten Aktienboom und waren im TV live dabei, als Sarajevo beschossen und Helmut Kohl abgewählt wurde. Joachim Hentschel berichtet von den ersten Raves, spricht mit VIVA-Moderatorinnen, besucht Revival-Partys, liest in alten BRAVO-Ausgaben – und ergründet so die Seele eines Jahrzehnts, das historisch eingeklemmt zwischen Mauerfall und 9/11 sehnlichst darauf wartet, von uns wiederentdeckt zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
I saw the sign, and it opened up my eyes.
Ace of Base, 1993
Coolness ist kein Maßstab, willkommen in der Gegenwart. Coolness ist 90er. Was für ein neurotisches Konzept: Coolness.
Jan Böhmermann, 2017
Das ist echt komisch: Überall, wohin ich komme, gibt’s Ärger mit Klopapier.
Franka Potente in »Nach Fünf im Urwald«, 1995
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Einleitung: Pogo getanzt, nach Aliens gesucht, Gott gefunden
Wir fangen mit dem Ende an: Der schrecklichste Tag in New York
Eine ganze Ära geht zu Ende – aber welche eigentlich?
Die besten Erinnerungen aller Zeiten: So startete die Spaßgesellschaft
Warum könnte uns ein Blick in die 90er die Gegenwart erklären?
»Zonen-Gaby (17) im Glück (BRD): Meine erste Banane«
Nutella mit Wildfremden: Willkommenskultur an der deutsch-deutschen Grenze
Was macht der Leipziger im Sexshop? Beste Aussichten und schlechte Witze
Zurück auf Los: Wie man aus Ex-Nazis und Ex-Kommunisten eine neue Nation bastelt
Klappe, die zweite: Zwei Kinofilme schauen ins deutsch-deutsche Herz
Ein Wunder, dass sie nicht übereinander herfallen: Der erste Kater nach der Wende
»This one is dedicated to all the ravers in the nation.«
Higher States of Consciousness: Den ersten Rave vergisst du nie
Techno, Herzschlag der neuen Kultur: Wir ziehen in die Ravers’ Nation!
Leistungsschau oder Befreiungsschlag? Der Streit um die Loveparade
In Berlin ist alles möglich: Die Stadt wird zum Abenteuerspielplatz
Mayday, Mayday: Techno wird Overground (und es war gut so)
»Miststück. Egoist. Nervensäge.«
Spice Girls, Fanta, Speeddating: Ein Freitagnachmittag mit VIVA
Der kleinste Nenner nützt nichts mehr – jeder will sein eigenes Entertainment
»Der Erfolg ist gewachsen wie meine Körbchengröße«: Blümchen, die virtuelle Sängerin
Alles geht, nichts muss: Wie man sich seine Szeneidentität selbst basteln kann
I’m a loser, baby, so why don’t you kill me? Slacker und Millennials haben’s nicht leicht
»Mein Sohn, ein Neonazi? Ich hätte ihm eine geschmiert.«
Mannheim-Schönau: Die Flüchtlingswelle erreicht einen badischen Stadtteil
Vom Kasernenmob bis zur Hetzjagd auf Nazis: Eine ganze Menge verschiedener Positionen
»An der Nordseeküste, am arischen Strand«: Wie rechts kann Pop werden?
Politisch schwer unkorrekt: Warum es immer komplizierter wurde, mit Rechten übers Rechtssein zu sprechen
Gottschalk gegen Schönhuber: Ein Duell kurz vor Mitternacht
Rio Reiser macht noch eine blöde Bemerkung, und sie ist großartig
»Sie hat ein weißes Gesicht und wuschlige Beine«
Gute Nachricht 1: Wir müssen nie wieder Geld wechseln
Gute Nachricht 2: Glückwunsch, jetzt bist du Aktionär!
Gute Nachricht 3: Es ist toll, ein Mädchen zu sein
Gute Nachricht 4: Sträflinge können Präsidenten werden
Gute Nachricht 5: Rucola passt zu allem
Gute Nachricht 6: Auch Fußballer sind schwul (und geben es sogar zu)
Gute Nachricht 7: Man muss nicht mehr links oder rechts sein – es gibt etwas dazwischen
Gute Nachricht 8: Wenn mein Hund stirbt, lass ich mir einen neuen machen
Gute Nachricht 9: Im Notfall rettet uns Bruce Willis
Die schlimme Nachricht: Tod, Rache und Verderben
»Hallo, wir sind’s! Vertreibt uns die Zeit!«
Stolz und Vorurteil, oder: Wie der Superstar der 80er zum Kasper der 90er wird
Alles ist schlimm, alles ist super: Kurt Cobain trifft tief in die Teenagerherzen
Von Homer bis Tupac: Eine Historie der kaputten Helden
Gelangweilt auf den Jungferninseln: Die Heroinmode und das Gesicht des Jahrhunderts
Die sexy Models kehren zurück – und mit ihnen die Erinnerung
»Scully, das sollten Sie sich ansehen!«
Liveshow mit Gespenstern: Die Geschichte eines TV-Skandals
Vom Tagtraum bis zu Lara Croft: Virtuelle Hobbys für alle Jahreszeiten
Ein Händedruck mit Monsterfingern: »Akte X«, der Parapsychokrimi
Ufos, Verschwörungen und andere moderne Mythen: Die atemlose Wahrheitssuche
Jetzt formen wir die Wirklichkeit selbst: Virtual Reality mit und ohne Brille
»Heute hat sogar meine Katze ihre eigene Website.«
Stell dir vor, es ist Internet und keiner geht hin: Eine neue Welt – oder ein kurzlebiger Trend?
Müsliriegel und Suchmaschinen: Der lange Weg vom Rechenzentrum in den Cyberspace
Angst vor der Atombombe, plappersüchtige Nerds – und ein feiner Herr aus England
Universum ohne Hierarchien: Das Internet entpuppt sich als LSD-Traum
Der Fall CompuServe: Und wer kehrt im Netz den Schweinkram zusammen?
»Jeder muss alles wissen – vor allem über Sex.«
Madonna, Sharon und das letzte Tabu: Die sexuelle Revolution kommt endlich aus dem Quark
Kickstart in die Spaßgesellschaft: Alles, was geil ist, ist irgendwie möglich
Ziviler Ungehorsam à gogo: Kaufen oder nicht kaufen, das ist hier die Frage
Der große Meta-Chill-out zum Ende des Jahrzehnts
»Kannst du das bitte filmen? Für meine Schwester?«
Neo-Grunge und Mambo No. 5000: Eine vergangene Dekade richtet es sich häuslich bei uns ein
Meine schöne, alte Handymöhre: Die Sehnsucht nach der frühen Digitalisierung
Früher waren wir crazy, heute haben wir Probleme: Wie ein Ex-VIVA-Girl das menschliche Gemüt erforscht
Was hat uns bloß so ruiniert? Eine nüchterne Bilanz nach zwanzig Jahren
Meine Jahre mit Blair, Boris und Loadsamoney: Ein alter Europäer sagt uns die Wahrheit
Okay, und jetzt? Was wir heute aus den 90ern lernen können (und was lieber nicht)
Schluss: »In Berlin ist die Finsternis nur partiell.«
Danksagungen
Bildteil
Einleitung: Pogo getanzt, nach Aliens gesucht, Gott gefunden
Warum sollen wir uns heute überhaupt noch einmal mit den 90er-Jahren beschäftigen?
Es war Dienstag, als die 90er-Jahre zu Ende gingen. Ein tendenziell blauäugiger, harmloser, verduselter Tag, kein großes Ding. Einer, von dem man im Zweifel eher geglaubt hätte, er könnte der lustige Anfang von irgendetwas sein. Kein Schluss. Keine No-Return-Klappe für eine herrliche, gewaltige Zeit, die theoretisch noch ewig hätte weitergehen können. Und von der man so nicht mal richtig Abschied nehmen konnte.
Die meisten, die man heute fragt, erinnern sich komischerweise daran, dass die Sonne schien. Dass sie in der Postamtsschlange standen oder im Auto an der Kreuzung, als es passierte. Dass sie Besuch hatten oder Zahnweh oder einen Abendtermin, zu dem sie umständlich anreisen mussten. Später konnte man den leuchtblauen Himmel und die Herbstvögelchen noch in tausend TV-Wiederholungen sehen, in Endlosloops, auf großen Bildwänden, über alle denkbaren Blickachsen verteilt. Weshalb sich jetzt, rund zwanzig Jahre später, niemand allzu sicher sein sollte, dass die Erinnerung an diesen Dienstag wirklich echt ist. Und nicht nur ein Phantom, eine multimediale Luftspiegelung.
Was mein eigener Kopf noch weiß: wie der Chef der Hamburger Redaktion, in der ich zu der Zeit arbeitete, gegen drei Uhr nachmittags aus seinem Glaskasten im ersten Stock schlüpfte wie ein Maulwurf. Wie er zur Treppe ging und mich im Vorbeigehen kurz anstarrte, in den Augen eine komische Mischung aus Schock und Belustigung. »Auch gehört?«, fragte er in gespielt amüsiertem Ton. »Eben sind zwei Flugzeuge ins World Trade Center geflogen.«
Wir fangen mit dem Ende an: Der schrecklichste Tag in New York
Und ja, das wäre mal gleich die erste These: Die Dekade der 90er ging nicht, wie oft behauptet wird, am 31. Dezember 1999 zu Ende, sondern am 11. September 2001. Obwohl man es ja eigentlich schon zu Silvester ’99 fest eingeplant hatte, das Finale mit großem, endzeitlichem Tamtam. Bei dem die Boeings vom Himmel fallen und die Toaster uns in die Finger beißen sollten. Bei dem die Atomkraftwerke feierlich schmelzen, die Erde aufsplittern, die »Titanic« als Gruselschiff vom Grund hochkommen und das große Blutgericht über die Welt hereinbrechen würde. Simultan zum Schluss des Jahrzehnts, Jahrhunderts und Jahrtausends würde so praktischerweise gleich die gesamte menschliche Kulturgeschichte enden. Passend zum Feuerwerk, ausgelöst durch den sogenannten Millennium-Bug.
Weil man ihn nachträglich gern mit dem Weltuntergang von 2012 verwechselt, den irgendjemand bei der Lektüre im Maya-Kalender gefunden hatte, kurz zur Erinnerung: 1999 war es noch um einen apokalyptischen, weltweiten IT-Crash gegangen, der dadurch ausgelöst werden sollte, dass um Mitternacht alle veralteten Computerkalender vom Jahr 99 auf 00 zurückspringen und dabei die Tore der Hölle öffnen würden. Am Ende passierte nichts, fast nichts. Nach all dem Vorabgebömmel war man fast ein bisschen enttäuscht.
Wie gesagt, es knallte dann doch noch, mit Verzögerung, aber dafür besonders schlimm. Die symbolische Bombardierung des World Trade Center in New York und des Pentagons in Washington, ausgeführt mit drei Passagierflugzeugen (das vierte stürzte ab). Verübt von den Möchtegernmärtyrern einer radikal-muslimischen Terrororganisation, die bis dahin nicht mal sonderlich Small-Talk-tauglich gewesen war, in Echtzeit erlebt vom Großteil der Menschheit: All das passierte zu einem Zeitpunkt, an dem viele, zumindest im privilegierten Westen, auch ohne allzu viel Naivität geglaubt hatten, dauerhaft auf die gute, rasengrüne Seite der Geschichte gefallen zu sein. Als man sich schon fast gewöhnt hatte an dieses Gefühl der Good News, der Befreiungs- und Grenzöffnungsszenen, an die virtuelle Allmöglichkeit der Dinge, an den Abschied von den alten, rostigen Ideologien. In den 90ern konnte man das eine Zeit lang glauben: Vielleicht würde am Ende ja doch alles gut werden.
Die Popstars Prince Ital Joe und Mark Wahlberg hatten das Glück in einem Song prophezeit, im April 1994, zum Höhepunkt der Euphorie: »Maybe one day we’ll be united, and our love won’t be divided.« Prince Ital Joe erlebte den 11. September 2001 übrigens gar nicht mehr. Er starb knapp vier Monate vorher bei einem Autounfall nahe Phoenix, Arizona. Auf dem Highway war ein Reifen geplatzt. Er war nicht angeschnallt.
Klar, bei vielen lag das sprichwörtliche undifferenzierte Hochgefühl das Jahrzehnts auch einfach nur an den Nebenwirkungen ihrer Techno-Tabletten oder am Afri-Cola-Rausch. An den Allmachtsfantasien aus den Internetchatrooms von voriger Nacht, am Girl-Power-High-Five oder einfach – an Ibiza. Und ja, natürlich gab es auch in den 90er-Jahren genug Krisenherde, Explosionen und geistesgeschichtlichen Spuk, genug Argumente für depressive Zweifel an der Zukunft. Aber trotzdem, nur mal als Experiment: Man kneift einen Moment lang die Augen zusammen, lässt nur einen Lichtspalt durch. Man guckt dann, nacheinander, erst in die restaurativ-trüben 70er. In die vom Kalten Krieg verklaustrophobierten 80er. Dann noch in die technologisch tadellosen Nullerjahre. Spätestens dann ist die orangefruchtige Sonne, die den 90ern aus beiden glatt rasierten Achselhöhlen zu strahlen scheint, im Vergleich umso blendender.
Eine ganze Ära geht zu Ende – aber welche eigentlich?
Als es dann unwiderruflich vorbei war, am 11. September 2001, saßen wir den Rest des Tages vor dem Fernseher. Kauten an Nägeln oder ungetoasteten Brotscheiben. Hatten plötzlich riesige Angst vor etwas, das wahnsinnig weit weg war, ein Gefühl, das wir fast schon verlernt hatten. Alle schauten in Richtung New York, wo um circa neun Uhr Ortszeit der erste Angriff passiert war. Selbst als das zweite Flugzeug einschlug, meinte der News-Anchorman Steve Bartelstein auf ABC noch, es könne sich nur um einen bizarren Unfall handeln, um den simultanen Ausfall mehrerer Navigationssysteme oder so. Eine so weit hergeholte, nicht terroristische Unschuldsvermutung sollte es in der Historie der Menschheit nie wieder geben. Ab sofort war es andersrum. Wenn irgendwo ein Navigationssystem ausfiel, glaubten wir zur Sicherheit erst mal, es wäre ein Anschlag.
Die Website Spiegel Online, im Jahr 2001 noch relativ jung, brach wegen der irren Nachfrage zeitweise zusammen. Man starrte auf die Skyline, wie man noch nie auf eine Skyline geschaut hatte, und viele dachten widerwillig, aber automatisch an die Schlussszene des Films »Fight Club« von 1999, in der Edward Norton und Helena Bonham Carter von der Galerie aus verfolgen, wie das Bankenviertel einer unbenannten amerikanischen Großstadt in die Luft fliegt. Freunde riefen an, die aus irgendwelchen Gründen nichts mitgekriegt hatten. Man sagte Sachen ab.
Mitten im stummen, stumpfen Häufchen vor dem Fernseher in der Hamburger Redaktion, unter dem ungebremsten Eindruck der Feuerbälle, Staublawinen und fallenden Menschen, ergriff einer, der meiner Erinnerung nach Ingo hieß, das Wort. »Leute, das gibt Krieg«, sagte Ingo. Er hatte recht. Er hatte natürlich nicht die leiseste Ahnung. Davon, was für ein bislang unbekannter, anomaler, welt- und gedankenverändernder Krieg das werden würde. Davon, wie lange er dauern würde.
Was genau war hier eigentlich zu Ende gegangen? Es gab bald Antworten. Große, widersprüchliche, deshalb ja nicht unbedingt völlig falsche Antworten – von Leitartikeln bis zu UN-Resolutionen, von zeichentheoretischen Puzzleanleitungen bis zu dunkel gestreiften Verschwörungstheorien.
Osama bin Laden, das mutmaßliche Evil Brain hinter dem Großanschlag, habe »die Geschichte des Terrorismus neu geschrieben und möglicherweise sogar der Geschichte des nach dem Kalten Krieg erkennbaren neuen Zeitalters ein Ende gesetzt«, sagte der US-Terrorismusforscher Bruce Hoffman im November 2001 bei einem Vortrag in der Frankfurter Paulskirche. Der Soziologe Jean Baudrillard stellte im Rückblick einen »Streik der Ereignisse« in den 90ern fest (im Original kam die Formulierung vom argentinischen Schriftsteller Macedonio Fernández). Dieses Vakuum hätten die 9/11-Terroristen auf besonders gerissene Art zum Platzen gebracht, indem sie die westliche Moderne mit ihren eigenen Errungenschaften bekämpft hätten: mit der Technologie, den Medienmechanismen. Mit der Vorstellung davon, was ein Event ausmacht.
Eine Woche nach den Anschlägen erklärte der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass es in einer Welt, die seit den 90ern im Prozess der Globalisierung stecke, keine wirklichen Angriffe »von außen« mehr gebe, nur noch von innen. Und Terroristen, denen der Tod im Prinzip egal sei, meinte Enzensberger, hätten den auf Selbsterhaltung getrimmten Kapitalistenkindern nun mal einen strategischen Vorteil voraus. Der marxistische Donnerkopfphilosoph Slavoj Žižek wiederum schrieb: »Amerikas Frieden wurde durch die Katastrophen anderswo erkauft.« Mit anderen Worten: Wir, die Profiteure der Globalisierung, waren selbst schuld am Elend, das hereinbrach.
Ein Slogan, der sich im Zug dieser Diskussionen durchsetzte, rief das »Ende der Spaßgesellschaft« aus. Der Begriff selbst war zwar schon etwas älter, aber die Ereignisdeuter schienen ihn herzlich zu begrüßen. In Zusammenhang mit den Anschlägen von New York brachte ihn bereits am Tag danach in der ARD-Fernsehsendung »Friedman« der Nahost-Expertenveteran Peter Scholl-Latour. »Wenn man nun Krieg führt und vielleicht sogar einen Teil der deutschen Jugend an die Front schickt«, erklärte derselbe Scholl-Latour kurz darauf höhnisch der (von ihm rätselhafterweise geschätzten) rechten Wochenzeitung Junge Freiheit, »dann kann man hier keine Loveparade mehr veranstalten.«
Keine Loveparade mehr? Echt nicht? Und wäre das schlecht oder gut? Die zeitkritische These, die sich irgendwo hinter Scholl-Latours grässlichem Zynismus versteckt, wäre dann wohl die: Wenn in der westlichen Welt zur Jahrtausendwende Hedonismus, Dekadenz und eine Sucht nach Ereignissen endgültig über die Suche nach Erkenntnis gesiegt haben – dann war ein Warnschuss wie 9/11 vielleicht gar nicht so verkehrt.
»Schluss mit lustig. Das Ende der Spaßgesellschaft« hieß 2004 der Wertewandel-Bestseller-Schocker von Peter Hahne, dem damaligen Chef und Oberdorfpfarrer des ZDF-Hauptstadtstudios. »Vorbei die Zeiten der Allmachtsfantasien vom Weltfrieden der Vernunft«, schrieb Hahne im ersten Kapitel. »Das ist das Ende der heiteren Beliebigkeit. Die Schalmeien der Multi-Kulti-Folklore sind verstummt.« Natürlich darf man solche altkatholische Müffelpropaganda nicht verallgemeinern. Trotzdem stand Hahnes Buch viele Monate lang auf Platz eins der Spiegel-Sachbuchcharts.
Was wir aus all dem lernen können: Offenbar bestand Anfang der Nullerjahre in der westlichen Welt ein besonders verstärktes Interesse an radikaler, umfassender Entspaßung. Eine Gegenreaktion, gegen was auch immer. Dreifach gequirlter Selbsthass. Ein indirektes Zeichen dafür, wie ungewohnt hoch es vorher wohl hergegangen sein musste. In den 90ern.
Das World Trade Center war zu der Zeit längst nachträglich aus den aktuellen Kinofilmen »Spider-Man«, »Zoolander« oder »Serendipity« herausgelöscht worden. Den der Überlieferung nach ersten Witz über 9/11 wagte wenige Wochen nach dem Unglück (das genaue Datum ist unbekannt) der amerikanische Comedian Gilbert Gottfried bei einem Stand-up-Abend im New Yorker Friars Club. »Leider habe ich es nicht geschafft, einen Direktflug nach Kalifornien zu buchen«, erzählte Gottfried ins Mikrofon. »Die Airline sagte mir, es gebe einen Zwischenstopp am Empire State Building.«
Kein Lacher. Das Publikum rumorte. »Zu früh!«, rief einer von hinten aus dem Saal.
Die besten Erinnerungen aller Zeiten: So startete die Spaßgesellschaft
Es war Donnerstag, als die 90er-Jahre begannen. Am 9. November 1989, als in der großen ostdeutsch-westdeutschen Stadt Berlin die Grenzmauer zwischen Bundesrepublik und DDR fiel. Auch nicht zeitgleich mit dem rechnerischen Anfang der Dekade, auch der Einsturz eines ziemlich symbolischen Bauwerks. Auch ein Tag der Bedeutsamkeiten und schwergewichtig herumsummenden Metaphern. 11/9 statt 9/11.
Und auch in diesem Fall weiß jeder noch, wo er war, als er vom Ereignis hörte, das wie die demokratische Höchstvollendung einer Straßenkampfszene aussah, wie ein Sieg der einfachen Leute. Eine Menschenmenge in Anoraks kloppte nach Einbruch der Dunkelheit mit Hämmerchen eine politische Sphärengrenze nieder, und kein Panzer hinderte sie daran.
Die komplexe diplomatische Vorgeschichte des Ereignisses war bekannt – trotzdem schien dadurch ganz unkompliziert einer weltweiten Evolution der Freiheit jede Tür geöffnet worden zu sein. Aufstand in Rumänien. Die deutsche Wiedervereinigung. Die Auflösung des Warschauer Pakts und der Sowjetunion. Kurz darauf der Wahlsieg des obercoolen Demokraten Bill Clinton in den USA. Das Ende der Apartheid in Südafrika, die Wahl des lange geächteten Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes. In Washington sah man allen Ernstes, wie sich der israelische Ministerpräsident Jitzchak Rabin und Palästinenserführer Jassir Arafat die Hände schütteln, im Rahmen des Oslo-Friedensprozesses, der es einige Zeit so aussehen ließ, als könnte der Nahostkonflikt doch am Verhandlungstisch gelöst werden.
Es gab den Vertrag von Maastricht und die Gründung der Europäischen Union. Die Umsetzung des Schengener Abkommens, die dazu führte, dass alle fröhlichen Interrail-Urlauber innerhalb Europas auch ohne Pässe und einschüchternde Kontrollstopps reisen konnten. Eine ganze Menge Großmachtpolitik, die direkt am eigenen Körper spürbar wurde, als Lifestyle-Faktor. Ob es Zufall war, vorübergehende kosmische Fügung, politischer Megatrend oder etwas ganz anderes – es setzte das große, dominante Hochgefühl in die Dekade. Eine seltsame, erst noch misstrauisch belauerte, dann gefeierte Empfindung: Optimismus.
»Selbst Menschen, die schon alles gesehen haben, fragen sich in letzter Zeit öfter mal, ob sie eigentlich träumen«, schrieb Lucas Koch, damaliger Chefredakteur des deutschen Magazins Tempo, schon im August 1990 im Editorial-Vorwort zu einer Ausgabe zum Revival der Sixties-Psychedelic-Mode, das durch Techno-Bassdrums und neue, unschmuddelige Drogen befeuert wurde. Da wusste er ja noch nicht einmal, dass bald das Internet kommen würde.
Wenn 9/11 das Ende der Spaßgesellschaft war – dann war der Mauerfall in Berlin ihre Geburtsstunde.
Mittlerweile, rund zwanzig Jahre nach Start und Ende des ganzen goldenen Schabernacks, vergegenwärtigen die 90er sich längst wieder selbst, ganz von selbst. Im Straßenbild durch Jacken, Hoodies, Schuhe von den Labels wie Fila, Kappa, Champion oder Reebok. Durch Plateauturnschuhe und Basecaps, Sportstreifenhosen und Collegejacken, über T-Shirts gefädelte Spaghettiträger. Fernsehserien wie »Twin Peaks«, »Beverly Hills, 90210« und »Baywatch« werden spät fortgesetzt. Robbie Williams und Sven Väth, Roxette und Blur, Captain Hollywood und Guns N’ Roses sind in verschiedenen Stadien der Las-Vegas- oder Dorfdisco-Epiphanie noch immer da, während Artikel auf Entertainmentportalen wie Buzzfeed süße alte Wunden aufreißen: »37 Dinge, die du nur kennst, wenn du in den 90ern zur Schule gegangen bist.« Tamagotchis und Kuschelrock-CDs. Dreh-und-Trink-Plastikflaschen. Game Boys und Analogmodems, Freundschaftsbändchen, Inlineskates. Und immer, immer so weiter.
Warum könnte uns ein Blick in die 90er die Gegenwart erklären?
Die ersten, wilden Bilanzen gab es schon, als das Karussell sich noch drehte, und sogar das ist archetypisch für das Jahrzehnt, in dem die Selbstreflexion in die Popkultur einzog. Bereits im Januar 1997 kündigte das englische Trendmagazin The Face »Die Wahrheit über die 90er« an und titelte ausführlich, über dem Foto einer so verstrahlt wie nachdenklich guckenden, obenrum nackten jungen Frau: »Mit dem Raven aufgehört, Wodka getrunken und davon high geworden, verliebt, mit dem besten Freund geschlafen, in Clubs Pogo getanzt, nach Aliens gesucht, in Ibiza ausgerastet, beim Glastonbury Festival Gott gefunden – und wie geht’s jetzt weiter?«
Gute Frage. Vor allem: Warum soll man über all das jetzt noch ein Buch schreiben und lesen? Weil wir heute den nötigen Abstand erreicht haben. Weil wir jetzt erst bereit und weise genug sind, um über die Wahrheiten und Zweifel von damals zu reden, aus der anderen Umlaufbahn heraus. Weil wir erst jetzt in der Lage sind, die Zusammenhänge zu erkennen, durch die die 90er zu einer Art intergalaktischem Scharnier zwischen zwei Zeitaltern geworden sind. Weil so immens viel noch ungesagt ist über die Dekade, die viele im Osten und Westen wie im Rausch erlebten. Und weil wir uns ja schon damals fragten, was überhaupt typisch oder kategorisch sein könnte an einer Zeit, die mit allen Kategorien, Generationen und Typischkeiten aufräumen wollte.
Und, das wäre der dramatische Grund: weil nun der Punkt erreicht ist, an dem man fragen muss, was eigentlich aus den damals errungenen Freiheiten geworden ist. Wie lange sie gehalten haben. Ob sie heute wieder zur Disposition stehen – oder ob die Ereignisse der Gegenwart, die wie Rückschritte in ältere, finstere Zeiten wirken, nur ein vorübergehender Spuk sind. Ereignisse wie das neue Auseinanderdriften der Länder Europas, der angestoßene Austritt Großbritanniens aus der EU. Die massiv wachsenden rechtspopulistischen Tendenzen in Europa und den USA. In Amerika wurde im Herbst 2016 ein altautoritärer Spalter wie Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Die Opposition zwischen den USA und Russland ist wieder kälter und kriegerischer geworden.
Um 2018 herum gibt es fast keine größere Weltgesellschaft, die von Beobachtern nicht als »tief gespalten« gesehen wird. »Maybe one day we’ll be united« – was ist geschehen? Warum haben wir die Befreiung geopfert, warum hat die scheinbar beendete Geschichte wieder begonnen?
Oder liegen die wahren Ursachen der heutigen Misere schon in der Zeit, die wir als Architektenjahre der Freiheit verstanden? Denn die 90er, das waren ja auch: das unfassbar todesgrün leuchtende Stück Limettentorte in der Anfangsszene von Oliver Stones Film »Natural Born Killers«. Das Stück vom Ohr des Boxer Evander Holyfield, das Mike Tyson ihm beim Kampf am 28. Juni 1997 in Las Vegas abbiss. Ben Stillers Sperma, das Cameron Diaz im Film »Verrückt nach Mary« für Haargel hielt und sich in die blonde Frisur schmierte. Der riesige, in Formaldehyd schwebende Tigerhaikadaver, den der Künstler Damien Hirst in die Saatchi-Galerie in London wuchtete.
Oder das schaurige, Zöpfe tragende Alienmädchen im berühmten Playstation-Werbespot des Regisseurs Chris Cunningham, der beim Popsender MTV lief. Schauplatz: ein leerer, neonfahler Raum. »Auf den Fortschritt, den andere stellvertretend für euch erzielen, könnt ihr pfeifen«, sagte die Kleine, ziemlich lebensecht, mit starkem schottischen Akzent und blinzelte mit ihren weit auseinanderliegenden Augen. »Landet auf eurem eigenen Mond!« Eine der weltbesten Reden auf die unzerstörbare Macht des Virtuellen, der digital stimulierten Fantasie. Gehalten von einem grässlich echten Avatar in rekordtauglichen vierzig Sekunden. Fürchtet euch nicht, denn wir werden frei sein! Ein Clip, der die gesamte Dekade in der geballten Faust zu halten scheint.
Über frühere Jahrzehnte, über die 60er, 70er oder 80er, wird ja oft schrecklich klischeesteif gesagt, meistens von verschwitzten Altschauspielern: Wer sich an sie erinnert, hat sie nicht erlebt. Komischerweise hat das noch nie jemand über die 90er gesagt. Trotz all der Ecstasy-Pillen, Alcopop-Räusche und Ufojäger-Blitzdinger, die angeblich das Gedächtnis löschen.
Wer sich an die 90er erinnert, hat sie erlebt. Definitiv. Warum? Weil, und das werden wir noch deutlicher sehen, wenn wir jetzt gleich Chevignon-Mütze und John-Lennon-Sonnenbrille aufsetzen, an der G-Shock-Uhr drehen und zurück in die Zeit reisen – weil die 90er die Dekade waren, die uns nachhaltig die Augen öffnete. Die uns aufklärte über unsere Grenzen. Die uns erst den Horror und dann die Erlösung zeigte, bevor sie uns in die Weiten des Universums katapultierte. Die unsere unsichtbaren Ängste in sichtbare Monster verwandelte, die wir selbst verprügeln oder verpixeln konnten. Die uns und unsere Wolkenkratzer nicht mit ihren Raumschiffen attackierten, sondern uns stattdessen ein Stück in ihnen mitnahmen.
Dann wachten wir mitten in der Nacht auf, wie aus Träumen gerissen oder aus Cyber-Realitäten, vielleicht sogar aufgetaucht aus der sogenannten Matrix. Schauten hoch in die Sterne, sahen die Supernova aus Champagner am dunklen Himmel. Und hatten das gleichnamige Lied der englischen Band Oasis von 1995 im Ohr. »How many special people change? How many lives are lived estranged?«, sangen Oasis vorab nostalgisch über ihre eigene Zeit. »Where were you while we were getting high?«
Wo waren die anderen, als wir high wurden? Das würde uns tatsächlich interessieren. Jetzt. Let’s go.
»Zonen-Gaby (17) im Glück (BRD): Meine erste Banane«
Wie die deutsche Wiedervereinigung zum Bundesstraßenpicknick wurde, statt des Weltuntergangs die Vollendung der Geschichte kam und beim Manta-Rennen am Ende ein Trabi gewann
Gut zwanzig Jahre später, als jeder mögliche Witz über die deutsche Wiedervereinigung längst gemacht worden war, als die Bilder von damals schon superalt wirkten und die Ostberliner Eisläuferin Katarina Witt gerade im Sat.1-Film-Film »Der Feind in meinem Leben« ihr phänomenal nutzloses TV-Schauspieldebüt gefeiert hatte – da erzählte mir eine gute Freundin, wie sie das alles erlebt hatte. Damals, Ende der 80er, Anfang der 90er. Diese großen, gravitätischen Tage. Als alles, an das wir uns heute noch erinnern, haarscharf Weltgeschichte war. Oder gleich richtig krass historisch.
Susanne heißt die Freundin. Susanne kommt aus der Oberpfalz, diesem rätselhaften Regierungsbezirk in Bayern, dessen Bewohner zur Sicherheit immer gleich dazusagen, dass er mit der Pfalz von Helmut Kohl und Kurt Beck überhaupt nichts zu tun hat. Die Oberpfalz war ein paar Jahrzehnte lang das, was man in Deutschland »Zonenrandgebiet« nannte. Rustikal, voller Wald und Seen. Rasend beliebt, sobald mal wieder jemand nach einem Standort für eine atomare Wiederaufbereitungsanlage suchte. Vor allem unmittelbar an gleich zwei politischen Reißverschlussgrenzen gelegen. Im Osten: das tschechische Egerland. Im Norden, wenige Kilometer Fahrt durchs benachbarte Oberfranken entfernt: Sachsen. Die Oberpfalz, ein Landstrich im realsozialistischen Dauerdunst.
Als die Geschichte passierte, die Susanne mir später erzählte, war sie noch sehr klein. Weshalb sie sich nicht mehr an alles erinnerte, was an diesem Sonntag im November 1989 geschah, an dem die Oberpfalz den Namen »Zonenrandgebiet« schon nicht mehr verdiente, weil die sogenannte Zone keine echte Zone mehr war. Was Susanne noch wusste: An besagtem Morgen wollte sie viel lieber zu Hause bleiben und ein Haus für ihre Plastikponys basteln. Sie hatte keinen Bock auf die deutsche Wiedervereinigung. Ihrem Vater und ihrem Bruder ging es ähnlich. Schließlich war Wochenende! Susannes Mutter wirkte als treibende Kraft: Los jetzt, ins Auto, Richtung Grenze. DDR-Bürger begrüßen.
Nutella mit Wildfremden: Willkommenskultur an der deutsch-deutschen Grenze
In welcher Version die Geschichte vom Mauerfall und vom Ende des Ostblocks heute erzählt wird, ob sie farbige Streifen hat, braune Punkte oder ein ganz anderes Muster – das hängt natürlich davon ab, von welcher Himmelsrichtung aus die Berichterstatter auf die Ereignisse schauen. Ob sie die Wende vom Osten aus erlebt haben, als Einbruch von Freiheit und erfrischender, nicht kommunistischer Beliebigkeit. Oder im Westen, als eine Art gastfreundliche Osterweiterung, als Punktsieg des lang erprobten, gut möblierten Überflusslebens. Zur Sicherheit, falls noch irgendwelche Zweifel bestehen: Dies hier wird eine der Westvarianten. Eine, die von durchaus unzuverlässigen Zeugen kommt. Kapitalistische Wichtigtuer erzählen unter Tränen, wie nachdrücklich der Mauerfall sie bewegt und geprägt hat, wie tief die Einschnitte für sie waren – zum Glück wurde diese TV-Dokumentation nie gedreht.
In der Zeit, in der Susannes Sonntagsgeschichte passierte, rotierten die November-1989-Szenen aus Berlin heiß im Fernsehen. Es gab praktisch keine anderen Nachrichten. Inzwischen war auch der Übergang Trogen-Ullitz offen, zwischen Hof und Plauen, eine kurze Fahrt für die kleine bayrische Familie. Schon nach einer halben Stunde stand Susanne, fröstelnd und mies gelaunt, auf einem Feldparkplatz an der Bundesstraße 173, in einer Menge aus Anorakleuten, die genau dieselbe Idee gehabt hatten wie ihre Mutter. Alle leicht beklommen, peinlich berührt. Vor Ort ist es dann ja doch nicht so einfach, die Wiedersehensfreude aus dem Fernsehen nachzuspielen und Wildfremden lustig auf die Autodächer zu klopfen.
Es sei doch sehr wichtig, hatte die Mutter gesagt, den Gästen von drüben – die auf der Schnellstraße von Osten her kolonnenartig vorbeituckerten – das Gefühl zu geben, dass sie bei uns willkommen seien. Dass Franken und Oberpfälzer sie nicht etwa als Eindringlinge oder Schmarotzer betrachteten, sondern als Freunde, unbekannterweise. Es wurde viel gewunken. In einer Plastiktüte hatten sie Bananen, Nutella und Bier mitgebracht. Und dann kamen Susannes Eltern tatsächlich mit einem Ehepaar aus der DDR ins Gespräch, das auf demselben Platz herumstand.
Die Schucks, ebenfalls mit Sohn und Tochter, kamen aus einem kleinen Ort im Erzgebirge. Beide Eltern arbeiteten für die Reichsbahn. An diesem Sonntag waren sie zwei Stunden lang zu viert im Trabant durch halb Sachsen gegurkt, weiter als je zuvor. Um die sogenannte BRD endlich in Farbe zu sehen, die sie schwarz-weiß aus dem Westfernsehen kannten. Nette Leute, nett genug. Man übergab die Nutella. Per Handschlag wurde Patenschaft geschlossen, mitten auf einem bayrischen Feld im November. Dann mussten die Schucks weiter Richtung Regensburg, wahrscheinlich hupten sie bei der Abfahrt.
Später besuchten die Familien sich dann wirklich noch ein paarmal gegenseitig. Susanne erinnerte sich an den mittelgroßen Kulturschock, den sie als Teenager im Erzgebirge erlitt. An den Braunkohlegeruch, die Rumpelstraßen. An die Schwierigkeiten zu verstehen, was die Leute auf Sächsisch eigentlich von ihr wollten. Noch heute hat sie losen, wenn auch etwas seltsamen Kontakt zu den Schuck-Kindern. Kürzlich erst stellte ihr Tochter Jenny stolz den Ehemann Ronny vor, auf dem Münchener Oktoberfest. Er war natürlich ein feiner Kerl.
Das ist eine der idyllischeren Geschichten aus dem Mauerfallkomplex. Der Ärger ging dann ja früh genug los, und die meisten Oberpfälzer Bürger nutzten die Öffnung des Ostblocks mit einer völlig anderen Agenda. Zum Beispiel, indem sie noch öfter Ausflüge über die nahe tschechische Grenze machten, um drüben preisgünstig zu tanken, auf dem Vietnamesenmarkt einzukaufen oder zu hilfsbereiten Prostituierten zu gehen. Auch das war nun alles leichter als früher. Eine Familie, die Susanne kannte, fuhr extra hinüber, um billig Braten zu essen. Und ja, Susanne selbst fuhr ab und zu auch.
»Svatý Kříž« stand auf dem ersten Schild, das sie hinter der Grenze passierte. »Schöne Grüße« auf Tschechisch, ein Willkommen an die Besucher von der deutschen Seite, dachte Susanne. Jahre später erfuhr sie, dass die Aufschrift alles andere als ein schöner Gruß war. Sondern einfach der Name des tschechischen Ortes, in dem es die Tankstelle gab, den Friseur und wohl auch das Bordell. Svatý Kříž. Heiligenkreuz.
Am Ende ist es so selbstverständlich, dass man es sich kaum ernsthaft zu behaupten traut. Aber gut: Der Mauerfall, auch wenn er rund sieben Wochen vor Beginn der 90er-Jahre passierte, die deutsche Wiedervereinigung 1990, das Ende von Sowjetunion und Warschauer Pakt 1991 – das waren sie, die nachhaltigsten Buzz-Ereignisse des europäischen Jahrzehnts, vielleicht sogar des weltweiten. Die Zeitenwende, bequem am Anfang der Dekade platziert. Die globalgalaktische Plattenverschiebung. Der ultimativ anwendbare Bedeutungsträger. Die Weltgeschichte zum Anfassen, Bunt-Anmalen und Sich-Reinsetzen. Die Diplomatie des Emotionalen.
Jedenfalls sollte in den zehn folgenden Jahren wenig passieren, das durch die Revolutionen dieser stürmischen, von bebenden Megafonstimmen untertitelten Monate nicht irgendwie berührt, gefärbt, verändert oder relativiert wurde. Denn so ging es weiter: Erst trafen sich zwei Nationen, dann kamen noch ganz viele andere mit dazu. Bei der Loveparade tanzte die weltgemischte, lila-orangene Menge an der Westberliner Siegessäule zu den Platten der ostdeutschen DJs. Eheleute trennten sich, nachdem einer die Akten aus der Gauck-Behörde gelesen und den anderen als Bettspion der Stasi entlarvt hatte. Andere fanden sich, weil die Liebe nicht mehr am Stacheldraht hängen blieb. Schulbücher mussten neu geschrieben werden. Sektkellereien, Autohersteller und Sportmarken fanden viele, viele neue Zielgruppen. Wolfgang Lippert moderierte »Wetten, dass …?« neunmal. Nein, es war auch nicht alles schön.
Jan Ullrich aus Rostock gewann 1997 für das Team Telekom die Tour de France, als erster und immer noch einziger Deutscher. Die Ostberlinerin Franziska van Almsick schnappte sich 1994 bei der Schwimm-WM in Rom den Finalplatz der Quedlinburgerin Dagmar Hase und siegte mit Weltrekord. Knapp die Hälfte der Bundeswehrsoldaten, die ab 1999 in den Kosovo mussten, kam aus den neuen Bundesländern. Die ukrainischen Klitschko-Brüder wurden durch Boxkämpfe zu turbokapitalistischen Superhelden, ebenso Henry Maske aus Brandenburg, und dann holte die postsowjetische Republik Lettland im Jahr 2000 bei ihrer ersten Teilnahme auch noch den sensationellen dritten Platz beim Eurovision Song Contest in Stockholm. Das war schon nach dem Millennium. Aber wie gesagt, es ging ja immer, immer weiter.
Was machte eigentlich Beate Zschäpe, die spätere Hauptangeklagte im Prozess um die rechtsradikale Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, in diesen Tagen des Donners? Antwort: 1990 besuchte sie die staatliche Regelschule Johann Wolfgang von Goethe in Jena-Winzerla und rauchte, einem zeitgenössischen Farbfoto zufolge, die Marke Pall Mall.
Was machte Angela Merkel, die 2005 deutsche Bundeskanzlerin wurde? Sie arbeitete erst als Sachbearbeiterin, dann als Pressesprecherin für den Vorsitzenden der Partei Demokratischer Aufbruch, der später als Stasispitzel enttarnt wurde. Bei der ersten freien DDR-Volkskammerwahl im März 1990 erzielte die Partei mit 0,9 Prozent ein jämmerliches Ergebnis.
Und Lutz Bachmann, der 2014 einer der Initiatoren der Gruppe Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes war, kurz Pegida? Er bereitete sich in der Sporteliteschule Artur Becker in Dresden aufs Abitur vor. Und stand im August 1990 zum ersten Mal in Berlin vor Gericht, wegen Diebstahls. Das Verfahren wurde nach Jugendgerichtsgesetz ohne Strafe eingestellt.
Mein persönlicher Blick auf den großen Ost-West-Shake-up hatte sich von der Hinterbank eines süddeutschen Klassenzimmers aus entwickelt. Ein einziges Schuljahr lang hatten wir Mitte der 80er-Jahre so etwas wie politische Landeskunde gehabt (während die kleinen Genossen drüben von der Siebten bis zur Zehnten Staatsbürgerkunde lernten und hinterher wenigstens ihren Marx im Schlaf aufsagen konnten, so wie Sahra Wagenknecht). Ich erinnere mich genau, wie wir die Präambel des Grundgesetzes durchnahmen, den berühmten Satz, der längst nicht mehr dort steht: »Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.«
Unser Lehrer meinte, das sei ja alles schön und gut. Aber es müsse jedem klar sein, dass es sich hier um reine Utopie handle, um Manifestblabla, einen frommen Wunsch. Dass es zu unser aller Lebzeiten ganz sicher nichts mehr werden würde mit Einheit und Vollendung. Er war eigentlich ein guter Lehrer, ein Pullunderträger mit moderatem Bart, kein lilaköpfiger Altochse, auch keiner der Vollkornbrotreferendare, die Schüler zum Schachspiel herausforderten. Aber noch vier oder fünf Jahre vor dem Mauerfall brachte er uns bei, dass es keine Wiedervereinigung geben würde. Ich schrieb mit, es ging um die Lernzielsicherung. Könnte ja in einer Klassenarbeit gefragt werden: Hallo, Kinder, wie wahrscheinlich ist das Ende der DDR?
Mit Ersteindrücken von drüben war es damals ja schwierig, auch im Land der freien Presse. Das ARD-Fernsehen zeigte immer nur Erich Honecker. Ab und zu erzählte der ausgebürgerte Wolf Biermann irgendwas und zupfte dazu wild auf der Gitarre. Falls einmal echte DDR-Bürger zu sehen waren, sahen sie immer aus wie Rainer Werner Fassbinder, zumindest die Männer. So gesehen, hatte ich ein echtes Teenagerprivileg: Es gab einen gewaltigen Sachsen in meiner unmittelbaren Familienumgebung. Meinen Vater.
Seine Eltern waren schon während des Krieges aus Leipzig in die Nähe von Braunschweig gezogen. Dennoch war ein breiter Nachschub an Ostverwandtschaft sichergestellt. Und wenn nicht gerade mein Opa sein Wunderköfferchen voller Schokolade, Kugelschreiber und Jeanshosen packte und sich als spendabler Westonkel drüben empfangen ließ, kamen die Menschen aus der Deutschen Demokratischen Republik ganz einfach zu uns. Auch schon in den 70ern und 80ern. Wenn sie alt genug waren und einen halbwegs guten Ausreisegrund nennen konnten.
Ein extrem beliebter Anlass waren Beerdigungen. Als meine arme, liebe Großmama 1984 kurz vor Weihnachten nicht mehr aus dem Krankenhaus nach Hause zurückkehrte, bekamen wir pünktlich zu Bestattung und Heiligabend Besuch aus Sachsen: ihren wirklich sehr, sehr alten Bruder Ernst und seine unwesentlich jüngere Ehefrau Friedel. Mein Opa hatte schon angekündigt, dass die Schwippschwägerin »eine Linientreue« sei. Friedel sah dem damaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, verblüffend ähnlich. Ob es Zufall war oder sie sich absichtlich so gestylt hatte, traute ich mich nicht zu fragen.
Es kann gut sein, dass es an unserer gestörten Wahrnehmung lag. Dass wir westarrogant davon ausgingen, das alte DDR-Ehepaar müsse demütig und dankbar dafür sein, dass wir ihm eine so selige schwäbische Weihnacht bereiteten. Es lief nicht so. Friedel und Ernst ließen sich von vorn bis hinten bedienen, stellten allerhand unverschämte Forderungen. Priesen in Tischgesprächen den Sozialismus und kosteten erstaunlicherweise trotzdem die staatlich tolerierte Westbesuchszeit bis zum letzten Hauch aus.
»Schmeckt gut«, sagte Friedel über das Festtagsessen meiner Mama. »Aber ich koch anders.«
1984 war im Übrigen auch das Jahr, in dem die erste größere Welle an Botschaftsbesetzungen losging. Während wir uns heimlich im Zimmer meiner Schwester zum Familienrat trafen und mit gedämpfter Wut über Ernst und Friedel schimpften, waren in der ständigen bundesdeutschen Vertretung in Prag vierzig Ostflüchtlinge in den Hungerstreik getreten. Meine Mutter nahm die Tageszeitung vom Bett, las laut die Aufmacherzeile vor: »Genscher rät DDR-Bürgern zur Rückkehr«. Selten hatten wir alle eine Überschrift so von ganzem Herzen unterstützt.
Die Flüchtlinge von ’84 mussten heimkehren. Friedel und Ernst am Ende auch. Knapp fünf Jahre sollte es noch bis zu Hans-Dietrich Genschers berühmter Balkonrede dauern, ebenda im Prager Palais Lobkowitz. Nacht, Blendlicht, Brillen, Megafon. »Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise …« Taumel. Freiheit für 4000 Wartende. Schon das hätte sich mein wackerer Landeskundelehrer im Traum nicht vorgestellt.
Warum sich Mauerfall, Wiedervereinigung und die Entgrenzung des Ostblocks wie ein solcher Weltbildersturm anfühlten, warum sie uns und unser ganzes gelerntes Verständnis von Geschichte einmal quer verknoteten? Genau deshalb – weil sie das faktisch Unmögliche von gestern auf heute möglich zu machen schienen. So einfach. Wie ein unfassbarer Plottwist gegen Ende einer tausendfach bekannten Handlung. Als ob auf Manfred Krugs Baustelle im Film »Spur der Steine« – dem großartigen DEFA-Spielfilm von 1966, der damals verboten wurde und erst 24 Jahre später, im Mai 1990, so richtig in die Kinos kam – in allerletzter Minute doch noch ein glänzender Coca-Cola-Truck voller Rohziegel, Fensterglas und Verbundschaum eingerollt wäre. Wie ein phänomenaler Endspurtsieg von Gerechtigkeit über Recht.
Natürlich musste schon damals jedem halbwegs Vernünftigen klar sein, dass die Ereignisse von 1989 bis 1991 nur als Melange aus stoischer, undankbarer Aktivistenarbeit und einer Menge machtpolitischem Herrschaftskalkül möglich waren. Als Ergebnis von Hinterbänklereien, vielen langen Staatsmännerspaziergängen in Strickjacken und symbolischen Opfergesten. Und dass es die Wiedervereinigung als den einen, weithin sichtbaren, historisch-dramatischen Wetterblitz niemals gab. Sondern nur als Summe aus Millionen individueller Geschichten. Von denen viele eben alles andere als euphorisch verliefen.
Und doch, trotzdem: Wer diese Tage hellwach erlebt hat, mit circa einer Revolution pro Minute, dem muss man rückblickend verzeihen, wenn es ihm kurz ein Flattern ins Herz setzte. Wenn er sich damals doch ein bisschen frühlingsfrisch, naiv und schlicht optimistisch fühlte.
Was macht der Leipziger im Sexshop? Beste Aussichten und schlechte Witze
Wenige Jahre zuvor hatten ja viele noch dieses Grummeln gefühlt. Die komische Ahnung, das Ende der Welt könnte nahe herbeigekommen sein. Der baldige Tod im atomaren Regen. Oder das ewige Leben mit altem Dosenglibberfleisch und noch älteren Fix-und-Foxi-Heften im Strahlenschutzbunker. Das Nuklearschlagsdrama »The Day After« von 1983 gilt mit über 100 Millionen Zuschauern noch heute als der erfolgreichste Fernsehfilm der amerikanischen Geschichte. Jedes Kind konnte damals mit Wachsmalkreiden Atompilze malen.
Jetzt, 1989 und danach, las man wieder die Zeichen der Zeit, die neuen Zeichen. Und konnte plötzlich ganz ernsthaft glauben, dass die Weltgeschichte knapp vor der Schlucht noch den entscheidenden Haken geschlagen habe und Richtung Sonne abgezischt sei. Dass sie im Großen und Ganzen eben doch auf eine Art von humanistischer Perfektion zulief, auf Demokratie, freie Marktwirtschaft, Freiheit, solches Zeug. Und dass die Botschaft früher oder später auch noch an den Orten ankommen würde, in Iran oder Nordkorea, die noch nicht so sonderlich erleuchtet wirkten. Eine flauschigere, T-Shirt-taugliche Version von dem, was der US-Politologe Francis Fukuyama mit seiner berühmten These vom »Ende der Geschichte« meinte.





























