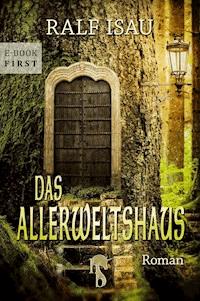
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks: e-book first
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Täglich verschwinden Menschen, wie vom Erdboden verschluckt. So wie Jan und Lisa. In einer nasskalten Nacht entdecken die Geschwister ein geheimnisvolles Haus. Es steht zwischen zwei Gebäuden, wo lang nur eine Lücke klaffte. Das Allerweltshaus ist groß wie eine Welt. Es wächst immerfort wie ein uralter Baum. Und es verfolgt einen bösen Plan. Auch Lisa lässt sich von ihm blenden. Um als Musikerin die Welt zu erobern, bricht sie hinter sich alle Brücken ab. Auf Irrwegen aus Raum und Zeit folgt Jan ihrer Spur, um sie vor dem Preis des Ruhms zu retten, der ihr Leben bedroht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ralf Isau
Das Allerweltshaus
Roman
»Was ihr den Geist der Zeiten heißt, Das ist im Grund der Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln.« Johann Wolfgang von Goethe, »Faust« Für Olivia Leonie
Die Wehen
Die Nachtweys waren eine Musikerfamilie. Mutter Nachtwey blies als Musiklehrerin pickligen Gymnasiasten den Marsch, Vater Nachtwey spielte die erste Geige in der Einkaufsabteilung der Elbstätter Oper, Lisa Nachtweys Gesang übertönte jedes Klavier und Jan Nachtwey war ein Querkopf – er spielte Querflöte.
An diesem Dienstagnachmittag gab Jans Mutter den Ton an. Julia schrie aus Leibeskräften, forte fortissimo sozusagen. Ihre Stimme hallte von einem bis zum anderen Ende der großen Dachgeschosswohnung. Sie scholl bis in den Keller des hundert Jahre alten Hauses hinab. Einige Bewohner des Viertels hörten sie sogar weit über die Halbkreisstraße hinaus.
Der Grund für ihr Geschrei war ein Ausnahmezustand, den sie bisher erst zweimal durchlebt hatte: Geburtswehen. Bald würde das Nachtweyorchester aus fünf Musikern bestehen.
Die übrigen Mitglieder des Quintetts eilten aus unterschiedlichen Richtungen herbei und stürzten ins Wohnzimmer. Julia lag wie ein gestrandeter Wal im Fernsehsessel, das Fußteil hochgeklappt, den Oberkörper weit nach hinten gelehnt, den enormen Bauch nach oben gereckt und die Hände um die Lehnen geklammert. Sie atmete geräuschvoll und rhythmisch, wobei sich ihre Wangen blähten wie Spinnakersegel bei einer Regattajacht.
»Ist die Fruchtblase geplatzt?«, stieß Jans Vater hervor. Eine ungeknotete Krawatte hing ihm um den Hals. In der Rechten hielt er sein kleines, schwarzes Notizbuch, um den Vorfall nötigenfalls zu protokollieren. Bastian Nachtwey lebte in ständiger Angst, etwas Wichtiges zu vergessen. Deshalb schrieb er alles auf, mit Datum und genauer Uhrzeit.
»Nein«, keuchte Julia, »aber besser, wir fahren trotzdem prestissimo ins Krankenhaus.« Sie meinte, sehr schnell.
»Soll ich den Rettungssanitäter kontaktieren?« Bastian löste den Gummi von dem Büchlein und begann darin zu blättern, vermutlich, um die Notrufnummer herauszusuchen.
»Ich bin nicht krank, nur schwanger «, antwortete Julia gereizt. Sie hatte die Zähne zusammengebissen und schwitzte.
Jans Vater fuhr sich mit den Fingern durch den üppigen Schopf und starrte Julia an, als könnte sie jeden Moment explodieren. Bastian war ein aschblonder Enddreißiger, der versuchte, mit einem Dreitagebart von seinen körperlichen Unzulänglichkeiten abzulenken: dem Schmerbauch und der unterdurchschnittlichen Körpergröße. Im Augenblick wirkte er nicht sonderlich souverän. Die Geburt von Lisa Luisa lag schon vierzehn Jahre zurück, die von Jan sogar sechzehn. Bastians Erfahrungen im Umgang mit Gebärenden waren also nicht auf dem neuesten Stand. Der unstete Blick aus seinen graublauen Augen verriet Hilflosigkeit.
»Du musst Mama in die Klinik fahren. Hol den Wagen aus der Garage. Wir passen so lange auf sie auf«, schlug Jan vor.
»Exzellente Idee!«, antwortete Bastian. Er hatte ein Faible für unnötige Fremdwörter. Kurz sah er auf sein Notizbuch, als spielte er mit dem Gedanken, die Vorgehensweise schriftlich festzuhalten, lief dann aber doch aus dem Zimmer.
»Ach, manno!« Lisa stampfte mit dem Fuß auf wie eine Vierjährige. »Das ist ungerecht. Hätte sie nicht bis morgen warten können!« Sie meinte vermutlich ihre ungeborene Schwester.
Ist ja mal wieder typisch!, dachte Jan. Unsere Diva denkt immer nur an sich. Lisa träumte davon, als Künstlerin unsterblich zu werden. Sie plante eine Karriere als Popstar. In jedem Auftritt vor Publikum sah sie ein mögliches Sprungbrett, das sie im Musikhimmel gleich neben Madonna und Katy Perry katapultierte. Zugegeben, sie war mit vierzehn schon eine bessere Pianistin als ihre Mutter und sang wie eine junge Liza Minelli – die Namensähnlichkeit war kein Zufall.
In Sachen Ehrgeiz war Lisas Bruder das genaue Gegenteil. Jan hätte sich damit begnügt, zur Hundertjahrfeier des Goethegymnasiums eine einzige Person zu begeistern: seinen Vater. Wenigstens einmal sollte er stolz auf ihn sein. Dafür hatte Jan wochenlang die schwierigen Läufe auf der Querflöte geübt. Und nun stahl ihnen ein ungeborenes Baby die Show.
»Ihr könnt trotzdem zur Schulaufführung gehen«, ächzte Julia. »Bei dir haben die Wehen neunzehn Stunden gedauert, und bei deinem Bruder waren’s sogar fast vierundzwanzig.«
»Supi!« Lisa fiel Mutter um den Hals und küsste sie stürmisch. »Das vergesse ich dir nie, Mom. Wenn ich meinen ersten Grammy kriege, bedanke ich mich zuerst bei dir. Eine Milliarde Menschen werden dich bewundern.«
»Dann nimm aber die Zahnspange raus, Primaballerina. Ach, und geh heute mal sparsamer mit meinem Make-up um.«
Jan grinste. Seine kleine Schwester musste ständig gebremst werden, weil sie sich in puncto Klamotten und Schminke gerne auf Kindfrau trimmte.
Trotzig verdrehte Lisa die Augen. »Du nervst, Mom!«
»Sag nicht dauernd Mom zu mir. Ich bin keine amerikanische TV-Serien-Glucke …« Julia stöhnte auf. Eine neue Wehe.
Sie hechelte noch gegen die Schmerzen an, als Bastian ins Wohnzimmer zurückgekehrte. Keuchend berichtete sie ihm, was sie mit den Kindern besprochen hatte. Er war viel zu nervös, um Einwände zu erheben.
»Nehmt Mamas Handy mit«, sagte er zu Jan. »Sobald das Konzert zu Ende ist, rufst du mich auf meinem an. Sollte es irgendwie gehen, hole ich euch von der Schule ab.«
»Besser an der Bushaltestelle bei der Bombenlücke. Müssen ja nicht alle sehen, dass wir ins Auto der Stimmgabel steigen.« Seine Mitschüler hatten ihr diesen Spitznamen verpasst.
Julia gab ein Knurren von sich. »Was habe ich nur falsch gemacht, dass meine Kinder mich nicht Mama nennen!«
»Und noch etwas, Jan«, fügte Vater unbeirrt hinzu. »Du bist mir für deine Schwester verantwortlich. Nach der Aufführung wird nicht Party gemacht, hört ihr? Setze dich einmal gegen Lisas Dickkopf durch und sei der große Bruder, auf den wir uns verlassen können.«
Komplikation! Das Wort hallte wie ein Echo durch Jans Sinn. Immer wieder. Hoffentlich ging alles gut mit der Entbindung. Gedankenvoll blickte er durch das beschlagene Fenster des Stadtbusses. Trotz des Feierabendverkehrs war nicht viel los auf den Straßen. Seltsam. Gab’s heute irgendein Fußballspiel? Saßen die Leute vor der Glotze?
Seine Schwester sang leise vor sich hin: »Yesterday a child came out to wonder …« Das Lied – The Circle Game von Joni Mitchell – hatte Mutter ihnen beigebracht, als sie noch klein waren. So sanfte Töne hörte man eher selten von Lisa. Manchmal beschallte sie mit ihren rockigeren Songs ganze Straßenzüge oder Einkaufspassagen. Anscheinend machte sie sich doch Gedanken über ihr neues Schwesterchen.
Bei der nächsten Station hieß es aussteigen und die Nase in den Regen recken. Der Herbst war in diesem Jahr wie ein Raubtier über Elbstadt hergefallen: unerwartet und brutal. Zum gestrigen Schulbeginn, dem 10. September 2001, hatte der Sommer noch ein glanzvolles Abschiedskonzert gegeben. In der Nacht war dann der Wetterumschwung gekommen. Jan wäre am liebsten ins Bett zurückgekrochen, als er morgens beim Aufstehen das neblige und nasskalte Wetter gesehen hatte. Tagsüber war es nicht mal richtig hell geworden.
Und nun nieselte es auch noch, als sie an der Bombenlücke ausstiegen. Ein beißender Sturm wirbelte die feinen Tröpfchen auf wie Gischt in einem Wasserfall. Lisas Gesicht schimmerte als bleiches Oval unter ihrer Kapuze hervor. Die Geschwister trugen Regenjacken – ihre war rot, seine blau. Trotzdem kroch die Feuchtigkeit überall hinein.
Jan drückte sich den Flötenkoffer an die Brust. »Müssen wir wirklich auf Kevin warten?« Kevin Holzmann war in der Klasse über ihm und haute nicht nur im Schulorchester ordentlich auf die Pauke. Er war ein Hardrocker mit Engelsgesicht, der sich unwiderstehlich vorkam. Lisa schwärmte für ihn.
»Ja«, antwortete sie. »Wir haben uns hier verabredet.«
»Vor zehn Minuten. Er müsste längst da sein.«
»Bei dem Wetter?« Sie machte Anstalten, ihren Regenschirm aufzuspannen.
»Das kannst du vergessen, ist viel zu windig«, sagte Jan.
Sie ignorierte ihn und versuchte es trotzdem.
Augenblicklich fuhr eine Bö unter den Schirm und drehte ihn auf links. Ein zweiter Windstoß riss ihn ihr aus den Händen. »Mist!«, zischte sie.
Jan stöhnte. Setze dich einmal gegen Lisas Dickkopf durch . Vaters Ermahnung lag ihm schwer im Magen. Er wusste nicht, wie er seine quecksilbrige Schwester bändigen sollte. Jan war ein Träumer, der sich von strengen Regeln und sturer Pflichterfüllung eingeengt fühlte. Deshalb wollte er auch keinem anderen seinen Willen aufdrängen. Bei verrückten Einfällen dagegen und bei allem, was ihn faszinierte, da blühte er auf, da vergaß er sich und die Welt.
Und viel zu oft auch Vaters Anweisungen.
Kein Wunder, dass er mit ihm unzufrieden war, so oft, wie er ihn mit seiner Traumtänzerei schon enttäuscht hatte. Scheinbar fehlte ihm das, was einen guten Sohn ausmachte. Manchmal kam sich Jan wie ein richtiger Versager vor.
Aber diesmal wollte er sich nichts vorwerfen lassen. Er hatte seinem Vater hochheilig versprochen, auf die Diva aufzupassen.
»Was hat Mom im Hausflur zu Dad gesagt?«, lispelte Lisa. Ihre Zunge focht einen ständigen Kampf gegen die Zahnspange.
»Woher soll ich das wissen?«, brummte Jan.
Sie zog das Kapuzenband nochmals fester, um die Konzertfrisur trocken zu halten. »Du bist Lippenleser.«
Das stimmte. Im Alter von drei hatte ihm eine Krankheit das Gehör genommen. Vierzehn Monate lang sperrte sie Jan in das Verlies der Stille. In dieser Zeit lernte er, mit den Augen zu hören. Er musste dem Sprecher nur auf den Mund schauen und verstand alles, inzwischen sogar in Englisch oder Französisch. »Ich hatte zu spät hingesehen. Hab nur noch ein Wort mitbekommen«, antwortete er.
»Und welches?«
»Komplikation.«
Ihre vollen Augenbrauen zogen sich zusammen. »Denkst du, wir müssen uns um Mom Sorgen machen? Oder um das Baby?«
»Sie meinte bestimmt nur die Heftigkeit der Wehen.« Jan sagte, was er sich wünschte, nicht, wovon er überzeugt war. Sein Blick schweifte über Lisas Schulter hinweg zu der Bombenlücke, diesen unkrautüberwucherten Streifen zwischen den zwei Gebäuden aus der Gründerzeit. Es hieß, dort hätte früher ein hübsches Jugendstilhaus gestanden, ähnlich jenem, in dem die Nachtweys wohnten. Als die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die Stadt bombardierten, wurde nur dieses Juwel von Haus getroffen, die beiden Bruchbuden rechts und links davon blieben stehen. Seitdem klaffte hier die Bombenlücke. Bis jetzt.
Jan riss die Augen auf. In der wirbelnden Gischt sah er auf einmal Teile einer seltsamen Fassade. Da waren Rundbögen, Spitzgiebel, Säulen, Holzbalken, Stuck und anderes, das so gar nicht zueinanderpassen wollte … Und plötzlich verschwand alles wieder.
»Was glotzt du so?«, beschwerte sich Lisa.
Er blinzelte. »Nichts. Ich dachte nur gerade eben …« Unvermittelt hob ein Windstoß den Nebel wie einen Bühnenvorhang empor und zum Vorschein kam das ganze verwunderliche Gebäude. Jan deutete aufgeregt darauf. »Da! Seit wann steht da ein Haus?«
Lisa drehte sich um und stutzte. »Sieht ja echt schräg aus. Ist mir auf dem Schulweg heute früh gar nicht aufgefallen.«
»Wahrscheinlich, weil du nur Augen für diesen schwarzen Engel Kevin Holzmann hattest.«
Sie strafte seine Bemerkung mit Nichtachtung und lief auf das sonderbare Gebäude zu.
Jan stolperte hinterher. »Ich finde, wir sollten jetzt gehen. Sonst verpasst du doch noch deinen historischen Auftritt.«
Lisa überhörte auch diesen Hinweis und murmelte nur: »Was ist das? ’Ne Disco?«
»Seltsamer Name für ’nen Tanztempel.« Er deutete zu dem goldenen Schriftzug über dem Eingang.
SUUM CUIQUE
»Jedem das Seine?«, übersetzte Lisa.
Er nickte. In der Schule hatten sie nur Englisch und Französisch, aber kein Latein. Seltsam, dass sie den Spruch trotzdem verstanden. Er klang ebenso geheimnis- wie verheißungsvoll. Vielleicht kannten sie ihn aus einem Film.
Lisa stieg die drei Stufen zum Eingang hinauf und streckte die Hand nach der Türklinke aus.
»Du kannst da nicht einfach …« Jan stöhnte. Die Diva behandelte ihn wie Luft. Sie öffnete die Tür, die wie ein Kontrabass geschwungen war und grauenhaft quietschte. Dahinter lag ein glitzernder Gang.
»Hmmm, lecker! Riecht nach Himbeergeist.« Ohne auch nur einmal zu zögern, betrat Lisa das Haus.
Jan konnte die Tür gerade noch am Zufallen hindern. Er blickte in den beleuchteten Korridor, der rund wie ein Abwasserrohr war. Setze dich einmal gegen Lisas Dickkopf durch …
»Cool!«, schwärmte sie und lief weiter. »Echt futuristisch der Laden. Scheint wirklich ’ne Disco zu sein. Komisch, dass wir nie eine Baustelle gesehen haben.«
»Was soll das?« Zeternd klemmte Jan den schwarzen Flötenkoffer in den Türspalt und eilte seiner Schwester nach. Jetzt roch auch er dieses schnapsige Aroma von Obstbrand.
Die untere Hälfte des metallenen Gangs war staubig und voller Kratzer. Oben dagegen bestand er aus Plexiglas. Jenseits davon leuchtete ein Geflecht von Röhren. Scheinbar schwerelos hingen sie in einem Raum, in dem sich ihr Licht verlor so wie das der Sterne in der Unendlichkeit des Universums. Die leuchtenden Stränge waren untereinander verbunden wie dicke Fäden eines riesigen Spinnennetzes. Erstaunlich weit sie in das Dunkel vordrangen.
Vermutlich eine Art Irrgarten, überlegte Jan. Das Ganze wirkte einerseits modern, andererseits schmutzig und schäbig wie das Innere eines maroden Raumschiffes in einem düsteren Science-Fiction-Film. »Hier ist keine Menschenseele, Lisa. Lass uns gehen. Sonst verpassen wir das Konzert.«
»Ich möchte nur noch schnell …«
»Vielleicht ist jemand von einer Plattenfirma da«, fiel er ihr ins Wort. Irgendwo bellte ein Hund.
Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um. »Du willst mich ja nur ködern.«
»Stimmt. Aber du weißt, was die Zeitungen über unser Schulorchester schreiben. Mama hat eine richtige Big Band draus gemacht. Eine gute Presse lockt Talentscouts an.«
Lisa grinste. »Du hast recht. Gehen wir.« Sie stapfte an ihm vorbei auf den Ausgang zu.
Er folgte ihr, erleichtert, das Temperament der Diva wenigstens vorübergehend gebändigt zu haben. Von der Straße drang erneut das helle Bellen zu ihnen herein. Jan malte sich aus, wie der dazu passende Hund aussehen mochte. Rehpinscher? Zwergspitz?
Als Lisa die Tür aufriss, quietschte diese wie unter Schmerzen. Jan erhaschte einen Blick auf einen windzerzausten Kläffer. Ein kleiner weißer Terrier.
»Warte, Brutus! Bei Fuß!«, hallte es von rechts. Ein schlanker Mann mit wehendem Regenmantel und skelettiertem Regenschirm rannte dem Westie hinterher. »Ich muss doch zum Dienst, Brutus. Verdammter Köter, bleib endlich stehen!« Der Hundebesitzer entschwand in den Nebelschwaden. Bald war sein Rufen nicht mehr zu hören.
»Schauen wir später noch mal rein, falls Dad nicht rechtzeitig da ist?«, fragte Lisa. Sie deutete mit dem Daumen hinter sich.
Jan zog nur eine Grimasse. Er hoffte, darum herumzukommen. Das Haus gefiel ihm nicht.
Die Erschütterung
Atárah fuhr der Schreck in die Glieder. Abwesend hatte er sich mit dem Pinselstil unter dem Zylinder gekratzt. Fast wäre er ihm dabei vom Kopf gerutscht. Rasch rückte der hagere Mann den samtig schwarzen Chapeau claque wieder zurecht. Im Allerweltshaus tat man gut daran, seine Kopfbedeckung niemals abzunehmen. Selbst beim Schlafen nicht.
Der Magistrat wandte sich wieder dem Bild zu. Behutsam tupfte er mit dem feinen Pinsel auf die Leinwand, um einen letzten Glanzpunkt zu setzen. Dazu summte er leise vor sich hin. Atárah hatte viel freie Zeit, die er auf diese Weise den schönen Künsten widmete. Bedächtig trat er einen Schritt von der Stafette zurück und begutachtete sein Werk.
Das Ölgemälde zeigte einen Helm, wie ihn die spanischen Konquistadoren bei der Eroberung der Neuen Welt getragen hatten. Stimmung, Proportionen, Licht und mehr noch die Schatten – alles war perfekt. Rembrandt hätte es nicht besser machen können. Ein Gefühl des Glücks erfüllte den uralten Hüter, weil er nur aus dem Gedächtnis etwas so Vollkommenes wiedererschaffen hatte. Andere Künstler hätten in diesem Moment zufrieden gelächelt. Nicht er. Atárah lächelte nie. Er verzog höchstens den Mund.
»Globalisierung«, murmelte er. Ja, so würde er sein neues Meisterwerk nennen. Bei der Wahl seiner Titel hielt er sich an den Zeitgeschmack. Mit einem Anflug von Besorgnis blickte er über den Rand des Gemäldes hinweg und fragte sich, wo er es aufhängen sollte.
In das Atelier hätte mühelos ein Zeppelin hineingepasst. Seine Bilder bedeckten die Wände der riesigen Halle bis hinauf zu dem verglasten Oberlicht. Er hatte die Kunstwerke ausnahmslos seiner großen Leidenschaft gewidmet: Kopfbedeckungen.
»Warum ausgerechnet ein Soldatenhelm?«, tönte eine Stimme durch die Künstlerwerkstatt. Sie klang voll und befehlsgewohnt.
Atárah zog erschrocken den Kopf ein, fast wie eine Schildkröte. Er wandte sich der Mitte des Ateliers zu.
Dort thronte auf einem mannshohen Sockel ein tönernes Haupt, das ihn hämisch angrinste.
Gesprächige Büsten dieser Art gab es im Allerweltshaus zu Tausenden. Sie dienten Hauron als Mund, Augen, Ohren und Nase. Ihm entging so gut wie nichts. Die Terrakottabüsten zeigten Hauron, wie er in der Antike als Herrscher von Damaskus ausgesehen hatte: vollbärtig, mit einer gebogenen Nase, tief liegenden Augen, buschigen Brauen, dicken Lippen und einem topfartigen Hut, der ringsum mit Sternen verziert war und in einer gezackten Krone endete.
»Ich finde, der Konquistadorenhelm veranschaulicht treffend die Globalisierung. Die iberischen Eroberer haben dem heutigen weltweiten Handel den Weg geebnet«, dozierte Atárah wie ein moderner Kunstprofessor. In seinem schwarzen Frack sah er eher wie ein Gelehrter des 19. Jahrhunderts aus.
»Indem sie fast alle ausrotteten, die nicht spanisch oder portugiesisch waren?«, fragte Hauron spöttisch.
»Sie haben auch von der Neuen Welt profitiert: Gold, Kakao, Mais, Kartoffeln …«
»Du hast recht, Atárah. Dein Helm ist ein passendes Symbol für die Ausplünderung, Unterdrückung und Zerstörung schwacher Kulturen. Ich würde mir deine Lektion liebend gern zu Herzen nehmen – wenn ich denn eins hätte.«
»Danke, Hoheit. Ihr seid zu gütig.«
»Womit wir beim Thema wären.«
»Ich kann Euch leider nicht folgen, Majestät.«
»Einige von denen, die sich ausgeraubt und geknebelt fühlen, haben heute zum Schwert gegriffen. Während du hier deinem Vergnügen gefrönt hast, sind sie gegen ihre Unterdrücker aufgestanden?«
Atárah stöhnte. »Etwa wieder eine Revolution? Das ist doch ein alter Hut, Hoheit. Euer Haus wird dem Vorfall nicht einmal mehr eine neue Besenkammer widmen, so oft hat es das schon gesehen.«
»Wenn du dich da mal nicht täuschst, mein Guter. In der Stadt, die sie ›den großen Apfel‹ nennen, ist heute etwas von solcher Brutalität geschehen, dass sogar mir ein Schauer durch sämtliche Etagen gelaufen ist – und ich bin beileibe nicht zimperlich.«
»War das der Grund für das Beben? Ich dachte, Ihr hättet nur schlecht geschlafen.«
»Ich schlafe nie, wie du nur zu gut weißt. Ich döse höchstens. Nein, Terroristen haben fliegende Maschinen in zwei Türme gelenkt. Sie sind darauf eingestürzt wie Kartenhäuser und begruben Hunderte Menschen unter sich. Wann töteten angebliche Freiheitskämpfer jemals so wahllos und grausam, Atárah? Dir ist doch klar, was das bedeutet.«
»Das Haus wird wachsen.« Der Magistrat griff zum Lappen und fing an, seinen Pinsel zu reinigen.
»Und das nicht zu knapp! Das Pendel schwingt zurück, der Zeitgeist wandelt sich«, sagte Hauron feierlich. »Du wirst sehen, der heutige Tag teilt die Geschichte in ein Vorher und ein Nachher. Wo Menschen sich einmal sicher fühlten, bleibt ihnen nur noch Angst und Bangen vor dem nächsten Anschlag. Stück für Stück werden sie ihre mit Blut erkämpfte Freiheit aufgeben, um sich ein wenig Sicherheit zu erkaufen. Solche Erschütterungen bleiben nicht ohne Folgen für das Allerweltshaus.«
»Ihr meint … es könnte sichtbar werden?«
»Irgendwo ganz bestimmt. Wir müssen auf der Hut sein, Atárah. Vielleicht dürfen wir den Auserwählten empfangen, der mir die Königskrone bringt.«
»Spürt Ihr sie denn schon?«
»Nein. Dann hätte ich dich längst zu ihr geschickt. Doch es werden sich viele Türen öffnen.«
»Das heißt, es kommt Arbeit auf mich zu.«
»Darauf kannst du deinen Zylinder verwetten.«
Atárah lächelte säuerlich. »Alles, nur nicht das, Majestät.«
Das Allerweltshaus
Sämtliche Fenster des Goethegymnasiums waren dunkel, alle Türen verschlossen. Am Hauptportal hing eine in Plastikfolie verpackte Mitteilung:
Liebe Besucher der Hundertjahrfeier!
Wegen des Terroranschlags auf die Zwillingstürme des New Yorker Welthandelszentrums fällt die heutige Jubiläumsveranstaltung aus. Wir wollen uns von den Terroristen nicht in die Knie zwingen lassen, doch die Achtung vor den Opfern gebietet uns einen Abend stillen Gedenkens.
Die Schulleitung
Elbstadt, 11. September 2001
Lisa stampfte mit dem Fuß auf. »Verdammter Mist!«
Jan sah sie fassungslos an. »Hallo-o! Hast du noch alle Tassen im Schrank? Wie kannst du an deinen Auftritt denken, wenn da Menschen umgekommen sind?«
»So schlimm wird’s schon nicht gewesen sein.«
»Meinst du, die sagen das Konzert ab, weil sich ein paar Leute das Knie aufgeschürft haben?«
»Weiß ich doch nicht.« Lisa fuhr beleidigt herum und stapfte die Freitreppe hinunter.
Jan warf einen letzten Blick auf den Anschlag und eilte ihr hinterher.
Schweigend liefen sie durch den dichten Nebel zur Bushaltestelle zurück. Die Straßen waren menschenleer. Wahrscheinlich verfolgte die ganze Stadt die Berichterstattung über den Terroranschlag. Schneidend kalter Wind blies ihnen ins Gesicht. Wenigstens ließ der Nieselregen nach, bis er nahe der Bombenlücke schließlich vollends versiegte.
»Du nimmst das mit deiner Musikerkarriere viel zu ernst«, wagte Jan anzumerken.
»So eine Karriere kann man gar nicht ernst genug nehmen«, versetzte Lisa schnippisch.
»Lieber ein Kleinkünstler mit Herz als ein herzloses Kleinhirn – so wie Kevin Holzmann.« Den Nachsatz bereute Jan, kaum dass er ihn ausgesprochen hatte.
Lisa blieb zehn Meter vor der Haltestelle wie festgetackert stehen, stemmte ihre Fäuste in die Seiten und funkelte ihn wütend an. »Du hast ja keine Ahnung. Kevin spielt jetzt in einer Rockband.«
»Als Pausenclown?«
»Als Schlagzeuger. Er sagt, ich habe Talent und soll auch mit einsteigen.«
»Als sein Groupie, oder was?«
»Spinnst du? Natürlich als Sängerin, du Pfeife.« Ihre abfällige Anspielung auf seinen Spitznamen Whistler sollte ihm wehtun. Derlei Gemeinheiten waren ihre Art, sich zu verteidigen.
Jan gab sich unbeeindruckt. »Bald ist der Sitzenbleiber achtzehn. Dann kommt er in den Knast, sobald er dir an die Wäsche geht.«
»Was weißt du denn schon? Kannst ja nicht mal telefonieren. Bin gespannt, was Dad dazu sagt.«
Jan schluckte. Jetzt hatte das kleine Biest ihn doch noch erwischt. Er hätte längst seinen Vater anrufen sollen. Wütend holte er Mutters Handy aus der Jackentasche, sah auf das Display und stöhnte. »Kein Netz. Muss das Wetter sein.«
Lisa schnaubte. »Na toll! Der nächste Bus kommt in ’ner halben Stunde.« Ihr Blick wanderte an Jan vorbei zur Bombenlücke. »Ich frier mir hier nicht den Hintern ab.«
Ehe er sichs versah, war die Diva an ihm vorbeigerauscht. Er drehte sich nach ihr um – und erschauerte.
Das eigentümliche Haus hatte er völlig vergessen. Es schien regelrecht aus dem Nebel hervorzutreten, so als wolle es ihn willkommen heißen. Raffinierter architektonischer Trick, dachte er.
Und Lisa fiel darauf herein. Sie marschierte geradewegs auf den Eingang zu, über dem die goldenen Worte prangten: SUUM CUIQUE – »Jedem das Seine«.
Jan zögerte. Er war stocksauer auf sie. Sein Blick wanderte an der Flickenteppichfassade empor. Im Licht der Straßenlaterne wirkte das Sammelsurium unterschiedlichster Stilrichtungen noch bizarrer als zuvor. Erker und Türmchen klebten ohne erkennbare Ordnung an den Wänden oder ragten vom Dach in den sternenlosen Abendhimmel auf. Dämonische Wasserspeier und geheimnisvolle Figuren sahen aus luftiger Höhe auf die Geschwister herab. Auf einmal kam ihm die Inschrift über dem Portal wie eine Drohung vor.
Schnurstracks stieg Lisa die Eingangstreppe hinauf. Der Begriff »Hausfriedensbruch« schien in ihrem Wortschatz nicht vorzukommen.
»Bleib weg von dem Haus!«, warnte Jan sie und lief ein paar Schritte darauf zu. Es war ihm nicht geheuer. Wie ein Flugzeugeinweiser auf dem Rollfeld winkte er mit seinem Flötenkoffer.
Lisa war schnurzpiepegal, was ihr großer Bruder verlangte. Sie ließ sich von niemandem umdirigieren. Lachend zog sie die Tür auf, trat hindurch und verschwand.
Jan stand einfach nur da und starrte wütend auf das wie ein lebendiges Wesen quietschende Portal, das sich langsam schloss. Sein Vater hatte den Dickkopf der Diva unterschätzt. Ein Sack Flöhe war leichter zu hüten als sie.
Als die Tür geräuschvoll zuschlug, zuckte er zusammen. Er hörte ein Seufzen. War das der Wind? Jan bekam eine Gänsehaut. Irgendetwas an dem Haus jagte ihm eine Furcht ein, wie er sie noch nie verspürt hatte. Ein kaltes Grauen, das sich einem unter die Haut schob wie eine eisgekühlte Rasierklinge.
Er wartete. So blöd konnte Lisa gar nicht sein. Ihre Naivität war nur eine Masche. Für die Schule lernte sie fast nie und schrieb trotzdem lauter Einser. Früher oder später musste ihr doch aufgehen, dass ihr Bruderherz draußen stand und sich Sorgen um sie machte.
Aber sie kam nicht mehr heraus.
Sei der große Bruder, auf den wir uns verlassen können. Vaters Ermahnung wiederholte sich in Jans Kopf in einer Endlosschleife. Minuten verstrichen, in denen er dem Band zuhörte und mit seiner Angst rang. Irgendwann fluchte er leise, lief zur Tür, riss sie auf, stürzte beherzt hindurch. Und während sie sich quietschend hinter ihm schloss, starrte er ungläubig auf das, was vor ihm lag.
Der Geruch nach Himbeergeist war immer noch da. Ansonsten hatte sich das Haus stark verändert. Die Plastikröhren, die ihn an ein Spinnennetz erinnert hatten, waren verschwunden. Nun stand er am Anfang eines hohen, bernsteinfarben beleuchteten Korridors von unvorstellbarer Länge – aber menschenleer. Jan kannte sich im Viertel rund um die Bombenlücke aus. Das Grundstück war vielleicht zwanzig Meter tief. Dahinter begann nach wenigen Schritten das nächste, ähnlich große Gebäude. Und dann kam auch schon wieder eine Straße. Was hier jedoch vor ihm lag, schien endlos zu sein. Irgendwo in der Ferne vereinten sich Boden, Wände und Decke in einem einzigen Punkt.
Jan hatte von italienischen Baumeistern der Renaissance gehört, die sich einen Spaß daraus machten, das Auge mit perspektivischen Tricks zu narren. Vielleicht war der Gang nur eine dieser optischen Täuschungen. Anders ließ sich seine Höhe von wohl fünfzig Metern kaum erklären – das Flickenteppichhaus war lange nicht so groß gewesen. An den Seiten reihten sich Rundbögen, die auf Säulen ruhten. Darüber erstreckten sich Galerien mit weiteren Bögen. Je weiter Jans Blick emporwanderte, desto kleiner erschienen die Bogenwerke. Bestimmt nur eine gemalte Kulisse, dachte er.
»Lisa!« Weder war sie zu sehen, noch antwortete sie auf sein Rufen.
»Liiiisaaaaa!«, versuchte er es abermals gedehnter und deutlich lauter.
Wieder blieb alles still.
Er öffnete den kleinen, schwarzen Koffer. In einem Bett aus rotem Samt lag, verführerisch funkelnd, die silberne Querflöte. Seine Stimme. Besonders in bewegten Momenten ließ er sie für sich sprechen. Jans großes Vorbild war Ian Anderson von der Gruppe Jethro Tull. In dessen Klanggemälde mischten sich die silbrig klaren Klänge seines Instruments mit dem heiseren Atem stark überblasener Töne. Manchmal sang der Brite sogar die Noten, während er sie gleichzeitig spielte.
Auf diese ungestüme Weise konnte man viel mehr Gefühle ausdrücken als mit der klassischen Spielweise. Jan hatte diese Eigenheiten übernommen und sich – sehr zu Vaters Leidwesen – oft tagelang ausschließlich in Flötentönen artikuliert. Nur Lisa verstand diese »Sprache« gut genug, um bisweilen als Dolmetscherin zu vermitteln.
Nun rief er sie mit der Flauto traverso, wie seine Mutter das Instrument nannte. Als Erkennungsmelodie wählte er dasselbe Lied, das seine Schwester zuvor im Bus gesungen hatte: The Circle Game.
Die Akustik in der Galerie war atemberaubend. Unglaublich, wie weit die Töne trugen. Nach der ersten Strophe setzte er ab und lauschte.
Keine Antwort.
Er spielte noch den Refrain, aber auch das fruchtete nichts.
»Warte, wenn ich dich erwische!«, knurrte er und lief in den Gang hinein.
Ab und zu ließ er den Blick nach links oder rechts schweifen. Was er da sah, war nicht weniger beunruhigend als die riesige Galerie vor ihm. Im Halbdunkel hinter den Rundbögen lagen nämlich neue Arkaden. Und dahinter nochmals. Immerfort schlossen sich schwach beleuchtete Bogengänge an, so weit das Auge reichte.
Nach vielleicht hundert Schritten erreichte Jan einen viereckigen Sockel, auf dem eine Büste aus gebranntem Ton stand: ein bärtiger Typ mit einer Art Kronenhut auf dem Kopf. Die Skulptur sah antik aus. Wie ein archäologisches Artefakt. War die Stadt etwa dabei, hier ein ganzes Viertel zu entkernen und klammheimlich ein Museum hineinzusetzen?
Als Jan weiterlief, bemerkte er aus den Augenwinkeln eine Bewegung. Er sah sich nach dem Terrakottakopf um. Hatte das tönerne Gesicht nicht eben noch mit der ernsten Würde eines Königs dreingeblickt?
Jetzt grinste es.
»Wohl doch kein Museum, sondern eher so ’ne Art Disneyland«, murmelte er und kehrte zu der Büste zurück. Sie argwöhnisch beäugend lief er einmal drum herum. Ganz dicht ging er an sie heran, fast berührten sich seine Nase und die des Grinsenden. Jan sah die körnige Struktur und sogar feine Risse. Wie eine bewegliche Silikonmaske sah das Ding nicht aus. Er hob die rechte Hand, um mit dem Knöchel des Zeigefingers gegen die tönerne Stirn zu klopfen.
»Davon rate ich dir dringend ab«, sagte der Kopf.
Jan schrie auf, stolperte einige Schritte zurück und riss die Querflöte hoch, so als wäre sie ein Lichtschwert.
»Bringt man euch heute nicht mehr bei, das Eigentum anderer Leute zu achten?«, tönte die volle Stimme des Tongesichts. Wie auf ein geheimes Zeichen hin kam auf einmal Leben in die Galerie. Irgendwo lachte jemand und aus allen Richtungen wehte Geflüster herbei.
Jan hätte mit seiner Gänsehaut Holz raspeln können, so standen ihm sämtliche Haare zu Berge. Am liebsten wäre er zurück auf die Straße gerannt. Doch wie könnte er, wenn dann Lisa etwas passierte, seinem Vater je wieder unter die Augen treten?
»Mist!«, zischte er und lief tiefer in das Haus hinein.
»Falsche Richtung«, rief ihm der Tonkopf hinterher.
Jan hörte nicht auf ihn.
Nach etwa zweihundert Metern erreichte er einen Platz, der einer Windrose glich: Acht schnurgerade, schier endlos lange Arkadenstraßen trafen hier zusammen. Wohin hatte sich Lisa wohl gewandt?
Gehetzt sah sich Jan um. Durch die angrenzenden Bogengänge bewegten sich dunkle Gestalten. Es waren Dutzende. Und alle hatten offenbar nur ein Ziel.
Sie wollten sich mit ihm auf dem Sternplatz treffen.
Im Nu hatten sie sämtliche Wege besetzt. Die ganz in Schwarz gekleideten Kerle trugen wallende Roben, knöchellange Umhänge, Lederhandschuhe und große Hüte, die wie Schiffe aussahen, mit einer riesigen Rabenfeder als Mast. So verschieden ihre Gesichter waren – kantig, faltig, wuchtig, mickrig, bärtig, schmutzig – so einmütig wirkten sie in ihrer Entschlossenheit. Mit gezückten Langschwertern stürzten sie auf den Eindringling zu, als wollten sie ihn in Stücke hauen.
Jan versuchte nach rechts auszuweichen. Am Rand des Sternenplatzes blieb er stehen und drehte sich hilflos um seine eigene Achse. Die Männer hatten ihm jeden Fluchtweg abgeschnitten.
»Ist das ein Rollenspiel?«, rief er. »Dann habt ihr den Falschen. Ich bin nur da, um meine Schwester abzuholen.«
Die Schwarzroben hatten bisher kein Sterbenswörtchen gesagt, und auch jetzt antworteten sie nicht. Ihr Ring zog sich nur enger um den Eindringling zusammen. Im Vergleich zu den kräftig gebauten Hünen war Jan mit seinen hundertvierundsiebzig Zentimetern eher ein Hänfling. Die Zwei in Sport würde ihm auch nicht viel nützen, falls es die Kerle ernst meinten. Sie würden ihn auseinandernehmen wie ein Actionspielzeug.
Plötzlich riss ein schnurrbärtiger Riese die Waffe hoch und griff an. Seine blitzende Klinge zielte auf Jans Hals. Der sprang zur Seite und rollte sich am Boden ab. Das Schwert sauste über ihn hinweg, traf eine Marmorsäule und sang wie eine tiefe Stimmgabel.
Der schwarze Rächer mit Schiffshut gönnte dem Jungen keine Atempause. Schon hob er erneut das Schwert. Jan, noch gar nicht wieder richtig auf den Füßen, stolperte rückwärts und riss seine Querflöte hoch, wohl wissend, dass sie gleich in ihre Einzelteile zerfallen würde.
»Halt!«, rief plötzlich eine knarrende Stimme.
Die Schwarzroben nahmen Habachtstellung ein und drehten ihre Schwertspitzen nach unten.
Jan keuchte. Rechts von ihm, nur durch eine Lücke im Kreis der schwarzen Rächer zu sehen, näherte sich ein hagerer Mann in Frack und Zylinder. Gehörte das zum Konzept dieses Actionspektakels, erst dem Spieler eine Sauangst einzujagen und dann die Figur des Retters einzuführen? Mit Video- und Computerspielen konnte Jan nicht viel anfangen – die Grafiken waren ihm zu schlecht. Das hier hatte eine ganz andere Qualität. Und der Typ war echt schräg.
Er ähnelte diesem amerikanischen Präsidenten, der die Sklaverei abgeschafft hatte. Wie hieß er noch gleich? Ach ja, Abraham Lincoln im Totengräberkostüm, so sah er aus.
Abgesehen von der seltsamen Garderobe fielen Jan an ihm vier Dinge auf: die ernste Miene, grauweiße Farbe an den spinnenfingrigen Händen, der lange Hals mit dem vorspringenden Adamsapfel und der krause Bart, der am Kinn als schwarzes Dreieck entsprang und in einer schmalen Haarlinie an der Kante des Unterkiefers entlangwuchs, um nahtlos in die Koteletten überzugehen.
Jan lief auf den Mann zu.
»Willkommen in der Zentrale«, sagte der Langhals, ohne die Leichenbestattermiene zu verziehen.
Seine spröde Höflichkeit vermochte Jans Ärger nicht zu besänftigen. In sicherem Abstand zu den Schwarzroben blieb er stehen und verschaffte sich Luft. »Ich möchte jemanden von der Geschäftsleitung sprechen.«
Der Hagere lächelte nicht, wie man es von einem Mitarbeiter erwartet hätte, dem etwas an der Zufriedenheit der Kunden lag. Er verzog nur den breiten Mund und antwortete ruhig: »Das hast du doch schon getan.«
»Mir hat sich niemand vorgestellt. Bringen Sie mich zu Ihrem Chef.«
»Er ist im Augenblick sehr beschäftigt – so viel Betrieb wie heute hatten wir lange nicht mehr. Ich fürchte, Sie müssen mit mir vorliebnehmen.«
»Und Sie sind?«
»Mein Name ist Atárah. Und wer bist du?«
»Ich bin … Whistler «, antwortete Jan. Er hatte gerade noch die Kurve gekriegt. Schließlich ging es diesen Typen nichts an, wer er war.
»Hast du eine goldene Krone mitgebracht, junger Whistler?«
Jan zeigte sein Instrument. »Nur eine silberne Flöte.«
»Hübsch«, sagte der Langhals. Sein Mangel an Begeisterung war überwältigend.
»Haben Sie hier etwas zu sagen, Herr Atárah?«
»Als Magistrat für Kopfbedeckungen darf ich das wohl bejahen.«
»Ist das so eine Art Unterabteilungsleiter für Kostüme?«
»Streiche das Wort ›unter‹ und du kommst der Wahrheit ziemlich nahe«, erwiderte der Hagere kühl. Er sprach so bedächtig, dass man ihm beim Reden den Zahnstein hätte entfernen können. Mit der langfingrigen Rechten deutete er auf seinen Zylinder. »Manche nennen mich den Hüter der Hüte.«
Jan konnte dem Humor des Mannes nichts abgewinnen. Er zeigte mit seiner Flöte auf die finsteren Robenträger. »Ist das hier Ihre Security?«
Der Magistrat zögerte. »Es sind die Haupt-Leute«, sagte er. »Sie kontrollieren jedes Haupt, damit in der Zentrale alles seinen geordneten Gang geht.«
»Wovon ist die Zentrale eigentlich die Zentrale?«
»Von der fünften bis achten Dimension.«
»Hätte ich mir denken können. Und Sie sind der Herrscher der Klingonen.«
Herr Atárah wirkte irritiert. »Ich fürchte, da liegt eine Verwechslung vor, junger Whistler.«
»Dann ist das hier also nicht Raumschiff Enterprise im Hyperraum? Ich habe nämlich vorhin diese Röhren gesehen, die …«
»Du befindest dich im Allerweltshaus «, beendete der Magistrat das Rätselraten. »Manche nennen es auch das Weltenhaus.«
»Ist das ein Vergnügungspark?«
Wieder verzog Herr Atárah den Mund. »Manche sehen das wohl so. Es ist das größte Gebäude der Welt. Streng genommen ist es ein eigener Kosmos, ein riesiger Organismus, der sich ständig verändert.«
»Also doch Disneyland. Und wie kommt es, dass meine Schwester und ich hier sind?«
»In Zeiten des Umbruchs ragt das Allerweltshaus in die erste bis vierte Dimension hinein. Dabei muss es euch wohl aufgeschnappt haben.«
»Per Anhalter durch die Galaxis gewissermaßen.«
Der Magistrat blinzelte. »Du hast eine absonderliche Art dich auszudrücken, Junge.«
»Danke. Das behauptet mein Vater auch immer. Sie haben Lisa nicht zufällig gesehen, so ein Zwerg von eins neunundsechzig in roter Regenjacke, vierzehn Jahre alt, dünn wie ’ne Bohnenstange, halblange, rotblonde Haare?«
Herr Atárah stach seinen langen Zeigefinger unter die Hutkrempe und kratzte sich. »Da müsste ich in meinen Akten nachschauen …«
»Vergessen Sie’s. Meine Schwester kann erst ein paar Minuten hier sein. Sie ist extrem gefährlich. Entweder singt oder redet sie einen in Grund und Boden. So jemanden wie Lisa wollen Sie bestimmt nicht im Allerweltshaus haben.«
»Ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst. Lass uns nur kurz ins Kabinett hinübergehen und einen passenden Hut oder eine Krone für dich finden. Dann kümmern wir uns um deine Schwester.«
»Das lohnt nicht. Ich möchte mit ihr schleunigst wieder an die frische Luft. Sonst verpassen wir den Bus.«
» Niemand bleibt hier unbehütet«, betonte der Magistrat bedrohlich ruhig. Seine spindeldürre Hand wies auf die Haupt-Leute. »Wer im Allerweltshaus mit unbedecktem Kopf angetroffen wird, verliert schnell das betreffende Körperteil.«
»Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder?«
»Sehe ich aus, als würde ich scherzen?«
Jan schluckte. Das konnte man nun wirklich nicht behaupten.
Das Kabinett der Hüte
»Und dies ist mein Wirkungsbereich, junger Whistler, das Kabinett der Hüte«, sagte der Magistrat für Kopfbedeckungen. Dabei lächelt er nicht, er verzog nur seinen schmallippigen Mund. Die schlichte Anrede mit Namen sei ihm am liebsten, hatte er auf dem etwa zehnminütigen Fußweg vom Sternplatz erklärt: »Nur Atárah, kein ›Herr‹, kein Titel.«
Im ersten Moment glaubte Jan, einen hippen Hutladen zu betreten. Der vieleckige Raum protzte mit teurem Parkett aus verschiedenen Edelhölzern. An jeder Seite gab es eine goldene Tür. Die Milchglaswände bestanden bis unter die hohe Decke aus beleuchteten Fächern. Darin lagen Kronen, Diademe, Tiaras, goldbehangene Turbane, Feldherrnhüte und andere prächtige Kopfbedeckungen. Jede war einzigartig, nur in ihrem Prunk unterschieden sie sich kaum.
»Irre Sammlung!«, sagte Jan, nachdem er sich ausgiebig umgesehen hatte. Nicht gerade mein Geschmack, aber allemal abgefahren. Er setzte das Mundstück seiner Flöte an die Lippen und blies einen himmelstürmenden Lauf, um den Worten mehr Nachdruck zu verleihen.
Atárah zog den Kopf ein, als fühle er einen Peitschenhieb. Wahrscheinlich war er unmusikalisch.
»Warum haben Sie mich vorhin eigentlich nach einer goldenen Krone gefragt? Die gibt’s hier doch dutzendweise«, erkundigte sich Jan.
»Uns ist vor längerer Zeit ein besonderes Stück abhandengekommen. Wir hoffen, ein ehrlicher Finder bringt es uns zurück. Siehst du etwas Passendes für dich, junger Whistler? Du hast die freie Wahl.«
»Sie meinen, ich soll mir eins der Dinger aussuchen?«
»Deshalb sind wir hier.« Atárah verzog nicht einmal den Mund.
Irgendetwas an dem lauernden Blick des Magistraten gefiel Jan nicht. Vielleicht präsentierte er ihm nachher eine gepfefferte Rechnung.
»Sie kosten nichts«, sagte Atárah.
Jan erschrak. Konnte der Langhals etwa Gedanken lesen? »Auch keine Leihgebühren?«
»Im Allerweltshaus hat jeder ein gesetzlich verbrieftes Recht auf die freie Wahl der Kopfbedeckung. Frei in jeglicher Beziehung. Nur ganz darauf zu verzichten, kostet etwas.«
»Sie meinen, das Leben?«
Atárah hielt es wohl für müßig, zu antworten. Seine ausdruckslose Miene schürte Jans Argwohn.
Lustlos wandte er sich wieder den beleuchteten Auslagen zu und begutachtete provozierend gründlich die Kronen, Diademe, Federhüte, Prunkkappen, Turbane, Kardinalshüte … Nichts von alldem gefiel ihm. Was sich wohl die Diva ausgesucht hatte? Sicher ein Teil mit hohem Glitzerfaktor.
»Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber gerade erfahre ich, dass der nächste Besucher im Anmarsch ist«, drängte Atárah.
Jan sah ihn überrascht an. »Echt? Wer hat Ihnen das verraten?« Der Langhals hatte kein Kabel im Ohr, wie die Bodyguards der Promis.
»Das Bewusstsein.«
Mit der Antwort konnte Jan nichts anfangen. Der ungeduldige Blick des Magistraten gemahnte ihn, endlich eine Wahl zu treffen. Er drehte sich um seine eigene Achse und überflog widerwillig all die prunkvollen Kopfbedeckungen. Auf einmal bemerkte er dicht über dem Parkettboden ein unbeleuchtetes Regalfach. Es war staubig und schien, abgesehen von ein paar Spinnweben, leer zu sein. Hatte hier Lisa zugegriffen? Er bückte sich.
»Da ist nichts«, sagte Atárah unwillig.
Jan langte trotzdem in die Box. Seine Fingerspitzen stießen gegen weichen Stoff. Er beugte sich tiefer hinab. Leise ächzend streckte er die Hand weiter in die Schatten, griff nach dem angeblichen Nichts und brachte es ans Licht.
»Wow! Die ist toll!«, entfuhr es ihm. Es war eine Schiebermütze. Hatte er nicht einmal ein Foto von diesem berühmten irischen Schriftsteller mit so einem Deckel gesehen? Wie hieß der Typ noch gleich …?
»Leg sie sofort zurück«, verlangte Atárah.
»Wieso? Ich denke, das Gesetz schreibt die freie Wahl der Kopfbedeckung vor.« Jan ließ, ganz typisch für ihn, all den Prunk und Protz links liegen und entschied sich spontan für die unscheinbare Mütze. Ehe der Magistrat auch nur Halt ! sagen konnte, hatte er sie sich schon aufs Haupt gedrückt.
Atárah wirkte entsetzt. »Das hättest du nicht tun sollen.«
»Wieso nicht?«
»Weil du dir mit dieser Ballonmütze im Allerweltshaus keine Freunde machst.« Erschrocken legte er die Hand auf den Mund, so als habe er etwas Verbotenes gesagt.
»Ich finde, es ist eine Schiebermütze«, sagte Jan.
»Bin ich hier der Kenner von Kopfbedeckungen oder du?«
»Für mich ist es eindeutig eine Schiebermütze.«
»Wie auch immer, sie tut dir nicht gut. Leg sie wieder zurück und such dir etwas anderes aus. Schau, die Krone dort oben, schlicht und eines Helden würdig. König Artus hat sie …«
»Warum lag die Mütze überhaupt in dem Fach, wenn ich sie nicht nehmen darf?«, unterbrach Jan den Magistraten.
Der stöhnte. »Hast du mir nicht zugehört? Das Gesetz gesteht jedem die freie Wahl zu zwischen …« Atárah presste sich beide Hände auf den Mund. Der Rest seiner Antwort ging in Gebrabbel unter.
»Zwischen was?«, hakte Jan nach.
Der Hüter der Hüte antwortete mit bedeckten Lippen.
Jan verstand kein einziges Wort. »Was ist auf einmal los mit Ihnen?«
Atárah ließ die Hände sinken. »Nicht ich habe mich verändert, sondern du dich. Die Mütze macht dich zu einem Wahrhörer.« Er wirkte erleichtert, wieder frei sprechen zu können.
»Sie meinen Wahr sager ?«
»Das wird jeder, in dessen Nähe du kommst. Niemand kann dich belügen. Ob man will oder nicht, man muss dir die Wahrheit sagen.«
»Cool! Dann wollten Sie mich also anschwindeln?
»Ja.«
»In welcher Beziehung?«
Atárah drückte sich wieder die Hände auf den Mund.
Jan hätte das amüsante Spiel gerne noch eine Weile fortgesetzt, doch er war nicht zum Vergnügen hier. »Wo finde ich meine Schwester?«
»Sie ist weggegangen«, antwortete der Hüter der Hüte. »Wohin, das weiß ich nicht.«
»Aber Sie ahnen es.«
»Vermutlich erfüllt sie sich gerade ihren sehnlichsten Wunsch.«
Jans Augen verengten sich. »Was für eine Kopfbedeckung hat Lisa gewählt?«
Atárah lachte. »Natürlich eine Krone.«
Der Befehl
Die Erschütterungen im Zeitgeist hatten den Alarmzustand ausgelöst. Dem Allerweltshaus wuchsen neue Geschosse wie Jahresringe an einem Baum. In der ersten bis vierten Dimension öffnete es Türen, die Neugierige anlockten. Menschen traten ein: Männer, die nur kurz Zigaretten holen wollten, kehrten nicht mehr zurück. Frauen und Kinder verschwanden, als hätte der Erdboden sie verschluckt. Im Weltenhaus ging alles weiter seinen geregelten Gang. Unter den Kopfbedeckungen seiner Bewohner gab es kaum Raum für Veränderungen.
Nur die Haupt-Leute waren in Alarmbereitschaft.
Sie überwachten das Weltenhaus von den Knotenpunkten aus. Hier trafen sich die Verbindungsgänge, die das Gebäude durchzogen wie ein Geflecht aus Adern. Von hier aus konnten die Schwarzroben binnen weniger Augenblicke die äußersten Winkel des Haus erreichen. Hier spürten sie, wenn jemand irgendwo seine Kopfbedeckung abnahm.
Der Magistrat eilte zu dem Knoten, der dem Kabinett der Hüte am nächsten lag. Mit wehenden Schößen platzte er in die Wachstube. Er mochte diese Horchposten nicht, fühlte sich darin immer wie im Gehäuse eines großen Seeigels. Von der durchlöcherten Gewölbedecke abgesehen, war es ein runder, schmuckloser Raum mit roh gezimmerten Bänken und Tischen. Die Haupt-Leute sprangen von ihren Sitzen auf. Sie bekamen nicht alle Tage so hohen Besuch.
»Wer hat die Kinder hereingelassen?«, zischte Atárah.
»Das Haus«, brummte ein stämmiger Riese von über zwei Metern. Er hieß Syrte und war der Haupthaupt-Mann, der Kommandant der Schwarzroben des Allerweltshauses.
Atárahs dunkle Augen funkelten bedrohlich. »Der Junge ist gefährlich. Er gehört nicht hierher. Bringt ihn mir zurück, damit wir ihn rauswerfen können, ehe er irgendein Unheil anrichtet.«
»Ihr kennt das Gesetz, Herr«, erwiderte Syrte gleichmütig. Den Kommandanten brachte so gut wie nichts aus der Ruhe. »Ein Schneckenhaus kann nur wachsen, solange Leben darin wohnt. Ohne die Besucher aus der ersten bis vierten Dimension gäbe es hier keine Erneuerung, kein Wachstum und keinen Wandel. Der Lohn für ihr Opfer ist die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.«
»Nur, wenn sie brav ihr Haupt bedecken. Der Junge ist ein Querkopf. Er wird die alberne Mütze nicht ewig aufbehalten. Ihr werdet seinen Geist auslöschen, sobald er sie abnimmt, hört ihr? Ist sein Sinn erst erneuert, wird er uns keine Schwierigkeiten mehr machen.«
»Vielleicht verlässt er das Allerweltshaus ja freiwillig.«
»Selbst dann könnte er uns noch schaden.«
»Wie denn, Herr? Er wird alles vergessen, sobald er das Haus verlässt.«
»Du hast ja keine Ahnung. Es gibt Umstände …«
Syrte hob die Augenbrauen. »Ja?«
Atárah verzog missmutig den Mund. »Nicht bei jedem verblasst die Erinnerung an den Aufenthalt im Weltenhaus.«
»Das wusste ich nicht, Herr.«
»Du weißt so vieles nicht, Syrte. Behaltet den Jungen im Auge.«
»Und wenn er den Hut nicht absetzt?«
»Dann bringt ihr mir seine Schwester. Beobachtet sie rund um die Uhr. Falls nötig, müsst ihr sofort zugreifen. Der Whistler scheint sehr um ihr Wohl besorgt zu sein. Ich bin überzeugt, im Zweifelsfall wird er sich eher für sie als für die komische Mütze entscheiden.«
»Ist das ein Befehl Seiner Majestät?«
»Das ist ein Befehl meiner Wenigkeit, Syrte. Du hältst dich besser daran, sonst kannst du deinen Hut nehmen.«
Das Fest
Die Tür war wie aus dem Nichts erschienen. »Viel Vergnügen!«, hatte Atárah gesagt, verzog seinen Mund und entließ Lisa aus dem Kabinett der Hüte in eine belebte Allee.
Es gab tatsächlich Bäume hier! Sie wuchsen in riesigen Blumentöpfen und waren auf Kugelform zurechtgestutzt. An den Rändern der überdachten Prachtstraße luden Arkaden zum Lustwandeln ein. Straßenhändler boten ihre Waren feil: Hutnadeln, Hutbänder, Hutfedern, Hutketten, Hutbroschen und -ketten. Im Allerweltshaus legte man offenbar großen Wert darauf, die einmal gewählte Kopfbedeckung der jeweiligen Mode anzupassen.
Aufgeregt beäugte Lisa die Passanten. In der Allee wimmelte es nur so von komischen Gestalten in schrägen Kostümen. Sie kam sich vor wie auf einem Karneval. Manche Leute trugen wahnsinnig natürlich wirkende Bodysuits. Die Ganzkörpermasken verwandelten ihre Träger in Michelinmännchen, Mister Universum oder bizarre Fabelwesen. Vom prachtvoll bedeckten Menschenkopf abwärts wirkten die Figuren täuschend echt. Vor lauter Verrücktheiten vergaß Lisa ganz die düsteren Warnungen Atárahs und verlor sich völlig im Schauen und Staunen.
»Ain’t it funny?«, trällerte sie in ihrem Übermut: Ist es nicht lustig? Ihre Gefühle in Liedtexten auszudrücken war ihr, der leidenschaftlichen Sängerin, in Fleisch und Blut übergegangen. Ain’t it funny? hieß ein Song aus dem neuesten Album J.Lo von Jennifer Lopez.
Ein Paar, das untergehakt vorbeischlenderte, blieb stehen und lächelte sie erwartungsvoll an. Er sah mit seiner Zigarre und den pomadigen Haaren wie ein Mafioso aus. Sie hatte Tonnen von Schminke im Gesicht und wirkte in ihrem Ballettröckchen wie eine pensionierte Primaballerina. »Da capo!«, rief sie entzückt.
Lisa konnte nicht widerstehen und sang: Ain’t it funny how a moment could just change your life and you don’t wanna face what’s wrong or right. Ain’t it strange …
Ist es nicht komisch, wie ein Moment dein Leben verändern kann und man nicht wahrhaben will, was falsch und was richtig ist? Ist es nicht seltsam …?
Während sie sang, blieben immer mehr Leute stehen, und als sie verstummte, brach tosender Applaus aus. Sie überlegte, was sie als Nächstes aus ihrem reichen Repertoire vortragen könnte. Vielleicht einen ihrer eigenen Songs …?
Die Kostümierten wandten sich jäh von ihr ab.
Mit offenem Mund starrte Lisa ihrem Publikum hinterher, während es in die Wandelgänge entschwand. Niemand drehte sich mehr nach ihr um. »Dann eben nicht«, schnaubte sie und ging ebenfalls weiter. Sie hatte es echt nicht nötig, sich bei diesen durchgeknallten Typen einzuschleimen. Wirf keine Perlen vor die Säue, pflegte Mom zu sagen.
Lisa bog in eine Seitengasse ab. Ihr Bedarf an Trubel war vorerst gestillt. Der lichterfüllte Gang mochte sechs Meter breit und die gewölbte Decke ebenso hoch sein. Blumenornamente aus vergoldetem Stuck zogen sich daran entlang. An den Wänden prangten ausladende Gemälde mit Landschaftsszenen. Alles ziemlich kitschig. Raffiniert fand Lisa die indirekte Beleuchtung, deren Lichtquelle sich nirgends ausmachen ließ.
In größerem Abstand zogen mächtige Holztüren an ihr vorüber. Jede Tür sah anders aus. Lisa schlenderte auf ein moosgrün lackiertes Exemplar mit goldfarbener Klinke zu. Vielleicht der Eingang zu einer Wohnung, grübelte sie und blickte sich verstohlen um. Irgendwo lachte jemand. Etwa fünfzig Meter hinter ihr kreuzte ein Pfau mit Menschenkopf den Gang. Niemand beachtete sie.
Lisa öffnete die Tür. Dahinter lag ein Dschungel. Feuchtheiße Luft schlug ihr entgegen. Ihr Blick wurde von einer seltsam geformten Luftwurzel angezogen, die sich plötzlich bewegte.
Es war eine Riesenschlange.
Schnell warf sie die Tür wieder zu und lief weiter.
Allmählich wurde es sehr still um sie herum. Selbst das Licht war jetzt gedämpfter. Hier und da entdeckte sie Terrakottabüsten. Alle zeigten dasselbe Gesicht eines griesgrämig dreinblickenden Königs. Manche Büsten standen auf Säulen, andere hingen an den Wänden. Sobald Lisa in Sichtweite eines der Tonköpfe kam, fühlte sie sich unwohl. So als würden die blinden Augen sie beobachten.
Warum hatte der Hüter der Hüte sie so eindringlich davor gewarnt, das Diadem abzunehmen? Als sie ihn danach fragte, war die wandelnde Reitpeitsche mit Zylinder merkwürdig schweigsam geworden. Atárahs schwarze Augen hatten sie nur angestarrt, als wäre er ein Hypnotiseur. Der Typ war ihr von Anfang an unheimlich gewesen.
Sie rief nach Jan, bekam aber keine Antwort. Wie auch? Das Allerweltshaus war riesig. Warum sollte er sie ausgerechnet hier suchen? Wenn überhaupt? Sie hatte ihm vors Schienbein getreten, nur verbal versteht sich. Bestimmt war er sauer auf sie.
Je länger Lisa durch die Gänge irrte, desto mehr verflüchtigte sich ihre anfängliche Neugier. Fände sie jetzt einen Ausgang, sie würde nicht zögern, das Allerweltshaus zu verlassen.
Von irgendwo drangen Pfeifentöne an ihr Ohr, ganz leise, ganz fern. Lisa blieb stehen. Eine Drehorgel? Nirgends war eine Menschenseele zu sehen, geschweige denn ein Leierkastenmann. Ihr suchender Blick wanderte zu einer der Riesentüren. Sie war bunt lackiert, wie ein Puzzle aus verschiedenfarbigen Teilen. Kam die Pfeifenmusik von dort? Lisa lief hin und guckte durchs Schlüsselloch.
Dahinter lag ein belebter Jahrmarkt, der sie an eine Theaterbühne denken ließ: Bilder von Hausgiebeln an den Wänden, ein verglastes Oberlicht für die Illusion von Sonnenschein und ein Gewimmel von kostümierten Darstellern. Der Rummelplatz war auch nur eine künstlich bespaßte Riesenhalle. Lisa machte sich nicht sonderlich viel aus mechanisierter Unterhaltung und Zuckerwatte. Also setzte sie ihre Suche nach dem Ausgang fort.
Schon nach wenigen Schritten blieb sie an einer Weggabelung stehen. Links oder rechts? Ihre empfindlichen Ohren empfingen keinerlei Signale, die ihr bei der Orientierung nützen könnten. Kein Straßenverkehr, keine Kirchenglocken, nichts. Die Stille war geradezu unheimlich. Mindestens eine halbe Stunde lang irrte sie nun bereits im Allerweltshaus herum. Den Bus jedenfalls hatte sie jedenfalls verpasst. Das gab Ärger.
Einmal mehr rief sie den Namen ihres Bruders. Wäre Jan doch nur da! Sie hätte ihn nicht so reizen sollen. Jetzt war er eingeschnappt und ließ sie in diesem horrormäßigen Irrgarten von Haus hängen, bis sie Spinnweben ansetzte.
Niemand antwortete auf ihr Rufen.
Sie schob eine widerspenstige Strähne hinters Ohr zurück und stieß mit dem kleinen Finger gegen die Krone, die sie im Kabinett der Hüte ausgewählt hatte. Genau genommen war es ein geschlossener Haarreif, ein juwelen- und perlengeschmücktes Diadem aus Silber oder Weißgold. Sie hatte es sich mit zwei Haarnadeln festgesteckt. Was würde wohl passieren, wenn sie die Warnung des Magistraten in den Wind schlug und …?
Mit zitternder Hand zog sie eine Nadel heraus.
Nichts. Kein Alarm, keine Lautsprecherdurchsage, gar nichts.
Schon etwas mutiger löste sie auch die zweite Nadel aus dem Haar. Nachdenklich betrachtete sie die Perle am Ende des gebogenen Silberdrahts.
Es geschah immer noch nichts.
Trotzig nahm sie das Diadem vom Kopf.
Sie hätte beinahe mit dem Fuß aufgestampft, weil selbst diese Aufmüpfigkeit unbeachtet zu bleiben schien.
Aber dann hörte sie auf einmal flüsternde Stimmen. Schwere Schritte näherten sich. Nur wenige Meter weiter unten im Gang wurde eine Tür aufgerissen. Ein ganz in Schwarz gekleideter Zweimetermann mit Umhang und Robe stürzte in den Korridor. Als er das unbehütete Mädchen entdeckte, grinste er und riss sein langes Schwert aus der Scheide. Es sah nicht danach aus, als würde er sich damit nur frische Luft zufächeln wollen.
Lisa ergriff schreiend die Flucht. Im Laufen drückte sie sich das Diadem auf den Kopf. Mehr schlecht als recht steckte sie es mit den Nadeln fest. Sie war so aufgeregt, dass sie nicht einmal merkte, ob der Robenmann sie verfolgte. Lisa rannte zur nächstbesten Tür, ein bordeauxrotes Monstrum, stieß sie auf, stürzte hindurch, warf sie hinter sich ins Schloss und stemmte sich mit dem Rücken dagegen.
Laute Musik schlug ihr entgegen. Ihre kopflose Flucht hatte sie mitten in ein rauschendes Fest geführt. Die Menschen in dem großen Saal waren vollauf mit sich selbst beschäftigt. Niemand beachtete das verängstigte Mädchen an der Tür.
Abgesehen von der unvermeidlichen Kopfbedeckung ging es in dem Raum ziemlich zwanglos zu. Keine Spur von pietätvoller Zurückhaltung wegen der Terroranschläge. Stilles Gedenken aus Achtung vor den Opfern sah gewiss anders aus.
Lisa staunte, wie betrunken etliche Festgäste bereits zu dieser frühen Stunde des Abends waren. Im Rausch von Alkohol und Wollust wälzten sich Männer und Frauen in opulenten Kostümen auf dem Boden. Dazwischen tollten Kinder herum oder bewarfen sich mit süßem Gebäck. Die Ausgelassenheit wirkte auf Lisa so falsch wie die Theateraufführung einer mäßig begabten Laienspielgruppe. Titel des Stücks: Lustbarkeiten im Barock.
Trotz allem übte der Trubel eine kaum zu widerstehende Faszination auf sie aus. Lisa liebte Partys und Verkleidungen. Die Sache in New York war vermutlich halb so schlimm. Warum nicht wie die anderen ein bisschen Spaß haben? Solange sie das Diadem auf dem Kopf behielt, war sie wohl sicher vor dem Schwertmann – er hatte immer noch nicht angeklopft. Sie stieß sich von der Tür ab und stürzte sich ins Getümmel.
Eine Zeit lang schlenderte sie ziellos durch den Raum, ließ sich von einem livrierten Diener ein Kaviarschnittchen aufdrängen, knabberte an einer Garnele, lauschte dem Streichorchester. Es war aufregend. Manche Gäste beäugten sie neugierig. Wahrscheinlich lag es an ihrer roten Regenjacke.
»Was für ein bezauberndes Fräulein hat sich da zu uns gesellt?«, sagte plötzlich jemand hinter ihr.
Die überschwängliche Stimme kam ihr bekannt vor. Sie drehte sich um und traute ihren Augen nicht. »Kevin?«
Der Schönling schlich auf sie zu. Er trug eine goldene Weste und Kniebundhosen mit weißen Seidenstrümpfen. Mit seiner gepuderten Zopfperücke sah er irgendwie verändert aus. Trotzdem, das konnte nur Kevin Holzmann sein. Der Schlingel gab sich ahnungslos. »Pardon, kennen wir uns, schöne Maid?«
Sie lachte. »Was ist das für ein irres Kostümfest, Kevin? An der Schule steht, dass heute Volkstrauertag ist, und du feierst hier voll die Orgie.«
»Es tut mir leid, wenn Sie jemand anderen erwartet haben. Außerordentlich sogar. Ich bin Nivek Namzloh. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten, bis dieser … Kevin sein verbrecherisches Versäumnis einsieht und sich um Sie kümmert?« Er spuckte den Namen des Mitschülers so angewidert aus, als wäre er eine Schnecke im Salat.
Lisa kicherte. »Das machst du gut.«
Er lächelte. »Danke. Wollt Ihr mir auch verraten, wer Ihr seid?«
»Das weißt du doch«, schmunzelte sie. Wirklich süß, wie er den Charmeur spielte.
»Vielleicht habe ich es vergessen«, antwortet er mit Schmollmund.
Das ist ein Kostümfest, überlegte sie sich. Und offenbar fing die Verkleidung beim Namen an. Da in ihrer Geburtsurkunde Lisa Luisa stand, hatte sie irgendwann einen Spitznamen mit denselben Initialen abbekommen. »Ich bin Lois Lane.«
»Wie reizend!«, rief Nivek entzückt.
Schlagartig wurde es still im Saal. Alle Festgäste seufzten hingerissen. Dann ging das Tohuwabohu weiter.
»Seid Ihr liiert, Lois Lane?«, fragte Nivek.
Sie grinste. »Ja, mit einem super Typ. Er schwirrt nur leider ständig in der Gegend herum.«
»Was für ein Glück für mich.« Der Schönling reichte ihr die Hand. »Möchtet Ihr Euch nicht umziehen? Ich zeige Euch die Garderobe. Da findet sich für Euch bestimmt etwas Passendes.«
»Davon möchte ich mich selbst überzeugen«, antwortete Lisa geziert und legte ihre Hand graziös in die seine. Mühelos schlüpfte sie in ihre neue Rolle.





























