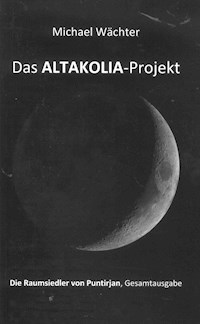Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Peters, ein Astronom aus Norddeutschland, macht im Wilden Westen eine unerklärliche Entdeckung am Himmel. Sie ist so unfassbar, dass er sich nicht traut, sie zu veröffentlichen. Kulik, ein russischer Mineraloge, macht einen unheimlichen Fund aus außerirdischem Mineral – er hält ihn für gefälscht. Doch der junge Münsteraner Student Jens bemerkt die Zusammenhänge – eine Entdeckung, die den Lauf der Geschichte der Menschheit ändern wird. Auch er wagt es nicht, davon zu erzählen. Doch dann erweist sich das Fundstück Kuliks als echt. Der unumstößliche Beweis: Es gibt ein Gegenstück. Geheimdienste jagen ihm nach. Eine Katastrophe passiert. Sein Freund verliert den Verstand. Und Jens liegt das "Anden-Artefakt" vor, der Beweis: Es gibt da draußen im Weltraum eine Zivilisation. Und sie ist unterwegs. Zu uns.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Anden-Artefakt. Eine historisch-phantastische Erzählung
Titel SeiteMichael WächterVorwortTEIL 1VorfallKapitel 1: Omas ErzählungenKapitel 5: Die EiskapelleKapitel 6: Der FlugkörperTEIL 2Kapitel 15: FeroniaKapitel 22: ExpeditionenTitelKapitel 24: Umbruch im LebenKapitel 25: Auf dem MondKapitel 27: VorbotenKapitel 29: Boris und PetrowKapitel 33: BogotàKapitel 34: AtemlosKapitel 37: Nach dem SchockAusblickNachwortAnhangTitel Seite
Das Anden-Artefakt
Eine historisch-phantastische Erzählung
Michael Wächter
Impressum
Texte: © Copyright by Michael WächterUmschlag:© Copyright by Michael WächterVerlag:Michael Wächter
Borsigweg 21a48153 Mü[email protected]
Druck:epubli, ein Service der
neopubli GmbH, Berlin
Printed in Germany
Vorwort
Mein Name ist Jens. Ich habe etwas herausgefunden, was die Weltgeschichte ändern kann. Aber ich traue mich noch nicht, Ihnen zu sagen, was ich da entdeckt habe. Sonst würden Sie meinen Bericht in die Altpapier-Tonne schmeißen.
Jeder normale Mensch würde das tun. Jeder der vernünftig denkt. Und jeder, der weiß, was wissenschaftlich bewiesen ist und was nicht. Ich dachte am Anfang auch so. Ich hätte einen solchen Bericht auch als bloße Erfindung angesehen und weggeschmissen, wenn ich schon am Anfang gelesen hätte, um was es geht. Es ist ja auch unglaublich!
Doch inzwischen denke ich ganz anders darüber. Eigentlich begann mein Umdenken, als ich von jener Prophezeiung in unserer Familienchronik erfuhr und von meinen inzwischen verstorbenen Großeltern das geheimnisvolle, kleine Spielzeug erhielt.
Ich war noch ein Kind. Ich saß im Wohnzimmer meiner Großmutter, unter diesem seltsamen, runden Tisch. Der Kohleofen brannte. In der Küche pfiff der Teekessel auf dem Gasherd und Oma schnitt auf ihrer Marmor-Arbeitsplatte ein Stück Marmorkuchen für mich ab. Ich befühlte die leicht elektrisierende Stange der Stehlampe neben mir. Ich genoss das Kribbeln in den Fingern. Es war jedes Mal bei der Berührung der Stange fühlbar, immer wenn das Licht an war. Wenn ich an der Kordel zog und es ausschaltete, dann war es wieder weg. Der runde Tisch daneben war mit Messing beschlagen. Unter ihm war ein Schränkchen mit Glasfenstern. Darin stand Opas Lieblingskugel. Man konnte sie aufklappen und sah einen Bakelit-oder Resopal-Ring mit Löchern darin, der Schnapsgläschen beinhaltete. In der Mittel war ein größeres Loch. In ihm stand ein kleines Fläschchen mit einer Flüssigkeit, das ich nicht öffnen durfte. Neben Opas Kugel stand ein hölzernes Kästchen. Darin waren die Gegenstände, die ich manchmal zum Spielen bekam: Die Replik eines westfälischen Friedensthalers von 1648, ein altes Notgeldstück von 1923 mit Freiherr vom Stein und ein magnetisches Metallstück aus Russland. Es sah wie eine Schraube aus. Ich spielte damit, als Oma wieder aus der Teeküche zurückkam. Und während ich ihren Marmorkuchen kosten durfte, erzählte sie mir eine Geschichte dazu, aus der Familienchronik.
Ich wusste damals noch nicht, dass sie eine Prophezeiung enthielt, die sich an unserer Familie erfüllen sollte – in Form dieser Schraube, die in dem Kästchen lag. Jetzt, Ende 1985, weiß ich es. Und dass meine Entdeckung die Geschichte der Menschheit von Grund auf ändern wird – wenn nicht sogar beenden.
Warum hat eigentlich niemand außer mir die Anzeichen bemerkt? Ich glaube, dass es mehrere Gründe hatte. Es liegt daran, dass wir – die drei überlebenden Zeugen Professor Haber, Ewald und ich – es nicht wagen konnten, einfach so davon zu berichten. Und es lag wohl auch daran, dass damals Viele vor uns, wie ich bei meinen Recherchen herausfand, die ersten Anzeichen der kommenden, großen Invasion nicht erkannten. Aber ich bin mir jetzt sicher. Ich habe alles gründlich recherchiert. Mehrmals. Es gab sie wirklich, diese Anzeichen, doch sie wurden einfach noch nicht bemerkt. Deshalb dieser Bericht: Etwas ganz, ganz Anderes greift nach unserer Erde, etwas völlig Fremdes dringt nach unserer Welt. Sein Zeitalter bricht an, das Xenozän.
Und das geht alle an, jeden Menschen.
TEIL 1
Vorfall
Sie kam wieder zu sich.
Ihr Mund brannte. Ihre Zunge schien zu glühen. Sie hatte Durst und ihr Hals tat weh.
Sie saß. Sie bemerkte, dass sie auf einem Stuhl war, aber sie konnte sich nicht bewegen.
Dieser Durst! Ich brauche Wasser!
Ihr war egal, wo sie war – sie wusste es ohnehin nicht. Sie wusste nur, dass sie Wasser brauchte.
Ich muss was trinken. Ich muss mich umsehen.
Nur dieser Gedankenfetze war noch da: Mich nach Wasser umsehen. Sie öffnete ihre Augen. Ihre Augenlider waren schwer wie Blei. Sie sah einen kahlen Raum, vermutlich ein Keller. An der Wand vor ihr ein Rohr. Daneben eine Stahltür. An der Decke hing eine nackte Glühbirne, doch es war dämmrig-hell im Raum. Das Licht kam von hinten. Hinter ihr war vermutlich ein Fenster. Oder eine Luke. Die Luke jedenfalls war offen. Sie hörte Vögel. Es klang wie im Urwald. Eine Hütte im Regenwaldgebiet vielleicht oder das Lager einer Kaffeeplantage. Ja, es schien ein leerer Lagerraum zu sein. Mit einem Rohr. Ob es Wasser enthielt?
Sie sah auf ihren Schoß. Um ihren Bauch nahm sie einen Strick wahr. Und um ihre Arme, die auf dem Rücken zusammengebunden waren. Ihre Beine waren an die Stuhlbeine gefesselt. Sie schienen taub zu sein – ihre Arme hingegen schmerzten durch den Druck der Schnüre.
Wenn ich nicht gleich Wasser kriege verdurste ich.
Sie hatte keine Chance an Wasser zu kommen. Sie war gefesselt. Das Rohr, selbst wenn es ein Wasserrohr war, hatte keinen Wasserhahn. Es endete in der Wand. Sie konnte kaum noch klar denken. Irgendetwas war mit ihr. Sie hatte das Gefühl, als ob ihr Stuhl schweben würde. Die kahlen, weiß getünchten Wände schienen Wellenbewegungen zu machen. Sie liefen in Regenbogenfarben an. Dann sackte sie wieder in sich zusammen.
Ein Bremsgeräusch weckte sie. Ein Jeep oder LKW schien anzukommen. Männer sprangen von der Ladefläche. Sie strömten in den Nebenraum hinter der Stahltür. Ein Schlüssel drehte sich im Schloss, die Klinke ging runter. Es quietschte, die Tür ging auf.
Monica richtete sich auf, so gut sie konnte. Zwei Männer traten an sie heran.
„Sie ist wach“, sagte er eine. Er hatte Tarnzeug an, eine Art Armeehose mit Camouflage. Seine Haare waren lang und schwarz. Er war unrasiert und verschwitzt. Und er roch nach Marihuana. Im Gürtel saß eine Machete. Der Andere war im Anzug und trug darüber einen offenen Ledermantel. Er war völlig untypisch gekleidet, die Kleidung passte nicht in die Tropenhitze des Dschungels. Zudem war er blond, völlig glattrasiert und trug einen Halfter mit Pistole am Hosenbund. Er war ganz sicher kein Latino, ein Yankee eher, oder ein Europäer.
Wasser, gebt mir Wasser, dachte sie.
„Was hat sie euch gesagt?“, fragte der Mann im Anzug. Er hatte einen ausländischen Akzent, aber nicht den der Amerikaner.
„Nicht viel, Seňor. Wir haben ihr einen Beruhigungstrip verpasst.“, sagte der Getarnte.
Der Mann im Anzug fluchte in einer Sprache, die sie nicht verstand. Sie klang hart und fremd. Er drehte sich zu ihr um.
„Wie heißt du?“, fragte er.
„Monica.“, stammelte sie. „Bitte gib mir Wasser.“
Er griff ihr Kinn, sah ihr in die Augen. Ihre Lippen waren trocken wie ein Schleifpapier.
„Wasser!“, schimpfte der mit dem Anzug zu dem Anderen. „Los, Idiot, mach’ schon! Ich will, dass sie klar denken kann, wenn sie mit mir redet. Ist das klar?“
Der Mann im Tarnzeug verschwand. Der im Anzug sah sie an.
„So, du bist also diese Assistentin aus Bogotà, vom Uni-Labor. Hör zu: Ich werde dir gleich ein paar Fragen stellen. Wenn du richtig antwortest, dann kommst du hier raus. Oder du verreckst hier im Dschungel.“
Monica nahm die Worte auf, als kämen sie aus einer anderen Welt. Sie schienen sie nicht zu berühren. Sie hatte sich schon aufgegeben, irgendwie. Wenn jetzt wenigstens etwas trinken könnte …
Der im Anzug ging halb um sie herum. Er sah sich ihren Arm an, die Einstichstelle in der Armbeuge.
„Das sind Idioten hier“, flüsterte er Monica zu. „Sie können ihr Scheiß-Kokain produzieren, aber mit Drogen umgehen, dazu sind sie zu blöd.“
Er lockerte die Fesseln an ihren Beinen. Sie spürte Blut in die Beine zurückströmen – das Gefühl kam zurück. Ihr linker Fuß schmerzte.
Die Tür ging wieder auf. Der Getarnte kam herein. Er hatte eine Wasserflasche. Der im Anzug nahm sie ihm weg, ging zu Monica und hielt ihr die geöffnete Flasche an den Mund. Monica, noch halb benommen, öffnete die Lippen und spürte das Leben in ihren Mund zurückkommen.
Wasser!
Er half ihr trinken. Gierig trank sie die Flasche leer.
Es dauerte ein paar Minuten, bis sie die Flasche geleert hatte. Der im Anzug hatte Geduld. Der Getarnte stand seitlich. Sie nahm ihn nicht wahr. Er schien abzuwarten. Der im Anzug gab den Ton an.
Als sie ausgetrunken hatte, warf er die geleerte Plastikflasche auf den Boden.
„Also pass auf“, sagte er. „Du bist hier als eine Geisel. Die dich entführt haben, das sind die Kokaindealer hier in eurem gottverdammten Kolumbianischen Dschungel. Kannst du mich verstehen?“
Monica nickte.
„Sie wollen die Kenntnisse aus eurem Chemielabor und die Analysegeräte, um ihr Scheißkokain besser machen zu können.“
Aber ich bin doch im Mineralogischen …
Monica schüttelte den Kopf und öffnete ihren Mund, doch sie besann sich und sprach nicht aus, was sie dachte.
„Mich interessieren deren Probleme einen Scheißdreck!“, stellte der im Anzug klar.
„Eti idioty, ya khochu znat', chto s etimi kosmicheskimi chastyami!“, fluchte er.
Monica sah ihn fragend an.
„Boris Barakow, hablamos espanol!“, gab der Getarnte genervt von sich.
„Schnauze!“, gab Boris wütend zurück. „Ich weiß das“.
Er drehte sich wieder Monica zu. Er flüsterte ihr fast ins Ohr.
„Ich sagte: Diese Idioten, ich will wissen, was mit diesen Weltraum-Teilen ist! Bestimmt kennst du Diego Humberto, die Hilfskraft in eurem Labor. Er ist ein braver Genosse von mir, weißt du – nicht so ein kokainbenebelter Guerillero! Und weißt du was? Er hat von mir eine kleine Kamera bekommen, dein Analyseergebnis geknipst und das Foto in sein Parteibüro gefaxt – schlaues Köpfchen, euer Genosse Humberto! Und weißt du was? Die KP hat das Ding dann an unsere Freunde in der DDR gefaxt und über die kam es dann zu uns. Und nun kommst du ins Spiel: Wir wollen dieses Ding, das du da analysiert hast. Aber Moskau ist nicht zufrieden damit. Da ist dir nämlich ein blödes Unglück passiert. Ein ganz blödes Unglück! Du hast das Päckchen diesem Westdeutschen mitgegeben, sagte uns dieser Juan. Du kennst Juan von deiner – wie sagt ihr da – Universidad de Caldas, Facultad de Ciencas Exactas y Naturales?“
Monica nickte. Sie drehte die Augen. Ihr war schwindelig.
Boris bemerkte es. Wütend drehte er sich zu dem Getarnten um.
„Du Buschkrieger, hör zu und lern jetzt mal von einem Profi! Wenn wir beim KGB jemanden verhören, dann kriegt der keine Drogen, sonst ist die Aussage so neblig wie deine benebelte Geisel – kapierst du das, Pablo, du Idiot?“
Pablo sah zu Boden. Er wusste, er durfte jetzt nichts Falsches sagen.
Boris drehte sich wieder zu Monica um. Er hielt ihr ein Foto vors Gesicht.
„Schau dieses Foto an. Kennst du das?“
Es war ein Foto von dem Päckchen. Monica erkannte eine Probe aus dem Depotraum ihres Labors an der Uni. Sie erkannte es an dem Zettel, der auf dem Päckchen klebte. Er trug ihre Handschrift. Oben auf dem Zettel standen das Symbol der Sonne und der Universitäts-Wahlspruch „Lumina spargo“. Und ihr Vermerk: „Proba 314/1985, Proba comparanda con tornillo (Senor Alemàn)“. Es war der kleine Karton mit dem metallischen Gegenstand, den sie untersucht hatte – dem Fundstück aus den Anden. Es war geformt wie ein Quader. An einer Kante wies er noch Reste von dunklem, meteoritischem Material auf. Ihre Analyse hatte die außerirdische Herkunft des Objektes bewiesen, und zwar die des Meteormaterials ebenso wie die des Metallquaders, an dem das dunkle Material saß. Sie hatte das Metallteil Ewald gegeben, weil der ihr so eine deutsche Probe gezeigt hatte, die aus dem gleichen Material war.
Ewald. Ihr Herz klopfte. Sie erinnerte sich. Sie hatte ihn in Bogotà kennengelernt. Vor dieser Katastrophe, und vor ihrer Entführung hier in dieses Drecksloch. Ewald war in dem Vulkanologenteam, das aus Westdeutschland gekommen war. Ihr Herz hatte sofort geklopft – sie war verliebt. Sie war fortan mit ihm unterwegs, auf Exkursion. Sie hätte sich sogar vorstellen können, mit ihm … Aber nun war er ja wieder in Westdeutschland, zusammen mit seiner Vergleichsprobe. Als „Proba No. 315/1985“ hatte sie das Stück registriert und mit untersucht. „Tornillo, origen: Sr. Ewald de Alemania.“ stand darauf.
Ewald.
Pablo stieß sie von der Seite an.
„Antworte dem Gentleman vom KGB, sonst kommst du hier nicht raus!“, zischte er.
Monica blickte auf.
„Ja“, stammelte sie. „Ja, ich kenne das Päckchen.“
„Hast du dieses Ding untersucht.“
„Ja, ich habe es analysiert.“
Monica sah wieder Wellenbewegungen auf den kahlen Wänden des Lagerraums. Alles drehte sich.
Boris sah sie an.
„Hör zu! Wir haben dein Ergebnis. Wir können lesen. Es beweist, dass das Ding aus außerirdischem Material ist. Aber Meteoriten sind nicht rechteckig. Wir glauben, es ist von einer US-Waffe. Von einem amerikanischen Geheimsatelliten, der unsere Genossen bedroht. Bestimmt hast auch du schon von diesem SDI-Programm gehört. Und du willst uns jetzt deshalb helfen und nicht hier in diesem alten Drogenschieberloch bei deinem Pablo aus Medellin verrecken, nicht wahr?“
Monica stammelte. „Nein … Ja … Ich sage ja, was sie wissen wollen. Bitte lassen sie mich gehen. Das war wirklich Meteoreisen und Seltene Erden-Metalle wie Neodym, und Bor und …“
„Khorosho, malen'kaya myshka – Alles gut Mäuschen!“, sagte Boris und strich ihr durch das Haar. „Ich will nur wissen, wer das Metallteil jetzt hat, und zwar genau jetzt! Wenn wir es haben, dann bist du frei!“
„Ich … Ich weiß es nicht.“
Boris schüttelte den Kopf.
„Njet, du weißt es sehr gut! Wir haben deinen Kollegen Juan gefragt. Du hast das Päckchen diesem Westdeutschen mitgegeben, sagte er, bevor er starb. Wir müssen seinen Namen haben, seine Adresse. Er könnte ein böser BND- oder MAD-Spion sein, weißt du. Auch wenn er angeblich nur so ein Mineraloge oder Vulkanologe war wie du.“
Monica war, als zuckten Stromschläge durch ihren Körper. Juan ist tot! Ewald? Ich muss dich retten, Ewald! Dich schützen vor diesen Bluthunden!
„Neinneinnein!“, schrie sie.
Sie setzte sich kerzengerade. Sie nahm ihre schwindenden Kräfte noch einmal beisammen und sah diesen Boris an. In ihr drehte sich alles. Aber sie musste ihn jetzt überzeugen. Unbedingt.
„Nein! Das hat Juan gesagt, um von sich abzulenken. Er hat die Probe mitgenommen, nicht dieser Deutsche. Juan wollte sie mitnehmen. Er hat es mir gesagt. Der Deutsche hatte nichts damit zu tun. Jedenfalls nicht nach dem, was ich weiß. Juan war auf das Teil scharf. Er hat immer wieder danach gefragt. Er wollte genau wissen, wo in den Anden es gefunden worden sei, und von wem.“
Monica schwitzte. Ihr fehlte die Luft zum Weitersprechen.
Boris sah sie schief an.
„Mäuschen, verarsch mich nicht!“, fauchte er grimmig. „Juan hätte uns gesagt, dass er das Teil hat, glaube mir. Wir sind da ganz genau. Wir haben da unsere Methoden. Er hatte es nicht. Garantiert. Und wenn du uns nicht sagst, wer es aus eurem Unilabor bekommen hat, dann müssten wir dich auch mit unseren Methoden, sagen wir, freundlicher befragen. Du willst doch nicht, dass mein Freund Pablo dich wiederbekommt, oder?“
„Nein“, stammelte Monica. „Juan hat das Päckchen mitgenommen. Er sagte, er wolle es dem Deutschen mitgeben. Aber vielleicht hat er dieses Metall ja auch lieber beim Schrotthändler zu Geld gemacht, dieser Schuft! Ich weiß es nicht. Ich hatte gesagt, er soll es dem Deutschen geben. Aber der hat mich später vom Flughafen aus angerufen, ich solle ihm das Teil per Luftpost zuschicken. Er habe das Teil nicht mehr von Juan mitbekommen, als er am Flughafen Bogotà eingecheckt habe.“
„Proklyatyy – Verflucht! Das ist nicht gut.“, grummelte Boris. „Das ist gar nicht gut!“
Gerettet! Monica sackte zusammen. Die Anspannung entwich aus ihrem Körper. Sie verstand: Der Russe hatte ihr die Geschichte abgekauft. Sie konnte Ewald da raushalten, und Juan war schon tot.
Scheiße, ich kann doch jetzt nicht auch noch alle Schrotthändler in Bogotà absuchen, die Sondermetalle angekauft haben, dachte Boris.
Er wandte sich ab, der Stahltür zu.
„Was jetzt?“, fragte Pablo. Er deutete auf die gefesselte Geisel.
„Willst du deine Geisel nicht mehr? Ihr habt uns Lösegeld versprochen!“
Boris fauchte ihn an.
„Einen Scheiß haben wir. Die halluziniert. Die ist nicht mehr zu gebrauchen. Spendier‘ ihr doch einen goldenen Schuss, du Kokainkocher, verkauf‘ sie in euer Bandenbordell oder schick sie doch gleich in den Dschungel – scheißegal.“
Die Stahltür knallte hinter Boris zu.
Pablo sah Monica an. Er wusste, was er nun zu tun hatte. Es durfte keine Spuren geben.
„Arme Chica!“, murmelte er. „Entspann dich. Keiner braucht dich mehr. Zum Abschluss spendiert dir der liebe Pablo noch eine schöne, letzte Reise.“.
Monica hörte ihn kaum noch. Sie nahm auch nicht mehr wahr, dass Pablo eine Spritze aufzog, um ihr den Goldenen Schuss zusetzen. Sie hatte gewusst, dass sie sterben musste – schon als die Entführer sie aufgegriffen haben. Sie war jetzt nur noch froh, dass sie es geschafft hatte, Ewald da raushalten. Dann spürte sie den Einstich. Und die Wärme dieser süßen Gewissheit: Ich habe dich da rausgehalten, Liebster. Da kam der „Trip“ ihrem Gehirn an. Sie spürte nicht mehr, dass er ihr den Tod gleich mitbrachte.
Boris saß in diesem Moment schon im Helikopter. Auf dem Weg zurück erhielt er über Funk seinen neuen Einsatzbefehl – Verhör eines U-Boot-Kommandanten auf Kuba. Sein KGB-Offizier teilte ihm die Umstände auch gleich mit. Ein russischer Geheimsatellit habe einen unbekannten Flugkörper über dem Atlantik registriert. Er sei in der Nähe eines amerikanischen Space Shuttles aufgetaucht, habe per Funk Sendungen aufgezeichnet und abgestrahlt und sei dann wohl, so die Radaraufzeichnungen, im Atlantik gewassert. Ein sowjetisches Tiefsee-U-Boot habe das wassernde Objekt bemerkt und am Meeresboden wiederentdeckt. Dort, wohin es getaucht war, sei per Radar eine über 700 m große Kugel am transatlantischen Seekabel identifiziert worden. Das U-Boot habe von der Kugel sogar einen Radar-Ping zurückbekommen. Doch als es sich der Stelle genähert habe, sei die Kugel weggewesen. Es habe nur noch Spuren zwischen den Manganknollen gegeben, und er, Boris, solle den U-Boot-Kapitän genauer befragen. Es bestehe der Verdacht, die Amerikaner haben eine neuartige, mobile Tiefsee-Station installiert, zum Abhören von Funk- und Kabelverbindungen oder zum Aussenden von Flugkörpern mit Nuklearsprengköpfen. Sicher, vielleicht hatte es von diesen Flugkörpern ein Bruchstück gegeben, das in den Anden runtergekommen war – aber diese Tiefseestation schien die Raketen mit ihren Flugkörpern auszusenden.
Boris verstand. Er blickte aus dem Helikopter. Er sah den Regenwald verschwinden. Auch die Kaffeeplantagen verschoben sich zum Horizont. Er hatte einen Ausläufer der Anden passiert und näherte sich der Karibik. Kuba wartete. Diese Tiefseestation war den Genossen jetzt viel wichtiger als so eine mögliche, nun aber auch noch nutzlose Informantin. Und für so etwas will das kolumbianische Medellìn-Kartell dann auch noch Lösegeld haben, dachte Boris verächtlich. Nein, die Genossen in Moskau haben Recht. Es gibt Wichtigeres. Schließlich ist Krieg, kalter Krieg. Da zahlen wir nicht auch noch Lösegelder für so wertlose „Zeuginnen“.
Kapitel 1: Omas Erzählungen
Es begann damals im Januar 1968. Ich saß in Omas Wohnzimmer, unter diesem seltsamen, runden Tisch. Der weiß gekachelte Kohleofen verbreitete wohlige Wärme. Oma war in der Küche und der Teekessel pfiff. Ich hörte sie auf ihrer Marmor-Arbeitsplatte ein Stück Marmorkuchen für mich abschneiden.
Ich spielte unter dem Tee-Tisch im Wohnzimmer. Der runde Tisch war mit Messing beschlagen. Oma hatte mir, wie schon so oft, erlaubt, aus dem Schränkchen mit Glasfenstern unter der Tischplatte das hölzerne Kästchen zu nehmen. Es lag auf meinem Schoß und meine Kinderhände öffneten die kleine Schatztruhe. Ich nahm die Replik des westfälischen Friedensthalers, legte sie unter ein Blatt Papier und rubbelte ihn mit einem Bleistift durch. Sein Bild wurde auf dem Papier sichtbar: Die Engel, die Stadtansicht mit der Stadtmauer und den gepanzerten Soldaten, die sich die Hand reichten. „Monasterium Vestphae“ stand über den Kämpfern, die ich als Kind für Ritter hielt, und „P. O. R. – Pax Optima Rerum“– der Wahlspruch des Westfälischen Friedens.
Ich griff wieder in das Kästchen. Unter dem alten Notgeldstück lag mein liebstes Spielzeug. Es konnte Schrauben und Nägel anziehen, Büroklammern, Pfennigstücke und Heftzwecken – aber keine Messingschrauben oder Groschen. Auch der Friedensthaler und das Notgeldstück wurden nicht von ihm angezogen, aber am gekachelten Ofen blieb es hängen. Und an der alten Badewanne in Omas Badezimmer.
„Oma, was ist das eigentlich? Warum bleibt das an manchen Sachen immer hängen und an anderen nicht?“
„Das ist ein Magnet, Jensilein“, sagte Oma, und ich erfuhr, dass er Eisen anzieht und Nickelgeld.
„Und Schrauben auch, Oma, guck mal!“, ergänzte ich begeistert.
Oma sah mich an und lachte von Herzen, als sie mich spielen sah.
„Ist dieses Ding selber auch eine Schraube?“, fragte ich. „Und woher habt ihr das?“
Oma reichte mir noch ein Stück Kuchen. Er duftete.
„Das hat Opa von einem Freund bekommen. Und der hat es aus Russland. Du weißt ja, Opa repariert Schreibmaschinen. Vielleicht gehört dieses Magnetstück zu den Feinwerkzeugen, die man dafür braucht. Aber er kennt es auch nicht so genau, weil es nicht aus Deutschland ist, weißt du.“
Oma stand auf.
„Magst du noch einen Kakao, Jensilein?“
„Gerne, Oma“, gab ich zurück. Als Oma das Wohnzimmer verließ um Milch auf dem Gasherd warm zu machen, spielte ich wieder mit dem magnetischen Metallstück. Es sah wirklich irgendwie wie eine Schraube aus. Als Oma wieder aus der Teeküche zurückkam, durfte ich ihren Marmorkuchen kosten und den Kakao. Sie nahm ihre Schürze ab und setzte sich neben mich in den Sessel. Dann erzählte sie mir, wie Opa an diese Schraube gekommen war, und sie versprach mir, als Gute-Nacht-Geschichte etwas aus unserer Familienchronik vorzulesen.
„Gute-Nacht-Geschichte?“, jubelte ich?
„Ja, Jensilein. Deine Mammi hat mir gesagt, dass du heute hier übernachten darfst. Sie hat mir eine Tasche mitgegeben mit deinem Schlafanzug und deinem Teddy.“
„Juchhuh!“
Ich jubelte. Ich hätte vor Freude platzen können, denn oft kam das nicht vor. Mutter wollte mich immer zuhause behalten, im Kinderzimmer. Doch manchmal gab es eben Ausnahmen. Wenn es in ein Ferienlager ging, zum Beispiel, oder auf Klassenfahrt. Oder wenn ich mal bei Oma Lotte schlafen durfte oder Oma Hanny.
Heute war Oma Lotte dran. Sie machte mir Hühnerbollen zum Abendessen mit Kartoffeln, Apfelmus und Roter Beete. Sie trank hinterher immer den Saft von der Roten Beete, da ich ihn nicht mochte. „Der schmeckt gut“, sagte sie. „Und er enthält Mineralstoffe, die gesund sind!“.
Ich verstand nichts von Kalium und Kalzium. Ich wollte nach dem leckeren Essen lieber gleich die Zähne putzen gehen und den Schlafanzug anziehen.
„Aber warum willst du denn jetzt schon ins Bett?“, fragte Oma überrascht. „Es ist doch erst sieben Uhr?“
„Na, umso eher bekomme ich die Gute-Nacht-Geschichte von dir vorgelesen!“, blinzelte ich ihr zu.
„Du bist mir ja einer!“, lachte sie. „Ein ganz schlauer!“
Dann sah sie mich an. Sie stellte die Teller beiseite, die sie zum Abräumen aufgenommen hatte, und setzte sich neben mich.
„Weißt du was, Jens? Ich setze gleich Wasser auf, dann spülen wir jetzt zusammen und danach lese ich dir die Geschichte vor, wenn wir auf dem Sofa sitzen. Du brauchst noch nicht ins Bett gehen, um sie hören zu können.“
„Au ja.“
Ich erinnere mich noch gut daran, wie sehr ich strahlte. Zuhause las mir niemand Geschichten vor. Mutter machte die Küche, und Vater musste oft länger arbeiten. Er reparierte Schreibmaschinen. Mein Bruder und ich, wir mussten dann immer einfach so ins Bett gehen. Schlafanzug an, waschen, kurz zusammen zum Schutzengel beten und dann: Gute Nacht.
Heute war alles anders. Ich durfte das Besteck spülen und es abtrocknen, während Oma die Teller spülte. Als ich das Besteck in die Küchenschrank-Schublade einsortiert hatte, trocknete sie unsere beiden Teller ab. Ihre Schürze wedelte im Takt ihrer Handbewegung, als das Handtuch über die Teller huschte.
„Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass unsere Vorfahren von einem Rittergut kommen?“, fragte sie mich.
Ich staunte.
„Echt, Ritter? So echt mit Rüstung, Lanze und Eisenhelm wie im Mittelalter?“
„Nun ja, nicht ganz im Mittelalter. Das ist länger her. Nein, du hast in deinem Stammbaum einen Vorfahren, der war Pächter. Er verwaltete ein echtes Rittergut. Es lag Skada.“
„Skoda?“
„Nein, Skoda ist eine Automarke. Skada. Das war ein Dorf. Bei Senftenberg und Geierswalde. Das liegt in Ostdeutschland.“
Es schien spannend zu werden. Oma kam aus Ostdeutschland. Da war die DDR, und als Kind war für mich alles, was von dorther kam, geheimnisvoll. Schließlich lag das hinter der Mauer, und alle Erwachsenen redeten davon, dass da die Ostzone war und dass man erschossen wurde, wenn man versuchte, von dort aus über die Mauer in unsere BRD zu kommen. Oma kam aus Thüringen, doch ihre Vorfahren aus der Säuberlich’schen Linie waren aus der Gegend um Geierswalde und Senftenberg. Ich stellte mir einen Wald vor, mit Geiern.
„Geierswalde liegt bei Bautzen in der Lausitz, nahe Hoyerswerda. Das ist Brandenburg, fast schon in Sachsen – beim Spreewald.“
In meiner Phantasie kreisten die Geier über einer bewaldeten, hügeligen Gegend. Ritter jagten durch das Gehölz, Fasanen hinterher, und irgendwo im tiefen Wald gab es eine kleine Ritterburg. Sie hatte keine Türme und Mauern und glich eher einer Gaststätte. Es war ein kleines Rittergut.
Oma erzählte weiter. „Das Gut Lohsa wurde ab 1599 als Rittergut bezeichnet. 1836 ging es in den Besitz der Familie von Loebenstein über. Die verpachtete es dann an Carl August Säuberlich. Das ist mein Urgroßvater.“
Oma ging in die Küche und holte mir einen Traubensaft. Währenddessen erzählte sie weiter.
„Das Gut hatte ein Herrenhaus, Ställe, Scheunen und Wirtschaftsgebäude wie zum Beispiel ein Wirtshaus, eine Gaststätte. Es lag bei Steinitz. Der Ort ist umgeben von mehreren großen Wäldern. Im Osten sind die Driewitz-Milkeler Heiden, das größte unbesiedelte Waldgebiet der Lausitz. Da ist auch der Eichberg. Auf dem Eichberg ist ein Denkmal, denn da kämpften 1813 die Truppen von Napoleon. In dieser Gegend zwischen Bautzen, Senftenberg, Kamenz und Hoyerswerda leben auch die Weiden.“
„Weiden? Bäume?“
„Neinnein.“. Oma lachte. Sie schüttelte den Kopf.
„Das sind die Oberlausitzer Serben oder Sorben. Sie sprechen ihre eigene Sprache. Du könntest sie nicht verstehen. Sie nennen Lohsa auf Sorbisch Łaz, und Steinitz heißt zum Beispiel Šćeńca, das bedeutet: „Junger Hund“. Und da ist auch noch so ein Rittergut.“
Ich kostete den süßen Saft. In meiner Vorstellung kämpften die Ritter inzwischen in Eichenwäldern. In den bewaldeten Hügeln stellten sich ihnen Drachen und fremde Räuber entgegen, die sie erschlagen mussten, um ihre Güter zu verteidigen.
Oma reichte mir ein Büchlein. Ich las den Titel: „Stammbaum der Säuberlich’schen Familie, geschrieben von Carl August Säuberlich, Kruggutsbesitzer zu Geierswalde 1856.“
Ich nahm noch einen letzten, großen Schluck Traubensaft. Als ich das alte Büchlein von Oma vorsichtig öffnete, stieß ich auf ein Bild. Auf dem Bild war ein alter Mann zu sehen. Er hatte eine Krücke oder einen Gehstock in der linken Hand. Über den Schultern trug er einen schwarzen Umhang oder Mantel. Und er hatte einen echt strengen Blick.
„Das ist Carl August Säuberlich, Mutters Großvater“, erklärte Oma. „Er ist 1801 in Lohsa geboren worden und starb 1878 in Geierswalde. Sein Enkelkind Anna Elise war meine Mutter. Sein Vater Johann Gottlob Säuberlich der Jüngere war der Rittergutspächter zu Skada. Er wurde 1779 geboren – da waren die Vereinigten Staaten von Amerika gerade drei Jahre alt.“
Ist das lange her, ging es mir durch den Kopf. Fast schon bewundernd blätterte ich weiter in dem Buch. Währenddessen räumte Oma das leere Saftglas vom Tisch zurück in die Küche.
„Ach ja, Amerika.“ Oma seufzte sehnsüchtig träumend.
„Hab ich dir schon erzählt, dass mein Bruder in Amerika war? Aber er war in Südamerika, mit der kaiserlichen Marine bis nach Argentinien. Dafür ist dein Opa nicht nur mit dem Schiff in ferne Länder gefahren, sondern sogar geflogen. Er war im ersten Weltkrieg bei der Zeppelinbrigade und flog in Belgien über die feindlichen Linien, um Luftaufnahmen zu machen.“
„Er hat Luft fotografiert?“
„Nein, Soldaten. Die Truppenaufklärung hat nachgesehen, wo feindliche Soldaten sind. So weit nach oben konnten die nicht schießen. Später wurde er verwundet, war Weihnachten 1917 im Lazarett. Dann war er Kriegsveteran. Und er wurde Büromaschinen-Mechaniker, wie ein Vater. Er wurde Innungsmeister bei der Handwerkskammer. Er hatte sogar Handelsbeziehungen bis nach Russland. Von da kam die Schraube, mit der du vorhin gespielt hast.“
Oma zeigte auf mein magnetisches Lieblings-Spielzeug. Dann fuhr sie fort: „Und weil Schreibmaschinen zu kriegswichtigen Industriegütern gehörten, musste er im 2. Weltkrieg nicht mehr an die Front. Das war unser Glück.“
Ich lächelte verlegen. Ich war wirklich beeindruckt. Ich erinnerte mich an ihre Bilder aus dem Fotoalbum. Opa zu Pferde. Opa am Zeppelin. Opa in Uniform an der Feldküche auf einem Acker irgendwo in Belgien, von wo aus die Truppen bis nach Verdun gekommen waren.
Als ich weiterblätterte erläuterte Oma die jeweiligen Seiten aus der Familienchronik. Sie zeigte dabei immer auf die Abbildungen. „Das da ist meine Oma. Sie hieß dann Emilie Ernestine Säuberling. Sie war Carl August Säuberlich Tochter und hat dann 1863 den Strumpfwarenfabrikanten Friedrich Wilhelm Herz aus Senftenberg geheiratet. Und 1885 hat dann ihre Tochter Anna Elise Herz in Senftenberg meinen Papa geheiratet. Der hieß Otto Köller und kam aus Niederlahnstein. Er wurde 1860 geboren und war königlicher Civilsupernumerar, ein Privatsekretär seiner Majestät des Königs Wilhelm I von Preußen.“.
Mein Kopf drehte sich, als es ins Bett ging. Oma hatte mir so viel erzählt. Aber es war spannend, und so ließ ich mir vor dem Einschlafen noch mehr aus ihrer Chronik vorlesen. Das, wo dort eine Prinzessin auftauchte. Dieser Friedrich Herz aus Senftenberg, erzählte Oma, war ihr 1859 in Kamenz begegnet. Er hatte der durchreisenden Prinzessin und ihren Hofdamen eine Erfrischung reichen dürfen, und ihre Begleit-Dame Marie und sie hatten ihm dafür gedankt. „Möge Ihnen der liebe Gott dafür gewähren, dass auch sie oder ihre Nachkommen einst reizvolle Dinge aus einer anderen Welt dafür bekommen – Ihnen und Ihrem freundlichen Bahnmeister Friedrich Köller hier!“, hatte die Dame Marie im Auftrag der preußischen Prinzessin gesagt. Omas Augen glänzten. Sie erzählte, wie die Prinzessin ihrem Vorfahren und seiner Familie wohl etwas richtig Besonderes und Nettes gewünscht haben muss, als sie ihm in diesem Eisenbahnwaggon begegnet war. Oma versprach mir, dass es sich bestimmt noch erfüllen werde.
„Und ich wünsch dir nun einen guten Schlaf, Jensilein. Und nun träum was Schönes!“
Oma verließ das Schlafzimmer. Ich machte es mir unter der Bettdecke bequem. Die Wärme umhüllte mich. Wie es wohl wirklich damals war?, dachte ich. Menschen sind ja so, dass sie etwas Erlebtes nachträglich ausmalen und mit Träumen und Wünschen ausfüttern, die sie haben. Ob aus dem netten Wunsch so wohl eine Art „Prophezeiung“ geworden war?
Ich konnte nicht einschlafen. Überhaupt nicht. Eine echte Prinzessin! So lag ich da, im Bett, und ich malte mir aus, wie das damals wohl gewesen sein könnte: Mein bürgerlicher Vorfahre war einer echten Kronprinzessin begegnet!
Kapitel 2: Die Verheißung von Kamenz
Ein heißer Tag des Spätsommers 1859 in jenem Waggon der Preußischen Eisenbahn. Der Waggon hielt in Kamenz. Dass er trotz Besetzung mit hoheitlichen Reisenden dort auf Gleis 3 zum Stehen kam, das war kein Zufall. Die drei edlen Damen, Kronprinzessin Augusta, Marie „Mimi“ von Buch und Cosima von Bülow, reagierten enerviert. Auch Bahnmeister Friedrich Köller war extrem nervös. Er hatte einen Plan. Er setzte seinen ganzen sächsischen Charme ein, und sein kleines Repertoire an höfisch-französischen Vokabeln, um die Hoheiten zu besänftigen.
„Pardon, Mesdames, wir haben een kleenes, technisches Probleem zu behem. Een Waggon is defekt, es gibt leeder ene kurze technisch bedingte Haltepause. Nutzen Sie sie zur Recréation, wir werdn ihnen frisches Mineralwasser vom benachbarten Kruggut zu Geierswalde anbieten!“
„Oh non, welch eine Malesse!“, stöhnte die Kronprinzessin und griff zur Bekämpfung ihrer Transpiration zu einem Fläschchen Zitronenwasser. Sie tupfte es mit einem feinen Seidentuch auf ihre Stirn.
Bahnmeister Friedrich Köller von Kamenz bedauerte sehr und vielmals. Ein weiterer Waggon sei sogar ganz ausgefallen, sächselte er, und es gebe daher zudem zwei Erste-Klasse-Passagiere, die die ehrenwerten Hofdamen untertänigst um die höfliche Erlaubnis bäten, im hoheitlichen Abteil der Prinzessin mitreisen zu dürfen.
„Bürgerliche?“, fragte Cosima von Bülow entsetzt.
„Aber Cosima, wir sind unserem Volk nahe!“, bestimmte die Prinzessin und erkundigte sich nach deren Namen.
„Es sind en Kruggutsbesitzer und en hoch ehrenwerter Strumpfwarenfabrikant, eure Hoohet!“, antwortete der Bahnmeister, „die Herren Friedrich Wilhelm Herz aus Senftenberch un Carl August Säuberlich, die ihrer Hoohet diese Bitte vortrachen.“
„Strumpfwaren – das interessiert uns. Die könnten wir noch brauchen. Lassen sie sie zusteigen, vielleicht kennen sie die neuste Mode aus London und Paris!“
„Umzugsmanager“ Friedrich Köller dankte untertänigst und vielmals, und er schloss seine Dankeshymne mit den Worten „Ich geh nu‘ die Herrn hooln.“. Eilig holte er die beiden „Erste-Klasse-Reisenden“ herbei. Der Strumpfwarenfabrikant Friedrich Wilhelm Herz aus Senftenberg war „zufällig“ der Schwager seiner Gattin Louise, einer geborenen Krechler. Sein ebenfalls „zufällig“ anwesender Schwiegervater war Carl August Säuberlich, der Kruggutsbesitzer zu Geierswalde. Friedrich Köllers Herz klopfte. Seine List hatte zum Erfolg geführt. Der Bahnmeister hatte sie auf Drängen seiner Verwandten eingefädelt und den technischen Defekt „arrangiert“, damit sein Schwager endlich eine Gelegenheit fand, um Kundschaft am Hofe zu werben. Und sein Schwiegervater wollte zum Dank für die Mitreisegelegenheit eine Einladung an die „gestrandete“ Prinzessin aussprechen, auf sein Kruggut zu Geierswalde natürlich.
„Hoffentlich können wir bald weiter, liebe Augusta!“, stöhnte Marie von Buch. Sie erbat sich etwas von dem Zitronenwasser aus dem Flacon der Kronprinzessin. Der Flacon wurde von einem Ornament mit Krone geziert. Prinzessin Augusta Marie Luise Katharina von Sachsen-Weimar-Eisenach war ihr voller Name, die Gemahlin des preußischen Kronprinzen Wilhelm I. von Preußen. Sie war von liberaler Gesinnung und hoher Bildung. Erneut trug sie etwas erfrischendes Zitronenwasser auf die in der Sommerhitze errötete Gesichtshaut auf. Dann redete sie weiter.
„Ja, Marie, es ist zu heiß heute. Erst recht für mich, die frisch gebackene Großmutter. Du weisst doch, meine geliebte britische Schwiegertochter Vicky hat meinem Friedrich endlich ein Kind geboren am.“
Marie nickte.
„Am 27. Januar im Kronprinzenpalais!“, fügte die Prinzessin stolz hinzu. Aber bitte sehr, liebste Marie!“. Sie und reichte ihr den Flacon. „Die Erziehung Wilhelms haben wir dem Kalvinisten Georg Hinzpeter übergeben. Und du kannst dir nicht vorstellen“, fuhr Augusta fort, „wie glücklich ich bin, seit Vickis und Friedrichs Hochzeit! Mein Triumph! Unsere Vicky, Princess Royal of England, Enkeltochter der britischen Königin Victoria – welch eine Partie für meinen Sohn Friedrich! Hinreichend von ihrer Herkunft geprägt kann sie ihm und vielleicht auch meinem Prinzgemahl das zeitgemäße Bild der liberalen, britischen Monarchie vorleben. Auch unser werter Alexander Gustav Adolf Graf von Schleinitz vom Hof in Koblenz schwärmte immer wieder von ihr!“
„Ach, ich hoffe mit dir, Liebste!“, sagte Marie. „Und ich glaube, dein Prinzregent wird sich diesem Ideal verschreiben.“
„Wie froh ich war, dass Wilhelm das letztes Jahr im November bei Regentschasftsbeginn verkündet hat! Er sagte im Staatsministerium, dass wir bemüht sein müssen, bei den veränderten Prinzipien der Rechtspflege das Gefühl der Wahrheit und der Billigkeit in alle Klassen der Bevölkerung eindringen zu lassen. Und dass unser Preußen in Deutschland moralische Eroberungen machen muss, durch eine weise Gesetzgebung, durch Hebung aller sittlichen Elemente und durch Ergreifung von Einigungselementen, wie par exemple dem Zollverband.“ Augustas Augen glühten. Schließlich war sie es, die ihrem Gemahl genau diese Wortwahl vorgeschlagen hatte.
„Ja, eine neue Ära in der Politik!“, strahlte Marie. „Er hält auf die Verfassung. Und er hat Fürst Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen zum Ministerpräsidenten berufen – Gott sei Dank! Dieser konservative Karl Otto von Manteuffel ist damit abberufen, und die Reaktionszeit mit ihm!“
„Vorsicht, wir sind noch nicht am Ziel!“, sagte die Kronprinzessin. „Mein Gatte ist noch immer Soldat mit Leib und Seele! Er neigt zur Übertragung militärischer Kategorien auf das zivile Leben. Disziplin! Stell dir nur vor, neulich bei der Truppenparade im Palais: Als das von den Stabsoffizieren ersehnte Diner kam, zog Wilhelm einfach nur seine Semmel aus der Rocktasche!“
„Unser Kartätschenprinz!“ schoss es Marie durch den Kopf. Marie „Mimi“ von Buch saß neben ihr, blond, schlank, und hochgewachsen. Sie war Diplomatentochter. Ihr Vater, preußischer Ministerresident zu Rom, war verstorben. Ihre Mutter hatte neu geheiratet. Sie war in Begriff, Marie mit nach Paris zu nehmen, um sie dort gemeinsam mit ihrer Großmutter in die feine Gesellschaft einzuführen. So bekam Marie Kontakt zu Alexander Freiherr von Schleinitz, der am Hofe zu Koblenz verkehrte, bei Kronprinzessin Augusta und ihrem Gemahl Wilhelm, dem Kronprinz. Marie hatte stets ein liebenswürdiges Lächeln auf den feinen Lippen
Marie und Augusta flüsterten sich noch etwas zu. Sie kicherten. Cosima von Wagner las in einer Druckschrift. Mit einem Ohr verfolgte sie dabei das Gespräch ihrer Freundinnen. Denn auch sie, Cosima Francesca Gaetana von Bülow, kannte Wagner. Sie war schließlich die uneheliche, mittlerweile aber auch anerkannte Tochter des Komponisten Franz Liszt.
„Ja, die Männer, unsere Prinzen!“, sagte Cosima. „Manchmal schlagen sie auch bei uns ein wie eine Kartätsche!“
Augusta und Marie sahen zu ihr rüber. Sie hatte ihre Druckschrift weggelegt.
„Du meinst deinen Hans?“, sagte Marie.
„Ja, ihn auch – und diesen göttlichen Richard!“
Und Cosima schwärmte Marie von ihrer Reise nach Zürich vor. Sie hatte sie letztes Jahr angetreten, direkt nach ihrer Trauung in Berlin und der anschließenden Hochzeitsreise mit ihrem Bräutigam Hans von Bülow. Und diese Reise war natürlich zunächst zu Richard Wagner gegangen, der im Gartenhaus der Villa Wesendonck wohnte. Denn ihr Gatte war einer der begabtesten Schüler ihres Vaters, des Pianisten Franz Liszt. Deshalb war er auch ein glühender Verehrer seines Freundes Richard Wagners. Cosima kannte Richard seit 1853. Sie war musikalisch hochbegabt, redegewandt und hatte eine starke Einbildungskraft. Und selbstverständlich ein Faible für Wagners Musik (und nicht nur für seine Kompositionen!).
„Aber nochmal zurück zu deinem Prinzen! Schau nur!“, sagte Cosima und reichte ihre Druckschrift der Prinzessin.
Augusta nahm das Blatt und las.
„Aus der Proklamation der Freisinnigen Vaterlandsfreunde vom 19. Juli 1859. Unsere Hoffnung richten wir daher auf Preußens Regierung, welche durch den im vorigen Jahre aus freiem Antriebe eingeführten Systemwechsel ihrem Volke und ganz Deutschland gezeigt hat, dass sie als ihre Aufgabe erkannt hat, ihre Interessen und die ihres Landes in Übereinstimmung zu bringen, und für einen solchen Zweck Opfer an ihrer Machtvollkommenheit sowie die Betretung neuer und schwieriger Bahnen nicht scheut.“
„Wie nett!“, lachte Marie. „Das schreiben die Freisinnigen?“
„Ja“, sagte Cosima, und sie zitierte weiter: „Die Ziele der preußischen Politik fallen mit denen Deutschlands im Wesentlichen zusammen. Wir dürfen hoffen, dass die preußische Regierung immer mehr in der Erkenntnis wachsen wird, dass eine Trennung Preußens von Deutschland und die Verfolgung angeblich rein preußischer Großmachtzwecke nur zu Preußens Ruin führen kann.“
„Das wird unseren Karl Otto von Manteuffel provozieren, das ist für ihn die Hölle!“, kicherte Augusta.
Plötzlich ging die Tür des Abteils auf. Der Bahnmeister und zwei gutbürgerliche „Reisende“ standen in der Tür, baten um Einlass.
„Dürfen wir zu Ihnen hereinkommen, werde Damen?“
„Bienvenu!“, sprach Prinzessin Augusta gutgelaunt, „Treten sie ein Messieurs!“
Die Herren traten ein.
„Eene Erfrischung gefällich?“
Der Bahnmeister stellte kühles Mineralwasser für die Damen bereit. Die beiden Herren setzten sich bescheiden seitlich auf eine Bank und begannen nach höflicher Danksagung eine Konversation über das Wetter, die Eisenbahn und über Strumpfwaren für die drei edlen Damen. Sie waren erstaunt über ihre guten Manieren und erfreuten sich an der Konversation, so dass sie die brütende Sommerhitze vergaßen.
Carl August Säuberlich sah sich im Abteil um. An der Wand hingen zwei Plakate. Eines erinnerte an den fünften Todestag des Lokomotiv-Fabrikanten August Borsig, gestorben 6.7.1854. Daneben hing ein bahnamtlicher Hinweis mit der Empfehlung, Erster-Klasse-Billets demnächst besser vorzubestellen, denn es würden für hoheitliche Herrschaften mehrere Sonderzüge werden, die die erkrankte Majestät Friedrich Wilhelm besuchen wollen. Und eine Postkarte hing dort, vom Kruggut zu Geierswalde. Friedrich hatte wirklich an alles gedacht.
Die höfliche Konversation der Hofdamen mit den beiden Herren zeigte mittlerweile auch etwas von deren Gelehrsamkeit, denn sie mühten sich redlich, den Gesprächsthemen zu folgen. Augusta parlierte mit ihnen über von Humboldt, über die Publikation einer neuen These des Naturforschers Darwin über Ursprung der Arten und über die Mode in der neuen Welt jenseits des Atlantiks. Sie erzählte den Herren Herz und Säuberlich vom preußischen Gesandten von Gerolt, der dort Strumpfwarenfabrikate zu kaufen suchte, und von einem von ihm unterstützten Astronom. Er war von Istanbul nach New York gekommen, um Kometen und Asteroiden am Nachthimmel zu suchen.
„Und ihre Hoohet menen, de preussche Gesandtschaft in Amerika wünscht, Strumpffabrikate in Preußen zu erwerm?“, säuselte Friedrich Wilhelm Herz hoffnungsvoll.
„Unsre Fabrikaate wärn für sie villeisch wie kostbare Dinge aus eener andern Welt!“, fügte er werbend hinzu.
„Wir werden sehen, bester Mann! Ihr Bemühen ist reizend! Möge Ihnen der liebe Gott dafür gewähren, dass auch sie oder ihre Nachkommen einst reizvolle Dinge aus einer anderen Welt dafür bekommen – Ihnen und Ihrem freundlichen Bahnmeister Friedrich Köller hier!“, sagte Marie.
Ihm wurde es warm ums Herz. Der freundliche Wunsch aus dem Mund der Prinzessin ging ihm runter wie Honig. Sie strahlten so etwas Prophetisches aus – sollten jetzt etwa auch ihm „kostbare Dinge aus eener andern Welt“ zukommen? Reizvolles vom Königshof? Aufträge aus Amerika? Friedrich Wilhelm Herz strahlte über das ganze Gesicht. Fortan glaubte er fest an die Erfüllung des Wunsches der Prinzessin und grub ihn tief in sein Gedächtnis ein.
„Wir werden sie gern unterrichten, mein Herr, falls ihr Angebot dort von Interesse sein sollte.“, sicherte Augusta ihm ergänzend zu. „Wir müssen ihn anschreiben. Herr von Gerolt weilt seit Januar 1859 wieder in Washington, denn Graf von Schleinitz hat seine Versetzung nach Europa ablehnen müssen.“
„Hat er sich nicht auch auf Empfehlung Humboldts für diesen Peters eingesetzt?“, fragte Marie von Buch.
„Ja, Mimi“, sagte Augusta.
„Wer?“, fragte Cosima von Bülow.
„Na, unser Astronom Christian Heinrich Friedrich Peters. Inzwischen ist er von Istanbul aus nach New York gegangen, um eine neue Sternwarte zu bauen. Er bat uns im Außenministerium um finanzielle Mittel hierzu. Er meint, dass auf der Sonne irgendwelche gewaltige elektrische Stürme vorherrschen. Er will sie beobachten, Kometen und Asteroiden suchen.“
Ein Lächeln ging über das Gesicht der Prinzessin. „Ja, ich hörte davon: Er hat einen Kometen entdeckt, vor zwei Jahren. Und stellt euch vor, meine Lieben: Von Gerolt sagte mir, Peters wolle auch mal einen neuen Planeten finden. Er würde ihn mir zu Ehren Feronia nennen, weil er gehört habe, dass ich Feronia verehre, die Göttin des Waldes.“
Wie romantisch!, dachte Cosima. Sogleich tauchten weitere mythologische Figuren in ihren Gedanken auf, die in Wagners Kompositionen vorkamen.
Alsbald konnten die Damen ihre Reise durch die Lausitz fortsetzten und sie parlierten über den Romantiker von Eichendorff, der vor zwei Jahren auf Schloss Lubowitz in Schlesien verstorben war. Ihm zu Gedenken hatten sie diesen Bahnausflug nach Schloss Lubowitz angetreten. Die Rast im Kruggut zu Geierswalde kam ihnen dabei sehr gelegen.
Bahnmeister Friedrich Köller fielen die Augen zu. Frisch heimgekommen hatte er seine Beine auf der Chaise longue eigentlich nur kurz hochlegen wollen. Er schlummerte ein, noch bevor er zu Bett gegangen war. Er fand sich mit seiner Chaise longue plötzlich in besagtem Eisenbahnabteil wieder, dem Erste-Klasse-Abteil der Prinzessin, das mit der Bahn über den Wolken zu schweben schien. Carl August und Friedrich Wilhelm saßen mit ihm auf der Sitzbank, und ihnen gegenüber stand das Zitronenwasser auf einem Tischchen – ein Schälchen mit der Aufschrift „Säuberlich“, eines mit der Aufschrift „Hertz“ oder „Herz“. Durch das offene Abteilfenster schwebten drei Engel vom Sternenhimmel her hinein und sangen ein Lied über tugendhaft säuberliche Herzen. Die Engel nahmen den Herren gegenüber Platz.
„Ich bin Cosima, Engel des himmlischen Musikers Richard!“, stellte sich der eine Engel bei Friedrich Wilhelm vor. „Und ich bin Augusta, Engel eines himmlischen Politikers.“, sagte der andere Engel zu Carl August und erfrischte sich aus dem Wasserschälchen mit der Aufschrift „Säuberlich“. Friedrich Köller hörte Gesänge. Der Engel da sieht aus wie die Kronprinzessin, dachte er. Nur jetzt hat sie Flügel, fast wie ein Vogelmensch, und eine Art Schnabelmund. Die Engelsstimmen klangen wie ein Zwitschern oder Trällern, und am Unterarm trugen sie eine große, auffällige Armbanduhr mit einem quadratischen, flimmernden Bild. Es wechselte ständig, wenn die Engel darauf tippten. Sie tippten darauf, als sei es eine dieser neuen, mechanischen Schreibmaschinen. Wie diese dänischen Skrivekuglen, die man von Pastor Rasmus Malling-Hansen vom dänischen Taubstummeninstitut bei Hofe hat und in den königlich-preußischen Ministerien, dachte er.
Ihm gegenüber nahm der Engel mit dem Gesicht von Marie von Buch Platz. Er stellte sich mit „Mimi, Gräfin von Schleinitz und Puntirjan“ vor. Sie seien Boten eines himmlischen Sternkundlers, sagte er. Der heiße Peter Puntirjan, nach dem Heiligen Petrus. Der Bote fuhr fort, er habe eine Botschaft an ihn.
Friedrich Köller schluckte. Er sah die Engelgestalt mit großen Augen an. Er war unfähig zu sprechen. Ein Zwitschern drang in seine Ohren, wie von den Vögeln aus den Wäldern der Lausitz. Er verstand es nicht, aber sein Kopf schien es ihm in seine Sprache zu übersetzen. Friedrich Herz, Carl Säuberlich und er seien auserwählt worden, Mitglieder eines „Familienschwarmes“ zu sein, in dem einige Generationen später ein Nachkomme Besuch aus dem Himmel empfangen werde. Der Besuch werde ihm „ein reizvolles Ding“ bringen „aus einer anderen Welt“. Es werde ihm vom Sternenhimmel her geschickt und von einem Händler überbracht, in die Hände seines Enkelkindes. Das Kind werde dann erneut Besuch bekommen, dieses Mal persönlich, um das reizvolle Ding wieder heimzuholen in die Welt der Sterne.
Plötzlich schien die Erde zu rumoren. Ein Erdbeben wie vor einem Vulkanausbruch. Friedrich erschrak. Er öffnete seine müden Augen. Seine Gattin stand vor ihm. Sie rüttelte heftig an der Chaise longue, auf der er eingeschlafen war.
„Friedrich, du bist ja kaum wach zu kriegen! Komm zu Bett!“, sagte sie ungeduldig.
„Ja, ich komm!“, antwortete Friedrich im Halbschlaf und scheuchte die Traumbilder und –engel fort.
„Nun erzähl doch! Dein Tag muss ja wirklich aufregend gewesen sein!“, drängte seine Frau. Sie platzte fast vor Neugier.
„Ja, stell dir vor, was Carl August und ich hinbekommen haben!“, begann Friedrich seinen Bericht von der Begegnung mit der Kronprinzessin und ihrer Freundin „Mimi“ von Buch.
Als er seinen Bericht an die Ehefrau beendet hatte, beschloss er, das Ereignis auch kurz zu notieren und es als Nachtrag in die vor drei Jahren verfasste Familienchronik zu übernehmen, um es späteren Generationen weitergeben zu können. Und so kam es, dass die „Chronik der Köller‘sch-Säuberlich‘schen Familie“ eines Tages einen Zusatz erhielt über die Kamenzer Prophezeiung der Hofdame „Mimi“ von Buch – die Prophezeiung eines „reizvollen Dinges aus einer anderen Welt“. Eines Tages sollte es in den Besitz eines der Enkelkinder gelangen, hieß es, aus einer anderen Welt. Vielleicht könnte es ja sogar wie ein Stern vom Himmel fallen, dachte Friedrich Köller und malte sich das Ereignis in den schönsten Farben aus. Mehr wusste er nicht. Doch denen, die nach ihm kamen, sollte es den Tod bringen – und ein neues Zeitalter.
Kapitel 3: Das Licht am Südseehimmel
Ich blickte auf. War es damals wirklich so? Habe ich mir die märchenhafte Begegnung mit der Prinzessin gerade so vorgestellt? Oder war ich eingeschlafen und hatte sie geträumt? Ich wunderte mich, denn diese Sprache – das „Sächsische“ – kannte ich nicht. Ich hatte mir die Begegnung mit der Prinzessin wohl nur ausgemalt – und ihre Verheißung von einem Ding aus einer anderen Welt. Ich musste an Opa denken, der im Zeppelin geflogen war und auch in alten Flugzeugen. Er schwebte über den Fronten und sah unten auf dem Boden die Kämpfe – weit unten, wie in einer anderen Welt. Und ich dachte an Omas Bruder und seine weite Schiffsreise in die Neue Welt, nach Argentinien. An fremde Länder und ihre Bewohner, völlig fremde Welten.
Dann schlief ich ein. Doch mein Gehirn arbeitete weiter (Es ist ja manchmal so, dass etwas verborgen geschieht. Es scheint inaktiv zu sein, und ohne dass wir es wahrnehmen, geschieht dann doch etwas – ohne uns bewusst war, dass da etwas kommen wird). Und plötzlich war ich auf einem Schiff statt im Zeppelin, und weitere acht Jahrzehnte zurück in der Vergangenheit – in einer Zeit, die mehrere Jahre vor der Geburt von Johann Gottlob Säuberlich dem Jüngeren lag, diesem Rittergutspächter zu Skada. Das Schiff, auf dem ich stand, war in der Südsee. Ich war wie ein unsichtbarer Geist, der eine Mannschaft von Entdeckern fremder Welten begleitete.
Joseph Banks stand in diesem Moment an Deck und genoss die milde, warme Abendluft der Südsee. Er war ein angesehener Mann, hoch gelehrt. Und er hatte ein Vermögen von zehntausend Pfund bezahlt, um an der Expedition auf der Endeavour teilnehmen zu können. Es war Abenddämmerung, der 11. Juni 1770. Banks blickte in Richtung Sonnenuntergang. Er nahm Sturmtaucher und Albatrosse wahr, und neue, unbekannte Arten von Seevögeln.
„Hoffentlich geht es bald wieder nach Süden!“, dachte Banks. „Bestimmt gibt es noch so viele neue Arten von Lebewesen zu entdecken, wenn wir den Südkontinent erst einmal erforscht haben.“.
Ein Poltern riss ihn wurde aus seinen Träumen. Hermann Diedrich, sein junger Sekretär, kam an Deck. Er wurde von Daniel Solander begleitet, dem schwedischen Botaniker, der Charles Green im Schlepptau hatte. Die gelehrten Herren hatten beschlossen, ihre wissenschaftliche Konversation an Deck der HMS Endeavour fortzusetzen. Ihre Diskussionen lenkten Banks von seinen Träumen ab.
„Ja, ich sage Ihnen, es stimmt: die Sonne muss drei Mal so weit entfernt sein von uns wie die Venus!“, rief Green erregt. Green war als Astronom an Bord. Er hatte die Messung auf Tahiti vorgenommen, letztes Jahr am 3. Juni.
Banks schwieg beeindruckt. Er dachte darüber nach, ob es auf der Venus wohl auch unbekannte Arten von Tieren und Pflanzen geben könnte. Er wollte Green und Solander nach deren Meinung dazu befragen, doch dann dachte er wieder an seine Aufgabe. Er sollte zunächst einmal die auf dieser Expedition neu entdeckten Tier- und Pflanzenarten zu beschreiben, nicht spekulieren. Gerade wollte er Diedrich ein paar Gedanken zur Niederschrift diktieren, da unterbrach ihn Solander.
„Hoffentlich hat der Smutje heute was ordentliches gekocht!“, brummte der Schwede. Er hatte einen Mordshunger bekommen, und er war froh, dass sie nicht nur Seemanns-Rationen bekamen. Täglich nur ein Pfund Schiffszwieback, Pökelfleisch, ein Schlag Erbsenbrei und eine Gallone Bier, das wäre absolut nicht sein Fall gewesen.
„Gehen wir!“, schlug Green vor.
„Ja!“, antwortete Solander erleichtert. Er blickte zu Banks rüber.
„Ja, gehen sie nur!“, knurrte dieser. „Ich bleibe noch kurz an Deck!“
Solander, Green und Diedrich wandten sich von der Reling ab und wollten unter Deck gehen. Banks war froh, wieder seine Ruhe zu haben. Er blickte über die Reling zu den Seeleuten herüber. Der Mann am Senkblei fischte Seegras vom Senkblei. Ein treibendes Holzstück zeigte ihm, dass Land in der Nähe war. Die Männer fluchten, dass sie die Meerestiefe schon wieder ausloten mussten – Kapitän Cook war wie besessen hinter den Messwerten her. Zwei Jahre schon waren sie auf See. Sie wollten endlich wieder heim, oder zumindest zurück nach Tahiti. Aber Cook befahl immer wieder, nordwärts abzusegeln und die Ostküste Neuhollands zu vermessen. Er wollte seinen kartographischen Beweis für die Existenz des Südkontinents, unbedingt. Die Crew jedoch murrte immer lauter.
Banks hörte, wie die Seeleute über ihre Essensrationen maulten, immer nur Schiffszwieback, Pökelfleisch und Bier. Sie widerten ihn an. Er musste daran denken, wie Cook einige von ihnen hatte auspeitschen lassen, weil sie die Tahitianerinnen vergewaltigt hatten, doch sie taten es immer wieder. Bei jedem Landgang. Banks hatte einen von ihnen gefragt, warum sie das tun. So lange es dafür vom Kapitän immer wieder die gleiche Strafe gab, hatte er ihm geantwortet, fanden sie das nur fair. „Pack!“, schoss es Banks durch den Kopf. Ihm fiel der Sekretär ein, dem Einige aus der Crew im Streit beide Ohren abgeschnitten hatten. Cook hatte auch diese Tat verurteilt, einige Tage bevor sie dann tatsächlich „Neuholland“ entdeckt hatten.
Banks gähnte. Er verließ die Reling. Er entschloss sich, den anderen Gelehrten zu folgen. Green, Solander und die Anderen lagen bereits satt und müde in ihre Kojen. Sie schliefen tief. Es war eine ruhige Nacht. Leutnant John Gore stand zur Nachtwache an Deck. Er ließ die Männer weiterhin ausloten, welche Untiefen es gab, und freute sich auf den Schichtwechsel. Er war auf Order des Kapitäns für den an Durchfall erkrankten Maat eingesprungen, und jetzt endlich ging dieser Einsatz vorüber. Pflichtbewusst sah er noch einmal über die Reling. Diese verfluchten Untiefen! Da plötzlich nahm er im Wasser etwas wahr, was dort absolut nicht hätte sein dürfen. Das Blut schien ihm in den Adern einzufrieren. Er erstarrte vor Schreck. Er brauchte ganze vier Sekunden, um sich von dem Schock erholen und wieder Luft holen zu können, dann aber atmete er so tief ein, wie er konnte, und schrie sich fast die Seele aus dem Leib.
„Volle Kraft zurüüückk! Segel streichen! Wir laufen auf Gruuunnd!“
Gore presste seine Meldung nach Leibeskräften aus der Brust, brüllte aus voller Kehle, – doch es war zu spät. Schon erbebte das Schiff. Ein heftiger Ruck erfasste ihn, ein krachendes Geräusch erfüllte den Rumpf. Leutnant Gore wäre fast über die Reling gefallen, hätte er sich nicht im Schreikrampf festgekrallt. Banks, Green, Solander und Dr. Sullenburg fielen aus ihren Kojen. Dann noch ein Poltern. Eine Gruppe von Seeleuten oben an Deck hatte den Halt verloren und war zu Boden gefallen. Kapitän Cook stürzte in Nachtkleidung an Deck.
„Was ist passiert?“, brüllte er und stürmte zur Reling. Er klammerte sich an ihr fest, beugte sich vor und erstarrte vor Entsetzen. Ein Korallenriff. Die HMS Endeavour, das Flaggschiff der Südsee-Expedition, war auf Grund gelaufen. Nun schien das Schiff verloren – die ganze Expedition drohte plötzlich zu scheitern, die Karten, die naturwissenschaftlichen Proben aus der Neuen Welt, die Berichte vom Venustransit, die Crew: Alles war in Gefahr!
Unter Deck war Gebrüll, die Männer aus ihren Kojen stürzten an Deck.
„Wassereinbruch unter Deck!“, brüllte Gore erregt. „Wir sinken!“
„Kanonen und Ausrüstung über Bord!“, befahl Cook.
Nun hasteten auch Banks und Green an Deck. Verständnislos sahen sie den Kapitän an.
„Wir müssen die Endeavour um jeden Preis wieder flott machen – oder wir sind dem Tode geweiht!“, brüllte er ihnen zu.
Die Crew schmiss hastig allen Ballast von Bord. Bloß nicht sinken!
Das Schiff wurde leichter, kam los. Wasser drang unter Deck ein, immer mehr. Sie befanden sich bei Cape Tribulation, 23 Kilometer vor der rettenden Küste.
„Segel unter dem Schiff durchziehen!“, brüllte Cook. Er hatte sich auf diese alte Seemannslist besonnen. Das Segel wurde an Tauen unter den Rumpf des Schiffes gebracht, um den es sich legte. Der Wasserdruck schloss das Leck zumindest teilweise, und so konnten sie etwas weiter kommen, bevor die Endeavour volllief. Das Leck war fast wieder dicht, und das Schiff dümpelte vor der Küste. Cook ließ das Schiff auflaufen und auf die Seite kippen, und die Crew konnte das Loch im Rumpf flicken mit allem, was sie an Land fanden.