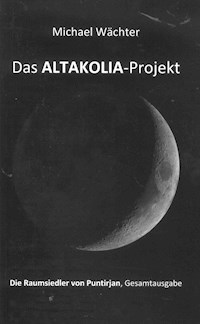6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Unsere Daten könnten über facebook, WhatsApp oder Google ausspioniert werden? Datenschutz ist unzureichend - oder auch hinderlich? Das Alles wird nach dem Lesen dieser Erzählung eher lächerlich erscheinen. Und unbedeutend. Unsere Informationen wie auch das Internet insgesamt könnten nämlich auch dazu benutzt werden, das Ende der Menschheit herbeizuführen - jedenfalls der Menschheit, wie wir sie heute kennen. Und es kann sein, dass genau das in Kürze passieren wird. Vielleicht sogar schon jetzt, da dieser Bericht erscheint... So beginnt der Bericht von Jens. In den 1980er Jahren stieß er eine geheimnisvolles Gerät, das XENOPHON. Es änderte sein Leben. Fortan musste sich davor fürchten, seine Entdeckung zu veröffentlichen. Geheimdienste, Medienreporter und Konzerne hätten die Jagd auf ihn eröffnet. Panik wäre ausgebrochen, weltweit, und ganze Armeen wären alarmiert. Doch jetzt, im Jahr 2036, muss er die Folgen seiner Veröffentlichung nicht mehr fürchten. Jetzt, kurz vor seinem Tod, kann er die Menschheit warnen, was auf sie zukommt. Denn es könnte ihr Ende sein ... Die Astronomen haben in den letzten Jahren Hunderte von neuen Exoplaneten entdeckt. Sie sind auf der Suche nach einer zweiten Erde, einer neuen Heimat. Die Puntirjaner haben sie schon gefunden. Und sie kommen - in unser Sonnensystem. Jens beginnt den Bericht von seiner Entdeckung auf Puntirjan, einer für uns völlig fremden und doch liebenswürdig menschlichen Welt. Sie ist von fremden Wesen bevölkert. Diese hochintelligenten Vogelmenschen haben begonnen, den Weltraum zu besiedeln: Ihre Agenten Tüngör und Jenis brechen eines Tages aus ihrem Alltag auf, jeder in einen anderen Bereich. Tüngör begibt sich in den Dschungel am Grenzfluss Sar, Jenis in den Weltraum. Unter Lebensgefahr bekämpfen sie feindliche Militärs und retten das größte und umfassendste Raumfahrt-Projekt ihrer Heimatwelt. Zur Belohnung werden sie auf eine Raumstation versetzt. Ein Mord geschieht. Dann ein Terroranschlag. Jenis wird Stationskommandant. Unter seinem Kommando schafft es die Besatzung im Anflug auf das Ziel schon aus der Ferne, auf der ihr so fremden Welt historische und auch schreckliche Ereignisse zu registrieren, die sie umhaut: Nuklearwaffen detonieren, Raumsonden und Raumgleiter starten. Herrscht dort unten Krieg? Droht ihnen Gefahr? Am Ende entschließt sich die Besatzung, trotzdem dort zu landen und einen direkten Kontakt zu Ihren Bewohnern aufzunehmen. Sie nennen sich die "Menschen". Wie werden sie reagieren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Titlepage
(Neuauflage des Ebooks „Das ALTAKOLIA-Projekt“ von Michael Wächter)
Mein Bericht
Sie haben Angst davor, Ihre Daten könnten über facebook, WhatsApp oder Google ausspionieret werden? Sie finden Datenschutz unzureichend – oder auch hinderlich? Das Alles werden Sie nach dem Lesen meines Berichtes eher lächerlich finden. Und unbedeutend. Informationen können nämlich auch dazu benutzt werden, das Ende der Menschheit herbeizuführen – jedenfalls der Menschheit, die wir sie heute kennen. Und ich weiß, dass genau das in Kürze passieren wird. Vielleicht sogar schon jetzt, da dieser Bericht erscheint.
Ich musste mich mein Leben lang davor fürchten. Diese Erkenntnis zu veröffentlichen, das bedeutet, dass mich von jetzt an Geheimdienste, Medienreporter und Konzerne jagen werden, dass weltweit Panik ausbrechen wird und ganze Armeen in Alarmbereitschaft versetzt werden. Doch ich werde bald sterben, denn ich bin ein alter Mann – so alt, dass ich die Folgen dieser Veröffentlichung für mich nicht mehr fürchten muss. Mein Ende kommt. Ich kann mein Gewissen endlich erleichtern und die Menschheit vor dem warnen, was auf sie zukommt. Es könnte ihr Ende sein.
Unsere Daten und Dateien, alle Informationen über die Menschen und ihre Gesellschaft werden abgefangen und ausgewertet, schon seit etlichen Jahrzehnten. Sie werden abgehört von einem Netz von Minisonden am Meeresboden und im All, abgefangen aus dem Internet und aus allen irdischen Funk- und Fernsehnetzen. Und sie landen nicht nur bei facebook, bei Google oder bei ausländischen Geheimdiensten. Sie werden von viel, viel größeren Macht abgefangen, von viel mächtigeren Wesen benutzt. Sie sind fremd, völlig fremd. Wir Menschen kennen sie nicht und wissen nichts über sie. Nur ich weiß etwas von ihnen. Ich weiß, dass sie sich darauf vorbereiten, die abgefangenen Informationen zu benutzen, die Erde von uns zu übernehmen.
Als ich jung war, hatte ich Kontakt zu einem von ihnen. Der Kontakt kam in den 1980er Jahren über ein geheimnisvolles Gerät zustande, eine Art Funkmodul – ein Artefakt unbekannter Herkunft aus Südamerika. Erst später verstand ich, dass das ein Moment war, der die Geschichte der Menschheit total verändern wird – oder beenden.
Das fremde Wesen nannte sich Jenini und arbeitet im Interfunknetz der Puntirjaner. Mein Kontakt zu ihm begann vor vierzig Jahren, und das Funkgerät der Fremden habe ich irgendwann XENOPHON genannt – nach dem griechischen Wort xenon für fremd und der Endsilbe des alten Wortes Funktelephon (Handies und Mobiltelefone gab es ja in den 1980er Jahren noch nicht).
Doch die Fremden, ihre Mission zum Abfangen unserer Daten, das begann schon lange vor meiner Zeit. Vor meiner Geburt. Ihr Projekt hat sich in die Geschichte der Menschheit „eingeschraubt“. Sie hat es nicht bemerkt. Ausgerechnet ich wurde dann in diese Sache verwickelt, durch den Funkkontakt über das XENOPHON. Ich hatte keine Wahl. Aber ich konnte herausfinden, was vor sich ging. Und es jetzt, da mein Leben bald enden wird, doch noch veröffentlichen. Ich hoffe, mein Bericht kann den Lauf der Geschichte noch ändern.
Mein Freund Ewald damals konnte es nicht. Er wurde als Student Augenzeuge des Ereignisses. Doch man glaubte ihm nicht. Er landete in der Psychiatrie. Ein weiterer Augenzeuge war sein damaliger Professor. Er verschwand danach und wurde nie wieder gesehen.
Ich habe geschwogen. Die Menschen hätten sonst gedacht, auch ich hätte eine Schraube locker. Doch komischerweise war es genau so eine Art Schraube, durch die die Fremden in unsere Menschheitsgeschichte eingetreten sind. Sie werden unsere Daten benutzen, für ihre Zwecke – notfalls auch gegen uns.
Mein Name ist Jens. Meinen Nachnamen möchte ich aus Rücksicht auf meine Familie und Freunde nicht angeben. Meine Geschichte hätte jedoch jedem passieren können. Jedermann hätte der Finder oder Besitzer des XENOPHONs werden können (Darum hatte ich auch die Idee, mich Jedermann nennen).
Ich weiß, dass mein Bericht die öffentliche Aufmerksamkeit erreichen wird. Er wird alles ändern. Denn es muss etwas getan werden. Sofort. Denn das Internet hätte nicht nur gegen Datenhändler und Terroristen gesichert werden müssen.
Ich kann es nur nocheinmal wiederholen: Die Fremden werden unsere Daten nutzen und die Gesellschaft verändern. Sie vielleicht sogar ganz abschaffen. Und die Zeit der Menschen könnte dann enden. Unsere Zeit.
Es könnte schon jetzt passieren. Deshalb hoffe ich, mein Bericht kommt nicht zu spät. Ich erzähle darin einfach alles, was ich seit damals über die Ereignisse herausgefunden habe, die zur Ankunft der Fremden in unserer Welt geführt haben.
Ich erzähle, als ob die Fremden uns Menschen ähnlich wären – doch sie sind ganz anders als wir. Und ich erzähle am Ende auch ganz neutral, wie ich als Jens Jedermann damals zu diesem XENOPHON-Kontakt kam. Denn wie gesagt: Das war vor rund fünzig Jahren, und ich nicht wichtig, doch die Mission der Fremden begann lange, sehr lange vor meiner Zeit.
Veröffentlicht in Münster / Deutschland, am 6.6. 2036, um fünf vor zwölf.
Jens Jedermann
Der Anfang: Dschersi’s Modul
Dschersi schwitze. Seine Hand zitterte so sehr, dass er das kleine Kommunikationsmodul kaum noch halten konnte. Er war hochnervös, und es kostete ihn eine Menge an Kraft, seine Nervosität vor Cisgör zu verbergen. Er hatte das Gefühl gleich zu platzen, wenn dieser lästige Kollege nicht gleich die Flatter machen und ausfliegen würde, ab in seinen Feierabend. Schließlich hatte der kleine, alte Dschersi noch etwas vor. Und Cisgör sollte das nun wirklich nicht mitbekommen.
„Ich prüfe eben noch die Steuerdüsen-Programmierung. Sofort fertig!“, rief er und schob das kleine Modul zurück in die Kitteltasche.
„Gut so!“, entgegnete Dschersi. Genervt fummelte er am Empfänger der Sonde herum. Sein heimlichesVorhaben, dass er hierin noch ein zusätzliches Kommunikationsmodul einbauen wollte, war eigentlich ganz harmlos. Er wollte sein Zusatzmodul, das XENOPHON, lediglich deshalb mit einbauen, weil es neben etwaigen Notrufen des Landeteams auch noch spezielle Funksignale der Fremden auffangen konnte, die sie belauschen wollten.
Doch sein Vorhaben sollte unabsehbare Folgen haben. Ohne Dschersis XENOPHON hätte es den Erstkontakt zwischen zwei grundverschiedenen Welten so niemals gegeben, und ein Dutzend Teammitglieder hätte ihn überlebt.
„Dschersi, altes Haus, kein Feierabend?“
„Alt? Ich helf‘ dir gleich!“, krächzte Dschersi zurück. Er stand kurz vor dem Ende seiner beruflichen Laufbahn, ja seines Lebens überhaupt. Er war Informationstechniker, der älteste Experte im Haus. Trotz seiner altersbedingten Gebrechlichkeit arbeitete er noch immer mit den IPO-Raumfahrttechnikern zusammen an der Programmierung der „Intersystemar“-Raumsonde. Auch wenn er manchen Kollegen als verkalkt oder spinnert galt, mit seinen Erfahrungen und beruflichen Fähigkeiten war er noch immer unverzichtbar. Er hatte schon immer die Idee gehabt, den Innereien der high-Tec-Sonde sein kleines Modul hinzuzufügen, welches ihr späteres Wiederauffinden ermöglichen sollte. Aber die jungen Betonköpfe der IPO hatten es ihm aus dem Bauprogramm gestrichen, sein Lebenswerk. Und das, obwohl seine Daten eine mögliche Überlebenshilfe für die künftigen Expeditionsteilnehmer sein konnten. Also musste er sein Modul heimlich an der Intersystemar-Sonde anbringen, unbemerkt und trotz alledem.
„Und?“
Cisgör, sein Kollege, sah ihn neugierig an. Endlich wollte Cisgör heim.
„Nein, Cisgör, ich kontrolliere nochmal das Gyroskop. Ich bin nicht sicher, ob es die Sonde so stabilisieren kann – die Lageregelung könnte noch eine kleine Unwucht aufweisen. Unser Baby soll auf seiner Reise doch keine Kreiseldrift bekommen!“
„Du bist und bleibst ein Perfektionist!“, lachte Cisgör und begab sich zum Ausgang. „Ich geh‘ dann mal vor!“
„Präzision über alles! Wir IT-Experten wollen uns doch nicht vor den Raumfahrttechnikern blamieren!“, rief Dschersi ihm nach.
„Jaja!“, gab Cisgör zurück. Er war schon in der Schleuse. Die Tür schloss sich. Dann hörte er ihn nicht mehr.
Es wurde still. Nur das Gebläse der Reinstraum-Belüftung war noch in der Halle zu hören.
Dschersi sah sich um. Nun war er allein, allein mit sich und der Raumsonde. Endlich. Das war die Gelegenheit. Hastig zog er die Mikro-Bauteile aus seiner Kitteltasche. Der Mikrosender war funktionstüchtig – eines dieser Funkteile, die die IPO-Techniker als Notrufboxen verwendeten, zur Lebensrettung sowie zur Bergung lebensnotwendiger Proviant- und Bauteil-Kapseln in der Raumfahrttechnik. Er platzierte ihn in den Kasten aus Hartmetall, zusammen mit den Spezialakkus, dem Steuerungschip und der Datenleseeinheit. Dann brachte er sein Kleinmodul direkt unter der Außenhaut der Raumsonde an. Er befestigte es mit den Neodymschrauben an den Gewinden in der Nähe der Lageregelungsdüse. Diese Schrauben waren die neuste Entwicklung der puntirjanischen Raumfahrttechniker. Ihre hochmagnetische Kraft der Spezialschrauben gab dem Modul einen zusätzlichen Halt – auch dann noch, wenn sich die Schrauben durch etwaige Vibrationen der Düse lockern sollte. Der Halt musste schließlich sicher sein, todsicher – über seinen Tod hinaus.
Plötzlich zuckte er zusammen. Sein Herz schien stehen zu bleiben, und die letzte Neodymschraube fiel ihm zu Boden. Die Tür der Luftschleuse ging auf und Cisgör kam noch einmal hinein.
„Ich habe noch mein Phone vergessen!“, stöhnte er.
„Tja, du wirst älter!“, frozzelte Dschersi.
Cisgör nahm es von der Werkbank, steckte es ein und begab sich zurück zur Luftschleuse.
„Mach‘ nicht mehr so lange, alter Mann!“, erwiderte er. „Ich bin im Coco.“
Dann verschwand er wieder. Cisgör hatte nichts bemerkt. Dschersi wischte sich mit dem Handrücken den Angstschweiß von der Stirn. Dann hob er die Schraube auf, steckte sie in das Gewinde des Moduls und zog sie fest.
Kurz darauf konnte sich auch Dschersi zur Coco-Strandbar begeben, in den wohlverdienten Feierabend.
Generationen später brachte die Schraube an seinem Modul einem Dutzend Expeditionsteilnehmern den sicheren Tod.
Zwei Arbeitsschichten nach Dschersis Aktion war es soweit. Die Sonde startete mit der Raumflotte Intersystemar in das All – der Start des größten Projektes aller Zeiten. Diese erste Expedition war unbemannt. Sie bestand aus gleich mehreren Raumflotten, einem gigantischen Schwarm von Raumschiffen und -sonden. Und ihr Vorbote war die Raumsonde „Intersystemar“, die das Dschersi-Modul enthielt. Sie war neun Jahrzehnte unterwegs, ehe sie die neue Welt erreichte. Schon vierzehn Jahre vor ihrer Ankunft dort registrierte sie spektroskopische Signale, die auf diese fremden Lebewesen hinwiesen – Biosignaturen in der Atmosphäre des dritten Planeten vor dem Fixstern Altakol. Die Nachricht, dass dort Leben existiert, reiste elf Jahre lang mit Lichtgeschwindigkeit zurück in die Welt, aus der sie losgesandt worden war. Dort löste sie den Beginn eines neuen Zeitalters aus – und später die Kontaktaufnahme mit einer bisher unbekannten Zivilisation.
Zwei Menschengenerationen später, an einem ganz anderen Ort
Joseph Banks stand an Deck und genoss die milde, warme Abendluft der Südsee. Er war ein angesehener Mann, hoch gelehrt. Und er hatte ein Vermögen von zehntausend Pfund bezahlt, um an der Expedition auf der Endeavour teilnehmen zu können. Es war Abenddämmerung, der 11. Juni 1770. Banks blickte in Richtung Sonnenuntergang. Er nahm Sturmtaucher und Albatrosse wahr, und neue, unbekannte Arten von Seevögeln.
„Hoffentlich geht es bald wieder nach Süden!“, dachte Banks. „Bestimmt gibt es noch so viele neue Arten von Lebewesen zu entdecken, wenn wir den Südkontinent erst einmal erforscht haben.“.
Er wurde aus seinen Träumen gerissen. Hermann Diedrich, sein junger Sekretär, kam an Deck. Er wurde von Daniel Solander begleitet, dem schwedischen Botaniker, der Charles Green im Schlepptau hatte. Die gelehrten Herren hatten beschlossen, ihre wissenschaftliche Konversation an Deck der HMS Endeavour fortzusetzen, und ihre Diskussionen lenkten Banks von seinen Träumen ab.
„Ja, ich sage Ihnen, die Sonne muss drei Mal so weit entfernt sein von uns wie die Venus!“, rief Green erregt. Green war als Astronom an Bord. Er hatte die Messung auf Tahiti vorgenommen, letztes Jahr am 3. Juni.
Banks schwieg beeindruckt. Er dachte darüber nach, ob es wohl auch auf der Venus unbekannte Arten von Tieren und Pflanzen geben könnte. Er wollte Green und Solander nach deren Meinung dazu befragen, doch dann dachte er wieder an seine Aufgabe, zunächst einmal die auf dieser Expedition neu entdeckten Tier- und Pflanzenarten zu beschreiben. Hierzu wollte er Diedrich ein paar Gedanken zur Niederschrift diktieren, doch Solander unterbrach ihn.
„Hoffentlich hat der Smutje heute was ordentliches gekocht!“, sagte der junge Schwede. Er hatte einen Mordshunger bekommen, und er war froh, dass sie nicht nur Seemanns-Rationen bekamen. Täglich nur ein Pfund Schiffszwieback, Pökelfleisch, ein Schlag Erbsenbrei und eine Gallone Bier, das wäre nicht sein Fall gewesen.
„Gehen wir!“, schlug Green vor.
„Ja!“, antwortete Solander erleichtert und blickte zu Banks rüber.
„Ja, gehen sie nur!“, sagte dieser. „Ich bleibe noch kurz an Deck!“
Solander, Green und Diedrich wandten sich von der Reling ab und wollten unter Deck gehen. Banks war froh, wieder seine Ruhe zu haben. Er blickte über die Reling zu den Seeleuten herüber. Einer der Matrosen fischte Seegras vom Senkblei. Ein treibendes Holzstück zeigte ihm, dass Land in der Nähe war. Die Männer fluchten, dass sie die Meerestiefe schon wieder ausloten mussten – Kapitän Cook war wie besessen hinter den Messwerten her. Zwei Jahre schon waren sie auf See. Sie wollten endlich wieder heim, oder zumindest zurück nach Tahiti. Aber Cook befahl immer wieder, nordwärts abzusegeln und die Ostküste Neuhollands zu vermessen. Er wollte seinen kartographischen Beweis für die Existenz des Südkontinents, unbedingt. Die Crew jedoch murrte immer lauter.
Banks hörte, wie die Seeleute über ihre Essensrationen maulten, immer nur Schiffszwieback, Pökelfleisch und Bier. Sie widerten ihn an. Er musste daran denken, wie Cook einige von ihnen hatte auspeitschen lassen, weil sie die Tahitianerinnen vergewaltigt hatten, doch sie taten es immer wieder. Bei jedem Landgang. Banks hatte einen von ihnen gefragt, warum sie das tun. So lange es dafür vom Kapitän immer wieder die gleiche Strafe gab, hatte er ihm geantwortet, fanden sie das nur fair. „Pack!“, schoss es Banks durch den Kopf. Ihm fiel der Sekretär ein, dem Einige aus der Crew im Streit beide Ohren abgeschnitten hatten. Cook hatte auch diese Tat verurteilt, einige Tage bevor sie dann tatsächlich „Neuholland“ entdeckt hatten.
Banks gähnte. Er verließ die Reling. Er entschloss sich, den anderen Gelehrten zu folgen. Green, Solander und die Anderen lagen bereits satt und müde in ihre Kojen. Sie schliefen tief. Es war eine ruhige Nacht. Leutnant John Gore stand zur Nachtwache an Deck. Er ließ die Männer weiterhin ausloten, welche Untiefen es gab, und freute sich auf den Schichtwechsel. Er war auf Order des Kapitäns für den an Durchfall erkrankten Maat eingesprungen, und jetzt endlich ging dieser Einsatz vorüber. Pflichtbewusst sah er noch einmal über die Reling. Diese verfluchten Untiefen! Da plötzlich nahm er im Wasser etwas wahr, was dort absolut nicht hätte sein dürfen. Das Blut schien ihm in den Adern einzufrieren. Er erstarrte vor Schreck. Er brauchte ganze vier Sekunden, um sich von dem Schock erholen und wieder Luft holen zu können, dann aber atmete er so tief ein, wie er konnte, und schrie sich fast die Seele aus dem Leib.
„Volle Kraft zurüüückk! Segel streichen! Wir laufen auf Gruunnd!“
Gore presste seine Meldung nach Leibeskräften aus der Brust, brüllte aus voller Kehle, – doch es war zu spät. Schon erbebte das Schiff. Ein heftiger Ruck erfasste ihn, ein krachendes Geräusch erfüllte den Rumpf. Leutnant Gore wäre fast über die Reling gefallen, hätte er sich nicht im Schreikrampf festgekrallt. Banks, Green, Solander und Dr. Sullenburg fielen aus ihren Kojen. Dann noch ein Poltern. Eine Gruppe von Seeleuten oben an Deck hatte den Halt verloren und war zu Boden gefallen. Kapitän Cook stürzte in Nachtkleidung an Deck.
„Was ist passiert?“, brüllte er und stürmte zur Reling. Er klammerte sich an ihr fest, beugte sich vor und erstarrte vor Entsetzen. Ein Korallenriff. Die HMS Endeavour, das Flaggschiff der Südsee-Expedition, war auf Grund gelaufen. Nun schien das Schiff verloren – die ganze Expedition drohte plötzlich zu scheitern, die Karten, die naturwissenschaftlichen Proben aus der Neuen Welt, die Berichte vom Venustransit, die Crew: Alles war in Gefahr!
Unter Deck war Gebrüll, die Männer aus ihren Kojen stürzten an Deck.
„Wassereinbruch unter Deck!“, brüllte Gore erregt. „Wir sinken!“
„Kanonen und Ausrüstung über Bord!“, befahl Cook.
Nun hasteten auch Banks und Green an Deck. Verständnislos sahen sie den Kapitän an.
„Wir müssen die Endeavour um jeden Preis wieder flott machen – oder wir sind dem Tode geweiht!“, brüllte er ihnen zu.
Die Crew schmiss hastig allen Ballast von Bord. Bloß nicht sinken!
Das Schiff wurde leichter, kam los. Wasser drang unter Deck ein, immer mehr. Sie befanden sich bei Cape Tribulation, 23 Kilometer vor der rettenden Küste.
„Segel unter dem Schiff durchziehen!“, brüllte Cook. Er hatte sich auf diese alte Seemannslist besonnen. Das Segel wurde an Tauen unter den Rumpf des Schiffes gebracht, um den es sich legte. Der Wasserdruck schloss das Leck zumindest teilweise, und so konnten sie etwas weiter kommen, bevor die Endeavour volllief. Das Leck war fast wieder dicht, und das Schiff dümpelte vor der Küste. Cook ließ das Schiff auflaufen und auf die Seite kippen, und die Crew sollte dann das Loch im Rumpf flicken mit allem, was sie an Land fanden.
Am folgenden Tag, dem 12. Juni 1770, begleiteten Banks und Green die Zimmerleute zusammen mit den Botanikern in einem Beiboot, und als die Zimmerleute Hölzer fällten und zur Endeavour schafften, inspizierten sie in dieser Zeit das fremde, neue Land. Neugierig durchstreiften Banks, Green, Diedrich und Solander stundenlang die Region um ihre Anlandestelle.
Stunden später saßen sie müde am Strand. Sie sahen den Schiffszimmerleuten bei ihrer Arbeit zu und hofften, dass ihr Flickwerk gelingt. Sie hatten doch so viel erreicht! Kap Hoorn, Tahiti, nun die erste Anlandung an der die Ostküste Neu-Hollands, jenes neu entdeckten Kontinents, den man später Australien nannte. Und jetzt lag ihr 340-Tonnen-Flaggschiff da, leckgeschlagen am Strand. Ausgerechnet jetzt hatte sie ein Korallenriff außer Gefecht gesetzt (das Great Barrier Reef, das wohl größte Riff der Erde, wo ihr Unglücksort später Endeavour Reef getauft wurde). Wer sollte von ihren Expeditionserfolgen erfahren? Diese fremde Welt war doch zur Begeisterung der mitgereisten Botaniker voll von zahlreichen, neuen Pflanzen- und Tierarten. Kein Europäer hatte sie je zuvor gesehen. Und nun? Sollten sie jetzt hier sterben? Es gab doch noch so viel zu entdecken.
Banks seufzte. Es war heiß, und Banks wischte sich den Schweiß von der Stirn. Gwoya Unaipon, ihr Fremdenführer vom Stamme der Guugu Yimidhirr, saß etwas abseits von der Gruppe und blickte in Richtung des Abendsterns. Er war am Horizont aufgegangen, und kaum sichtbar funkelte neben ihm ein erster, kleiner Fixstern.
„Etwas Zitronenwasser zur Erfrischung?“, fragte Diedrich. Banks blickte auf, sah an ihm vorbei.
„Green, schauen Sie!“, rief Banks plötzlich aufgeregt, „dort auf der Lichtung!“
Astronom Green nahm sein Fernrohr, blickte in die Richtung, die Banks ihm wies.
„Was ist das?“, fragte er.
„Ich weiß nicht.“, gab Banks noch aufgeregter zurück. „Diese Tiere sehen ja aus wie riesige Hasen!“
„Echt seltsame Lebewesen hier!“
„Ob wir sie fangen können?“, fragte sich Green.
„Wie die hüpfen! Schauen sie!“
„Ja, und dort sind zwei, die sich treten oder zu boxen scheinen!“
„Ganz schön flink! Die kriegen wir wohl eher nur vor die Flinte, nicht ins Netz.“
„Auch gut, soll der Smutje sie verarbeiten – vielleicht schmeckt das Fleisch ja. Hasenbraten – neu-holländisch!“, lachte Green.
Banks rief Gwoya Unaipon, zeigte ihm die riesigen Hasen. Er war mausgrau, groß wie ein Greyhound.
„Gang-oo-roo!“ sagte Gwoya, „Känguruh.“ Und er deutete mit einer Handbewegung an, dass man diese als Beutetiere essen kann, und es gelang ihnen, eines dieser Tiere zu erlegen.
Solander und Diedrich notierten ihr Erlebnis im wissenschaftlichen Tagebuch der Expedition. Es ist immer ein bedeutender Moment, wenn eine ganz neue, bisher unbekannte Art von Lebewesen entdeckt wird. In diesem Fall bedeutete es sogar eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan der Crew. Cook ließ umgehend einige Männer mit Waffen auf die Jagd gehen. Gwoya Unaipon aber zog sich wieder zu den Seinen in den Busch zurück in das Outback.
Kapitän James Cook brummte missmutig vor sich hin. Nachdenklich blickte er aus seiner Kabine hinaus auf das weite Meer. Ärgerlich, das alles! Jetzt hatten sie 3200 km nordwärts entlang der Küstenlinie gesegelt – nur um jetzt hier festzuhängen. Die Admiralität hatte ihm für seine Expedition noch extra den 340 Tonnen schweren Kohletransporter Earl of Pembroke umgebaut und auf den Namen HMS Endeavour getauft. Dann waren sie 1768 unter seinem Kommando in See gestochen, hatten Tahiti erreicht, um dort den Durchgang des Planeten Venus vor der Sonnenscheibe zu beobachten, um die Entfernung der Sonne von der Erde berechnen zu können. Cook hatte – einer Geheimorder entsprechend – Kurs den unbekannten Ozean südlich des 40. südlichen Breitengrades genommen, zu dessen Erforschung. Im Januar 1769 hatten sie Kap Hoorn umrundet, sie hatten Tahiti erkundet, Fort Venus errichtet, und sie hatten am 29. April 1770 als erste Europäer in der Botany Bay die Ostküste von Neu-Holland betreten, eines neu entdeckten Kontinents, den man später Australien nannte. Diese fremde Welt war zur Begeisterung der auf eigene Kosten mitgereisten, schwedischen Botaniker voll von sehr zahlreichen, neuen Pflanzen – kein Europäer hatte sie je zuvor gesehen – und nun waren sie, 3.200 km nordwärts entlang der Küstenlinie segelnd, auf Grund gelaufen. Ein Korallenriff hatte sie außer Gefecht gesetzt, das größte Riff der Erde (man nannte es später das Great Barrier Rief, und den Unglücksort Endeavour Reef).
Am folgenden Tag beendeten die Schiffzimmerleute ihre Arbeiten, um den Rumpf wieder herzustellen – was sechs Wochen in Anspruch genommen hatte. Endlich war die Endeavour wieder seetauglich und mit neuem Proviant beladen. Kaptän Cook und seine Crew konnten die Fahrt fortsetzten. Sie fanden eine Passage durch das riesige, scheinbar endlose Korallenriff. Endlich waren sie frei, konnten wieder nordwärts segeln, und ihre Expedition war gerettet (Sie entdeckten, dass Neuholland und Neuguinea zwei getrennte Welten waren, nahmen die Ostküste Neuhollands für England in Besitz, und ließen das Schiff dann in Batavia überholen, wobei sieben Männer Cooks an Durchfallerkrankungen starben, und kurz danach auch Green).
Kapitel 1: Tüngörs Coup
Wieder auf Puntirjan, zwei Generationen nach Dschersi
Er hielt die Luft an. Er befand sich in der Höhle des Löwen, aber er sah sich auch dem Ende seines Einsatzes entgegen. Tüngör Auflingé war Spion und er hatte erstmals im Datenzentrum des Feindes operiert, die Joséfien-Datei kopiert, auf dem Server der Sarkarier gelöscht und die Kündigung seines Alibi-Jobs provoziert. Und nun stand er da, in der Höhle des Löwen.
„Das liest doch kein Mensch!“
Vorstandschef Sark Sarkermann wütete. Sein Gesicht war puterrot angelaufen, seine Halsschlagader angeschwollen. Mit einer Verärgerung ohne Grenzen sah er Tüngör an.
„Das liest doch kein Mensch!“, tobte er. „Wir haben Sie als Sachbearbeiter in der PR doch nicht eingestellt, damit sie derartig belanglosen Mist in unsere Dokumente einarbeiten!“
Sarkermann starrte den jungen Tüngör an, als wolle er ihn zerfleischen. Tüngör wich dem Blick des Löwen nicht aus. Er stand mit seiner Ausarbeitung da und schwieg.
Sark Sarkermann fing sich wieder und holte Luft.
„Es tut mir leid, Monsieur Auflingé! Ihr Dokument wird so niemals verwendet werden können. In Anbetracht der vielen, investierten Arbeitszeit, Gehälter und Materialien sehen wir uns leider gezwungen, sie zu kündigen! Sie sind hiermit entlassen!“
Sarkermann warf Tüngörs Ausarbeitung auf den Schreibtisch, direkt vor Tüngör. Tüngör nahm sie wortlos auf, drehte sich um und verließ den Raum. Hätte Sarkermann sein Gesicht im Rausgehen sehen können, er hätte sich über das verschmitzte Lächeln Tüngörs gewundert. So aber sah er Tüngör Auflingé die Bürotür passieren, drehte sich wieder der Computerkonsole zu und rief die nächste Termindatei auf sein Display. Als Gruppenleiter des Netzwerk-Konzerns Sarkodot hatte er schließlich viel zu tun.
Als Tüngör Auflingé das Gebäude der Sarkodot kurze Zeit später verließ wurde es Abend. Er atmete auf: die Kündigung war nach Plan verlaufen. Er hatte die Datei vernichtet und das fingierte, für Sarkodot somit nutzlose Dokument erstellt, um mit diesem Kündigungsgrund die Firma schnell und unauffällig verlassen zu können – nun hielt ihn nichts mehr. Er war erleichtert, sein erster Einsatz als Spion war vorbei. Sein Auftrag war es, die monastairsche Joséfien-Datei im Sarkodot-Konzern für den Geheimdienst der I.P.O. in seinen Besitz zu bringen. Die Sarkarier sollten keine Chance mehr haben, an die Bahndaten der lang ersehnten Raumsonden zu kommen.
Zügig, aber nicht auffällig hastig begab sich Tüngör über die Plaza des Sarkodot-Towers hin zur zweiten Seitenstraße. Erleichtert erreichte er das Innenstadtviertel und tauchte im Gewimmel der City unter. Eigentlich mochte er solche Einsätze nicht. Er war noch jung, manchmal etwas naiv und suchte oft Nähe zu Anderen, die er als Kind nie gehabt hatte. Daher seine Sehnsucht nach Romantik, Natur und Wärme. Dennoch war er gelegentlich auch kühn, sehr pflichtbewusst, jung verheirateter und ein insgesamt eigentlich liebenswerter Kerl. Jetzt, da die politischen Spannungen mit den Sarkariern zugenommen hatten, war er als junger, Arbeit suchender Chemie- und Informationstechniker an den Geheimdienst geraten. Er hatte sich im Auftrag der I.P.O. mit „korrigiertem“ Lebenslauf als Werbetexter bei Sarkodot beworben, sich dort in das Intranet der Sarkarier gehackt und die begehrte Joséfien-Datei mit der Bahndaten-Software auf seinen Chip kopiert. Er hatte sie sodann komplett aus den Datenbänken der Sarkodot gelöscht und selbst auch die letzten, ungelöschten und für Wiederherstellungsprogramme eventuell noch verwendbaren Datei-Reste bis auf das letzte Mikrobit extrahiert. Die IPO-Geheimdienst-Software hatte ganze Arbeit geleistet. Sarkermanns Computerspezialisten würden keine Chance mehr haben, die Raumsonden zu kapern.
Die Interplanetarische Puntirjanische Organisation I.P.O hatte ihren Sitz in Monastair. Tüngör hatte bei Clénairville einen Flieger genommen, um möglichst schnell von der Sarkodot wegzukommen.
Jetzt saß er auf dem Sitzkissen des Raumgleiter-Passagierraums und spürte seinen großen Durst. Er hatte seit Stunden nichts mehr getrunken. Er orderte ein Mineralwasser, fasste sich mit der Hand an die Halskette, an deren Medaillon der Speicherchip hing, und dachte daran, wie sie ihn bei der I.P.O. wohl empfangen würden – ihn, der die Raumsonden vor den Sarkariern gerettet hatte. Ob sie ihn befördern oder ihm einen Orden verleihen würden?
Die Stewardess schwebte mit einer Karaffe Mineralwasser herbei.
„Etwas Wasser, Monsieur?“
Tüngör sah ihre beneidenswerte Figur, schnalzte mit der Zunge und hielt ihr sein Glas hin. Sie schenkte ihm, ein paar freundliche Laute zwitschernd, ein und er kostete. Es war frisch, kühl und angenehm prickelnd. Tüngör genoss es in vollen Zügen. Ihm war, als hätte allein dieser Schluck Mineralwasser all die Mühen lohnenswert gemacht.
Entspannt lehnte er sich zurück in das Sitzkissen, schloss die Augen und während der Flieger seinen Flug von Cisnaira nach Monastair absolvierte, döste er und malte sich aus, wie er als IPO-Held in Monastair empfangen werden könnte. Was würde ihn erwarten? Er jedenfalls erwartete eine astreine Belohnung – und doch wollte er nicht unverschämt erscheinen und zuviel fordern – denn man sollte den Ast, auf dem man sitzt, auch nicht absägen.
In der RAGA herrschte geschäftiges Treiben. Die RAGA, oberste I.P.O.-Abteilung für Raumfahrt, Astronomie und Geheimdienst-Affären, lag im 27. Stock des Monastair-Towers im Nachbarbezirk der Domunion. Von der Aula des Towers aus konnte man den Dom von Monastair sehen, den Sitz des hohepriesterlichen Prepstus, der die RAGA eingeweiht hatte.
Schon als Tüngör den Raumgleiter in Monastair verließ und den Shuttle zum Monastair-Tower betrat, bekam er eine Nachricht von Klettmann persönlich. RAGA-Chef Klettmann lobte ihn für seinen erfolgreichen Einsatz und erinnerte ihn feierlich ausschweifend an die Geschichte der I.P.O. Schon vor Tüngörs Lebzeiten hatte sie es zum Ideal erhoben, mit Hilfe neuartiger, interplanetarischer Sonden den Weltraum zu erforschen und orbitale Kolonien im All zu erreichten – riesige, fliegende Weltraumstädte über Puntirjan, autarke Ökosysteme, gigantische, moderne Raumstationen, auf denen ganze Generationen leben und forschen sollten, um eines Tages ferne Welten zu besiedeln – Planeten, Monde oder gar Kometen: Das Projekt Altakolia. Tausende unbemannter Xenon-Sammelsonden hatten vor Jahrzehnten, riesigen Sonnensegelschiffen gleich, ihren langen Weg zur Kometenwolke in den Wemuran-Orbit angetreten, um dort das begehrte Material einzusammeln, aus dessen eingefrorenen Gasen Krypton und Xenon gewonnen wurden, als Treibstoff für RAGA-Ionentriebwerke. Im Swing-by-Orbit hatten die Sonden dann den Rücksturz nach Puntirjan angetreten, um im Mondorbit Xenon-Tanks zu deponieren, und Tüngör hatte verhindert, dass die Bahndaten und somit auch diese Xenon-Sammelsonden in die Hände der Sarkarier fallen konnten. Die hätten das Gas gerne für ihre eigenen Zwecke eingesetzt – militärische Zwecke, versteht sich.
Klettmann jedenfalls war außer sich vor Freude, und das Ende der Nachricht eine Lobeshymne auf Tüngör, die RAGA und die I. P. O. insgesamt.
Auf dem Weg hoch zur Aula empfing ihn Jenis, sein langjähriger Kontaktmann, dem er auch die Joséfien-Datei zugefunkt hatte.
„Gute Reise gehabt?“, fragte er.
„Danke, alter Freund! Ich weiß nicht, was besser war: Das Mineralwasser oder die Stewardess!“
„Immer noch der Alte!“, lachte Jenis.
„Nein, nein, ich habe nur das Mineralwasser vernascht, nicht die Lady!“, lachte Tüngör zurück. „Ist Gugay schon da?“
„Nein“, antwortete Jenis. „Er ist von Clénairville aus in das Naturreservat aufgebrochen – von zwei Rangern begleitet. Er will dich nach der Ordensverleihung dort empfangen, wenn du Urlaub hast. Kennst ihn doch: Er hat von einem großen Fund gesprochen – und von einer Überraschungs-Jagd.“
Tüngör staunte, dass Gugay Jenis über sein Vorhaben informiert hatte, wo Jenis doch Vegetarier war und das Jagen hasste. Jenis aber trennte Arbeit und Privates, und so wechselten sie bald das Thema.
„Ein Abgesandter des Prepstus verleiht mir den Orden?“, fragte Tüngör.
„Ja, Eminenz Lettone. Schon heute Morgen im Tower eingetroffen!“
„Oje“, stöhnte Tüngör, „die ganze Zeremonie?“
„Was dachtest du denn, Tüngör?“, lachte Jenis. „Du hast ihnen schließlich den Hintern gerettet mit ihrem Altakolia-Projekt! Sogar die Andock-Raketen, die die Xenon-Sammelsonden zum Gastank geflogen haben, haben sie nach dir benannt. Ohne dieses Xenon hätten sie die Ionentriebwerke der Raumstation vergessen können!“
Tüngör ahnte, dass viele Hymnen, Gebete und Reden anstanden – nur weil er diese Datei den Sarkariern gelöscht und der IPO zugefunkt hatte. Der Gedanke, dass per Rundfunk auch Sark Sarkermann von Tüngörs Ehrung erfahren würde, bereitete ihm großes Vergnügen.
Kapitel 2: Gugays Entschluss
Es wurde ein nebliger Tag, tief in den weiten Urwäldern hinter Clénairville, nahe der Grenze zu Sarkar. Die bewaldeten Täler dampften ihre Feuchtigkeit im Lichte der über Puntirjan aufsteigenden Sonne aus. Das Gezwitscher der Tierwelt ertönte, und im Dschungel herrschte reges Treiben.
Auch Gugay Fiscaux zwitscherte und gurrte wie betrunken vor Freude. Heute, im ersten Tag des neuen Jahres, würde er mit seiner Leidenschaft wieder voll zur Geltung kommen, wenn er am Neujahrstag gegen Mittag mit der Familie zur Reptilienjagd ausfliegen würde. Er war ein Abenteurer, ein Egomane, groß geworden unter wilden Nomaden am Rande des Urwalds, und nun würde wieder prahlen können vor seiner Schwester. Er würde Tüngör, diesen ängstlichen, verwöhnten Weichling, mal zeigen können, was eine Reptiljagd ist! Tüngör – jetzt zu seinem Urlaub in Clénairville angekündigt – war irgendwie sein familiärer Rivale, sein jüngster Stiefbruder. Er buhlte seit einiger Zeit mit Gugay um die Gunst seiner Schwester Fisca, zu der er in Bewunderung und Zuneigung aufsah. Gugay machte einfach sein Ding, den „kleinen“ Tüngör tolerierte er und nahm ihn kaum für voll.
Tüngör hatte auf einen ruhigen Urlaub gehofft.
„Warum tue ich mir das eigentlich alles an?“, dachte er. „Schließlich habe ich Chemieingenieur gelernt und bin so in die Fußstapfen meines Urgroßvaters getreten, des Erfinders des Ionotrons“. Ionotrone waren spezielle Magnetfeld-Generatoren, die in der Raumfahrttechnik der Puntirjaner in Plasmablasen-Synthesizern eingesetzt wurden, um außerhalb der Atmosphären vor der tödlichen, kosmischen Strahlung zu schützen. Ionotrone waren eine der Lebensgrundlagen auf den puntirjanischen Raumstationen geworden – entsprechend das Ansehen des Clans, dem Tüngör entstammte. Genervt schaute er weg. Gugay jedoch gab keine Ruhe.
„Nicht wahr, Tüngör, du kommst doch mit, du machst doch mit!? Nicht wahr, Tüngör, dieses Mal sichern wir uns den Erzfund, und zur Belohnung jagen wir dann eine große Flugechse, und wenn wir sie bis nach Sarkugratt verfolgen müssen!“
Fisca erschrak.
„Vater! Du weißt doch genau, dass Sarkugatt hinter der Grenze liegt! Wir dürfen doch in Sarkar nicht einfach Erz abbauen! Und im Naturschutzgebiet schon garnicht! Vater! Und trink nicht so viel!“
„Ach was, und wenn wir bis zum Hauptquartier des Gouverneurs von Westsarkar müssen, wir gehen im Echsenwald das Lithiumerz holen, nicht wahr, Tüngör? Und wenn ich den Sarkariern ihr Erz vor den Augen ihres blöden Anführers einlade, diesem Schwein! Nein, das lassen wir uns nicht nehmen, nicht wahr, Tüngör!?“
„Hah, tja klar, Bruder, wir gehen graben!“, gab Tüngör von sich, um seine Ruhe zu haben.
„Tüngör! Ich bitte dich! ...“
Ängstlich sah Fisca von ihrem älteren Bruder weg zu Tüngör, der sich nun ausmalte, im Dschungel seine Ruhe zu haben.
Plötzlich sah der junge Tüngör seinen großen Siefbruder zustimmender an, fast begeistert. Dieser redete weiter auf ihn ein und schwärmte von den Mineralien im Boden der Urwälder Sarkars und den leckeren Lurchen und Beutetieren darin. Fisca wollte verhindern, dass er sich auf diese leichtsinnige Idee Gugays einließ, nur um ihr zu imponieren oder um sich von den unangenehmen Zeremonien in Monastair zu erholen.
„Aber Fiskalein, ich sach’ doch jarnisch von Grenzverletzung. Wir brauchen ja nicht über den Sarfluss zu fliegen, wir können ja in unserem Wäldchen bleiben. Selbst wenn wir mal aus Versehen drüberfliegen, was macht das schon?“
„Tüngör! Du weißt doch genau, dass der Großkaiser von Sarkar jetzt diesen sarkarischen Staatenbund gründen will. Es kam doch gerade noch per Mail die Warnung durch, dass die Grenzen nicht überflogen werden sollen – auch nicht zur Erzsuche. Wenn euch nun der Reichsgrenzschutz fasst? Oh, Tüngör, fliegt nicht, ich bitte euch, fliegt in unser Wäldchen, aber fliegt nicht rüber! Tüngör, dass das klar ist, ich flieg da nicht mit! Tüngör!“
Doch die besten Ermahnungen halfen nun auch nichts mehr. Gugay war aufgestanden, hatte seinen jungen Stiefbruder, die Ausrüstung und den Schlüssel zum Shuttle gepackt und stand schon an der Tür.
„Fisca! Reg’ dich doch nicht so auf, kriegst auch noch'n schönen Großlurch zum Abendessen! Komm, Tüngör, komm, wir fliegen!“
Fisca sah noch ihre Schwanzfedern, hörte ein Flügelrauschen und weg waren sie. Nur noch die leere Flasche stand da, aus der ihr Vater eben noch munter Krøg getrunken hatte, das Nationalgetränk, das so schrecklich viel an Ethanol enthielt. Gugay war halt ein leidenschaftlicher Sammler und Jägers in den Wäldern jenseits der Grenze – auch an der Grenze zum Erlaubten. Bei jeder Gelegenheit war er hinter Mineralien, Schätzen und Flugechsen her, und er liebte es, wenn die Leute ihm neue Funde und Schwärme meldeten. An der Küste Cisnartikas gab es viele, die einen Mineraliensammler und Jäger wie ihn gerne mit Positionsmeldungen unterstützten, denn Flugechsen fraßen viele Obst- und Ravrokylplantagen kahl, und das konnten die Siedler nun mal überhaupt nicht leiden. So waren sie Freunde der Erzsucher, deren Abbaumethoden die Echsen für immer vertreiben konnten.
Ereignis 1: Der Verlust der Schraube
In dieser Zeit drang die kleine, unscheinbare Raumsonde in einer Formation von Raumsonden in die Welt der Menschen ein. Sie kam aus den kalten, dunklen Weiten des Weltalls. Sie kam aus einer fremden Welt. Sie war dort in fernster Vergangenheit gestartet, in einer fernen Zeit, in der in der Welt der Menschen Vieles noch völlig unbekannt war. Damals war zum Beispiel eine allererste europäische Südsee-Expedition gestartet – die Menschen entdeckten viele noch völlig unbekannte, für sie neue Arten von Lebewesen. Dabei hätte diese Expedition übrigens beinahe vorzeitig geendet, am Endeavour Reef bei Australien. Ihr Flaggschiff, die HMS Endeauvour, war an diesem 11.6.1770 völlig unerwartet auf ein Riff aufgelaufen und fast gesunken. Es ging jedoch weiter: Die Schiffszimmerleute, die Captain Cooks Schiff wieder reparierten, sahen an Land plötzlich große, hüpfende, den Hasen ähnelnde Tiere. Von den Eingeborenen wurden sie als Känguruhs bezeichnet.
Seit jenem Start im Jahr 1770 irdischer Zeitrechnung flog die Flotte der High-Tec-Minisonden nun auf die Welt der Menschen zu. Viele Jahrzehnte waren seitdem vergangen. Die Raumsonden-Flotte hatte seitdem mit fast unvorstellbarer Geschwindigkeit die fast ein Jahrhundert dauernde, ereignislose Weltreise durch die Tiefen des kosmischen Raumes hinter sich. Sie driftete nun in eine Region, in der einige Eis- und Felsbrocken um einen kleinen, fernen Stern kreisten. Hin und wieder gab es auch einige Kometenkerne oder Gesteinsbrocken, die zusammen mit etwas interstellarem Staub vorbeizogen. Und da die Sonden jahrzehntelang zuerst mit Sonnensegeln, dann nuklear und am Ende mit einem Xenon-Ionentriebwerk beschleunigt worden war, zogen diese Brocken mit einigen Promille der Lichtgeschwindigkeit vorüber. Sie hatte eine Wolke aus einigen Hundert Milliarden Gesteins-, Staub und Eiskörpern erreicht, die zu einem noch fast ein Lichtjahr entfernten Fixsternsystem gehörte.
Hier geschah es, dass zufällig zwei dieser tiefgekühlten Brocken frontal kollidierten. Sie prallten nicht voneinander ab, sondern zerbrachen in viele, kleine Fragmente. Ein winziges Teilchen dieser Eisfragmente geriet in den Weg einer der Sonden und berührte sie leicht. Die fremde Sonde mit dem XENOPHON streifte es kurz, ohne dass ihre Bahn groß verändert wurde, aber ein äußeres Blech der Sonde aus Puntirjan bekam so einen Kratzer. Es gab dadurch mechanische Spannungen in der Außenhaut der Sonne, und sie verlor in Folge dessen eine inzwischen etwas gelockerte Befestigungsschraube aus einer permanent magnetisierten, außerirdischen Neodym-Legierung. Sie löste sich langsam aus dem Blech und trieb dank Schwunges aus der mechanischen Spannkraft langsam ab, trotz der magnetischen Anziehungskraft. Die Schraube wurde dabei von einem vorbeischießenden Eisfragment aufgenommen und verschwand mit ihm in den Tiefen des Raumes.
Weitere Fragmente trafen vorbeifliegende Kometenkerne und Zwergplaneten, und einige dieser Objekte wurden umgelenkt auf Bahnen, die sie langsam aber sicher in die Nähe des Fixsternes führen sollte, der sich im Zentrum dieser Oort’schen Wolke befand.
Kapitel 3: Malalos Choppu-Deal
Malalo war Gugays bester Handelspartner diesseits der Grenze. Er betrieb einen Im- und Export für Kleinroboter, Boote, landwirtschaftliche Maschinen, Hard- und Software sowie von Feinkost aller Art. Außerdem belieferte er von Cisnartika aus sogar ausländische Adels-Häuser mit Nanocomputern und illegalen Software-Kopien. Was er jedoch nur langjährigen Handelspartnern gegenüber einräumte – ansonsten war er allgemein der honorig-wohlhabende Eigentümer eines mittelständischen Nanotec-Betriebes. Und er war ein Sohn der Wüste, vom Stamme der Walali – und darauf war er stolz.
„Fünfzig?“, rief er freudig erregt in das Mikro seines Mini-Phones am Handgelenk.
„Ja, fünfzig Nanocomputer mit Gigabyte-Speicherchips, und zwar bis morgen!“, hörte er am anderen Ende der Leitung.
„Wird geliefert!“, sicherte er Choppu zu und beendete das Gespräch.
Malalo stieß einen Jubelschrei aus. Ein solcher Auftrag würde ihm mehr einbringen als Hundert Kleindealer-Anfragen. Niemals hätte er damit gerechnet, nun auch Lieferant für Sarkodot werden zu können – das Bestechungsgeld an seinen Mittelsmann in Sarkugratt hatte sich wirklich ausgezahlt: Choppu hatte die Bedenken an Malalos Seriosität in der Vorstandsetage bei Sarkodot und ins Besondere bei Sarkermann persönlich zerstreuen können. Die Bestellung von Sarkodot ging an ihn. Nun war er Handelspartner beiderseits der Grenze zwischen den beiden Blöcken auf Puntirjan.
Puntirjan ist eine harte Welt. Puntirjan, so heißt die Welt, in der diese Geschichte spielt – ein Planet, etwas größer als unsere Erde, im Planetensystem eines Mehrfachsterns aus einer gelborangen Sonne, einem erkalteten Methanzwerg und einem fernab umkreisenden Weißen Zwerg. Aber da Puntirjan, Tüngörs Heimatplanet, in ähnlich günstigem Abstand vom Zentralgestirn Wemur A kreist wie unsere Erde um die Sonne, herrschen auch dort trotz allem erträgliche Temperaturen. Es gibt dort mineralienreiche Gebirge, fruchtbare Ebenen und weite Ozeane. Es gibt Regenwolken, Winde und Jahreszeiten wie auf der Erde, und eine Atmosphäre, die Wasserdampf, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid und sogar Spuren von Edelgasen und Chlor aufweist – Letzteres aus einer urzeitlichen Reaktion von chlorathaltigen Gesteinen mit Wasser, Peroxiden und der UV-Strahlung des Gestirns. Und obwohl die Atmosphäre Puntirjans so chlorhaltig ist, dass man zum Wasser der puntirjanischen Ozeane fast schon Chlorwasser sagen müsste, hat sich eben dort das entwickelt, was auch das Bild unserer Erde so prägt: Lebewesen.
Nahezu 78% von der Oberfläche des Planeten sind vom Ozeanwasser bedeckt, aus dem sich aus Mikroben sauerstoff- und chlorresistente, einzelligen Lebewesen entwickelt haben, und hieraus Weichtiere, Ozeanpflanzen und fischähnliche Ozeantiere entwickelt haben, aber auch im Ozean lebende Insekten. Der Kontinent nun, etwa von der Größe Nordamerikas, ist neben zahlreichen Pilzen, Pflanzen, Landinsekten, Reptilien und Kriechtieren von einer seltsamen Gattung Lebewesen bewohnt, die teils dem Menschen, teils dem Wellensittich ähnlich sieht, und diese vogelmenschähnlichen Wesen sind sehr intelligent,.
Für Puntirjan sind die Puntirjaner oder Puntirjanors das, was für die Erde der Mensch ist – nur dass die Zivilisation der Puntirjanors einige Millionen Jahre alt ist, hoch entwickelt, und mit der Kolonisation des näheren Weltraumes begonnen hat. Zunächst bauten die Puntirjanors isolierte, von außen unabhängige Ökosysteme aus mikrobiellen Symbiose-Gemeinschaften. Die, die im All überlebten, wurden vergrößert, schlossen die Weltraumsiedler bald mit ein, und so gab es bald viele, kleine Welten im Orbit um Puntirjan. Und diese Raumkolonien entwickelten sich weiter durch Selektion, Evolution, Konkurrenz und Symbiose.
Nun ist es nicht einfach, die Geschichte einer völlig andersartigen Zivilisation irgendwo im Weltraum zu erzählen. Trotz Selektion, Koevolution und Symbiose – die Entwicklung lebender Arten verlief hier völlig andersartig: Ein urzeitlicher Meteoreinschlag vernichtete die damals vorherrschenden Groß-Säugetiere und Riesen-Insekten, und aus den reptilienähnlichen Kleintieren, die in Flüssen, Meeren und Erdhöhlen lebten, gingen die Puntirjaner hervor. Sie legen Eier, haben eine lange Lebensdauer, ein Gefieder und sechs Gliedmaßen: Je zwei Beine, Flügel und Arme – wobei die Flügel nur noch zu kurzen Gleitflügen taugen. Zwei Monde, Tolon und Wemuriel, stehen an ihrem Himmel, und ein Jahr (puntirjanisch: Annu) hat für sie die Länge von anderthalb irdischen Jahren. In diesem Annu sehen sie ihr Zentralgestirn ziemlich genau 243 Mal aufgehen, und die 243 =35 ist ihnen daher eine heilige Zahl. Sie rechnen im Dreiersystem, mit Tertialen (statt wie wir im Dezimalsystem). Wenn sie sich unterhalten – und das tun sie wie die Papageien meisterhaft und leidenschaftlich – dann klingt es eher wie das zwitschern eines Wellensittichs mit dem Kropf einer Taube.
Mit der Hilfe ganzer Übersetzerstäbe ließ sich diese Geschichte trotzdem mit schreiben, indem für die uns fremden Vorgänge, Wesen und Geräte entsprechende, irdische Ausdrücke eingesetzt wurden. Die Sprache der geselligen Vogelmenschen aus Puntirjan wurde dabei durch phonologisch-semantische Wortübertragungen so gut es ging mit unseren Buchstaben und Worten ausgedrückt. Der zwitschernd-gurrende Laut, den sie zum Beispiel ausstoßen, wenn sie ihren Heimatplanet meinen, wurde so in etwa mit „Puntirchan, Puntirjän“ oder eben „Puntirjan“ wiedergegeben).
Hoch entwickelte Siedlungen aus rotierenden Habitaten für künstlichen Biotope kreisen im All, bevölkert mit je eigens entwickelten Ökosystemen, um Puntirjan, seine beiden Monde und einige Nachbarplaneten, und auch auf der Landkarte Puntirjans liegen große, volierenartige Städte verstreut wie Tintenkleckse – ins Besondere in allen Teilen des nördlichen Kontinentes, auf dem Gugay und Tüngör lebten. In ihrer Zeit stieg die Zivilisation der Puntirjaner auf eine neue Stufe: In gemeinschaftlicher Zusammenarbeit von über 14 Nationen der „internationalen, parlamentarischen Organisation“ (Abkürzung: IPO) sollte der erste bemannte Raumflug einer puntirjanischen Weltraumkolonie der IPO stattfinden, der aus dem heimischen Sternsystem herausführt – ein globales Generationenprojekt, aufwändiger und bewundernswerter noch als der Bau von Pyramiden und Kathedralen früher durch die Menschen. Während der junge Tüngör für die IPO-Raumfahrtbehörde RAGA neuerdings als Spion arbeitete, bekam Gugay jedoch hiervon herzlich wenig mit. Schließlich lebte er in der tiefen Provinz von Cisnaire, und genau hier begab er sich nach Clénairville, zu Malalo.
Kapitel 4: Tüngörs Bade-Ausflug und Gugays Deal
Tüngör hatte Gugay natürlich mit Absicht verschwiegen, dass er den neuen Job angetreten hatte. Er ließ ihn im Glauben, er arbeite als Werbetexter – allzu neugierigen Fragen seines großen Bruders über etwaige mögliche Handelsbeziehungen zu den Sarkariern wollte er aus dem Weg gehen. Er wollte Urlaub. Und er genoss ihn in vollen Zügen: Er flog mit Fisca aus, in den Urwald – ein gemeinsamer Bade-Ausflug zum Cisnit-Biotop an einem Seitenflüsschen des Sar.
Die Bucht lag in einem Nebel erfüllten Tal. Dichte Ravrokyl-Pflanzen umsäumten das Ufer, riesigen Ackerschachtelhalmen gleich. Summende Insektenschwärme umkreisten die hellblauen Blüten einiger Rank-Pflanzen, die an Ackertrichterwinden erinnerten. Einige Pflanzen waren von parasitären Klein-Saugern bedeckt, deren orange Panzer schwach im trüben Sonnenlicht glänzten. Tau tropfte von den Halmen, und kleine Wesen, ähnlich den Blattschneiderameisen, schleppten Mykorrhiza-Pilze, Blattläuse, Blattsegmente und Halmspitzen die Stängel hinab in ihren Bau. Ein Wasserfall rauschte und bildete den akustischen Hintergrund für die Laute der Urwald-Tiere, die das Tal erfüllten.
„Hier ist das Wasser wunderbar!“, schwärmte Fisca und schwamm zu einem kleinen Wasserfall, der sich in den Tümpel ergoss.
Tüngör schwamm zu ihr rüber. Sie spielten im Wasser, spritzten es einander zu. Es schimmerte blaugrün, enthielt Mikroben, den Blaualgen ähnlich, Muscheln und Korallen, die mit Zooxanthellen in Symbiose lebten, so wie auf der Erde Darmbakterien mit ihren luftfreien, lebenden Behältern, den Säugetieren und Menschen.
Ein Schwarm Putzervögel streifte durch das Tal – auf der Suche nach neuen Großlurchen.
Fisca tauchte auf, freudig erregt.
„Schau, eine Anemonenqualle!“, rief sie und winkte Tüngör herbei.
„Sonnentau und Bärenklau!“, rief Tüngör freudig, holte tief Luft und tauchte in den Tümpel. Da sah er sie – eine große, hellblau schimmernde Anemonenqualle, ein selten großes Exemplar. Einige kleine Quallen folgten ihr, wohl der Nachwuchs, und dann kamen weitere, im Wasser wallende Wolken dort scheinbar qualmender Quallentierchen und quollen, leise quiekend, aus einer Wasserquelle, die in einer Höhle lag, quer zu einer wie Quark aussehenden Quarz-Felswand, knapp unter der Wasseroberfläche.
Später ruhten sie sich kurz auf einem der Felsen aus Ambblygonit-Erz aus, die aus dem Tümpel ragten. Trotz allen Genusses – sie blieben wachsam, denn auch im Dschungel drohten Gefahren. Schwärme von Libellenmücken, Riesenzecken und Blauwespenschwärme zogen gelegentlich durch die Sümpfe, und sie hatten keine Lust, einem von ihnen zu begegnen.
Fisca und Tüngör genossen ihren Badeausflug bis in den späten Morgen. Mittags zog Gugay mit Tüngör los, Abendessen jagen. Nachmittags waren sie dann müde, aber mit guter Beute zu Fisca heimgekehrt, die eine Platte mit Früchten vorbereitet hatte und ein Büffet mit köstlichen, pflanzlichen Speisen, die der Urwald zu bieten hatte. Tüngör und Fisca ließen es sich noch lange schmecken. Gugay hingegen war sofort nach dem Essen aufgesprungen und für den Abend zu Malalo geflogen. Er wollte mit ihm den nächsten Coup aushandeln, einen Coup, der ihn bald in eine äußerst brisante, ja, gefährliche Geschichte bringen sollte – eine Geschichte, deren Bedeutung weit über die fremde Welt von Puntirjan hinaus reichen sollte.
Malalos Bau lag im inndjarschen Viertel von Clénairville. Es und besaß ein Bürozimmer, wo man ungestört zwitschern und trinken konnte. Das heiße Krøggetränk bremste jede Bewegung Gugays aus. Die Luft war so schwül, dass es von den Wänden zu tropfen schien.
„Hey Malalo, es reicht doch völlig aus, wenn du mir lediglich einen deiner schrottigen Frachtshuttles überlässt! Ich werde es wird für dich mit Profit so vollstopfen, dass du dir ein gigantisches Imperium aufbauen und finanzieren kannst!“
„Ach ja?“ sagte Malalo völlig kühl und lüftete seine Flügel, wobei sein Antlitz in diesem Augenblick dem Blick eines misstrauischen Papagei glich.
„Ich habe dir noch nie zu viel versprochen!“ krächzte Gugay verärgert.
„Naja…“ seufzte Malalo.
„Mein Projekt ist genial, ehrlich!“ Gugay wartete, um Atem zu holen und eine geeignete Lautfolge zu finden. „Es ist … Es ist von fast göttlichem Genie!“
„Naja…“ wiederholte Malalo. Er naschte ein paar Ravrokylkörner mit Schokoladenüberzug, goss sich Krøg in den Becher, hielt diesen behutsam einen Moment fest und nahm dann bedächtig einen kleinen Schluck, ehe er weitersprach. „Ich muss also nur einen Fracht-Shuttle im Werte von...“ Nach kurzem Überlegen rundete er die Summe auf. „ … von 2400 Cisni abschreiben?“
„Nein, du kriegst ihn unbeschadet zurück. Und das ist gegenüber deinem Gewinn doch nur ein Prozent!“ warf Gugay schnell ein.
Malalo sah ihn halb zweifelnd, halb staunend an – staunend über so viel naiven Optimismus, den Gugay da zur Schau stellte.
„Du schätzt den Gewinn aus deinem Erzvertrieb wirklich so gigantisch ein?“ fragte er.
„Das ist das Minimum, Malalo, überleg doch mal! Kryolithionit und Pegmatit sindn hochgradig Lithium-reiche Mineralien, die gibt es im Sar-Gebiet in Massen! Lithium für Tausende von Akku-Fabriken! Und das Sar-Gebiet als Naturschutzgebiet ist völlig unbewohnt, ist das private Jagdrevier des Großkaisers, da ist ansonsten seit Generationen keine Erz mehr abgebaut worden! Die Lithiumvorräte dort sind gewaltig, man muss sie nur vom Boden aufheben und in den Frachtraum schieben!“ Unwillkürlich formte sich seine Hand so, als wolle er eine handvoll Kryolithionit-Knollen vom Boden aufheben.
„Selbstmord!“, flüsterte Malalo kreidebleich, doch die Gier milderte seinen sonst harten Gesichtsausdruck. „Du willst also vom Ozean her in den Fluss hineinsegeln, die Hoheitszeichen der Cisnaire Répüblik mitten im Jagdrevier des sarkarischen Großkaisers funken und das Shuttle mit geraubtem Erz füllen. Das ist praktisch Selbstmord!“
„Ich schon wieder weg, ehe der Gouvernör die erste Kurznachricht an seinen Großkaiser schickt, und schon wieder daheim, wenn der sich bei unserem Président beschwert. Die Sarkarier sind bisher auf keiner der Sar-Inseln präsent, außerdem ist das Sar-Gebiet ein hoheitlich neutrales Naturschutzreservat!“
„Sie wären innerhalb weniger Momente mit einer gigantischen Schlagkraft da, du Phantast! Das Sarjowa-Geschwader liegt drüben im Hangar in Bereitschaft, ein Kampfjet mit Laser-Geschützen!“
„Wir sind unter dem Schutz der Cisnair-Zeichen, die können es nicht riskieren, uns festzunehmen! Und erst recht nicht auf freiem Ozean, so wie die Lage zwischen den Reichen von Sarkar und der Cisnaire Répüblik, ja, der IPO überhaupt, liegen. Das wäre ein Anlass zum Krieg! Zudem werde ich selbst erst von den Seiten des Reiches von Cisnar her dazustoßen. Mit echten, sarkarischen Fracht-Papieren!“
„Entschuldige, Gugay!“ Malalo beruhigte sich wieder und blickte Gugay an. „Dann muss es ja funktionieren.“
Malalo zückte sein Mobilfunkgerät, tippte ein „o.k.“ in die Konsole und unterschrieb damit den im Display angezeigten Mietvertrag für den Fracht-Shuttle.
„Monsieur Gugay Fiscaux, ich bin genau der Mann, der dir den richtigen Shuttle liefern kann!“
Kapitel 5: Der Erz-Fels
Es klappte alles wie am Schnürchen. Das Shuttle kam, die Familie Fiscaux-Auflingé ging an Bord (selbst Fisca, doch das wohl eher, weil sie noch nicht so recht wusste, wohin es ging) und man erreichte das Sar, ohne von den fliegenden Reichsgrenzschutzgarden gesehen worden zu sein.
Die offizielle Landung auf Gugay Fiscaux’ Insel fand ohne großes Aufsehen statt. Es hatte Gugay viel Energie gekostet, Tüngör- von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Insel für die Répüblik vereinnahmen zu müssen, und das Ziel des Energieeinsatzes war erst erreicht, als er Tüngör als Kandidaten für den goldenen Orden der Großrépüblik am Bande bezeichnete.
Die auf den zusammengebastelten Ortsnamen „Erz-Felsen von Fiscauflingé“ getaufte Insel war gut sieben sm lang (ein Supermiku ist eine puntirjanische Längeneinheit von 86,369 irdischen Metern) und halb so breit. An ihrem höchsten Punkt erhob sich die Insel nicht mehr als fünf mk (1 Miku entspricht 1,06628 Metern) von der Wasseroberfläche des Sars. Fünfzehn Kattmiku von der Mündung entfernt, hatte das Wasser nur noch einen leichten Chlor- und Salzgehalt, und der Ravrokylbestand war dichter geworden. Ravrokylen, das waren die häufigsten Landpflanzen des Planeten, welche ganze Wälder bilden. Sie sehen ein wenig wie übergroße Riesenschachtelhalme aus, ein wenig auch wie Grashalme, an deren Spitzen Palmblätter und bananenartige Früchte wachsen.
Sie fanden etwas hinter dem Ufer der Insel eine große Lichtung inmitten der Ravrokylwälder. Auf ihr hatten Gugays Begleiter ein Dutzend Zelte aufgebaut. Inmitten der Lichtung befand sich auch eine vereinzelt dastehende, große Blau-Ravrokyl. Ihr Rumpf war so groß, dass es mehrere Flügelschläge brauchte, um zu seiner Spitze hochfliegen zu können, und die Pflanze selbst war abgestorben und ohne Früchte und Blätter. Gugay deutete mit der Flügelspitze auf diese Ravrokyl.
„Hier hängen wir den Sender auf!“, sagte Tüngör.
„Wen?“, krächzte Gugay erschrocken. „Wen willst du hängen sehen?“
„Den Sender für das „Gris-Quadre“-Hoheitszeichen natürlich, Gugaylein!“, grinste Tüngör. Er hielt den Sender für das „Gris Quadre“ der Cisnair Répüblik fest, machte ein Holo-Bild von der Szene mit der Mobilfunk-Cam-Unit seines Minismartphones, und funkte es an die Naturreservats-Verwaltungen von Clénairville und Sarkugratt.
Gugay spürte eine tiefe, patriotische Wärme im Inneren. Er ließ seinen Blick den Rumpf emporgleiten. Er wollte einen Krøg-Flachmann aus dem Gefieder ziehen, doch dann ließ er stattdessen den cisnairschen Nationalruf ertönen. Einen kurzen Moment später standen sie still.
Tüngör flog, den Sender in der Hand, den Ravrokylrumpf hoch, befestigte ihn oben an der Spitze, aktivierte ihn und er funkte das traditionnelle „Hoch lebe M. Germaing Ebertaing, der Président der Cisnair Répüblik und hoch der IPO-Vorsitzende Kaiser Hindius der Fünfte von Monastair! Hoch, Hoch, Hoch!“.
Die Information von der Vereinnahmung der kleinen Insel im Sar durch Grenzverletzer aus Cisnair wurde zunächst von der fliegenden Reichsgrenzschutzgarde ignoriert. Sie brauchte elf Puntirjanminuten, bis sie in Sarkugratt in der persönlichen Mailbox des Westgebietsgouverneurs auftauchte, doch gelesen wurde sie dort erst einen halben Tag später.
Ereignis 2: Der Kometenkern
Als die Schraube der fremden Sonde im Eisfragment die Oort’sche Wolke verließ, traf der Eisbrocken auf einen Kometenkern am Rande des Kuipergürtels. Der umgelenkte Kometenkern zog ihn an, nahm ihn in sich auf und setzte seine Reise in das Innere des Sonnensystems fort. Er folgte so der Sonde „Altakol-Späher“ und schwebte in Richtung der Welt der Menschen.
Die Sonde leitete im Unterschied zum Kometenkern ein automatisches, nukleares Abbrems-Manöver ein, um in eine Umlaufbahn um das gelbe Zentralgestirn zu gelangen, dessen System sie erforschen sollte.
Die Sonde aus der fremden Welt jedoch nahm erste Holo-Bilder von den noch fernen Planeten des Sonnensystems auf, auf das sie zuraste, und sie gab die Funksignale weiter, zurück in das 11,2 Lichtjahre ferne Puntirjan.
Kapitel 6: Grenzverletzung gemeldet
Sarkugratt lag im Buschland oberhalb der Küstenniederung. Es bestand aus insgesamt vier Handelsstationen, die im Besitz indjarscher und westsarkarischer Kaufleute waren, und der sarkarischen Reichsgouvernörsfestung.
Zu dem Zeitpunkt, da der Bote mit der Nachricht von der cisnairschen Inbesitznahme der Deltainsel über den letzten Hügel flog und durch die Ravrokylenwälder die kleine Gebäudegruppe von Sarkugatt vor sich liegen sah, war der Herr Aru gerade damit beschäftigt, sein Mittagsmahl einzunehmen.
Er gab schließlich ein tiefes, sattes Gurren von sich und plumpste in sein Kissen, dessen Nähte ob des plötzlichen Luftdruckes einige Flaumfedern freigaben fast wie sein Körper die Blähungen. Er musste nun eine ganze Zeit lang warten, ehe seine Flugtauglichkeit wieder hergestellt war.
Da erreichte ihn die Nachricht. Arfazzu Aru betrachtete das Display mit düsterem Blick. Seine gute Laune war weg, denn er hatte ein Ruhepäuschen im Sinn gehabt. Er fixierte die Wolke dicht über den Hügeln im Süden, schlürfte sein Krøg aus und wischte sich die Wurstreste vom Mund.
„Mist!“ knurrte er, und öffnete die Videobotschaft mit einem Klick. Der Nachrichten-Unteroffizier blickte ängstlich und voller Respekt in die Kamera des Reichskommandeurs von Westsarkar.
„Heil Arefazom, dem Elften Sarjowairkaiser. Ich benachrichtige sie, Kommandant, weil ….“, begann er, und Arfazzu Aru fühlte sich geschmeichelt. Er mochte es in einem Zug mit dem großen Führer des Profaznatorgismus, dem.Großkaiser von Sarkar, genannt zu werden.
„Ich beziehe mich auf eine Information von Ganssar, dem Generalmajor der Reichsgrenzschutzgarde West. Funkzelle Nr. 482 im Sar-Gebiet 52 hat Funksignale mit Holo-Fotos registriert, dass dort das „Gris Quadre“ gezeigt worden ist.
Arfazzu Aru richtete sich langsam auf, seine Schlagader unter dem Halsgefieder schwoll an.
„Seit ihrer Landung haben die Inselbesetzer nicht aufgehört zu wildern, und es sind viele Flugechsen erlegt worden. Die Verluste im elektronisch erfassten Wildbestand liegen, den Chip-Ausfällen zufolge, bei 82%“.
Arfazzu Aru plusterte sich auf, als wolle er platzen.
„Die Gesichtserkennungssoftware meldet, die beiden Anführer der Aktion sind in unserer Datei. Der Ältere ist ein Gugay Fiscaux aus der Region von Clénairville.“
Arfazzu Aru schrie auf wie ein Milchsaurier zur Brunftzeit. Die Videoübertragung brach ab. Herr Aru kontaktierte die Sicherheit.
„Fahnenmarschall!“
Aru krächzte wie bei einem Angriffsbefehl.
„Fahnenmarschall, sofort!“ brüllte er, „Ein Geschwader Düsengleiter, die Grenzschützer! Fiscaux ist wieder da, unsere Wildbestände im Naturschutzgebiet plündern! Er hat das republikanischen Gris Quadre gesendet – im Herrschaftsbereich unseres Großkaisers, des Großen Führers von Sarkar.
„Fahnenmarschall, wo bleibt ihr Startbefehl! Geschwader-Start, sofort!“
Das war ein Fall von internationaler Bedeutung, Aru wusste es nur zu gut. Der Große Anführer kannte da keine Gnade, und wenn er jetzt etwas falsch machte, so konnte er mit seiner Exekution rechnen – gerade jetzt, wo das große, prosarkarische Bündnis gegen den Willen höchster IPO-Behörden und des Parmun-Parlamentes zustandegekommen war. Aru keuchte, prustete und hustete vor Erregung – er stand im Zentrum einer historischen Auseinandersetzung. Seine Hände zitterten, als er eine Email an den großkaiserlichen Prinzgouvernör der Reiche von Sarkar lossandte, die auf dem Planeten vielleicht einen Weltkrieg aufflammen lassen könnte, den die fazisto-sarkarischen Völker als die Erstbesiedler fremder Welten im All beschließen könnten.
Ein Flug im Düsengleiter würde sie zum Sar bringen, zur dritten Sarka-Station, wo das Sarfazzo-Geschwader von Westsarkar im Hangar stand.
Kapitel 7: Erzräuber werden gestellt
Das war eine Beute! Gugay war zufrieden. Sie hatten gerade die Beute Malalos Shuttle verladen. Der Frachtraum war rappelvoll, und wenn er das Lithiumerz bei den Groß-Hehlern versteigern würde, könnte er dafür Kisten voller Krøg eintauschen. Das Shuttle schien fast Übergewicht zu bekommen, als er die Startbereitschaft checken wollte, doch als er den Radar-Bildschirm erblickte, blieb Gugay Fiscaux plötzlich der Krøg in der Kehle stecken. Das Bildschirmsymbol zeigte, direkt von Osten her flog ein volles Grenzschutz-Geschwader auf die Shuttle-Position zu – die Sarfazzo-Flotille.
„A .... Ar ... Aru!“ stotterte er, als sich seine Erstarrung löste, und das Geschrei an Bord war groß.
Tüngör blickte herüber, fand als Erster Worte des Schreckens.
„Gugay, Gugay, der meint ja uns! Der hat ja so viel Sachen drauf, dass er uns gleich ... „
„Los, sitz nicht so rum!“ brüllte Gugay, der sich wieder erholt hatte.
„Hau den Alarmstart rein, vollen Antrieb!“
Doch schon hörten sie das Donnern der Jets, ein mitgebrachter Kampfhubschrauber setzte neben dem Shuttle auf, noch bevor es starten konnte, streifte seine Landefüße und es gab eine heftige Erschütterung. Die Frachtraum-Tür sprang wieder auf, die kostbare Ladung fiel ins Wasser und die Wellen schossen über die Tragflächen, so dass Gugay und Tüngör nass wurden. Nun fiel das Shuttle zur Seite, kippte ins Wasser und nach einem lauten Blubbern und Gurgeln sah man Tüngör und Gugay nur noch auftauchen, schwimmen und heftig nach Luft schnappen. Etwas weiter flussabwärts wendete der gewasserte Kommandojet des Geschwaders, kam wieder zurück und als Aru aus dem Cockpit den unten im Wasser paddelnden Gugay Fiscaux erblickte, stieß er ein brüllendes Gelächter aus, dass der ganze Raum vibrierte.
„Harrharhar, Gugay Fiscaux, du wirst nie wieder im Jagdgebiet des Großkaisers deine Echsen jagen! Jetzt hast du ausgespielt, du cisnairscher Stinkkäfer!“ Der Wasserflut des Fahrtwindes der Jets folgte eine Flut von Schimpfwörtern, die sich jeder Übersetzung widersetzen, eine Flut, in der Arfazzu Aru all seine Wut ablassen konnte, die sich in ihm seit Tolonmonaten aufgestaut hatte, - immer wieder war Gugay Fiscaux ihm zuvorgekommen. Und jetzt paddelte er mit den Flügeln hilflos vor ihm im Wasser herum.
Er strahlte vor Freude, sein Gefieder zitterte vor Erregung, und er blickte genüsslich aus dem Fenster, um dem Schauspiel der Festnahme der Wilderer zusehen zu können. Er verließ den Kommandojet, stellte sich auf die Rampe, die ihm wie die VIP-Lounge einer Aussichtsplattform vorkam, und postierte sich im warmen Licht der Wemursonne.
Karte: Lage der „Cisnair Répüblik“, in der Gugay und Tüngör leben (grün, links oben), und des gegnerischen Reichs von Sarkar (rot) auf Puntirjan. Rechts die Monastair-Union.
Ereignis 3 : Der Späher bremst ab
Das automatische Abbremsmanöver der fremden Sonde hatte einige Monate gedauert. Dann war auch ihr Ionentriebwerk Zwei ausgebrannt. Sie vollführte ein Swingby-Manöver am Ringplaneten, geriet zwischen Mars und Planetoidengürtel, und befand sich nun in einer weiten, elliptischen Umlaufbahn um die Sonne. Der große Gasplanet befand sich zum Glück auf der anderen Seite des Fixsterns, und so war die provisorische exzentrische Umlaufbahn der abgebremsten Sonde aus Puntirjan, stabil.
Der „Altakol-Späher“ fuhr sein Spektralpolarimeter, die Solarpaneele, Mikroteleskope und –spektroskope aus, sammelte genauere Daten in fast allen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums und begann sie zu speichern, um auch sie sie demnächst heimzusenden in die ferne, heimatliche Welt von Puntirjan. Die Funktionsfähigkeit der Sonde war nicht beeinträchtigt: der Verlust der einen Neodymschraube in der Oort’schen Wolke hatte keinen Schaden verursacht. Ohne dass sich jemand Sorgen machen musste, konnte die Sonde in Ruhe einige Jahrzehnte warten, bis dass Funkbefehle aus Puntirjan bei ihr eintrafen.
Hinweis: Die Reisedaten der Raumsonde mit dem XENOPHON sowie zur weiteren Geschichte von Tüngör, Jenis und Gugay finden sich hinten im Anhang.
Kapitel 8: Die Sarjowa
„Los, Mann, holen sie raus, was rauszuholen ist! Wir müssen das Geschwader finden!“ befahl der Kapitänleutnant dem Bordingenieur, der mit öligem Gefieder einen Knopf bis zum Anschlag herunterpresste, sich etwas Öl vom Flügel wischte und ein „Eyeye, Sir, Order ausgeführt!“ erwiderte.
Unter dem Druck der Beschleunigung wurde die Besatzung einige Schritte weit geschleudert, als plötzlich vom Radarbeobachter die Meldung kam: „Geschwader backbord vorrraaaus!“
„Antrieb stop!“ krächzte der Kapitänleutnant, „Kurs backbord voraus!“ und der Bordingenieur zog den Knopf wieder zurück. Der Besatzung des herannahenden Kampfjets Sarjowa bot sich ein dramatisches Bild. In einem Umkreis von einigen Übermikus paddelen zwei schwer verwundete Puntirjaner, kurz vor dem Ertrinken und überall lagen Wrack-Teile verstreut am Ufer.
„Die Sarjowa!“ brüllte Arfazzu Aru vor Freude bebend, „Die Sarjowa, mein Anführer!“ Er erkannte den Gouvernörsshuttle sofort, denn er hatte ihn bei einer Reichsgrenzschutzübung gesehen. „Fahnenmarschall, senden sie Grußfrequenzen!“ Er flog vor Freude einen Salto. Der großkaiserliche Prinzgouvernör musste die Sarjowa unverzüglich zum Sar geschickt haben, um die Mündung zu blockieren.
Der Gouverneursshuttle hatte fast gigantische Maße und im Vergleich zu Arus Shuttle und dem Kampfhubschrauber wirkte er wie ein Flugzeugträger neben einem Gummiboot und einer auf dem Wasser treibenden Ente. Arfazzu Aru sah angewidert bis ängstlich die Markierung an der Shuttlewand empor, an der entlang er hochfligen sollte. An der Eingangsplattform landete er plötzlich neben einer Gardisten-Abordnung, an deren Vorderseite ein nordsarkarischer Garde-Offizier in einer schicken, frischen Gardeuniform auf ihn zukam.
Aru salutierte und nahm mit knallenden Hacken Haltung an. Er schluckte aufgeregt.
„Leutnantskommandeur Aru.“
„Leutnant Narkjowair.“
Der Offizier sah ihm in die Augen.
„Ich muss sofort Ihren Kapitänleutnant sehen. Es geht um die Grenzsicherheit des Kaiserreichs.“
Kapitel 9: Die Verhaftung der Erzräuber
Generalstabs-Kapitänskommandeur h. c. Sarfazzu Sarjowär setzte sich, als er Arfazzu Aru empfing.