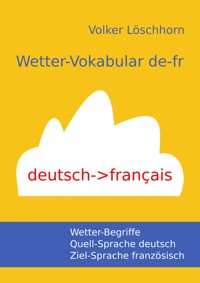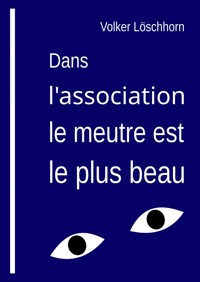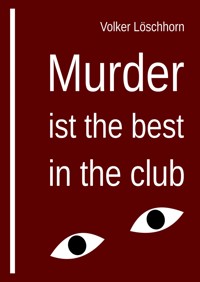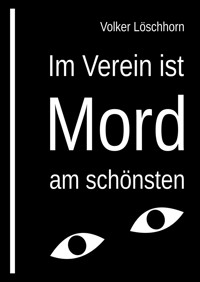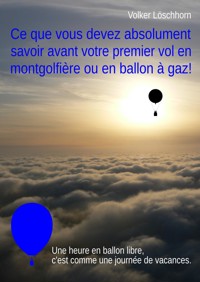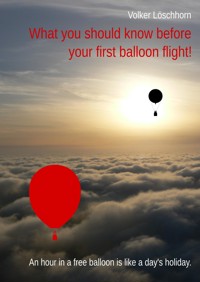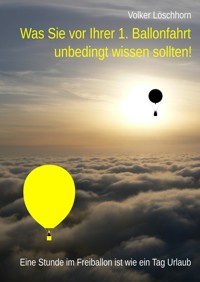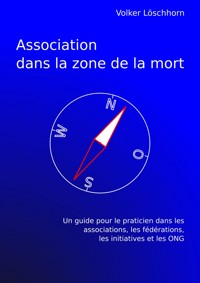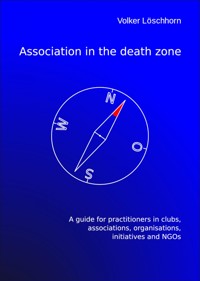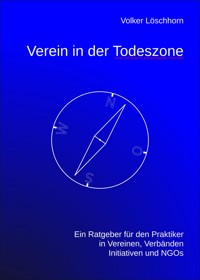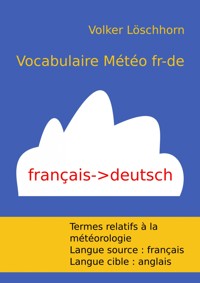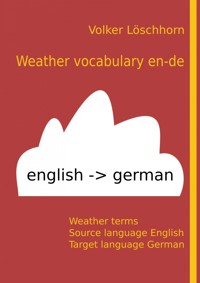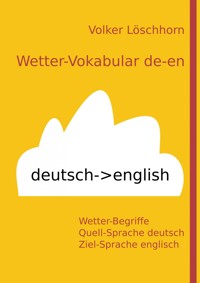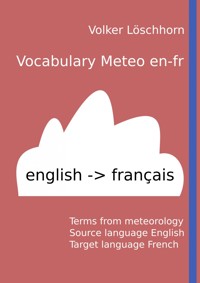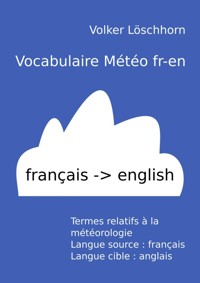Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mit dem Ballon eroberten die Menschen den Luftraum. Aber dem Ballon haftet etwas geheimnisvolles an: Ist er wirklich nur ein Spielball des Windes, oder kann man ihn doch steuern? Direkt nicht aber indirekt durch ausnutzen verschiedener Windströmungen. Hierbei helfen moderne Möglichkeiten der Windvorhersage, die die Intution des Piloten ergänzen. Ein Ballonfahrer benötigt ein tiefes Verständnis für die Atmosphäre und die Gesetze wie Vorgänge in ihr ablaufen. Die Troposphäre ist sein Spielplatz. Die Ballonfahrt hat viele Facetten: Kommerzieller Passagiertransport für touristische Zweck, Werbung, Freizeitgestaltung und sportlicher Wettbewerb. Fast jeder hat schon einmal ein Heißluftballon gesehen, aber die viel selteneren Gasballone werden kaum wahrgenommen. Dabei beherrschen sie fast zwei Jahrhunderte zusammen mit den Vögeln den Himmel. Und dabei sind sie die in Serie hergestellten Luftfahrzeuge, die am längsten in der Luftbleiben können: Ohne zwischendurch zu landen über hundert Stunden. Solche Fahrten unterscheiden sich wie die Binnenschiffahrt von der Hochseeschiffahrt. Das Ballonfahren-eBook möchte hier erläutern, wie das alles funktioniert und abläuft. Der Autor des Buches, Volker Löschhorn, ist selbst aktiver Ballonpilot und Fluglehrer. Auch im Sport ist er aktiv, war mehrmals Deutscher Meister im Gasballonfahren. Er teilt hier seine umfangreiche Erfahrung hauptsächlich in Textform, ergänzt mit einigen Abbildungen. Das Buch richtet sich an den, der auf die Ballonfahrt neugierig ist. Aber auch der erfahrene Balloner kann noch Neues für sich entdecken - versprochen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Löschhorn
Das Ballonfahren eBook
Impressum
Texte: © 2025 Copyright by Volker Löschhorn
Umschlag: © 2025 Copyright by Volker Löschhorn
Verlag
Volker Löschhorn
Dattelweg 37 B
70619 Stuttgart
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.loeschhorn.name
Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Mehr Bücher und anderes von mir finden sie auf meiner Homepage
www.loeschhorn.name
Haftungsausschluss
Trotz aller Sorgfalt können sich Fehler eingeschlichen haben. Die Ausführungen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beziehen sich auf Deutschland udn die EASA-Mitgiedsstaaten. Für Ballonfahrten in anderen Ländern gelten die dortigen Vorschriften. Auch unterliegt das Luftrecht, und auch das Recht im Allgemeinen, einem ständigen Wandel. Deshalb sollte man sich über die am Ort geltenden aktuellen Vorschriften kundig machen.
Vorwort
Wann hat der erste Mensch einem Vogel nachgeschaut, und sich gewünscht es ihm gleichzutun und in die Lüfte zu steigen? Wir wissen es nicht, nur dass es viele tausend Jahre gedauert hat, bis die ersten Menschen den Erdboden zu einer Luftreise verlassen haben. Interessant dabei ist, dass sie dabei nicht den Flug der Vögel nachgeahmt haben, sich nicht mit Hilfe der Aerodynamik in die Luft erhoben haben, sondern mit Hilfe des statischen Auftriebs aufgestiegen sind. Was die größere gedankliche Leistung ist da man kein natürliches Vorbild nachgeahmt hat, aber offensichtlich der aerodynamische Flug technisch schwieriger umzusetzen war. Zwar hatte bereits Archimedes von Syrakus das Prinzip des hydrostatischen Auftriebs im 3. Jahrhundert vor Christi Geburt entdeckt und beschrieben, also vor mehr als zwei Jahrtausenden, aber auf die Luft hat er es nicht angewendet. Dass das archimedische Prinzip sich auch auf Gase und Gasgemische wie die Luft übertragen lässt, diesen Gedanken hatte 1650 Otto von Guericke. Er entwickelte das Dasymeter, mit dem sich der Auftrieb eines Körpers in der Luft bestimmen lies.
Aber er dachte nicht an die Luftschiffahrt, aber er inspirierte Francesco Lana de Terzi, der 1670 ein Luftschiff entwarf, dass seinen Auftrieb mit Vakuumkugeln gewann.
Vakuum ist ideal um Auftrieb zu erzeugen, leider müssen bis heute Vakuumbehälter so schwer gebaut werden, dass sie schwerer sind als der Auftrieb den sie erfahren, und damit ungeeignet um in die Lüfte zu steigen. Zwar gibt es verschiedene Legenden über feuerspeiende Figuren, und ähnliche Körper, die in die Luft gestiegen sind. Am meisten Indizien gibt es dafür, dass Bartolomeu Lourenço de Gusmão 1709 einen kleinen Ballon am portugiesischen Hof in Lissabon hat aufsteigen lassen. Aber erst die Versuche der Gebrüder Montgolfier 1783 setzten die Entwicklung in Gang. Doch trotz dieser langen Geschichte der Ballonfahrt bleibt Ballonfahren für viele rätselhaft: Dass man mit warmer Luft oder einem leichten Gas nach oben steigen kann, diese Erkenntnis wird allgemein akzeptiert. Aber wie geht es dann weiter? Wie steuert man einen Ballon? Warum gibt es Ballone mit Sandsäcken und welche ohne? Und warum haben Ballone keinen Anker mehr? Diese und viele weitere Fragen werden Ballonfahrern gestellt. In diesem Buch möchte ich diese Fragen beantworten, und erklären, wie Ballonfahren funktioniert.
Ballone
Ballon gefahren wird heute mit drei verschiedenen Ballonklassen, man könnte auch Ballonarten sagen: Heißluftballonen, Gasballonen und Rozièren. Weltweit gibt es über zehntausend Heißluftballone, etwa ein halbes Hundert Gasballone und Rozièren im einstelligen Bereich. Warum die eine Ballonklasse so häufig ist, und die anderen so selten sind, wird bei der Vorstellung der einzelnen Ballonarten verraten.
Heißluftballon
Der Heißluftballon war der erste Ballon am Himmel – seinen Auftrieb erzeugt man ganz einfach mit heißer Luft. 1783 ließen die Brüder Étienne und Joseph Montgolfier den ersten Heißluftballon im südfranzösischen Städtchen Annonay vor Publikum aufsteigen. So einfach das Prinzip ist heiße Luft mit Feuer zu erzeugen, so problematisch war die damit verbundene Brandgefahr: Es standen weder nichtbrennbare Materialien für die Hülle zur Verfügung – die Montgolfiers bauten ihre Ballone aus Leinenstoff der mit handgeschöpftem Papier verstärkt wurde – noch war das Heizen mit Festbrennstoffen wie Stroh praktisch in der Handhabung. Daher fristete der Heißluftballon fast zwei Jahrhunderte lang ein Schattendasein, bis in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Materialien und der Brennstoff für den modernen Heißluftballon zur Verfügung standen: Kunststofffasern für die Hülle, und Propan als einfach zu handhabender Brennstoff. Übrigens, häufig bezeichnet man Heißluftballone auch nach ihren Erfindern als Montgolfièren.
Heißluft-Luftschiffe
Heißluft-Luftschiffe gehören zu den Heißluftballonen, werden auch als Lenkballone bezeichnet. Sie bestehen aus einer aerodynamisch für die horizontale Bewegung gegen die Luft günstig geformten Ballonhülle. Und verfügen über ein Seitenruder und einen Antrieb mit Propeller. Die Höhe wird wie bei einem Heißluftballon durch unterschiedlich starkes Aufheizen der Luft in der Ballonhülle erzeugt. Bei manchen Heißluft-Luftschiffen wird in der Hülle mit Hilfe eines Gebläses ein leichter Überdruck erzeugt, der die Hülle stabilisiert und höhere Geschwindigkeiten ermöglicht. Der Betrieb eines Heißluft-Luftschiffes erfordert viele Helfer, und ist auch deshalb aufwändig. Es gab zwar auch schon Meisterschaften bis hin zu Weltmeisterschaften, aber diese finden nicht regelmäßig statt. Meistens sind die wenigen Heißluft-Luftschiffe zu Werbezwecken unterwegs.
Gasballon
Die Erfindung des Gasballons war eine Auftragsarbeit. Die Nachricht des Ballonaufstiegs in Annonay verbreitete sich in Windeseile bis nach Paris, und dort wollte man auch einen Ballon aufsteigen sehen. Man beauftragte den Wissenschaftler Professor Charles mit der Umsetzung. Dieser hatte gehört, dass die Montgolfiers ein neues Gas erfunden hätten. Er vermutete dass es sich dabei um das leichteste aller Gase – Wasserstoff – handelte. Zusammen mit den Brüdern Robert baute er eine gasdichte Hülle und einen Erzeuger für Wasserstoff, und nur zwei Wochen nach dem Aufstieg der ersten Montgolfière startete in Paris der erste Gasballon – die Charlière. Einmal mit Gas befüllt, müsste ein Gasballon unendlich lange fahren können – sofern die Hülle dicht ist – da bei ihm nicht um den Auftrieb zu erhalten wie bei einem Heißluftballon ständig nachgeheizt werden muss. Das würde auch so funktionieren wenn, ja, wenn die Sonne nicht wäre. Diese heizt das Traggas tagsüber auf, und nachts kühlt es dann ab und zieht sich zusammen, und der Ballon verliert an Volumen und damit an Auftrieb. Diesen Verlust an Auftrieb gleicht man aus, indem man etwas des auch zu diesem Zweck mitgeführten Ballastes abwirft. Das geht aber nicht beliebig oft, mit einem modernen Gasballon könnte man unter günstigen Bedingungen drei bis fünf Tage, ohne zwischendurch zu landen, fahren. Als Traggas wird für Gasballone heute in der Regel Wasserstoff verwendet. Die einzige für die Verwendung in Ballonen negative Eigenschaft des Wasserstoffgases ist, dass es brennbar ist. Um zu verhindern, dass sich das Wasserstoffgas aufgrund elektrostatischer Aufladung entzündet, sind die Hüllen leitfähig beschichtet, so dass sich keine für Zündfunken ausreichenden Ladungsunterschiede bilden können. Das nichtbrennbare aber doppelt so schwere und sehr teure Edelgas Helium wird selten verwendet. Leider stehen weder Wasserstoff noch Helium oder andere geeignete Gase überall zur Verfügung, und der Transport ist aufwändig und damit teuer.
Gasballon-Startplätze
Günstig kann Wasserstoff nur an Startplätzen, die mit einer Pipeline versorgt werden, bezogen werden. Leider sind diese Startplätze sehr selten, es gibt davon fünf in Deutschland und keinen im Ausland. Hier die Startplätze in Deutschland, die entweder über eine Pipeline oder über einen stationären Tank Wasserstoff bereit stellen:
Düsseldorf: https://www.ballon-duesseldorf.de/
Gladbeck: http://www.ballon.org/
Münster: https://www.fsv-muensterland.de/
Ibbenbüren: http://www.ballonclub-teuto.de/
Bitterfeld-Wolfen: https://www.ballon-bitterfeld.de
Burgkirchen: https://freiballonclub-salzach-inn.chayns.site/
Gersthofen: https://www.augsburg-ballon.de/
Stuttgart: https://ballonsportgruppe-stuttgart.de/
Rozière
Bringt es Vorteile, Gas- und Heißluftballon zu kombinieren? Diese Frage stellte sich Pilâtre de Rozier, und baute eine Kombination aus beiden, die nach ihm benannte Rozière. Mit ihr versuchte er am 15. Juni 1785 den Kanal nach England zu überqueren. Leider hatte er weder das unbrennbare Traggas Helium noch unbrennbare Materialien für die Hülle zur Verfügung. Auch das Heizen der Heißlufthülle unter der Wasserstoffhülle mit Stroh war nicht ohne Funkenflug möglich. Die Ursache konnte nicht geklärt werden, aber das Wasserstoffgas entzündete sich während der Fahrt und der Ballon stürzte aus circa 900 m Höhe ab.
Heute werden Rozièren mit dem unbrennbaren, aber sehr teuren Heliumgas befüllt. Aber ihr Einsatz lohnt sich nur, wenn man sicher mehr als drei bis vier Tage unterwegs sein möchte. Der Vorteil der Rozière gegenüber dem reinen Gasballon ist, dass man mit Hilfe des Brenners die nächtliche Abkühlung des Traggases ausgleichen kann, ohne dass deswegen Ballast abgegeben werden muss. Und auch Änderungen der Fahrthöhe sind durch mehr oder weniger heizen möglich. Dadurch kann die Fahrtdauer mit dem Einsatz von relativ wenig Brennstoff gegenüber dem Gasballon erheblich verlängert werden. Zum Beispiel wurden die Weltumrundungen mit Rozièren gefahren – dabei waren die Ballone wochenlang in der Luft.
Modellballone
Alle Ballone lassen sich auch als ferngesteuerte Modelle bauen, aber auch die meisten Modellballone sind Heißluftballone. Modellballonfahren ist ein eigenständiges Hobby, aber auch eine hervorragende Möglichkeit, Jugendliche an das Ballonfahren heranzuführen. Für Modellballone benötigte man früher keinen Pilotenschein, heute aber einen Kenntnisnachweis. Mehr Informationen, nicht nur über die rechtlichen Rahmenbedingungen, gibt es hier:
http://www.modellballone.de
Aber die kleinen ferngesteuerten Modellballone reagieren viel empfindlicher als ihre großen Brüder – wer das Fahren eines Modellballons beherrscht, wird sich in der Pilotenausbildung leicht tun, den großen Ballon zu manövrieren.
Modell-Luftschiffe
Luftschiffe sind selten und können sowohl als Heißluft-Luftschiffe als auch als Gas-Luftschiffe gebaut werden. Ob gasgefüllte Modell-Luftschiffe zu den Ballonen zählen? Kann man sich darüber streiten, teilweise verbinden sie Aerostatik und Aerodynamik um durch die Luft zu reisen. Wer sich dafür interessiert ist auf der Homepage des Vereins aerarium Luftschifftechnik e.V. richtig:
https://www.aerarium.de/
Weitere Ballonarten
Die vorgestellten Ballone haben eine nicht dehnbare Hülle, und der Innendruck wird auch nicht erhöht, die Hüllen sind nicht für einen inneren Überdruck gebaut. Ballone mit einer dehnbaren Hülle gibt es als Kinderluftballone und als Wettersonden. Dehnbare Ballone und Überdruckballone spielen in der bemenschten Ballonfahrt keine Rolle.
Piloten
Pilot werden heißt entscheiden zu lernen, und Entscheidungen umsetzen zu lernen. Und um Entscheidungen treffen zu können, braucht es Wissen. Und praktisches Können um die Entscheidungen umzusetzen. Daraus folgt, dass man um Pilot zu werden, eine theoretische und praktische Ausbildung benötigt. Ein Ballonpilot muss in der Lage sein Verantwortung zu übernehmen und ein Team zu führen. Und vor allem muss er sich bewusst sein, dass er für seine Kompetenzen selbst verantwortlich ist. Fluglehrer und Lehrpläne können nur ein roter Faden beim Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten sein, aber in einer sich verändernden Welt gehört die Bereitschaft dazu, sich selbstständig weiter zu bilden. Nur dann ist man in der Lage kompetenzbasierte Entscheidungen zu treffen.
Voraussetzungen
Kann jeder Pilot werden? Oder muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
Formale Voraussetzungen um Pilot zu werden sind das Mindestalter, die medizinische Tauglichkeit und die Zuverlässigkeit.
Hier die Kriterien für die flugmedizinische Tauglichkeit aufzuführen, würde nur verwirren. Denn wenn man diese im fachchinesisch formulierten Kriterien als medizinischer Laie liest, stellt man sich nur die Frage, ob es überhaupt jemanden gibt der tauglich ist. In der Praxis erfüllen die meisten Menschen die Anforderungen der Tauglichkeitsklasse 2 oder LAPL, die für Ballonpiloten gilt. Für sich selbst kann man es nur durch eine flugmedizinische Untersuchung durch einen Fliegerarzt (flugmedizinischer Sachverständiger) klären. Die häufigsten Ursachen für die Nichttauglichkeit sind Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes, und eine zu große Fehlsichtigkeit. Eine gute Beschreibung gibt es auf der Seite Segelfluggrundausbildung: https://segelfliegenausbildung.de
Die Zuverlässigkeit wird durch ein polizeiliches Führungszeugnis und einen Auszug aus dem Verkehrszentralregister nachgewiesen. Als ungeeignet zum Führen eines Luftfahrzeugs kann zum Beispiel jemand angesehen werden, der häufige und/oder schwere Verkehrsverstöße begangen hat. Aber außer den formalen gibt es auch noch andere Voraussetzungen: Die Begeisterung für das Ballonfahren, die Bereitschaft sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, und zu führen – nicht nur den Ballon, sondern auch das Team das man zum Ballonfahren braucht.
Ausbildung
Die Ausbildung findet in einer Luftfahrerschule statt. Hier gibt es gewerbliche Angebote, aber auch viele Vereine haben die Genehmigung zur Ausbildung ihrer Mitglieder.
Theoretische Ausbildung
Die theoretische Ausbildung umfasst Luftrecht und Luftverkehrsregeln, Navigation, Kommunikation, Meteorologie, Aerostatik, Technik, Verhalten in besonderen Fällen und bei Unfällen und, last but not least, menschliches Leistungsvermögen.
Luftrecht – das mit Abstand trockenste Fach, das man hauptsächlich für die Prüfung lernt, für die Praxis ist es wichtig zu wissen, was wo steht, wo man nachlesen muss – auch durch die fortschreitende europäische Integration ändert sich das Luftrecht rasch.
Luftverkehrsregeln – für Ballonfahrer die Sichtflugregeln – muss man kennen.
Kommunikation (Flugfunk) – hier lernt man das Kommunizieren mit der Flugsicherung – wichtig um während der Fahrt Informationen und Freigaben für kontrollierte Lufträume zu bekommen.
Navigation – hat sich durch die Satellitennavigation erheblich vereinfacht, trotzdem sollte man auch die traditionelle Navigation mit der Karte beherrschen. Und man lernt auch, Informationen über Lufträume und das Gelände aus der Karte zu entnehmen.
Meteorologie – Hintergrundwissen und Verständnis sind hier für den Ballonpiloten unverzichtbar – gerade was den Wind angeht muss man das Gelände lesen können und den unsichtbaren Wind „sehen“ lernen.
Technik – des Ballons und der Bordinstrumente, lernt sich am leichtesten, da man hier ständig nicht nur die Theorie sondern in der Ausbildung auch den direkten Bezug zur Praxis hat.
Verhalten in besonderen Fällen und bei Unfällen – das Fach mit dem längsten Namen – hier geht es um den Umgang mit Störungen und Unfällen – nicht das angenehmste Thema, aber man lernt es um es nicht anwenden zu müssen.
Menschliches Leistungsvermögen – ist das jüngste Fach, denn man hat irgendwann festgestellt, dass das Wissen um die „Funktion“ des Menschen ebenso wichtig ist wie das Wissen um die Technik. Der englische Begriff „Human performance and limitations“ hebt noch mehr hervor, dass es vor allem auch wichtig ist zu wissen, wo die Grenzen der (eigenen) Leistungsfähigkeit liegen.
Praktische Ausbildung
Die Praxis – das Ballonfahren – ist es wozu die ganze Ausbildung dient. Doch zur Praxis gehört nicht nur das Bedienen des Ballons, sondern die Praxis umfasst:
Kennenlernen des Ballons und seines Zubehörs – des Ballon selbst mit seinen Bauteilen Hülle, Brenner, Flaschen, Korb – und den Fluginstrumenten Variometer und Höhenmesser – und des Flugfunkgerätes und des Transponders.
Fahrtvorbereitung – Organisation von allem was für die Fahrt benötigt wird: Ballon und Team, Wetterinformationen, Startplatz.
Fahrtentscheidung – sind die Wetterbedingungen okay, ist der Startplatz okay, ist der Ballon okay, bin ich als Pilot okay, und ist mein Team okay?
Briefing des Teams – was habe ich vor – wer macht was?
Aufrüsten – Zusammenbauen des Ballons – Füllen.