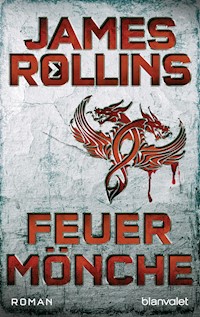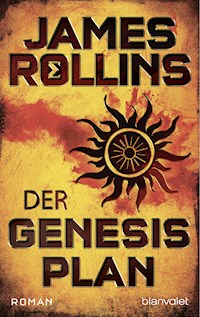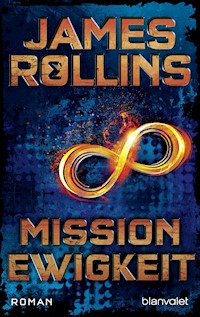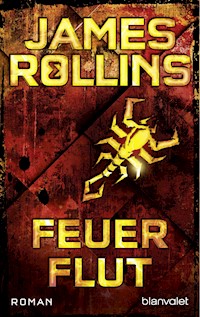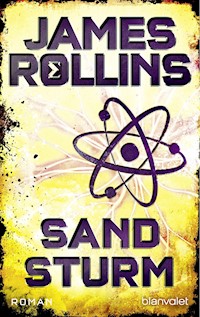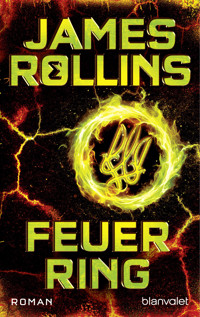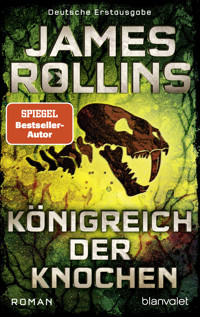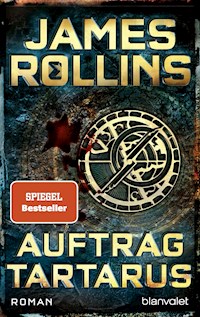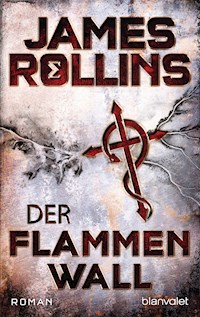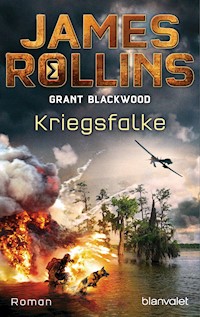2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Indiana Jones meets Lara Croft - mehr Action geht nicht!
Fast fünfhundert Jahre alt ist die Mumie, die der Archäologe Henry Conklin in einer Höhle hoch oben in den peruanischen Anden gefunden hat. Rasch stellt sich heraus, dass es sich bei seinem sensationellen Fund nicht um einen Inka, sondern um die Überreste eines spanischen Priesters handelt. Und die Mumie ist seltsam präpariert: Ihr Schädel wurde mit einer Substanz gefüllt, die aussieht wie reines, flüssiges Gold und verheerende Eigenschaften besitzt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
James Rollins
Das Blut des Teufels
Roman
Deutsch von Alfons Winkelmann
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Excavation«bei HarperCollins, New York.
AuflageTaschenbuchausgabe Juni 2014 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, MünchenCopyright © 2003 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.Copyright © 2000 by Jim CzajkowskiPublished in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.© der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.Umschlaggestaltung: © Illustration Johannes Wiebel | punchdesignSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-11235-6www.blanvalet.de
WIDMUNG UND DANKSAGUNG
Dem Examensjahrgang 1985 der tiermedizinischen Fakultät an der Universität von Missouri gewidmet, insbesondere meinen Zimmergenossen: Dave Schmitt, Scott Wells, Steve Brunnert und Brad Gengenbach.
Dieser Roman wäre ohne die unschätzbare Hilfe sowohl von Freunden als auch Kollegen nicht möglich gewesen. Zuallererst möchte ich meine Dankbarkeit Lyssa Keusch, meiner Verlegerin, und Pesha Rubinstein, meiner Literaturagentin, ausdrücken. Ihre Entschlossenheit, ihr Können und ihre Mühe haben dieser Geschichte zu ihrer gegenwärtigen Gestalt verholfen. Aber ich wäre auch nachlässig, würde ich etlichen Freunden nicht meine Anerkennung aussprechen und danken, die dabei geholfen haben, den ersten Entwurf zu zerpflücken und aufzupolieren: Inger Aasen, Chris Cowe, Michael Gallowglass, Lee Garrett, Dennis Grayson, Debra Nelson, Dave Meek, Chris Smith, Jane O’Riva, Judy und Steve Prey und Caroline Williams. Außerdem danke ich aus tiefstem Herzen Carolyn McCray und John Clemens dafür, dass sie mir während der Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres beigestanden haben.
Darüber hinaus muss ich auch Frank Malaret für seine Kenntnisse der peruanischen Geschichte und Andie Arthur für ihre Hilfe bei den lateinischen Übersetzungen meinen Dank aussprechen. Dank gilt ebenfalls Eric Drexler, PhD., dessen Buch Engines of Creation mich auf den wissenschaftlichen Hintergrund dieser Geschichte brachte.
Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen.
Darauf pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, gegen Osten, und versetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte.
Das erste Buch Mose 2, 7–8
PROLOG
Bei Sonnenaufgang, Anden, Peru 1538
ES GAB KEINEntkommen.
Während Francisco de Almagro durch den dunstigen Regenwald rannte, hatte er längst jede Hoffnung aufgegeben, seine Verfolger noch abschütteln zu können. Heftig keuchend, hockte er sich neben den schmalen Pfad, bis er wieder zu Atem kam. Mit dem Ärmel wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Er trug nach wie vor seine Dominikanerkutte aus schwarzer Wolle und Seide, doch war sie inzwischen schmutzig und zerrissen. Die Inkas, die ihn jagten, hatten ihm alles abgenommen, abgesehen von Kutte und Kreuz. Aus Angst, die Gottheit des Fremden zu beleidigen, hatte der Schamane ihres Volks davor gewarnt, diese Talismane zu berühren.
Obwohl die Kutte für eine Flucht durch den dichten Regenwald der hohen Anden völlig ungeeignet war, wollte der junge Mönch sie doch nicht abwerfen. Papst Clement hatte sie gesegnet, als Francisco seine Weihen empfangen hatte, und er würde sich nicht von ihr trennen. Was ihn jedoch nicht davon abhielt, sie seiner gegenwärtigen Lage anzupassen.
Er nahm den Saum und zerriss die Kutte bis auf Oberschenkelhöhe.
Anschließend horchte Francisco auf die Geräusche seiner Verfolger. Schon schallten die Rufe der Inkajäger immer lauter durch den Bergpass hinter ihm und übertönten inzwischen sogar das Gekreisch der aufgestörten Affen in dem Blätterbaldachin. Bald würden sie ihn eingeholt haben.
Dem jungen Mönch blieb nur noch eine Hoffnung – eine Aussicht auf Erlösung; zwar nicht mehr für sich selbst, aber für die Welt.
Er küsste das abgerissene Stück seiner Kutte und ließ es zu Boden fallen. Er musste sich beeilen.
Als er sich eilig aufrichtete, wurde ihm schwarz vor Augen. Francisco hielt sich am Stamm eines Dschungelsprösslings fest, um ja nicht umzufallen. Er keuchte in der dünnen Luft. Kleine Funken tanzten vor seinen Augen. In dieser Höhe bekam er nicht genügend Luft in die Lunge, deshalb musste er in regelmäßigen Abständen eine Rast einlegen. Seine Kurzatmigkeit durfte ihn jedoch nicht an der Erfüllung seiner Aufgabe hindern.
Francisco stieß sich von dem Baum ab und eilte stolpernd und schwankend weiter den Pfad hinauf. Sein unsicherer Gang war nicht allein auf die Höhe zurückzuführen. Vor seiner Exekution, die zur Morgendämmerung erfolgen sollte, hatte man ihn einem rituellen Aderlass unterzogen und gezwungen, einen Schluck eines bitteren Elixiers zu trinken – chicha, ein gegorenes Getränk, nach dessen Genuss rasch der Boden unter ihm zu schwanken begonnen hatte. Die plötzliche Anstrengung der Flucht verstärkte die Wirkung der Droge noch.
Während er weiterrannte, kam es ihm vor, als griffen die Äste des Regenwalds nach ihm und versuchten ihn einzufangen, der Pfad kippte erst zur einen, dann zur anderen Seite ab. Das Herz schlug ihm bis zum Hals; das zunehmende Dröhnen in seinen Ohren war inzwischen lauter als die Rufe seiner Verfolger. Francisco stolperte aus dem Dschungel und wäre fast über einen Felsrand gestürzt. Weit unten entdeckte er die Ursache des donnerähnlichen Lärms – weißes, schäumendes Wasser rauschte die schwarzen Felsen hinab.
Ein Teil seines Bewusstseins registrierte, dass dies einer der vielen Nebenflüsse sein musste, die den mächtigen Urubamba speisten, aber er hatte jetzt keinen Sinn für Topographie. Pure Verzweiflung erfüllte ihn und drückte ihm schier das Herz ab. Der Abgrund lag zwischen ihm und seinem Ziel. Heftig keuchend, stützte Francisco die Hände auf die zerkratzten Knie. Erst da fiel ihm die schmale Hängebrücke aus geflochtenem Gras auf, die rechts den Abgrund überspannte.
»Obrigado, meu Deus!«, dankte er dem Herrn unwillkürlich auf Portugiesisch. Er hatte seine Muttersprache nicht mehr gebraucht, seit er in Spanien seine Gelübde abgelegt hatte. Erst jetzt, da ihm Tränen der Enttäuschung und der Furcht über die Wangen liefen, verfiel er wieder in die Sprache seiner Kindheit.
Mühsam richtete er sich auf, ging zu der Brücke hinüber und strich mit den Händen über das geflochtene Ichu-Gras. Ein einzelnes dickes Tau erstreckte sich über den breiten Fluss unten. Zu beiden Seiten gab es ein dünneres Seil zum Festhalten. Wäre er nicht in seinem gegenwärtigen Zustand gewesen, hätte er die Brückenkonstruktion vielleicht als technische Meisterleistung gewürdigt, aber jetzt waren seine Gedanken einzig und allein auf die Flucht gerichtet – immer einen Fuß vor den anderen setzen und sich im Gleichgewicht halten.
Seine ganze Hoffnung lag darin, den Altar auf dem nächsten Gipfel zu erreichen. Die Inka verehrten diesen Berg wie so viele andere Höhen in der Region und beteten ihn an. Doch zunächst musste Francisco den Abgrund überwinden, anschließend den wolkenverhangenen Wald durchqueren und dann den Steilhang hinaufsteigen.
Bliebe ihm dazu genügend Zeit?
Erneut wandte sich Francisco um und horchte, ob seine Verfolger zu hören waren. Er vernahm jedoch lediglich das Rauschen und Dröhnen des Flusses unten. Er hatte keine Ahnung, wie weit seine Jäger noch hinter ihm waren. Jedenfalls wagte er nicht, zu zaudern oder angesichts des Abgrunds den Mut sinken zu lassen.
Er strich sich mit einer schweißnassen Hand über die Stoppeln auf seinem geschorenen Kopf und packte eines der beiden Halteseile der Brücke. Einen Moment lang schloss er fest die Augen und ergriff dann das andere Tau. Mit dem Vaterunser auf den Lippen betrat er die Brücke und machte sich auf den Weg über den Abgrund. Um nicht nach unten zu sehen, heftete er den Blick fest auf die andere Seite.
Nach geradezu endloser Zeit berührte sein linker Fuß Stein. Er trat von der Brücke herab auf festen Felsboden und sackte erleichtert zusammen. Fast hätte er sich auf die Knie fallen lassen, um die Erde zu küssen und zu segnen, aber da ertönte hinter ihm ein schriller Schrei, und ein Speer bohrte sich tief in den Lehm neben seiner Ferse. Der Aufprall war so hart, dass der Schaft summte.
Francisco erstarrte wie ein aufgeschrecktes Kaninchen.
Ein weiterer Ruf ertönte. Er schaute sich um und entdeckte einen einzelnen Jäger auf der anderen Seite. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke über dem Abgrund.
Räuber und Opfer.
Der Mann grinste ihn unter seiner Haube aus azurblauen und roten Federn an. Er trug dicke Goldketten. Zumindest betete Francisco darum, dass es Gold war. Ihn schauderte.
Ohne zu zögern, holte er einen Silberdolch aus seiner Kutte. Die Waffe, die er dem Schamanen gestohlen hatte, hatte ihm zur Flucht verholfen. Jetzt musste sie ihm erneut dienen. Er packte eines der Halteseile. Nie im Leben bliebe ihm genügend Zeit, das Hauptseil der Brücke durchzusägen, aber wenn es ihm gelänge, die dünnen Halteleinen zu zerschneiden, dürfte seinen Verfolgern die Überquerung schwerfallen. Es würde sie vielleicht nicht aufhalten, aber er hätte sich zumindest etwas Luft verschafft.
Seine Schultern protestierten, während er an dem Zopf aus getrocknetem Gras sägte. Die Seile waren hart wie Eisen. Der Mann drüben rief ihm ruhig und gelassen etwas in seiner Muttersprache zu. Der Mönch verstand kein Wort, aber die Drohung, ihm Schmerzen zuzufügen, war deutlich herauszuhören.
Die erneut auflodernde Furcht verstärkte Franciscos Kräfte. Er bohrte und schnitt an dem Seil herum, während ihm heiße Tränen über das schmutzige Gesicht liefen. Plötzlich löste sich das Tau so ruckartig unter seiner Klinge, dass ein Ende seine Wange streifte. Instinktiv hob er eine Hand und berührte die Verletzung. Als er die Finger zurückzog, waren sie blutig, aber er spürte keinen Schmerz.
Er schluckte heftig und wandte sich dem zweiten Seil zu. Da traf ein weiterer Speer den Rand der Klippe, fiel aber hinab in den Abgrund. Ein dritter folgte. Diesmal etwas näher.
Francisco schaute auf. Vier Jäger säumten inzwischen die andere Seite. Der zuletzt eingetroffene hielt einen vierten Speer in der Hand, während der erste Jäger eilig einen Bogen spannte. Francisco blieb keine Zeit mehr. Er betrachtete das unangetastete Seil. Hierzubleiben würde den Tod bedeuten. Er musste darauf hoffen, dass das eine Halteseil weniger die Jäger zumindest eine gewisse Zeit aufhielt.
Er wandte sich um und jagte in den Regenwald auf der anderen Seite des Abgrunds. Der Pfad stieg steil an, was eine äußerste Strapaze für Beine und Lunge bedeutete. Die Bäume hier waren weniger dick, der Blätterbaldachin nicht so dicht. Mit jeder schwer erkämpften Meile wurde der Baumbestand spärlicher. Während er einerseits froh darum war, dass der Regenwald ausdünnte, war ihm andererseits bewusst, dass ihn das fehlende Laubwerk zu einem leichteren Ziel machte. Bei jedem Schritt erwartete er, einen Pfeil im Rücken zu spüren.
So nah am Ziel … O Herr, verlasse mich jetzt nicht!
Bewusst hielt er den Blick auf den Boden gerichtet. Jeder einzelne Schritt war ein Kampf. Plötzlich umgab ihn blendende Helligkeit, als hätte der Herr die Bäume eigenhändig beiseitegeschoben, um Sein Licht auf ihn herabscheinen zu lassen. Keuchend hob Francisco den Kopf. Selbst eine so einfache Bewegung fiel ihm schwer. Noch ein einziger Schritt und der Regenwald lag hinter ihm. Ungehindert strahlte das Licht der aufgehenden Sonne über die roten und schwarzen Felsen des kahlen Berggipfels.
Sogar für ein Dankgebet war er zu schwach. Mühsam kletterte er auf allen vieren durch das letzte Unterholz zum Gipfel hinauf. Es musste dort geschehen. An ihrem heiligen Altar.
Er weinte jetzt, verschloss jedoch die Ohren vor dem eigenen Schluchzen. Auf Händen und Füßen legte er das letzte Stück zu dem Granitbrocken zurück. Nachdem er den steinernen Altar erreicht hatte, setzte er sich auf die Fersen und hob das Gesicht dem Himmel entgegen. Er schrie. Es war kein Gebet, sondern ein Jubelruf darüber, dass er noch lebte. Und alle sollten es hören.
Die Antwort kam prompt. Erneut erschallte das Geschrei der Jäger von der Brücke herauf. Sie hatten den Abgrund überquert und ihre Verfolgung wieder aufgenommen.
Francisco senkte das Gesicht. Ringsumher erstreckten sich die zahllosen Gipfel der Anden bis zum Horizont. Einige waren schneebedeckt, doch die meisten ebenso kahl wie derjenige, auf dem er kniete. Einen Moment lang verstand er beinahe, weshalb die Inka diesen Berghöhen so viel Verehrung entgegenbrachten. Hier, inmitten der Wolken und des Himmels, war man näher bei Gott. Ein Gefühl der Zeitlosigkeit und eines Versprechens der Ewigkeit schien in dem himmlischen Schweigen zu liegen. Sogar die Jäger verstummten – entweder aus Respekt vor dem Berg oder um ihr Opfer unbemerkt zu beschleichen.
Francisco war zu erschöpft, um sich deswegen Sorgen zu machen.
Sein Blick ruhte auf der anderen Art von Gipfel, die es in dieser Bergregion gab. Unter ihm, Richtung Westen, lagen zwei rauchende Berge, Calderas, die in denselben morgendlichen Himmel hinaufstarrten. Von hier aus sahen die im Schatten liegenden Gipfel aus wie zwei verwunschene Augen.
Er spuckte in ihre Richtung und hob eine Faust, den Daumen zwischen zwei Finger gesteckt – ein Zeichen gegen das Böse.
Francisco war bekannt, was in jenen warmen Tälern lag. Von seinem Altar auf den Berghöhen aus taufte er die Zwillingsvulkane: »Ojos del Diablo«, flüsterte er … die Augen des Teufels.
Zitternd kehrte er ihnen den Rücken zu. Er konnte das, was zu tun war, nicht vollbringen, solange er jene Augen anstarrte. Er wandte sein Gesicht nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen.
Er kniete vor der prächtigen Helligkeit nieder, griff in sein Gewand und zog das Kreuz hervor, das ihm um den Hals hing. Er drückte das warme Metall gegen die Stirn. Gold. Das war der Grund, weshalb die Spanier sich mühsam durch diese fremden Dschungel gekämpft hatten – der Traum von Reichtum und Wohlstand. Jetzt würde ihre Habgier sie allesamt in die Verdammnis führen.
Francisco drehte das Kreuz um und küsste die goldene Gestalt auf der Vorderseite. Deswegen war er in dieses Land gekommen. Um den Wilden hier das Wort Gottes zu bringen – und nun war sein Kreuz die einzige Hoffnung der ganzen Welt. Er strich mit einem Finger über die Rückseite und tastete nach den Einkerbungen, die er sorgfältig in das weiche Gold geschnitten hatte.
Möge es uns alle erretten!, betete er schweigend und ließ das Kreuz in sein Gewand zurückgleiten, wo es nahe an seinem Herzen ruhte.
Francisco hob die Augen der Morgendämmerung entgegen. Er musste um jeden Preis verhindern, dass die Inka ihm das Kreuz wegnahmen. Obwohl er einen der heiligen Orte erreicht hatte – diesen natürlichen Altar auf dem Berggipfel –, musste er noch ein Letztes tun, damit das Kreuz auch wirklich in Sicherheit wäre.
Erneut holte er den Silberdolch des Schamanen aus dem Gewand.
Mit einem Reuegebet auf den Lippen bat er um Vergebung für die Sünde, die er nun begehen würde. Ob er damit seine Seele der Verdammnis überantworten würde oder nicht – ihm blieb keine andere Wahl. Mit Tränen in den Augen hob er den Dolch und schnitt sich mit der Klinge die Kehle durch. Er verspürte einen stechenden Schmerz, dann fiel ihm die Waffe aus den Fingern. Er stürzte vornüber auf die Hände. Blut strömte über die dunklen Steine unter ihm.
Im Schein der Morgendämmerung floss es leuchtend rot über den schwarzen Fels. Es war das Letzte, was er vor dem Tod sah – sein Blut, das über den Inkaaltar strömte und dabei glänzte wie Gold.
Erster Tag RUINEN
Montag, 20. August, 11.52 UhrJohns-Hopkins-UniversitätBaltimore, Maryland
PROFESSOR HENRY CONKLINSFinger zitterten leicht, als er die letzte Schicht Decken von seinem tiefgekühlten Schatz entfernte. Er hielt den Atem an. In welchem Zustand befände sich die Mumie nach der dreieinhalbtausend Kilometer langen Reise von den Anden? In Peru hatte er die gefrorenen Überreste sorgfältig in Trockeneis gepackt, aber während der langen Fahrt nach Baltimore hätte alles Mögliche schiefgehen können.
Henry fuhr sich mit der Hand durch die dunklen Haare, die mittlerweile reichlich mit Grau durchsetzt waren. Immerhin hatte er vergangenes Jahr die sechzig überschritten. Er hoffte inständig, dass sich seine letzten drei Jahrzehnte der Forschung und der Arbeit im Gelände jetzt bezahlt machten. Eine zweite Chance würde es nicht mehr geben. Der Transport der Mumie von Südamerika hierher hatte ihn fast die gesamten Forschungsgelder gekostet. Und heutzutage gingen neue Stipendien und Forschungsgelder ausschließlich an jüngere Wissenschaftler. Bei Texas A&M wurde er allmählich zum Dinosaurier. Natürlich, man verehrte ihn noch, nahm ihn aber trotz aller Hätschelei nicht mehr recht ernst.
Doch seine kürzliche Entdeckung der Ruinen einer kleinen Inkastadt hoch in den Anden könnte alles ändern – insbesondere wenn sie seine umstrittene Theorie bewies.
Vorsichtig zog er das letzte Leinentuch weg. Der Nebel aus dem schmelzenden Trockeneis nahm ihm vorübergehend die Sicht. Er wedelte den Dunst beiseite, und da tauchte die Gestalt auf: Die Knie waren an die Brust gezogen und die Arme um die Beine geschlungen, fast wie bei einem Fötus. Genau in dieser Haltung hatten sie die Mumie in einer kleinen Höhle nahe am schneebedeckten Mount Arapa entdeckt.
Henry starrte seinen Fund an. Uralte, leere Augenhöhlen erwiderten seinen Blick. Strähnen glatten schwarzen Haars lagen noch immer um den Schädel. Die ausgetrockneten Lippen waren zurückgezogen und enthüllten gelb gewordene Zähne. Nach wie vor hafteten ausgefranste Überreste eines Leichentuchs an der zu Leder gewordenen Haut. Das Tuch war so gut erhalten, dass sogar die schwarze Farbe auf dem zerrissenen Stoff hell unter der Chirurgenlampe des Forschungslabors aufleuchtete.
»O mein Gott!«, rief jemand neben ihm aus. »Das ist unglaublich!«
Henry fuhr ein wenig zusammen. Versunken, wie er war, hatte er die anderen im Raum völlig vergessen. Er wandte sich um und wurde vom Blitzlicht einer Kamera geblendet. Ohne die Nikon vom Auge zu nehmen, trat die Reporterin vom Baltimore Herald zurück und postierte sich für einen weiteren Schnappschuss. Ihr blondes Haar war zu einem strengen Pferdeschwanz zurückgekämmt. Während sie weitere Fotos machte, fragte sie: »Wie alt würden Sie sie schätzen, Professor?«
Henry blinzelte, um die Funken vor den Augen zu vertreiben, und wich einen Schritt zurück, sodass die anderen einen Blick auf die Überreste werfen konnten. Zwei Wissenschaftler traten mit Untersuchungsinstrumenten heran.
»Ich … ich würde die Mumifizierung ins sechzehnte Jahrhundert datieren – vor etwa fünfhundert Jahren.«
Die Reporterin nahm ihre Kamera herab, ließ die zusammengekrümmte Gestalt auf dem CT-Tisch jedoch nicht aus den Augen. Etwas angewidert kräuselte sie die Oberlippe. »Nein, ich habe gemeint, wie alt war die Mumie bei ihrem Tod?«
»Oh …« Er schob sich die Drahtgestellbrille höher auf die Nase. »Etwa zwanzig … Genauer lässt sich das nach einer oberflächlichen Untersuchung nicht sagen.«
Eine zierliche Frau Ende vierzig mit dunklen Haaren, die ihr in seidigen Strähnen bis weit über den Rücken fielen, drehte sich zu ihnen um. Sie gehörte zum zweiköpfigen Ärzteteam. Sie hielt einen Zungenspatel in der Hand und hatte den Kopf der Mumie untersucht. »Er war bei seinem Tod zweiunddreißig«, stellte sie nüchtern fest. Dr. Joan Engel war Leiterin der forensischen Pathologie an der Johns Hopkins Universität sowie eine alte Freundin von Henry. Ihre Stellung hier war einer der Gründe, weshalb er die Mumie an die Johns Hopkins gebracht hatte. Sie führte ihre Feststellung weiter aus. »Seine Weisheitszähne, also die dritten Backenzähne, sind teilweise impaktiert, aber dem Grad der Abnutzung der zweiten Backenzähne und der fehlenden Abnutzung bei den dritten zufolge müsste meine Schätzung mit einer maximalen Abweichung von drei Jahren zutreffen. Die CT-Untersuchung sollte das Alter noch präziser bestimmen können.«
Während sie sprach, leuchteten ihre Jadeaugen im Kontrast zu ihrem ruhigen Auftreten hell auf. In den Augenwinkeln waren leichte Krähenfüße zu erkennen. Auf ihrem Gesicht zeigte sich keinerlei Ekel, als sie die Mumie untersuchte, nicht einmal, als sie die ausgedörrten Überreste mit den behandschuhten Fingern hin und her schob. Henry spürte, dass sie ebenso aufgeregt war wie er selbst. Gut zu wissen, dass Joans Begeisterung für wissenschaftliche Rätsel seit ihrem Studium nicht nachgelassen hatte. Sie machte sich wieder an die Untersuchung, nicht ohne Henry zuvor einen entschuldigenden Blick zugeworfen zu haben, weil sie seiner Einschätzung des Alters der Mumie widersprochen hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!