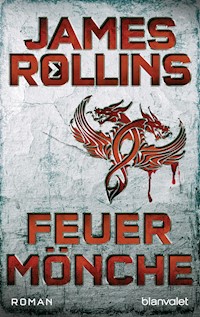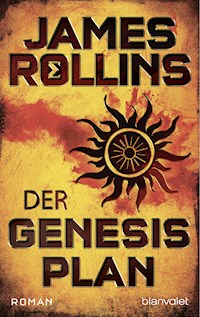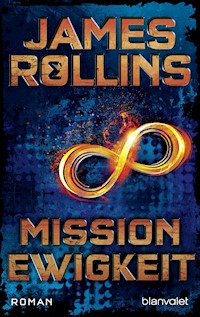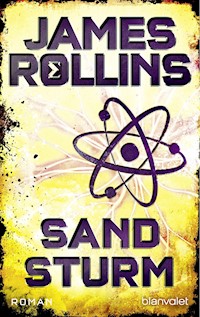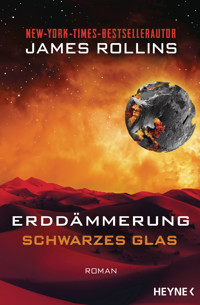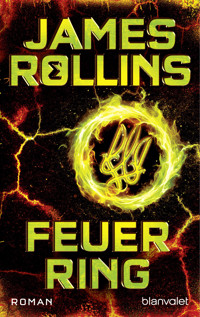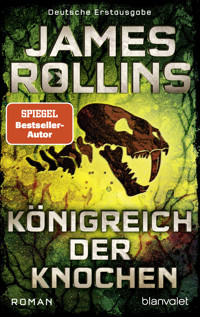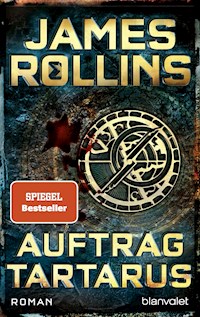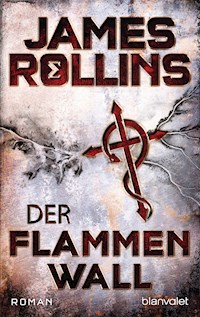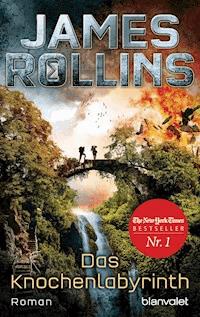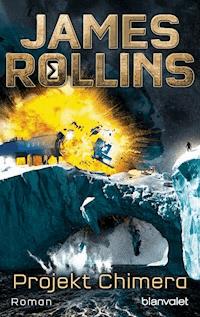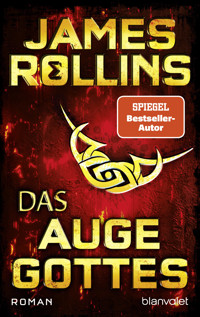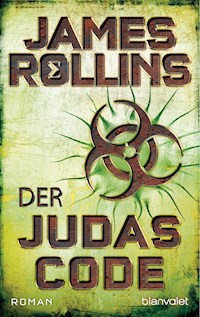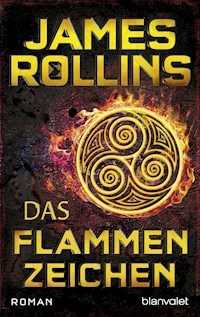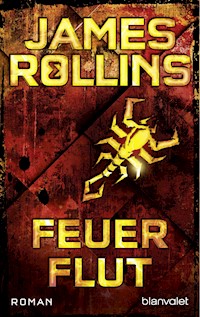
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
Ein hochspannender Cocktail aus Abenteuer, Wissenschaft und Action
In einer Höhle in den Rocky Mountains werden mumifizierte Leichen und seltsame goldene Platten entdeckt, die mit unverständlichen Zeichen graviert sind. Bevor die Funde geborgen werden können, erschüttert eine gewaltige Explosion die Grabungsstätte – und eine junge Indianerin verschwindet mit einem wichtigen Beweisstück. Die Söldner der Geheimorganisation Gilde heften sich an ihre Fersen, und es gibt nur einen Menschen, der ihr noch helfen kann: ihr Onkel Painter Crowe, Direktor der SIGMA Force.
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
In einer Höhle in den Rocky Mountains werden mumifizierte Leichen und seltsame goldene Platten entdeckt, die mit unverständlichen Zeichen graviert sind. Bevor die Funde geborgen werden können, erschüttert eine gewaltige Explosion die Grabungsstätte – und eine junge Indianerin verschwindet mit einem wichtigen Beweisstück. Die Söldner der Geheimorganisation Gilde heften sich an ihre Fersen, und es gibt nur einen Menschen, der ihr noch helfen kann: ihr Onkel Painter Crowe, Direktor der SIGMA Force.
Welches Interesse hat die Gilde an den alten indianischen Artefakten? Die Männer der Sigma Force kommen einer dunklen, jahrhundertealten Verschwörung auf die Spur, und bald wird klar: Die Ereignisse in den Rocky Mountains haben eine furchterregende Kettenreaktion in Gang gesetzt, die den Westen der USA zu zerstören droht.
Autor
Der New York Times Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Außerdem von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Der Genesis-Plan (38261), Feuermönche (36738), Sandsturm (36266), Der Judas-Code (37216), Das Messias-Gen (37217) Das Flammenzeichen (37473), Feuerflut (37472)
Außerdem:
Sub Terra (37824), Im Dreieck des Drachen (37822), Operation Amazonas (37821), Das Blut des Teufels (37823) Das Evangelium des Blutes (37670)Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (37092)
James Rollins
Feuerflut
Roman
Deutsch von Norbert Stöbe
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »The Devil Colony« bei William Morrow, New York.
1. Auflage
März 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright der Originalausgabe © 2011 by Jim Czajkowski
Published in agreement with the author, c/o Baror Interantional, Inc. Armonk, New York, U.S.A.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Blanvalet Verlag, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlaggestaltung und -illustration © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Gerhard Seidl
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-14424-1
www.blanvalet.de
Für meinen Dad,denn es wird Zeit – und du bliebst zu oft unbesungen.
»Wissenschaft ist meine Leidenschaft, meine Politik,meine Pflicht.«
Thomas Jefferson, in einem Brief an Harry Innes, 1791
VORBEMERKUNG ZUM HISTORISCHEN HINTERGRUND
JEDES SCHULKIND KENNT Thomas Jefferson, den Architekten und Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, den Mann, der maßgeblich dazu beigetragen hat, aus einem Haufen Kolonien in der Neuen Welt eine Nation zu formen. In den vergangenen zwei Jahrhunderten wurden zahlreiche Bücher über diesen Gründervater Amerikas geschrieben, doch bis heute ist sein Bild voller Geheimnisse und Widersprüche.
Beispielsweise wurde ein in Geheimschrift verfasster Brief aus seinem Nachlass erst 2007 entschlüsselt. Jefferson erhielt ihn 1801, der Absender war die Amerikanische Philosophische Gesellschaft – ein Thinktank der Kolonialzeit, der sich der Förderung der Wissenschaft und gelehrten Debatten verschrieben hatte. Diese Gruppe interessierte sich speziell für zwei Themen: die Entwicklung einer nicht zu knackenden Verschlüsselung und die Erforschung der Geheimnisse der Indianerstämme, die in der Neuen Welt heimisch waren.
Jeffersons Interesse an Kultur und Geschichte der amerikanischen Ureinwohner grenzte an Besessenheit. In seiner Heimatstadt Monticello legte er eine Sammlung von Stammesartefakten an, die es mit dem Bestand mancher Museen aufnehmen konnte – nach seinem Tod verschwand diese Sammlung auf ungeklärte Weise. Viele dieser Artefakte hatten Lewis und Clark bei ihrer berühmten Expedition quer durch Amerika zusammengetragen. Nur wenigen ist jedoch bekannt, dass Jefferson im Jahr 1803 einen geheimen Brief an den Kongress schrieb. Darin enthüllte er die wahre Absicht dieser Reise durch den Westen.
In diesem Buch werden Sie mehr über diese Absicht erfahren. Denn es gibt eine geheime Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, die kaum bekannt ist. Dabei geht es nicht um die Freimaurer, die Tempelritter oder um abstruse Verschwörungstheorien. Ein Beleg dafür hängt in der Rotunde des Kapitols. In dieser ehrwürdigen Halle findet sich das berühmte Gemälde von John Trumbull mit dem Titel Die Unabhängigkeitserklärung – an dessen Entstehung Jefferson beratend beteiligt war. Darauf sind alle Männer abgebildet, die jenes berühmte Dokument unterzeichnet haben – nur wenigen ist jedoch bekannt, dass Trumbull fünf weitere Personen abgebildet hat, welche die Unabhängigkeitserklärung nicht unterzeichnet haben. Warum? Und wer waren diese Männer?
Wenn Sie an einer Antwort auf diese Frage interessiert sind, lesen Sie weiter.
VORBEMERKUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN HINTERGRUND
ZUM BEGINN DIESES neuen Jahrtausends lässt sich der nächste große Entwicklungsschritt in der wissenschaftlichen Forschung und der Industrie in einem Wort zusammenfassen: Nanotechnologie. Kurz gesagt geht es darum, auf atomarer Ebene zu fertigen, in einem Maßstab von einem milliardstel Meter. Um sich etwas so Kleines vorzustellen, betrachten Sie einmal den Punkt am Ende dieses Satzes. Wissenschaftlern von Nanotech.org ist es gelungen, Teströhrchen zu konstruieren, die so klein sind, dass dreihundert Milliarden davon in diesen Punkt hineinpassen würden.
Die Nanotechnologie-Industrie wächst sprunghaft, ihre Produkte sind nicht mehr wegzudenken. Sie finden sich in Zahnpasta, Sonnencreme, Tortenglasur, Beißringen, Sportsocken, Kosmetika, Medikamenten, sogar in Bobschlitten … Fast zehntausend Produkte enthalten bereits Nanopartikel, und der Markt wächst ständig.
Wie sieht die Kehrseite einer solchen Wachstumsindustrie aus? Nanopartikel können krank machen und sogar zum Tode führen. Wissenschaftler der Universität von Los Angeles haben herausgefunden, dass nanotechnisches Titanoxid – enthalten in Sonnenschutzmitteln für Kinder und vielen anderen Produkten – im Tierversuch genetische Schäden hervorrufen kann. Kohlenstoff-Nanoröhrchen – enthalten in Tausenden von Produkten des alltäglichen Lebens, unter anderem in Sicherheitshelmen für Kinder – reichern sich erwiesenermaßen in der Lunge und im Gehirn von Ratten an. Außerdem kommt es auf dieser mikroskopischen Ebene zu merkwürdigen und unerwarteten Reaktionen. Zum Beispiel bei Alufolie. An und für sich ist sie harmlos und eignet sich dazu, Speisereste zu verpacken. Zerlegt man sie jedoch in Nanopartikel, ist sie auf einmal hoch explosiv.
Das Ganze ist ein neues, aufregendes Grenzgebiet. Gegenwärtig ist die Kennzeichnung von Nanoprodukten nicht vorgeschrieben, für Produkte mit Nanopartikeln müssen keine Sicherheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Doch diese Industrie hat eine noch dunklere Seite. Die Geschichte der Nanotechnologie reicht weiter zurück als bis ins zwanzigste Jahrhundert – viel weiter. Wenn Sie mehr erfahren möchten über den Ursprung und die geheimen Wurzeln dieser Wissenschaft …
… lesen Sie weiter.
Herbst 1779Kentucky
NACH UND NACH kam der Schädel des Ungeheuers zum Vorschein.
Ein gelblicher Stoßzahn ragte aus dem dunklen Erdreich.
Zwei schmutzige Männer knieten neben dem ausgehobenen Erdloch. Der eine war Billy Prestons Vater, der andere sein Onkel. Billy stand bei ihnen und knabberte unruhig an den Fingern. Er war zwölf und hatte darum gebeten, an der Reise teilnehmen zu dürfen. Bisher hatten sie ihn jedes Mal in Philadelphia bei seiner Mutter und seiner kleinen Schwester Nell zurückgelassen.
Dass er mitkommen durfte, erfüllte ihn mit Stolz.
Im Moment war ihm allerdings auch ein wenig bang zumute.
Vielleicht kam es daher, dass die Sonne unterging und ein Schattennetz aufs Lager warf. Oder es lag an den Knochen, nach denen sie seit einer Woche gruben.
Es waren noch andere Personen in der Nähe: schwarzhäutige Sklaven, die Dreck und Steine schleppten, sowie die sauber gekleideten Gelehrten mit ihren tintenfleckigen Fingern. Und dann war da noch der geheimnisvolle französische Wissenschaftler Archard Fortescue, der Leiter dieser Expedition in die Wildnis von Kentucky.
Der große, knochige Franzose mit seinen in tiefen Höhlen liegenden Augen machte Billy Angst, denn er erinnerte ihn wegen seiner dunklen Weste und der schwarzen Anzugjacke an einen Leichenbestatter. Er hatte Bemerkungen über den hageren Mann aufgeschnappt; Fortescue hatte Tote seziert, Experimente mit ihnen durchgeführt und in fernen Gegenden geheimnisvolle Artefakte gesammelt. Es hieß, er sei sogar an der Mumifizierung eines verstorbenen Gelehrten beteiligt gewesen, der seinen Leichnam der Wissenschaft vermacht und für diesen makabren Zweck seine unsterbliche Seele in Gefahr gebracht habe.
Allerdings hatte der französische Wissenschaftler Empfehlungsschreiben vorzuweisen. Benjamin Franklin hatte ihn persönlich für eine neue wissenschaftliche Vereinigung ausgewählt, die Amerikanische Gesellschaft zur Förderung nützlichen Wissens. Offenbar hatte er auf Franklin in der Vergangenheit Eindruck gemacht, wenngleich niemand etwas Genaues wusste. Außerdem war er mit dem neuen Gouverneur von Virginia bekannt, der sie alle an diesen seltsamen Ort geschickt hatte.
Und deshalb waren sie jetzt hier – und zwar schon seit geraumer Zeit.
In den vergangenen Wochen hatte Billy beobachtet, wie sich das Laub erst gelblich und dann feuerrot färbte. Neuerdings herrschte frühmorgens Frost. Nachts wehte der Wind die Blätter von den Bäumen, zurück blieben skelettartige Äste, die am Himmel zu kratzen schienen. Billy hatte die Aufgabe, die Grabungsstätte mit Besen und Rechen von Laub frei zu halten. Es war ein ständiger Kampf, als wollte der Wald das, was offen zutage lag, wieder zudecken.
Auch jetzt wieder hielt Billy einen mit Laub verfilzten Besen in Händen und schaute zu, wie sein Vater – die Kniehose verdreckt, die Ärmel bis zu den Ellbogen aufgekrempelt – die letzten Erdreste vom vergrabenen Schatz entfernte.
»Jetzt ganz vorsichtig …«, sagte Fortescue mit starkem Akzent. Er streifte die Rockschöße zurück, beugte sich vor, die eine Hand in die Hüfte gestemmt, die andere um den mit Schnitzereien verzierten Gehstock gelegt.
Billy ärgerte sich über die versteckte Herablassung des Franzosen. Sein Vater kannte sich im Wald besser aus als jeder andere, von den Flutgebieten Virginias bis zur Wildnis von Kentucky. Schon vor dem Krieg war er in dieser abgelegenen Gegend als Trapper unterwegs gewesen und hatte Handel mit den Indianern getrieben. Einmal war er sogar Daniel Boone begegnet.
Jetzt aber zitterten seinem Vater die Hände, als er mit Bürste und Spatel den Schatz aus dem lehmigen Waldboden löste.
»Das ist es«, sagte sein Onkel aufgeregt. »Wir haben ihn gefunden.«
Fortescue beugte sich über die knienden Männer. »Naturellement. Natürlich war er hier vergraben. Am Kopf der Schlange.«
Billy hatte nicht gewusst, wonach sie suchten – nur sein Vater und sein Onkel hatten die versiegelten Briefe gelesen, die der Gouverneur dem Franzosen geschrieben hatte –, doch er wusste, was der Franzose mit der »Schlange« meinte.
Billy musterte den Grabungsort. Sie hatten einen Erdhügel freigelegt, der in Windungen durch den Wald verlief. Er war zwei Meter hoch, doppelt so breit und zog sich sechshundert Meter weit über einen niedrigen Hügel. Er ähnelte einer verendeten Riesenschlange, die unter Erdreich begraben war.
Billy hatte schon von solchen Erdhügeln gehört. In der Wildnis Amerikas gab es viele solche Erdwälle und auch noch andere von Menschenhand angelegte Erhebungen. Sein Vater meinte, dies seien Hügelgräber, die von den Vorfahren der einheimischen Wilden errichtet worden seien. Die Indianer selbst konnten sich daran nicht mehr erinnern, sie kannten nur Mythen und Legenden. Geschichten, die von einer untergegangenen Zivilisation handelten, von alten Königreichen, Gespenstern und Bannflüchen – und natürlich auch von vergrabenen Schätzen.
Billy rückte näher, als sein Vater den Fund freilegte, der in dickes Fell eingewickelt war. Die schwarzen, struppigen Haare waren noch gut erhalten. Ein moschusartiger Geruch – eine Mischung aus Erd- und Tiergeruch – ging davon aus und überlagerte die Fleischdüfte der nahen Kochfeuer.
»Büffelfell«, sagte sein Vater und blickte Fortescue an.
Der Franzose bedeutete ihm mit einem Nicken, er solle fortfahren.
Mit beiden Händen teilte sein Vater behutsam das Fell und enthüllte, was seit einer kleinen Ewigkeit im Erdreich verborgen gewesen war.
Billy hielt den Atem an.
Seit Gründung des Landes hatte man schon viele indianische Hügelgräber geöffnet und geplündert. Gefunden hatte man darin die Gebeine Verstorbener sowie ein paar Pfeilspitzen, Lederschilde und Tonscherben.
Was war an diesem Fundort so besonders?
Nachdem sie zwei Monate lang akribisch erkundet, kartografiert und gegraben hatten, wusste Billy noch immer nicht, weshalb sie ausgerechnet hierher gekommen waren. Wie alle anderen Grabräuber hatten sein Vater und dessen Begleiter als Lohn für all die Mühe bislang nicht mehr vorzuweisen als verschiedene indianische Grabbeigaben und Artefakte: Bogen, Köcher, Lanzen, einen großen Kochtopf, ein paar perlenbestickte Mokassins, einen prachtvollen Kopfschmuck. Und natürlich hatten sie Gebeine gefunden, zu Tausenden. Schädel, Rippen, Schenkel- und Beckenknochen. Fortescue schätzte, dass hier mindestens einhundert Männer, Frauen und Kinder bestattet worden waren.
Es war mühevoll gewesen, all die Gegenstände zu sammeln und zu katalogisieren. Sie hatten bis zum Winteranfang gebraucht, um sich von dem einen Ende des Hügelgrabs bis zum anderen vorzuarbeiten, den Hügel Schicht für Schicht abzutragen und das Erdreich und die Steine zu sieben. Jetzt aber hatten sie, wie der Franzose sich ausgedrückt hatte, den Kopf der Schlange erreicht.
Billys Vater schlug die Büffelhaut auseinander. Ausrufe des Erstaunens waren zu vernehmen. Selbst Fortescue sog mit zusammengekniffener Nase die Luft ein.
Auf der Innenseite des Fellstücks war eine wilde Schlacht abgebildet. Indianer jagten zu Pferd über das Leder, viele davon mit Schilden ausgerüstet. Die Speerspitzen waren rot bemalt. Pfeile flogen durch die Luft. Billy meinte, die trillernden Kriegsschreie der Wilden zu hören.
Fortescue kniete nieder, hielt die Hand über das Bild. »Ähnliche Arbeiten habe ich schon gesehen. Die Eingeborenen gerben das Büffelfell mit einem Brei aus dem Gehirn der Tiere, dann tragen sie mit einem ausgehöhlten Knochenstück die Farbe auf. Aber, mon Dieu, ein solches Meisterwerk habe ich noch nie zu Gesicht bekommen. Sehen Sie nur, die Pferde unterscheiden sich alle, und bei der Kleidung der Krieger sind selbst kleinste Details dargestellt.«
Die Hand des Franzosen wanderte ein Stück zur Seite und kam über dem Gegenstand zur Ruhe, der in das Fell eingewickelt gewesen war. »Und so etwas sehe ich auch zum ersten Mal.«
Zum Vorschein gekommen war der Schädel eines Ungeheuers. Zuvor hatten sie die Fangzähne gereinigt, die aus dem Paket hervorgeschaut hatten. Der Schädel, den sie jetzt vor sich sahen, war so groß wie eine Kirchenglocke. Und wie das Büffelfell war auch der Schädel reich verziert und zum Malgrund eines prähistorischen Künstlers geworden.
Figuren und Formen waren in den Schädelknochen eingeschnitzt, die Farben so leuchtend, dass sie noch ganz frisch wirkten.
Billys Vater sagte voller Ehrfurcht: »Das ist ein Mammutschädel, hab ich recht? So wie die, die wir in Big Salt Lick gefunden haben.«
»Nein. Das ist kein Mammut«, entgegnete Fortescue und zeigte mit dem Stock darauf. »Betrachten Sie nur den Schwung und die Länge der Stoßzähne, die gewaltigen Backenzähne. Die Schädelform unterscheidet sich von der der Mammuts der Alten Welt. Diese Knochen stammen von einem Tier, das nur in Amerika vorkam und das als neue Spezies klassifiziert wurde, Mastodon genannt.«
»Es ist mir egal, wie man das nennt«, sagte Billys Vater energisch. »Aber das ist doch der richtige Schädel, oder? Mehr will ich gar nicht wissen.«
»Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.« Fortescue fuhr mit dem Zeigefinger über die Mitte des Schädelknochens und schob die Fingerspitze in ein Loch am hinteren Ende. Billy hatte schon genug Rehe und Kaninchen ausgeweidet, um zu wissen, dass die Ränder des Lochs zu gleichmäßig waren, als dass es natürlichen Ursprungs hätte sein können. Der Franzose krümmte den Zeigefinger und zog.
Ausrufe des Erstaunens waren zu hören. Mehrere Sklaven wichen entsetzt zurück. Billy machte große Augen, als der Schädel des Ungeheuers sich in der Mitte teilte und aufklappte wie eine Schranktür. Mithilfe seines Vaters schob Fortescue die beiden Schädelteile behutsam zurück – sie waren fünf Zentimeter dick und so groß wie Essteller.
Obwohl der Sonnenschein hier gedämpft war, funkelte es im Innern des Schädels hell.
»Gold!«, sagte sein Onkel bestürzt.
Die Innenseite des Schädels war mit dem kostbaren Metall überzogen. Der Goldüberzug wies Höcker und Vertiefungen auf. Das Ganze hatte Ähnlichkeit mit einer Landkarte, mit stilisierten Bäumen, plastisch geformten Bergen und sich windenden Flüssen. Außerdem waren in das Gold Striche eingeritzt, bei denen es sich um Schriftzeichen handeln mochte.
Fortescue neigte sich vor und murmelte ein einziges Wort, voller Ehrfurcht und mit einem Anflug von Furcht: »Hebräisch.«
Als er den anfänglichen Schreck überwunden hatte, sagte Billys Vater: »Aber der Schädel ist leer.«
Fortescue musterte die vergoldete Schädelhöhle. Ein Neugeborenes hätte darin Platz gehabt, doch wie Billys Vater richtig bemerkt hatte, war sie leer.
Fortescues Miene war undurchdringlich, Billy ahnte jedoch, dass er unergründliche Überlegungen anstellte.
Was hatte er zu finden gehofft?
Fortescue richtete sich auf. »Verschließen Sie den Schädel. Wickeln Sie ihn wieder ins Fell. Wir müssen ihn unverzüglich nach Virginia schaffen.«
Niemand erhob Einwände. Hätte sich die Nachricht von dem Goldfund verbreitet, hätten sie mit Plünderungen rechnen müssen. Während die Sonne unterging und Fackeln entzündet wurden, beeilten sich die Männer, den großen Schädel vollständig auszugraben. Ein Wagen wurde herangeschoben, die Pferde angeschirrt. Billys Vater, sein Onkel und der Franzose steckten derweil die Köpfe zusammen.
Billy tat so, als fege er weiter Laub, wobei er ihnen so nahe kam, dass er ihre Unterhaltung belauschen konnte. Sie unterhielten sich im Flüsterton, sodass er nur einzelne Gesprächsfetzen mitbekam.
»Es könnte reichen …«, sagte Fortescue, »… für den Anfang. Wenn der Gegner ihn vorher findet, ist eure junge Union zum Untergang verurteilt.«
Sein Vater schüttelte den Kopf. »Dann wäre es vielleicht am besten, wir zerstören ihn. Werfen ihn ins Feuer. Soll er zu Asche verbrennen und das Gold zu Schlacke werden.«
»Dazu könnte es kommen, aber diese Entscheidung überlassen wir lieber dem Gouverneur.«
Sein Vater schien dazu aufgelegt, dem Franzosen zu widersprechen, da bemerkte er Billy. Er drehte sich um, machte Anstalten, ihn wegzuscheuchen, und öffnete den Mund.
Er kam jedoch nicht mehr dazu, etwas zu sagen.
Auf einmal spritzte Blut aus seiner Gurgel. Er ging in die Knie, fasste sich an den Hals. Ein Pfeil steckte darin. Blut strömte über seine Finger, auf seinen Lippen bildete sich roter Schaum.
Billy lief zu seinem Vater, wurde in einem grauenvollen Moment vom angehenden jungen Mann wieder zum Kind. »Papa!«
Ihm versagte das Gehör. Die Welt schrumpfte auf seinen Vater, der seinen Blick voller Bedauern und Schmerz erwiderte. Dann zuckte er am ganzen Leib, wieder und wieder, und kippte nach vorn. Federn ragten aus seinem Rücken. Billy sah, dass sein Onkel kniete, der Kopf hing ihm schlaff herab. Ein Speer hatte von hinten seine Brust durchbohrt, die Spitze hatte sich ins Erdreich gegraben, der Schaft stützte den Toten.
Ehe Billy begriff, was er da sah und was vor sich ging, bekam er einen Schlag gegen die Seite – nicht von einem Pfeil oder Speer, sondern von einem Arm. Er wurde umgeworfen und wälzte sich über den Boden. Plötzlich nahm er wieder die Umgebung wahr.
Lautes Geschrei erfüllte seine Ohren. Pferde wieherten. Schatten tanzten durch den Fackelschein, während Männer miteinander kämpften und rangen. Pfeile zischten durch die Luft, begleitet von wildem Gejohle.
Ein Indianerüberfall.
Billy wollte sich aufrappeln, doch er war unter dem Franzosen eingeklemmt. »Bleib liegen, Junge!«, flüsterte Fortescue ihm ins Ohr.
Der Franzose wälzte sich von ihm hinunter und sprang auf, als ein halb nackter Wilder mit roter Kriegsbemalung sich mit gerecktem Tomahawk auf ihn warf. Fortescue verteidigte sich mit der einzigen Waffe, die ihm zur Verfügung stand, so untauglich sie auch sein mochte – seinem Spazierstock.
Als er den Stock herumschwenkte und auf den Angreifer richtete, teilte der sich nahe dem Griff. Eine Holzscheide kam an der Spitze zum Vorschein, darin steckte ein Schwert. Die Scheide traf den Wilden an der Stirn und ließ ihn zurücktaumeln. Fortescue warf sich auf ihn und rammte ihm die Klinge in die Brust.
Der Indianer brüllte auf. Fortescue nutzte den Schwung des Mannes und warf den Wilden neben Billy zu Boden.
Er riss das Schwert aus der Wunde. »Her zu mir, Junge!«
Billy gehorchte benommen. Sein Kopf war wie leer. Er rappelte sich hoch, da packte ihn jemand beim Arm. Der blutüberströmte Wilde versuchte, ihn festzuhalten. Billy riss sich los.
Der Indianer fiel zurück. Auf Billys Ärmel war ein verschmierter Handabdruck zurückgeblieben. Das war kein Blut, wurde Billy bewusst.
Es war Farbe.
Er schaute den sterbenden Wilden an. Die Hand, die ihn gepackt hatte, war lilienweiß, nur in den Falten der Handfläche haftete noch etwas Farbe.
Jemand packte ihn beim Kragen und zog ihn auf die Beine.
Billy blickte zu Fortescue auf, der ihn festhielt. »Das … das sind keine Indianer«, sagte er völlig verwirrt und unterdrückte ein Schluchzen.
»Ich weiß«, sagte Fortescue. Mehr als nur ein wenig Furcht schwang in seiner Stimme mit.
Ringsumher herrschte Chaos. Die letzten beiden Fackeln erloschen. Schreie, Gebete und lautes Flehen um Gnade.
Fortescue zerrte Billy durch das Lager. Auf dem Weg hob er das Büffelfell auf und drückte es Billy in die Hand. Sie stießen auf ein einzelnes Pferd, im Wald an einem Baum festgebunden und gesattelt, als habe jemand den Angriff vorausgeahnt. Das Pferd stampfte und warf unruhig den Kopf, von dem Geschrei und dem Blutgeruch in Panik versetzt.
Der Franzose zeigte auf das Tier. »Rauf mit dir. Halt dich bereit zur Flucht.«
Während Billy den Stiefel in den Steigbügel setzte, verschwand der Franzose im Wald. Billy schwang sich in den Sattel. Sein Gewicht schien das Pferd zu beruhigen. Er schlang die Arme um den schweißnassen Hals des Tieres, doch das Herz klopfte ihm noch immer bis zum Hals. Er wollte sich die Ohren zuhalten, damit er das Geschrei nicht mehr hörte, doch er musste horchen, ob sich nicht die Wilden an ihn anschlichen.
Nein, das waren keine Wilden, rief er sich in Erinnerung.
Hinter ihm knackte ein Zweig. Als er den Kopf wandte, humpelte eine Gestalt näher. Am Umhang und dem Funkeln des Schwertes erkannte er den Franzosen. Billy wäre am liebsten vom Pferd gesprungen und hätte sich an ihn geklammert, ihn gezwungen, ihm das Blutvergießen und die Täuschung zu erklären.
Fortescue stolperte heran. In seinem Oberschenkel, oberhalb des Knies, steckte der abgebrochene Schaft eines Pfeils. Als er neben dem Pferd stand, reichte er Billy zwei große Gegenstände an.
»Nimm das. Wickel das in das Fell.«
Billy nahm die Gegenstände entgegen. Es waren die geteilten Schädelplatten des Ungeheuers, knochenweiß auf der einen Seite, vergoldet auf der anderen. Fortescue hatte sie anscheinend vom Schädel abgenommen.
Aber warum?
Eilig schlug er die beiden vergoldeten Schädelplatten in das Büffelfell ein.
»Reite los«, sagte Fortescue.
Billy nahm die Zügel in die Hand, zögerte aber. »Was ist mit Ihnen, Sir?«
Fortescue legte Billy die Hand aufs Knie und sagte mit großem Nachdruck: »Das Pferd hat mit dir und der Last genug zu tragen. Du musst so schnell reiten, wie du kannst. Bring das in Sicherheit.«
»Aber wohin?«, fragte Billy.
»Zum Gouverneur von Virginia.« Der Franzose trat einen Schritt zurück. »Bring das Thomas Jefferson.«
EINS BETRETEN VERBOTEN
1
Gegenwart18. Mai, 13:32Rocky Mountains, Utah
ES SAH AUS wie das Tor zur Hölle.
Die beiden jungen Männer standen am Rande eines tiefen, finsteren Abgrunds. Sie hatten acht Stunden gebraucht, um vom Städtchen Roosevelt zu diesem Ort in den Rocky Mountains hochzuklettern.
»Bist du sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte Trent Wilder.
Charlie Reed nahm sein Handy aus der Tasche, las die GPS-Anzeige ab und zog die indianische rehlederne Landkarte zurate, die er in einem durchsichtigen Beutel verwahrte. »Ich glaub schon. Am Grund der Schlucht ist ein kleiner Fluss eingezeichnet. Der Höhleneingang befindet sich dort, wo der Flusslauf nach Norden schwenkt.«
Trent fröstelte und strich sich Schnee vom Haar. Im Tiefland kündete ein Blumenteppich vom nahen Frühling, doch hier oben herrschte noch Winter. Es war eiskalt, die umliegenden Gipfel waren schneebedeckt. Zu allem Überdruss hatte sich der Himmel im Laufe des Tages immer mehr zugezogen, und es schneite leicht.
Trent musterte die schmale Schlucht. Sie wirkte bodenlos. Die Wipfel von Schwarzkiefern ragten aus dem Nebel hervor. An beiden Seiten schroffe Felswände. Er hatte zwar Seile und Abseilgeschirr eingepackt, hoffte aber, auf deren Einsatz verzichten zu können.
Was ihm Sorge bereitete, war jedoch etwas anderes.
»Vielleicht sollten wir lieber nicht da runtergehen«, meinte er.
Charlie hob eine Braue. »Nach der ganzen Kletterei?«
»Was ist mit dem Fluch? Dein Großvater …«
Charlie winkte geringschätzig ab. »Der alte Herr steht mit einem Fuß im Grab und hat den Kopf voller Peyote.« Charlie klopfte ihm auf die Schulter. »Also mach dir nicht gleich in die Hose. In der Höhle gibt es vermutlich ein paar Pfeilspitzen und Tonscherben. Vielleicht auch ein paar Knochen, wenn wir Glück haben. Los, komm.«
Trent blieb nichts anderes übrig, als hinter Charlie her den schmalen Wildpfad entlangzutrotten, den sie vor einer Weile entdeckt hatten. Im Gehen musterte er finster die beiden Federn auf Charlies dunkelroter Jacke, das Zeichen der Universität Utah. Er selbst trug noch immer die Letterman-Jacke, die man ihm auf der Highschool für besondere schulische Leistungen verliehen hatte und auf der ein Puma abgebildet war: das Logo der Roosevelt-Verbindung. Sie waren seit der Grundschule miteinander befreundet, hatten sich in letzter Zeit aber einander immer mehr entfremdet. Charlie hatte soeben das erste Collegejahr abgeschlossen, während Trent Vollzeit in der Karosseriewerkstatt seines Vaters arbeitete. Im Sommer würde Charlie ein Praktikum in der Rechtsabteilung des Uintah-Reservats absolvieren.
Sein Freund war ein aufsteigender Stern, und Trent würde in seinem Heimatkaff bald ein Fernrohr brauchen, um Charlies Laufbahn zu verfolgen. Aber das war eigentlich nichts Neues. Trent hatte schon immer in Charlies Schatten gestanden. Dass sein Freund ein halber Ute war und die dauerhafte Sonnenbräune und das dichte schwarze Haar seines Volkes geerbt hatte, machte es auch nicht besser. Trents roter Bürstenhaarschnitt und die Unmengen von Sommersprossen auf seiner Nase und den Wangen hatten ihn bei den Schulpartys zu Charlies Statisten degradiert.
Charlie zufolge war diese Begräbnisstätte in der High Uintas Wilderness nur einer Handvoll Stammesältesten bekannt. Die wenigen, die sie kannten, durften nicht darüber sprechen. Charlie war nur deshalb eingeweiht, weil sein Großvater dem Bourbon zugetan war. Vermutlich konnte er sich nicht mal mehr erinnern, dass er ihm die in einem ausgehöhlten Büffelhorn versteckte lederne Landkarte gezeigt hatte.
Trent hatte zum ersten Mal auf der Mittelschule davon gehört, in einem Zweimannzelt, das er sich mit Charlie teilte.
Charlie hatte sich mit der Taschenlampe von unten ins Gesicht geleuchtet, als er seinem Freund die Geschichte erzählte. »Mein Opa glaubt, in der Höhle wohnt noch immer der Große Geist und bewacht einen gewaltigen Schatz unseres Volkes.«
»Was für einen Schatz?«, hatte Trent skeptisch gefragt. Damals hatte er sich eher für die Playboyhefte interessiert, die er aus dem Schrank seines Vaters stibitzte. Dieser Schatz reichte ihm.
Charlie zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Aber es liegt bestimmt ein Fluch darauf.«
»Was soll das heißen?«
Sein Freund hielt sich die Taschenlampe näher ans Kinn und wölbte dämonisch die Augenbrauen. »Opa sagt, niemand, der unerlaubt die Höhle des Großen Geistes betritt, kommt lebend wieder heraus.«
»Wieso das?«
»Weil sonst die Welt untergeht.«
In diesem Moment stimmte Trents alter Jagdhund ein ohrenbetäubendes Geheul an. Sie schreckten beide zusammen. Dann lachten sie und unterhielten sich bis tief in die Nacht. Charlie tat die Geschichte seines Großvaters als Aberglaube ab. Als moderner Indianer gab er sich alle Mühe, derlei Unfug entgegenzutreten.
Gleichwohl hatte Charlie Trent gebeten, Schweigen zu geloben, und sich geweigert, ihn zu dem auf der Landkarte verzeichneten Ort zu führen – bis jetzt.
»Es wird wärmer«, sagte Charlie.
Trent streckte die Hand aus. Sein Freund hatte recht. Der Schneefall war stärker, und die Flocken waren dicker geworden, doch je tiefer sie kamen, desto wärmer wurde es. Außerdem roch es nach faulen Eiern. Irgendwann war der Schneefall in Nieselregen übergegangen. Er wischte sich die Hand an der Hose ab und stellte fest, dass der Nebel, den er am Grund der Schlucht bemerkt hatte, in Wirklichkeit Dampf war.
Der Ursprung des Wasserdampfs lugte zwischen den Bäumen hervor; ein schmaler Fluss plätscherte über den Grund der Schlucht.
»Riecht nach Schwefel«, sagte Charlie und schniefte. Als sie das Flüsschen erreicht hatten, tauchte er den Zeigefinger ins Wasser. »Warm. Hier muss es irgendwo eine geothermische Quelle geben.«
Trent ließ sich nicht so leicht beeindrucken. In dieser Gegend gab es viele heiße Quellen.
Charlie richtete sich auf. »Hier muss es sein.«
»Wieso das?«
»Heiße Quellen gelten bei meinem Volk als heilig. Deshalb haben sie ihre Toten gern in deren Nähe bestattet.« Charlie setzte sich in Bewegung, hüpfte von Stein zu Stein. »Los, komm. Es ist nicht mehr weit.«
Sie wandten sich flussaufwärts. Mit jedem Schritt wurde es wärmer. Die schwefelhaltige Luft brannte Trent in Augen und Nase. Kein Wunder, dass hier noch niemand gewesen war.
Trent tränten die Augen, und er hätte am liebsten kehrtgemacht, doch auf einmal hielt Charlie an einer scharfen Biegung an. Er drehte sich einmal um die eigene Achse, das Mobiltelefon wie eine Wünschelrute in der ausgestreckten Hand, dann sah er auf die Karte, die er heute Morgen aus dem Schlafzimmer seines Großvaters entwendet hatte.
»Hier ist es«, sagte Charlie.
Trent schaute sich um. Bäume, nichts als Bäume. Weiter oben blieb der Schnee liegen, doch hier unten kam nur Nieselregen an.
»Der Höhleneingang muss ganz in der Nähe sein«, murmelte Charlie.
»Oder das Ganze ist einfach nur eine alte Geschichte.«
Charlie hüpfte von Stein zu Stein ans andere Ufer und kickte ein paar Farnwedel beiseite. »Wir sollten uns wenigstens mal umschauen.«
Trent machte sich halbherzig daran, die Umgebung zu erkunden, und entfernte sich ein paar Schritte weit vom Ufer. »Hier ist nichts!«, rief er, als er vor einer Granitwand stand. »Wie wär’s, wenn wir wieder …«
Als er sich umdrehte, sah er es aus den Augenwinkeln. Es wirkte wie ein Schatten an der Felswand, doch gleichzeitig fuhr ein Luftzug durchs Tal, brachte das Geäst der Bäume zum Schwanken und versetzte die Schatten in Bewegung.
Dieser Schatten aber rührte sich nicht von der Stelle.
Lautes Platschen und ein Fluch kündigten das Erscheinen seines Freundes an.
Trent hob die Hand.
»Also stimmt es wirklich«, sagte Charlie; zum ersten Mal wirkte er unsicher.
Sie betrachteten den Höhleneingang und dachten an die Geschichten, die in Umlauf waren. Sie waren beide zu nervös, um weiterzugehen, und gleichzeitig zu stolz, um umzukehren.
»Ziehen wir’s durch?«, fragte Trent nach einer Weile.
Charlie spannte sich an. »Klar, Mann, wir ziehen das durch.«
Bevor einer von ihnen die Nerven verlieren konnte, näherten sie sich der Felswand und kletterten zum Höhleneingang hoch. Charlie nahm die Taschenlampe heraus und leuchtete in die Dunkelheit hinein. Ein steiler Gang führte in die Tiefe des Bergs.
Charlie duckte sich und trat in die Höhle. »Na los, suchen wir den Schatz!«
Befeuert von der zur Schau gestellten Tapferkeit seines Freundes, folgte ihm Trent.
Der Gang wurde alsbald schmaler, sodass sie hintereinander gehen mussten. Hier drinnen war es noch wärmer als draußen, aber wenigstens trocken, und der Gestank war erträglich.
Als er sich durch eine besonders schmale Engstelle zwängte, spürte Trent die Wärme des Granits durch die Jacke hindurch.
»Mann«, sagte er, als er die Engstelle überwunden hatte, »das ist ja eine gottverdammte Sauna hier drin.«
Charlie strahlte. »Oder eine Schwitzkammer. Vielleicht haben meine Ahnen hier drinnen ja geschwitzt. Ich wette, die heiße Quelle entspringt genau unter unseren Füßen.«
Trent gefiel das nicht, doch jetzt gab es kein Zurück mehr.
Nach ein paar Schritten mündete der Gang in einen niedrigen Hohlraum von der Größe eines Basketball-Spielfelds. Unmittelbar vor ihnen befand sich eine aus dem Gestein herausgemeißelte Grube. Der Granit wirkte verrußt.
Charlie tastete blindlings nach Trents Arm. Der Griff seines Freundes war eisenhart, doch ihm zitterte die Hand. Trent konnte sich denken, warum.
Die Höhle war nicht leer.
Überall waren Tote, Männer und Frauen. Einige saßen im Schneidersitz da, andere waren zur Seite gekippt. Ledrige Haut spannte sich über die Knochen, die Augen waren leere Höhlen, die Lippen vertrocknet, sodass man die gelblichen Zähne sah. Alle waren bis zur Hüfte nackt, auch die Frauen, deren verschrumpelte Brüste flach am Brustkorb anlagen. Einige Tote trugen Federschmuck im Haar oder Halsketten aus Schmucksteinen und Tiersehnen.
»Mein Volk«, sagte Charlie mit brechender Stimme, als er sich einer der Mumien näherte.
Trent folgte ihm. »Bist du sicher?«
Im Schein der Taschenlampe wirkte die Haut der Toten zu blass, ihr Haar zu hell. Aber Trent war kein Experte. Vielleicht hatte die warme, mit Mineralien angereicherte Luft die Toten ja ausgebleicht.
Charlie untersuchte einen Mann, der einen schwarzen Federschmuck um den Hals trug. Er leuchtete ihn mit der Taschenlampe an. »Der hier ist rot.«
Charlie meinte nicht die Haut des Toten. Das Haar, das am ausgedörrten Schädel klebte, hatte eine rotbraune Farbe.
Trents Blick wanderte nach unten. »Guck dir mal den Hals an.«
Der Kopf des Mannes lehnte an der Felswand. Unter dem Kinn war ein klaffendes Loch, man sah den Knochen und vertrocknetes Gewebe. Der Schnitt war vollkommen gerade. In den verhutzelten Fingern hielt der Mann ein Messer. Die Klinge wirkte wie poliert und funkelte im Schein der Taschenlampe.
Charlie schwenkte die Lampe im Halbkreis. Auch andere Tote hielten Messer in ihren Knochenhänden, weitere Messer lagen auf dem Steinboden verstreut.
»Scheint so, als hätten sie Selbstmord begangen«, bemerkte Trent verblüfft.
»Aber warum?«
Trent zeigte zum zweiten Zugang. An der anderen Höhlenseite führte ein finsterer Tunnel tiefer in den Berg hinein. »Vielleicht haben sie hier unten etwas versteckt, von dem niemand erfahren sollte?«
Sie starrten in die Öffnung im Felsen. Ein Schauder wanderte von Trents Zehen nach oben. Er bekam eine Gänsehaut. Er und Charlie standen wie erstarrt da. Keiner von beiden wollte die Todeskammer durchqueren. Die Vorstellung, dass hier ein Schatz versteckt sein könnte, hatte auf einmal nichts Verlockendes mehr.
Charlie brach das Schweigen als Erster. »Lass uns von hier verschwinden.«
Trent hatte nichts dagegen. Ihm reichte es für heute.
Charlie drehte sich um und ging zum Ausgang.
Trent folgte ihm in den Gang hinein, blickte sich aber immer wieder um, als hätte er Angst, der Große Geist könnte von einem der Toten Besitz ergreifen und ihnen mit gezücktem Dolch hinterherschlurfen. Da er abgelenkt war, geriet er auf dem losen Geröll ins Stolpern. Er fiel auf den Bauch und rutschte ein Stück weit den steilen Gang hinunter.
Charlie wartete nicht auf ihn. Offenbar hatte er es eilig, nach draußen zu kommen. Als Trent sich aufgerappelt hatte und sich den Staub von den Knien klopfte, hatte Charlie den Ausgang erreicht und sprang hinaus.
Trent wollte sich lautstark bei ihm beschweren – da ertönte ein scharfer, zorniger Ruf. Da draußen war noch jemand. Es folgte ein hitziger Wortwechsel, doch Trent konnte nicht verstehen, worum es ging.
Auf einmal knallte es.
Trent schreckte zusammen und stolperte zwei Schritte in die Finsternis hinein.
Als der Pistolenschuss verhallt war, senkte sich lastende Stille herab.
Charlie …?
Zitternd vor Angst wich Trent vom Eingang zurück. Da seine Augen sich inzwischen auf die Dunkelheit eingestellt hatten, erreichte er die Mumienkammer, ohne Lärm zu machen. Am Rand der Kammer hielt er inne, gefangen zwischen der Dunkelheit in seinem Rücken und der Gefahr dort draußen.
Die Stille vertiefte, der Zeitablauf verlangsamte sich.
Auf einmal hörte er ein leises Schlurfen und Scharren.
O nein.
Jemand kletterte in die Höhle. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich weiter in die Finsternis zurückzuziehen – doch er brauchte eine Waffe. Als er einem Toten das Messer entwand, brachen dessen Finger wie trockenes Reisig.
Trent schob das Messer hinter seinen Gürtel und suchte sich einen Weg zwischen den Toten hindurch. Die Arme hatte er vorgestreckt und streifte mit den Fingern an spröden Federn und drahtigem Haar entlang. Er stellte sich vor, wie Knochenhände nach ihm griffen, ging aber trotzdem weiter.
Er musste sich irgendwo verstecken.
Und es gab nur eine einzige Möglichkeit.
Der gegenüberliegende Gang …
Davor aber hatte er Angst.
Auf einmal trat er mit dem Fuß ins Leere. Beinahe hätte er aufgeschrien – dann machte er sich klar, dass er nur vor der Feuergrube stand. Mit einem kleinen Sprung setzte er darüber hinweg. Er versuchte, sich anhand der Grube zu orientieren, doch das war gar nicht nötig.
Hinter ihm wurde es hell, der Lichtschein einer Taschenlampe fiel in die Totenkammer.
Jetzt, da er wieder sehen konnte, rannte er. Als er die Mündung des Gangs erreichte, hörte er hinter sich ein dumpfes Geräusch. Er warf einen Blick über die Schulter.
Eine Gestalt kam aus dem Gang hervorgerollt und blieb bäuchlings auf dem Höhlenboden liegen. Er konnte die gestickten Federn auf dem Rücken der dunkelroten Jacke erkennen.
Charlie.
Trent schlug sich die Hand vor den Mund und flüchtete in die schützende Dunkelheit des Felsentunnels. Mit jedem Schritt wuchs seine Panik.
Ob sie wissen, dass wir zu zweit waren?
Der Gang war eben, der Boden geglättet, doch er war viel zu kurz. Nach nur fünf furchtsamen Schritten hatte Trent auch schon die nächste Kammer erreicht.
Trent tat einen Schritt zur Seite und drückte sich an die Wand. Er versuchte, seinen keuchenden Atem zu dämpfen, denn er hatte das Gefühl, man könne ihn bis in die andere Höhlenkammer hören. Er riskierte einen Blick zurück.
Jemand mit einer Taschenlampe hatte die erste Kammer betreten. Im unsteten Lichtschein bückte er sich und zerrte den Leichnam seines Freundes an den Rand der Feuergrube. Die Person war allein. Der Mörder kniete nieder, legte die Taschenlampe ab und zog Charlies Leichnam an seine Brust. Der Mann schaute an die Decke, wiegte den Oberkörper und sang etwas in der Sprache der Ute.
Trent unterdrückte einen Aufschrei, denn er kannte dieses faltige, ledrige Gesicht.
Charlies Großvater setzte sich eine stahlglänzende Pistole an den Kopf. Trent wandte sich ab, doch er hatte zu langsam reagiert. Der Knall hallte dröhnend wider. Der Schädel des alten Mannes zerbarst in einem Schwall von Blut, Knochen und Gehirnmasse.
Die Pistole fiel scheppernd auf den Felsboden. Der alte Mann kippte auf den Leichnam seines Enkels, als wollte er ihn noch im Tod beschützen. Sein Arm fiel schlaff herab, traf die abgelegte Taschenlampe und drückte sie herum, sodass sie direkt in Trents Versteck leuchtete.
Trent fiel vor Entsetzen auf die Knie. Er dachte an die abergläubische Warnung, die Charlies Großvater ausgesprochen hatte: Niemand, der unerlaubt die Höhle des Großen Geistes betritt, kommt lebend wieder heraus.
Dass sich die Drohung für Charlie bewahrheitet hatte, dafür hatte der Stammesälteste gesorgt. Offenbar hatte er den Diebstahl der Landkarte bemerkt und war ihnen hierher gefolgt.
Trent schlug die Hände vors Gesicht und atmete zwischen den Fingern hindurch. Er konnte nicht glauben, was er soeben gesehen hatte. Er horchte, ob noch jemand dort draußen war, und wartete geschlagene zehn Minuten.
Als er sich vergewissert hatte, dass er allein war, richtete er sich auf. Er warf einen Blick über die Schulter. Der Strahl der Taschenlampe fiel in die kleine Höhle und enthüllte, was man vor langer Zeit hier versteckt hatte.
An der Rückwand der Kammer waren Steinkisten gestapelt, jeweils von der Größe eines Brotkastens. Es sah aus, als wären sie eingeölt und in Baumrinde eingepackt. Was Trents Blicke auf sich lenkte, nahm allerdings die Mitte der Kammer ein.
Auf einem Granitsockel ruhte ein großer Schädel.
Ein Totem, dachte er.
Trent betrachtete die leeren Augenhöhlen, die gewölbte Hirnschale und die über dreißig Zentimeter langen Fangzähne. Vom Unterricht in Altertumsgeschichte wusste er, dass er den Schädel eines Säbelzahntigers vor sich hatte. Trotzdem war er verblüfft vom eigenartigen Zustand des Schädels. Er musste den Mord und den Selbstmord melden – aber auch den entdeckten Schatz.
Einen Schatz, der keinen Sinn ergab.
Er stürmte durch den Felstunnel, eilte durch die Mumienkammer und rannte dem Tageslicht entgegen. Am Höhleneingang hielt er inne und dachte an die Warnung, die Charlies Großvater ausgesprochen hatte, an die Folgen, die es haben könnte, wenn ein Eindringling aus der Höhle entkam.
Dann geht die Welt unter.
Mit tränenden Augen schüttelte Trent den Kopf. Der Aberglaube hatte seinen besten Freund getötet. Ihm sollte das nicht passieren.
Er sprang aus der Höhle und floh in die Welt hinaus.
2
30. Mai, 10:38High Uintas Wilderness, Utah
NICHTS SORGTE FÜR einen solchen Rummel wie ein Mord.
Margaret Grantham schritt durch das provisorische Lager, das man auf einer Bergwiese mit Ausblick auf die Schlucht errichtet hatte. Sie schnaufte ein wenig in der dünnen Luft, und von der Kälte schmerzten ihr die arthritischen Knöchel. Ein Windstoß hätte ihr beinahe den Hut vom Kopf gerissen, doch sie hielt ihn fest und steckte ein paar graue Haarsträhnen darunter fest.
Die Zelte nahmen eine Fläche von mehreren Morgen ein, die einzelnen Gruppen, angefangen von den Gesetzeshütern bis hin zu den Medienvertretern, waren deutlich sichtbar voneinander abgegrenzt. Eine Einheit der Nationalgarde sollte für Ordnung sorgen, erhöhte aber allein durch ihre Anwesenheit die Spannungen.
In den vergangenen zwei Wochen waren, angelockt von der Kontroverse, Gruppen amerikanischer Ureinwohner aus dem ganzen Land zu Fuß oder zu Pferd an diesen abgelegenen Ort geeilt. Verschiedene Organisationen waren vertreten: NABO, AUNU, NAG, NCAI. Alle hatten sich einem einzigen Ziel verschrieben: die Rechte der amerikanischen Ureinwohner zu schützen und das Stammeserbe zu bewahren. Unter den Zelten waren auch Tipis vertreten, die von den konservativeren Gruppierungen errichtet worden waren.
Maggie beobachtete kopfschüttelnd, wie am Rande des Lagers ein Helikopter der Medienberichterstatter landete. Das öffentliche Interesse machte alles nur noch schwieriger.
Sie lehrte Anthropologie an der Brigham Young University und hatte die Utah-Abteilung der Indianerbehörde gebeten, beim Streit um die Funde in dieser Gegend zu vermitteln. Da sie seit dreißig Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit des universitären Indianerprogramms verantwortlich war, wussten die einheimischen Stämme, dass sie sich für ihre Interessen einsetzte. Außerdem hatte sie schon häufig mit dem bekannten Schoschonenhistoriker und Naturforscher Professor Henry Kanosh zusammengearbeitet.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!