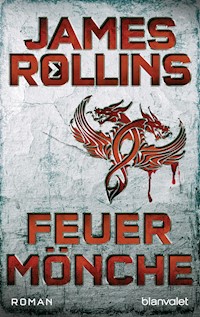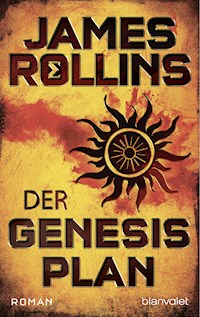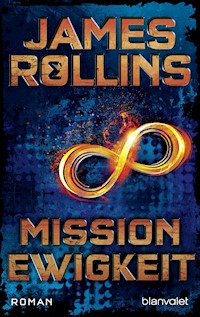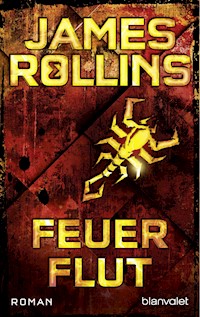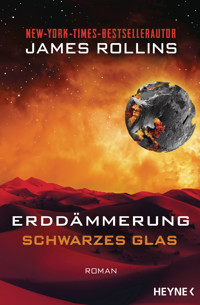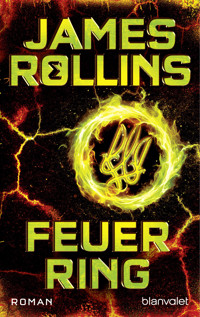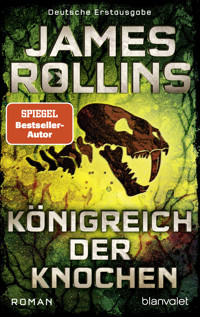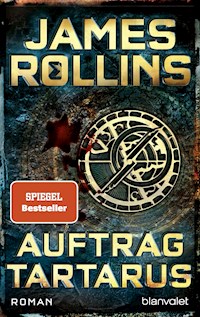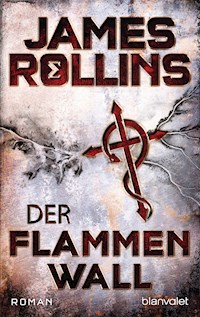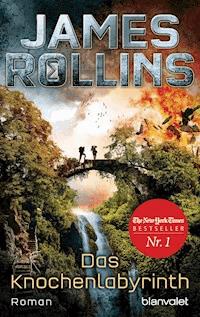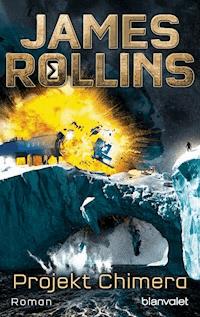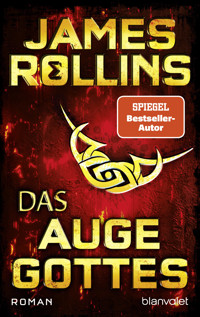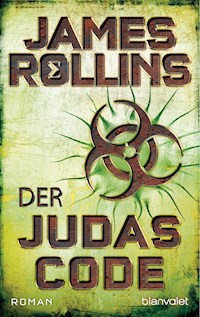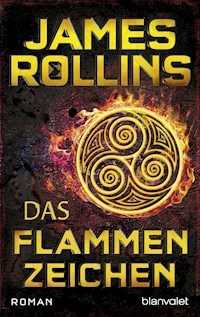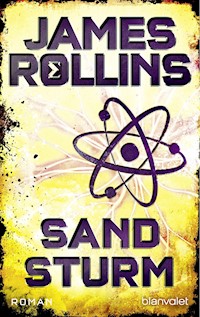
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
James Bond war gestern – die Zukunft gehört Painter Crowe!
Eine mysteriöse Lichtkugel erscheint im Britischen Museum in London – und explodiert mit unfassbarer Gewalt. Bestand sie tatsächlich aus reiner Antimaterie? Für Painter Crowe von der wissenschaftlichen Spezialeinheit SIGMA Force beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit: Denn wer immer diese unerschöpfliche Energiequelle zuerst beherrscht, entscheidet über Leben und Tod der gesamten Menschheit! Doch Painter Crowes Gegner sind skrupellos und scheinen ihm immer einen Schritt voraus zu sein …
Dies ist der erste Sigma-Fore-Roman von James Rollins. Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 886
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
James Rollins
Sandsturm
Roman
Aus dem Englischen von Klaus Berr
Buch
Eine gewaltige Explosion erschüttert das Britische Museum in London und vernichtet die berühmte Kensington-Sammlung arabischer Kunstschätze. Die Aufnahmen der Sicherheitskameras zeigen Bilder einer mysteriösen blauen Lichtkugel, welche die verheerende Detonation auslöste. Die Geheimdienste aus aller Welt reagieren alarmiert und versuchen herauszufinden, was der Ursprung dieses Phänomens ist. Lady Kara Kensington, deren Familie die zerstörte Sammlung gestiftet hatte, und die Museumskuratorin Safia al-Maaz entdecken Spuren, die zu der Stadt Ubar führen, die in der Wüste von Oman begraben liegen soll. Die beiden Frauen überreden den renommierten Archäologen und berüchtigten Abenteurer Omaha Dunn, sie auf ihrer Suche nach der sagenumwobenen Stadt zu begleiten.
Der SIGMA-Agent Painter Crowe arbeitet gerade an einem Auftrag in Connecticut, als er plötzlich ins Hauptquartier zurückgerufen wird. Dort zeigen ihm seine Vorgesetzten die Videoaufnahmen aus dem Museum sowie einen Meteoritensplitter, der in den Ruinen entdeckt wurde – sein Kern ist aus reiner Antimaterie. Crowe erhält den Befehl, Ubar zu finden und dort die unerschöpfliche Energiequelle sicherzustellen, bevor sie in die falschen Hände gerät.
Doch auch andere Kreise haben bereits die Fährte aufgenommen, und es beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, an dessen Ende die Vernichtung der gesamten Menschheit stehen könnte. Der Countdown läuft bereits …
Autor
Der New York Times Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma-Force: Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera, Das Knochenlabyrinth, Die siebte Plage, Die Höllenkrone, Auftrag Tartarus Tucker Wayne: Killercode, Kriegsfalke Die Bruderschaft der Christuskrieger: Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes Außerdem: Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des Teufels, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels
Besuchen Sie uns auf:
Für Katherine, Adrienne und RJ, die nächste Generation
KARTENORDNER
Dossier
Verteidigungsministerium
Code: ALPHA42-PCR
SIGMA FORCE
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil – Gewittersturm
1 Feuer und Regen
2 Fuchsjagd
3 Herzensangelegenheiten
4 Gischt
5 Drahtseilakt
Zweiter Teil – Sand und Meer
6 Heimkehr
7 Altstadt
8 Schlangen und Leitern
9 Blut auf dem Wasser
10 Stürmische See
Dritter Teil – Gräber
11 Im Stich gelassen
12 Sicherheit über alles
13 Fußabdrücke des Propheten
14 Grabräuber
15 Bergpfad
Vierter Teil – Die Tore von Ubar
16 Kreuzungen
17 Ein Schloss knacken
18 Hinab in das Kaninchenloch
Fünfter Teil – Feuer in der Tiefe
19 In einem Sturm ist jeder Hafen recht
20 Schlacht unter dem Sand
21 Sturmwache
22 Feuersturm
Epilog
Nachbemerkung des Autors
Danksagung
ERSTER TEIL
Gewittersturm
1
Feuer und Regen
14. November, 01:33 Im British Museum London, England
In dreißig Minuten sollte Harry Masterson tot sein.
Hätte er das gewusst, hätte er seine letzte Zigarette bis zum Filter geraucht. Stattdessen drückte er die Kippe nach nur drei Zügen aus und wedelte sich den Rauch vor dem Gesicht weg. Würde man ihn beim Rauchen vor dem Pausenraum des Wachpersonals erwischen, würde dieser Mistkerl Fleming, der Leiter des Sicherheitsdienstes des Museums, ihm die Hölle heiß machen. Harry stand sowieso schon auf der Abschussliste, weil er letzte Woche zwei Stunden zu spät gekommen war.
Er fluchte leise und steckte den Stummel in die Tasche. Bei der nächsten Pause wollte er die Kippe zu Ende rauchen … falls er in dieser Nacht noch eine Pause bekam.
Donner hallte durch das Mauerwerk. Der Wintersturm war kurz nach Mitternacht losgebrochen, zuerst mit einem heftigen Hagelschauer und dann mit einem Platzregen, der London in die Themse zu spülen drohte. Blitze zuckten quer über den ganzen Himmel. Nach Angaben des Wetterberichts war es eins der heftigsten Unwetter des letzten Jahrzehnts. In der halben Stadt war die Stromversorgung zusammengebrochen, ein spektakuläres Sperrfeuer aus Blitzen hatte das Netz lahm gelegt.
Und zu Harrys Pech war es seine Hälfte der Stadt, die plötzlich dunkel wurde, darunter auch das British Museum an der Great Russell Street. Obwohl es natürlich Notstromaggregate gab, war die gesamte Sicherheitsmannschaft zusammengerufen worden, um die Schätze des Museums zusätzlich zu schützen. Innerhalb der nächsten halben Stunde würden die Männer eintreffen. Aber Harry, der Nachtschicht hatte, war bereits im Dienst, als die reguläre Beleuchtung ausfiel. Und obwohl die Videoüberwachung dank des Notstromnetzes noch funktionierte, hatte Fleming ihn und die restliche Mannschaft sofort auf einen Kontrollgang durch die zweieinhalb Meilen langen Gänge des Museums geschickt.
Das bedeutete, dass sie sich trennen mussten.
Harry nahm seine Stablampe zur Hand und leuchtete den Gang ab. Er hasste es, nachts Runden drehen zu müssen, denn dann lag das ganze Museum im Dunkeln. Das einzige Licht kam von den Straßenlaternen vor den Fenstern. Aber wegen des Stromausfalls brannten auch diese Lampen nicht. Das Museum lag in völliger Schwärze, und die makabren Schatten wurden nur unterbrochen von den dunkelroten Lichttümpeln der Niedervolt-Notbeleuchtung.
Um seine Nerven zu beruhigen, hatte Harry eine Dosis Nikotin gebraucht, aber jetzt konnte er seine Runde nicht länger aufschieben. Da er in der Hackordnung der Nachtschicht auf der untersten Stufe stand, hatte man ihm den Nordflügel zugewiesen, der am weitesten von ihrem Stützpunkt entfernt lag. Aber das hieß nicht, dass er keine Abkürzung nehmen konnte. Er drehte dem vor ihm liegenden langen Gang den Rücken zu und ging zu der Tür, die zu dem großen Innenhof Elizabeth II. führte.
Dieser zentrale, knapp einen Hektar große Innenhof wird begrenzt von den vier Flügeln des Museums. In seinem Zentrum erhebt sich der große Round Reading Room, der runde Lesesaal mit seiner Kupferkuppel. Der gesamte Innenhof war von Foster and Partners mit einem riesigen geodätischen Dach überspannt worden, wodurch der größte bedeckte Platz Europas entstand.
Mit seinem Generalschlüssel öffnete Harry die Tür und betrat den gewölbeartigen Platz. Wie das Museum selbst war auch der Hof in Dunkelheit getaucht. Regen prasselte auf das Glasdach hoch über seinem Kopf. Trotzdem hallten Harrys Schritte durch den leeren Raum. Wieder zuckte ein Blitz über den Himmel. Das in tausend dreieckige Scheiben unterteilte Dach wurde für einen Augenblick blendend hell. Dann versank das Museum wieder in Dunkelheit und dem Prasseln des Regens.
Donner folgte, den Harry tief in der Brust spürte. Das Dach klirrte. Harry zog den Kopf ein, weil er Angst hatte, die ganze Konstruktion könnte einstürzen.
Die Stablampe vor sich ausgestreckt, überquerte er den Hof in Richtung des Nordflügels. Er umrundete den Lesesaal in der Mitte. Wieder blitzte es, und einige Herzschläge lang wurde der Raum hell. Riesige Statuen tauchten wie aus dem Nichts vor ihm auf. Der Löwe von Knidos erhob sich neben dem riesigen Kopf einer Statue von den Osterinseln. Dann verlosch der Blitz, und die steinernen Wächter wurden wieder von der Dunkelheit verschluckt.
Harry fröstelte und bekam eine Gänsehaut.
Er ging schneller, und bei jedem Schritt fluchte er leise. »Blöde, elende Scheißdinger …« Das beruhigte ihn ein wenig.
Als er die Tür zum Nordflügel öffnete, begrüßte ihn die vertraute Duftmischung aus Moder und Ammoniak. Er war froh, wieder feste Mauern um sich zu haben, und leuchtete mit seiner Lampe den Gang entlang. Zwar schien alles in Ordnung zu sein, doch er war verpflichtet, jede Galerie des Flügels zu kontrollieren. Er rechnete schnell nach. Wenn er sich beeilte, hatte er nach dem Rundgang noch genug Zeit für eine schnelle Zigarette. Die Vorfreude auf die nächste Nikotindröhnung trieb ihn an, und er ging, den Strahl seiner Taschenlampe vor sich, den Gang weiter.
Der Nordflügel beherbergte die Jubiläumsausstellung des Museums, eine ethnographische Sammlung, die einen Überblick über die menschlichen Errungenschaften aller Jahrhunderte und aller Kulturen bot. Etwa die ägyptische Galerie mit ihren Mumien und Sarkophagen. Er beeilte sich und hakte die verschiedenen Kulturkreise ab: den keltischen, den byzantinischen, den russischen und den chinesischen. Jede Saalflucht war mit einem Sicherheitsgitter verschlossen. Nach dem Stromausfall waren die Tore automatisch heruntergelassen worden.
Endlich kam das Ende des Korridors in Sicht.
Die meisten Ausstellungen der Galerien waren nur vorübergehend hier untergebracht, es waren Leihgaben des Museum of Mankind – des Museums für die Geschichte der Menschheit – für die Jubiläumsfeierlichkeiten. Nur die hinterste Galerie war immer schon hier gewesen, zumindest soweit Harry sich erinnern konnte. Sie beherbergte die arabische Abteilung des Museums, eine unschätzbare Sammlung von Antiquitäten von der Arabischen Halbinsel. Die Galerie war von einer einzigen Familie eingerichtet und finanziert worden, einer Familie, die durch ihre Ölgeschäfte in dieser Region reich geworden war. Die Mittel, die nötig waren, um eine solche Dauerausstellung im British Museum zu unterhalten, überstiegen angeblich fünf Millionen Pfund pro Jahr.
Einer solchen Art von Engagement musste man Respekt zollen.
Oder auch nicht.
Harry, der für eine so sinnlose Geldverschwendung nur Verachtung übrig hatte, richtete den Strahl seiner Lampe auf die gravierte Messingtafel über der Tür: THE KENSINGTON GALLERY. Auch bekannt als: »Der Dachboden der Schlampe«.
Harry war Lady Kensington zwar noch nie begegnet, doch nach dem Gerede unter den Angestellten war klar, dass auch nur der geringste Makel in ihrer Galerie – Staub auf einer Vitrine, ein Fleck auf einer Beschriftung – heftigsten Tadel nach sich zog. Die Galerie war ihr Steckenpferd, und niemand entging ihrem heiligen Zorn. Er hatte schon einige Männer den Job gekostet, darunter auch einen ehemaligen Direktor.
Deshalb hielt sich Harry vor dem Sicherheitsgitter dieser Galerie auch ein wenig länger auf. Mit mehr als beiläufiger Gründlichkeit ließ er den Strahl seiner Lampe durch den Eingangsbereich wandern. Doch auch hier war alles in Ordnung.
Er ließ die Lampe sinken und wollte sich eben abwenden, als er aus dem Augenwinkel eine Bewegung bemerkte.
Er erstarrte und richtete den Strahl der Lampe auf den Boden.
Tief im Inneren der Kensington Gallery, in einem der entfernteren Säle, wanderte langsam ein bläulicher Schein und veränderte in seiner Bewegung den Schattenwurf der Gegenstände.
Noch eine Taschenlampe … Da war jemand in der Galerie …
Harrys Herz schlug bis zum Hals. Ein Einbrecher. Er lehnte sich an die angrenzende Wand. Seine Finger tasteten nach seinem Funkgerät. Durch die Mauern hallte voll tönend und tief ein Donner.
Er drückte auf den Sprechknopf. »Ich habe hier im Nordflügel möglicherweise einen Eindringling. Erbitte Anweisungen.«
Er wartete auf die Antwort seines Schichtleiters. Gene Johnson war zwar ein Idiot, aber er war auch ein ehemaliger Offizier der Royal Air Force. Er wusste, was zu tun war.
Signalausfälle wegen der atmosphärischen Störungen durch das Gewitter verstümmelten seine Antwort. »… möglich … sind Sie sicher? … warten bis … sind die Tore gesichert?«
Harry starrte die heruntergelassenen Sicherheitsgitter an. Natürlich hätte er nachprüfen sollen, ob man sie aufgebrochen hatte. Jede Galerie hatte nur eine Tür zum Gang. Der einzige andere Zugang zu den verschlossenen Sälen wäre durch eins der hohen Fenster gewesen, aber auch die waren gesichert. Und obwohl das Gewitter die Hauptstromversorgung lahm gelegt hatte, hatten die Notstromaggregate das Sicherheitsnetz aufrechterhalten. Im Kontrollzentrum war kein Alarm ausgelöst worden.
Harry stellte sich vor, wie Johnson schon jetzt von einer Kamera zur nächsten schaltete, diesen Flügel absuchte und vor allem die Kensington Gallery ins Auge fasste. Er riskierte einen Blick in die aus fünf Sälen bestehende Flucht. Der Schein war weiterhin in der Galerie zu sehen. Er bewegte sich scheinbar ziellos, beliebig, und wirkte nicht wie das entschlossene Hin- und Herschwenken eines Diebes. Harry kontrollierte schnell das Sicherheitstor. Das elektronische Schloss leuchtete grün. Es war nicht aufgebrochen worden.
Er spähte wieder zu dem Schein. Vielleicht war es nur der Scheinwerferkegel eines vorbeifahrenden Autos, der durch die Fenster der Galerie fiel.
Johnsons immer wieder unterbrochene Stimme aus dem Funkgerät ließ in hochschrecken. »Videoüberwachung zeigt nichts … Kamera fünf ist ausgefallen … Verstärkung ist unterwegs.« Was er sonst noch sagte, ging in den atmosphärischen Störungen unter.
Harry stand vor dem Tor. Andere Wachmänner waren unterwegs. Was, wenn es gar kein Eindringling war? Was, wenn es nur ein Scheinwerferstrahl war? Schon jetzt bewegte er sich bei Fleming auf dünnem Eis. Auf keinen Fall wollte er als Trottel dastehen.
Er nahm all seinen Mut zusammen und hob die Stablampe. »He, Sie da drinnen!«, rief er. Er wollte es eigentlich herrisch klingen lassen, doch es kam als schrilles Kreischen aus seinem Mund.
Aber das Bewegungsmuster des Lichts änderte sich nicht. Es schien noch tiefer in die Galerie zu wandern – doch nicht in einem panischen Rückzug, sondern langsam und nicht sehr zielstrebig. Kein Dieb konnte so viel Eis in seinen Adern haben.
Harry ging zum elektronischen Schloss und öffnete es mit seinem Generalschlüssel. Die magnetischen Verriegelungen lösten sich. Er zog das Gitter gerade so weit hoch, dass er darunter hindurch in den ersten Saal kriechen konnte. Dann richtete er sich auf und hielt die Stablampe wieder vor sich. Seine kurzfristige Panik war ihm durchaus nicht peinlich. Er hätte nur gründlicher ermitteln sollen, bevor er Alarm auslöste.
Aber jetzt war es schon passiert. Er konnte nur hoffen, sein Gesicht zu wahren, indem er den mysteriösen Vorfall selbst aufklärte.
Nur für alle Fälle rief er noch einmal: »Sicherheitsdienst! Stehen bleiben!«
Doch sein Rufen zeigte keine Wirkung. Der Schein behielt seinen stetigen Zickzackkurs tiefer in die Galerie hinein bei.
Durch das Gitter schaute er noch einmal in den Korridor. Die anderen würden in weniger als einer Minute hier sein. »Scheiß drauf«, murmelte er und lief in die Galerie. Er wollte den Schein aufspüren und seine Ursache beheben, bevor die anderen eintrafen.
Mit kaum einem Blick für die Objekte von zeitloser Bedeutung und unschätzbarem Wert eilte er durch die Säle: Glasvitrinen mit Lehmtafeln des assyrischen Königs Ashurbanipal, ungeschlachte Sandsteinstatuen aus vorpersischer Zeit, Schwerter und Waffen aus allen Jahrhunderten, phönizische Elfenbeinfiguren, die Könige und Königinnen darstellten, sogar eine Erstausgabe von Arabische Nächte unter dem Ursprungstitel Der orientalische Moralist.
Harry eilte durch die Säle und wechselte von einer Dynastie in die nächste – von den Zeiten der Kreuzzüge zur Geburt Christi, von der Blütezeit Alexanders des Großen zu den Perioden des Königs Salomon und der Königin von Saba.
Schließlich erreichte er den hintersten Saal, einen der größten. Er enthielt Objekte, die eher für Naturforscher von Interesse waren; seltene Steine und Juwelen, Fossilien, neolithische Werkzeuge.
Nun sah er auch, was die Quelle des Scheins war. Fast in der Mitte des Kuppelsaals schwebte träge eine Kugel blauen Lichts von etwa einem halben Meter im Durchmesser. Sie schimmerte, und auf ihrer Oberfläche schien eine Flamme prismatischen blauen Öls zu züngeln.
Vor Harrys Augen drang die Kugel in eine Glasvitrine ein, als wäre sie aus Luft. Harry schaute sprachlos zu. Schwefelgestank stieg ihm in die Nase. Er schien von der Kugel aus tiefblauem Licht auszugehen.
Dann rollte das Gebilde über eine der rot leuchtenden Sicherheitslampen, und sie zerplatzte mit einem knisternden Plopp. Das Geräusch erschreckte Harry, er trat einen Schritt zurück. Dasselbe musste wohl auch mit Kamera fünf im Saal hinter ihm passiert sein. Er schaute hoch zu der Kamera in diesem Saal. Das rote Lämpchen darüber leuchtete. Sie funktionierte noch.
Als hätte Johnson seinen Blick zur Kamera bemerkt, meldete er sich über Funk. Aus irgendeinem Grund gab es keine statischen Störungen mehr. »Harry, es ist besser, wenn Sie von dort verschwinden!«
Doch er blieb unbeweglich stehen, halb aus Angst, halb aus Faszination. Außerdem bewegte sich das Phänomen von ihm weg, auf eine dunkle Ecke des Saals zu.
Der Schein der Kugel beleuchtete einen Klumpen Metall innerhalb eines Glaswürfels. Es war ein Brocken rotes Eisen, so groß wie ein Kalb, ein kniendes Kalb. Das Informationstäfelchen bezeichnete das Ding als Kamel. Allerdings bestand höchstens eine entfernte Ähnlichkeit mit einem solchen Tier, aber Harry verstand, warum man es so interpretierte: Das Objekt war in der Wüste gefunden worden.
Der Schein schwebte jetzt über dem Eisenkamel.
Harry trat vorsichtig einen Schritt zurück und hob sein Funkgerät. »O Gott!«
Die schimmernde Kugel fiel durch das Glas und landete auf dem Kamel. Der Schein verlosch so schnell, als hätte man eine Kerze ausgeblasen.
Die plötzliche Dunkelheit machte Harry einen Atemzug lang blind. Er hob seine Stablampe. Das Eisenkamel ruhte noch immer in seinem Glaswürfel, offensichtlich völlig unbeschädigt. »Der Schein ist verschwunden …«
»Sind Sie okay?«
»Ja. Was zum Teufel war denn das?«
Johnson antwortete mit Ehrfurcht in der Stimme: »Ein verdammter Kugelblitz, würde ich mal sagen! Ich habe Geschichten von Kumpeln gehört, die mit Kampfflugzeugen durch ein Gewitter flogen. Anscheinend hat das Unwetter ihn ausgespuckt. Aber verdammt, das war vielleicht strahlend hell.«
Jetzt ist es nicht mehr strahlend hell, dachte Harry und schüttelte den Kopf. Was es auch war, auf jeden Fall bewahrte es ihn vor dem peinlichen Spott seiner Kollegen.
Er senkte die Stablampe. Doch als der Strahl vom Kamel zum Boden wanderte, glühte es weiter in der Dunkelheit. Mit einem dunkelroten Schein.
»Und was ist das jetzt?«, murmelte Harry und packte sein Funkgerät. Heftige statische Entladungen fuhren ihm in die Finger. Fluchend schüttelte er sie ab. Dann hob er das Funkgerät. »Irgendwas ist komisch. Ich glaube nicht …«
Das Leuchten im Eisen wurde heller. Harry wich zurück. Das Eisen floss über die Oberfläche des Kamels, es schmolz, als wäre es einem Säureregen ausgesetzt. Er war nicht der Einzige, der die Veränderung bemerkte.
Das Funkgerät in seiner Hand bellte: »Harry, machen Sie, dass Sie da rauskommen!«
Er widersprach nicht. Er drehte sich um, aber es war schon zu spät.
Die Glasvitrine explodierte. Scharfe Speere stachen ihm in die linke Flanke. Ein schartiger Splitter schlitzte seine Wange auf. Aber er spürte die Schnitte kaum, denn eine sengende Gluthitze, die allen Sauerstoff verbrannte, traf ihn mit voller Wucht.
Ein Schrei lag ihm auf den Lippen, doch er wurde nie ausgestoßen.
Die nächste Explosion riss Harry von den Füßen und schleuderte ihn quer durch die ganze Galerie. Doch nur noch lodernde Knochen trafen das Sicherheitstor und verschmolzen mit dem Metallgitter.
01:53
Safia al-Maaz wachte voller Panik auf. Aus allen Richtungen waren Sirenen zu hören. Die roten Lichtblitze der Signallampen zuckten über die Wände ihres Schlafzimmers. Entsetzen packte sie mit eiserner Faust. Sie konnte kaum atmen, und kalter Schweiß trat ihr auf die Stirn. Mit verkrampften Fingern drückte sie sich die Bettdecke an die Kehle. Den Blick starr ins Leere gerichtet, war sie einen Augenblick lang zwischen Vergangenheit und Gegenwart gefangen.
Heulende Sirenen, in der Ferne Explosionen … und näher die Schreie der Verwundeten, der Sterbenden – und ihre eigene Stimme, die in diesen Chor der Schmerzen und des Schocks einfiel …
Megafone dröhnten auf den Straßen unter ihrer Wohnung. »Machen Sie Platz für die Einsatzwagen! Räumen Sie die Straße!«
Englisch … nicht Arabisch, nicht Hebräisch.
Ein tiefes Grollen zog an ihrer Wohnung vorbei und verklang in der Ferne.
Die Stimmen der Einsatzkräfte holten sie wieder zurück in ihr Bett, in die Gegenwart. Sie war in London, nicht in Tel Aviv. Endlich konnte sie die Luft aus ihren Lungen lassen. Tränen stiegen ihr in die Augen, und mit zitternden Fingern wischte sie sie weg.
Eine Panikattacke.
Einige Atemzüge lang saß sie, eingewickelt in ihren Schal, einfach nur da. Am liebsten hätte sie geweint. So war es doch schon immer, sagte sie sich, aber das half ihr auch nicht. Mit geschlossenen Augen zog sie sich den Wollschal enger um die Schultern und spürte das Herz in ihren Ohren pochen. Sie machte die Atem- und Beruhigungsübungen, die ihr Therapeut ihr beigebracht hatte. Bis zwei einatmen, bis vier ausatmen. Mit jedem Atemzug fiel Spannung von ihr ab, als strömte sie heraus. Langsam wurde ihre Haut wieder wärmer.
Etwas Schweres landete auf ihrem Bett. Ein leises Geräusch begleitete es. Wie ein quietschendes Scharnier.
Sie streckte die Hand aus, und ein Schnurren begrüßte sie. »Komm her, Billie«, flüsterte sie dem übergewichtigen schwarzen Perserkater zu.
Billie drückte sich an ihre Handfläche und strich mit der Unterseite seiner Schnauze über Safias Finger, dann ließ er sich einfach auf ihre Oberschenkel plumpsen, als wären die unsichtbaren Fäden, die den Kater aufrecht hielten, durchtrennt worden. Die Sirenen hatten ihn offensichtlich bei seinem gewohnten nächtlichen Streifzug durch die Wohnung gestört.
Das leise Schnurren ging in Safias Schoß weiter, ein sehr zufriedenes Geräusch.
Dies entspannte die verkrampften Muskeln in ihren Schultern viel mehr als ihre Atemübungen. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie den Rücken gekrümmt hatte, als fürchtete sie einen Schlag, der nie kam. Sie richtete sich auf und streckte den Hals.
Die Sirenen und der Tumult gingen einen halben Block von ihrem Haus entfernt weiter. Sie musste aufstehen und herausfinden, was da los war. Sie würde alles tun, nur um in Bewegung zu sein. Die Panik hatte sich in nervöse Energie verwandelt.
Sie schob die Beine zur Seite, achtete jedoch darauf, dass Billie auf dem Wollschal zu liegen kam. Das Schnurren setzte kurz aus, ging jedoch sofort weiter, als der Kater merkte, dass man ihn nicht aus dem Bett warf. Billie war in den Straßen Londons geboren worden, ursprünglich ein Gassenstreuner, ein wildes Knäuel aus verfilztem Fell und Feuchtigkeit. Safia hatte das Kätzchen lang hingestreckt auf ihrer Vordertreppe gefunden, ölverschmiert, mit einem gebrochenen Lauf, von einem Auto angefahren. Obwohl sie ihm helfen wollte, hatte der Kater ihr in den Daumen gebissen. Freunde hatten ihr geraten, das Kätzchen ins Tierheim zu bringen, aber Safia wusste, dass es dort nicht besser war als in einem Waisenhaus. Stattdessen hatte sie ihn in einen Kissenbezug gepackt und in die örtliche Tierklinik gebracht.
Es wäre an diesem Abend ein Leichtes gewesen, auf der Treppe einfach über ihn hinwegzusteigen, aber sie war einmal selbst so einsam und verlassen gewesen wie das Kätzchen. Damals hatte jemand auch sie in sein Haus aufgenommen. Und wie Billie war auch sie domestiziert worden – doch beide wurden nie völlig zahm, sie zogen wilde Orte vor und das Herumstöbern in den vergessenen Winkeln dieser Welt.
Doch das alles hatte mit einer Explosion an einem sonnigen Frühlingstag geendet.
Alles meine Schuld … Wieder hallten Weinen und Schreie durch ihren Kopf und vermischten sich mit den Sirenen der Gegenwart.
Safia streckte die Hand nach der Nachttischlampe aus, einer kleinen Tiffany-Kopie mit Libellen aus Buntglas. Ein paar Mal drückte sie auf den Schalter, doch die Lampe blieb dunkel. Der Strom war ausgefallen. Offensichtlich hatte das Unwetter eine Leitung unterbrochen.
Vielleicht deshalb der ganze Tumult.
Hoffentlich ist es etwas so Einfaches.
Sie schwang sich aus dem Bett, barfuß zwar, aber in einem warmen Flanellnachthemd, das ihr bis zu den Knien reichte. Sie ging zum Fenster und kurbelte die Jalousien hoch, um auf die Straße sehen zu können. Ihre Wohnung lag im dritten Stock.
Unter ihr war aus der normalerweise ruhigen und ehrwürdigen Straße mit Eisenlaternen und breiten Bürgersteigen ein surreales Schlachtfeld geworden. Trotz des Regens stiegen Rauchschwaden in die Höhe, aber wenigstens hatte das Unwetter sich abgeschwächt und war in gewohnten Londoner Regen übergegangen. Da die Straßenlaternen nicht brannten, kam die einzige Beleuchtung von den Blinklichtern auf den Dächern der Einsatzfahrzeuge. Und doch flackerte weiter unten ein tiefroter Schein durch den Rauch und die Dunkelheit.
Feuer.
Safias Herz pochte heftiger, ihr stockte der Atem – nicht wegen alter Ängste, sondern wegen neuer Befürchtungen. Das Museum. Sie öffnete die Verriegelung des Fensters, stemmte das Schiebefenster hoch und beugte sich hinaus in den Regen. Die eisigen Tropfen spürte sie kaum.
Das British Museum lag nur einen kurzen Fußweg von ihrer Wohnung entfernt. Mit aufgerissenem Mund betrachtete sie die Szenerie. Die nordöstliche Ecke des Museums war nur noch eine lodernde Ruine. Flammen leckten aus zersplitterten Fenstern in den oberen Etagen, Rauch drang in dichten Schwaden heraus. Männer mit schwerem Atemschutzgerät schleppten Schläuche. Dicke Wasserstrahlen schossen in die Luft. Leitern ragten von Einsatzfahrzeugen in die Höhe.
Doch das Schlimmste war das klaffende Loch im ersten Stock der nordöstlichen Ecke. Schutt und geschwärzte Betonbrocken lagen auf der Straße. Anscheinend hatte sie die Explosion nicht gehört oder sie als Donner gedeutet. Aber das war kein Blitzeinschlag.
Eher schon eine Bombenexplosion … ein Terroristenangriff. Nicht schon wieder …
Sie spürte, wie ihr die Knie weich wurden. Der Nordflügel … ihr Flügel. Sie wusste, dass das rauchende Loch in die Galerie am Ende führte. Ihre ganze Arbeit, all ihre Forschungen, die Sammlung, tausend Antiquitäten aus ihrer Heimat. Es war zu viel, um es zu begreifen. Weil sie das alles noch nicht glauben konnte, wirkte die ganze Szenerie noch irrealer, wie ein schlechter Traum, aus dem sie jeden Augenblick aufwachen konnte.
Schließlich zog sie sich zurück in die Geborgenheit ihres Zimmers. Sie wandte sich ab von den Schreien und den blinkenden Lichtern, und in der Dunkelheit leuchteten plötzlich Libellen auf. Sie verstand einen Augenblick lang nicht, was sie da sah. Dann dämmerte es ihr. Die Stromversorgung funktionierte wieder.
In diesem Augenblick klingelte das Telefon auf ihrem Nachtkästchen. Sie erschrak.
Billie hob den Kopf vom Wollschal und spitzte die Ohren.
Safia eilte zum Telefon und hob ab. »Hallo?«
Die Stimme klang ernst und geschäftsmäßig. »Dr. al-Maaz?«
»J-ja?«
»Hier spricht Captain Hogan. Im Museum hat es einen Unfall gegeben.«
»Unfall?« Was da passiert war, war mit Sicherheit mehr als nur ein Unfall gewesen.
»Ja. Der Direktor des Museums hat angeordnet, dass ich Sie zu der Besprechung hinzurufe. Können Sie in der nächsten Stunde hier sein?«
»Ja, Captain. Ich komme sofort.«
»Gut. Ich hinterlasse bei den Sicherheitsabsperrungen Ihren Namen.« Es klickte im Hörer, der Captain hatte aufgelegt.
Safia sah sich in ihrem Schlafzimmer um. Billie zuckte mit dem Schwanz hin und her, offensichtlich war er verärgert über die dauernden nächtlichen Störungen. »Es dauert nicht lang«, murmelte sie, doch sie wusste nicht so recht, ob das auch stimmte.
Draußen heulten weiter die Sirenen.
Die Panik, die sie geweckt hatte, war noch nicht ganz verschwunden. Irgendetwas hatte ihre mühsam errungene Sicherheit ins Wanken gebracht. Vor vier Jahren war sie aus einer Welt geflohen, in der Frauen sich Rohrbomben vor die Brust schnallten. Sie hatte sich geflüchtet in die Sicherheit und Ordnung eines akademischen Lebens, hatte die Arbeit vor Ort mit der Arbeit am Schreibtisch vertauscht, Pickel und Schaufel durch Computer und Diagramme ersetzt. Sie hatte sich im Museum eine kleine Nische gegraben, eine, in der sie sich sicher fühlte. Sie hatte sich hier ein Zuhause geschaffen.
Dennoch hatte das Unheil sie eingeholt.
Ihre Hände zitterten. Sie musste eine mit der anderen umfassen, um einen Anfall niederzukämpfen. Sie wollte nichts lieber als wieder ins Bett zurück und sich den Schal über den Kopf ziehen.
Billie starrte sie an, in seinen Augen spiegelte sich das Licht der Lampe.
»Ich bin okay. Alles ist okay«, sagte Safia leise, eher zu sich selbst als zur Katze.
Beide waren sie nicht so recht überzeugt.
02:13 GMT (London)/09:13 EST (Ostküste Amerikas) Fort Meade, Maryland
Thomas Hardey hasste es, wenn man ihn beim Kreuzworträtsel der New York Times störte. Es war sein sonntagabendliches Ritual, zu dem auch ein ordentliches Glas vierzigjähriger Scotch und eine gute Zigarre gehörten. Im Kamin knisterte ein Feuer.
Er lehnte sich in seinem Ledersessel zurück, starrte das halb gelöste Rätsel an und klickte dabei immer wieder auf den Drücker seines Montblanc-Kugelschreibers.
Mit einem Stirnrunzeln konzentrierte er sich auf 19 senkrecht, ein Wort mit fünf Buchstaben. »19. Die Summe aller Männer.«
Während er über die Lösung nachdachte, klingelte das Telefon auf seinem Schreibtisch. Er seufzte und schob die Lesebrille von der Nasenspitze hoch zu seinem zurückweichenden Haaransatz. Wahrscheinlich war es nur eine der Freundinnen seiner Tochter, die wissen wollte, wie ihr Rendezvous am Wochenende gelaufen war.
Als er sich über den Apparat beugte, sah er, dass Leitung fünf blinkte, seine persönliche Leitung. Nur drei Personen kannten diese Nummer: der Präsident, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs und sein Stellvertreter in der NSA, der National Security Agency, dem amerikanischen Auslandsgeheimdienst.
Er legte die zusammengefaltete Zeitung in den Schoß und drückte auf den roten Knopf der Leitung. Nun würde ein ständig wechselnder algorithmischer Code jedes Gespräch verschlüsseln.
Er hob ab. »Hardey hier.«
»Director.«
Mit einem gewissen Argwohn setzte er sich auf. Er erkannte die Stimme des anderen nicht. Und er kannte die Stimmen der drei Personen, die seine Privatnummer hatten, so gut wie die seiner eigenen Familie. »Wer spricht?«
»Tony Rector. Es tut mir Leid, dass ich Sie so spät am Abend noch stören muss.«
Thomas blätterte in seinem mentalen Rolodex. Vice Admiral Anthony Rector. Er brachte den Namen mit fünf Buchstaben in Verbindung: DARPA. The Defense Advanced Research Projects Agency. Eine Abteilung des Außenministeriums, die sich mit den Forschungs- und Entwicklungsprojekten der Behörde beschäftigte. Sie hatten ein Motto: Sei immer der Erste. Wenn es um technologischen Fortschritt ging, durften die Vereinigten Staaten nie Zweite sein.
Niemals.
Eine unbestimmte Angst stieg in ihm auf. »Wie kann ich Ihnen helfen, Admiral?«
»Im British Museum in London hat es eine Explosion gegeben.« Rector erläuterte nun die Lage in allen Einzelheiten. Thomas sah auf die Uhr. Seit der Explosion waren weniger als fünfundvierzig Minuten vergangen. Er war beeindruckt von der Fähigkeit von Rectors Organisation, so viele Informationen in so kurzer Zeit zu sammeln.
Nachdem der Admiral geendet hatte, stellte Thomas die offensichtlichste Frage: »Und was interessiert DARPA an dieser Explosion?«
Rector antwortete ihm, und Thomas hatte den Eindruck, als würde es in seinem Büro um zehn Grad kälter werden. »Sind Sie sicher?«, hakte er nach.
»Ich habe bereits ein Team vor Ort, das genau dieser Frage nachgeht. Aber ich brauche die Kooperation des britischen MI5 … oder noch besser …«
Die Alternative hing in der Luft, blieb jedoch trotz der sicheren Leitung unausgesprochen.
Jetzt verstand Thomas diesen ungewöhnlichen Anruf. MI5 war das britische Äquivalent seiner eigenen Organisation. Rector wollte, dass er ein Tarnmanöver startete, sodass ein DARPA-Team rein- und wieder rausflitzen konnte, bevor irgendjemand auch nur einen Verdacht in Bezug auf die Entdeckung hegte. Und das schloss auch den britischen Geheimdienst ein.
»Verstehe«, sagte Thomas schließlich. Sei immer der Erste. Er hoffte, dass sie das auch in diesem Fall schafften. »Haben Sie ein Team bereit?«
»Morgen früh sind sie so weit.«
Da Rector nicht weiter darauf einging, wusste Thomas, wer sich um die Sache kümmern würde. Er zeichnete einen griechischen Buchstaben auf den Rand seiner Zeitung.
Σ
»Ich mache Ihnen den Weg frei«, sagte er.
»Sehr gut.« Und damit war die Leitung tot.
Während Thomas auflegte, überlegte er bereits, was zu tun war. Es musste alles sehr schnell gehen. Er starrte auf das halb fertige Kreuzworträtsel hinunter. 19 senkrecht.
Ein Wort mit fünf Buchstaben für die Summe aller Männer.
Wie passend.
Er nahm den Stift zur Hand und schrieb die Antwort in Blockbuchstaben in die Kästchen.
SIGMA.
02:22 GMT London, England
Safia stand vor der Absperrung, einem gelb-schwarzen Holzbock. Sie hatte die Arme verschränkt, war beunruhigt und fror. Rauch erfüllte die Luft. Ein Polizist hinter der Absperrung hatte ihre Brieftasche in der Hand und verglich das Foto ihres Ausweises mit der Frau, die vor ihm stand.
Sie wusste, dass es schwer war, eine Übereinstimmung festzustellen. Das Foto der Museumskennkarte in der Hand des Polizisten zeigte eine beflissene dreißigjährige Frau mit Milchkaffeehaut und pechschwarzen, zu einem praktischen Zopf geflochtenen Haaren und grünen Augen hinter einer schwarzen Lesebrille. Doch vor dem jungen Beamten stand eine vor Nässe triefende, aufgelöste Frau mit Haaren, die ihr in langen Strähnen auf dem Gesicht klebten. Ihr Blick war unstet und verwirrt, auf etwas hinter der Absperrung, hinter der Hektik der Einsatzteams mit seinen Gerätschaften gerichtet.
Fernsehteams sprenkelten die Umgebung, beleuchtet von den Scheinwerfern ihrer Kameras. Einige Übertragungswagen standen halb auf den Bürgersteigen. Außerdem entdeckte sie ein paar britische Militärfahrzeuge zwischen den Notfallteams, zusammen mit bewaffnetem Personal.
Die Möglichkeit eines Terrorangriffs war nicht von der Hand zu weisen. Gerüchte in diese Richtung hatte sie in der Menge der Schaulustigen und von einem Reporter gehört, dem sie ausweichen musste, um zu der Absperrung zu kommen. Und nicht wenige warfen argwöhnische Blicke in ihre Richtung, die einzige Araberin auf der Straße. Sie hatte direkte persönliche Erfahrungen mit Terrorismus, aber nicht in der Art, wie diese Leute vermuteten. Und vielleicht verstand sie die Reaktionen um sie herum sogar falsch. Eine Form von Paranoia, die so genannte Hypernervosität, war häufig die Folge einer Panikattacke.
Safia bewegte sich weiter durch die Menge und versuchte dabei, ruhig zu atmen und sich auf den Grund ihres Hierseins zu konzentrieren. Sie bedauerte, dass sie ihren Schirm vergessen hatte. Nach dem Anruf hatte sie ihre Wohnung sofort verlassen, sich zuvor nur schnell eine Khakihose und eine weiße Bluse mit Blumenmuster angezogen. Sie hatte sich zwar einen knielangen Burberry-Mantel übergeworfen, in ihrer Hast aber den passenden Regenschirm im Ständer neben der Tür vergessen. Erst als sie im Erdgeschoss ihres Hauses war und in den Regen hinausstürzte, erkannte sie ihren Fehler. Die Nervosität hielt sie davon ab, noch einmal in den dritten Stock zu steigen und den Schirm zu holen.
Sie musste einfach erfahren, was im Museum passiert war. Die letzten zehn Jahre hatte sie dem Aufbau der Sammlung gewidmet, und seit vier Jahren betrieb sie ihre Forschungsprojekte aus dem Museum heraus. Wie viel wurde zerstört? Was konnte man noch retten?
Inzwischen regnete es wieder heftiger, aber wenigstens war der Nachthimmel nicht mehr so zornig. Als sie den provisorischen Kontrollpunkt erreichte, der den Zugang versperrte, war sie nass bis auf die Haut.
Sie zitterte, als der Posten ihr die Kennkarte befriedigt zurückgab.
»Sie können durchgehen. Inspector Samuelson erwartet Sie.«
Ein zweiter Polizist brachte sie zum Südeingang des Museums. Sie starrte an der säulengeschmückten Fassade hoch, die solide wie ein Banktresor wirkte und eine Dauerhaftigkeit verströmte, die scheinbar nicht in Zweifel zu ziehen war.
Bis zu dieser Nacht …
Man führte sie durch den Eingang und einige Treppen hinunter. Sie durchschritten ein paar Türen mit der Aufschrift NUR FÜR MUSEUMSPERSONAL. Safia wusste, wohin man sie brachte. In den unterirdischen Sicherheitsbereich.
Ein bewaffneter Posten stand an der Tür Wache. Ganz offensichtlich erwartete er sie. Er öffnete die Tür.
Ihr Begleiter gab sie an einen Kollegen weiter: ein Schwarzer in Zivilkleidung, einem unauffälligen blauen Anzug. Er war einige Zentimeter größer als Safia, und seine Haare waren völlig grau. Sein Gesicht sah aus wie abgenutztes Leder. Auf seinen Wangen bemerkte sie einen grauen Stoppelschatten; er war unrasiert und offensichtlich ebenfalls aus dem Bett geholt worden.
Er streckte ihr eine muskulöse Hand hin. »Inspector Geoffrey Samuelson«, sagte er mit einer Stimme, so fest wie sein Händedruck. »Vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind.«
Sie nickte nur, zum Reden war sie zu nervös.
»Wenn Sie mir folgen wollen, Dr. al-Maaz, wir brauchen Ihre Mithilfe bei der Ermittlung der Ursache der Explosion.«
»Meine Hilfe?«, brachte sie mit Mühe hervor. Sie kamen an einem Aufenthaltsraum vorbei, der gesteckt voll war mit Sicherheitspersonal. Offensichtlich hatte man die gesamte Mannschaft zusammengerufen, alle Schichten. Sie kannte einige der Männer und Frauen, aber sie starrten sie jetzt an, als wäre sie eine vollkommen Fremde. Als sie vorbeiging, verstummten ihre Gespräche. Sicherlich wussten sie, dass man sie gerufen hatte, aber anscheinend kannten sie den Grund genauso wenig wie sie selbst. Dennoch lauerte hinter ihrem Verstummen offensichtlich Argwohn.
Safia straffte den Rücken noch ein wenig mehr, ihre Verärgerung war greifbar. Das waren ihre Mitarbeiter und Kollegen. Allerdings kannten sie alle auch ihre Vergangenheit nur zu genau.
Sie ließ die Schultern wieder sinken, als der Inspector sie den Gang entlang in den hintersten Raum führte. Sie wusste, dass dort das »Nest« untergebracht war, wie das Personal es scherzhaft nannte, ein ovaler Raum, dessen Wände völlig mit Videoüberwachungsmonitoren bedeckt waren. Als sie den Raum betrat, war er beinahe verlassen.
Sie entdeckte den Sicherheitschef, Ryan Fleming, einen kleinen, aber kräftigen Mann mittleren Alters. Unverkennbar machten ihn sein völlig haarloser Schädel und seine Hakennase; diese beiden Attribute hatten ihm auch seinen Spitznamen »Kahler Adler« eingebracht. Er stand neben einem schlaksigen Mann in einer frisch gebügelten militärischen Uniform, zu der auch eine Pistole im Halfter gehörte. Die beiden beugten sich über einen Techniker, der vor einer Reihe von Monitoren saß. Als sie eintrat, drehte die Gruppe sich kurz zu ihr um.
»Dr. Safia al-Maaz, Kuratorin der Kensington Gallery«, stellte Fleming sie vor. Er richtete sich auf und winkte sie zu der Gruppe.
Fleming war schon Angestellter des Museums gewesen, lange bevor Safia ihren Posten hier angetreten hatte. Damals noch Wachmann, hatte er sich bis zum Sicherheitschef hochgearbeitet. Vor vier Jahren hatte er den Diebstahl einer präislamischen Skulptur vereitelt. Allein seiner Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit hatte er seine gegenwärtige Stellung zu verdanken. Die Kensingtons wussten, wie sie jene belohnen mussten, die ihnen gute Dienste geleistet hatten. Seit dieser Zeit kümmerte er sich mit besonderer Fürsorge um Safia und ihre Galerie.
Sie ging zu der Gruppe vor den Monitoren, und Inspector Samuelson folgte ihr. Fleming legte ihr die Hand auf die Schulter, und in seinen Augen lag Trauer. »Es tut mir so Leid. Ihre Galerie, Ihre Arbeit …«
»Was ist alles zerstört?«
Fleming sah blass aus. Er deutete nur auf einen der Monitore. Sie beugte sich darüber. Es waren Live-Bilder. In Schwarzweiß war der Mittelgang des Nordflügels zu sehen. Rauch waberte. Männer in Schutzanzügen arbeiteten überall im Flügel. Eine Gruppe stand vor dem Sicherheitstor, das in die Kensington Gallery führte. Sie starrten zu einer Gestalt hoch, die an das Gitter gefesselt zu sein schien, eine dürre, skelettierte Form, wie eine ausgezehrte Vogelscheuche.
Fleming schüttelte den Kopf. »Wir lassen gleich den Leichenbeschauer hinein, damit er die Überreste identifizieren kann, aber wir sind sicher, dass es Harry Masterson ist, einer meiner Männer.
Das Knochengerüst rauchte noch. War das einmal ein Mann gewesen? Safia hatte das Gefühl, der Boden unter ihr würde wegsacken, und sie taumelte einen Schritt zurück. Fleming stützte sie. Ein Feuer, das so heiß war, dass es einem Menschen das Fleisch von den Knochen brannte, überstieg ihre Vorstellungskraft.
»Ich verstehe nicht«, murmelte sie. »Was ist hier passiert?«
Der Mann in militärischem Blau antwortete: »Genau bei dieser Frage hoffen wir, dass Sie uns weiterhelfen können.« Er wandte sich an den Videotechniker. »Spulen Sie zurück zu null einhundert.«
Der Techniker nickte.
Der Soldat wandte sich wieder Safia zu, während sein Befehl ausgeführt wurde. Sein Gesicht wirkte hart, abweisend. »Ich bin Commander Randolph, Bevollmächtigter der Antiterrorabteilung des Verteidigungsministeriums.«
»Antiterror?« Safia starrte die anderen an. »War das ein Bombenanschlag?«
»Das müssen wir erst noch herausfinden, Ma’am«, sagte der Commander.
Der Techniker meldete sich. »Alles bereit, Sir.«
Randolph winkte sie zum Monitor. »Wir möchten, dass Sie sich das anschauen, aber was Sie jetzt gleich sehen werden, unterliegt der Geheimhaltung. Verstehen Sie das?«
Sie tat es nicht, nickte aber trotzdem.
»Abspielen«, befahl Randolph.
Auf dem Monitor war der hintere Saal der Kensington Gallery zu sehen. Alles schien in Ordnung zu sein, allerdings war es dunkel, nur die Notbeleuchtung brannte.
»Das wurde kurz nach ein Uhr aufgenommen«, berichtete der Commander.
Safia sah nun, wie ein neues Licht von einem der Nachbarsäle hereinschwebte. Zunächst sah es aus, als wäre jemand eingetreten, der eine Lampe in der Hand hielt. Doch schon bald wurde klar, dass das Licht sich selbstständig bewegte. »Was ist das?«, fragte sie.
Der Techniker antwortete: »Wir haben uns das Material mit verschiedenen Filtern angesehen. Es scheint ein Phänomen zu sein, das man Kugelblitz nennt. Eine frei schwebende Plasmakugel, die von dem Gewitter ausgestoßen wurde. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass eins dieser verdammten Dinger auf Film gebannt wurde.«
Safia hatte von solchen Naturschauspielen schon gehört. Kugeln aus geladener Luft, die horizontal über den Boden schwebten. Sie zeigten sich auf weiten Ebenen, in Häusern, an Bord von Flugzeugen, ja sogar in U-Booten. Aber solche Phänomene richteten so gut wie nie Schaden an. Sie warf noch einen Blick auf den Live-Monitor mit dem Bild des qualmenden Leichenhauses. Das konnte doch unmöglich die Ursache für diese Explosion gewesen sein.
Während sie noch darüber nachdachte, tauchte auf dem Bildschirm eine Gestalt auf, ein Wachmann.
»Harry Masterson«, sagte Fleming.
Safia stockte der Atem. Wenn Fleming Recht hatte, war das der Mann, dessen Knochen auf dem anderen Monitor rauchten. Sie wollte die Augen schließen, konnte es aber nicht.
Der Wachmann folgte dem Schein des Kugelblitzes. Er schien ähnlich verwirrt zu sein wie diejenigen, die sich jetzt mit ihr in diesem Raum befanden. Er hielt sich das Funkgerät an den Mund, wohl um seine Entdeckung zu melden, doch das Videoband hatte keine Tonspur.
Dann tauchte der Kugelblitz in eine der Vitrinen, in der sich eine Eisenfigur befand. Er senkte sich auf die Figur und verlöschte plötzlich. Sofia zuckte zusammen, aber nichts passierte.
Der Wachmann sprach weiter in sein Funkgerät. Er drehte sich in dem Moment um, als die Vitrine zerbarst. Einen Augenblick später war eine zweite Explosion als weißer Lichtblitz zu sehen, dann wurde der Monitor schwarz.
»Stoppen Sie, und spulen Sie ein paar Sekunden zurück«, befahl Commander Randolph.
Die Aufzeichnung stoppte und spielte rückwärts. Aus dem Blitz tauchte der Saal wieder auf, dann setzte die Vitrine sich um die Eisenfigur herum wieder zusammen.
»Stoppen Sie hier.«
Auf dem Monitor war nun ein leicht zitterndes Standbild zu sehen. Die Eisenfigur war in ihrer Glasvitrine klar zu erkennen. Genau genommen sogar zu klar. Sie schien wie aus sich selbst heraus zu leuchten.
»Was zum Teufel ist das?«, fragte der Commander.
Safia starrte das uralte Artefakt an. Jetzt begriff sie, warum man sie gerufen hatte. Keiner hier im Raum hatte auch nur die geringste Ahnung, was passiert war. Das alles ergab absolut keinen Sinn.
»Ist das eine Skulptur?«, fragte der Commander. »Wie lang ist sie schon hier?«
Safia wusste, was er dachte, hörte die kaum verhüllte Anschuldigung. Hatte irgendjemand eine als Skulptur getarnte Bombe ins Museum geschmuggelt? Und falls das so war, wer würde am ehesten als Kollaborateur bei einem solchen Anschlag infrage kommen? Jemand, der schon einmal in eine Explosion verwickelt gewesen war.
Sie schüttelte den Kopf, als Reaktion auf die Frage wie auf die Anschuldigung. »Es … es ist keine Skulptur.«
»Was ist es dann?«
»Die Eisenfigur ist das Fragment eines Meteoriten … der am Ende des neunzehnten Jahrhunderts in der omanischen Wüste gefunden wurde.«
Safia wusste, dass die Geschichte des Artefakts viel weiter zurückreichte. Seit Jahrhunderten war in arabischen Mythen von einer versunkenen Stadt die Rede, deren Eingang von einem eisernen Kamel bewacht wurde. Die Reichtümer dieser Stadt überstiegen angeblich jede Vorstellung. So sollten Unmengen schwarzer Perlen vor dem Eingang verstreut liegen wie Unrat. Dann brachte im neunzehnten Jahrhundert ein Beduinenführer einen britischen Forschungsreisenden an diesen Ort, aber er fand dort keine versunkene Stadt. Was er entdeckte, war nichts als das Bruchstück eines Meteoriten, das halb im Sand vergraben war und vom Umriss her ein wenig an ein kniendes Kamel erinnerte. Auch die schwarzen Perlen erwiesen sich als Kugeln aus Schlackenglas, die beim Aufprall des superheißen Meteoriten auf den Wüstenboden entstanden waren.
»Dieser wie ein Kamel geformte Meteorit«, fuhr Safia fort, »gehört seit der Gründung des British Museum zu seinem Bestand … doch er war im Archiv versteckt, bis ich ihn im Katalog entdeckte und in diese Sammlung integrierte.«
Detective Samuelson brach das Schweigen. »Wann war das?«
»Vor zwei Jahren.«
»Dann war er also schon eine ganze Weile dort«, sagte der Detective spitz und mit einem schnellen Blick zum Commander, als würde diese Aussage einen früheren Disput beilegen.
»Ein Meteorit?«, murmelte der Commander mit einem Kopfschütteln. Ganz offensichtlich war er enttäuscht darüber, dass seine Verschwörungstheorie sich nicht bewahrheitete. »Das ergibt doch keinen Sinn.«
Unruhe an der Tür ließ alle im Raum den Kopf drehen. Safia sah, dass der Direktor des Museums, Edgar Tyson, sich Zugang zum Sicherheitsraum verschaffte. Der normalerweise elegante Mann trug einen zerknitterten Anzug, der zu seinem besorgten Gesichtsausdruck passte. Er zupfte an seinem kleinen weißen Kinnbart. Erst jetzt wunderte Safia sich über seine auffällige Abwesenheit bis zu diesem Zeitpunkt. Das Museum war Lebensunterhalt und Lebensinhalt dieses Mannes.
Doch der Grund für seine Abwesenheit wurde schnell klar. Genau genommen folgte sie ihm auf den Fersen. Die Frau rauschte in den Raum, und beinahe meinte man, ihre Präsenz würde ihrer Gestalt vorauseilen, wie die plötzlich steigende Spannung vor einem Gewitter. Sie war sehr groß, eine ganze Handspanne über einsachtzig, und sie trug einen langen Tartan-Mantel, der jetzt vor Nässe triefte, doch ihre schulterlangen, sandblonden Haare waren trocken und zu weichen Locken geföhnt, die wie in einer leichten Brise zu schwingen schienen. Offensichtlich hatte sie ihren Regenschirm nicht vergessen.
Commander Randolph nahm Haltung an, trat vor, und seine Stimme klang plötzlich respektvoll. »Lady Kensington.«
Die Frau ignorierte ihn und suchte den Raum ab, bis sie Safia entdeckt hatte. Erleichterung blitzte in ihrem Gesicht auf. »Saffie … Gott sei Dank!« Sie eilte zu ihr, drückte sie fest an sich und flüsterte ihr ins Ohr. »Als ich es erfahren habe … du arbeitest doch so oft bis spät in die Nacht. Und telefonisch konnte ich dich nicht erreichen …«
Safia drückte die Frau nun ebenfalls und spürte das Zittern in ihren Schultern. Die beiden kannten sich von Kindesbeinen an, standen sich näher als zwei Schwestern. »Mir geht’s gut, Kara«, murmelte sie an der Schulter der anderen.
Sie war überrascht von der Tiefe dieser echten Angst in der ansonsten so starken Frau. Eine solche Zuneigung hatte sie von ihr schon lange nicht mehr erfahren, nicht mehr seit ihrer Jugend, nicht mehr seit dem Tod von Karas Vater.
Kara zitterte. »Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich dich verloren hätte.« Sie drückte Safia noch fester, sowohl zum Trost wie aus eigenem Bedürfnis.
Tränen stiegen Safia in die Augen. Sie erinnerte sich an eine ähnliche Umarmung, ähnliche Worte. Ich will dich nicht verlieren.
Als Safia vier war, starb ihre Mutter bei einem Busunfall. Da auch ihr Vater nicht mehr lebte, brachte man Safia in ein Waisenhaus, einen schrecklichen Ort für ein Mädchen gemischter Abstammung. Ein Jahr später nahm der Kensington-Haushalt Safia als Spielkameradin für Kara auf, und sie erhielt ihr eigenes Zimmer. An diesen Tag konnte sie sich kaum noch erinnern. Ein großer Mann war ins Waisenhaus gekommen und hatte sie abgeholt.
Es war Reginald Kensington gewesen, Karas Vater.
Wegen der Ähnlichkeiten im Alter und in ihrem ungezügelten Wesen wurden Kara und Safia schnell Freundinnen … nachts teilten sie Geheimnisse, sie spielten zwischen Datteln und Palmen, schlichen sich ins Kino, tuschelten unter der Bettdecke über ihre Geheimnisse. Es war eine wunderbare Zeit gewesen, ein endloser, süßer Sommer.
Dann, als sie zehn Jahre alt war, die niederschmetternde Nachricht: Lord Kensington kündigte an, dass Kara nach England reisen würde, um dort zwei Jahre lang zu studieren. Safia war bestürzt und hatte den Esstisch verlassen, ohne sich zu entschuldigen. Sie war in ihr Zimmer gerannt, voller Panik und verzweifelt darüber, dass man sie ins Waisenhaus zurückschicken würde wie ein Spielzeug, das man wieder in eine Kiste steckte. Aber Kara war ihr gefolgt. Ich will dich nicht verlieren, hatte sie unter Tränen und Umarmungen versprochen. Ich bringe Papa dazu, dass er dich mit mir kommen lässt.
Und Kara hatte Wort gehalten.
Für diese zwei Jahre also ging Safia mit Kara nach England. Sie studierten zusammen, wie Schwestern, wie beste Freundinnen. Als sie nach Oman zurückkehrten, waren sie unzertrennlich. Zusammen schlossen sie ihre Schule in Maskat ab. Alles schien wunderbar bis zu dem Tag, als Kara sonnenverbrannt und rasend von einem Geburtstags-Jagdausflug zurückkam.
Ihr Vater war nicht mit ihr zurückgekehrt.
In einem Schlundloch umgekommen, lautete die offizielle Version, aber Reginald Kensingtons Leiche wurde nie gefunden.
Seit diesem Tag war Kara nicht mehr dieselbe. Noch immer suchte sie Safias Nähe, aber es war mehr die Sehnsucht nach dem Vertrauten als echte Freundschaft. Kara vertiefte sich in den Abschluss ihrer Ausbildung und die Übernahme des väterlichen Konglomerats aus Firmen und Unternehmungen. Mit neunzehn machte sie in Oxford ihren Abschluss.
Die junge Frau erwies sich als finanzielles Genie und verdreifachte noch während ihres Studiums das Nettovermögen ihres Vaters. Kensington Wells wuchs immer weiter und betätigte sich in neuen Geschäftsbereichen: Computertechnologie, Entsalzungspatente, Fernsehen. Dennoch vernachlässigte Kara nie den Ursprung des Familienreichtums: das Öl. Erst im letzten Jahr übertraf Kensington die Halliburton Corporation, was die lukrativsten Kontrakte anging.
Und wie die Kensington’schen Ölunternehmungen wurde auch Safia nicht vernachlässigt. Kara bezahlte weiter für ihre Ausbildung, darunter auch sechs Jahre in Oxford, wo Safia in Archäologie promovierte. Nach dem Abschluss blieb sie auf der Gehaltsliste von Kensington Wells, Inc. Schließlich wurde sie die Leiterin von Karas Lieblingsprojekt hier im Museum, einer Sammlung von Antiquitäten von der Arabischen Halbinsel, einer Sammlung, die von Reginald Kensington ins Leben gerufen worden war. Und wie sein Konzern florierte auch dieses Projekt unter Karas Leitung und wurde zur größten Einzelsammlung auf der ganzen Welt. Vor zwei Monaten hatte die saudi-arabische Herrscherfamilie versucht, die Sammlung zu kaufen und sie auf arabischen Boden zurückzuholen, ein Geschäft, bei dem es Gerüchten zufolge um hunderte von Millionen ging.
Kara hatte abgelehnt. Die Sammlung bedeutete ihr mehr als Geld. Sie war ein Andenken an ihren Vater. Auch wenn seine Leiche nie gefunden wurde, war doch hier sein Grab, in diesem abgelegenen Flügel des British Museum, umgeben von all dem Reichtum und der Geschichte Arabiens.
Safia starrte über die Schulter ihrer Freundin zu dem Live-Monitor, zu den schwelenden Ruinen ihrer harten Arbeit. Sie konnte sich vorstellen, was dieser Verlust für Kara bedeuten würde. Es war für sie wohl so, als hätte man das Grab ihres Vaters geschändet.
»Kara«, begann Safia und versuchte den Schlag abzumildern, den sie nun gleich austeilen musste. Sie wollte, dass Kara es von jemandem hörte, der ihre Leidenschaft teilte. »Die Galerie … gibt es nicht mehr.«
»Ich weiß. Edgar hat es mir bereits gesagt.« Karas Stimme hatte ihre Zögerlichkeit verloren. Sie löste sich aus der Umarmung, als käme sie sich plötzlich töricht vor, und schaute sich in der Runde um. Der vertraute herrische Ton war nun wieder zu hören. »Was ist passiert? Wer ist dafür verantwortlich?«
Dass die Sammlung so kurz nach der Zurückweisung des saudischen Angebots verloren ging, hatte auch Karas Argwohn geweckt.
Ohne Zögern wurde das Band für Lady Kensington noch einmal abgespielt. Safia erinnerte sich, dass man sie zur Geheimhaltung in Bezug auf das Gezeigte verdonnert hatte. Bei Kara wurde diese Ermahnung nicht ausgesprochen. Reichtum brachte Privilegien.
Safia achtete nicht mehr auf die Wiederholung. Stattdessen betrachtete sie Kara, sie hatte Angst, dass sie das zu sehr mitnehmen würde. Aus dem Augenwinkel heraus sah sie den letzten Blitz der Explosion, dann wurde der Bildschirm schwarz. Während der ganzen Vorführung blieb Karas Ausdruck reglos, ein Marmorrelief der Konzentration, eine in Gedanken versunkene Athene.
Am Ende aber schloss Kara langsam die Augen. Nicht vor Schock oder Entsetzen – Safia kannte Karas Stimmungen nur zu gut –, sondern aus tiefer Erleichterung. Die Lippen ihrer Freundin bewegten sich in einem atemlosen Flüstern, ein einziges Wort, das nur an Safias Ohren drang.
»Endlich …«
2
Fuchsjagd
14. November, 07:04 Est Ledyard, Connecticut
Geduld war der Schlüssel zu einer erfolgreichen Jagd.
Painter Crowe stand auf dem Land seiner Geburt, dem Land, das der Stamm seines Vaters Mashantucket nannte, das »stark bewaldete Land«. Doch wo Painter wartete, gab es keine Bäume, kein Vogelgezwitscher, keinen Windhauch an den Wangen. Hier gab es das Klackern von Spielautomaten, das Klimpern von Münzen, den Gestank von Tabakrauch und das ewige Recyceln von lebloser Luft.
Foxwoods Resort and Casino war der größte Glücksspielkomplex auf der ganzen Welt, er übertraf alles, was man in Las Vegas oder sogar in Monte Carlo fand. Am Rand des unscheinbaren Dörfchens Ledyard, Connecticut, gelegen, erhob sich die hoch aufragende Anlage dramatisch aus den dichten Wäldern des Mashantucket-Reservats. Neben der Glücksspielanlage mit ihren sechstausend einarmigen Banditen und den hunderten von Spieltischen beherbergte der Komplex auch noch drei Luxushotels. Die gesamte Anlage gehörte dem Pequot-Stamm, den »Fuchsmenschen«, die seit zehntausend Jahren in den heimischen Wäldern jagten.
Doch im Augenblick ging die Jagd nicht auf Hirsch oder Fuchs.
Painters Ziel war ein chinesischer Computerspezialist: Xin Zhang.
Zhang, besser bekannt unter seinem Decknamen Kaos, war ein Hacker und Codeknacker von erstaunlichem Talent. Nachdem Painter sein Dossier gelesen hatte, betrachtete er den schlanken Mann im Ralph-Lauren-Anzug mit Respekt. In den letzten drei Jahren hatte er eine erfolgreiche Spionagekampagne auf amerikanischem Boden inszeniert. Seine letzte Beute: Plasmawaffen-Technologie aus Los Alamos.
Endlich erhob sich Painters Zielperson vom Pai-Gow-Tisch.
»Wollen Sie Ihre Chips in größere einwechseln, Dr. Zhang?«, fragte der Pit Boss, der am Kopfende des Tisches stand wie ein Kapitän im Bug seines Schiffes und das Spiel mit Argusaugen überwachte. Um sieben Uhr morgens war nur noch dieser einzelne Spieler da … und seine Leibwächter.
Diese Einsamkeit verlangte von Painter, dass er sein Opfer aus sicherer Entfernung überwachte. Es durfte kein Verdacht aufkommen. Vor allem nicht so kurz vor dem Ende.
Zhang schob den Stapel schwarzer Chips der Geberin zu, einer Frau mit gelangweiltem Blick. Während sie den Gewinn zu Türmchen stapelte, musterte Painter sein Opfer.
Zhang war ein Musterbild chinesischer Unerforschlichkeit. Er hatte ein Pokerface, das absolut nichts verriet, in dem nicht einmal das kleinste Zucken darauf hindeutete, ob er ein gutes oder ein schlechtes Blatt hatte. Er spielte einfach sein Spiel.
Und das tat er auch jetzt.
Vom Aussehen des Mannes her würde niemand auf die Idee kommen, dass er ein Meisterverbrecher war, der in fünfzehn Ländern gesucht wurde. Gekleidet war er wie ein typischer westlicher Geschäftsmann: ein perfekt sitzender Maßanzug mit unauffälligen Nadelstreifen, eine Seidenkrawatte und eine Platin-Rolex. Dennoch verströmte er eine gewisse ästhetische Strenge. Seine schwarzen Haare waren über den Ohren und im Nacken rasiert, sodass er, ein wenig wie ein Mönch, nur oben auf dem Kopf eine drahtige Haarkrone trug. Auf der Nase hatte er eine kleine Brille mit runden, leicht blau getönten Gläsern, was ihm einen gelehrten Ausdruck verlieh.
Schließlich bewegte die Geberin ihre Hände über den Chipstapeln hin und her und zeigte so den in der schwarz verspiegelten Decke versteckten Überwachungskameras ihre leeren Finger und Handflächen.
»Genau fünfzigtausend Dollar«, sagte sie zum Abschluss.
Der Pit Boss nickte. Die Geberin zählte den Betrag in Tausend-Dollar-Chips ab. »Weiterhin viel Glück, Sir«, sagte der Pit Boss.
Ohne auch nur ein Nicken verließ Zhang mit seinen beiden Leibwächtern den Tisch. Er hatte die ganze Nacht gespielt. Der Morgen dämmerte bereits. In drei Stunden würde das CyberCrime Forum die Arbeit wieder aufnehmen. Die Konferenz befasste sich mit den neuesten Entwicklungen in den Bereichen Identitätsdiebstahl und Infrastrukturschutz sowie unzähligen anderen Sicherheitsaspekten.
In zwei Stunden würde ein von Hewlett Packard veranstaltetes Frühstückssymposium beginnen. Zhang wollte den Transfer während dieses Treffens über die Bühne gehen lassen. Sein amerikanischer Kontakt war noch unbekannt. Er war eins der wichtigsten Ziele dieser Operation. Neben der Sicherung der Waffendaten lautete der Auftrag, Zhangs Kontakt in den Staaten auffliegen zu lassen, jemanden mit Verbindungen zu einem zwielichtigen Netzwerk, das mit militärischen Geheimnissen und Technologien handelte.
Es war eine Mission, die nicht fehlschlagen durfte.
Painter folgte der Gruppe. Seine Vorgesetzten bei DARPA hatten ihn persönlich für diesen Auftrag ausgesucht, zum Teil wegen seines Fachwissens in Mikroüberwachung und Computertechnologie, vor allem jedoch, weil er in Foxwoods nicht auffiel.
Painter war zwar nur ein Halbblut, hatte jedoch von seinem Vater genügend Merkmale geerbt, um als Pequot-Indianer durchzugehen. Allerdings waren ein paar Sitzungen in einem Sonnenstudio nötig gewesen, um seiner Haut die richtige Tönung zu geben, und braune Kontaktlinsen, um die blauen Augen seiner Mutter zu verbergen. Doch danach sah er mit seinen schulterlangen, rabenschwarzen Haaren, die er zu einem Pferdeschwanz gebündelt hatte, wirklich aus wie sein Vater. Um seine Tarnung zu perfektionieren, trug er einen Casino-Anzug mit dem Symbol des Pequot-Stammes auf der Brusttasche, ein Baum auf einer Kuppe vor einem klaren Himmel. Wer schaute schon hinter einen Anzug?
Painter folgte Zhang mit äußerster Vorsicht. Nie richtete er den Blick direkt auf die Gruppe. Er beobachtete sie aus den Augenwinkeln heraus und nutzte jede natürliche Deckung, die sich ihm bot. Er verfolgte sein Opfer durch den Neonwald der blinkenden Maschinen und die weiten Lichtungen der grünen Tische. Er wahrte Distanz und wechselte Tempo und Richtung.
In seinem Ohrhörer summte Mandarin. Zhangs Stimme. Aufgefangen von dem Mikrotransceiver. Zhang kehrte in seine Suite zurück.
Painter berührte sein Kehlkopfmikrofon und flüsterte ins Funkgerät: »Sanchez, wie ist der Empfang?«
»Laut und deutlich, Commander.«
Seine Kollegin bei dieser Mission, Cassandra Sanchez, saß in einer Suite direkt gegenüber der von Zhang und kontrollierte die Überwachungstechnik.
»Wie hält sich die Subkutane?«, fragte er sie.
»Er sollte sich besser bald an seinen Computer setzen. Der Wanze geht langsam der Saft aus.«
Painter runzelte die Stirn. Die »Wanze« war Zhang gestern während einer Massage eingepflanzt worden. Sanchez’ Latino-Gesichtszüge waren so dunkel, dass sie als Indianerin durchging. Sie hatte den subkutanen Transceiver während einer Tiefengewebsmassage gestern Abend implantiert, und da sie dabei ihre Finger tief ins Fleisch grub, hatte er den kurzen Stich nicht gespürt. Den winzigen Einstich hatte sie mit einem Tropfen medizinischen Klebers bedeckt. Am Ende der Massage war er ausgetrocknet und hatte die Wunde versiegelt. Der digitale Mikrotransceiver hatte eine Lebensdauer von nur zwölf Stunden.
»Wie viel Zeit haben wir noch?«
»Günstigste Schätzung … achtzehn Minuten.«
»Verdammt.«
Painter konzentrierte sich nun wieder ganz auf die Unterhaltung seiner Zielperson.
Der Mann sprach leise, was er sagte, war nur für seine Leibwächter bestimmt. Painter, der flüssig Mandarin sprach, hörte aufmerksam zu. Er hoffte, Zhang würde irgendeinen Hinweis auf den Zeitpunkt geben, wann er auf die Plasmawaffendatei zugreifen wollte. Doch er wurde enttäuscht.
»Das Mädchen soll bereit sein, wenn ich geduscht habe«, sagte Zhang.
Painter ballte eine Faust. Das »Mädchen« war dreizehn, eine Sklavin aus Nordkorea. Seine Tochter, hatte Zhang jenen erklärt, die überhaupt zu fragen wagten. Würde das stimmen, müsste man der langen Liste der Verbrechen, die man Zhang vorwarf, auch noch Inzest hinzufügen.
Bei der Verfolgung der Gruppe ging Painter nun um eine Geldwechselkabine herum und dann an einer langen Reihe von Automaten entlang, immer parallel zu seiner Zielperson. Aus einem einarmigen Banditen klimperte ein Jackpot. Der Gewinner, ein Mann mittleren Alters in einem Jogginganzug, grinste und sah sich nach jemandem um, dem er von seinem Glück erzählen konnte. Doch da war nur Painter.
»Ich habe gewonnen«, rief er triumphierend, die Augen rot gerändert nach der durchspielten Nacht.
Painter nickte. »Weiterhin viel Glück, Sir«, erwiderte er, so wie es zuvor der Pit Boss getan hatte, und ging an dem Mann vorbei. Es gab hier keine wirklichen Gewinner – bis auf das Casino. Die Spielautomaten allein hatten im vergangenen Jahr netto achthundert Millionen Dollar eingebracht. Wie es aussah, hatte es der Pequot-Stamm, der in den Achtzigern noch mit Sand und Kies gehandelt hatte, weit gebracht.
Leider hatte Painters Vater von diesem Boom nichts mitbekommen, da er das Reservat schon Anfang der Achtziger verlassen hatte, um in New York sein Glück zu suchen. Dort lernte er auch Painters Mutter kennen, eine feurige Italienerin, die nach sieben Jahren Ehe und der Geburt ihres Sohnes ihren Ehemann schließlich erstach. Da seine Mutter danach in der Todeszelle saß, war Painter in einer Reihe von Pflegefamilien aufgewachsen, wo er schnell lernte, dass es am besten war, still zu sein und sich unsichtbar zu machen.
Das war sein erstes Training in Verstohlenheit gewesen, aber nicht sein letztes.
Zhangs Gruppe betrat nun die Aufzugshalle des Grand Pequot Tower und zeigte dem Wachmann den Schlüssel zu ihrer Suite.
Painter ging schnell am Eingang vorbei. Versteckt unter seinem Casino-Sakko, trug er in einem Halfter im Rücken eine Glock 9 mm. Er musste sich zusammennehmen, um sie nicht zu ziehen und Zhang, wie bei einer Hinrichtung, in den Hinterkopf zu schießen.
Aber damit würden sie ihr Ziel nicht erreichen: die Wiederbeschaffung der Skizzen und Forschungsergebnisse für die orbitale Plasmakanone. Zhang war es gelungen, die Daten von einem gesicherten staatlichen Server zu stehlen und dabei einen Wurm zu hinterlassen. Als am nächsten Morgen ein Techniker namens Harry Klein in Los Alamos auf die Datei zugriff, setzte er unabsichtlich den Datenwurm frei, der daraufhin alle Hinweise auf das Waffensystem löschte und zugleich eine falsche Spur legte, die Klein belastete. Dieser kleine Computer-Zaubertrick kostete die Ermittler zwei Wochen, weil sie zuerst der falschen Spur folgten.