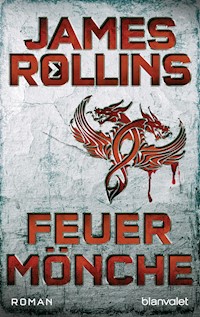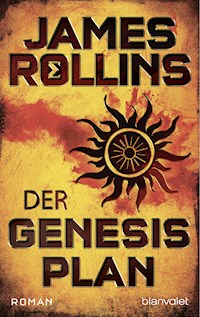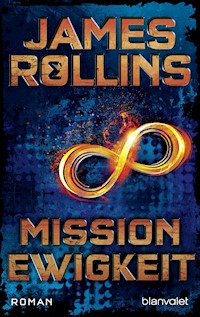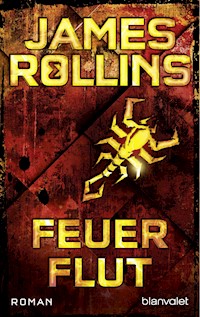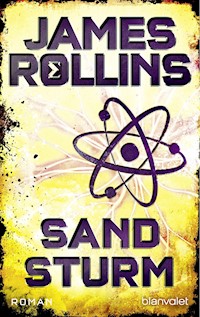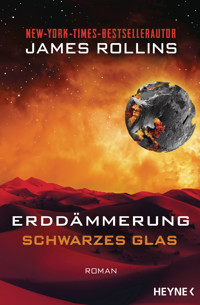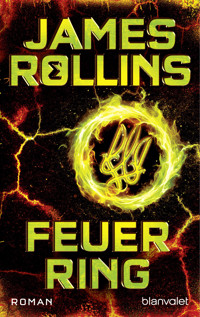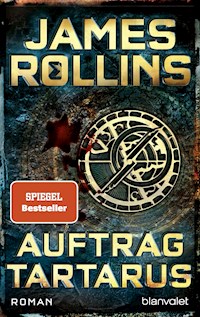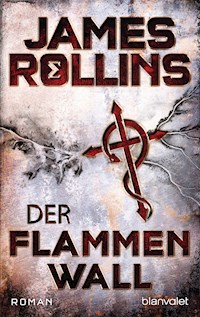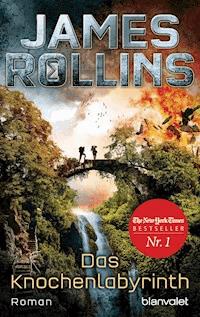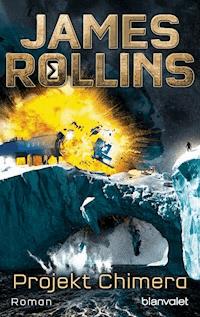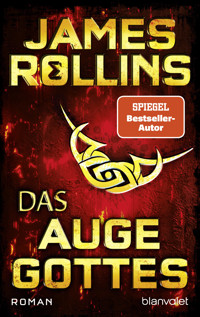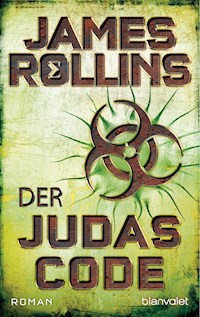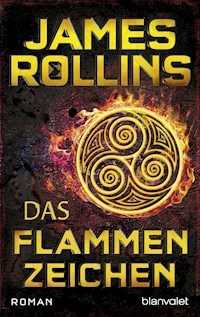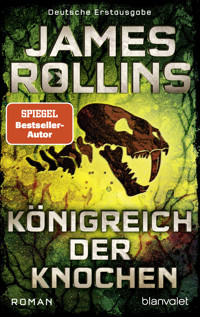
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force
- Sprache: Deutsch
Wenn die Natur zurückschlägt … Der 16. Roman um die Topagenten der Sigma Force
Im Kongo wird ein humanitäres Hilfscamp von Tieren angegriffen. Doch nicht nur von einer einzigen Spezies, sondern von allen auf einmal. Alle Tiere der Wildnis haben sich gegen die Menschen verbündet. Commander Grayson Pierce und sein Team vom wissenschatlichen Geheimdienst Sigma Force werden zur Hilfe gerufen. Doch auch korrupte Militärangehörige sowie der skrupellose Multimilliardär Nolan De Coster sind bereits vor Ort. Was kann diesen Amoklauf der Natur ausgelöst haben? Und wie kann man es aufhalten? Die Antwort findet sich im Königreich der Knochen …
Verpassen Sie nicht die weiteren in sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force, zum Beispiel »Auftrag Tartarus«, »Der Judas-Code« oder »Das Messias-Gen!«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Im Kongo wird ein humanitäres Hilfscamp von Tieren angegriffen. Doch nicht nur von einer einzigen Spezies, sondern von allen auf einmal. Alle Tiere der Wildnis haben sich gegen die Menschen verbündet. Commander Grayson Pierce und sein Team vom wissenschatlichen Geheimdienst Sigma Force werden zu Hilfe gerufen. Doch auch korrupte Militärangehörige sowie der skrupellose Multimilliardär Nolan De Coster sind bereits vor Ort. Was kann diesen Amoklauf der Natur ausgelöst haben? Und wie kann man es aufhalten? Die Antwort findet sich im Königreich der Knochen …
Autor
Der New York Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:Sigma-Force:Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes, Projekt Chimera, Das Knochenlabyrinth, Die siebte Plage, Die Höllenkrone, Auftrag Tartarus, Königreich der KnochenTucker Wayne:Killercode, KriegsfalkeDie Bruderschaft der Christuskrieger:Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlagund www.facebook.com/blanvalet.
James Rollins
Königreich der Knochen
Roman
Deutsch von Norbert Stöbe
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Kingdom of Bones (Sigma Force 16)« bei William Morrow, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2021 by Jim Czajkowski
Published in agreement with the author, c/o Baror International Inc. Armonk, New York, USA.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: text in form / Gerhard Seidl
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von stock.adobe.com (captainvector, Melica, grasycho, Mykola Mazuryk, Dmitriy Kosterev, Valentina Shilkina)
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28136-6V001
www.blanvalet.de
Für alle Ärzte und Krankenschwestern, Sanitäter und Hausmeister, für das Personal der Krankenhäuser und Kliniken in diesem Land und in aller Welt, die während der Pandemie tapfer und heroisch ihre Arbeit getan haben. Danke.
Vorbemerkung zum wissenschaftlichen Hintergrund
Diese Geschichte befasst sich mit den bizarren Eigenschaften der Viren, insbesondere mit der Art und Weise, wie diese winzigen ansteckenden Gebilde alles Leben auf der Erde im Verborgenen miteinander verbinden. Ich habe die Grundzüge entworfen, lange bevor das Coronavirus Teil der modernen Welt und Covid-19 zur globalen Epidemie wurde. Als die Plage die ganze Welt erfasste, habe ich überlegt, ob ich diesen Roman abschließen soll. Es erschien mir als Inbegriff des Hochmuts, zu einer Zeit, da die Realität erschreckender (und herzzerreißender) war als jede erfundene Geschichte, einen Roman über ein tödliches Virus zu schreiben. Außerdem erschien es mir unsensibel, mit einer Virengeschichte zu unterhalten, während alle Welt litt.
Da Sie das Buch in Händen halten, wissen Sie, wie meine Überlegungen ausgegangen sind. Warum? Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass ich »pandemische« Bedrohungen auch schon in früheren Werken thematisiert habe (Die siebte Plage, Projekt Chimera). Meine Absicht war es, mich nicht zu wiederholen. Bei dieser Geschichte sollte es weniger um die eigentliche Plage gehen als vielmehr um deren Verursacher und die seltsame Biologie der Viren. Ich fand, dieses Thema könnte die Leser interessieren – und wäre zudem im Moment von besonderer Relevanz.
Im Zuge der Recherche fand ich heraus, wie merkwürdig, vielfältig und allgegenwärtig Viren in der Natur sind. Tagtäglich regnen zahllose Viren vom Himmel herab. Pro Stunde gehen etwa dreiunddreißig Millionen Virenpartikel auf jeden Quadratmeter des Planeten nieder.1 Trotz ihres häufigen Vorkommens sind Viren immer noch ein Rätsel. Selbst heute ist über die Biologie der Viren weniger bekannt als über jede andere Lebensform.2 Außerdem nimmt man an, dass es Millionen, wenn nicht gar Milliarden bislang noch unentdeckte Virenarten gibt.
Allerdings wissen wir, wie eng Viren mit unserer Evolutionsgeschichte verflochten sind. Ihr genetischer Code ist tief in unserer DNA verankert. Wissenschaftler schätzen, dass vierzig bis achtzig Prozent des menschlichen Genoms ursprünglich von Viren stammen.3 Und das gilt nicht nur für uns. Kürzlich fand man heraus, wie eng Viren mit der ganzen Natur verflochten sind. Sie sind das Bindeglied, das alle Lebensformen miteinander verknüpft. Man glaubt inzwischen, Viren könnten einen Hinweis auf die Entstehung des Lebens geben und der Motor der Evolution, vielleicht sogar der Ursprung des menschlichen Bewusstseins gewesen sein.4
Wenngleich dieses Buch nicht die Pandemie zum Thema hat, ist sein Inhalt womöglich noch erschreckender.
Warum?
Weil dies eine der neuesten Warnungen ist, die Wissenschaftler aussprechen: Viren – natürlich vorkommende wie die innerhalb unseres Körpers – verändern uns weiterhin und entwickeln uns weiter. Und das passiert auch in diesem Moment, da Sie dies lesen.
1 Trillions Upon Trillions of Viruses Fall from the Sky Each Day, Jim Robbins, New York Times, 13. April 2018
2 Welcome to the Virosphere, Jonathan R. Goodman, New Scientist, 11. Januar 2020.
3 Robbins, loc. cit.
4 An Ancient Virus May Be Responsible for Human Consciousness, Rafi Letzter, Live Science, 2. Februar 2018
Vorbemerkung zum historischen Hintergrund
»Das Grauen! Das Grauen!« Das sind in Joseph Conrads Erzählung »Herz der Finsternis« die letzten Worte des Schurken Kurtz. Dies ist der Moment, in dem Kurtz bewusst wird, welche Gräuel er den Eingeborenen des Kongos angetan hat. Sie dienen auch als Warnung: Seid euch der Finsternis in unser aller Herzen bewusst.
Conrad griff bei der Erzählung (erschienen 1899) auf seine Erfahrungen als Kapitän eines Dampfschiffs auf dem Kongo zurück, wo er Zeuge der Brutalität des Kolonialregimes im Kongo-Freistaat wurde, das er als »übelste Form der Raffgier, die je das Gewissen der Menschheit besudelt hat«, bezeichnete. Binnen zehn Jahren wurden über zehn Millionen Kongolesen getötet. In den Worten des britischen Forschers Ewart Grogan: »Jedes einzelne Dorf wurde niedergebrannt, und als ich aus dem Land floh, sah ich überall Skelette herumliegen – in den bizarrsten Haltungen. Was für Geschichten des Grauens sie erzählten!«5
Wie kam es zu diesen Grausamkeiten?
Tragischerweise waren sie eine Folge des Fortschritts von Medizin und Technik. Die Entdeckung des Malariamedikaments Chinin zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts machte den Kontinent allgemein zugänglich. Portugiesische und arabische Sklavenhändler hatten den Kongo schon vorher ausgeplündert, doch mit der Möglichkeit, Malaria zu behandeln, kam die Kolonisierung durch Europa in Schwung. Die Franzosen sicherten sich den Nordteil des Kongos, während der belgische König Leopold II. mit juristisch fragwürdigen Verträgen zweieinhalb Millionen Quadratkilometer im Süden für sich reklamierte, ungefähr ein Drittel der Fläche der Vereinigten Staaten.
Dann erfand der schottische Tierarzt John Boyd Dunlop den Luftreifen. Damit löste er eine Jagd nach Kautschuk aus, von dem ein großer Teil im Kongo gewonnen wurde. Auf einmal war es äußerst gewinnbringend, die kongolesischen Dorfbewohner auszubeuten und zu versklaven. König Leopold setzte für jedes Dorf Quoten für Kautschuk und Elfenbein fest. Wer sie nicht erfüllte, dem wurde eine Hand abgehackt. In kurzer Zeit wurden menschliche Hände sowie abgeschnittene Ohren, Nasen, Genitalien und sogar Köpfe im Freistaat Kongo zu einer Art Währung. Belgische Offiziere übten zudem Terror gegen die Bevölkerung aus, dazu gehörten Kreuzigungen und das Erhängen von Männern, Frauen und Kindern.6
Über all diese Grausamkeiten wurde über ein Jahrzehnt lang nicht berichtet, bis schließlich die Hälfte der Bevölkerung abgeschlachtet worden oder verhungert war. Conrads »Herz der Finsternis« machte die Gräuel erstmals publik, doch es ist Missionaren und vor allem William Henry Sheppard, Amerikaner und Mitglied der Presbyterianer, zu verdanken, dass die Welt von dem wahren Grauen erfuhr, das die Kongolesen während seines Missionseinsatzes in der Region erdulden mussten.7
Diese Grausamkeiten waren jedoch nicht das ganze »Grauen«, dessen Zeuge Reverend Sheppard in dieser blutigen Zeit wurde. Ein weiterer Bericht Sheppards wurde unter Gebeinen begraben. Darin geht es um Landkarten, Altertümer und Mythen eines weiteren schwarzen, christlichen Patriarchen.
Nur wenigen ist diese Geschichte bekannt.
Das ändert sich jetzt.
5 Forever in Chains: The Tragic History of Congo, Paul Vallely, Independent, 28. Juli 2006.
6 Ibid.
7 Edgerton, op. cit., S. 143
Der Menschengeist ist zu allem fähig, weil er alles umfasst – die Vergangenheit ebenso wie die Zukunft.
JOSEPH CONRAD, »HERZ DER FINSTERNIS«
Der einzige wahre Schurke in meiner Geschichte: das überdimensionierte menschliche Gehirn.
KURT VONNEGUT, GALAPAGOS
14. Oktober 1894Distrikt Kasai, Freistaat Kongo
Reverend William Sheppard sprach lautlos das Vaterunser, während er darauf wartete, dass der Kannibale aufhörte, an seinen Zähnen herumzufeilen. Der Mann, Angehöriger des Basongye-Stamms, hockte beim Feuer und hielt in der einen Hand eine Knochenfeile und in der anderen einen Spiegel. Er spitzte einen Schneidezahn zu, begutachtete lächelnd sein Werk und richtete sich auf.
Der Afrikaner, der sich vor Sheppard aufbaute, war über zwei Meter groß. Der Kannibale war mit langer Hose, polierten Stiefeln und geknöpftem Hemd bekleidet. Man hätte ihn für einen Studienkollegen vom presbyterianischen Priesterseminar halten können. Allerdings hatte sich der Mann die Augenbrauen abrasiert und die Wimpern ausgezupft, was ihn zusammen mit dem Haifischgrinsen wahrlich Furcht einflößend aussehen ließ.
Sheppard schwitzte in seinem weißen Leinenanzug mit Krawatte und hellem Tropenhelm. Er legte den Kopf in den Nacken und sah zum Anführer der Zappo Zaps auf. Der kriegerische Stamm hatte sich mit den belgischen Kolonialstreitkräften verbündet und diente König Leopold praktisch als Armee. Die berüchtigten Zappo Zaps hatten ihren Namen vom ratternden Geräusch ihrer zahlreichen Gewehre. Sheppards Blick fiel auf das Gewehr, das der Kannibale geschultert hatte. Er fragte sich, wie viele Menschen es wohl schon in den Tod befördert hatte.
Bei seiner Ankunft im Dorf hatte er Dutzende fliegenübersäte Leichen gesehen. Angesengte Knochen ließen darauf schließen, dass weitere Tote verzehrt worden waren. In der Nähe trennte ein Stammesangehöriger einen blutigen Fleischbatzen von einem abgehackten Oberschenkel ab. Ein anderer Zappo Zap rollte in einem ausgehöhlten Schädel Tabakblätter. Auf dem Feuer, das sich zwischen ihm und dem Anführer befand, wurden auf Bambusstöcken abgetrennte Hände geräuchert.
Sheppard bemühte sich, das Grauen auszublenden, das auf ihn einstürmte. Wolken schwarzer Fliegen hingen in der Luft. Der Gestank von verbranntem Fleisch drang ihm in die Nase. Um sich nicht übergeben zu müssen, fixierte er den Eingeborenen. Er durfte sich keine Blöße geben.
Sheppard redete langsam, denn der Kannibale sprach zwar Englisch und Französisch, allerdings nur gebrochen. »M’lumba, ich muss mit Hauptmann Deprez sprechen. Das ist von äußerster Wichtigkeit.«
M’lumba zuckte mit den Schultern. »Er nicht da. Ist weg.«
»Was ist dann mit Collard oder Remy?«
Ein weiteres Achselzucken, doch die Miene des Mannes verfinsterte sich. »Sind mit Capitaine gegangen.«
Sheppard runzelte die Stirn. Deprez, Collard und Remy – alle drei Angehörige der belgischen Armee – befehligten die Zappo Zaps in dieser Gegend. Sheppard hatte sie kennengelernt, nachdem er am Kasai, einem Nebenfluss des Kongo, eine Mission gegründet hatte. Die Abwesenheit der Belgier war ungewöhnlich, denn sie trieben im Dorf die »Kautschuksteuer« ein – was freilich nicht bedeutete, dass sie gegen die hier begangenen Gräuel eingeschritten wären. Vielmehr ermutigten sie die Eingeborenen sogar zur Brutalität. Deprez führte eine aus Flusspferdleder geflochtene Peitsche mit sich, mit der er aus nichtigen Anlässen seine Opfer strafte. In den vergangenen Monaten hatte die Gruppe unter der Aufsicht des Hauptmanns am Kasai gewütet und auf ihrem Weg nach Norden Dorf um Dorf terrorisiert.
Das war der Grund, weshalb Sheppard seine Mission in Ibanj verlassen und sich auf die Suche nach der Gruppe begeben hatte. Die Kuba, ein anderer Stamm, hatten einen Abgesandten ihres Königs geschickt und den Reverend gebeten, die mörderischen Zappo Zaps daran zu hindern, auf ihr Gebiet vorzudringen. Den Wunsch konnte er ihnen nicht abschlagen. Zwei Jahre zuvor hatten die Kuba Sheppard als erstem Fremden Zugang zu ihrem Königreich gewährt, vor allem deshalb, weil er sich die Zeit genommen hatte, ihre Sprache zu erlernen. Als er sich flüssig auszudrücken vermochte, wurde er am Hof des Königs freundlich aufgenommen. Wie sich herausstellte, waren die Menschen aufrichtig und fleißig, obwohl sie an Hexerei glaubten und der König siebenhundert Frauen hatte. Zwar war es ihm nicht gelungen, sie zu bekehren, doch sie erwiesen sich in dieser feindseligen Region als wertvolle Verbündete.
Und jetzt brauchen sie meine Hilfe.
Er musste wenigstens versuchen, Deprez dazu zu bewegen, die Kuba vor seiner Grausamkeit zu verschonen.
»Wohin sind Deprez und die anderen gegangen?«, fragte Sheppard.
M’lumba blickte nach Osten, zu dem Land jenseits des träge dahinfließenden Kasai. Er fluchte auf Bantu und spuckte aus: »Ich ihnen gesagt, sie nicht dorthin gehen. Das ist alaaniwe.«
Das war das Bantu-Wort für »verflucht«. Der Aberglaube war bei den hiesigen Stämmen tief verwurzelt. Sie glaubten an Gespenster und Geister, an Zauberei und Magie. Es war ihm nahezu unmöglich, diesen Schleier heidnischer Überzeugungen zu durchdringen und durch die frohe Botschaft Christi zu ersetzen. Trotzdem hatte er sich nach Kräften bemüht und gleichzeitig, bewaffnet allein mit einer Bibel und einer Kodakkamera, die hier verübten Gräuel dokumentiert.
Sheppard legte die Stirn in Falten. Es musste einen gewichtigen Grund dafür geben, dass alle drei Offiziere losgezogen waren. »M’lumba, weshalb sind Deprez und die anderen beiden fortgegangen? Wonach suchen sie?«
»Pango«, murmelte der Eingeborene, das Bantu-Wort für »Höhle«. Dann machte er ein finsteres Gesicht und tat so, als würde er den Boden umgraben, wobei er Sheppard ansah.
Sheppard blinzelte, dann begriff er. »Meinst du ein Bergwerk?«
M’lumba nickte heftig. »Oui. Bergwerk. An einem bösen Ort. Mfupa Ufalme.«
Sheppard blickte ans andere Ufer und übersetzte die beiden Worte des Kannibalen.
Königreich der Knochen.
Das klang bedrohlich, doch Sheppard schenkte dem wenig Beachtung. Im pfadlosen Dschungel gab es noch viele unerforschte Orte. Er selbst hatte einen bislang unbekannten See entdeckt, und in ein paar Monaten sollte er bei der Royal Geographic Society einen Vortrag darüber halten. Noch weiter als der Aberglaube aber waren in dieser Region Gerüchte über geheime Schätze und verborgene Königreiche verbreitet. Schon viele Männer hatten sich davon ins Verderben locken lassen.
Und jetzt vielleicht auch die drei Belgier.
»Weshalb wollen sie zu dem Bergwerk?«, fragte Sheppard. »Was hoffen sie dort zu finden?«
M’lumba wandte sich um und erteilte einem älteren Mann mit Gesichtstätowierungen barsch einen Befehl. Offenbar war dies der mganga der Gruppe, der Hexendoktor. Die Zappo Zaps reisten niemals ohne Schamanen, der die visuka und roho abwehrte, die rachsüchtigen Gespenster und Geister derer, die sie abgeschlachtet hatten.
Der alte Mann trat näher. Er war nur mit einem Lendentuch bekleidet und trug eine Halskette mit Amuletten aus Elfenbein und Holz. Seine Lippen waren fettig, anscheinend hatte er kurz zuvor gegessen. M’lumba fragte den mganga etwas im Basongye-Dialekt, das Sheppard nicht verstand.
Der Schamane machte ein finsteres Gesicht, hantierte mit den verknäulten Amuletten und streifte sich eine geflochtene Schnur über den Kopf. Daran war ein einzelnes Totem befestigt. Es handelte sich um eine Metallscheibe, nicht größer als ein Fingernagel. Der Älteste schüttelte sie vor M’lumba, der sie entgegennahm und an Sheppard weiterreichte.
»Capitaine Deprez hat das gefunden. Ein mganga eines anderen Dorfs trug es um den Hals. Der capitaine peitscht Leute aus, damit sie reden. Zwei Tage lang Geschrei. Dann mganga sagt ihm, woher das ist.«
»Von Mfupa Ufalme …«, murmelte Sheppard. Vom Königreich der Knochen.
M’lumba nickte düster; offenbar war er verärgert.
Sheppard betrachtete das Amulett. Anscheinend handelte es sich um eine schwarz angelaufene Münze mit einem Loch in der Mitte. An einer Seite hatte man am Belag gerieben, darunter schimmerte es golden.
Sheppard wurde mulmig zumute.
Kein Wunder, dass Deprez so brutal vorgegangen ist …
Für einen dermaßen verkommenen Menschen war die Verlockung des Goldes weitaus stärker als die von Elfenbein oder Kautschuk. Von all den Gerüchten über im Dschungel verborgene Städte und Schätze stachelte keines die Gier so an wie die Aussicht auf Gold. Seit jeher durchstreiften Forscher den Dschungel nach solchen Reichtümern. Hartnäckig hielten sich Legenden über Bergwerke, die angeblich von römischen Legionären oder gar den Streitkräften König Salomos angelegt worden waren.
Sheppard seufzte, denn er wusste nur allzu gut, wie viele Forscher bei solch tollkühnen Unternehmungen ihr Leben gelassen hatten. Er wollte das Goldstück gerade sinken lassen, als ein Sonnenstrahl auf die Inschrift auf der Rückseite fiel. Er hob die Münze wieder an und wendete sie im Licht. Er blinzelte, dann machte er große Augen. Er rieb an der Münze, bis ein Name zum Vorschein kam.
Presbyter Iohannes.
Er krampfte die Hand um die Münze.
Das kann nicht sein.
Der Name war auf Latein geschrieben, doch Sheppard wusste, dass die Goldmünze nicht von einer römischen Legion geprägt worden war. Auch nicht vom Heer des König Salomo. Vielmehr verwies sie auf eine andere Geschichte, nicht minder fantastisch als die übrigen Legenden.
»Priesterkönig Johannes«, übersetzte er.
Während des Theologiestudiums hatte er auch von dem Respekt einflößenden christlichen Priesterkönig von Afrika erfahren. Berichten aus dem zwölften Jahrhundert zufolge hatte Priesterkönig Johannes fast ein Jahrhundert lang über Äthiopien geherrscht. Angeblich war er ein Nachkomme Balthasars, des schwarzhäutigen Weisen aus dem Morgenland, einer der drei Könige, die dem Christuskind in der Krippe gehuldigt hatten. Priesterkönig Johannes verfügte demnach über sagenhaften Reichtum und geheimes Wissen. Seine Legende war mit der des Jungbrunnens und der verschwundenen Bundeslade verknüpft. Jahrhundertelang hatten europäische Herrscher nach dieser sagenumwobenen Person gesucht. Sie sandten Missionare aus, von denen viele auf Nimmerwiedersehen im Dschungel verschwanden. Auch Shakespeare erwähnte den afrikanischen Patriarchen in seinem Theaterstück Viel Lärm um nichts.
Die meisten Historiker der Gegenwart verwiesen die Geschichte von einem schwarzen Christenkönig, der über einen großen Teil Afrikas herrschte, ins Reich der Mythen.
Sheppard starrte den Namen an. Er hätte das, was er in Händen hielt, am liebsten als Fälschung abgetan. Doch als Sohn eines Sklaven war ihm das nicht möglich. Er verspürte eine innere Verwandtschaft zu der Legende und dem schwarzen Christen aus der Vergangenheit.
Steckte in all den Geschichten vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit?
Während Hauptmann Deprez die Aussicht auf Gold in den Dschungel gelockt hatte, vermochte Sheppard eine Art Sehnsucht nicht zu verleugnen – nicht nach Reichtümern, sondern nach der Geschichte, von der die Münze kündete.
Er senkte die Hand und blickte M’lumba an. »Wann sind Deprez und die anderen aufgebrochen?«
M’lumba schüttelte den Kopf. »Vor zwölf Tagen. Haben zwanzig Männer mitgenommen.« Er bleckte seine scharfen Zähne. »Und meinen Bruder Nzare. Ich ihm sage, er soll bleiben. Aber Capitaine zwingt ihn mitkommen.«
Sheppard spürte, dass dies der Ursprung von M’lumbas Zorn war – wodurch sich ihm eine Chance bot. »Dann lass uns eine mkataba machen. Einen Vertrag zwischen dir und mir.«
M’lumba zog argwöhnisch die haarlosen Brauen zusammen. »Nini mkataba?«
Sheppard legte die Hand aufs Herz. »Ich reise nach Mfupa Ufalme und hole deinen Bruder zurück – aber nur, wenn du mir versprichst, dass du mit deinen Männern hierbleibst und nicht weiter ins Land der Kuba vordringst.«
M’lumba ließ den Blick über die zerstörten Dorfhütten schweifen und überlegte.
»Lass mir drei Wochen Zeit«, sagte Sheppard.
M’lumbas Miene verfinsterte sich noch mehr.
Sheppard wartete gespannt auf seine Antwort. Selbst wenn sein Vorhaben scheiterte, könnten die Kuba in der Zeit ihre Dörfer räumen und im Wald Zuflucht suchen. Er hoffte, es werde ihm auf diese Weise gelingen, fünfzigtausend Seelen vor der hier vorherrschenden Barbarei zu bewahren.
M’lumba hielt drei Finger hoch. »Tatu Wochen. Wir hier warten.« Er musterte die am Boden liegenden Toten. »Dann ich bekomme Hunger.«
Sheppard unterdrückte ein Schaudern. Er dachte an die gepflegten Straßen in Kubas Königsresidenz, die gesäumt waren von den lebensgroßen Statuen der früheren Könige und die widerhallten vom Gelächter der Frauen und Kinder. Dann stellte er sich vor, wie das Gelächter Schreien Platz machte und sich die sauberen Straßen von vergossenem Blut rot färbten.
Er betrachtete den Dschungel am anderen Ufer des Kasai. Er wusste nicht, ob es dort eine vergessene Goldmine gab. Er zweifelte sogar an der Echtheit der lateinischen Inschrift auf der Münze. Und er war überzeugt, dass das Königreich der Knochen mit keinem Fluch belegt war.
Der Gestank nach verbranntem Fleisch war für ihn eine Mahnung.
Ich darf nicht scheitern.
1. TEIL
1
23. April, 7:23 CATProvinz Tshopo, Demokratische Republik Kongo
Ein schmerzhafter Stich versetzte Charlotte Girard unvermittelt in die harte Realität zurück. Sie hatte geträumt, sie schwimme nackt im eiskalten Pool des Familienlandsitzes an der französischen Riviera. Sie klatschte sich mit der Hand auf den Hals und setzte sich im aufgeheizten Zelt auf. Die Luft war erstickend. Sie wurde erneut gestochen, diesmal am Handrücken. Erschrocken schüttelte sie den Arm und verfing sich im Moskitonetz.
Sie fluchte auf Französisch und befreite den Arm. Sie senkte den Blick in der Erwartung, eine der schwarzen Fliegen zu sehen, unter denen die Bewohner des Flüchtlingslagers litten. Stattdessen saß eine rot-schwarze Ameise auf ihrem Handgelenk. Die Mandibeln hatten sich tief ins Fleisch gegraben.
Angewidert schnippte sie sie weg. Das Insekt landete im Netz und kletterte daran hoch. Mit klopfendem Herzen trat Charlotte unter dem Netz hervor, das ihre Pritsche umhüllte. Ameisenstraßen verliefen im Zickzack über Boden und Wände.
Wo kommen die alle her?
Sie schlüpfte in die Sandalen, von denen ein paar verirrte Ameisen abfielen. Dann tappte sie auf Zehenspitzen über die wimmelnde Landkarte auf dem Boden. Zum Glück war sie mit blauem Kittel und weißer Weste bekleidet.
Sie musterte sich im Standspiegel und erschrak. Sie war Ende zwanzig, wirkte aber um zehn Jahre gealtert. Das tiefschwarze Haar hatte sie zum Pferdeschwanz gebunden, doch da sie darauf geschlafen hatte, war er zerzaust. Ihr Gesicht wirkte aufgedunsen, und sie hatte dunkle Augenringe. Nach dem langen Aufenthalt in der Sonne schälte sich die Haut. Ihr Hautarzt in Montmartre wäre entsetzt gewesen, doch hier draußen im Busch hatte sie keine Zeit für einen solchen Luxus wie Sonnenschutzmittel und Feuchtigkeitscreme.
Am Abend zuvor hatte sie sich weit nach Mitternacht erschöpft auf die Pritsche gelegt. Sie war die Jüngste des vierköpfigen Einsatzteams der Médecins Sans Frontières, der Ärzte ohne Grenzen. Sie waren unterbesetzt, denn da der Dschungel im Osten aufgrund der anhaltenden Regenfälle überschwemmt war, strömten ständig neue Flüchtlinge ins Dorflager.
Vor acht Tagen hatte sie ein Helikopter von der Stadt Kisangani hergeflogen, wo sie für das Programm Gesunde Dörfer der UNICEF gearbeitet hatte. Schon kurz nach der Ankunft fühlte sie sich überfordert. Vor zwei Jahren hatte sie die Facharztausbildung in Kinderheilkunde an der USPC – der Université Sorbonne-Paris-Cité – abgeschlossen und sich für ein Jahr bei den MSF verpflichtet, da sie etwas zurückgeben wollte. Damals war ihr das vorgekommen wie ein großes Abenteuer, das sie unbedingt mitnehmen wollte, bevor die Routine in einem Krankenhaus begann. Außerdem hatte sie einen Teil ihrer Kindheit in Brazzaville verbracht, der Hauptstadt der angrenzenden Republik Kongo. Seitdem hatte sie sich gewünscht, irgendwann in den afrikanischen Dschungel zurückzukehren. Allerdings stellte sich heraus, dass sie die Kongoregion durch eine rosarote Brille betrachtet hatte. Auf die Beschwernisse im ländlichen Buschgebiet war sie nicht vorbereitet gewesen.
Als versuchte hier alles, einen zu fressen, zu stechen, zu vergiften oder zu bescheißen.
Sie ging zur Eingangsklappe des Schlafzelts, schob sie mit der Schulter beiseite und trat in den dunstigen morgendlichen Sonnenschein hinaus. Sie blinzelte und beschattete die Augen mit der Hand. Zur Rechten lagen mit Stroh oder Blech gedeckte Hütten. Ein großer Teil der Behausungen war bereits vom angeschwollenen Tshopo weggeschwemmt worden. Zur Linken breiteten sich Zelte und provisorische Unterkünfte bis zum Wald aus. Darin waren Flüchtlinge aus anderen Dörfern untergebracht, die vor den Wasserfluten geflohen waren.
Und täglich kamen weitere Menschen an und vergrößerten die Probleme.
Der Rauch der zahlreichen Lagerfeuer vermochte den Gestank der Abwassergräben nicht zu überdecken. Die Zahl der Cholerafälle stieg, und es mangelte an Infusionslösung und Doxycyclin. Gestern hatte sie außerdem noch Dutzende Malariafälle behandelt.
Das war nicht die ländliche Idylle, von der sie in Paris geträumt hatte.
Um das zu unterstreichen, grollte in der Ferne bedrohlich der Donner. In den vergangenen zwei Monaten war in der Gegend Unwetter auf Unwetter gefolgt. Die überfluteten Gebiete verwandelten sich in Sümpfe, obwohl eigentlich Trockenzeit war. Die Regenfälle waren die schlimmsten seit hundert Jahren – und es waren weitere Unwetter angekündigt. Die Fluten bedrohten den ganzen Zentralkongo, und aufgrund von Korruption und bürokratischer Hemmnisse tat sich die Katastrophenhilfe schwer. Sie hoffte, dass die UN Nachschub liefern würden, bevor die Situation sich weiter verschlechterte.
Auf dem Weg zum Behandlungszelt beobachtete sie, wie ein Kind sich hinhockte und mit einem Schwall flüssigen Stuhls erleichterte. Ameisen liefen dem kleinen Mädchen über die Füße und krabbelten an den Beinen hoch. Sie schrie vor Schmerzen, bis eine Frau, vermutlich ihre Mutter, sie hochhob und die Ameisen von Beinen und Füßen abstreifte.
Charlotte eilte hinüber und half dabei, die letzten Ameisen abzuklauben. Sie zeigte zum Behandlungszelt. Ihr Swahili war ziemlich bescheiden. »Dawa«, sagte sie und geleitete Frau und Kind hinüber. »Deine Tochter braucht Medizin.«
Ein Kind konnte binnen eines Tages an Dehydrierung sterben, ganz gleich, ob Cholera oder irgendeine andere Krankheit die Ursache war.
»Kuza, Kuza«, drängte Charlotte die Frau zur Eile und ging voran.
Überall eilten Einheimische umher. Viele versuchten, die Ameisenhorde mit Palmwedeln abzuwehren. Charlotte schloss sich einem Luba an, der den Weg zum Behandlungszelt fegte. In seinem Gefolge erreichte sie unbeschadet die Eingangsplane. Der Geruch von Desinfektionsmittel und Jod überlagerte vorübergehend den Gestank im Lager.
Cort Jameson, ein grauhaariger Kinderarzt aus New York, bemerkte sie. »Was haben Sie da, Dr. Girard?«, fragte er auf Englisch, der Umgangssprache der Ärzte.
»Einen weiteren Fall von Diarrhö«, antwortete sie und trat hinter der Frau mit dem Kind ins Zelt.
»Ich kümmere mich drum.« Er reichte ihr einen dampfenden Becher Kaffee. »Trinken Sie erst mal. Sie sehen aus, als könnten Sie kaum die Augen offen halten. Wir können auch noch ein paar Minuten länger hierbleiben.«
Sie lächelte dankbar, fasste den Becher mit beiden Händen und atmete den Kaffeeduft ein. Allein schon vom Geruch bekam sie Herzklopfen. Der Kaffee war hier so dick wie Sirup, ganz anders als der köstliche petit café in ihrem Pariser Lieblingsrestaurant. Inzwischen waren alle von dem Gebräu abhängig und erörterten halb im Scherz, ob sie es sich nicht besser intravenös verabreichen sollten.
Sie trat beiseite, um die kurze Pause und das dunkle, bittere Elixier zu genießen.
Ihr Blick fiel auf den stämmigen Benjamin Frey, einen dreiundzwanzigjährigen Biologiestudenten, der gerade seine Doktorarbeit schrieb. Der junge Mann mit dem kastanienbraunen Haar war mit Kakisachen und Schlapphut bekleidet. Außerdem trug er Turnschuhe, die unerklärlicherweise noch immer makellos weiß waren. Aufgrund seines schroffen Verhaltens und seiner Tics vermutete sie, dass er Autist war, allerdings ein hochfunktionaler. Außerdem verbiss er sich immer wieder in esoterische Themen, ohne Rücksicht auf das Interesse – oder Desinteresse – seiner Zuhörer.
Als er in der Nähe einer breiten Ameisenstraße in die Hocke ging und eins der Insekten mit einer Pinzette hochhob, ging sie zu ihm. Die Ameisenschwemme, die neueste Plage im Lager, weckte ihre Neugier.
Frey blickte sich zu ihr um. »Dorylus wilverthi«, sagte er und reckte das gefangene Exemplar in die Höhe. »Die afrikanische Treiberameise. Auch siafu genannt. Einer der größten Vertreter der Treiberameisen. Soldaten wie dieser können bis zu eins Komma drei Zentimeter groß werden, die Königin sogar fünf Zentimeter. Die Mandibeln sind so kräftig, dass die Eingeborenenstämme damit Wunden verschließen.«
Bevor er zu einem längeren Diskurs ausholen konnte, kam sie ihm zuvor. »Aber woher kommen sie auf einmal?«
»Ach, das sind Flüchtlinge wie alle anderen hier auch.« Er setzte die Ameise wieder ab und richtete sich auf. Mit der Pinzette zeigte er auf die wogenden Fluten des Tshopo. »Sieht so aus, als wären sie aus ihren Siedlungsgebieten vertrieben worden.«
Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass die in der Strömung treibenden schwarzen Inseln keine Trümmer waren, sondern große Flöße dunkelroter, miteinander verbundener Ameisen.
»Wieso sind sie nicht alle ertrunken?«, fragte sie.
»Nur weil sie ein bisschen nass geworden sind? Das stellt für sie kein Problem dar. Sie können unter Wasser einen ganzen Tag lang überleben. Ameisen sind widerstandsfähige kleine Soldaten. Es gab sie schon zu Zeiten der Dinosaurier, und sie haben sämtliche Kontinente besiedelt. Mit Ausnahme der Antarktis natürlich.«
Angewidert beobachtete sie, wie eines der Flöße ans Ufer stieß und sich die Ameisenhorde landeinwärts bewegte. Die Eindringlinge agierten im Einklang, als hätten sie den Vorstoß im Voraus geplant.
»Das sind schlaue Viecher«, setzte Frey hinzu, als hätte auch er die Aktion bemerkt. »Jede Ameise verfügt über zweihundertfünfzigtausend Gehirnzellen. Damit sind sie die intelligentesten Insekten des Planeten. Und das bezieht sich auf gerade mal eine. Nimmt man vierzigtausend Exemplare, entspricht deren Gehirnkapazität der unseren. Dabei wurden Superkolonien von Dorylus mit mehr als fünfzig Millionen Individuen gefunden. Können Sie sich das vorstellen? Angeführt von einer Königin, die dreißig Jahre alt werden kann, älter als jedes andere Insekt. Man sollte sie nicht unterschätzen.«
Auf einmal wünschte Charlotte, sie hätte sich auf keine Unterhaltung mit dem Biologen eingelassen.
»Es wird eine Menge Bissverletzungen geben, bevor diese Armee weiterzieht«, sagte Frey, als sie sich zum Gehen wandte. »Treiberameisen sind nicht nur intelligent, sondern auch reizbar und äußerst wehrhaft. Die Mandibeln sind so fest wie Stahl und messerscharf. Wenn sie unterwegs sind, verzehren sie alles, was ihnen in die Quere kommt. Sie töten sogar angeleinte Pferde und skelettieren sie. Oder Hunde, die im Haus eingesperrt sind. Manchmal auch Säuglinge.«
Charlotte schluckte beklommen. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. »Wie lange dürfte es dauern, bis sie weiterziehen?«
Frey runzelte die Stirn und stemmte die Hände in die Hüften. Er betrachtete die Ameisenstraßen, die sich vom Fluss ausgehend durchs Lager zogen. »Das ist schon seltsam. Ein solches Verhalten ist ungewöhnlich. Normalerweise meiden die Treiberameisen Gebiete, wo es so unruhig zugeht wie hier im Lager. Sie bevorzugen den Schatten des Dschungels.« Er zuckte mit den Schultern. »Die Überflutung ist jedenfalls atypisch. Vielleicht hat das die Ameisen so aggressiv gemacht. Aber irgendwann sollten sie sich beruhigen und weiterziehen.«
»Ich hoffe, Sie haben recht.«
Er nickte, den Blick auf die sich ausbreitende Ameisenhorde gerichtet. »Ich auch.«
11:02
Charlotte leuchtete dem drei Monate alten Säugling mit der Stiftlampe in die Augen. Die besorgte Mutter hielt den Jungen in den Armen. Den Daumen hatte er in den Mund gesteckt, doch er saugte nicht daran. Seine geweiteten Pupillen reagierten kaum auf das Licht. Hätte er nicht geatmet, hätte man meinen können, eine Wachspuppe vor sich zu haben. Seine Haut war grünlich, doch er hatte keine erhöhte Temperatur.
»Was meinen Sie?«, fragte Charlotte, ohne sich umzudrehen.
Cort Jameson stand neben ihr. Sie hatte den amerikanischen Kinderarzt zu der Untersuchung hinzugezogen. Sie befanden sich hinter einem dünnen Vorhang, der sie von der stark belegten Krankenstation abschirmte.
»Gestern hatte ich einen ähnlichen Fall«, sagte Jameson. »Ein halbwüchsiges Mädchen. Ihr Vater meinte, sie habe aufgehört zu sprechen und bewege sich nur noch, wenn man sie anstoße. Sie hatte angeschwollene Lymphknoten und Ausschlag am Bauch. Genau wie dieser kleine Bursche. Es könnte sich um Trypanosomiasis im Spätstadium handeln.«
»Schlafkrankheit«, murmelte Charlotte und überlegte. Die Krankheit wurde von Einzellern ausgelöst, die durch den Biss der Tsetsefliegen übertragen wurden. Frühe Anzeichen waren angeschwollene Drüsen, Ausschlag sowie Kopf- und Muskelschmerzen. Wurde die Krankheit nicht behandelt, griff der Parasit später das Zentralnervensystem an, was Artikulationsschwierigkeiten und Koordinationsstörungen zur Folge hat.
»Wie sieht die Therapie aus?«, fragte Charlotte.
Jameson zuckte mit den Schultern. »Ich habe ihr eine Infusion gelegt, denn sie war dehydriert, und dann Doxy und Pentadimin verabreicht. Ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft und versucht, ihren Vater dazu zu bewegen, sie hierzulassen, doch er hat sich geweigert. Später habe ich erfahren, dass er mit ihr den Dorfschamanen aufgesucht hat.«
Die Missbilligung war ihm deutlich anzuhören. Sie legte Jameson tröstend eine Hand auf den Arm. »Auch ihr Vater wollte alle Möglichkeiten ausschöpfen.«
»Das ist wohl richtig.«
Charlotte konnte dem Eingeborenen die Entscheidung nicht verdenken. Viele Dorfschamanen kannten Heilkräuter und Behandlungsmethoden für häufige Krankheiten, die von der Wissenschaft noch nicht entdeckt oder bestätigt worden waren. Sie selbst hatte mehrere davon untersucht. Die Einheimischen behandelten Blasenentzündung schon mit Grapefruitsaft, bevor die Vorzüge der Zitrusfrucht von der Schulmedizin verifiziert worden waren. Schamanen setzten auch Ocimum gratissimum – Baumbasilikum – zur Behandlung von Durchfall ein, auf den das Team vielleicht würde zurückgreifen müssen, wenn die Medikamentenvorräte zur Neige gingen.
»Ich glaube nicht, dass der Junge an Schlafkrankheit leidet«, erklärte Charlotte. »Wegen der minimalen Pupillenreaktion und des fehlenden Drohreflexes dachte ich zunächst an Onchozerkose oder Flussblindheit. Aber ich habe in seinen Augen keine Wurmparasiten entdeckt, welche die Krankheit hervorrufen.«
»Was glauben Sie dann?«, fragte Jameson.
»Die Mutter sagt, vor zwei Tagen sei er noch gesund gewesen. Wenn das stimmt, haben sich die Symptome zu schnell entwickelt, als dass ein Parasitenbefall durch Einzeller oder Würmer infrage käme. Ich vermute eine Vireninfektion.«
»Viren gibt es hier draußen jedenfalls genug. Gelbfieber, HIV, Chicungunya, Dengue, Rifttalfieber, Westnilfieber. Ganz zu schweigen von allen möglichen Pockenviren wie Blattern oder Affenpocken – denken Sie an den Ausschlag, den der Junge und das Mädchen gestern aufwiesen.«
»Ich weiß nicht. Die Symptome passen nicht. Vielleicht haben wir es mit einem neuen Erreger zu tun. Die meisten neuen Virenerkrankungen tauchen bei Eingriffen in die Umwelt auf. Beim Straßenbau, bei der Waldrodung, bei der Jagd nach seltenen Tierarten.« Sie blickte sich zum Kinderarzt um. »Auch bei schweren Regenfällen, wenn Viren durch Mücken oder andere Insekten übertragen werden.«
Wie aufs Stichwort krabbelte eine große Treiberameise über die Schulter des Jungen und verbiss sich in seine Wange. Blut tropfte, als die Mandibeln das weiche Gewebe durchschnitten. Charlotte dachte an die schmerzhaften Bisse, die sie am Morgen abbekommen hatte, doch der Junge rührte sich nicht. Anstatt zu schreien, ließ er den Finger im Mund. Er blinzelte nicht einmal. Er saß einfach nur mit trübem Blick da.
Sie zuckte mitfühlend zusammen, klaubte die Ameise mit der behandschuhten Hand von der Wange, drückte fest zu und schleuderte sie weg.
Jameson musterte sie mit besorgtem Blick. »Hoffen wir, dass Sie sich hinsichtlich des neuen Virus irren. In Anbetracht der Überbelegung, der vielen obdachlos gewordenen Menschen und der Flüchtlingsströme …«
Die Katastrophe wäre unausweichlich.
»Bis wir mehr wissen, sollten wir die Sicherheitsvorschriften erhöhen«, schlug Charlotte vor. »In der Zwischenzeit nehme ich Blut- und Urinproben.«
Jameson kniff die Augen zusammen. »Ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Bei dem ganzen Chaos dürfte es Wochen dauern, bis wir die Proben in ein richtiges Labor schaffen können.«
Sie verstand, was er meinte. Dann könnte es zu spät sein.
»Aber ich kenne einen Forscher in Gabun«, sagte Jameson. »Einen auf Wildtiere spezialisierten Veterinär, der für das Global Health Program der Smithsonian-Stiftung arbeitet. Er sammelt Proben und hilft beim Aufbau eines Überwachungsnetzwerks für unbekannte Viren. Vor allem aber verfügt er über ein mobiles Labor, in dem er Proben analysieren kann. Wir könnten ihn anfunken und versuchen, ihn dazu zu bewegen, hierherzukommen …«
Er blickte Charlotte fragend an.
Bevor sie etwas erwidern konnte, waren vom Eingang des Behandlungszelts aufgeregte Stimmen zu hören. Sie traten hinter dem Vorhang hervor. Zwei Männer mit einer Trage kamen ins Zelt gestürzt. Einer der Ärzte, ein vierzigjähriger Frauenarzt und Geburtshelfer, eilte zu ihnen – und wich erschrocken zurück.
Jameson ging hinüber und zog Charlotte mit sich.
Einer der beiden Männer mit der Trage war ein Angehöriger der kongolesischen Armee, der FARDC, der andere ein Schweizer Triage-Sanitäter, der den Außenbereich des Lagers abgeklappert hatte. Er war blond und hochgewachsen und wurde einfach nicht braun. Jetzt wirkte sein Gesicht noch blasser als sonst.
Japsend setzte er die Trage ab. »Den … habe ich am Rand des Lagers entdeckt. Da waren noch vier weitere. Alle tot. Sie wurden überrannt. Er ist der einzige Überlebende.«
Charlotte trat hinter Jamesons Rücken hervor und bemerkte, dass das Opfer sich in einem desolaten Zustand befand. Es handelte sich um einen alten Einheimischen, der sich kraftlos aufzusetzen bemühte. Seine zerfetzte Kleidung war blutgetränkt. Die eine Gesichtshälfte bestand aus rohem Fleisch, aus dem stellenweise weißer Knochen hervorlugte. Er sah aus, als sei ein Löwe über ihn hergefallen, dabei waren die wahren Raubtiere in diesem Fall sehr viel kleiner.
Ameisen krabbelten durch das Blut oder hatten sich ins rohe Fleisch verbissen.
»Er war unter Ameisen begraben, hat sich aber noch schwach gerührt«, erklärte der Sanitäter. »Sie haben versucht, ihn bei lebendigem Leib aufzufressen. Wir haben sie mit Eimerladungen Wasser weggespült.«
»Wieso ist der Mann vor den Ameisen nicht weggelaufen?«, fragte Jameson. »Hatte er das Bewusstsein verloren? Oder ist er vielleicht betrunken?«
Der Kinderarzt kniete nieder, um den blutüberströmten Patienten zu untersuchen. Der Einheimische hatte es endlich geschafft, sich aufzusetzen. Er öffnete den Mund, als wollte er schildern, was passiert war – da quoll ein schwarzer Schwarm Ameisen aus seinem Rachen und verteilte sich auf Kinn und Brust. Er sackte zusammen und kippte nach hinten.
Jameson schreckte zurück.
Charlotte musste an die Warnung des Biologen denken: Es wird eine Menge Bissverletzungen geben. Außerdem hatte er erwähnt, Treiberameisen könnten ein angeleintes Pferd skelettieren. Sie blickte sich zum Vorhang um. Die Mutter stand davor, in den Armen ihren steifen Sohn, der zu benommen war, um auf einen Ameisenbiss zu reagieren.
Auf einmal hatte sie Mühe zu atmen, so als habe sich die Luft verdickt. Eine furchterregende Gewissheit machte sich in ihr breit. Alles hängt irgendwie zusammen. Sie wandte sich um und legte Jameson eine Hand auf die Schulter. »Funken Sie Ihren Freund an, den Virusjäger. Sofort.«
Der Kinderarzt musterte sie einen Moment lang mit gerunzelter Stirn, ganz benommen von dem Grauen. Dann fasste er sich wieder und nickte. Er richtete sich auf und lief nach draußen, zu dem Funkerzelt mit den Satellitenantennen.
Charlotte hatte den Arm noch nicht wieder sinken lassen. Am Handgelenk fiel ihr eine Bewegung ins Auge. Drei schwarze Ameisen zappelten auf dem schmalen Hautstreifen, den der Handschuh nicht bedeckte. Die Zangen hatten sie tief in der Haut vergraben. Sie wurde von Grauen überwältigt – nicht wegen des Angriffs, sondern weil ihr plötzlich eine Erkenntnis gekommen war.
Sie hatte die Bisse gar nicht gespürt.
2
23. April, 17:38 WATProvinz Ogooué-Maritime, Gabun
Tief unter der Erde trotzte Frank Whitaker dem roten Augenpaar, das den Strahl seiner Helmleuchte reflektierte. Die Augen leuchteten in der Tiefe des Gangs, unmittelbar über dem schwarzen Wasserlauf, durch den er watete. Kreatürliche Angst krampfte ihm das Herz zusammen. Man hatte ihn vor den Raubtieren gewarnt, die in dem zur Hälfte überfluteten Höhlensystem lauerten.
Krokodile …
Ein paar kleinere Exemplare hatte er schon gesehen, nicht länger als sein Arm, doch sie waren mit peitschendem Schwanz vor ihm geflohen. Dieses hier machte keine Anstalten, sich zurückzuziehen. Er bemerkte die Panzerung unter den leuchtenden Augen. Fast zwei Meter lang. Die Schuppen waren orangefarben, was typisch war für die im Höhlensystem gefangenen Krokodile. Sie gehörten der Art der Stumpfkrokodile an, Osteolaemus tetraspis. Obwohl man bei dieser Größe wohl kaum von »stumpf« sprechen konnte.
Die Kolonie war vor dreitausend Jahren, als der Wasserspiegel sank, in den Abanda-Höhlen nahe der gabunischen Küste eingeschlossen worden. In der unwirtlichen, lichtlosen Umgebung hatten sie sich allmählich von ihren Artgenossen fortentwickelt.
Als Wildtierveterinär hätte er das eigentlich faszinierend finden müssen – allerdings wäre ihm etwas mehr Abstand lieber gewesen.
»Sie sind fast blind«, versicherte ihm Remy Enonga. Der Gabuner war Pathologe und arbeitete für CIRMF, das Internationale Zentrum für Medizinische Forschung. Die Einrichtung im Südosten Gabuns lieferte Einschätzungen zu neu auftretenden Krankheiten in Westafrika. »Mit etwas Lärm können wir den kleinen Bullen verscheuchen.«
»Klein?«, fragte Frank, dessen Stimme von der Papiermaske gedämpft wurde.
»Oui. Die Krokodile an der Oberfläche sind vielfach größer.«
Frank schüttelte den Kopf. Mir reicht das hier schon. Doch er nahm es dem Pathologen ab, dass die Tiere blind waren. Er löste die Aluminiumwasserflasche von der Hüfte, schlug sie gegen die Karstwand und brüllte. Der Krokodilbulle reagierte nicht. Schließlich aber drehte er sich um, schwamm langsam davon und verschwand in der Dunkelheit.
Der Weg war frei, und die beiden Männer gingen weiter. In dieser fremdartigen Umgebung kam Frank sich vor wie ein Astronaut, der einen lebensfeindlichen Planeten erkundet, zumal seine Schutzausrüstung ihn von Kopf bis Fuß bedeckte. Er trug einen MicroGuard-Overall mit Kapuze, die Hosenbeine hatte er in die wasserdichten Stiefel gestopft. Seine Augen wurden von einer Plastikbrille geschützt, und die Atemmaske filterte die ammoniakgeschwängerte Luft und hielt die umherschwirrenden Schnaken und Mücken ab.
Nach einer Weile ließen sie den Wasserlauf hinter sich und wateten durch den Schlamm, der überwiegend aus Fledermauskot bestand. An der Decke hingen Horden der geflügelten Höhlenbewohner, andere flatterten umher und stießen immer wieder auf die Eindringlinge herab. Das viele Guano war der Grund für die einzigartige Orangefärbung der Krokodile. Diese wiederum, gefangen in ewiger Dunkelheit, ernährten sich von den Fledermäusen sowie von Krabben, Grillen und Algen.
»Wie weit ist es noch bis zu den Fallen?«, rief Frank Remy zu.
»Wir sind fast da. Beim nächsten Engpass. Die Stelle schien mir am besten geeignet, um die Netze aufzustellen.«
Remy und seine Mitarbeiter vom CIRMF waren so freundlich gewesen, die Fallen tags zuvor aufzustellen. Frank wollte Proben von den verschiedenen hier lebenden Fledermausarten nehmen, darunter Flughunde, Riesen-Rundblattnasen und andere. Fledermäuse bildeten ein natürliches Reservoir für Ebola und das Marburgvirus. Frank wollte die Viren der Höhlenbewohner katalogisieren und nach Krankheitserregern suchen, welche die nächste große Pandemie auslösen könnten.
Er hielt sich seit einem halben Jahr in Afrika auf und hatte den Kongo und die Küste von Westafrika bereist. Bislang hatte er über fünfzehntausend Proben gesammelt.
Als sie sich den Fallen näherten, wunderte er sich wieder einmal, dass er überhaupt hier war. Für ein schwarzes Waisenkind von der Southside von Chicago war es ein weiter Weg zu den Höhlen von Gabun. Seine Liebe zur Natur rührte von seiner Abneigung gegenüber den kalten Wintern und schwülen Sommern in Chicago her. Auf der Suche nach einer Zuflucht war er immer wieder im Lincoln Park, im Brookfield-Zoo und im Shedd-Aquarium gelandet. Stundenlang hatte er sich die Infotafeln eingeprägt und von den geheimnisvollen Gegenden geträumt, die in den Texten beschrieben wurden. Dem schwarzen Jungen in der zwei Nummern zu großen Jacke und den löchrigen Jordans-Jeans war das sehr fremdartig vorgekommen.
Und jetzt bin ich hier …
An der Highschool hatte seine Begabung für Naturwissenschaften und Mathematik – und vielleicht auch seine Körpergröße von über eins neunzig – das Interesse eines Anwerbers vom JROTC, dem Ausbildungskorps für Reserveoffiziere, geweckt. Er machte sich so gut, dass er ein Vollstipendium für ein Community College und anschließend ein Stipendium für ein Studium der Veterinärwissenschaft an der Universität von Illinois bekommen hatte. Durch die Annahme des Stipendiums war er zur Freude seiner Adoptiveltern automatisch zum Second Lieutenant befördert worden.
Obwohl er seine leiblichen Eltern nie kennengelernt und auch nie nachgeforscht hatte, weshalb sie ihn weggegeben hatten, war er einer der Glücklichen. Er wuchs in drei Pflegefamilien auf, die ihn teils vernachlässigten, teils mit ihren guten Absichten schier erdrückten. Dann nahmen ihn die Whitakers auf und adoptierten ihn schließlich. Ihre liebevolle Zuwendung machte seine bittere Jugend wett, die ihn aggressiv gemacht und von der Gesellschaft, die ihn zurückgewiesen hatte, immer weiter entfernt hatte.
Bei Abschluss des Studiums – welches wochenlanges Training im aktiven Dienst mit einschloss – wurde er prompt zum Captain befördert. Anschließend absolvierte er ein Einsatztraining, denn er war eine Dienstverpflichtung für sieben Jahre eingegangen. Er landete mitten im Irakkrieg, wo er an seinem Master in Public Health arbeitete und sich mit zoonotischen Krankheiten befasste. Der Krieg raubte ihm seine Illusionen hinsichtlich des Zustands der Welt und der Menschheit im Allgemeinen.
Nach der Rückkehr in die Staaten arbeitete er eine Zeit lang am USAMRIID, dem Medizinischen Forschungsinstitut der US-Armee für Infektionskrankheiten, hielt aber nur ein Jahr durch. Er schied aus der Armee aus und wurde vom Global Health Program der Smithsonian-Stiftung angestellt, einer Non-Profit-Einrichtung, die virale Bedrohungen erforschte. Er bekam die erforderlichen Mittel, um nach Afrika zu reisen, wo er beabsichtigte, auf der Suche nach der in den entfernten Winkeln der Welt verborgenen dunklen Virenmaterie, wie seine Kollegen sich ausdrückten, so viele Viren wie möglich zu katalogisieren.
»Sieht so aus, als hätten wir zahlreiche Freiwillige«, bemerkte Remy, als er zu Frank aufschloss.
Der Pathologe zeigte auf das Netz, das eine Engstelle des Gangs versperrte. Dunkle Schemen hatten sich darin verfangen wie pelzige schwarze Früchte, insgesamt etwa zwei Dutzend Fledermäuse unterschiedlicher Größe. Die Tiere bewegten sich, als sie sich ihnen näherten.
»Ganz ruhig, ihr Kleinen«, sagte Frank. »Wir wollen euch nichts tun.«
Frank nahm den Rucksack ab und kniete nieder. Er zog eine Spritze mit einer beruhigenden Mischung aus Acepromazin und Butorphanol auf. Dann streifte er dicke Gummihandschuhe über, damit er nicht gebissen wurde. Die Spritze in der Hand, fing er oben an und arbeitete sich an den gefangenen Fledermäusen nach unten vor. Die Dosis passte er der Größe an und verabreichte den Tieren nicht mehr als einen Tropfen. Als er unten angelangt war, waren die oberen bereits in Starre verfallen.
»Helfen Sie mir, das Netz zu lösen?«, sagte Frank zu Remy.
Sie hakten die Falle los und machten den Gang wieder frei. Mehrere Fledermäuse nutzten die Gelegenheit und flatterten über sie hinweg. Frank breitete das Netz mit den schlummernden Tieren auf dem Höhlenboden aus.
An die Arbeit.
18:28
Frank kniete inmitten von Tupfern, Spritzen und kleinen Glaspipetten. Schweiß tropfte ihm von der Stirn und brannte ihm in den Augen, die bereits vom Ammoniak verströmenden Guano gereizt waren.
Vielleicht hätte ich ein Atemgerät mitnehmen sollen.
Er atmete so schnell, wie es möglich war, ohne das Risiko einer Kontamination der Proben einzugehen. Er hielt eine schlaffe Rundblattfledermaus hoch, Hipposideros gigas. Remy half ihm, einen Flügel zu strecken, damit er eine Blutprobe entnehmen konnte. Außerdem nahm er Abstriche aus dem Rachenraum und vom After.
Frank betrachtete das zarte Wesen eingehend. Der glockenförmige Bauch war samtweich. Die Nasenlöcher waren winzig. Die Membran der dünnen, ledrigen Schwingen wirkte im Licht von Remys Helmleuchte durchscheinend.
Remy beugte sich vor. »Dr. Whitaker, dürfte ich fragen, weshalb Sie sich bei Ihren Studien auf Fledermäuse konzentrieren?«
Frank setzte sich auf die Hacken und markierte mit einem Wachsstift die Probe, die er in der Hand hielt. »Vor allem deshalb, weil diese kleinen Burschen so stark mit Viren befrachtet sind. Sie tragen nicht nur von Natur aus Hunderte Spezies in sich, sondern dienen auch als Reservoirs für Umweltviren. Von den Insekten, die sie fressen, nehmen sie alle möglichen Viren auf. Sogar Pflanzenviren im Falle der Obst fressenden Fledermäuse. Es wäre wundervoll, wenn wir die Virosphäre aller Wirbeltiere, Wirbellosen und Pflanzen untersuchen könnten. Aber das ist weder praktikabel noch möglich. Fledermäuse sind ein hervorragender Ersatz, um zu dokumentieren, was in der Umwelt auf der Lauer liegt.«
»Ich verstehe«, sagte Remy. »Aber ich frage mich, weshalb die Fledermäuse trotz der vielen Viren nicht erkranken.«
Frank legte die Rundblattfledermaus auf den Boden und löste die nächste aus dem Netz, offenbar ein Flughund, Rousettus aegyptiacus.
»Aus drei Gründen«, antwortete Frank. »Erstens sind Fledermäuse wahre Meister, was ihr Immunsystem angeht. Offenbar haben sie diese Fähigkeit entwickelt, weil sie das einzige Säugetier sind, das fliegen kann.« Er entfaltete die große Schwinge, pikste eine Ader mit einer Nadel und saugte mit der Pipette ein paar Blutstropfen an. »Dafür braucht es einen Metabolismus im Hyperdrive. Die metabolisch erzeugte Wärme versetzt die kleinen Körper in einen Dauerfieberzustand, der Infektionen unterdrückt.«
Frank legte die Pipette weg und nahm einen Tupfer in die Hand. »Der zweite und noch wichtigere Grund ist, dass ein so hochtouriger Metabolismus eine Menge Entzündungsmoleküle produziert, die tödlich sein können. Als Gegenreaktion haben die Fledermäuse im Lauf ihrer Evolution zehn Gene ausgeschaltet. Dadurch wurde die Entzündungsreaktion gedämpft und das Immunsystem an einer Überreaktion, dem sogenannten Zytokinsturm, der für viele Todesfälle bei Virusinfektionen verantwortlich ist, gehindert. Entzündungen sind ein wichtiger Grund für das Altern, und dank der Dämpfung werden Fledermäuse bis zu vierzig Jahre alt, was für ein so kleines Säugetier erstaunlich ist.«
Frank hielt den Tupfer hoch, und Remy zog das Maul des Testobjekts auf und entblößte die messerscharfen Zähne.
»Sie sagten, es gebe drei Gründe, weshalb Fledermäuse nicht erkranken«, sagte Remy. »Wie lautet der dritte?«
»Ah, die Antwort findet sich in der DNA. Der größte Teil ihres genetischen Codes – und übrigens auch des unseren – enthält Bruchstücke alten Virencodes, DNA-Fragmente, die bei einem früheren Befall ins Genom übernommen wurden. Fledermäuse nutzen diese Gene auf einzigartige Weise. Sie können sie abspalten und im zellulären Cytoplasma in Antikörperfabriken umwandeln.«
»Wodurch sie gesund bleiben.« Remy schüttelte bedauernd den Kopf. »Wenn wir ihnen das nur nachmachen könnten. Mein Team bekämpft noch immer Ebola-Ausbrüche in Afrika. Kaum haben wir einen unter Kontrolle gebracht, flammt auch schon der nächste auf.«
Frank nickte grimmig. Er hatte die Probenentnahme am Flughund beendet und suchte weiter das Netz ab. Es war leer.
»Wie es aussieht, sind uns die Freiwilligen ausgegangen«, meinte Frank.
»Macht nichts. Die Sonne geht bald unter. Wir sollten umkehren.«
Frank war einverstanden, denn er wollte nicht im Dunkeln zum Lager zurückmarschieren. Gemeinsam machten sie sich ans Aufräumen. Frank verpackte die letzten Proben, während Remy das Netz aufsammelte. Dann marschierten sie los. Die Testobjekte, die sie zurückließen, würden bald aufwachen und ihren Schlafplatz aufsuchen.
Frank beobachtete, wie sich die ersten beiden Fledermäuse taumelnd in die Luft erhoben. »Wir sollten hier weg sein, bevor die anderen aufwachen.«
»Wieso das?«
»Normalerweise haben Fledermäuse ihre Virenlast unter Kontrolle, aber wenn sie gestört werden oder Angst bekommen, bricht ihr kompliziertes Immunsystem zusammen. Dann vermehren sich die Viren, und die Ansteckungsgefahr nimmt zu.« Frank blickte Remy an. »Nicht vergessen: Gestresste Fledermäuse sind gefährlich.«
»Werd ich mir merken.«
Remy schritt schneller aus und blickte sich hin und wieder besorgt um. Bald darauf gelangten sie zum überfluteten Bereich und wateten zum Eingang zurück. Frank hielt im Wasser nach rot leuchtenden Augen Ausschau, doch es waren keine zu sehen. Offenbar hatten sich die Krokodile wegen des Lärms in andere Höhlenbereiche verzogen.
»Wie geht es weiter?«, fragte Remy und wies mit dem Kinn auf Franks Rucksack. »Was machen Sie mit all den Proben?«
»Ich bringe sie in das mobile Labor im Lager. Dann führe ich eine Polymerase-Kettenreaktion durch und gleiche die viralen Antigensequenzen mit einer genetischen Datenbank ab. Damit kann ich die bekannten Viren katalogisieren. Ich habe auch Reagenzien und geschachtelte Primer für die Identifikation unbekannter Viren entwickelt. Die Methode ist noch nicht ausgereift, aber mittels SISPA – Einzelprimer-Amplifikation – kann ich Linker-Adaptoren einer bekannten Sequenz mit einer unbekannten Sequenz verbinden, um auf diese Weise …«
Remy hob abwehrend die Hand. »Schon gut.«
Frank lächelte. »Verzeihung. Mehr kann ich vor Ort nicht machen. Die Methode der Wahl wäre natürlich, die unbekannten Viren mit einer Zellkultur zu vermehren. Aber das ist außerhalb einer geschützten Einrichtung wie zum Beispiel Ihrem Forschungszentrum in Frankreich zu gefährlich.«
Er beneidete Remy und dessen Team um das CIRMF. Dort gab es ein Primatenlabor und ein Sicherheitslabor der Stufe vier. Hätte ich etwas Derartiges zur Verfügung …
Remy ahnte, was in ihm vorging. »Wenn Sie eine interessante Entdeckung machen, könnten wir eine Isolationsstudie durchführen. Insbesondere von den Proben, die in Westafrika genommen wurden. Man sollte wissen, was kommt, bevor es zum Problem wird.«
»Deshalb bin ich hier. Und weil ich herausfinden will, wie viele Mückenstiche ein Mensch aushalten kann, bevor er in den Wahnsinn getrieben wird.«
Remy hob eine Braue. »Dieses Rätsel werden wir sicherlich lösen, Dr. Whitaker. Bei den vielen Unwettern hier.«
»Wohl wahr.« Frank blickte sich zum dunklen Wasserlauf um. »Wenn der Wasserstand steigt, werden die armen Krokodile vielleicht wieder in die Außenwelt gespült.«
Remy zeigte nach vorn. »Im Moment wäre ich schon froh, wenn ich endlich das Tageslicht wiedersehen würde.«
19:22
Eine halbe Stunde später machte Frank in der Ferne, über dem schwarzen Wasser, einen Lichtschimmer aus.
Remy hatte ihn auch bemerkt. »Dieu merci …«, sagte er und seufzte.
Angezogen vom Licht, stapften sie zum Höhleneingang. Japsend näherte Frank sich der Stelle. Eine zwei Meter lange Strickleiter führte zur Ausgangsöffnung hoch. Daneben strömte ein kleiner Wasserfall in die Höhle, der einen feinen Nebel erzeugte.
Frank blickte ins Helle und nahm Schutzbrille und Maske ab. Tief atmete er die frische, ammoniakfreie Luft ein. Die Hitze aber war erdrückend. Obwohl es auf Sonnenuntergang zuging, war es noch heißer geworden. Die Luftfeuchtigkeit betrug bestimmt hundertzehn Prozent.
Remy kletterte als Erster die schwankende Strickleiter hoch. Frank folgte ihm mit dem schweren Rucksack. Oben angelangt, half ihm Remy, aus der farnbewachsenen Grotte zu kriechen.
Ächzend richtete Frank sich auf und wandte sich der nächsten Herausforderung zu. Ein Trampelpfad führte durch den dichten Dschungel. Bis zum Lager stand ihnen noch ein Fußmarsch von zwei Meilen bevor. Er hoffte, dass sie es erreichen würden, bevor die Sonne vollständig unterging. Sie stand bereits dicht über dem Horizont.
Nach einem großen Schluck aus der Wasserflasche marschierten sie los. Sie waren beide zu müde, um sich zu unterhalten. Nach einer Viertelmeile war Franks Overall durchgeschwitzt. Er überlegte, ob er ihn ausziehen sollte, doch die Anstrengung war ihm zu viel. Außerdem schützte der Overall vor den Mücken, die sie umschwirrten.
Wo sind die Fledermäuse, wenn man sie braucht?
Plötzlich hielt der vorausgehende Remy an.
Frank wäre beinahe gegen ihn geprallt. »Was ist los?«
Der Pathologe trat beiseite und zeigte auf den fliegenübersäten Dunghaufen mitten auf dem Weg. »Ein Waldelefant. Ganz frisch.«
Frank zuckte mit den Schultern. Im gabunischen Regenwald gab es Herden dieser schwerfälligen Riesen. Man hatte ihn über ihr Revierverhalten informiert. Nicht, dass er den Tieren ihr Temperament verübelt hätte, zumal in Anbetracht der vielen Wilderer hier draußen. In den vergangenen zehn Jahren waren achtzig Prozent der gabunischen Elefanten wegen ihrer Stoßzähne getötet worden.
»Wir sollten uns von hier ab leise verhalten«, sagte Remy und trat am großen Dunghaufen vorbei. Er legte die Hand auf sein Pistolenhalfter, im Dschungel eine notwendige Vorsichtsmaßnahme, die nicht nur der Abwehr von wilden Tieren galt. Die kleine Pistole könnte gegen einen angreifenden Elefantenbullen zwar nichts ausrichten, aber vielleicht würde der laute Knall ihn vertreiben.
Das wollen wir jedenfalls hoffen.
Sie gingen weiter. Frank hielt streckenweise die Luft an und lauschte auf Trompeten- oder Trampelgeräusche. Im Wald wurde es immer dunkler, die Umgebung wurde in Schatten gehüllt.
Dann hörten sie es beide. Es kam von vorn.
Zweige knackten, Laub raschelte.
Frank erstarrte.
Remy löste den Sicherungsriemen des Holsters und zog die Waffe halb hervor. Er stellte sich breitbeinig hin und flüsterte atemlos: »Verdrücken Sie sich beim ersten Anzeichen von Gefahr ins Gebüsch.«
Frank schluckte und nickte.
Die Geräusche wurden lauter – dann kam hinter einer Biegung des schmalen Pfads ein Tier hervor. Doch es war kein Waldelefant. Ein großer Hund gelangte in Sicht, im Zwielicht kaum zu erkennen. Den Kopf hatte er gereckt, die Ohren aufgestellt. Er knurrte leise.
Im nächsten Moment tauchten zwei Männer in Tarnanzügen auf, bewaffnet mit Gewehren.
Zunächst hielt Frank sie für Wilderer. Als der Hund jedoch näher kam, erkannte er die roten Kappen und die Uniformen der gabunesischen Streitkräfte. Ihnen folgte ein sonnengebräunter Mann mit struppigem blondem Haar. Er trug Zivilkleidung: abgenutzte Stiefel, Kakihose, luftiges, langärmliges Hemd und Baseballkappe.
Der Mann zwängte sich an den Soldaten vorbei und näherte sich Frank und Remy. Er streckte die Hand aus. »Dr. Whitaker, nehme ich an.«
Frank runzelte die Stirn über den abgestandenen Scherz, eine Anspielung auf den berühmten Satz des Kongo-Forschers Henry Morton Stanley: Dr. Livingstone, I presume.
Frank trat um Remy herum und begrüßte den Amerikaner, den er aus seiner Zeit als Armee-Veterinär gut kannte. Er ergriff dessen schwielige Hand, die ihn endgültig überzeugte, dass die Wiederbegegnung mitten im gabunesischen Regenwald real war.
»Tucker, was machst du denn hier?« Frank blickte den großen Hund an, der sich an den Mann schmiegte. Er hatte schwarz-braunes Fell und große Ohren. »Und Kane, wie ich sehe. Das letzte Mal habe ich euch beide in Bagdad gesehen, kurz vor meinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst.«
Captain Tucker Wayne war ein hochdekorierter Soldat und hatte als Kampfhundführer bei den Army Rangers gedient. Auch Kane, sein Partner, hatte mehr Orden bekommen als die meisten Kämpfer.
Tucker zuckte mit den Schultern. »Ich soll eine Extraktion durchführen, unsere Spezialität.« Er tätschelte Kane die Flanke. »Offenbar hat jemand versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen. Als das nicht klappte, hat man sich an deine Vorgesetzten vom Smithsonian Institute gewandt. Anscheinend machst du dich rar.«
»Ich war heute die meiste Zeit unter der Erde«, erklärte Frank. »Aber ich verstehe nicht, weshalb man dich eingeschaltet hat.«
»Ich kenne eine Gruppe, die der Smithsonian-Stiftung nahesteht. Wegen der Dringlichkeit hat man sich an mich gewandt.« Tuckers verdrossene Miene ließ erkennen, dass er über den Auftrag nicht begeistert war. »Ich war in Südafrika, wo ich mich um eine Kapitalanlage gekümmert habe. Zusammen mit meinen Geschäftspartnern habe ich mir einen Ort im Norden Namibias angesehen, als mich der Anruf erreichte. Und als ich hörte, wen ich rausholen sollte … also, nachdem du im Krieg Kane geholfen hast, war ich dir einen Gefallen schuldig.«
»Aber warum ich? Weshalb braucht man mich?«
»In einem UN-Flüchtlingslager in der Demokratischen Republik Kongo gibt es einen Krankheitsausbruch. Offenbar spitzt sich die Lage zu. Deine Unterstützung wurde von einem Kinderarzt erbeten, der dort arbeitet und dich kennt. Von einem gewissen Jameson.«
Frank brauchte einen Moment, bis er den Namen unterbringen konnte, doch dann erinnerte er sich an den Arzt, den er vor einem Monat in Kinshasa kennengelernt hatte, der Hauptstadt der Republik Kongo. »Du meinst Cort? Cort Jameson?«
Tucker nickte.
Frank runzelte die Stirn. Der Kinderarzt hatte ihn dazu überredet, vor Vertretern der Ärzte ohne Grenzen einen Vortrag über zoonotische Krankheiten zu halten. Am Abend hatte Frank den Mann über seine Arbeit und seine Technik der Probennahme informiert.
»Jameson war in Panik«, sagte Tucker. »Er möchte, dass du dein Virenlabor mitbringst und den Ausbruch untersuchst. Das war vor acht Stunden. Als ich hier ankam, erhielt ich den zweiten Anruf. Er war stark gestört, im Hintergrund waren Schüsse und Geschrei zu hören.«
Frank zuckte zusammen. Offenbar wurde das Lager von Banditen oder einer der sich bekriegenden Milizen angegriffen.
»Der Anruf brach unvermittelt ab«, fuhr Tucker fort. »Weitere Anrufversuche scheiterten. Das kongolesische Militär wurde bereits entsandt, doch die UN bittet dich trotzdem, der Bitte deines Kollegen nachzukommen und bei der Untersuchung der dortigen Lage zu helfen.«
»Gern«, sagte Frank. »In einer Stunde habe ich das Labor verpackt.«
»Gut. Es steht eine vollbetankte Cessna bereit. Wir bringen dich damit nach Kisangani und von dort mit dem Helikopter zum Lager. Wenn das Wetter mitspielt, kannst du um Mitternacht Ortszeit dort sein.«
Frank bedeutete Tucker voranzugehen, doch der hielt ihn mit erhobenem Arm auf.
»Was noch?«, fragte Frank, dem das harte Funkeln in den blaugrünen Augen des Rangers auffiel.
»Der zweite Anruf. Ich konnte nur sehr wenig verstehen. Mit Ausnahme der letzten Worte deines Freundes.«
»Und die lauteten?«
Tucker sah ihm fest in die Augen. »Halten Sie sich fern. Bei Gott, kommen Sie nicht hierher.«
3
23. April, 22:44 CATProvinz Tshopo, Demokratische Republik Kongo
Charlotte schaute aus dem Plastikfenster des Behandlungszelts. Regen prasselte auf die Trümmer des Lagers. In den schwarzen Pfützen und Lachen spiegelten sich mehrere Feuer, die man brennen gelassen hatte.
Horden von Ameisen krabbelten durch den Morast und bedeckten fast alle Oberflächen. Ein paar geflügelte Exemplare – männliche Drohnen – schwirrten durch den Regen. Dort, wo es dunkel war, lagen Tote. Einige waren der Horde erlegen, andere erschossen worden.
An der anderen Seite des Weges, in der Nähe eines Stapels von Vorratskisten, schwankten Taschenlampen. Jameson und Byrne, der Schweizer Sanitäter, luden dort zusammen mit drei Einheimischen, die Gewehre geschultert hatten, Ausrüstung auf einen Pick-up. Die fünf Männer trugen Schutzanzüge, komplett mit Atemmaske und Schutzbrille. Die billigen Wegwerfanzüge hatten die niedrigste Schutzklasse, die bei Ansteckungsgefahr kaum ausreichte. Aber sie hinderten die schlammverdreckten Ameisen daran zu beißen.
Jameson gab seinem Team letzte Anweisungen zur Evakuierung der Einsatzgruppe. Nur wenige Personen blieben im Lager zurück. Die Zelte waren zerstört, überall lagen Kisten herum.
Wenigstens haben das Chaos und das Kämpfen aufgehört.
Den ganzen Tag über hatte Jameson sich bemüht, das Lager zusammenzuhalten. Unterstützt hatten ihn das ICCN-Team – Angehörige des Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, der sogenannten Öko-Brigade, die den Regenwald vor Wilderern und illegaler Nutzung schützte. Doch als immer mehr Ameisen ins Lager strömten und Gerüchte über den Ausbruch einer unbekannten Krankheit aufkamen, zerstob die Hoffnung, das Gebiet unter Quarantäne stellen zu können. Es kam zu Plünderungen, und es wurde geschossen, da die Öko-Brigade die medizinischen Vorräte des Teams und die ICCN-Trucks zu schützen versuchte. Es dauerte nicht lange, da hatte sich die Mehrheit der Lagerinsassen in den Dschungel geflüchtet.