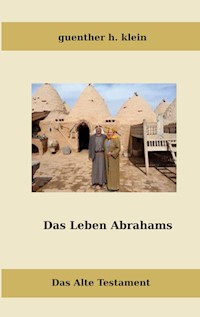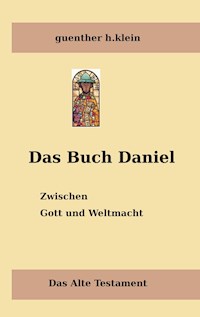
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Theologie und Philosophie
- Sprache: Deutsch
Das Buch Daniel zählt zu den Büchern mit apokalyptischem Inhalt. Es wollte zu allen Zeiten Menschen Zuversicht und Hoffnung geben. Dazu wird uns Daniel vorgestellt, der trotz einiger Angriffe an seinem Gott festhielt. Die zahlreichen im Buch enthaltenen Visionen sind entstanden aus den Konflikten zwischen den Weltmächten des Alten Orients und dem alten Israel. Zugleich war das Buch auch immer Anlass von allerhand Berechnungen und Spekulationen. Das Buch wurde in späterer Zeit verfasst. Es war die Zeit der Makkabäer (175 bis 134 v.Chr.).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Deutsche Bibliothek CIP – Einheitsaufnahme
Mit einer Abbildung und verschiedene Zeittafeln
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Am babylonischen Hof
1.1. Historische Hintergründe
1.2. Am königlichen Hof
Der Traum von den Weltreichen
Im Feuerofen
3.1. Die Rettung der drei Freunde
Der Traum des Königs
Das Gastmahl
5.1. Exkurs: Meder und Perser
Daniel in der Löwengrube
6.1. Die Rettung
Vision von den vier Tieren und dem Menschensohn
7.1. Die vier Tiere
7.2. Gottes Gegenschlag
Vision vom Widder und Ziegenbock
8.1. Das griechische Weltreich
Siebzig Siebenheiten
9.1. Weissagung der siebzig Siebenheiten
Die letzten Offenbarungen
Anhang A. Nachwort
Chronik nahöstlicher Reiche
Abbildungsverzeichnis
Sachverzeichnis
Bibelstellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
VORWORT
IM VORDERGRUND dieser Betrachtung steht das Buch Daniel.1 Das Buch wurde als eines der letzten dem biblischen Kanon hinzugefügt.
An der zeitlichen Einordnung Daniels gibt es keine Zweifel. Er hat zur Zeit des Königs Jojakim von Juda gelebt; man schreibt das Jahr um 600 v.Chr. Zur damaligen Zeit zog der legendäre neubabylonische König Nebukadnezar zum ersten Mal nach Jerusalem. Er nahm Jojakim in Ketten gefangen. Er starb dort 598 v.Chr. Diese zeitliche Entfernung von damals zu heute beträgt annähernd rund 2800 Jahre. Nicht nur diese große Zeitspanne macht Schwierigkeiten, das Buch einzuordnen, sondern auch was Sprache, Eigenarten und Bräuche sowohl der gesamten nahöstlichen Völker als auch der Juden betreffen.
Mit diesen wenigen Worten wird bereits deutlich, um was es geht. Das Buch Daniel und die gleichnamige Person betrachte ich aus historischer Sicht. Das Buch Daniel ist in die Geschichte des Alten Orients einverwoben. Davon ist es sich nicht wegdenkbar. Die Träume, die er selbst hatte, und die die nahöstlichen Könige hatten, will er deuten. Auch im späteren Verlauf des biblischen Buches gibt es weitere Träume. Diese hat er aber nicht selbst, und das ist erstaunlich, sondern wurden durch Schriftgelehrte erdacht und niedergeschrieben. Das bezeugt ein einziger biblischer Vers, der im ersten Kapitel steht.
Als Daniel und seine drei Freunde durch den König Nebukadnezar nach Babel deportiert wurden, waren sie noch jung. Dabei besteht keine Übereinstimmung zwischen einzelnen Bibelübersetzungen, was das Alter angeht. Während hebräische Bibeln Daniel einen Knaben heißen, machen die Luther- und die Elberfelder-Übersetzung einen jungen Mann daraus. Im Wesentlichen war man sich nicht klar darüber, wie man das Alter Daniels am besten bestimmen könnte. Über das genaue Alter schweigt die Bibel. Man kann aber von einem Lebensalter von etwa 10–12 Jahren ausgehen, als sie nach Babel geführt wurden. Als Zeitpunkt der ersten Wegführung waren die Jahre 600-598. Für unsere Ohren klingt der »junge Mann« vertrauter als »Knaben«. Diese Erörterung des Lebensalters Daniels ist nicht erforderlich, näher bestimmt zu werden. Das gibt auch Raum für Spekulationen. Das Lebensalter Daniels reichte von etwa 615 bis zum ersten Jahr des persischen Königs Kyrus (Regierungszeit von 559 bis 529 v.Chr.). Damals dürfte Daniel rund 55 Jahre alt gewesen sein, als er starb oder anderweitige Aufgaben übernahm. Bei solchen Berechnungen sollte eines nicht vergessen werden: Die Regierungszeit Nebukadnezar war zu Ende. Damit waren auch Verfolgungen und Unterjochungen vorbei. Mit dem persischen König Kyros begann es neues Zeitalter.
Das biblische Buch umfasste eine Zeitspanne von mehr als 450 Jahren. Das ist der Grund dafür, dass weitere Autoren sich des Buchs angenommen und Zusätze angebracht haben. Das 8. Kapitel beinhaltet die Vision vom Widder und Ziegenbock.
Ein weiterer Punkt gilt es noch zu berücksichtigen: Alle orientalischen Sprachen lieben die Begeisterung der Rede, den Schwung der Dichtung, die blumige Ausdrucksweise, die Schlichtheit der Prosa und das herzzerreißende Klagen bei Leid und Tod. Der Psalmist steht unter diesem Eindruck und schreibt:
Psalm 137,1:
»An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten.«
Das wird deshalb in dieser Ausführlichkeit erwähnt, weil unsere Sprache von Rationalität geprägt ist, während die Sprache und das Lebensgefühl der damaligen Menschen mehr emotionaler Art ist. Diese Empfindungen, Sehnsüchte und Erwartungen können heute nicht mehr nachvollzogen werden. Daher kann das Buch Daniel nur aus zeitlicher Distanz betrachtet werden. Es versteht sich von selbst, dass man die damalige Zeit nicht zurückholen kann. So sind die einzelnen Episoden des Buchs mit der inneren Erwartungshaltung des jüdischen Volkes verbunden, die von Verfolgung und Demütigung geprägt waren.
Der Gott der Juden steht im Widerspruch zu den damaligen Weltmächten Assyrien, Babylonien, Persien und Makedonien (Griechenland). Das Buch Daniel beschreibt solche Auseinandersetzungen. Dazu gibt es noch weitere Besonderheiten zu erwähnen.
Israel als kleines Land konnte militärisch wenig gegen die damaligen Weltmächte ausrichten. Was blieb waren ihre Sehnsüchte und Erwartungen, die sie an ihren Gott richteten. Er sollte für sein Volk streiten, wenn möglich für sie gewinnen.
Daniel deutet die Träume und Visionen der altorientalischen Könige. Er zeigte sich dabei als weitaus Kundiger als die übrigen Traumdeuter. Bei solchen nächtlichen Traumdeutungen ging Daniel regelmäßig als Sieger hervor. Daniel gibt einesteils als ein gottesfürchtiger Mann und andererseits deutet er die Träume der weltlichen Könige. Dieser Spagat – Daniel zwischen Gott und Weltreich – ist ein weiterer Inhalt des Buchs Daniel. Damit ist ein Epos entstanden, das wir heute vor uns haben.
Mit den Kapiteln 7-12 hat Daniel selbst wiederholt Träume, die er sich selbst deutet und sich sogar auslegen lässt. Diese Kapitel gehören zu den Besonderheiten des biblischen Buchs. Ausgehend davon, dass das Volk Israel nichts gegen die herrschenden Weltreiche ausrichten konnte und ausgehend davon, dass Daniel bzw. die Schreibschulen um Daniel – es waren Priester, Schriftgelehrte und fromme Schriftkundige – welche die irdischen Weltreiche in himmlische Örter verlegten; sie taten so, als hätte Anfang und Ende der Weltreiche bereits im Himmel stattgefunden. Aus diesem Grund erscheinen zur passenden Zeit die Erzengel Gabriel und Michael, die auf die realen Weltreiche Einfluss nahmen.
Wie bereits gesagt, betrachte ich das Buch Daniel aus historischer Sicht. Begriffe wie Träume, Traumgesichte und Visionen spielen nur am Rand eine Rolle. Solcherlei Begriffe finden nur nachts statt. Solche nächtlichen Ereignisse wurden gesammelt und später zu einer Schrift zusammengefasst. Der Aufbau des biblischen Buchs Daniel geschah zunächst während der Zeit des Königs Nebukadnezars. Darüber hinaus reicht das Buch Daniel bis weit in die griechische Zeit hinein. Daher war Daniel nicht mehr der Verfasser, sondern es werden jüdische Persönlichkeiten gewesen sein, die das Buch während oder zum Ende der makkabäischen Freiheitskämpfe fertig geschrieben haben. Die Herrschaft der Griechen reichte bis etwa 130 v.Chr. Das biblische Buch Daniel umfasst einen Zeitraum von 600 bis 130 v.Chr. und damit rund 470 Jahre.
Die Epoche der Juden geht von 175 bis 134 v.Chr. Das war die Zeit der Makkabäer2. Das waren Juden, die sich gegen die hellenistische Herrschaft und sich vor allem gegen die Herrschaft des Antiochos Epiphanes aufgelehnt hatten.
Ein weiterer Punkt, der zu Fragen Anlass gibt, ist das, was Sprache angeht. Die zu Anfang verwendete hebräische Sprache geht von Kapitel 2,4 bis 7,28 ins Aramäische über, kehrt dann am Schluss des Buchs wieder zur hebräischen Sprache zurück. Glaubt man den alten Gelehrten, wurde die aramäische Sprache, die zur Quadratschrift zählte, zusammen mit der babylonischen Sprache gesprochen. Die eigentliche hebräische Sprache sei vom einfachen Volk gesprochen worden. Es werden auch Samaritaner genannt, welche die hebräische Sprache gepflegt haben sollen. Daher haben am Buch Daniel entsprechend sprachlich versierte Gelehrte mitgewirkt.
Dass man sich mit Hilfe der Sprache verständigen konnte, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die Schwierigkeit liegt jedoch darin, die gesprochene Sprache schriftlich zu fixieren, damit sie auch von anderen Menschen gelesen werden konnte. Das ist ein Spezialgebiet, das zwar höchst interessant ist, hier aber nicht behandelt werden soll. Fast am Buchende ist ein Keilschrifttext eingefügt. Auch die sprachlichen Anredeformen wechseln, ohne dass ein Grund ersichtlich wäre. Daniel spricht zunächst in der dritten Person, dann redet er bisweilen selbst in der ersten und sogar der König Nebukadnezar kommt in der ersten Person zu Wort. All das zeigt, dass geschichtliche und sprachliche Verflechtungen in das Buch eingeflossen sind, die sich der einfachen Deutung entgegenstellen. Zum Leidwesen des Buch gehört es, dass Daniel bzw. die Schriftgelehrten Namen Gottes nur indirekt verwendeten.
Das Buch Daniel hat in unserer westlichen Kultur nicht mehr die Bedeutung, die sie damals hatten. Prophetie und Vorhersage gab es damals. Man meint im Buch Daniel gäbe es Vorhersagen, die sich auf Jesus Christus und auf das Ende der Welt beziehen würden, das ist nicht möglich. Es sind die Siebzig Siebenheiten, die mit 490 Jahren gleichgesetzt wurden, und so auf das Kommen von Jesus Christus hingerechnet wurden. Der Beginn der Wegführung, es sind die Jahre um 597 – würde man davon 490 Jahre abziehen, blieben 107Jahre übrig. Das könnte man als das Ende der griechischen Herrschaft annehmen und lässt den Beginn der römischen Dynastie ahnen.
In einem Elaborat war zu lesen, die Eisen- und Tonteile der Bildsäule hätten sich auf das von Gorbatschow regierte Sowjetreich bezogen. Als bei der damaligen Sowjetunion der wirtschaftliche Niedergang nicht zu vermeiden war, wird Daniel angeführt, der das alles längst vorausgesehen hätte.
Solche Gedanken gehören nicht in das Buch Daniel und sind ihm auch fremd. Was in 1000 Jahren eintreffen könnte, ist im Voraus nicht bestimmbar und steht noch nicht einmal in den Sternen. Bekanntlich waren die Chaldäer die ersten, die Sternkunde betrieben haben und meinten, in die Zukunft sehen zu können. Was die heutige Prophetie, Vorhersage und Zukunftsschau angeht, steht vielfach der Wunsch nach Deutung von Prophetie, Vorhersage und Zukunftsschau an erster Stelle. An zweiter Stelle würde erst die Realität kommen. So liest man etwas und denkt sich etwas in das Buch Daniel hinein, was dort nicht steht.
Zu erwähnen wäre noch die Reihenfolge der nahöstlichen Könige. Im Buch Daniel ist eine zeitliche Ordnung von Königen angeführt, die es so nicht bestimmbar ist. Das betrifft besonders den König Darius. Der biblische Text nennt ihn den König der Meder. Aber Darius oder Dareios3 war Perser, aber kein Meder, obwohl nach griechischen Quellen Perser und Meder als ein Volk bezeichnet werden. Ein anderer Darius ist nicht bekannt.
Dieser Dareios war Nachfolger des Kambyses, der wieder der Sohn des Kyrus bzw. Kores war. Dieser Kores gilt als Begründer des Persischen Reichs. Gleiches lässt sich auch zum Vizekönig Belschazzar sagen. In der Bibel wird er als Sohn Nebukadnezars vorgestellt. Das trifft nicht zu. Belschazzar war der Sohn des Königs Nabonid (Nabû-n-id, d.h. »Nabu ist erhaben«). Dieser letzte König des neubabylonischen Reichs weilte aus unerfindlichen Gründen 10 Jahre in der Einöde. Flüchtete er aus seiner Verantwortung? So wurde Belschazzar Vizekönig. Dass sich Könige aus dem »Staub» machen, ist nicht neu.
Bei vielfacher Kritik an der biblischen Geschichte darf eines nicht vergessen werden: Erst durch die Nennung der Könige und Königreiche in der Bibel haben Forschungen, Nachforschungen und Archäologie erst begonnen. Umgekehrt kann gesagt werden, wenn es die damaligen Könige und Königreiche nicht gegeben hätte, dann wäre längst Ruhe und Frieden eingekehrt. So aber bleiben Prophetien, Wahrsagungen, Deutungen und Missdeutungen.
Anmerkungen:
Die verwendeten biblischen Texte wurden der Einheitsübersetzung (EÜ) entnommen. Diese Schrift schreibt den Großkönig Nebukadnezar mit zwei zz (Nebukadnezzar). Die EÜ enthält Zusätze zum Buch Daniel, die nur in griechischer Sprache vorliegen. Sie wurden hier weggelassen. Im Folgenden ist der biblische Text eingerückt und zudem in kleinerer Schrift gesetzt. Kommentare, Exkurse und Auslegungen stehen im normalen Schriftbild. Kleine eckige Klammern mit einer Zahl z.B. [11] weisen auf das Abbildungsverzeichnis hin. Neben der Bibliographie wurden zwei verschiedene Indexe realisiert.
1hebr.
2Benannt nach dem Ehrennamen Makkaba d.h. Hämmerer.
3Besitzer des Guten
KAPITEL 1 AM BABYLONISCHEN HOF
Daniel und seine Freunde am babylonischen Hof
Der biblische und historische Bericht beginnt mit der Vorstellung des jüdischen Königs Jojakim, wird dann weiter geführt durch Nebukadnezar, des neubabylonischen Herrschers, der die Stadt Jerusalem belagerte. Hierzu der folgende Bericht:
1Im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Jojakim von Juda zog Nebukadnezzar, der König von Babel, gegen Jerusalem und belagerte es. 2Und der Herr gab König Jojakim von Juda sowie einen Teil der Geräte aus dem Haus Gottes in Nebukadnezars Gewalt. Er verschleppte sie in das Land Schinar, in den Tempel seines Gottes, die Geräte aber brachte er in das Schatzhaus seines Gottes.
1.1. Historische Hintergründe
Das erste Weltreich, das neuassyrische Reich mit der Hauptstadt Ninive, wurde durch das zweite Weltreich, das neubabylonische, abgelöst. Neben weiteren neuassyrischen Königen, ist der letzte König Assyriens, Assurbanipal (669–627 v.Chr.), von Bedeutung. Nach seinem Tod (627) sind es nur noch 18 Jahre, dann gehörte das Land Assyrien der Geschichte an.
Im Jahr 626 v.Chr. schuf der chaldäische General Nabopolassar (Nabu-aplu-usur), der sich selbst »Der Sohn eines Niemand« nennt, das neubabylonische Reich. In Allianz mit dem Mederkönig Kyaxares griffen sie das assyrische Reich an. Als erste große Stadt fiel Assur, dann die Hauptstadt Ninive. Die Neubabylonier und die Meder waren jetzt die uneingeschränkten Herrscher im Zweistromland, das als Kerngebiet die Flüsse Euphrat und Tigris umfasste.
In Sorge um das Gleichgewicht der Kräfte griff ein weiteres Weltreich, Ägypten, in das Geschehen ein. Der Pharao Necho II. unterstütze Assyrien nach Kräften. Er griff mit seinen Soldaten und mit dem Überrest Assyriens die Verbündeten Babylonier und Meder an. Die entscheidende Schlacht fand bei der Stadt Karkemisch statt. Der chaldäische König Nabopolassar zog sich entweder dabei tödliche Verwundungen zu oder er war für ein erfolgreiches Kriegsgeschäft nicht mehr jung genug. Er übertrug das Kommando an seinen Sohn, den Kronprinzen Nebukadnezar II., kurz Nebukadnezar4 genannt. Er besiegte die Weltmacht Ägypten. Das geschah um 607 v.Chr. Das neubabylonische (chaldäische) Reich zählte gemeinsam mit dem medischen zu den ersten Weltmacht, die im Buch Daniel in den ersten Kapiteln erwähnt ist. Diese Begebenheit ist im Buch Jeremia, 46,2, nachzulesen:
Die Niederlage am Euphrat:
„Über Ägypten: Gegen das Heer des Pharao Necho, des Königs von Ägypten, das bei Karkemisch am Euphrat stand und das Nebukadnezzar, der König von Babel, geschlagen hat. Es war im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Joschijas, des Königs von Juda.“
Im Jahr 605 v.Chr. machte der Pharao Necho einen zweiten Versuch (der erste war 609), den völligen Untergang des Assyrerreichs zu verhindern, als Nebukadnezzars wieder heranrückte. Der König von Ägypten wünschte ein erstarktes Assyrerreich, das als Pufferstaat zwischen seinem und dem Chaldäerreich dienen sollte. Der Versuch schlug fehl. Der letzte Rest des Assyrerreichs ging 605 v.Chr. unter. Diese Schlacht trug sich bei der Stadt Karkemisch zu. Sie liegt im westlichen Teil des Euphratbogens.
Die neuen Herrscher teilten die neue Welt unter sich auf. Die Meder besetzten das assyrische Kerngebiet im Norden bis Harran und Allepo. Den Babyloniern fiel der Großteil Mesopotamiens zu. Sie beanspruchten außerdem Gebiete westlich des Euphrat, also Syrien und Palästina. In diese Welt der Sieger wird der junge jüdische Mann, Daniel, neben vielen weiteren Personen verschleppt. Er, der von zu Hause nur seinen monotheistischen Gott kannte, kommt in Konflikt mit der Übermacht der heidnischen Götzenwelt. Diese innere Anspannung, der Zwiespalt, die bei einigen deportierter Juden zur Anpassung geführt haben mag, wird auch bei Daniel mit seinen drei Freunden zum inneren Widerstreit geführt haben. Sie blieben aber standhaft und beteten nicht die heidnischen Götzen an, wie der biblische Bericht besagt.
Als der Großkönig Nebukadnezar (Reg.-Zeit 605-562 v.Chr.) Jerusalem belagerte, hatte das kleine Juda mit der Hauptstadt Jerusalem5 keine Chance. Der König beschlagnahmte die Tempelschätze und die Schätze aus dem königlichen Palast, auch wenn es heißt, dass der König Jojakim ihm die heiligen Gegenstände gab. Der Name des Königs Jojakim war nicht sein eigentlicher Name. Der besagte Pharao Necho hatte den ursprünglichen Namen, Eljakim, in Jojakim umbenannt (2Kön 23,24). Im Übrigen hatte Jojakim bzw. Eljakim (Herrschaft von 609-598 v.Chr.) auf den ägyptischen Herrscher gesetzt, als dieser die Weltmacht Babylonien und Medien angriff. Er ermunterte ihn sogar, gegen den neuen Aramäerstaat zu opponieren. Er, Necho, würde ihm dabei helfen. Der jüdische König erwies sich im königlichen Spiel als einer der größten Verlierer. Das trug sich im Jahre 601 v.Chr. zu. In 2.Könige 24 steht mehr über den jüdischen König zu lesen.
Der babylonische Großkönig nahm nicht nur Schätze aus dem Tempel, sondern auch die aus des Königs Palast mit. Zusätzlich waren noch Räuberscharen, die aus Chaldäern, Aramäern, Moabitern und Ammonitern bestanden, unterwegs, um die letzten Reste der Stadt zu plündern. Das Reich Juda endete mit der Verbrennung der Stadt Jerusalem (2Kön 25 ff). Das geschah im Jahr 586 v.Chr.
Um welche Tempelgeräte es sich dabei handelte, die der chaldäische König mitnahm, ist in 1.Könige 7 ff. nachzulesen. Das Land Schinar, das in Vers 2 erwähnt wird, ist das Land zwischen den Flüssen. Damit sind die Flüsse Euphrat und Tigris gemeint. Nach den Kriegen, Plünderungen und Auslöschen des assyrischen Reichs steht die neue Weltmacht, die Allianz zwischen Babylonien und Medien im neuen Glanz vor der Weltöffentlichkeit.
Die Bezeichnung »Chaldäer« war weniger eine Bezeichnung für ein Volk, eher Bezeichnung für eine Gelehrtenschaft - eben die Chaldäer. Hierzu gehörten: Zeichendeuter, Wolkenbeschauer, Omendeuter, Salbpriester (Reinigung der Statuen mit Öl), Magier, und Leberbeschauer. Sie alle dienten dazu, die Könige damit mit Rat zur Verfügung zu stehen. Das ist nichts anderes als Hokuspokus. Heute nennt man das ›Rat der Weisen‹.
1.2. Am königlichen Hof
Der weitere biblische Bericht:
3Dann befahl der König seinem Oberkämmerer Aschpenas, einige junge Israeliten an den Hof zu bringen, Söhne von königlicher Abkunft oder wenigstens aus vornehmer Familie; sie sollten frei von jedem Fehler sein, schön an Gestalt, in aller Weisheit unterrichtet und reich an Kenntnissen; 4sie sollten einsichtig und verständig sein und geeignet, im Palast des Königs Dienst zu tun; Aschpenas sollte sie auch in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten. 5Als tägliche Kost wies ihnen der König Speisen und Wein von der königlichen Tafel zu. Sie sollten drei Jahre lang ausgebildet werden und dann in den Dienst des Königs treten. 6Unter diesen jungen Männern waren aus dem Stamm Juda Daniel, Hananja, Mischaël und Asarja. 7Der Oberkämmerer gab ihnen andere Namen: Daniel nannte er Beltschazzar, Hananja Schadrach, Mischaël Meschach und Asarja Abed-Nego.
Kurzum: Die gemeinsamen Namen Gottes, EL, Elohim, lassen die Verflechtung der alten orientalischen Völker erkennen.8 Dieses Bild des Stieres hat sogar in der Bibel Eingang gefunden. Nach 5.Mose 33,17. wird in Zusammenhang mit Josef von „dem Erstling seines Stieres“ gesprochen. Josef gilt dem Schreiber als Gottes Erstgeborener.
Was das Alter der vier Jünglinge zur Zeit ihrer Deportation betrifft, lässt sich keine eindeutige Zeit festmachen. Jüdische Bibeln verwenden für die vier Freunde die Bezeichnung „Knabe“. Ein Knabe ist noch kein geschlechtsreifer Mann. Demzufolge kann man das Alter mit rund 10 Jahren annehmen. Liest man aber die in Deutschland bekannten Übersetzungen z.B. Luther nennt man Knaben junge Männer. Nur die Neue Genfer Übersetzung verwendet eine andere Aussage. Sie spricht von den „Söhnen Israels“; sie macht damit wohlweislich keine Altersangabe. Für die jungen Männer können wir ein Alter von rund 20 Jahren annehmen. Das trug sich im dritten Jahr des jüdischen Königs Jojakims zu (Daniel 1,1). Man schreibt das Jahr 606 v.Chr. Das Geburtsdatum Daniels schwangt damit zwischen 616 (606 +10 )und 626 Jahren. Da nach Vers 21 Daniel bis zum ersten Jahr an dem Hof des Perserkönigs Kyrus (Kores) blieb, der ab 560 v.Chr. herrschte, betrug das Alter Daniels zwischen 56 und 66 Jahren. Das erwähnte Alter ergibt sich durch Interpolation. Das angenommene Alter gewährt einen Einblick in die Geschicke des Buchs Daniel. Daher ist es durchaus möglich, dass Daniel nicht älter als 70 Jahre wurde. Das Buch Daniel ist daher aus historischer Sicht zu betrachten. Wir es aus religiöser Sicht gesehen, sind Deutungen Tür und Tor geöffnet. Man kommt dann vom Hundertsten ins Tausende.
Die Jahreszahl drei, die in 1,1 genannt wird, wird in Kapitel 8,1 und 10,1 wiederholt. Die verwendeten Zahlen erinnern an eine priesterschriftliche Denkweise.
Daniel wurde in eine ihm vollkommen fremde Welt deportiert. Die Schrift, die Sprache, die Kultur stammen aus einer anderen, ihm fremden Welt. Das war auch ein Grund, weshalb ihre Ausbildung drei Jahre dauerte.9
Man wird den vier jungen Männern zu Beginn die Örtlichkeiten der Stadt Babel gezeigt haben. Hierunter wäre das Ishtar-Tor, das am Ende der Prozessionsstraße gestanden hat, zu nennen. Im Innenraum des Königspalastes werden in Steine gehauene Tierfiguren, Steinstiere, Schlangendrachen, Löwen oder Adler geprunkt haben. Manche Steinfiguren hatten Ähnlichkeiten mit Menschen. Solche Mischwesen säumten die königlichen Promenaden. Selbst die sagenhaften, hängenden Gärten in Babel dürften sie besichtigt haben.
Der folgende biblische Text führt die Geschichte Daniels fort:
8Daniel war entschlossen, sich nicht mit den Speisen und dem Wein der königlichen Tafel unrein zu machen, und so bat er den Oberkämmerer darum, sich nicht unrein machen zu müssen. 9Gott ließ ihn beim Oberkämmerer Wohlwollen und Nachsicht finden. 10Der Oberkämmerer sagte aber zu Daniel: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch die Speisen und Getränke zugewiesen hat; er könnte finden, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Leute eures Alters; dann wäre durch eure Schuld mein Kopf beim König in Gefahr. 11Da sagte Daniel zu dem Mann, den der Oberkämmerer als Aufseher für ihn selbst sowie für Hananja, Mischaël und Asarja eingesetzt hatte: 12Versuch es doch einmal zehn Tage lang mit deinen Knechten! Lass uns nur pflanzliche Nahrung zu essen und Wasser zu trinken geben! 13Dann vergleiche unser Aussehen mit dem der jungen Leute, die von den Speisen des Königs essen. Je nachdem, was du dann siehst, verfahr weiter mit deinen Knechten! 14Der Aufseher nahm ihren Vorschlag an und machte mit ihnen eine zehntägige Probe. 15Am Ende der zehn Tage sahen sie besser und wohlgenährter aus als all die jungen Leute, die von den Speisen des Königs aßen. 16Da ließ der Aufseher ihre Speisen und auch den Wein, den sie trinken sollten, beiseite und gab ihnen Pflanzenkost.
Daniel sollte das essen, was der König und seine Hohen auch aßen. Das führte bei Daniel und seinen drei Freunden zu einem inneren Konflikt. Denn das, was angeboten wurde, entsprach nicht ihren Speisegesetzen. In 3.Mose 11,1-47 steht über diese jüdischen Gesetze mehr geschrieben. Zudem wurde das, was Daniel essen sollte, auch den Götzen geopfert. Der Gefühlszwiespalt konnte nicht deutlicher sein.
Daniel wollte und musste die Vorschriften beachten, um seinen Herrn, den Oberkämmerer, nicht zu betrüben. Dieser Oberkämmerer äußerte daraufhin Bedenken, dass die gewünschten Speisen schlechtes Aussehen bewirken könnten. Er hatte zudem Angst um seinen Job und um sein Leben. Menschliches Leben zählte damals nicht viel. Daniel machte den Vorschlag, es doch mit den Speisen und Getränken 10 Tage lang zu versuchen. Nach dieser Zeit könnte er ihr Aussehen mit dem Aussehen der anderen Personen vergleichen und beurteilen.