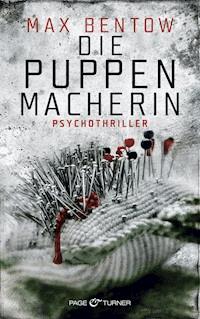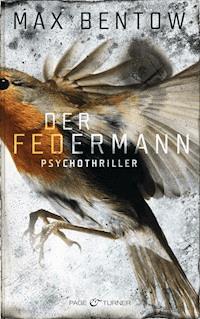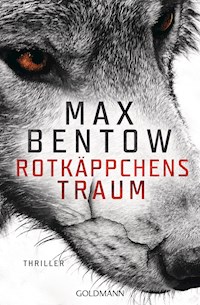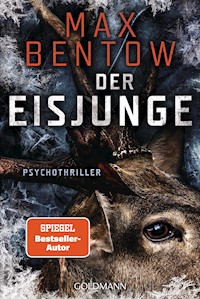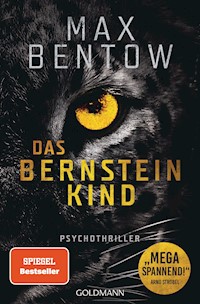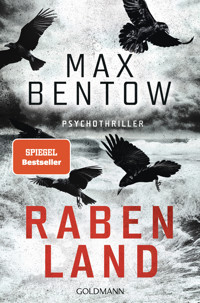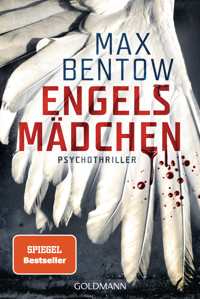9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Nils Trojan
- Sprache: Deutsch
Tödlicher als die Rückkehr eines Serienkillers ist nur
seine Rache.
Der Fund von drei Todesopfern, in deren Haut geheimnisvolle Botschaften geritzt wurden, stellt die Berliner Kriminalpolizei vor ein Rätsel. Während der Ermittlungen wird Trojans schlimmster Albtraum wahr: Er bekommt den Anruf einer Frau, die behauptet, die Tochter des „Federmannes“ zu sein. Der infame Serienmörder war dem Ermittler vor vier Jahren schwerst verletzt entwischt. Zu seinem Entsetzen schwört sie, dass ihr Vater am Leben ist. Trojan merkt schnell, dass er in einen fatalen Sog geraten ist. Denn der „Federmann“ wird nicht eher ruhen, bis er ihn vernichtet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Die Berliner Kriminalpolizei steht vor einem Rätsel, als man drei Todesopfer auffindet, in deren Haut geheimnisvolle Botschaften geritzt wurden. Doch während Kommissar Nils Trojan und sein Team noch fieberhaft versuchen, den Sinn der grausamen Tätowierungen zu entschlüsseln, wird Trojans schlimmster Alptraum wahr: Er bekommt den Anruf einer jungen Frau mit Namen Wendy, die behauptet, die Tochter des »Federmannes« zu sein, jenes infamen Serienmörders, der Trojan schwerst verletzt vier Jahre zuvor entwischt war – und zu Trojans Entsetzen schwört sie, dass ihr Vater am Leben ist. Als er einem Treffen mit Wendy in einem schäbigen Hotel zustimmt, merkt er sehr schnell, dass er in einen fatalen Sog geraten ist. Denn der »Federmann« wird nicht eher ruhen, bis er ihn vernichtet hat. Und dazu wird ihm jedes Mittel recht sein …
Weitere Informationen zu Max Bentow sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
MAX BENTOW
Das Dornenkind
Psychothriller
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe August 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Dieses Werk wurde vermittelt
durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Anna Mutwil/arcangel images und FinePic®, München
ISBN 978-3-641-15802-6
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
ERSTER TEIL
EINS
Sabrina liebte diesen Sommer, sie schlenkerte mit den Armen und schritt noch schneller aus. Als sie um die nächste Straßenecke bog, erfasste sie ein Windhauch, und ein Prickeln fegte über ihre Haut, so jäh und intensiv, dass sie unwillkürlich die Schultern hob und verharren musste. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah zum Nachthimmel hinauf. Rund um die Mondsichel funkelten vereinzelte Sterne. Sie sog die Luft ein, lau und mild, beinahe würzig, trotz erhöhter Smogwarnstufe, und ein ungeahntes Glücksgefühl durchströmte sie. Beschwingt ging sie weiter.
Sie verehrte die Stadt zu dieser Jahreszeit, wenn ihre Hüften von lässigen T-Shirt-Kleidern umschmeichelt wurden, die Loops aus den Clubs noch auf dem Heimweg durch die Blutbahn jagten und das Tocken ihrer Absätze auf dem Asphalt so sehnsüchtig und verheißungsvoll klang. Das war ihr Stakkato im Juli, das waren die Lust und die Leichtigkeit.
In ihrem Viertel war es noch immer laut, hektisch, die Plätze draußen vor den Kneipen waren dicht besetzt, Gelächter schwirrte umher, das anschwellende Stimmengewirr der Nachtschwärmer. In einer Wohnstraße wurde es ruhiger.
Den Kleinbus bemerkte Sabrina erst, als sie sich bis auf wenige Schritte genähert hatte. Er parkte am Straßenrand, im Halbdunkeln, hier waren ein paar der alten Laternen defekt.
»Liebling, nun fahren wir nach Hause, es ist schon spät.«
Da war ein Herr im beigefarbenen Sommerblouson, er beugte sich über eine Frau im Rollstuhl. Alles, was Sabrina von ihr erkennen konnte, war ihr Hinterkopf, umhüllt von einem rotgepunkteten Tuch, und ihr karierter Wintermantel, der ihr doch viel zu warm sein müsste. Er war dabei, sie auf die Rampe des Fahrzeugs zu schieben, was ihn offenbar Mühe kostete.
»Ich hab’s gleich, Liebes, sei geduldig mit mir.«
Er gab ein leises Ächzen von sich. Sabrina wollte sich unbemerkt an den beiden vorbeistehlen, als er sie ansprach.
»Könnten Sie mir eventuell behilflich sein, junge Frau?«
Sie hielt inne, anfangs widerwillig, da registrierte sie sein freundliches Lächeln, und schon nickte sie.
»Danke. Wie überaus charmant von Ihnen.«
Sie trat heran, er machte einen Schritt zur Seite, und Sabrina stemmte sich gegen die Griffe des Rollstuhls, der sich erstaunlich leicht die Rampe hinaufschieben ließ.
Er ging hinter ihr.
»Wissen Sie, in meinem Alter macht mir öfter der Rücken zu schaffen.«
»Kein Problem«, sagte sie, »das haben wir gleich«, und schon war der Rollstuhl im Inneren des Kleinbusses.
Danach ging alles sehr schnell. Er schien einen Knopf betätigt zu haben, denn die Rampe war im Nu eingeklappt, und die hinteren Türen schlugen zu.
Sabrina fuhr herum.
»Was soll das!«
Für einen Moment war es völlig finster im Wagen. Keine Fenster, durchzuckte es sie. Schon flammte eine Neonröhre auf. Sie registrierte zwei Dinge gleichzeitig: das Gesicht der Frau in dem Rollstuhl, merkwürdig bleich und schimmernd, und die Pistole in der Hand des Mannes.
»Schön brav sein. Die ist geladen.«
Ihr Herz hämmerte so heftig, dass ihr kurzzeitig die Luft wegblieb. Ihr Blick glitt wieder zu der Frau hin. Das Kopftuch war unterm Kinn verschnürt, der Hals fleischfarben wie eine Prothese. Die Lippen leuchteten unnatürlich rot. Und in den Augen waren Farbtupfen wie bei einem Püppchen. Und dann erst verstand sie. Es war eine Puppe! Sie sah täuschend echt aus. Eine Silikonpuppe im Rollstuhl.
Sabrinas Mund schnappte auf, doch die Panik lähmte ihre Glieder, ein rasch wirkendes Gift. Die Stimme des Mannes hingegen war so sanft und gütig, als sei er der Überraschungsgast bei einem Kindergeburtstag.
»Hab keine Angst, dir wird nichts passieren. Du musst mir nur noch einen zweiten Gefallen tun, ja?«
Schreien. Warum bekam sie denn keine Luft in ihre Lungen?
Schon war er bei ihr, entwand ihr die Handtasche, entnahm das Mobiltelefon und schaltete es aus, legte es wieder hinein und klemmte sich die Tasche unter den Arm.
»Ist mir lieber, wenn es aus ist. Du weißt schon, dieser neumodische Quatsch, GPS und so.«
Sie sah auf seine Lederhandschuhe. Sie starrte auf den Lauf der Waffe.
»Bitte«, haspelte sie, »wir können uns doch irgendwie einigen.«
Er lächelte, sie schien ihn zu amüsieren. Mit einer schier väterlichen Geste berührte er ihre Schulter. Sofort verkrampfte sich ihr Nacken und verwandelte sich in ein schreiend schmerzendes Muskelbündel. Sie roch ihren eigenen Angstschweiß, triefend unter den Achseln.
»Gibt wirklich keinen Grund zur Aufregung«, murmelte er, »wir müssen uns nur um einen weiteren Invaliden kümmern.«
Er blickte zu der Puppe im Rollstuhl hin, lächelnd legte er ihr Sabrinas Handtasche in den Schoß, als seien sie über viele Jahre miteinander vertraut, ein glückliches älteres Paar.
»Dieser Kranke, von dem ich spreche, braucht ein bisschen Hilfe.«
Sabrina wollte etwas entgegnen, doch sie brachte nur ein Stammeln hervor. Zu ihrer eigenen Verwunderung dachte sie an ihre Mutter, mit der sie sich eigentlich nicht mehr besonders gut verstand. Doch in diesem Moment stellte sie sich vor, wie sie tröstend von ihr in den Arm genommen wurde, und eine Kindheitserinnerung blitzte vor ihrem inneren Auge auf, Mama, die eine Schürfwunde an ihrem Knie verarztete, Mama, die ihr die Tränen trocknete.
Sabrina keuchte, als er, den Lauf der Pistole weiterhin auf sie gerichtet, eine Rolle Klebeband aus seinem Blouson hervorzog. Dieses hässliche Ratschen, mit dem er das Band aufzog.
»Leg dich hin«, sagte er sanft.
Sie schüttelte den Kopf.
»Mach schon. Ist besser für dich. Tut auch nicht weh.«
Sie musste sich hinter den Rollstuhl kauern. Er fesselte ihr die Hände auf dem Rücken, indem er das Klebeband mehrmals herumschlang. Er zog sehr fest. Als sie schrie, tippte er einmal kurz mit dem Lauf der Pistole gegen ihre Schläfe, und sie war sofort still.
»Gut so«, murmelte er.
Danach wickelte er das Band um ihre Fußgelenke.
»Hören Sie«, wimmerte sie, »ich mache Ihnen einen Vorschlag. Lassen Sie uns erst mal reden, ja? Nur reden.«
»Ach, nicht doch.«
Er wiegte sacht seinen Kopf und sah auf sie herab.
Und wieder ratschte das Band, und dann verschloss es ihren Mund.
Präg dir sein Gesicht ein, dachte sie entsetzt, als er sich vorbeugte, um ihr eine Stoffbinde über die Augen zu ziehen. Präg es dir ein, vielleicht hast du noch eine Chance!
Er verknotete die Binde am Hinterkopf.
»Wir fahren nicht lange«, sagte er. »Du musst dich wirklich nicht ängstigen. Und tief durchatmen, ja? Einfach weiter atmen, das hilft gegen die Panik.«
Er tätschelte ihre Wangen, während sie gegen einen Brechreiz ankämpfte.
Und dann hörte sie seine Schritte und kurz darauf das Klappen der hinteren Wagentüren.
Wenig später vernahm sie, wie er vorne einstieg und den Motor startete, und mit einem Ruck fuhr der Kleinbus ab.
Sie verlor jegliches Zeitgefühl. Der Wagen schlingerte. Ihr war schwindlig. Ihre Blase schmerzte wie verrückt, doch sie hielt an sich, wollte sich wenigstens diese Schmach ersparen.
Einige Zeit später stoppten sie. Plötzlich war er bei ihr. Er half ihr auf, nachdem er ihr die Fesseln an den Füßen und den Händen abgenommen hatte. Ihr Gang war unsicher, und er stützte sie.
Als sie mit ihm ausstieg, glaubte sie in einer Garage zu sein, es roch nach Motorenöl und Benzin. Eine Tür wurde geöffnet, dann noch eine.
Endlich nahm er ihr die Augenbinde ab. Sie schrie leise auf, als er ihr das Klebeband vom Mund entfernte.
Er entschuldigte sich bei ihr.
Die Panik kam in Wellen, ihr fiel das Atmen schwer.
»Ganz ruhig.«
Wieder dieses Lächeln. Ihr Blick blieb an einer Goldkrone in seiner Zahnreihe hängen.
»Dir wird nichts passieren, wenn du nur schön artig bist, ja?«
Sie sah sich um, versuchte sich Einzelheiten einzuprägen, das Muster der Tapete, ein Holztisch, eine Wanduhr. Doch sie hatte zu viel Adrenalin im Blut, sie konnte die Informationen nicht verarbeiten, sie ergaben kein Gesamtbild. Herabgelassene Jalousien, vermutlich ein Einfamilienhaus. Sie zwang sich, tiefer zu atmen, aber in ihrer Brust war ein Stechen, das sie noch panischer werden ließ.
Er legte seinen Blouson ab, darunter trug er Anzug und Krawatte. Er war so festlich gekleidet, als käme er von einer Abendveranstaltung.
Oder als habe er noch eine ganz besondere Feier vor sich.
Die Pistole lag in seiner Hand, auch als er sich ein kleines Stück von ihr entfernte und sich einer Ansammlung glänzender Lackstiefel näherte, die ordentlich auf dem Boden aufgereiht waren.
Holzfußboden, registrierte sie, Fischgrätenparkett, alt, blank getreten. Und da war noch etwas. Ein Geruch nach Desinfektionsmittel. Ein kranker Geruch. Sie assoziierte Mullbinden damit, Klinikbedarf.
Er suchte ein Paar Stiefel aus und kam zurück zu ihr.
»Wie heißt du?«
Das Herz drohte ihr in der Brust zu zerspringen.
»Sabrina«, stammelte sie.
»Okay, Sabrina, probier die mal an. Die könnten dir passen. Müsste deine Größe sein.«
»Nein!«
Ihre Augen irrten umher. Wie kam sie nur hier raus? Wieder hielt er den Lauf der Pistole auf sie gerichtet, aber er wirkte so entspannt, beinahe unbeteiligt. Er war glatt rasiert, seine Haut straff und gepflegt, an seiner linken Schläfe kringelte sich eine Ader. Darin war ein Pochen.
»Nur anprobieren.«
»Nein, ich kann nicht.«
»Sabrina. Bitte.«
Er trat näher, redete ihr gut zu.
»Danach bringe ich dich wieder nach Hause. Versprochen.«
Seine Stimme war schmeichelnd. Er hielt ihr das Paar Stiefel hin und lächelte.
Und da erkannte sie den Ehering an seinem Finger.
Für einen Moment entfernte sich alles von ihr. Sie taumelte.
»Sabrina?«, fragte er.
Ihr war so schwindlig. Wie sollte sie das nur weiter durchstehen?
»Möchtest du ein Glas Wasser?«
Sie nickte. Vielleicht konnte sie ihn so überlisten. Aber es geschah alles zu schnell, schon reichte er ihr das Glas. Sie trank gierig. Sie überlegte, ob sie es als Waffe benutzen könnte, da hatte er es ihr schon wieder abgenommen.
Sie starrte auf die Stiefel in seiner Hand.
»Also, was ist jetzt? Tust du mir den Gefallen?«
Und so schlüpfte sie aus ihren Schuhen und glitt in die Stiefel. Sie reichten bis zu ihren Oberschenkeln hinauf, und das widerte sie an.
»Passen?«
Sie nickte schwach.
»Na, siehst du. Alles halb so wild.« Er deutete auf eine Ecke im Zimmer. »Da kannst du dich umziehen. Leg deine Kleidung ordentlich auf den Stuhl. Alles ausziehen. Dann steigst du wieder in die Stiefel und gehst mit mir dort rein.« Er wies zu einer Flügeltür, die offenbar zu einem Nebenraum führte.
»Nein! Niemals!« Sie schüttelte den Kopf. Der Schweiß drang ihr aus allen Poren.
Er lächelte ihr aufmunternd zu. »Hör zu, es geht nur darum, einen Kranken etwas aufzuheitern, ihm eine kleine Freude zu machen.«
»Nein!«
Mit einer Miene des Bedauerns bewegte er die Pistole in seiner Hand. »Sie ist geladen, glaub mir. Zwing mich bitte nicht dazu abzudrücken.«
Sie rührte sich nicht.
»Du willst doch sicher zurück zu deinen Angehörigen, nicht wahr?«
Sie keuchte.
»Na also.«
Sie wandte sich von ihm ab und tat alles, was er ihr befohlen hatte. Schließlich stand sie bebend vor ihm, nur mit den Stiefeln bekleidet, und bedeckte mit den Händen ihren Schoß.
Er sah ihr bloß in die Augen. Sie versuchte, in seinem Gesicht abzulesen, ob es tatsächlich eine Chance gab, lebend aus diesem Alptraum herauszukommen.
Er wies sie mit einem Kopfnicken an, zu jener Flügeltür zu gehen und sie zu öffnen. Er blieb dicht hinter ihr.
Der Raum war nur schwach beleuchtet. In der Mitte stand ein Bett auf Rollen, da waren verschiedene Hebel zum Verstellen, ein Spezialbett. Klinikbedarf, dachte sie wieder.
»Ich glaube, er schläft«, sagte er leise und andächtig. »Aber du wirst ihn wecken. Ganz sanft.«
Er schloss hinter ihr die Tür und machte eine Geste hin zu dem Bett.
Sabrina war wie erstarrt.
»Du streichelst ihn mit deinem Haar. Mehr musst du nicht tun. Keine Schmerzen. Keine Gewalt. Sei ganz ruhig.«
Ihr Herzschlag stolperte, während er weiter auf sie einsprach.
»Du beugst den Kopf vor und wiegst dein Haar sacht hin und her. Du hast wunderschönes langes Haar, Sabrina. Mach es dir zunutze. Fang unten an. Wandere dann langsam hoch. Wenn du merkst, dass es eine Stelle gibt, die ihm besonders gefällt, verweilst du dort.«
»Bitte lassen Sie mich hier raus. Ich kann das nicht.«
Er senkte die Stimme zu einem Flüstern, berührte kurz ihre nackte Schulter, so dass sie zusammenfuhr.
»Du schaffst das schon, Sabrina. Und danach fahre ich dich nach Hause. Es wird nicht lange dauern, glaub mir. Er ist sehr, sehr krank. Doch diese Behandlung wird ihn aufbauen.«
»Warum ich? Warum gerade ich?«
»Ich sagte doch, dein Haar ist so schön.«
Er trat einen Schritt zurück, deutete eine Verbeugung an und wies zu dem Bett.
»Bitte, Sabrina. Du bist die Auserwählte. Mein Gott, dies ist ein großer Moment. Wenn du den Kranken erst siehst, wirst du die Zeremonie zu schätzen wissen.«
Er ließ ihr keine andere Wahl. Also trat sie zögernd an das Bett heran. Ihre Schritte waren unsicher, die Lackstiefel knarzten, und sie schwitzte darin.
»Näher.«
Er hielt sich im Hintergrund.
Und sie gehorchte.
»Fang an.«
Sie war jetzt an der Bettkante, sie erkannte eine Ausbuchtung auf dem Bettzeug. Der Kranke schien auf der Seite zu liegen.
»Schlag die Decke zurück.«
Sie zitterte so stark, dass es ihr zunächst nicht gelang. Sie überwand sich, berührte die Decke mit spitzen Fingern. Sie war weiß und gestärkt, etwas darunter roch nach Krankenhaus. Und dann warf sie sie zurück, und unweigerlich drang ein Schluchzen aus ihrem Mund.
Sabrina starrte auf die bleiche Haut auf dem Laken.
»Großer Gott.«
»Mach schon.«
Sie konnte nicht.
Ihre Muskeln waren wie gelähmt.
»Tu es einfach.«
Es erschien ihr wie eine Ewigkeit, bis sie es endlich fertigbrachte, sich vorzubeugen, so dass ihr Haar in langen blonden Kaskaden auf das Bett herabzufließen schien.
»Sehr gut. Nun beweg deinen Kopf. Lass ihn pendeln.«
Ihr war, als würde ihre Seele aus ihr heraustreten. Als schaute sie sich selbst bei dieser verstörenden Verrichtung zu.
Und so bewegte sie ihren Kopf, und ihr Haar schwang hin und her.
»Bravo, weiter so.« Seine Stimme klang mit einem Mal heiser und ergriffen, voll feierlicher Erregung. »Seine Haut dürstet danach. Nicht nachlassen. Nur zu!«
Sie tat es mechanisch und abgestumpft. Wenn es irgendeine Möglichkeit gab, lebend hier herauszukommen, musste sie sich fügen.
Und so strichen ihre Haarspitzen über die gräuliche Haut, und über den Raum senkte sich eine beklemmende Stille.
Schließlich wisperte er: »So ist es gut, Sabrina, es gefällt ihm. Auch wenn er schweigt. Sieh nur, wie er lächelt. Er genießt diesen Ritus sehr.«
Unablässig pendelte ihr Kopf.
Irgendwann sagte er, dass es genug sei. Er führte sie aus dem Raum heraus, und sie durfte sich wieder anziehen. Man hatte sie nicht berührt.
Er nahm ihr die Stiefel ab und stellte sie ordentlich zurück in die Reihe zu den anderen. Er verband ihr die Augen, und bald darauf schienen sie sich wieder in der Garage zu befinden. Er half ihr beim Einsteigen. Sie musste sich wieder in dem hinteren Teil des Wagens zusammenkauern, wo er sie fesselte. Er fragte sie nach ihrer Adresse. Um sich zu schützen, nannte sie ihm irgendeinen Straßennamen, der ihr gerade in den Sinn kam.
Sie bat ihn inständig, ihr nicht wieder den Mund zu verkleben, und versprach ihm, sich ruhig zu verhalten.
Er willigte ein, und sie fuhren los. Sabrina zog sich irgendwo in den hintersten Winkel ihrer Seele zurück.
Bald darauf hielten sie an.
Er kam nach hinten, sie hörte, wie er die Türen zuschlug. Er nahm ihr die Fesseln und die Augenbinde ab.
»Wir haben uns verfahren. Ich glaube, es ist besser, wenn du hier aussteigst.«
Er wies zu den hinteren Türen, sie sah die eingeklappte Rampe und den Rollstuhl. Die Silikonpuppe saß noch immer darin. Wie zum Hohn lächelte der rote Mund ihr zu.
War sie nun frei?
Mühsam richtete sie sich auf.
»Warte«, murmelte er. »Du hast ja mein Gesicht gesehen.«
»Ich verrate nichts«, erwiderte sie tonlos.
»Wirklich?«
»Ja. Ich werde nichts sagen. Nichts von alledem.«
Er schien zu überlegen. »Gut«, sagte er schließlich, »aber wenn du aussteigst, schaust du nicht auf das Nummernschild.«
Sie nickte hastig.
»Kein Blick zurück.«
»Ja.«
Er machte eine Bewegung mit der Waffe.
Und noch einmal beteuerte sie, sie werde nichts verraten.
Er lächelte.
Sie war schon fast an der Tür, als er sagte: »Es gibt allerdings jemanden, den es interessieren wird, was du gesehen hast.«
Was sollte das noch? Sie musste hier raus, schnell.
Er griff nach ihrer Handtasche im Schoß der Puppe.
»Weißt du was, ruf ihn einfach an. Ich geb dir seine Nummer.«
Er befahl ihr, das Mobiltelefon aus der Tasche zu nehmen und es wieder einzuschalten.
Er nannte ihr eine Ziffernfolge, die sie fahrig eintippte.
Danach sprach er ihr zwei Sätze vor. »Sag es, sag es ihm. Nur diese beiden Sätze.«
Sie umklammerte ihr Telefon, vernahm den Rufton. Sie hörte, wie sich eine mechanische männliche Stimme am anderen Ende der Leitung meldete.
»Anrufbeantworter«, wisperte sie.
Mit einem Kopfnicken bedeutete er ihr draufzusprechen.
Und so stammelte Sabrina in den Hörer, was man ihr aufgetragen hatte.
Der Mann nickte ihr zu, und sie drückte auf die rote Taste.
»Gut, und jetzt bist du frei.«
Sie steckte das Handy ein. Sollte er es wirklich ernst meinen?
»Warte. Eins noch.« Plötzlich schob er die Waffe in die Tasche seines Blousons, zog dafür ein Klappmesser hervor und ließ es aufspringen.
»Es tut nicht sehr weh. Nur ein kleiner Ritz, und dann darfst du verschwinden.«
Sie war kaum noch in der Lage zu realisieren, was geschah. Der Schmerz kam in Sekundenschnelle. Sie verspürte einen Stich auf ihrem rechten Schulterblatt, dann noch einen und noch einen. Ihr Kleid riss auf, aber nach allem, was man ihr angetan hatte, war sie beinahe empfindungslos.
Die Klinge ritzte ihre Haut und drang nicht sehr tief. Sie brachte einen erstickten Laut hervor.
»Nun geh, Sabrina.«
War das die Erlösung? Er betätigte einen Knopf, und die hinteren Türen des Kleinbusses sprangen auf.
Die Straße war dunkel und leer.
Ihre Absätze berührten unsicher den Asphalt.
Sabrina setzte schwankend Schritt für Schritt.
Nicht umdrehen, dachte sie, bloß nicht umdrehen. Jeden Moment erwartete sie, dass in ihrem Rücken ein Schuss knallen würde.
Doch dann vernahm sie, wie der Motor ansprang. Der Wagen fuhr ab und schien sich in die entgegengesetzte Richtung zu entfernen.
Plötzlich war alles still.
Sie ging einfach weiter. Tränen rannen über ihr Gesicht. In der Ferne taten sich verschwommene Lichter auf, sie steuerte darauf zu.
Nur ganz allmählich sickerte ihr ins Bewusstsein, dass sie noch am Leben war.
ZWEI
Nils Trojan erwachte, noch bevor sein Wecker Alarm schlug. Er öffnete die Augen und war erstaunt. So tief und erholsam hatte er schon seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Keine Alpträume, keine nächtlichen Panikattacken, bloß Stunden traumlosen Schlummerns.
Er reckte sich, schwang sich aus dem Bett und zog die Vorhänge auf. Der Sommer war prächtig. Trojan öffnete das Fenster und verlor sich eine Weile in dem Anblick der dicht belaubten Linden in der Forster Straße. Spatzen lärmten darin, einige Amseln riefen, selbst der Geruch aus der Keksfabrik kanalabwärts war heute weniger störend. Im Gegenteil, er löste angenehme Erinnerungen aus. Einmal hatte er mit seiner Tochter Emily, als sie noch ein kleines Kind war, versucht, einen Schokoladenkuchen zu backen, was gründlich misslang. Aber der Teig war lecker, er sah deutlich vor sich, wie sie beide mit den Fingern von ihm naschten. Emily lehnte den Kopf an ihn, um sich dann verträumt ihren braunverschmierten Mund am Saum seines T-Shirts abzuwischen, worauf sie in ein vergnügtes Gelächter ausbrach, in das er sofort mit einstimmen musste.
Das konnte nur damals in der Wohnung in Charlottenburg gewesen sein, dachte er, als er noch mit Friederike verheiratet war. Und sogleich beschlich ihn die Wehmut. Nun war Emily schon beinahe erwachsen.
Verdammt, seine eigene Mutter war mit nur neunundvierzig Jahren an Krebs gestorben. Je näher er selbst diesem Alter kam, desto unheimlicher wurde es ihm. Trojan atmete tief durch. Wie leicht doch so eine Sommerlaune von Melancholie eingetrübt werden konnte.
Er straffte die Schultern und lächelte. Sei’s drum, dachte er, dieser Tag wird mir gelingen.
Nachdem er geduscht hatte, schlürfte er gedankenverloren seinen Kaffee, ein wenig verwundert darüber, dass er sogar noch Zeit für ein kleines Frühstück hatte, bevor er zur Arbeit musste. Nur leider hatte er kein Brot mehr im Haus, und auch ansonsten fand sich im Kühlschrank wenig Essbares. So beschloss er, sich unterwegs ein belegtes Brötchen zu holen, und schnappte sich seine Jacke und die Schlüssel. Da fiel sein Blick auf den blinkenden Anrufbeantworter in der Diele. Er drückte die Taste und hörte die Nachricht ab.
Eine ihm unbekannte weibliche Stimme war zu vernehmen. Sie sprach nur wenige Worte, abgehackt, völlig verängstigt. Er drückte noch einmal die Taste und runzelte die Stirn. Vielleicht eine Betrunkene, die falsch verbunden war, möglicherweise eine Geistesgestörte.
Es gab so viele Irre in der Stadt.
Er suchte im Verzeichnis und fand den Eintrag: 1:23 Uhr. Eine Mobilnummer, die ihm nichts sagte.
Normalerweise rissen ihn nächtliche Anrufe aus dem Bett, noch ein Beweis dafür, wie tief er geschlafen hatte.
Trojan zwang eine aufkeimende Unruhe hinunter. Mit einem Achselzucken verließ er die Wohnung.
Wie üblich wuchtete er sein Fahrrad vom Hof durch den schmalen Treppenaufgang hinaus auf den Gehweg. Er schwang sich auf den Sattel und radelte los.
Auf dem Trottoir der Wiener Straße, kurz vorm Görlitzer Bahnhof, hockte eine kleinwüchsige Person auf einer Pferdedecke, ein Pappschild vor sich, darauf war in krakligen Buchstaben notiert: Handlesen 2 Euro. Trojan musste lächeln, mal eine ganz neue Kreuzberger Geschäftsidee. Er nahm Fahrt auf, als der Kurzbeinige aufsprang und ihm den Radweg versperrte.
»He! Moment!«
Trojan bremste irritiert ab.
»Nicht an Ihrer Zukunft interessiert?«
»Hab’s eilig.«
Sein Gesicht war alt und faltig, sein Körper hingegen wie der eines Kindes. Er sprach mit hartem osteuropäischen Akzent. »Das erste Mal ist umsonst.«
»Wie gesagt, bin in Eile.«
Doch zu seiner Überraschung hatte der Kleine bereits seine Hand genommen, öffnete sie und schaute darauf.
»Lassen Sie das«, sagte Trojan verärgert, während sein Handgelenk von dem anderen mit ungeahnter Kraft umklammert wurde. Er war ihm unheimlich. Wirkte wie ein Gnom auf ihn mit der Halbglatze und dem zotteligen Haar, seiner speckigen Weste über dem nackten Oberkörper und den kurzen Cargo Pants, aus denen extrem weiße Beine staksten.
»Sie sollten sich in Acht nehmen.« Der selbsternannte Wahrsager hob den Blick. Wässrige, hervortretende Augen. Sein Atem roch nach Lakritz-Pastillen, die ihm die Zunge schwarz gefärbt hatten. »Ihre Lebenslinie ist extrem kurz.«
Trojan schüttelte ihn ab. »Na, schönen Dank auch!«
Er stieg wieder in die Pedale und ließ den Kerl hinter sich.
Der rief ihm noch etwas hinterher, was er nicht mehr verstand.
Trojan fluchte leise, von dieser Prophezeiung wollte er sich nicht den Tag verderben lassen.
Als er zwanzig Minuten später das Kommissariat in der Karthagostraße in Tiergarten erreichte, hatte er den Vorfall längst vergessen.
Sabrina kauerte auf ihrem Bett und starrte auf die Lichtlachen am Boden. Sie nahmen die Form von Messerspitzen an.
Sie hatte sich eine zweite Decke aus dem Schrank genommen. So konnte sie die eine umklammern, zusammengeballt zu einem dichten Knäuel, während die andere über ihr lag, bis über den Kopf gezogen. Nur um ihr Gesicht herum ließ sie eine Öffnung, um atmen zu können, flach und gepresst.
Ihr war kalt, entsetzlich kalt, trotz der Wärme in ihrer Wohnung. Alle Fenster waren verriegelt, die Vorhänge geschlossen, doch unerbittlich drangen die Sonnenstrahlen durch die Ritzen herein.
Sie wagte es nicht, die Augen zu schließen, obwohl sie brannten und tränten und ihr Kopf vor Erschöpfung dröhnte. Fielen sie ihr doch einmal für Sekunden zu, brachen sofort die Bilder der vergangenen Nacht auf sie ein, und sie riss sie wieder auf.
Nach einiger Zeit stand sie auf und schleppte sich ins Badezimmer. Sie wusste noch, wie sie nach ihrer Rückkehr endlos lange unter der Dusche gestanden hatte, in dem verzweifelten Versuch, alles von sich abzuspülen, was ihr widerfahren war.
Doch es hatte nichts genutzt.
Sie erschrak vor ihrer bleichen Gestalt im Spiegel, umhüllt von einem ausgeleierten Pullover, der ihr fast bis zu den Knien reichte. Ihr Exfreund hatte ihn nach ihrer Trennung versehentlich bei ihr zurückgelassen. Er roch noch ganz leicht nach ihm, ein Umstand, von dem sie sich etwas Trost versprach.
Die Wunde auf ihrem Rücken pochte.
Sie wandte sich halb um, schob zögernd den Pullover hoch und spähte über ihre Schulter zurück.
Spiegelverkehrt las sie, was man ihr in die Haut eingeritzt hatte.
Geh endlich zur Polizei, mahnte sie eine innere Stimme. Die bringen dich in Sicherheit, die kümmern sich um dich.
Doch dann meldete sich eine andere Stimme in ihrem Kopf. Die Stimme des Mannes, der sie am Leben gelassen hatte.
Er war noch immer bei ihr.
Er war überall.
Die Maschine aus Seattle befand sich im Anflug auf Berlin. Wendy Hain wandte sich dem Fenster zu, da war die Havel, da war ein Funkeln auf dem Wasser, sie erblickte Baumwipfel, und schon tauchten erste Häuser auf, klein wie Spielzeug.
Die schräg einfallenden Sonnenstrahlen blendeten sie, und sie schloss die Augen, bis sie von ihrem Sitznachbarn angestoßen wurde. Er sagte etwas zu ihr, das sie nicht verstand, und deutete auf das Anschnallzeichen. Sie nahm die Ohrhörer ihres MP3-Players heraus, und er wiederholte es für sie.
»Sie müssen das Gerät abschalten, ist Vorschrift.«
Wendy seufzte und drückte die Aus-Taste. Die satten Bässe ihres Chillout Samplers waren die einzige Möglichkeit, ihre Nervosität zu dämmen. Nicht dass sie unter Flugangst litt, aber nachdem sie geschätzte achtundvierzig Stunden nicht mehr geschlafen hatte, war sie dringend auf den Filter ihrer dämpfenden Downbeats angewiesen.
Abflug in Vancouver gestern Vormittag nach einer ängstlich durchwachten Nacht, Aufenthalt in Seattle, lähmende Stunden in der Wartehalle, Start gegen vierzehn Uhr, Nachtflug nach London, ein Gewitter über dem Atlantik, Turbulenzen, Verspätung, verlängerte Wartezeit in Heathrow, und nun endlich sollte sie am Ziel sein.
Zehn Minuten später setzte die Maschine auf dem Rollfeld auf.
Nachdem sie ihr Gepäck in Empfang genommen hatte, trat sie hinaus in das grelle Sommerlicht und blieb für einen Moment ratlos stehen. Eigentlich konnte sie es sich bei ihrer eingeschränkten Finanzlage nicht leisten, aber die Ungeduld war zu groß, also stieg sie in ein Taxi.
Sie nannte dem Fahrer die Adresse, und sie fuhren los. Auf der Stadtautobahn hatte sich ein Stau gebildet, und es ging nur langsam voran. Wendy stöpselte ihre Ohrhörer ein und versuchte erneut, sich mit der Musik abzulenken. Immer wieder griff sie sich mit beiden Händen in ihr auffallend honigfarbenes Haar, verknotete es mal im Nacken, dann schüttelte sie es auf. Der Fahrer warf ihr interessierte Blicke durch den Rückspiegel zu, die sie offensiv ignorierte.
Der Jetlag meldete sich als Summen in ihrem Kopf.
Noch vor drei Tagen war sie völlig ahnungslos gewesen. Es war irgendwann gegen Mittag, als sie ziemlich verkatert von der spontanen Feier zu ihrem dreiundzwanzigsten Geburtstag ihr Handy einschaltete. Ihre Mitbewohner in dem ärmlichen Backsteinhaus in Vancouver Downtown Eastside schliefen noch. Sie hörte die Nachricht auf der Mailbox ab. Machte sich Vorwürfe, dass sie nicht schon längst zurückgerufen hatte.
Großmama hatte mehrmals versucht, sie zu erreichen, aber niemals draufgesprochen, denn sie gehörte nun mal zu dem Teil der Senioren, der sich von den Errungenschaften der vernetzten Welt leicht einschüchtern ließ.
Nun überbrachte jemand anders eine Nachricht für sie, eine überaus geschäftsmäßig klingende Stimme des Krankenhauspersonals.
Das Taxi hielt vorm Virchow-Klinikum, und Wendy kramte ihr Geld aus dem Portemonnaie.
»Wird sie es überleben?«
Die Stationsschwester schwieg für ihren Geschmack einen Augenblick zu lang.
»Sagen Sie schon, schafft sie es?«
»Wissen Sie, in dem Alter und bei dem nicht unbeträchtlichen Herzklappenfehler Ihrer Großmutter ist das schwer einzuschätzen. Zudem erlitt sie, kurz nachdem wir sie stationär aufgenommen haben, auch noch einen Schlaganfall.«
»Ist sie denn ansprechbar?«
»In der Regel nicht. Und wenn sie sich mal äußert, macht sie einen eher verwirrten Eindruck. Wir haben sie zwar mittlerweile von der Intensivstation nach hier unten verlegen können, doch ist es notwendig, sie weiterhin künstlich zu ernähren. Und was uns Sorge bereitet: Es bildet sich Wasser in ihrer Lunge, das regelmäßig abgesaugt werden muss.«
Wendy krümmte die Schultern.
»Aber es ist gut, wenn Sie bei ihr sind, das wird sie spüren. Sie sind ihre einzige Angehörige, nicht wahr?«
Sie nickte schwach.
Die Schwester lächelte ihr aufmunternd zu. Dann drückte Wendy die Türklinke zu dem Krankenzimmer und trat ein.
»Großmama!«
Sie näherte sich dem Bett.
»Ich bin es!«
Seitdem sie sich das letzte Mal gesehen hatten, schien sie noch kleiner geworden zu sein. Ihr Kopf war so schmal, die Stirn so hoch, die Wangen eingefallen. Sie hatte die Augen geschlossen und schien zu schlafen.
Wendy kämpfte gegen eine starke Gefühlsregung an und setzte sich zu ihr.
»Ich bin wieder da, Großmama, gerade erst gelandet.« Instinktiv verfiel sie in den munteren Plauderton, mit dem sie schon als Kind Anwandlungen von Traurigkeit zu verbergen versucht hatte. »Stell dir vor, unzählige Flugstunden, nur um mit dir ein kleines Schwätzchen zu halten, ist das nicht lieb von mir? Eine komplette Atlantiküberquerung, bloß um guten Tag zu sagen.«
Mit einem Mal war ihr, als könnte sie ihre Stimme hören.
Alles Gute nachträglich zu deinem dreiundzwanzigsten Geburtstag.
Ein Schauer lief über ihren Rücken. Nein, die alte Frau hatte nichts gesagt, nur ihr stockender, rasselnder Atem war zu vernehmen. Wendy strich über ihren Arm, der war so runzlig und dünn. In der Beuge steckte eine Kanüle.
Sie betrachtete den Tropf, aus dem eine helle Flüssigkeit in den Schlauch perlte, und blinzelte eine Träne weg.
»Großmama, du wirst doch durchhalten, nicht wahr? Ich hab doch sonst niemanden außer dir.«
Und wieder war ihr, als würde sich der Mund der alten Frau zu einer Antwort öffnen. Aber es war eine Täuschung.
Wo sollte sie nun hin? Das Zimmer in ihrer Kreuzberger WG war untervermietet, also blieb ihr einzig Großmutters Wohnung, zu der sie noch den Schlüssel besaß.
Als die Betonklötze der Gropiusstadt vor ihr aufragten, war ihr, als würde ein Sog sie zurück in ihre Kindheit und Jugend katapultieren, und schon legte sich die altbekannte Beklemmung um ihren Brustkorb, die sie all die Jahre hier verspürt hatte.
Dabei war es doch ihr Wunsch gewesen, der Tristesse dieser Siedlung für immer den Rücken zu kehren.
In einem der Wohntürme – es war die Nummer 19b – betrat sie den Lift. Im siebzehnten Stockwerk stieg sie aus. Ihre Schritte hallten in dem langen Flur wider. Schließlich blieb sie vor der Wohnungstür stehen, an der noch die Reste eines Stickers klebten, in der Form einer Blume, das war früher einmal die Werbung für ein Geschirrspülmittel gewesen. Wendy erinnerte sich, wie sie ihn als Kind von der Spülflasche entfernt und damit die Tür markiert hatte, um sie besser wiederzuerkennen. Allzu oft hatte sie nämlich mit dem Schlüssel, den sie stets an einem Band um den Hals trug, versehentlich am falschen Schloss gekratzt. Das war zu der Zeit gewesen, als ihr das Lesen der Klingelschilder noch schwerfiel und ihr die schier endlose Reihe der stets gleichen Türen Angst einflößte. Großmama hatte den Sticker nie vollständig entfernen können, auch wenn er schon völlig ausgefranst und beinahe farblos war.
Im Innern der Wohnung empfing sie der Geruch nach Alter und Einsamkeit. In der Küche befanden sich Brotkrümel auf dem Frühstücksbrett, im Wohnzimmer lag Großmamas Lesebrille zusammengeklappt auf der Fernsehzeitschrift, weiße Spitzentücher zierten Tisch und Sofa. Das verwaiste Doppelbett im Schlafzimmer war aufgedeckt, Laken und Kissen eingedrückt, als habe sie noch eben dort geschlafen. Ihre Hausschuhe lagen am Boden verstreut, wie in großer Eile abgeworfen, der eine zur Seite gekippt, der andere mit der Sohle nach oben. Zerbeult waren sie, der Stoff so glattgetreten, dass er schon glänzte. Ihr Anblick rührte Wendy. Ordentlich stellte sie die Pantoffeln vorm Bett zusammen. Sie sollte sie ihr beim nächsten Krankenbesuch mitbringen, für den Fall, dass sie wieder auf die Beine kam. Sie durfte die Hoffnung nicht aufgeben.
Die Tür zu Wendys ehemaligem Zimmer war nur angelehnt. Großmutter hatte hier seit ihrem Auszug nichts verändert. Selbst der Teddybär, den sie in die Wohngemeinschaft mitzunehmen nicht fertiggebracht hatte, hockte noch auf ihrem alten Jugendbett. Da war die Kommode mit der abgeblätterten Farbe, darauf stapelten sich noch immer zerlesene Zeitschriften, Taschenbücher und Comics auf einigen eingedrückten Kartons mit Brettspielen. Auf einem ausrangierten Computermonitor stand das Schmuckkästchen, das sie zu ihrem zwölften Geburtstag geschenkt bekommen hatte, sehr zu ihrem Missfallen, denn all den Mädchenkram hatte sie stets verachtet. Es war aufgeklappt, ihre nicht ganz unbeträchtliche Sammlung von Gummimonstern und Dinosauriern quoll daraus hervor, der in der Innenseite des Deckels befestigte Spiegel war fleckig und halbblind.
Wendy nahm ihren Tramperrucksack ab, schob ihn unters Bett und setzte sich für einen Moment. Die Wände schienen sich zu verschieben, näher auf sie zu. Sie rang nach Luft und schloss die Augen. Danach war alles wieder an seinem angestammten Platz.
Sie stand auf und überprüfte, was sich im Kühlschrank befand, daraufhin beschloss sie, in den Supermarkt um die Ecke zu gehen.
Sie war bereits im Hausflur und verschloss die Wohnungstür, als sie hinter sich eine Stimme vernahm.
»Hallo!«
Sie wandte sich um.
Es war Herr Pollek, der Nachbar ihrer Großmutter, ein schmächtiger Typ in den Dreißigern, dunkles, welliges Haar und eine Bifokalbrille, durch die seine Mausaugen blinzelten. Sie hatte ihn noch nie anders als mit Hemd und Strickjacke bekleidet gesehen.
»Wie geht es der armen Frau Hain?«, fragte er vertraulich.
Sie zuckte mit den Achseln.
Pollek trat näher. Sein Blick war forschend. Sie wusste, dass er öfter bei ihrer Großmutter zu Besuch war, und die schwärmte geradezu von ihm, weil er zuweilen Einkäufe für sie erledigte und ihr die Einsamkeit mit Plaudereien vertrieb.
»Ich war es, der sie in die Klinik gefahren hat. Mein Gott, das war eine Aufregung. Du bist Wendy, nicht wahr? Ihr Enkelkind?«
Sie nickte, erwiderte zögernd seinen feuchtwarmen Händedruck.
»Wir kennen uns noch von früher, hmm?«
Sie wollte gehen, aber er ließ sie nicht vorbei.
»Es ist doch in Ordnung, wenn ich du sage? Ich bin Jurek.«
Sie zog einen Flunsch. »Okay.«
»Das wird schon wieder. Deine Oma hat eine zähe Gesundheit.«
»Wenn Sie meinen.«
»Willst du vielleicht auf einen Kaffee reinkommen? Du bist gerade angekommen, nicht wahr? Frau Hain hat mich über deine Reise informiert. Ein Kaffee wird dir guttun.«
»Nein danke, ich …«
»Aber interessiert es dich denn gar nicht, was mit deiner Oma los war? Sie wirkte sehr aufgewühlt auf mich, da muss etwas passiert sein.«
Und schon nötigte Pollek sie in seine schmale Wohnung. Sie folgte ihm zögernd in die Küche, stand ratlos da, während er die Kaffeemaschine bediente.
»Sie kam zu mir, als sie ihre Herzprobleme hatte. Klingelte aufgeregt an meiner Tür. Sie war bleich und zittrig, und sie sprach ziemlich wirr. Ich sagte zu ihr: ›Frau Hain, nun beruhigen Sie sich doch erst einmal.‹ Aber offenbar hatte sie große Angst.«
»Wovor?«
Wieder bedachte er sie mit einem durchdringenden Blick. »Das würde mich auch mal interessieren. Irgendeine Sache schien sie in großen Aufruhr versetzt zu haben.«
»Und sie hat keinerlei Andeutungen gemacht?«
Er antwortete nicht, wies sie stattdessen an, sich an den Tisch zu setzen, und sie nahm auf der Stuhlkante Platz. Ihre Schultern verkrampften sich, während er mit den Tassen hantierte, Milch und Zucker reichte.
Sie rührte den Kaffee nicht an.
»Sie sind also gerade in Kanada tätig?« Das Duzen schien ihm doch nicht so leicht zu fallen, ihr war es nur recht.
»Ja«, murmelte sie widerwillig, »ich absolviere dort ein Programm, das sichWork and Travel nennt. Man lernt das Land kennen, die Leute, man kann jobben, wo man will, hat ein Visum für ein Jahr und verbessert seine Sprachkenntnisse.«
»Und danach? Irgendwelche Pläne?«
Sie zuckte mit den Achseln. »Studieren oder so.«
»Was denn?«
»Weiß noch nicht.«
Er begann ihr umständlich von seinem Job in der Versicherungsbranche zu erzählen. Sie hörte kaum zu.
Plötzlich sagte er: »Du hängst sehr an deiner Großmutter, nicht wahr?«
»Klar, schließlich bin ich bei ihr aufgewachsen.«
»Deine Mutter starb, als du fünf Jahre alt warst. Das ist bitter.«
Sie sah ihn reglos an.
»Frau Hain sprach mit mir darüber.«
Ich muss hier raus, dachte sie.
Er hob seine Tasse und spitzte den Mund. Nahm einen Schluck und fragte schließlich seltsam bedächtig: »Was ist mit deinem Vater?«
Wendy antwortete rasch: »Den hab ich nie kennengelernt. Ich weiß nicht einmal, wer er ist.« Abrupt stand sie auf. »Ich muss jetzt wirklich gehen.«
Zum Abschied ergriff er wieder ihre Hand. »Alles wird gut, Wendy. Und falls du Hilfe brauchst, du weißt ja, wo ich bin.«
Noch während sie auf den Aufzug wartete, spürte sie seine Blicke im Rücken.
Das Tageslicht schien sich durch ihre Augen hindurch in ihre Gehirnwindungen zu bohren, dort, wo der hämmernde Schmerz saß. Doch davon durfte sie sich nicht abhalten lassen.
Denn Sabrina hatte ein Ziel.
Sie schlang beim Gehen die Arme um ihre Schulter. Eilig bog sie in die Kopernikusstraße ein. Sie näherte sich der nächsten Kreuzung, vernahm bereits den dort tosenden Verkehr, als sie spürte, dass ihr jemand folgte. Nicht umdrehen, dachte sie und beschleunigte ihre Schritte.
Schon hatte sie die belebte Warschauer Straße erreicht. Vor ihr sprang die Fußgängerampel auf Rot, und sie musste innehalten.
»Sabrina!«
Nun wandte sie doch den Kopf um. Er war es! Also wusste er, wo sie wohnte, sie konnte ihm nicht entkommen.
Sie wollte losrennen, war schon halb auf dem Fahrdamm, als ein Auto hupte, beinahe hätte es sie erfasst. Erschrocken wich sie zurück.
»Du hast mir doch etwas versprochen, Sabrina.«
Er packte ihren Arm mit sanftem Druck. Da war sein Lächeln, vor dem sie sich so sehr fürchtete.
»Willst du etwa zur Polizei gehen?«
»Nein«, haspelte sie. »Ganz bestimmt nicht, nein.«
Er deutete mit zwei Fingern auf seine Augen, dann wechselten die Finger zu ihrem Gesicht.
Sabrina versuchte, sich von ihm zu befreien, er aber umklammerte sie nur fester: »Einen Moment noch.«
Öffentlichkeit herstellen, dachte sie, um Hilfe schreien, doch ein innerer Druck presste ihr die Kehle zu.
»Jetzt«, murmelte er. Er grinste. Sein Blick schweifte noch einmal in die Ferne, und schon lockerte er seinen Griff. »Lauf! Und denk an dein Versprechen.«
Wie zur Aufmunterung gab er ihr einen kleinen Stoß.
Sie stürmte von ihm weg. Auf der anderen Straßenseite wäre sie in Sicherheit.
Sie erblickte eine Lücke zwischen den vorbeirasenden Fahrzeugen. Doch da näherte sich auch die Tram. Die M10 schoss pfeilschnell auf sie zu.
Ihre Knie wurden weich.
Sabrina erkannte den Fahrer hinter der Windschutzscheibe, das Entsetzen in seinem Gesicht. Sie warf die Arme hoch, als könnte sie noch irgendwo Halt finden.
Aber es war bereits zu spät.
Das Letzte, was sie hörte, war das Kreischen der Bremsen.
Dann explodierte etwas in ihrem Kopf.
DREI
In Gropiusstadt wurde es niemals dunkel. Unablässig funkelten aus den Hochhäusern vereinzelte Lichter schlafloser Bewohner. Mit einem Ruck schloss Wendy den Vorhang vor dem Fenster ihres ehemaligen Kinderzimmers. Zum wiederholten Male tappte sie hinaus in die Küche und trank noch einen Schluck aus der Weinflasche.
Sie wusste, zu viel Alkohol würde ihr schaden. Sie musste ihren Körper fit halten. Klar im Geist sein. Niemals vom Ziel abweichen. Die Prinzipien befolgen: Koordination von Oben und Unten, Harmonie zwischen Innen und Außen, der ununterbrochene Fluss.
Wendy stellte die Flasche ab, atmete tief durch und begann mit einigen Übungen aus der Lehre des Tai-Chi Chuan: Fersenkick rechts, einfache Peitsche, der weiße Kranich breitet seine Flügel aus, die Mähne des Wildpferdes teilen.
Während sich ihr Körper diesen fließenden Bewegungen hingab, wurde sie innerlich ganz ruhig. Aber es meldeten sich auch die üblichen Zweifel in ihr, denn mit dieser harmonischen und nahezu meditativen Art der Kampfkunst würde sie ihren Feind niemals besiegen können, das wusste sie, das lehrte sie das Gesetz der Straße. Und so wurde mit einem Mal aus ihrem chinesischen Schattenboxen ein wilderer Tanz.
Sie stellte sich vor, ihr unsichtbarer Angreifer umklammere sie von hinten. Also senkte sie den Körperschwerpunkt ab, um sich schwerer zu machen. Sie stieß ihm mit dem Ellenbogen ins Gesicht, wirbelte herum und startete sogleich weitere Gegenangriffe.
Wendy setzte mehrere Fußtritte in die Luft und stieß dabei leise Schreie aus. Da attackierte sie der Angreifer mit einem weit ausholenden Schlag, den sie parieren musste. Schon ergriff sie mit ihrer linken Hand sein Handgelenk von innen, während sie einen Schritt nach vorn tat. Gleichzeitig streckte sie ihren rechten Arm unter seiner Achsel hindurch. Armbeuge in seine Achselhöhle! Mit dem Rücken zu ihm! Hüfte absenken! Mit dem Becken nach hinten stoßen und gleichzeitig an seinem Arm ziehen!
So hob Wendy den unsichtbaren Gegner auf ihren Rücken, zog ihn weiter nach vorn, führte ihre rechte Schulter in Richtung linkes Knie und warf ihn zu Boden.
Doch schon war er zurück auf den Beinen. Er attackierte sie gnadenlos. Also machte sie weiter: Kniestöße, Back Kicks, Front Kicks und Slap Kicks in rascher Folge. »Nimm das und das und das!«, rief sie laut aus.
Plötzlich hielt er ein Messer in der Hand, sie lenkte den Angriff weg, indem sie gegen seinen Handrücken schlug und die Waffe weit weg von ihrem Körper drückte. Sie ging leicht schräg und explosiv an ihn heran, ließ dabei den Arm nach vorn unten gleiten, um seinen Arm zu packen. Mit der Rechten schlug sie kräftig zu. Rechte Hand schnell zurückziehen, von oben auf die Hand des Gegners greifen! Wendy führte einen Cavalier aus und entriss ihm das Messer.
Sie nutzte die Überraschung aus und trat zu, mitten in seine Weichteile. Winselnd ging er vor ihr auf die Knie.
Geschafft.
Sie atmete schwer, wischte sich den Schweiß von der Stirn und legte das imaginäre Messer weg.
Es war mit einem Mal so ruhig in der Küche, kein Feind anwesend, niemand, der sie aus dem Hinterhalt ansprang. Bloß das leise Summen des Kühlschranks war zu hören und ihr wild pochendes Herz.
Im Eifer des Gefechts hatte sie einen Stuhl umgeworfen und den Tisch verrückt. Wendy stellte alles wieder an seinen gewohnten Platz, verkorkte die Weinflasche und ging zurück in ihr Zimmer.
Sie rollte sich unter der Bettdecke zusammen, nahm den alten abgeliebten Teddybären in die Arme und schlief endlich ein.
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Großmama kam herein, sie trug das Nachthemd mit den Rüschen.
»Wendy!«
Ihre Stimme klang wie ein Reibeisen.
Sie öffnete die Augen. »Was?«
Schon stand die alte Frau an ihrem Bett. Ihre Hand drückte sich auf ihren Mund.
»Schsch, sei still.«
Die andere Hand wollte ihr die Augen zudrücken, Fingernägel zerkratzten ihre Haut.
»Schau nicht hin! Nicht hinschauen.«
Wendy keuchte, strampelte mit den Füßen. Endlich konnte sie die alte Frau von sich wegschieben.
Sie starrte zu der geöffneten Tür hin, dahinter war ein schwacher Lichtschein.
»Um Himmels willen, nicht! Du wirst etwas Schreckliches sehen!«
Da war jemand. Eine Gestalt im Flur.
Und sie schreckte hoch, war sofort hellwach. Sie sprang auf, schüttelte den Alptraum von sich ab.
Instinktiv nahm sie ihre Kampfhaltung ein, hüftbreiter Stand, den linken Fuß vor, Gewicht auf den Fußballen, nicht auf den Fersen, die Hände locker auf Kinnhöhe, nicht zu nah am Gesicht, Ellenbogen eng am Körper, Schultern frontal nach vorn.
Aber da war nichts. Niemand. Sie war ganz allein.
Trojan hasste den klinischen Geruch in den Autopsieräumen der Charité, er verursachte bei ihm starke Übelkeit. Während er sich noch bemühte, eine betont lässige Haltung einzunehmen, schlug Dr. Semmler bereits das weiße Tuch zurück.
Das Gesicht der Toten war eingedrückt. Ihr gesamter Körper wirkte merkwürdig verschoben. Und überall auf ihrer wächsernen Haut befanden sich Abschürfungen.
»Sabrina Krempe«, murmelte Semmler. »Sechsundzwanzig Jahre alt, von Beruf Zahntechnikerin. Sie rennt heute Morgen in der Warschauer Straße vor die Tram, wird von dem Schienenfahrzeug erfasst und einige Meter weit mitgeschleift. Sie verstarb noch am Unfallort.«
Trojan zog einen Flunsch. »Und deshalb rufst du mich hierher? Wegen eines Verkehrsunfalls?«
Semmler wiegte den Kopf. »Wie lange arbeiten wir jetzt schon zusammen, Nils? Zehn Jahre, zwölf?«
Er antwortete mit einem gezwungenen Lächeln. »Okay, hab begriffen, du würdest niemals meine kostbare Zeit verschwenden.«
»So ist es. Zugegeben, ich hielt das Ganze zunächst auch für eine reine Routineangelegenheit. Aber sieh dir das mal an.« Mit geübtem Griff drehte Semmler den Leichnam auf die Seite.
Trojan trat näher an den Untersuchungstisch heran. Zwischen den Schulterblättern der Toten war etwas in die Haut eingeritzt. Da waren deutlich Buchstaben zu erkennen, in der Größe von etwa drei Zentimetern:
TRIEB
»Ich hab das mal mit dem Fingernagel an mir selbst ausprobiert«, sagte Semmler. »Weder über die Schulter von oben, noch mit verdrehtem Arm von unten kommst du an diese Stelle gut genug heran, um dir so eine makabre Botschaft in doch recht deutlichen Lettern selbst einzuritzen.«
»Wie alt ist die Wunde?«
»Nach meinem Befund relativ frisch. Sie wurde dem Opfer ungefähr vierundzwanzig Stunden vor Todeseintritt zugefügt. Und zwar mit einer glatten Klinge. Ein herkömmliches Springmesser vermutlich.«
»Herkömmlich?«
»Kannst du dir leicht im Internet besorgen. Da werden wenig Fragen nach der Legalität gestellt.«
»Haben wir Augenzeugenberichte vom Tatort?«
»Der Fahrer steht leider noch unter Schock. Einer der Fahrgäste sagte aus, die Frau habe weder nach links noch nach rechts geschaut. Sie ist auf die Straße gestürmt, als sei, und ich zitiere wörtlich, der Leibhaftige hinter ihr her.«
»War denn jemand bei ihr? Hat sich jemand in ihrer Nähe aufgehalten?«
»Offenbar nicht. Lässt sich aber auch nicht mehr genau feststellen.«
In Trojan arbeiteten zwei Impulse gleichzeitig. Der stärkere war, den Fall abzuwimmeln. Ein Unfall, weder ein Mord noch ein Totschlag. Sabrina Krempe könnte selbst jemanden gebeten haben, ihr die Buchstaben einzuritzen, vielleicht war das Teil eines bizarren Sadomaso-Spiels. Bei manchen Leuten lagen Schmerz und Eros eben dicht beieinander. Nach dieser Einschätzung könnte er schnell von hier abhauen und jeglichen Gedanken an dieses Gebäude verjagen, an die unzähligen Leichen in den Kühlfächern, die abgelebten Einzelschicksale, nackt ausgebreitet auf Metalltischen.
Aber war das nicht eher ein Antrieb der Flucht? Was war mit dem speziellen Kribbeln in seinen Fingern? Meldete sich nicht stets auf diese Art sein kriminalistischer Instinkt?
TRIEB, las er zum wiederholten Mal vom Rücken des Leichnams ab.
Schließlich fragte er: »Wo sind die Habseligkeiten der Toten?«
Semmler holte aus einer Schublade einen Klarsichtbeutel, in dem eine kleine Handtasche steckte, und hielt ihn hoch.
»Ist das alles?«
»Bloß noch ihre Klamotten. Hab alles durchsucht. Steckt nichts weiter darin. Aber ich kann sie dir gerne ins Kommissariat schicken lassen.«
Trojan zog ein Paar Latexhandschuhe aus seiner Jackentasche hervor und streifte sie sich über. Er ließ sich den Beutel geben, öffnete ihn, nahm die Handtasche heraus und ließ den Verschluss aufschnappen. Im Innern befanden sich Schlüsselbund, Geldbörse, Handy und diverse Schminkutensilien. Das Mobiltelefon unterzog er einer genaueren Untersuchung. Er klickte sich durch das Verzeichnis, bis ihm die letzte gewählte Rufnummer angezeigt wurde.
Mit einem Mal stellten sich seine Nackenhaare auf, und er stieß die Luft aus.
»Was ist los?«
Trojan antwortete nicht. Er starrte bloß auf die Ziffernfolge auf dem Display.
Sie kam ihm verdammt bekannt vor.
»Kümmerst du dich nun um die Sache?«
Lieber nicht, durchfuhr es ihn. Hitze wallte in ihm auf.
Oder unterlag er etwa einem Irrtum? Einem fatalen Zahlendreher in seinem Kopf? Nein, kein Zweifel, es war seine eigene private Telefonnummer.
»Nils!«
Endlich nickte er dem Rechtsmediziner zu.
»Ja«, sagte er heiser, »mach ich.«
Wendy hatte eine Strelitzie mitgebracht und drapierte sie in der Vase auf dem Kliniknachttisch. Sie liebte diese Blumen mit den leuchtend orangefarbenen und blauen Blüten, die aussahen wie der Federschmuck eines Paradiesvogels, und vielleicht konnte sich auch Großmama an dem Duft und den Farben erfreuen.
»Wie geht es dir heute?«, fragte sie aufgesetzt fröhlich. »Hast du gut geschlafen?«
Sie sah zu der alten Frau hin, die bleich und mit halb geöffnetem Mund in den Kissen lag. Gib dir keine Mühe, dachte sie bitter, sie ist ja ohnehin nicht bei Bewusstsein.
Und doch versuchte sie es weiter im munteren Tonfall. »Sag schon. Hast du vielleicht etwas geträumt?«
Ich hab nämlich von dir geträumt, dachte sie. Du hast schon immer etwas vor mir verborgen gehalten, nicht wahr? Für wie naiv hältst du mich eigentlich? Ich bin nicht mehr die kleine Wendy mit den blonden Zöpfen, die aus jeder noch so hoffnungslosen Situation krampfhaft das Beste zu machen versucht.
Da wandte die Alte auf einmal das Gesicht zu ihr hin und schlug die Augen auf.
Ihre Lippen bebten.
»Wendy, du musst zur …« Ihr versagte die Stimme, sie hustete, ein beängstigendes Keuchen drang aus ihrer Kehle.
Polizei, formte ihr Mund noch, dann verdrehten sich ihre Pupillen, und ihr Kopf sank zurück.
Wendy stürmte aus dem Zimmer.
Kurz darauf war sie mit der Krankenschwester wieder am Bett. »Doch, es ist wahr, sie hat für einen Moment mit mir gesprochen!«, rief sie aufgeregt.
Die Schwester fühlte den Puls der Alten, danach veränderte sie etwas an der Einstellung des Tropfes.
»Geht es ihr gut? Sie ist doch noch am Leben, oder?«
»Alles in Ordnung.«
Die Art, wie sie Wendy anlächelte, war freundlich und mitleidig zugleich.
»Ist ja gut, Schätzchen, bleiben Sie bei ihr. Reden Sie mit der Patientin, irgendwie kriegt sie das schon mit.«
Und sogleich war sie wieder zur Tür hinaus. Wendy ballte ihre Hände zu Fäusten und bemühte sich, ruhiger zu atmen.
Trojan schloss auf, eilte an dem Anrufbeantworter auf der Flurkommode vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, und warf sich im Schlafzimmer auf sein Bett. Es war am helllichten Tag, die Sonne schien herein, alle Fenster seiner Wohnung standen offen. Merkwürdig, um diese Zeit heimzukehren. Er war versucht sich auszumalen, er wäre am Beginn eines langen Urlaubs, in dessen Verlauf er all die Grausamkeiten in seinem Beruf einfach vergessen könnte.
Doch das war jetzt nicht möglich. Er musste dringend etwas überprüfen, um dann schleunigst zurück ins Kommissariat zu fahren.
Tu es endlich, sprach er in Gedanken zu sich selbst, zögere den Moment nicht unnötig hinaus, immerhin gibt es noch die klitzekleine Chance, dass du dich geirrt hast.
Auf seinem Weg zurück in die Diele ahnte er bereits, dass dies eine Illusion war. Er nahm sein Festnetztelefon aus der Ladeschale und scrollte sich durch das Verzeichnis. Da war der Eintrag. Die Uhrzeit stimmte schon mal überein. Gestern Nacht 1:23 Uhr.
Und dann las er Ziffer für Ziffer die Nummer des eingegangenen Anrufs ab. Sein Nacken verspannte sich, nun konnte er es nicht mehr leugnen: Es war die Handynummer der Toten.
Er drückte auf die Taste, um erneut das Band abzuhören.
Ihm war, als würde Sabrina Krempe aus dem Jenseits zu ihm sprechen, metallisch scheppernd, bloß wenige Worte:
»Er ist zurück. Und seine Rache wird grausam sein.«
Danach klickte es.
Lesen Sie weiter in
ISBN 978-3-641-15802-6 (eBook)
ISBN 978-3-442-20432-8 (Paperback)
ISBN 978-3-8445-1916-7 (Hörbuch)
Erscheinungstermin aller Ausgaben: 24.08.2015