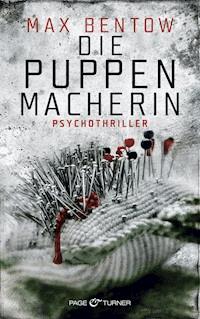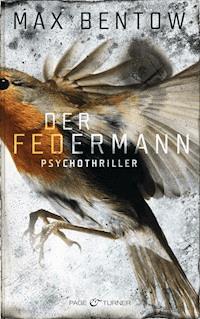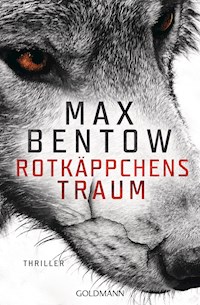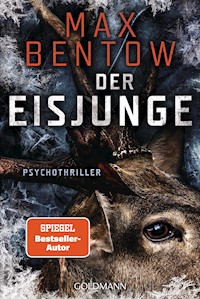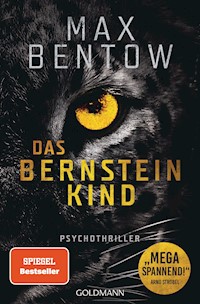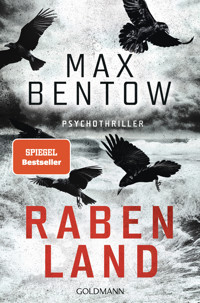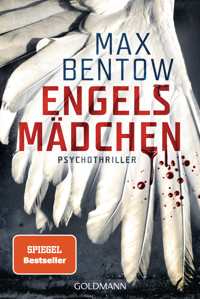9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Page & Turner
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Nils Trojan
- Sprache: Deutsch
Zwei kleine Mädchen verschwinden. Drei Menschen werden grausam hingerichtet. Und wer ist die »Hexe«, von der die Kinder erzählt haben?
Den Berliner Kommissar Nils Trojan erwartet ein alptraumhaftes Szenario, als er mitten in der Nacht am Schauplatz eines Verbrechens eintrifft: Das männliche Opfer wurde in seiner eigenen Küche auf grausame Weise hingerichtet, der Körper ist arrangiert zu einem grotesken Tableau. Noch bevor Trojan Atem holen kann, schlägt der Mörder wieder zu – und wieder trägt die Leiche die unverwechselbare Signatur des Täters.
Trojan hat nicht den geringsten Anhaltspunkt, doch dann verschwindet plötzlich die kleine Sophie, dicht gefolgt von ihrer Freundin Jule, von der ebenfalls jede Spur fehlt. Langsam beschleicht ihn der Verdacht, dass ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht - denn zwei Fragen gehen Trojan nicht aus dem Kopf: Warum haben die Kinder von einer mysteriösen "Hexe" gesprochen, die sie in Angst und Schrecken versetzt? Und warum fühlte er sich beim Anblick der Mordopfer fatal an ein bekanntes Kindermärchen erinnert?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Den Berliner Kommissar Nils Trojan erwartet ein alptraumhaftes Szenario, als er mitten in der Nacht am Schauplatz eines Verbrechens eintrifft: Das männliche Opfer wurde in seiner eigenen Küche auf grausame Weise hingerichtet, der Körper ist arrangiert zu einem grotesken Tableau. Noch bevor Trojan Atem holen kann, schlägt der Mörder wieder zu – und wieder trägt die Leiche die unverwechselbare Signatur des Täters. Trojan hat nicht den geringsten Anhaltspunkt, doch dann verschwindet plötzlich die kleine Sophie, dicht gefolgt von ihrer Freundin Jule, von der ebenfalls jede Spur fehlt. Langsam beschleicht ihn der Verdacht, dass ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht – denn zwei Fragen gehen Trojan nicht aus dem Kopf: Warum haben die Kinder von einer mysteriösen »Hexe« gesprochen, die sie in Angst und Schrecken versetzt? Und warum fühlte er sich beim Anblick der Mordopfer fatal an ein bekanntes Kindermärchen erinnert?
Max Bentow
Das Hexenmädchen
Psychothriller
Page&Turner
Inhalt
PROLOG
ERSTER TEIL
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
ZWEITER TEIL
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
DRITTER TEIL
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
VIERTER TEIL
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
EPILOG
Über den Autor
PROLOG
Einmal hielt sie inne, mitten im Schnee, und rang nach Luft. Ihre Lunge fühlte sich an, als steckte in ihr ein Heer aus tausend Messern. Atemwolken bildeten sich vor ihrem Mund in rascher Folge. Der Mond blitzte durch die Wipfel der Bäume hindurch, die Äste waren schwarz und kahl, wie knochige Hände, die nach ihr griffen. Vor Erschöpfung wollte sie einfach hinsinken. Doch obwohl sie noch ein Kind war, verstand sie: Ließe sie sich fallen, wäre alles vorbei. Die Schneedecke war ein Leichentuch. Also musste sie weiterlaufen.
Es war nicht einfach, im dichten Geäst des Waldes einen Weg zu finden, Zweige peitschten ihr entgegen, in Mulden sackte sie ein und strauchelte. Eine Zeit lang hatte die Kälte noch unter ihren Sohlen gebrannt, dann aber breitete sich die Taubheit aus und kroch allmählich an ihr herauf. Während sie weiterhastete, fürchtete sie, im Frost ihre Beine zu verlieren. Denn sie hatte ja nichts weiter als ein Nachthemd auf der Haut.
Schmerzhaft erinnerte sie sich an eine Geschichte, die ihre Mutter ihr einmal vorgelesen hatte. Darin war jemand erfroren, und kurz vor seinem Ende war er in eine täuschende Wärme gehüllt worden. So weit durfte es nicht kommen! Sie musste aus diesem Wald herausfinden.
Das Mädchen stolperte, rappelte sich auf und irrte weiter. Einmal versank sie knietief im Schnee, ein anderes Mal schlug ihr ein Ast so heftig gegen die Stirn, dass es ihr den Atem nahm.
Nicht umdrehen!, durchfuhr es sie. Weiter, vorwärts! Manchmal war ihr, als hörte sie Schritte in ihrem Rücken. Zuweilen glaubte sie ein Keuchen zu vernehmen, ganz nah bei ihr. Sicherlich war ihr Verschwinden längst bemerkt worden, und man hatte die Verfolgung aufgenommen. In diesen Momenten keimte Panik in ihr auf, und ihr Herz begann zu rasen. Sie zwang sich, allein auf ihre Bewegungen zu achten, nicht das Gleichgewicht und nicht die Orientierung zu verlieren. Nur nicht im Kreis laufen, die Richtung halten, möglichst geradeaus. Irgendwo musste dieser Wald doch enden.
Schließlich meinte sie, der Pfad würde sich vor ihr verbreitern, wie eine im Mondlicht glitzernde Spur, der sie nur zu folgen brauchte. Sie versuchte ihre Erschöpfung niederzuringen, bald aber wechselten sich Kälte und Hitze in ihr ab, und das Fieber lähmte sie. Sie war kurz davor aufzugeben, wollte sich hinwerfen und zum Mond hinaufstarren, in dessen Mitte sie ein mild lächelndes Gesicht ausmachte. Es schien ihr zuzuraunen: Schon gut, mein Kind, lass sein, strecke dich aus und gleite mit mir dahin. Das Zittern in ihrem Körper wurde immer stärker, sodass ihre Zähne aufeinanderschlugen und sie nur noch taumelnd vorankam.
Als sie erneut ins Straucheln geriet und sich an den Dornen eines Gebüsches verletzte, tropfte Blut in das eisige Weiß, und sie betrachtete es fasziniert, schwankend im Schwindel, bis sie sich endlich von dem Anblick losreißen konnte und sich weiterschleppte.
Der Weg änderte sich, die Bäume standen nun wieder dichter, und sie sah das lächelnde Mondgesicht nicht mehr. Alles vorbei, dachte sie, und ihr war, als drang die Stimme ihrer Mutter an ihr Ohr, sie sang leise ein Lied, schien sie zu liebkosen und in den Schlaf wiegen zu wollen.
Das Mädchen schüttelte sich. Nein, dachte sie, nur eine Erscheinung, geh schneller, du darfst dem nicht nachgeben. Und so beschleunigte sie ihre Schritte, und mit einem Mal tat sich ein Forstweg vor ihr auf. Der Mond war nun so hell und klar, dass sie sich seinem Licht ganz anvertrauen konnte.
Es brannte in ihren Augen, und plötzlich hatte sie wieder ein Gefühl in den Füßen. Unter ihr lag Schotter, spitze Steine bohrten sich in ihre nackten Sohlen. Schließlich erkannte sie die Landstraße, und da waren zwei Scheinwerferkegel. Sie kamen näher.
War das ein Wagen? Sollte das ihre Rettung sein?
Das Mädchen atmete schwer, unter größter Anstrengung hob sie beide Arme und bewegte sie.
Das Auto näherte sich. Langsam, viel zu langsam, dachte sie, und verzweifelt fuchtelte sie mit den Händen in der Luft herum. Hoffentlich bemerkte man sie auch.
Schon vernahm sie das Motorengeräusch. Sie winkte unter Schmerzen. Ihr Nachthemd schien an ihrer Haut festgefroren zu sein, und ihre Finger waren bläulich und gekrümmt.
Der Wagen hielt.
Das Mädchen war wie erstarrt und wartete, dass man ihr helfen würde.
Sie sah, wie der Fahrer ausstieg und auf sie zukam. Das Licht der Schweinwerfer stach ihr in die Augen, direkt hinein.
Und dann stand der Mann vor ihr. Fassungslos blickte er sie an. Bis sich sein Mund auftat und er zu ihr sprach.
»Was ist mit dir, Kind? Großer Gott. Wo kommst du her?«
Sie taumelte, und er fing sie auf. Erst als er sie auf die Rückbank seines Wagens gelegt und in eine Decke gehüllt hatte, war sie sich halbwegs sicher, dass er nicht die Ausgeburt ihres Fiebers war.
Sie bemerkte noch, wie er sich hinters Steuer setzte. Gleich darauf fielen ihr die Augen zu. Als sie sie wieder öffnete, fuhren sie noch immer durch die Nacht. Er hatte ihr zugeraunt, er werde sie in ein Krankenhaus bringen.
Das Mädchen wollte sich aufrichten und ihm etwas sagen. Er hatte sie doch gefragt, woher sie kam. Und darauf musste sie ihm antworten.
Sie nahm ihre letzte Kraft zusammen. Allerdings wusste sie nicht genau, ob er sie auch verstand, als sie kaum hörbar flüsterte:
»Ich war bei der Hexe. Tief im Wald.«
ERSTER TEIL
Eins
Ronja schlug die Augen auf. Sie hatte wirr geträumt. Da war ein brauner Umschlag gewesen, in der Post ihres Vaters, und darin hatte sie Teile ihrer Barbiepuppe gefunden, einen Arm, den Kopf, ein Bein. Auch anderes Spielzeug war darin, alles zertrümmert, alles kaputt.
Sie atmete schwer. Es war doch nur ein Traum gewesen. Aber etwas stimmte nicht, das spürte sie sofort, ihre Hände waren schweißnass.
Sie lauschte.
Ihr Vater war draußen im Flur, seine Stimme klang seltsam gepresst. Und noch eine andere Stimme konnte sie ausmachen, dunkel und fremd. Dann fiel polternd etwas um, und wieder hörte sie ihren Vater. Es folgten ein Schlag und ein dumpfer Schmerzenslaut.
Sie setzte sich erschrocken auf, klammerte sich an ihrer Bettdecke fest.
Wer war das? Hatte ihr Vater Besuch bekommen, mitten in der Nacht? Ihre Mutter konnte es jedenfalls nicht sein, denn sie war zu einer Fortbildung gefahren und würde erst in drei Tagen zurückkehren. Ronja vermisste sie.
Sie musste nachsehen, was da draußen los war. Sie schwang sich aus dem Bett, schlich sich zur Tür und öffnete sie einen Spalt.
Gleich darauf wich sie zurück. Der Flur war hell erleuchtet, und auf dem Boden schimmerte eine Blutspur.
Sie wollte nach ihrem Vater rufen, doch etwas schnürte ihr die Kehle zu. Sie horchte. Wieder ein gedämpftes Geräusch, dann ein Wimmern. Was sollte sie nur tun?
Schließlich nahm sie all ihren Mut zusammen, glitt hinaus und folgte zögernd den Blutstropfen auf dem Dielenboden. Sie führten hin zur Küche. Da war ein leiser Tumult.
Nur noch ein paar Schritte bis zu der angelehnten Tür, sie traute sich kaum zu atmen. Wenn dahinter nun ein Einbrecher war? Bestimmt würde er auch ihr wehtun.
Erneut vernahm sie die Stimme ihres Vaters. Sie klang so sonderbar. Er stöhnte vor Schmerz.
Ängstlich starrte sie durch den Türspalt hindurch.
Da kniete jemand am Boden. War das ihr Vater?
Jemand würgte und wimmerte zugleich. Und dann zischte die fremde Stimme etwas, entsetzt taumelte Ronja zurück, erst einen Schritt, dann noch einen, schließlich drehte sie sich um und irrte ziellos im Flur umher. Ihr Atem ging stoßweise, in ihren Ohren lärmte ein merkwürdiger Pfeifton, sie hatte das Gefühl, ihr Kopf würde platzen. Der Vater hatte ihr immerzu eingeschärft, was in einem Notfall zu tun sei: zum Telefon, 110 wählen!
Auf der Kommode stand der Apparat, die Ziffern des Anrufbeantworters leuchteten in Signalrot, doch das Telefon steckte nicht in der Ladeschale. Wo war es nur? Sie sollte im Wohnzimmer nachschauen gehen, aber um dorthin zu gelangen, müsste sie an der Küche vorbei, und das war zu gefährlich.
Ihre Hände zitterten, man würde sie entdecken.
Da fuhr sie zusammen. Schläge aus der Küche, gefolgt von gepressten Lauten wie von einem verwundeten Tier. Ohne länger nachzudenken, floh sie ins Bad und schloss hinter sich ab.
Keuchend stand sie in dem halbdunklen Raum, sie wagte es nicht, das Licht einzuschalten. Sie presste das Ohr an die Tür.
Jemand wimmerte. Ihr Vater.
Wenn doch nur die Nachbarn aufwachen würden. Jemand müsste Hilfe holen und sie beide retten. Hatte sie denn die Nachttischlampe in ihrem Zimmer angeknipst? Das könnte sie verraten.
Leise schluchzte sie auf.
Niemand kam. Hilflos stand sie da. Es dauerte lange.
Schließlich herrschte Stille. Bloß das Tosen ihres Blutes war zu vernehmen und ihr heftig schlagendes Herz. Sie musste dringend aufs Klo, aber ihre Angst verbot ihr, sich zu rühren. Sie presste die Beine zusammen und wartete ab.
Mit einem Mal war ihr, als sei jemand draußen an der Tür.
Sie saß in der Falle.
Gehetzt sah sie sich um. Wo konnte sie sich nur verstecken? Hinter dem Duschvorhang vielleicht? Wenn der Einbrecher jedoch merkte, dass abgeschlossen war, wüsste er gleich Bescheid. Er würde die Tür aufbrechen, und sie wäre geliefert.
Sie zitterte.
Nichts geschah.
War der Fremde weg? Stille. Was war mit ihrem Vater? Warum rührte er sich nicht?
Schließlich glaubte sie, ein Geräusch an der Wohnungstür zu hören. Als würde sie jemand beinahe lautlos ins Schloss ziehen.
Noch immer traute sie sich nicht hinaus.
Sie brachte es nicht einmal fertig, den Toilettendeckel zu heben. Stattdessen lief warm der Urin an ihren Beinen herab, und sie weinte kaum hörbar.
Da dachte sie wieder an ihren Traum. Der Kopf ihrer Barbiepuppe, abgetrennt vom Körper.
Es erschien ihr wie eine Ewigkeit, bis sie endlich bereit war, den Riegel umzulegen. Vorsichtig drückte sie die Klinke herunter.
Im Flur brannte noch immer Licht.
Und da war das Blut.
Langsam ging sie zur Küche.
Die Tür stand nun weit offen.
»Papa?«, fragte sie leise. Aber es kam keine Antwort.
Sie stand reglos an der Schwelle.
Da bemerkte sie den Geruch. Verbrannt. Versengt. Und es war heiß, viel zu heiß.
Ihre Knie wurden weich, sie musste sich am Türrahmen abstützen. Wie in Zeitlupe reckte sie den Kopf vor und blickte in die Küche hinein.
Da riss das Mädchen den Mund auf und erstarrte.
Ein Klirren, und Emily Trojan schreckte hoch.
Normalerweise hatte sie einen tiefen Schlaf. So wäre das Geräusch auch kaum in ihr Bewusstsein gedrungen, sie hätte sich einfach umgedreht und weitergeschlummert. Doch seit dem Streit mit ihrer Mutter, der sie dazu bewegt hatte, vorübergehend wieder bei ihrem Vater einzuziehen, war sie dünnhäutiger geworden.
Sie hatte sich an die neuen Umstände noch nicht recht gewöhnt. Vielleicht lag es auch daran, dass ihr Vater oftmals nachts zu Einsätzen gerufen wurde und sie sich nie sicher sein konnte, ob er zu Hause war oder nicht, auch wenn sie wusste, wie sehr es ihn belastete, sie wegen seines Jobs allein lassen zu müssen.
Dieser verdammte Job, der nach ihrer Meinung ein wesentlicher Grund dafür war, warum sich ihre Eltern getrennt hatten.
Und so war sie mit einem Mal hellwach.
Sie stand auf und tappte in den Flur. Die Schlafzimmertür ihres Vaters stand offen, es brannte Licht, das Bett war zerwühlt, doch er war nicht da. In der Küche sah sie Scherben am Boden, ein zerbrochenes Glas, eine Wasserlache.
»Paps?«
Schließlich entdeckte sie ihn im Wohnzimmer.
Seine Silhouette zeichnete sich vorm Fenster ab. Draußen schien der Mond.
Sie trat näher. Er war leichenblass, krümmte sich, beide Arme um den Oberkörper geschlungen.
»Paps!«
Er keuchte.
»Was ist mit dir?«
Sie nahm seine Hand, sie war eiskalt und zittrig. Auf seiner Stirn glänzte der Schweiß.
»Um Himmels willen, was ist los?«
Er zog eine Grimasse, antwortete nicht.
Die Angst kroch an ihr hoch, so hatte sie ihren Vater noch nie erlebt. »Papa!«
»Das Herz«, stammelte er endlich, »irgendwas stimmt da nicht.«
»Mein Gott.« Was, wenn sie ihn verlieren würde? »Nicht doch!« Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Dieses Keuchen. Was hatte er bloß?
»Ich ruf den Notarzt«, sagte sie. Ihre Stimme klang schrill.
Er umklammerte ihre Hand, ließ sie nicht gehen. Er schüttelte den Kopf.
»Aber Paps, du brauchst Hilfe.«
»Geht schon wieder«, flüsterte er.
Er sah furchtbar aus. Sie bekam eine Gänsehaut.
Eine Weile starrten sie sich wortlos an. Dann löste sie sich von ihm und eilte zum Telefon.
Wenn er sich lediglich auf die Reihe der Neonröhren an der Decke konzentrierte, würde er sich vielleicht wieder in den Griff bekommen. Sie von vorne bis hinten im Flur der Notaufnahme durchzählen und dabei in die Papiertüte atmen, wie man es ihm geraten hatte. Den Atem durch die Nase einströmen und ihn durch den Mund in die Tüte ausströmen lassen, währenddessen den Blick auf das erste Licht heften, weiteratmen, den Blick gleiten lassen. Hin zur zweiten Lampe, gut so. Und weiter. An nichts anderes denken, weder an einen Infarkt noch daran, irgendwann völlig auszurasten.
Die Tüte in seinen Händen blähte sich, mittlerweile war sie von seinem Schweiß beinahe aufgeweicht. Die nächsten hundert Atemzüge durchhalten, dachte er, das Einzige, was jetzt wichtig war.
Emily drückte seinen Arm, für einen Moment gerieten ihre blonden Locken in sein Gesichtsfeld, ihr aufmunterndes Lächeln, diese Grübchen, die braunen Augen. Meine Tochter, dachte er. Verdammt, dass sie das alles mitbekommen musste. Er wollte etwas zu ihr sagen, ließ es dann aber bleiben, weil er nicht mit dem Atmen durcheinanderkommen wollte. Sein Herz raste noch immer. Wie irr, hämmerte es seinem Kopf, wie irr, in einem fort.
Plötzlich trat sie zur Seite. Und da war der Weißkittel. Trojan verstand nicht ganz, warum man ihn nicht gleich auf die Intensivstation gebracht hatte, überhaupt verstand er so einiges nicht. Nahm man ihn etwa nicht ernst?
»Herr Trojan?«
»Hmm.«
Der Arzt blickte unbekümmert auf ihn herab, die Papiertüte blähte sich gerade, erschlaffte, um mit dem nächsten Atemzug wieder prall zu werden. Mit einem Mal war ihm das peinlich vor diesem Kerl. Er ließ die Tüte sinken. Schon pochte sein Herz wieder schneller, und das Schwindelgefühl war zurück.
»Schlechte Nachrichten, Doc?«
»Nicht im Geringsten. Ihr EKG ist in Ordnung. Und auch die übrigen Tests haben nichts ergeben.«
»Kein Infarkt?«
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Leiden Sie öfter unter Panikattacken?«
Trojan antwortete nicht. Stattdessen wollte er sich auf der Liege aufrichten, aber er war noch zu schwach.
»Hatten Sie viel Stress in letzter Zeit?«
Trojan verzog das Gesicht.
»Stress?«, sagte Emily. »Das ist sein zweiter Vorname.«
Der Weißkittel schaute auf sein Klemmbrett. »Die Blutwerte sind okay.«
»Das Herz wummert. Wie verrückt.«
»Könnte psychische Ursachen haben.«
Er stieß die Luft aus. Er dachte an Jana, seine Ex-Therapeutin. Es machte ihn ratlos.
»Tut mir leid, mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun.«
Trojan nickte, die schlaffe Papiertüte in der Hand.
»Bleiben Sie ruhig noch ein bisschen hier liegen«, sagte der Arzt und verabschiedete sich.
Schon war er verschwunden.
Trojan sah zu seiner Tochter hin.
»Was ist das nur mit dir, Paps?«
»Ich weiß es nicht.«
»Die müssen dich doch weiter untersuchen. So können die dich nicht gehen lassen.«
»Abwarten«, murmelte er.
Lange Zeit horchte er in sich hinein. Er war so zittrig.
Und dann fragte er: »Du schreibst doch morgen eine Geschichtsklausur, oder nicht? Kriegst du das überhaupt noch hin?«
»Ist doch völlig egal, wenn es dir nur besser geht.«
In diesem Moment läutete das Handy in seiner Hosentasche. Das kann doch nicht wahr sein, durchfuhr es ihn. Er nahm es heraus und blickte auf das Display.
»Schalt es lieber aus«, sagte sie.
»Es ist Landsberg.«
Emily runzelte die Stirn.
Eine Weile zögerte er noch, dann drückte er entgegen seiner Absicht auf die grüne Taste und meldete sich.
Als er seinem Chef schweigend zuhörte und keine Anstalten machte, das Gespräch zu beenden, stemmte Emily die Hände in die Hüften.
Schließlich boxte sie ihm leicht gegen die Schulter: »Sag ihm, dass du einfach nicht mehr kannst! Du hattest einen Zusammenbruch, du bist …!«
»Schon gut«, murmelte er zu ihr hin. Und kurz darauf sprach er in den Hörer: »In Ordnung. Klar.«
Seine Tochter starrte ihn an.
Er unterbrach die Leitung und steckte das Handy wieder ein.
Ich hab keine Kraft mehr, dachte er. Wie soll ich das nur schaffen?
»Was wollte er von dir?«
Er schwieg.
Es half alles nichts, er musste da hin.
»Tut mir leid, Emily, aber es ist meine Pflicht.«
»Was?«
»Ich muss los.«
»Jetzt? Bist du verrückt?« Sie schnappte nach Luft. »Das bringt dich noch um.«
Vielleicht hat sie ja recht, dachte er. Seine Hände zitterten, als er die Papiertüte zusammenfaltete.
Mühsam richtete er sich auf.
Zwei
Als Nils Trojan die Tatortwohnung in der Lenaustraße betrat, wusste er sogleich, dass ihn das Bild, das sich ihm dort bot, auf immer in seinen Alpträumen verfolgen würde.
Da kniete ein Mann vorm geöffneten Backofen in der Küche. Seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt, auch seine Fußgelenke waren mit einem Strick verknotet.
Das Schlimmste aber war der Anblick des Kopfes, der seltsam verdreht auf dem Rost im Ofen lag. Die Haare waren zum Teil weggesengt, die Gesichtshaut war verbrannt, das rohe Fleisch darunter zu erkennen. Die Augen des Mannes waren hervorgequollen, sein Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen.
Obwohl er sich am liebsten abgewendet und fluchtartig den Raum verlassen hätte, zwang sich Trojan in die Hocke, um genauer hinzuschauen. Und so erkannte er, dass tief im Rachen des Mannes ein Stoffknäuel steckte.
Als er sich wieder aufrichtete, wurde ihm kurzzeitig schwarz vor Augen.
Sein Blick wanderte durch die Küche. Ein umgeworfener Stuhl. Ein paar Blutflecken. Spuren eines Kampfes.
Sein Chef, die Kollegen vom Team und der Kriminaltechnik, Dr. Semmler, der Rechtsmediziner, sie alle standen betreten in der Küche herum, vorübergehend sprachlos angesichts dieses Grauens.
Trojan bemühte sich, tief durchzuatmen. Sein Brustkorb fühlte sich an, als sei er in ein Eisenkorsett gepresst.
Es roch nach Tod, verbranntem Fleisch.
Und nach Folter.
Er versuchte sich zu sammeln. Seine Stimme war rau.
»Name?«
»Georg Haubacher, vierundvierzig Jahre alt, von Beruf Gymnasiallehrer«, antwortete Stefanie Dachs. Sie hatte sich ihr dunkelblondes Haar wie so oft, wenn sie im Einsatz war, zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden.
»Tatzeit?«
»Vor etwa zwei Stunden, länger nicht«, sagte Semmler.
»War der Backofen noch eingeschaltet, als man ihn gefunden hat?«
»Nein«, sagte der kleine, bullige Ronnie Gerber, »aber der Kopf war bereits ziemlich verbrannt, als seine …«, er schluckte, »… seine kleine Tochter ihn gefunden hat.«
»Um Himmels willen, war sie in der Wohnung, als es passiert ist?«
Er nickte.
Landsberg ergänzte: »Sie wurde von Kampfgeräuschen geweckt, kam leise aus ihrem Zimmer, dann hat sie sich geistesgegenwärtig im Bad eingeschlossen. Das hat ihr sicher das Leben gerettet. Offenbar hat der Täter oder die Täterin sie nicht bemerkt.«
»Hat sie was beobachtet?«
»Wohl nicht.«
»Gibt es Einbruchsspuren?«
Kopfschütteln. »Es scheint, als hätte Haubacher seinen Mörder oder seine Mörderin in die Wohnung gelassen.«
»Im Flur gab es einen Kampf«, sagte Albert Krach.
»Auch dort eine Blutspur«, sagte Trojan, »hab ich gesehen.«
Semmler deutete auf das halbverbrannte Gesicht des Toten. »Da ist nicht mehr viel zu erkennen, aber am Körper sind ein paar Blessuren. Der Mann hat sich gewehrt.«
Trojan hatte einen säuerlichen Geschmack im Mund. »Wo ist die Kleine jetzt?«, fragte er leise.
»In ihrem Zimmer«, sagte Dennis Holbrecht auf seine schüchterne Art leise, aber eindringlich. »Sie weigert sich herauszukommen.«
»Das ist der Schock.«
»Sie lässt nicht mal einen Arzt an sich heran.«
»Kann ich verstehen. Die ist fertig für den Rest ihres Lebens. Das hier ist wie …« Er brach ab.
»Sprich es aus, Nils«, sagte Landsberg.
Trojan blickte ihn an. »Wie eine Hinrichtung.«
»Hmm.«
»Wo ist die Mutter des Mädchens?«
»Nicht in der Stadt, auf Fortbildung. Wir haben sie benachrichtigt, sie ist hierher unterwegs.«
Trojan schaute zu Semmler hin. »Deine Einschätzung?«
»Ich vermute, dass er an dem Knäuel in seinem Rachen erstickt ist. Das sollte ihn wohl am Schreien hindern. Es sieht mir aus wie ein großes Taschentuch. Der Täter oder die Täterin muss es ihm mit äußerster Brutalität in die Kehle gestoßen haben. Es ist aber auch möglich, dass er durch den Verbrennungsschmerz einen Herzinfarkt erlitten hat. Mehr weiß ich nach der Autopsie.«
Bei dem Wort Infarkt griff sich Trojan instinktiv an die Brust. Die rasante Fahrt von der Notaufnahme hierher im Polizeiwagen, mit dem man ihn abgeholt hatte, war ihm wie ein wirrer Angsttraum erschienen. Das Morden nimmt kein Ende, dachte er, und es wird immer grausamer. Was ist der Mensch? Ein krankes Tier?
Er dachte an Emily. Nun war sie wieder allein in der Wohnung. Bestimmt würde sie nicht mehr einschlafen können. Und wenn sie ihre Klausur am nächsten Morgen vergeigte, war das seine Schuld.
Entsetzt blickte er auf den Toten.
»Haben die Techniker genügend Fotos von ihm gemacht?«, fragte er schwach.
»Ja«, murmelte jemand.
»Dann sollten wir ihn jetzt aus dieser demütigen Haltung befreien.«
Dieser saure Geschmack. Gallensaft. Sein Magen rebellierte.
Semmler nickte. »Ich übernehme das.«
»Das muss doch einen furchtbaren Krach gemacht haben«, sagte Dennis Holbrecht.
»Hat denn keiner der Bewohner …?«
»Die Befragungen laufen. Bisher keine Hinweise.«
»Eine Nachbarin hat ein Poltern gehört«, sagte Stefanie. »Hat sich aber nicht weiter darum gekümmert.«
»Knöpft sie euch alle vor«, sagte Trojan. »An die Arbeit. Ich werde versuchen, mit dem Mädchen zu reden.«
Eine Ärztin trat auf ihn zu, als er in das Kinderzimmer gehen wollte.
»Wir sollten sie da rausholen, aber sie fängt an zu schreien, sobald man ihr nur zu nahe kommt.«
»Schon gut.«
»Ich wollte ihr eine Beruhigungsspritze geben, aber sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt.«
»Ich werde es versuchen.«
Trojan ging hinein und schloss die Tür hinter sich.
Er näherte sich dem Bett. Verborgen unter der Decke, dessen Bezug ein Muster mit springenden Delfinen hatte, kauerte jemand.
»Hallo«, sagte er.
»Geh weg.«
»Ich heiße Nils.«
»Das ist mir egal.«
»Wie heißt du?«
Keine Antwort.
Er setzte sich an den Bettrand, wartete ab. Neben dem Kopfkissen lag ein Teddybär. Unten war ein kleiner Griff mit einer Schnur, er zog daran. Es war eine Spieluhr, die Melodie eines Schlaflieds erklang. Als Kind hatte Emily auch so eine gehabt.
Er saß da und summte die Melodie leise mit.
Es beruhigte ihn, und auch das Mädchen schien es nach einer Weile zu besänftigen, denn plötzlich lugte ihr Kopf unter der Bettdecke hervor.
»Wie alt bist du?«, fragte er.
»Neun. Und du?«
»Vierundvierzig.«
»Das ist alt.«
»Findest du?«
»So alt wie mein Vater.«
Er schlug die Augen nieder.
»Wo kommt er jetzt hin?«, fragte das Mädchen.
»Wir werden ihn untersuchen.«
»Aber er ist tot.«
Er nickte.
»Warum wollt ihr ihn dann noch untersuchen, wenn er tot ist?«
»Um seinen Mörder zu finden. Hör zu«, sagte er und zog die Spieluhr ein zweites Mal auf, »wenn du mir genau erzählst, was du heute Nacht gesehen und gehört hast, stehen die Chancen sehr gut, den Mörder deines Vaters zu fassen.«
Das Mädchen überlegte, nagte an ihrer Unterlippe. »Okay«, sagte sie schließlich.
Und dann erzählte sie, wie sie aufgewacht und hinaus in den Flur gegangen war.
»Was hast du gesehen?«
»Blut. Am Boden.«
»Was noch?«
»Mein Vater hockte in der Küche.«
»Wer war bei ihm?«
»Ich weiß nicht.«
»Hast du denjenigen gesehen?«
»Nein.«
»Hast du etwas gehört?«
»Eine Stimme.«
»War es die Stimme eines Mannes oder einer Frau?«
»Weiß nicht.«
»Was geschah dann?«
»Ich hab mich im Bad eingeschlossen, weil ich das Telefon nicht finden konnte.«
»Das hast du gut gemacht.«
Sie sah ihn an.
»Und weiter?«, fragte er.
»Er hat gestöhnt. Richtig laut. Es dauerte lang. Ich hab auch meinen Papa gehört. Er hat gestöhnt. Man hat ihm wehgetan, stimmt’s?«
Trojan nickte ernst.
»Als alles still war, bin ich raus. Und dann …«
Sie weinte nicht.
Er schwieg.
Schließlich fragte er: »Konntest du schon mit deiner Mutter sprechen?«
»Ja, am Telefon.«
»Sie kommt zu dir.«
»Hmm.«
»Aber es dauert noch ein bisschen.«
»Ich weiß.«
»Gibt es irgendjemanden, bei dem du heute übernachten möchtest? Eine Tante vielleicht oder eine Oma?«
»Meine Patentante.«
»Sollen wir sie anrufen?«, fragte Trojan.
Und das Mädchen nickte.
»Gut.« Er reichte ihr den Teddybären mit der Spieluhr und lächelte sie an.
»Warum war sein Kopf im Ofen?«, fragte sie.
Er schluckte.
»Es war so heiß, und es hat gestunken.«
Trojan wusste nicht, was er ihr darauf erwidern sollte.
Das Mädchen starrte ihn an.
»Ich heiße übrigens Ronja«, sagte sie leise.
»Okay, Ronja, ich bringe dich jetzt erst einmal von hier weg.«
Sie zögerte einen Moment, dann schlang sie die Bettdecke um sich herum, nahm den Teddybären und stand auf.
Drei
Sophie saß auf der Schaukel und fror. Sie war ganz allein. Hoffentlich kam Jule bald, mit ihr wäre es lustiger. Mit ihr war es selbst auf einem verlassenen Spielplatz im Winter schön. Auf einmal fürchtete sie, ihre Freundschaft könnte schon wieder vorbei sein, obwohl sie gerade erst begonnen hatte, nämlich vor ein paar Tagen, als sie sich genau hier begegnet waren.
Sie stieß sich mit den Füßen vom hartgefrorenen Sand ab und umklammerte mit den Händen die Eisenkette, an der der Sitz der Schaukel befestigt war. Sich vor- und zurücklehnend, geriet sie in Schwung, und je höher sie kam, desto besser fühlte sie sich. Von weiter oben sah alles weniger traurig aus, die rostigen Spielgeräte, die zerbeulten Papierkörbe, der Müll in den Sträuchern und die gefrorenen Pfützen.
Da sah sie wieder das cremefarbene Auto um die Ecke biegen und erschrak. Es war nun schon das dritte Mal, und erneut verlangsamte es, im Schritttempo zog es an dem niedrigen Zaun des Spielplatzes vorbei, und ihr war, als würde jemand aus dem Inneren die ganze Zeit gebannt zu ihr herüberspähen.
Oder bildete sie sich das bloß ein?
Bemüht, sich den Anschein von Gleichgültigkeit zu geben, holte sie noch mehr Schwung und erreichte die höchste Stelle. Es war der Punkt, an dem sie stets befürchtete, sich mit der Schaukel zu überschlagen. Einerseits war das beängstigend, andererseits genoss sie den Kitzel, das flaue Gefühl im Magen. Sie sauste nach vorn, den cremefarbenen Wagen im Blick. Vielleicht war diese verschwommene Gestalt am Steuer nur auf Parkplatzsuche, doch längst hatte sie mindestens zwei Lücken in den Reihen der abgestellten Autos entdeckt, in die das Fahrzeug hätte einscheren können.
Sie zählte in Gedanken bis dreißig, dann war es endlich weg. Doch nur kurze Zeit später bog es wieder um die Ecke. Es war bloß einmal ums Karree gefahren.
Sie hielt in ihren Bewegungen inne. Dann stoppte sie mit den Füßen ab. Bald darauf stand die Schaukel still.
Vor ihrem Mund bildeten sich Atemwolken, so kalt war die Luft.
Sie fixierte die Seitenscheibe des Wagens, schemenhaft machte sie dahinter die Umrisse des Fahrers oder der Fahrerin aus. Kein Zweifel, sie wurde angestarrt. Was hatte das zu bedeuten?
Schnell weg, die Schultasche nehmen und rennen, allerdings durfte sie Jule nicht verpassen. Auf das Treffen mit ihr hatte sie sich doch so sehr gefreut. Was sollte Jule von ihr denken, wenn sie Verabredungen nicht einhielt? Sie würde sich eine andere Freundin suchen.
Als der Wagen plötzlich anhielt, zog sie die Schultern hoch. Auf einmal war ihr so kalt, dass sie zu zittern begann.
Ihre Augen tränten im eisigen Wind.
Nicht hinsehen, dachte sie, nicht auffallen, und sie senkte den Blick.
Nichts geschah.
Nach einiger Zeit heulte der Motor auf, und der Wagen raste davon. Mit quietschenden Reifen bog er um die nächste Straßenecke und verschwand.
In diesem Moment sprach sie von hinten jemand an.
Sie schrie auf, sprang von der Schaukel und drehte sich um.
Es war Jule.
»Was ist los mit dir?«
Sophie holte zu einer Geste aus, als hätte sie bloß Spaß gemacht, dabei versuchte sie zu grinsen. Doch es wurde nur eine schiefe Grimasse daraus.
Schließlich sagte sie einfach leise: »Hallo.«
Jule nickte ihr zu. Sie hatte sich das Haar zu Zöpfen geflochten, das gefiel Sophie. Dass sich Jule überhaupt mit ihr abgab, so schön wie sie war. Stolz und schön.
»Hast du sie mit?«, fragte Sophie.
»Ja.«
Ihr Herz klopfte. Sie wusste nicht, ob es an dem cremefarbenen Auto lag oder daran, dass ihre neue Freundin endlich bei ihr war.
Und Jule zog die Schneekugel aus ihrer Manteltasche. Sie hatte sie also wirklich mitgebracht, wie versprochen. Ein Lieblingsgegenstand aus ihrem Besitz, von dem sie ihr gestern erzählt hatte, bestimmt etwas, das sie nicht jedem zeigte.
»Darf ich?«, fragte Sophie zaghaft, und Jule reichte sie ihr.
Schon begann Sophie die Kugel zu drehen, und die Flocken darin stoben auf und tanzten. In dem Glas befand sich ein kleines Lebkuchenhaus, und davor stand eine noch kleinere Figur, unverkennbar die Hexe. Sie war alt, böse und bucklig, und das Mädchen daneben konnte niemand anderes sein als Gretel.
Und wieder schüttelte sie die Kugel, und wieder wirbelten die Schneeflocken auf, es war faszinierend. Wie gern hätte sie auch so ein Spielzeug gehabt.
Dann fragte sie: »Wo ist eigentlich Hänsel? Da sind nur Gretel und die Hexe drin.«
Jule war ihr jetzt sehr nah, sie steckten buchstäblich die Köpfe zusammen. Sophie konnte ihren Atem spüren.
»Hänsel hat schon immer gefehlt.«
»Ist er im Hexenhaus?«
»Nein. Es gibt ihn einfach nicht.«
»Aber er muss doch da sein.«
»Muss er nicht. Die Hexe und Gretel, das reicht.«
Sophie ließ die Flocken tanzen.
Jule nahm ihr die Kugel aus der Hand. »Ich muss jetzt los.«
»Jetzt schon?«
Das konnte doch noch nicht alles gewesen sein. Den ganzen Tag hatte sie sich auf diesen Moment gefreut. Jule aber steckte die Schneekugel wieder ein und wandte sich zum Gehen.
»Warte.«
Jule hielt inne.
»Ich hab heute Nacht von ihr geträumt«, sagte Sophie.
Jule runzelte die Stirn. »Von der Hexe, meinst du?«
»Hmm.«
»Was hat sie getan?«
»Sie stand an meinem Bett. Stand einfach nur da.«
»Das war auch in meinem Traum neulich so.«
Es muss etwas Besonderes sein, dachte Sophie, wenn zwei Menschen den gleichen Traum haben. Sie hoffte, dass auch Jule das so sah. Und sie dachte: Ich will, dass sie eines Tages zu mir sagt, unsere Freundschaft ist wie keine andere.
Noch immer schlug ihr Herz viel zu heftig.
»Was geschah dann?«, fragte Jule.
»Sie wollte nach mir greifen.«
»Hast du Angst gehabt?«
Sophie nickte. »Ich hab geschrien, dann war sie weg.«
Sie schauten einander schweigend an, Atemwolken vor den Mündern. Jules Gesicht war vor Kälte gerötet.
Und endlich brachte Sophie es heraus: »Willst du mal mit zu mir kommen?«
Sie hatte ihr erst gestern das Mietshaus gezeigt, in dem sie wohnte. Alles wäre so einfach, sie beide in ihrem Zimmer, ein ganzer Nachmittag, zwei beste Freundinnen.
»Okay«, sagte Jule.
Das war ihr Einverständnis. Sophie hätte es gern mit einem Handschlag besiegelt. Oder einer Umarmung. Sie machte einen Schritt auf sie zu, doch Jule hob bloß das Kinn zum Abschied.
»Bis dann«, sagte sie.
»Bis dann.«
Sie schaute ihr noch lange nach. Meine neue Freundin, dachte sie.
Da hörte sie das Motorengeräusch. Nicht umdrehen, befahl sie sich. Schließlich tat sie es doch.
Es war das cremefarbene Auto.
Wie in Zeitlupe bog es um die Straßenecke.
Die Frau schien ein Mutant zu sein. Als sie auf ihm hockte, nackt und gierig, und ihr langes Haar in den Nacken warf, gab es leichte Veränderungen in ihrer Erscheinung. Ihr Gesicht bekam kurzzeitig etwas Fratzenhaftes, Monstermäßiges, und das irritierte ihn. Doch da sie ihn aufgeilte, sie und ihr lautes Stöhnen, ackerte er einfach weiter. Auf einmal schrillte das Telefon neben ihm auf dem Nachttisch, anfangs wollte er es ignorieren, schließlich hob er ab. Es störte sie nicht im Geringsten, sie turnte einfach weiter auf ihm herum.
Hallo?
Es war der Commander.
Und der hatte wichtige Informationen über die Frau, mit der er gerade im Bett war. Er wollte es nicht wahrhaben, aber es war die Bestätigung: Sie war ein mutiertes außerirdisches Wesen, das menschliche Gestalt annehmen konnte. Sie war bloß hier, um ihn für ihre Zwecke auszunutzen.
Was zum Teufel …, schrie er in den Hörer, doch es war zu spät. Sie hatte sich bereits in ein schleimiges Viech verwandelt, unzählige Augen, die auf langen rüsselartigen Gliedmaßen steckten, glubschten ihn an. Tentakel umklammerten ihn, schuppig und schmatzend. Sie war ein Weltraumkrake, der ihn verschlingen wollte, und er wehrte sich, kämpfte, der Hörer glitt ihm aus der Hand, stattdessen tastete er nach seiner Laserkanone.
Da war sie. Er richtete den Lauf auf den Dämon über ihm und feuerte.
Eine ohrenbetäubende Detonation, und das triefende Viech wurde gegen die Wand geschleudert, wo es sich in schleimige Partikel auflöste. Es glibberte von der Tapete herab und war dahin.
Roman kicherte.
Ja, so in etwa stellte er sich den Ablauf des Comicstrips vor. Er beugte sich über den Zeichentisch, strich das Papier glatt und zückte einen Stift für die Skizze. Zunächst arbeitete er an der Perspektive des Schlafzimmers seines Helden.
Er begann mit den groben Umrissen und arbeitete sich dann ins Detail vor. Er benutzte Fineliner, Marker, Eddings, Federn und Tickys, schon bald tat ihm der Rücken weh, aber das gehörte nun mal dazu. Das Comicgeschäft war hart und brachte wenig ein, doch es hatte keinen Sinn, darüber zu jammern. Er musste sich in die Seele seines Helden hineinbeißen, nur dann wurde die Story gut.
Er ging zum Kolorieren über. Die Farben mussten explodieren, sobald dem Helden klar wurde, dass er Sex mit einem Alien hatte. Es ist wie ein Trip, dachte Roman, es ist psychedelisch.
Sein Körper zuckte im Takt der immer gleichen Musik, die er beim Arbeiten hörte. Er war so in das Zeichnen vertieft, dass er zusammenfuhr, als Jule plötzlich vor ihm stand. Er hatte sie nicht kommen gehört.
»Hey, meine Süße.«
Sie schien etwas zu ihm gesagt zu haben. Ihr Blick war ein einziger Vorwurf.
»Du hörst mir nicht zu.«
»Entschuldige.« Er lächelte sie an. Die Zöpfe, die sie sich heute Morgen geflochten hatte, standen ihr gut. Sie sah bezaubernd aus. Er stand auf und gab seiner Tochter einen Kuss. »Du weißt doch, wenn ich am Arbeiten bin, vergesse ich alles um mich herum.«
Missbilligend schaute sie zur Stereoanlage hin. Rasch drehte er die Musik leiser.
»Wie war es in der Schule?«, fragte er.
»Ich vermisse Mama.«
Es traf ihn jedes Mal wie ein Faustschlag.
»Was sagst du da?«
»Ich vermisse sie einfach.«
Roman seufzte. Die Trennung von Jules Mutter lag nun schon zwei Jahre zurück, doch das Kind fühlte sich noch immer verraten. Eines stand fest: Anna war in Lissabon bei ihrem fusselbärtigen Lover, führte ihr wildes, unabhängiges Leben und würde nicht mehr zu ihnen zurückkommen. Wie sollte er ihr das nur erklären?
»Ihr könnt skypen. Heute Abend.«
Jule zog einen Flunsch. »Skypen ist doof.«
»Warum?«
»Es ist niemals so, als würde sie bei mir sein.«
Er nickte. Anna sollte ihre Tochter öfter besuchen. Doch eine Reise von Portugal nach Berlin war für sie zu teuer. Immer ist es eine Frage des Geldes, dachte er bitter.
Roman suchte nach Worten.
Doch Jule hatte ihm bereits den Rücken zugekehrt. Verschwand in ihrem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Nun würde sie wieder den ganzen Nachmittag lang ihre Schneekugel anstarren und jegliche Kommunikation mit ihm verweigern.
Als sei es seine Schuld, dass sich Anna aus dem Staub gemacht hatte.
Es tat ihm weh zu sehen, wie sehr Jule unter der Trennung ihrer Eltern litt.
Und auch er vermisste Anna, jeden einzelnen Tag vermisste er sie.
Er starrte auf seine Arbeit. Die Zeichnung war nicht gut. Nein, verdammt, sie war misslungen.
Roman fegte das Blatt vom Tisch und fluchte.
Er musste hier raus, dringend an die frische Luft, sich Bewegung verschaffen. Er schnappte sich seine Jacke und die Schlüssel und rief seiner Tochter zu, er sei gleich wieder zurück.
Kaum war er im Treppenhaus, überlegte er, ob es irgendwo da draußen etwas gab, an dem er sich abreagieren konnte.
Sophie trödelte auf dem Heimweg, sie wollte noch nicht nach Hause. Es war in letzter Zeit immer so traurig dort, weil es ihrer Mutter nicht gut ging, und das beeinflusste auch ihre Stimmung. Die Mutter war einsam, das spürte Sophie, und sie gab sich Mühe, sie aufzuheitern, aber das war anstrengend, und manchmal hatte sie einfach keine Lust darauf, ihr immerzu zu sagen, sie würde schon wieder einen Mann für sich finden. Sicher wäre es auch für Sophie schön, einen neuen Vater zu haben, aber das ließ sich nun mal nicht erzwingen.
Heute war sie allerdings selbst ein bisschen traurig, da Jule sich so wenig Zeit für sie genommen hatte. Und sie wusste nicht einmal genau, wann sie sich wiedersehen würden, hatte versäumt, etwas mit ihr auszumachen. Sie kannte auch ihre Adresse nicht, hätte danach fragen müssen. Ob Jule vielleicht gar nicht mit ihr befreundet sein wollte?
Sophie ließ die Schultern hängen. Nein, das durfte nicht sein, auf gar keinen Fall.
Plötzlich fesselte etwas ihre Aufmerksamkeit. Es war ein weißes Kaninchen, das vor ihr über den Gehweg hoppelte. An einem Straßenbaum hielt es inne, schnüffelte, dann lief es weiter.
Ein weißes Kaninchen, mitten in der Stadt.
Wie eine Erscheinung.
Wie in einem Traum.
Sophie war begeistert. So ein flauschiges Tier hatte sie sich schon immer gewünscht. Bestimmt war es jemandem entlaufen. Sie wollte es einfangen, vielleicht durfte sie es sogar behalten, wenn sich der Besitzer nicht meldete. Ob ihre Mutter damit einverstanden wäre? Auf manche Tiere reagierte sie allergisch.
Schon rannte sie los. Das Kaninchen war flink, aber sie würde schneller sein. Das Fell war rein weiß. Ob es auch rosa Augen hatte, wie in Alice im Wunderland?
Vielleicht führte es sie zu einem Bau, wo es sprechende Tiere gab und eine Königin und Humpty Dumpty und Elixiere, die einen schrumpfen und dann wieder wachsen ließen.
Möglicherweise begann in diesem Augenblick ein Abenteuer für sie.
Sie hatte es beinahe eingeholt. Sie beugte sich vor und streckte bereits die Hände nach ihm aus, als es in eine Toreinfahrt entwischte.
Vielleicht war es hier zu Hause, dachte sie und folgte ihm. Wenn es ihr gehörte, würde sie ihm keinen kitschigen Kosenamen geben, sondern es einfach nur Weißes Kaninchen nennen. Ja, das wäre schön.
Sie würde ihm ein Gehege bauen. Geräumig sollte es sein, mindestens halb so groß wie ihr Zimmer. Nachts dürfte das Kaninchen in ihrem Bett schlafen. Und an einem Halsband könnte sie eine Leine befestigen und es täglich spazieren führen.
In der Einfahrt war es schummrig, plötzlich sah sie es nicht mehr. Sophie blinzelte, ging weiter Richtung Hof, dort war mehr Licht.
Da preschte hinter ihr ein Auto in die Einfahrt. Sophie sprang erschrocken zur Seite.
Der Wagen hielt. Sie erkannte die cremefarbene Lackierung wieder. Eine Tür wurde aufgerissen.
Es ging blitzschnell, etwas warf sie um, ihre Beine verloren den Halt, und plötzlich war alles dunkel. Man hatte ihr eine Decke übergeworfen, sie darin eingeschnürt und gepackt. Sie wurde fortgeschleppt, wollte schreien, doch sie bekam keine Luft.
Jemand stieß sie ins Auto, die Tür knallte zu.
Schon setzte der Wagen zurück und raste mit ihr davon.
Vier
Es war Montag am späteren Abend. Landsberg kam ohne anzuklopfen in Trojans Büro.
»Nils, ich brauche Ergebnisse. Gib mir irgendwas, das ich der Journaille zum Fraß vorwerfen kann. Ich musste für morgen früh eine Pressekonferenz anberaumen, damit diese Aasgeier wenigstens für ein paar Stunden Ruhe geben.«
Trojan raufte sich das stoppelkurze Haar.
Er war so erschöpft, dass ihm schon ein paar Mal beinahe der Kopf auf die Tischplatte gesunken wäre. Seit Sonntagnacht, als der Tote entdeckt worden war, hatte er pausenlos unter Hochdruck an dem Fall gearbeitet, dabei keimte immer wieder ein diffuses Panikgefühl in ihm auf. Es war ihm zwar halbwegs gelungen, diese heftige Attacke, die ihn in die Notaufnahme geführt hatte, niederzuringen, doch die raunende Stimme seiner unerklärlichen Angst war längst nicht verstummt.
Als kauerte irgendwo tief in seinem Innern ein dunkler Dämon, der auf sein Recht beharrte, wahrgenommen zu werden.
Was stimmte denn bloß nicht mit ihm? Warum war es ihm nicht möglich, einfach nur seinen Job zu tun, ohne diese Scheißangst?
Landsberg trat näher. »Hast du inzwischen die Frau des Ermordeten befragen können?«
»Ja«, sagte Trojan, »ihr Alibi ist lupenrein. Dass sie sich wegen einer Fortbildung in Hagen aufhielt, als der Mord geschah, konnten mehrere Personen dort bestätigen.«
»Sie scheidet also als Tatverdächtige aus?«
»Es sei denn, sie hatte einen Komplizen. Das kann ich mir aber nicht recht vorstellen, denn sie war völlig geschockt. Was sie am meisten fertigmacht, ist, dass die kleine Tochter das alles mit ansehen musste. Kaum vorstellbar, dass eine Mutter ihrem Kind so etwas zumuten würde.«
»Hmm.« Landsberg rieb sich über die Augen, auch er wirkte völlig übermüdet. »Georg Haubachers Kollegen im Goethe-Gymnasium beschreiben ihn übereinstimmend als freundlich und umgänglich. Und auch bei seinen Schülern galt er als sehr beliebt.«
»Könnte vielleicht dennoch einer der Schüler einen großen Hass auf ihn gehabt haben? Schlechte Noten? Er fühlte sich ungerecht behandelt?«
»Nicht auszuschließen. Wir müssen die Vernehmungen in der Schule intensivieren.«
»Vergiss die Ehemaligen nicht.«
»Verdammt, ja. Das wird eine lange Liste. Unmöglich, uns die alle vorzuknöpfen.«
»Aber wir dürfen nichts unversucht lassen.«
Trojan erhob sich und ging zur Magnettafel, an der die Tatortfotos befestigt waren. Erneut verspürte er ein Stechen in der Brust, als sein Blick über die Nahaufnahmen des Toten wanderte, sein verkohltes Gesicht, der weit aufgerissene Mund, das Stofftaschentuch darin, der Strick um Hände und Füße, diese erniedrigende Haltung auf den Knien.
Er wandte sich von den Bildern ab.
»Wir müssen herausfinden, was der Ofen für eine Bedeutung hat«, sagte er. »Jemanden bei lebendigem Leib zu rösten, das ist wie …« Er brach ab.
»Wie was?«
»Ich weiß noch nicht genau, aber … Der Täter oder die Täterin will uns damit etwas sagen. Er oder sie legt es darauf an, dass Haubacher in dieser schrecklichen Pose gefunden wird, achtet dabei sogar darauf, dass es nicht zu einem Wohnungsbrand kommt, denn der Ofen war bereits ausgeschaltet, als die Tochter ihren Vater in der Küche entdeckte. Dem Täter geht es also in erster Linie um die Schmerzen seines Opfers und um dieses Bild: der auf dem Rost schmorende Kopf. Und er verhindert, dass ein Feuer dieses morbide Bild unter Umständen zerstören könnte.«
»Kannte Haubacher seinen Mörder vielleicht?«
»Möglicherweise. Oder der Täter hat sich eines Tricks bedient. Haubacher öffnet ihm ahnungslos die Tür, und der Schrecken beginnt. Er wehrt sich. Doch sein Mörder ist bewaffnet.«
»Ein Messer.«
Trojan nickte. »Ja, das Blut im Flur. Es stammt von Haubacher, das haben die Laborberichte ergeben.«
»Hmm.«
»Er zwingt ihn in die Küche. Haubacher muss niederknien. Der Zweck ist, ihn zu demütigen.«
Landsberg nickte. »Der Täter stopft ihm dieses große Stofftaschentuch in den Mund, damit er nicht schreien kann.«
»Es ist weiß. Aus Leinen. Ziemlich altmodisch. So was besitzen normalerweise alte Frauen.«
»Merkwürdig. Der Ofen wird eingeschaltet, die Klappe geöffnet.«
»Es gibt keine Fingerabdrücke.«
»Er trägt Handschuhe.«
»Was ist eigentlich mit Spuren unter Haubachers Fingernägeln? Fasern, Hautfetzen von dem Kampf?«
»Ich hab mit Semmler gesprochen«, sagte Landsberg. »Die Fingernägel des Toten waren erstaunlich sauber. Wahrscheinlich hat sich der Täter so viel Zeit genommen, sie hinterher zu reinigen.«
»Mann, der ist clever.« Trojan stieß die Luft aus. »Hat sich Semmler mittlerweile zu der genauen Todesursache geäußert?«
»Ja, es war tatsächlich ein Herzinfarkt, ausgelöst durch die heftigen Schmerzen, die Angst und die …«
»Folter«, ergänzte Trojan.
Landsberg nickte. Sie schwiegen einen Moment.
Schließlich fragte der Chef: »Meinst du, der Täter hatte wirklich keine Ahnung, dass sich das Mädchen in der Wohnung aufhielt?«
»Ich weiß nicht. Wenn ja, ist es sehr merkwürdig. Sie stellte doch ein großes Risiko für ihn da. Sie hätte rauslaufen und Hilfe rufen können. Also hat er entweder gar nicht mit ihr gerechnet, oder er wollte, dass sie ihren Vater so findet.«
»Aber warum?«
Trojan sah zu den Fotos hin.
Es ist ein Aufschrei, dachte er mit einem Mal. Der Täter oder die Täterin rief ihnen zu: Seht her, was für eine Macht ich über mein Opfer habe. Und mein Opfer ist demütig und klein.
Er seufzte.
»Wir stehen erst am Anfang«, sagte er leise.
Landsberg straffte die Schultern. »Mal sehen, ob sich die Presse morgen damit zufrieden gibt.«
Er wandte sich zur Tür.
»Wie geht es eigentlich Theresa?«, fragte Trojan unvermittelt.
Der Chef hielt inne.
Landsbergs Frau war im letzten Herbst zur Verdächtigen in einer grausamen Mordserie geworden, was eine schwere Ehekrise zwischen den beiden ausgelöst hatte.
»Besser.«
»Kommst du klar?«
Er machte eine vage Geste mit den Händen. »Wir raufen uns zusammen.«
»Gut so.«
Landsberg blickte ihn an. Ein schmales Lächeln huschte über seine Lippen. Trojan hatte bei den Ermittlungen damals mehr über das Privatleben seines Chefs erfahren, als diesem eigentlich lieb sein konnte. Doch auf diese Art waren sie beinahe Freunde geworden, soweit Landsbergs distanzierte Haltung das überhaupt zuließ.
Der Chef nickte ihm zu, dann war er auch schon zur Tür hinaus.
Kaum hatte sich Trojan wieder über seine Notizen gebeugt, betrat Max Kolpert das Büro.
Trojan sah auf. Wieder einmal musste er dem Impuls widerstehen, den Blick vom Gesicht seines Kollegen jäh abzuwenden.
Besonders von der linken Hälfte. Denn die war furchtbar entstellt. Von Säure verätzt.
Ein jeder im Kommissariat nannte die Bestie, die ihm das angetan hatte, nach ihrer bevorzugten Tarnung mit einem Motorradhelm bloß noch das Visier.
Trojan hatte das Visier zwar in Notwehr erschossen, das Säureattentat auf seinen Kollegen nur einen Wimpernschlag zuvor aber nicht mehr verhindern können. Wertvolle Sekunden, die er zu spät reagierte. Selbstvorwürfe, die er nicht mehr loswurde. Grelle Alptraumbilder, die ihn nachts verfolgten.
Kolpert konnte von Glück reden, dass er nicht sein Augenlicht verloren hatte.
Immer wieder fragte sich Trojan, ob er seinen Job überhaupt noch ausüben könnte, wenn sein Kollege erblindet wäre. Sicher, der Säureangriff war nicht seine Schuld, aber er hätte Kolpert besser schützen müssen.
»Max, was gibt’s?«, fragte er möglichst unbefangen.
»Ich hab mir den Computer von Georg Haubacher vorgenommen und dabei was Merkwürdiges entdeckt.«
Trojan hob die Augenbrauen.
»Vor wenigen Tagen hat er sämtliche Dateien mit einem speziellen Programm bearbeitet, wir Experten nennen es wipen. Das heißt, sie sind mehrmals mit Nullen überschrieben worden.«
»Was?«
Kolpert verzog keine Miene. »Der Kerl hat sich richtig Mühe gegeben. Selbst auf einer von ihm neu konfigurierten Festplatte hätte ich seine Daten wiederherstellen können. Doch dieser Wipe ist ein anderes Kaliber.«
»Und nicht einmal ein Ass wie du kommt da ran?«
Kolpert schüttelte den Kopf. »Keine Chance.«
»Was ist mit Kopien? Sticks? Externen Festplatten?«
»Wir haben in seinem Schreibtisch etliche DVDs gefunden, aber darauf war nur Unterrichtsmaterial.«
»Verdammt.«
»Ich schätze, Haubacher hatte etwas Wichtiges zu verbergen.«
Als das Telefon klingelte und Emily abhob, hoffte sie, ihr Vater würde sich melden, um ihr zu sagen, dass er endlich auf dem Nachhauseweg sei. Dass er schon wieder Überstunden schob, erfüllte sie mit Sorge. Gestern in der Notaufnahme war er bloß noch ein Haufen Elend gewesen, und heute schien er schon wieder Vollgas zu geben. Wie lange konnte das noch gut gehen?
»Ja?«
»Hallo, meine Süße, ich bin es.«
Es war ihre Mutter. Emily versuchte, sich ihre Enttäuschung darüber nicht anmerken zu lassen.
»Hallo, Mama.« Sie hatte sie wirklich lieb, aber in letzter Zeit nervte sie einfach nur.
Es folgte einiges Geplänkel, bis Friederike zu ihrem leidigen Thema kam, was Emily bereits befürchtet hatte.
»Willst du nicht wieder nach Hause kommen?«
»Das hier ist doch auch mein Zuhause.«
»Natürlich, Süße. Aber du weißt, wie ich es meine. Hier ist mehr Platz für dich, und ich bin abends immer für dich da.«
»Papa ist auch für mich da!«
»Im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber sein Job lässt ein gesundes Familienleben einfach nicht zu.«
»Jetzt fang nicht wieder damit an!«
Noch so eine dämliche Bemerkung von ihr, dachte Emily, und sie würde ausrasten. Würde dieser Zoff denn nie aufhören?
»Zugegeben, hier lief einiges gehörig aus dem Ruder. Und ich bedaure, dass du all die Streitereien mit Flo mitbekommen hast, aber jetzt …«
Ihre Mutter holte tief Luft. Flo war ihr neuer Lover, ein verhinderter Künstler mit Allüren, ein Schnösel, den Emily ganz und gar nicht ausstehen konnte, Friederike hatte ihn in einem Internetforum für Singles kennengelernt.
Plötzlich war die Stimme ihrer Mutter tränenerstickt. »Es ist vorbei. Wir haben endgültig Schluss gemacht. Einvernehmlich.«
Was auch nicht anders zu erwarten war! Sie verspürte nicht die geringste Lust, ihre Mutter zu trösten.
»Tut mir echt leid, Ma«, sagte sie wenig überzeugend.
»Nun kehrt hier wieder Ruhe ein. Komm zu mir zurück, Emily. Von Kreuzberg aus ist doch dein Schulweg viel zu weit. Und bei mir kannst du …«
In diesem Moment hörte Emily, wie die Wohnungstür aufgeschlossen wurde. Endlich. Ihr Vater würde sie von diesem Gespräch erlösen.
»Ich muss auflegen, Paps ist da.«
»Er kommt jetzt erst nach Hause? Emily, es ist nach zehn, und du hast morgen früh Schule!«
Was ihre Mutter allerdings nicht davon abhielt, sie um diese Zeit noch anzurufen, dachte Emily bitter.
Sie verabschiedete sich knapp und legte auf.
Dann stürmte sie in den Flur, um ihrem Vater um den Hals zu fallen. Doch mitten in der Bewegung stoppte sie ab und erschrak.
Eine fremde Frau stand vor ihr, den Schlüssel noch in der Hand.
»Was …! Wer …?«
»Oh«, sagte die Frau. »Entschuldige, ich hätte vorher klingeln sollen.« Ein Lächeln breitete sich in ihrem Gesicht aus, nicht ganz unsympathisch. »Du musst wohl Emily sein.«
Sie rührte sich nicht.
»Ich bin Jana, hallo.«
Sophie erwachte aus einer Ohnmacht.
Ihre Blicke wanderten unruhig hin und her. Sie lag auf einem Bett in einem kleinen Zimmer. Die Lampe an der Decke warf ein funzliges Licht auf sie herab.