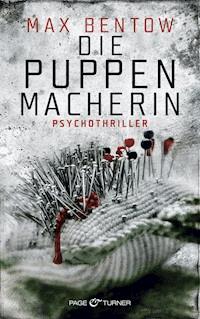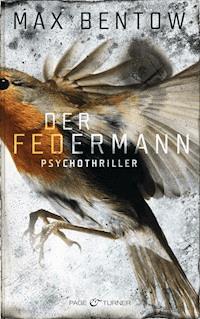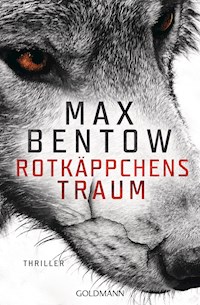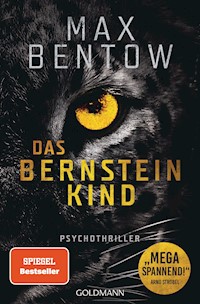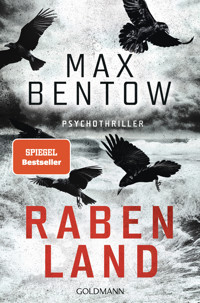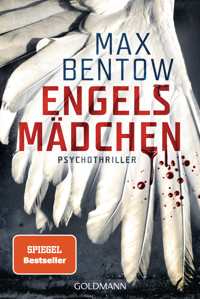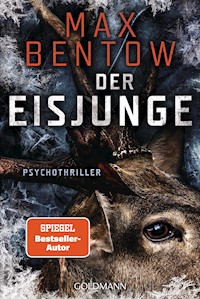
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Nils Trojan
- Sprache: Deutsch
Ich tröste dich. Ich wärme dich. Ich verschlinge dich.
Nils Trojan ist gerade erst zurück von seiner Auszeit auf einer Insel, da wird er schon an einen neuen Tatort gerufen. Im ersten Moment glaubt er, in einen absurden Albtraum geraten zu sein: Es sieht aus, als würde ein Tier über dem Opfer kauern, denn der Mörder hat das Fell eines Rehs über die getötete junge Frau drapiert. Wenig später ereignet sich ein zweiter Mord, und wieder sind Mensch und Tier auf makabre Weise ineinander verschlungen. Aber was will der Täter mit seiner grausamen Botschaft mitteilen? In einem verlassenen Haus im Umland von Berlin stößt Trojan auf eine Fährte – und erkennt zu spät, dass er in eine mörderische Falle geraten ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Nils Trojan ist eben zurück von seiner Auszeit auf einer Insel, da wird er schon an einen neuen Tatort gerufen. Im ersten Moment glaubt er, in einen absurden Albtraum geraten zu sein: Es sieht aus, als würde ein Tier über dem Opfer kauern, denn der Mörder hat das Fell eines Rehs über die getötete junge Frau drapiert. Wenig später ereignet sich der zweite Mord, und wieder sind Mensch und Tier auf makabre Weise ineinander verschlungen. Aber was will der Täter mit seiner grausamen Botschaft mitteilen? In einem verlassenen Haus im Umland von Berlin stößt Trojan auf eine Fährte – und erkennt zu spät, dass er in eine mörderische Falle geraten ist …
Weitere Informationen zu Max Bentow sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
MAX BENTOW
DER EISJUNGE
PSYCHOTHRILLER
OriginalausgabeDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe September 2021
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt
durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München; Arcangel / Tim Robinson
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-26374-4V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
ERSTER TEIL
Seine Verwandlung begann, als er sechzehn Jahre alt war. Der Winter damals war streng, doch der Frost störte ihn nicht. Es war die Kälte in seinem Innern, die ihn erschreckte. An manchen Tagen hatte er das Gefühl, sein Herz sei nichts weiter als ein Klumpen Eis.
Nach der Schule trieb er sich auf den Straßen herum, denn er wollte nicht nach Hause. Eines Nachmittags entdeckte er einen Ort, an dem er es warm hatte und wo er allein sein konnte. Es war eine Bibliothek, still, nahezu menschenleer. Er wanderte an den Regalen entlang, seine Schritte wisperten über den Linoleumboden. Es roch nach Staub und Papier. Er griff sich wahllos ein Buch heraus, setzte sich an die Heizung, schlug es auf und las.
Er blieb, bis geschlossen wurde. Anderntags kam er wieder. Es wurde ihm zur Gewohnheit. Er lieh sich die Bücher nicht aus, sondern stellte sie ins Regal zurück. Meistens fand er sie am folgenden Tag wieder. Wenn nicht, fing er einfach mit dem nächsten an. Er las alles, was ihm in die Hände fiel. Thriller, Krimis, aber auch Liebesromane, Klassiker, Abenteuergeschichten, selbst Märchen und Sachbücher. Bald darauf entdeckte er die Sparte der Fantasy-Literatur.
Er fand Trost in den Geschichten, die von Dämonen erzählten. Besonders in denen, die von Rache handelten. Sie versprachen ihm Erlösung von seinem Zorn und der Einsamkeit. Immerzu hoffte er, auf einen Helden zu stoßen, der ihm ähnlich war. Ein Jugendlicher, der feststellen musste, anders zu sein als die anderen.
Ein Sechzehnjähriger, der von seinen Mitschülern gemieden wurde. Sie tuschelten hinter seinem Rücken. Sie machten Witze über ihn.
Ein Junge, der von seinen Eltern kalt und vorwurfsvoll angestarrt wurde.
Sie gaben ihm die Schuld am Tod von Zoe.
Sie taten ihm Unrecht.
In den Büchern gab es Wendungen, die ihn faszinierten. Die Helden entwickelten unheimliche Kräfte. Sie entstanden aus ihrer Wut. Bei ihm war das auch so. Zumindest glaubte er das. Zunächst ängstigte es ihn. Doch schließlich wollte er lernen, mit dieser dunklen Energie umzugehen und sie für seine Zwecke einzusetzen.
Nachts, wenn seine Eltern schliefen, stellte er sich vor den Spiegel. Er betrachtete sein Gesicht, es war erstaunlich weich und rein. Nicht von Pickeln entstellt wie bei den anderen Jungs aus seiner Klasse. Er sah auch sehr viel jünger aus, eher wie zwölf oder dreizehn. Das war wohl der Grund, warum ihn niemand ernst nahm.
Er zog sein T-Shirt aus, strich sich das halblange Haar aus der Stirn und spannte die Muskeln an. Er gestattete sich, weder zu atmen noch die Lider zu bewegen. Allmählich lief er rot an, und seine Augen brannten. Er stellte sich vor, dass seine Haut aufplatzte. Darunter würde eine fremde Gestalt zum Vorschein kommen.
Ein Wesen, vor dem sich alle fürchteten.
Der Junge malte sich eine entsetzliche Fratze aus, die seine Gegner erschrecken würde.
Das war zu der Zeit, als auch die Bücher nichts halfen. Er ging nicht mehr in die Bibliothek. Er mied diesen Ort wie die Pest. Wieder hatte man ihm Unrecht getan.
Oftmals drückte ihm sein Zorn die Kehle zu. An anderen Tagen schaffte er es morgens nicht aus dem Bett. Die Decke, unter der er lag, schien ein Gletscher zu sein. Kein Gespür in den Gliedern, und sein Atem gefror.
Auf einmal erinnerte er sich an längst vergangene Ferientage. Dunkelheit auf einer Landstraße, sein Vater am Steuer. Plötzlich ein dumpfer Aufprall, der Wagen schleuderte.
Als er zum Stehen kam, sahen sie das Reh auf der Straße liegen. Der Kotflügel hatte es erwischt. Sie stiegen aus und blickten auf das Tier hinab. Es lebte noch.
»Fass mit an«, sagte sein Vater.
»Ich kann das nicht.«
»Solltest du aber. Deine Mutter macht uns einen Braten daraus.«
»Bitte nicht.«
»Was bist du nur für ein Schwächling.«
Die großen braunen Rehaugen starrten den Jungen an. Sie hievten das Tier in den Kofferraum.
Zu der Hütte, die sie gemietet hatten, gehörte ein Schuppen. Dort wuchteten sie das Reh auf einen Tisch. Die Mutter des Jungen weinte, doch der Vater sprach von einigen leckeren Abendessen.
»Jetzt sieh genau hin«, sagte er zu ihm.
Der Junge schaute auf das Jagdmesser in der Hand des Vaters. Er hielt die Luft an. Er zuckte nicht mit den Lidern. Er wartete, bis die Augen tränten.
Verschwommen sah er, wie das Messer bis zum Schaft im Tier verschwand. Der Vater weidete es aus. Die Innereien dampften.
In dem Winter, als Zoe starb, musste er oft an das Blut denken, das aus dem Reh hervorquoll. Er fand es merkwürdig, dass ihn die Gedanken daran trösteten. Andererseits leuchtete es ihm ein: Das Blut war warm, die Kälte brachte den Tod.
Seitdem Zoe im Eis verschwunden war, gab es kein Lachen mehr im Leben des Jungen. Und dennoch hoffte er, dass es gut für ihn enden würde. Seine hasserfüllten Fantasien sollten verschwinden.
Er wehrte sich gegen die Verwandlung.
Schließlich war er beinahe noch ein Kind.
EINS
FREITAG, 13. NOVEMBER, NACHMITTAGS
Die junge Frau fuhr schnell. Sie schaltete in den fünften Gang hoch und jagte in ihrem Mietwagen über die Landstraße. Felder im fahlen Licht, davor entlaubte Bäume in einer Reihe am Straßengraben, in der Ferne türmten sich dunkle Wolken auf.
Die eine Hand am Lenkrad, griff sie mit der anderen nach ihrer Kamera auf dem Beifahrersitz. Sie hob sie vors Gesicht, blickte durch den Sucher und drückte den Aufnahmeknopf. Der Wagen schlingerte, sie versuchte, die Spur zu halten und gleichzeitig durch die Windschutzscheibe zu filmen. Nur ein Experiment, ein paar Probeaufnahmen. Noch waren die Lichtverhältnisse geeignet, die tief stehende Sonne brach aus der Wolkenwand hervor, ein Bündel hellweißer Strahlen überflutete den Horizont.
Sie überprüfte die Bilder auf dem Display, während sie im hohen Tempo weiterfuhr.
Laut hupend raste hinter ihr ein anderes Fahrzeug heran. Rasch legte sie die Kamera ab und umklammerte beidhändig das Steuer. Das Auto hinter ihr scherte aus und schoss dicht an ihr vorbei.
Das war knapp, sie atmete durch.
Sie warf einen Blick aufs Navi. Es war nicht mehr weit, und doch war sie ungeduldig. Zuvor hatte sie sich verfahren und dabei viel Zeit verloren.
Vor der nächsten Siedlung drosselte sie das Tempo. Der Asphalt war voller Schlaglöcher. Das Dorf wirkte verlassen, keine Menschenseele weit und breit. Unscheinbare Backsteingebäude, Flachdächer. Auch hier machte sie ein paar Aufnahmen durch das Wagenfenster, absichtlich verwackelt und schräg im Gegenlicht.
Sie passierte das letzte Haus. Hinter der nächsten Biegung begann der Wald, und sie beschleunigte. Um noch vor Anbruch der Dunkelheit am Ziel zu sein, musste sie sich beeilen.
Bald darauf näherte sie sich einem Abzweig und setzte den Blinker. Sie bog ab und fuhr zügig weiter. Ein dichter Kiefernwald, der bis an die Straße heranreichte. Wieder rissen die Wolken auf, Lichtreflexe tanzten auf der Windschutzscheibe.
Doch dann verschattete sich der Weg. Wenig später fielen erste Regentropfen, und sie schaltete die Wischer und die Scheinwerfer ein.
Sie vergewisserte sich auf dem Navi, ob sie hier richtig war. Plötzlich machte sie eine Bewegung aus. Etwas schoss zwischen den Bäumen hervor und sprang auf die Straße.
Sie erschrak, trat energisch aufs Bremspedal. Der Wagen schleuderte, die Reifen quietschten.
In Sekundenbruchteilen brachte sie das Auto zum Stehen.
Dunkle Tieraugen starrten sie an.
Stille, der Motor war abgewürgt. Sie hörte bloß ihren keuchenden Atem und das schurrende Geräusch der Scheibenwischer.
Das Tier stand nur einen halben Meter von der Kühlerhaube entfernt.
Es war ein Reh.
Sie verschnaufte. Schließlich griff sie vorsichtig zur Kamera und filmte.
Lange Zeit verharrte das Tier.
Dann duckte es sich, setzte an und stob durchs Dickicht davon.
Nach einer Weile startete sie den Motor neu und fuhr weiter. Diesmal langsamer, bis sie sich halbwegs beruhigt hatte.
Das nächste Dorf war bloß eine Ansammlung verwahrloster Gehöfte.
Noch etwa zwei Kilometer Landstraße. Ein Schwarm Krähen flog von den Baumwipfeln auf, als sie in einen schmalen Schotterweg einbog.
Sie kam nur im Schritttempo voran, wich Unebenheiten im Boden aus. Der Pfad versandete allmählich.
Er führte in einem Bogen um eine Gruppe von Schwarzpappeln herum und endete dort.
Vor ihr lag das verlassene Haus.
Sie stellte den Motor aus. Sie blieb eine Weile sitzen und ließ den Anblick auf sich wirken. Es war die ideale Kulisse für ihr Videoprojekt.
Lange Zeit hatte sie im Internet gesucht, spezielle Websites durchforstet, auf denen geheimnisvolle Orte im Umland Berlins vorgestellt wurden. Die genauen Geodaten verrieten die Betreiber jedoch nie, das war eine Art Sport von ihnen.
Nur durch den Vergleich von Details auf zahlreichen Fotos, Texten und Satellitenaufnahmen im Netz war es ihr gelungen, diese Adresse aufzuspüren.
Zwei Stockwerke, das Backsteingemäuer baufällig, das Schrägdach vermoost und halb eingestürzt. Ein verrußter Schornstein, leere Fensterhöhlen.
Sie schnappte sich ihre Kamera und die Umhängetasche und stieg aus. Langsam ging sie auf das Haus zu. Die Gartenmauer bestand nur noch aus ein paar losen Steinen, dahinter wucherten Brennnesseln und Disteln. Der Giersch stand hüfthoch. Efeu rankte beinahe bis zum Dach hinauf.
Für die Aufnahmen war es eigentlich schon zu dunkel. Sie bevorzugte natürliches Licht. Dennoch versuchte sie es mit ein paar Schwenks in der Dämmerung. Das Auge ihrer Kamera strich durch den verwilderten Garten und wanderte an der Fassade entlang. Zum Glück hatte es aufgehört zu regnen.
Schließlich näherte sie sich dem Eingang.
Die Tür war mit Holzlatten verrammelt, darum musste sie durch eine der Fensteröffnungen ins Innere klettern. Sie nahm das LED-Licht aus ihrer Tasche, schraubte es auf die Kamera und filmte.
Schutt und zerbrochenes Glas. Mit Graffiti besprühte Wände. Zertrümmerte Möbelstücke. Tapetenreste, stockfleckig. Vor ihr huschte etwas über den Boden. Sie hielt das Licht der Kamera darauf gerichtet.
Es war eine gut genährte Ratte. Es schüttelte sie.
Sie filmte in den beiden vorderen Räumen, dann schritt sie durch den kleinen Flur nach hinten in die Küche. Der altertümliche Backofen war noch vorhanden, die Klappe geöffnet. Darin lag ein Knäuel, das wie ein Mäusenest aussah. Ein Tisch, das Holz wurmstichig, ein zerbrochener Stuhl. In einem altmodischen Küchenschrank steckte noch eine einzige Schublade.
Sie zog sie auf. Der Boden war mit vergilbtem Zeitungspapier ausgelegt, der Schein ihrer LED-Lampe fuhr über die uralte Schrift, die Buchstaben in Fraktur.
Sie wandte sich um, ließ die Kamera sinken und schaute durch das zersprungene Fensterglas in den hinteren Garten hinaus. Eine weitverzweigte Eberesche versperrte ihr die Sicht.
Zurück im Flur, verharrte sie an der Treppe ins Obergeschoss. Die Holzstufen wirkten morsch, das Geländer bestand nur noch aus ein paar losen Streben.
Vorsichtig ging sie hinauf. Sie setzte Schritt für Schritt. Manche Stufen gaben sofort nach, wenn sie sie mit ihren Stiefelspitzen berührte. Dann überstieg sie die Stelle und tastete sich an der Wand entlang.
Oben angelangt, filmte sie die anderen Räume. In einem stand ein Schaukelstuhl, noch ziemlich intakt. Sie setzte sich und wippte hin und her. Die Kufen scharrten auf dem nackten Steinboden, während sie die Kamera auf die Fensteröffnung richtete. Auch hier war das Glas zerbrochen. Kalte Luft wehte zu ihr herein.
Sie schwenkte die Kameralinse hoch zur Zimmerdecke. Durch ein Loch sah sie direkt in den Dachstuhl. Über dem Gerippe der Balken schimmerte der trübe Novemberhimmel.
Der Ort war perfekt für ihren geplanten Kurzfilm.
Noch hatte sie nur eine grobe Vorstellung davon, aber das Haus inspirierte sie.
Sie stand auf und schaltete Kamera und LED-Licht aus, um Akku zu sparen.
Sie trat ans Fenster und sah hinunter in den Garten. Sie erkannte die Esche und dahinter ein verkrautetes Rasenstück, das bis zu einem Zaun reichte. In der Ferne ein Feld, aus dem Nebel aufstieg.
Ihr Blick wanderte die Zaunlatten entlang, als sie plötzlich zusammenzuckte.
Da stand jemand.
Direkt am Zaun.
Eine Gestalt grinste zu ihr herauf.
Reflexartig hob sie die Kamera, doch mit einem Mal verkrampfte sich ihre Hand.
Sie trat zurück, stieß gegen den Schaukelstuhl und schrie leise auf. Sie drehte sich um und verließ das Zimmer. Kurz darauf war sie an der Treppe und stieg hinunter. Eine Stufe brach ein, und wieder entfuhr ihr ein erstickter Schrei.
Ruhig, ganz ruhig. Vielleicht hatte sie sich ja getäuscht.
Unten angelangt, hielt sie inne.
Sollte sie wegfahren oder noch mal nachsehen?
Unruhig irrte sie umher. Da entdeckte sie im Halbdunkel eine Tür am Ende des Flurs. Offenbar führte sie nach hinten in den Garten hinaus.
Sollte sie sich vergewissern, ob dort wirklich jemand war?
Nach einigem Zögern drückte sie die verrostete Klinke. Die Tür gab leicht nach, das Holz war verzogen, doch schließlich gelang es ihr, sie einen Spaltbreit zu öffnen und sich hindurchzuzwängen. Drei Treppenstufen führten hinunter in den Garten.
Sie näherte sich der Esche und lauschte. Nichts war zu hören, nur ihr Herzschlag und das leise Säuseln des Windes. Ängstlich spähte sie hinter dem Stamm hervor.
Das Licht war jetzt schon so schwach, dass sie eine Weile brauchte, um die Umrisse am Zaun auszumachen.
Doch da war die Gestalt.
Ein blutroter Kopf. Eine Fratze in der Dämmerung.
Ein Gesicht, das nichts Menschliches an sich hatte.
Augenblicklich war sie wie erstarrt.
Schließlich hatte sie ihre Kraft wieder und rannte los.
Sie stürmte an dem Haus vorbei und durchquerte den vorderen Garten. Sie riss die Wagentür auf, warf ihre Kamera und die Tasche auf den Beifahrersitz, startete den Motor und fuhr los.
In diese Gegend wollte sie nie wieder zurück.
Niemals.
Denn sie kannte das Gesicht.
Sie hatte die Fratze schon einmal gesehen.
ZWEI
MONTAG, 23. NOVEMBER, ABENDS
Marta klatschte den Tonklumpen auf die Drehscheibe und begann mit ihrer Arbeit. Der Elektromotor surrte, mit dem Fuß auf dem Pedal kontrollierte sie die Geschwindigkeit. Kalt und feucht schmiegte sich der Ton in ihre Handwölbung. Weich und erdig fühlte er sich an. Das erinnerte sie an ihre Kindheit, wenn sie an verregneten Nachmittagen durch Pfützen gesprungen war und selbstversunken im Matsch gespielt hatte.
Mit starkem Druck zwang sie das Material in eine gleichmäßig umlaufende Kegelform. Breitbeinig und vorgebeugt saß sie da, die Unterarme auf den Drehscheibenkasten gestützt. Nur manchmal ließ sie los, um die Fingerspitzen kurz in die bereitstehende Schale mit Wasser zu tauchen, um danach gleich wieder die Form zu umfassen. Tief atmend zentrierte sie den Ton, der sich kühl und glatt unter ihren Handflächen im Kreis bewegte.
Marta war ganz bei sich, sie nahm nur wenig von dem geschäftigen Treiben in der öffentlichen Töpferwerkstatt wahr. Die Gesprächsfetzen der Kursteilnehmer aus dem Nebenraum, die Frau, die den Ofen ausräumte, der junge Mann an der Drehscheibe links von ihr, der sich von einer Kursleiterin ein paar Kniffe erklären ließ, all das drang wie aus weiter Ferne zu ihr.
Die Kugel war nun gut zentriert. Marta bohrte mit den Fingern ein Loch in die Mitte. Allmählich entstand eine Höhlung, etwa so groß wie eine Kirsche. Sie setzte den Daumen senkrecht an und drückte ihn fest in das Material. Es war, als würde sie einen Korken in einen Flaschenhals zwängen. Sie presste den Daumen so tief in den rotierenden Ton, bis sie beinahe den Scheibenkopf berührte.
Der junge Mann neben ihr lachte über eine Bemerkung seiner Lehrerin, doch Marta ließ sich davon nicht irritieren. Sie war nun dabei, den Boden ihrer Vase auszugestalten. Eine hübsche, bauchige Blumenvase sollte es werden, die sie ihrer Mitbewohnerin Lea schenken wollte.
Marta lehnte sich noch weiter vor und drückte den Daumen im Innern des Gefäßes nach außen und weg von ihrem Körper. Sie arbeitete ruhig und stetig. Den Boden zu setzen war nicht ganz einfach, doch sie hatte einige Übung darin, und es glückte ihr.
Nun konnte sie die Wandung hochziehen, dazu nahm sie alle Finger zu Hilfe, die eine Hand innen, der gekrümmte Zeigefinger der anderen außen. Mal im Sitzen, mal halb im Stehen, bearbeitete sie die feuchte, sich drehende Form, und der Ton unter ihren Händen wuchs höher und höher.
Es war ein fantastisches Erlebnis, aus einem unscheinbaren Klumpen etwas Einzigartiges zu erschaffen, denn jedes Gefäß war ein bisschen anders. Oftmals war es gerade das Unvollkommene, kleine Dellen, eine nicht allzu perfekte Rundung, später winzige Schäden bei der Glasur, die den besonderen Reiz der Keramik ausmachten.
Vergnügt, mit einem Lächeln auf den Lippen, strich Marta dann und wann den Schlicker ab, diese schleimige Masse, die sich zwischen dem Ton und ihren Händen bildete. Dabei bespritzte sie ihre Arbeitskleidung und zuweilen auch ihr Gesicht, doch das störte sie nicht. Wiederum erinnerte sie sich an selbstvergessene Kindheitstage, als sie im Garten ihrer Eltern mit Eimer und Gießkanne hantierte, sich schmutzig machen durfte und aus Erde und Wasser Matschkugeln formte.
Insgesamt viermal zog sie die Wandung hoch, bis sie eine gleichmäßige Zylinderform geschaffen hatte. Nun konnte sie an der feineren Ausgestaltung arbeiten. Sie feuchtete ihre Hand an, schob sie in das sich drehende Gefäß und drückte von innen nach außen, sodass sich die Vase wölbte.
Sie war hochkonzentriert. Unbewusst schob sie die Zungenspitze zwischen ihre Zähne. Während sie bei mittlerer Drehgeschwindigkeit weiterhin den Bauch der Vase formte, blies sie sich eine Haarsträhne aus der Stirn.
Als es ihr schließlich gelang, die Außenwölbung allmählich nach oben einzuschließen, sodass der Hals der Vase unter ihren Fingern entstand, seufzte sie leise auf. Sie engte den Hals ein. Geschmeidig glitt das leicht triefende Material durch die Innenflächen ihrer beiden Hände und schmeichelte ihrer Haut. Warm durchströmte sie ein Glücksgefühl.
Nun musste sie den Rand gut ausführen, dazu nahm sie zwei Finger, von jeder Hand einen. Mit den Mittelfingern gelang es ihr am besten. Es war Maßarbeit, der Rand durfte nicht zu fein werden, sonst könnte er reißen. Marta spürte den glitschigen Ton unter ihren Fingerspitzen. Mit dem angefeuchteten Stück eines Ledertuchs versuchte sie, dem Hals der Vase eine besondere Struktur zu geben.
Marta hob den Kopf, und für einen Moment glitt ihr Blick aus dem Fenster hinaus in den Neuköllner Hinterhof. Grau und trist erstreckte er sich vor ihr im Halbdunkel. Es war ein diesiger Abend im Spätherbst.
Schon war sie wieder in ihr Werk vertieft. Die Zeit verstrich. Beim Töpfern konnte sie alles um sich herum vergessen.
Sie befühlte den Vasenrand, gab der Form den letzten Schliff, legte den Lederfetzen beiseite, befeuchtete ein letztes Mal ihre Hände, ließ das Gefäß kreisen, verlangsamte die Geschwindigkeit der Scheibe und hielt sie schließlich an.
Der erste Arbeitsschritt war getan. Morgen nach Feierabend könnte sie weitermachen. Doch vorerst musste der Ton trocknen.
Mit einem Draht schnitt sie ihn von der Scheibe. Vorsichtig hob sie die Vase an und stellte sie auf einem sauberen Tragbrett ab.
Sie kennzeichnete das Brett mit ihrem Namen, wusch sich am Spülbecken die Hände und betrachtete sich in dem kleinen Spiegel davor. Notdürftig wischte sie sich die feinen Tonspritzer von den Wangen. Zu Hause müsste sie dringend duschen.
Sie nahm ihre Jacke vom Haken, zog sie über ihre Arbeitskluft und schlenderte in den Vorderraum, wo Paula, die Werkstattleiterin, hinterm Tresen stand.
»Wie war es heute, Marta?«
»Ich bin zufrieden.«
»Woran arbeitest du?«
»An einer Vase. Ich möchte sie meiner Mitbewohnerin Lea schenken.«
»Wie nett von dir.« Paula lächelte sie an. Sie war eine hochgewachsene Dunkelhaarige, wohl ungefähr in ihrem Alter, Mitte dreißig. Zunächst hatte sie ihr Unterricht gegeben, nun zahlte Marta nur noch einen monatlichen Betrag für das Material und die Nutzung der Räume. »Du bist sehr fleißig. Und ziemlich begabt.«
Marta spürte, wie sie leicht errötete. »Danke. Ich hatte eigentlich schon als Jugendliche den Traum, Keramikerin zu werden, mein Hobby zum Beruf zu machen. Aber letztlich habe ich mich nicht getraut. Nun hab ich einen Job, der mich nicht gerade erfüllt, und freue mich auf die Abende, wenn ich hier sein kann.«
»Was machst du beruflich?«
»Ach, das ist so eine Stelle beim Bezirksamt. Nicht der Rede wert.«
»Selbstständig zu arbeiten ist auch nicht immer ein Vergnügen. Die Werkstatt läuft zwar ganz gut, aber die Angst vor der nächsten Mieterhöhung sitzt mir ständig im Nacken.«
»Ich bin froh, dass es diesen Laden gibt. Bis morgen, Paula.«
»Bis dann.«
Marta nickte ihr zu, klinkte die Tür auf und trat hinaus.
Kühle Herbstluft schlug ihr entgegen. Fröstelnd zog sie die Schultern hoch. Ihre Schritte hallten pochend im Hofeingang. Sie bog nach rechts in das südliche Ende der Pannierstraße ein. Nach einigen Metern hatte sie die Sonnenallee erreicht.
An der Fußgängerampel überquerte sie die Straße und bog abermals nach rechts ab. Die Sonnenallee war um diese Zeit noch äußerst belebt. Sie kam an Gemüseläden, Import-Export-Geschäften, Shisha-Bars und Schawarma-Imbissen vorbei, schnappte arabische Gesprächsfetzen auf und musste immer wieder hektisch gestikulierenden Passanten ausweichen.
Sie erreichte die Weichselstraße, in der es weitaus ruhiger war. Dunst waberte unter den weiß leuchtenden Straßenlaternen. Der Wind rauschte in den Linden, die nur noch spärlich belaubt waren. Auf dem Gehweg schimmerten gelb verfärbte Blätter.
Das Novemberwetter stimmte sie melancholisch. Doch wenn sie an ihre Keramik zurückdachte, wurde ihr leichter zumute. Sie überlegte, welche Glasur sie für die Vase auswählen sollte. Der Blauton, den sie neulich für ein anderes Gefäß verwendet hatte, gefiel ihr sehr gut. Ja, der könnte auch etwas für Lea sein.
Vor dem weiß getünchten Altbau an der Ecke Weserstraße blieb sie stehen und nahm den Schlüssel aus ihrer Jackentasche. Sie schloss die Haustür auf und stieg die Treppe zum dritten Obergeschoss hinauf. Sie öffnete ihre Wohnungstür, trat ein und warf den Schlüssel in die bereitstehende Schale auf der Flurkommode, auch ein selbst getöpfertes Werk von ihr.
Sie zog ihre Jacke aus und schaltete überall in der Wohnung das Licht ein, damit ihr die Räume nicht so verlassen vorkamen. Lea war beruflich unterwegs und würde erst in zwei Tagen zurückkehren.
Marta hatte sich vor einem Jahr nach längeren Streitereien von ihrem Freund getrennt, da er sich partout nicht auf ihren Kinderwunsch einlassen wollte. Für sie aber war ein Leben ohne Kinder undenkbar. Nun war sie vierunddreißig und hatte noch immer nicht den richtigen Mann getroffen, der bereit war, mit ihr eine Familie zu gründen.
Sie durfte nicht wieder daran denken, dass ihr die Zeit davonlief. Nur nicht ins Grübeln geraten. Die Angst vor der Einsamkeit, die Frage, ob sie sich vielleicht von Gerald vorschnell getrennt hatte, ihn womöglich noch immer liebte, die ewigen Selbstzweifel, die Vergleiche mit anderen Frauen, die in ihrem Alter bereits ein zweites Baby erwarteten, all das tat ihr nicht gut.
Positiv denken, nach vorne schauen.
Das Leben musste irgendwie weitergehen.
Seitdem sie eines der drei Zimmer ihrer Wohnung über eine Anzeige im Internet an Lea vermietet hatte, war es wenigstens nicht mehr so still hier. Lea war ein lebensfroher Mensch. Marta ließ sich gerne von ihrem herzlichen Lachen und ihrer Fröhlichkeit mitreißen. Mittlerweile bedauerte sie es, dass ihre Mitbewohnerin oft auf Geschäftsreisen war. Sie hoffte sehr, dass sich aus ihrer Zweckwohngemeinschaft bald eine tiefe Freundschaft entwickelte, denn sie mochte Lea. Vielleicht war dieses Zusammenleben ein dauerhafter Ersatz für ihre romantischen Familienpläne.
Verdammt, dachte sie, bin ich wirklich so einsam und desillusioniert?
Ich bin doch noch jung. Das große Glück liegt vor mir, bestimmt.
Bis dahin musste sie sich eben mit dem kleinen begnügen.
Und wieder stellte sie sich eine besondere Glasur für das Geschenk vor, mit dem sie Lea bald nach ihrer Rückkehr überraschen wollte.
Marta nahm eine heiße Dusche, trocknete sich ab und schlüpfte in bequeme Sachen. In der Küche überlegte sie gerade, was sie sich zum Abendessen kochen sollte, als es an der Tür läutete.
Sie runzelte die Stirn. Um diese Zeit erwartete sie keinen Besuch.
Im Flur schaute sie durch den Spion. Im Treppenhaus stand ein Junge. Sie schätzte ihn auf vierzehn Jahre, vielleicht sogar jünger.
»Was willst du?«, fragte sie durch die Tür hindurch.
»Helfen Sie mir. Bitte.«
Sie öffnete. »Was ist denn los?«
Sie musterte ihn. Schmale Gesichtszüge. Dunkelblondes Haar. Traurige braune Augen. Er trug Jeans und ein ausgewaschenes Sweatshirt. Er hatte keine Jacke an.
»Kann ich mal bei Ihnen telefonieren?« Er sprach sehr leise, kaum hörbar.
»Wieso?«
Keine Antwort.
Der Junge schien zu keinem ihrer Nachbarn zu gehören. Er war ihr unbekannt.
»Wie bist du ins Haus gekommen?«
»Die Tür war offen. Mir ist so kalt.« Er zitterte.
»Hast du denn keine Jacke?«
Er schüttelte den Kopf, offenbar den Tränen nah. »Die haben mir alles weggenommen. Auch mein Handy.«
»Wer?«
»Sie waren zu fünft. Ich konnte mich nicht wehren.«
»Du bist ausgeraubt worden?«
Er nickte.
»Auf der Straße?«
»Ja.«
Marta prüfte ihn mit Blicken. Er war vielleicht eher zwölf, dreizehn Jahre alt. Ein hübsches Gesicht. Etwas blass. Halblanges Haar.
»Du bist ja völlig durchgefroren.«
Er senkte den Kopf.
Marta griff zum Festnetztelefon auf der Kommode. »Wie ist die Nummer deiner Eltern?«
Er zitterte am ganzen Körper, seine Zähne schlugen aufeinander. Wie lange war der Junge wohl schon ohne Jacke unterwegs?
Marta musste an die Besonderheiten ihres Viertels denken. Einerseits war es bei jungen Leuten sehr beliebt, die Mieten stiegen ständig, die Gentrifizierung war weit vorangeschritten. Andererseits galt Neukölln noch immer als sozialer Brennpunkt. Dass ein wehrloser Junge von anderen Jugendlichen auf offener Straße ausgeraubt wurde, überraschte sie nicht.
Sie musste helfen.
Der Junge schaute sie an. Er war ungefähr so groß wie sie, ein Meter siebzig, schmale Schultern. Er tat ihr leid.
»Wie heißt du?«
Er schlug die Augen nieder.
»Wo wohnst du? Hier in der Nähe?«
Was hatten sie nur mit ihm angestellt? Er wirkte völlig verstört.
Auf einmal presste er die Beine zusammen.
»Ich muss dringend auf die Toilette.« Wieder sprach er so leise, dass sie ihn kaum verstand.
Marta war kurzzeitig überfordert. Der Junge verzog das Gesicht. Augenscheinlich war er in großer Not.
»Na schön, aber beeil dich.«
Sie wies auf die Tür zum Badezimmer.
Der Junge verschwand darin und schloss sich ein.
Verlegen wartete sie ab, bis sie endlich gedämpft das Rauschen der Spülung vernahm. Die plötzliche Nähe war ihr unangenehm. Doch was sollte sie tun? Sie konnte nur helfen.
Mit hängenden Schultern kam er wieder heraus.
»Wir rufen jetzt deine Eltern an, ja? Sag mir die Nummer.«
Er verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich will nicht mehr nach Hause.«
»Aber warum denn nicht? Was ist passiert?«
»Haben Sie ein Glas Wasser für mich?«
Sie zögerte.
»Bitte.«
Ich bin zu gutmütig, dachte sie. Schon war sie in der Küche und füllte ein Glas an der Spüle. Als sie zurückkam, drückte er sich an der Wohnungstür herum.
Sie reichte ihm das Glas. »Hier.«
Er trank.
»Sag mir deinen Namen.«
Sein Zittern verstärkte sich.
»So kalt«, murmelte er. Er schüttelte sich. Dabei glitt ihm das Glas aus der Hand. Ein leiser Aufschrei. Es zersprang am Boden.
Marta starrte auf die Scherben.
Als sie aufblickte, riss der Junge die Tür auf und verschwand im dunklen Hausflur.
»Warte doch«, rief sie ihm nach.
Sie hörte bloß noch seine eiligen Schritte auf der Treppe. Danach war es still.
DREI
DIENSTAG, 24. NOVEMBER
Am nächsten Abend war sie wieder in der Werkstatt. Sie war mit dem Abdrehen der Vase beschäftigt. Dafür musste sie das getrocknete Gefäß kopfüber auf die Drehscheibe stellen, um den Boden zu bearbeiten. Sie ließ die Scheibe rotieren und schabte mit einem scharfen, rechtwinkligen Werkzeug allen überflüssigen Ton von der Unterseite weg. So entstand allmählich ein Fußring, auf dem die Vase mehr Halt haben würde.
Marta war müde. Sie hatte schlecht geschlafen. Die halbe Nacht hatte sie wach gelegen und über die seltsame Begegnung mit dem Jungen nachgedacht. Schon bei der Arbeit im Büro war sie unkonzentriert gewesen, und während sie nun mit dem Werkzeug hantierte, stellte sie fest, dass ihre Bewegungen immer fahriger wurden.
Sie schnitt zu tief in den Ton. Wenn sie so weitermachte, würde sie den Vasenboden ruinieren. Bei mäßiger Drehgeschwindigkeit versuchte sie krampfhaft, ihren Fehler auszumerzen.
Wie es dem Jungen jetzt wohl erging? Warum wollte er nicht zu seinen Eltern zurück? Und warum hatte er ausgerechnet bei ihr geklingelt? War das ein Zufall?
Sie dachte an sein Missgeschick mit dem Wasserglas. Der arme Junge. Sie hätte doch nicht mit ihm geschimpft. Wahrscheinlich wurde er von seinen Eltern geschlagen.
Eine weitere unkontrollierte Bewegung, und die Vase rutschte ihr von der angefeuchteten Scheibe.
Nun hatte sie den oberen Rand zerstört.
»Mist!«
Paula kam zu ihr.
»Probleme beim Abdrehen?«
»Ich bin so ungeschickt.«
»Ach, nicht doch, das passiert mir auch manchmal.«
»Ist die Vase noch zu retten?«
»Ich denke nicht. Versuch es lieber mit einer neuen.«
»Ich mache Schluss für heute«, murmelte Marta.
»Wirklich?«
»Ist nicht mein Tag.«
Paula half ihr dabei, den Arbeitsplatz zu säubern und den angetrockneten Ton in eine Kiste zu werfen.
Das also war aus ihrem Geschenk für Lea geworden
Sie unterhielten sich noch eine Weile, dann verließ Marta die Werkstatt.
Als sie in der Weichselstraße ihre Wohnung aufschloss und den Schlüssel in die Schale warf, musste sie wieder an den Jungen denken.
Die Glasscherben waren aufgekehrt, nichts deutete mehr auf seinen rätselhaften Besuch hin. Sie hatte sogar das Badezimmer gesäubert. Und doch war ihr, als schwebte noch immer etwas von seiner Anwesenheit in den Räumen.
In der Küche war sie für einen Moment irritiert. Unwillkürlich begann sie zu schwitzen. Etwas war anders als sonst. Lea und sie waren nicht besonders penibel, was das Aufräumen betraf, und doch erschien ihr die Küche ordentlicher als noch am Vorabend.
Sie ließ die Blicke schweifen.
Nein, sie täuschte sich wohl.
Alles war wie immer.
Es wurde Zeit, dass Lea heimkam. Das Alleinsein tat ihr nicht gut.
Marta duschte, aß zu Abend, dann ging sie früh zu Bett.
In der Nacht träumte sie von dem Jungen. Er klingelte an der Tür, und diesmal ließ sie ihn herein wie einen Bekannten.
Sie fragte ihn, wie es in der Schule gewesen sei.
Er zuckte mit den Schultern.
Sie strich ihm sanft über den Kopf.
Er wich vor ihr zurück.
»Was ist passiert?«, fragte sie ihn. »Was hat man dir angetan?«
Er öffnete den Mund. Er sprach zu ihr.
Doch sie verstand ihn nicht.
Auf einmal hatte sie das Gefühl, dass Wasser in ihre Ohren drang. Sie sank tiefer. Das Gesicht des Jungen verschwamm vor ihren Augen.
Plötzlich war sie hellwach.
Jemand war im Zimmer.
Da saß jemand an ihrem Bett.
Sie wollte schreien. In diesem Moment presste sich eine Hand auf ihren Mund. Die Hand roch nach Gummi.
Die Nachttischlampe wurde eingeschaltet. Marta war für eine Sekunde geblendet. Abermals wollte sie schreien. Es war ein roter Latexhandschuh, der sich fest auf ihren Mund drückte.
Eine Fratze beugte sich über sie. Eine leise Stimme sprach zu ihr: »Wenn du schreist, bist du tot.«
Dann spürte sie eine Messerspitze an ihrer Kehle.
»Willst du leben?
Sie keuchte.
»Willst du weiter atmen?«
Ihr war schwindlig vor Angst.
»Sag schon.«
Sie nickte schwach.
Die Fratze war ein einziges dunkelrotes Grinsen. Etwas stimmte mit den Augen und dem Mund nicht. Sie waren tief ausgehöhlt. Darin glänzte etwas, triefend rot.
Marta bäumte sich auf, doch die Gestalt drückte sie zurück aufs Kissen.
Sie sah das Messer aufblitzen. Es war lang und scharf.
»Nur atmen. Weiter atmen. Ganz ruhig.«
Sie rang nach Luft. Ihr war, als würde ihr Herz für einige Schläge aussetzen.
Entsetzt blickte sie in dieses entstellte blutrote Gesicht über ihr. Es war so unheimlich, dass sie kaum hinsehen konnte.
Große Augenhöhlen, in denen es rot schimmerte. Was war das? Was steckte darin? Auch der weit aufgerissene Mund war voll von diesem dunklen Zeug.
»Ich lege das Messer weg«, sagte die Gestalt zu ihr. »Wenn du still bist, lege ich es weg. Aber du darfst dich nicht rühren. Und du musst leise sein. Verstanden?«
Marta nickte schwach. Ihr Nachthemd klebte klatschnass an ihrer Haut. Sie roch ihren eigenen Angstschweiß.
Sie sah, wie die Gestalt das Messer auf den Nachttisch legte.
Die Fratze näherte sich ihr.
»Nein«, wimmerte sie, »nein, bitte, tun Sie mir nichts.«
»Sei leise.«
Ihr entkamen kehlige Laute.
»Gib mir deine Hand.«
Sie war wie erstarrt.
»Mach schon.«
Zögernd gehorchte sie.
»Nein, die linke.«
Zittrig streckte sie die andere aus.
Ihre Handfläche wurde betastet. Danach jeder einzelne Finger. Sie spürte den Latex auf ihrer Haut.
Es schüttelte sie.
Sie blickte auf. Der gesamte Kopf der Gestalt war knallrot. Das Gesicht schien aufgeschlitzt zu sein. Diese blutroten Stummel in den Augenhöhlen und im klaffenden Mundraum schimmerten feucht. Der Anblick verursachte ihr einen Brechreiz.
»Deine Hand ist so kalt«, sagte die Gestalt leise. »Eiskalt.«
Sie begann zu stammeln: »Bitte, wir können doch …«
»Schsch. Kein Wort. Du musst still sein.« Die Fratze kam ihr sehr nah. »Ich will nur hören, wie du atmest. Einatmen. Ausatmen.«
Sie sog die Luft in ihre Lunge und stieß sie aus.
»Gut.«
Was hatte es mit diesen Stummeln auf sich? Was war das für ein Gesicht über ihr? Träumte sie etwa?
Nein, das war kein Albtraum.
Es war Wirklichkeit.
Plötzlich ließ die dunkel gekleidete Gestalt von Martas Hand ab.
»Warum starrst du mich so an? Gefällt dir mein Gesicht nicht?«
Sie hechelte.
Die Gestalt richtete sich ein wenig auf. Dann fuhr sie sich mit Daumen und Zeigefinger in die breit grinsende Fratze.
Sie zog sich einen der blutroten Stummel aus der Augenhöhle und hielt ihn Marta hin.
»Hier, koste mal. Schmeckt süß.«
Der Stummel wurde vor ihren Lippen hin- und herbewegt.
Marta schrie.
VIER
MITTWOCH, 25. NOVEMBER, FRÜHMORGENS
Nils Trojan erwachte noch vor Sonnenaufgang. Nur mit T-Shirt und Boxershorts bekleidet, trat er hinaus auf die Terrasse der kleinen Finca. Der Horizont war in Pastellfarben getaucht, mattrosa, ein helles Blau. Über dem Atlantik stand die Mondsichel. Das Meer war ruhig, glatt, in den Farben des Himmels.
Er sog die Luft ein. Würzig war sie, erdig, mit einem Hauch von Salz und Jasmin. Barfuß stieg er die Stufen aus Felsstein in den Garten hinab und näherte sich der Dattelpalme.
Er schloss für einen Moment die Augen und lauschte. Es war ein sanftes Flüstern, wenn der Wind durch ihre Blätter fuhr.
Trojan schaute auf und beobachtete, wie der Mond allmählich verblasste. Das Meeresblau wurde tiefer, und der Himmel begann zu leuchten.
Unten im Dorf krähte ein Hahn. Die Hunde schlugen an.
Er wandte sich um. Über der Hügelkette würde gleich die Sonne aufgehen. Zunächst war es wie ein Lodern in den Pinien, die die Bergspitze säumten, dann erschien der Feuerball, warf seine Strahlen hinunter ins Tal und wärmte Trojans Gesicht.
Dieses Schauspiel hatte er seit drei Monaten an jedem Morgen beobachtet, und es beglückte ihn auch heute, auch wenn es diesmal mit einer Prise Wehmut verbunden war, denn es war der Tag seines Abschieds.
Zwölf Wochen unbezahlten Sonderurlaub hatte ihm sein Chef Hilmar Landsberg nach langem Hin und Her gewährt. Selbst eine Kündigung hatte Trojan in Betracht gezogen, da er nach der Aufklärung der letzten Mordfälle so ausgebrannt war, dass er kurz vor einem Zusammenbruch stand.
Er hatte einen seiner Kollegen im Zuge der Ermittlungen verloren, und das hatte ihn mehr mitgenommen, als er sich anfangs eingestehen wollte.
Trojan betrachtete die roten Blüten der Bougainvillea, die sich im Sonnenlicht entfalteten, dann glitt sein Blick hinunter, über den Weinberg, auf dem sich gerade ein Taubenschwarm niederließ, und wanderte hinaus aufs Meer. Auf dieser kleinen Kanareninsel, die vom Massentourismus verschont geblieben war, herrschten auch Ende November noch frühlingshafte Temperaturen.
In Berlin hingegen erwartete ihn nasskaltes Wetter, wie ihm Steffie gestern Abend am Telefon gesagt hatte. In drei Stunden würde sein Flugzeug abheben, doch vorher hatte er noch etwas Dringendes zu erledigen.
Er duschte, zog sich an, trank einen letzten Kaffee auf der Terrasse, verstaute seinen Koffer im Mietwagen und fuhr los.
Beinahe im Schritttempo nahm er die Schotterpiste mit den vielen Schlaglöchern, die von dem abseits gelegenen Haus wegführte. Als er die nächste Kreuzung erreichte, ignorierte er die Route zur Ostseite der Insel, wo sich der kleine Flughafen befand, sondern wählte die Straße durch die Ortschaft, die sich steil den Hang hinunterwand. Ein paar hundert Meter weiter bog er in einen schmalen, asphaltierten Weg ab, der vorbei an Vulkangestein und Bananenplantagen in Haarnadelkurven hinunter zum Meer führte.
Seine ersten beiden Wochen auf der Insel hatte er überwiegend schlafend verbracht, so erschöpft war er gewesen. Vormittags ruhte er auf der Gartenliege im Schatten der Dattelpalme, mittags hielt er Siesta im Schlafzimmer der Finca, dann fuhr er am Spätnachmittag zum Strand hinunter, um kurz zu baden, danach döste er unter seinem Sonnenschirm ein. Hierzulande ging die Sonne früh unter, darum hatte er auch Grund, frühzeitig zu Bett zu gehen.
In der dritten Woche schloss er Bekanntschaft mit Jan, einem Deutschen, der öfter im Jahr einige Wochen auf der Insel verbrachte. Er war ihm aufgefallen, weil er beinahe täglich auf dem Volleyballfeld oberhalb des kleinen Strands anzutreffen war, an dem Trojan regelmäßig schwimmen ging. Eines Nachmittags fragte er Nils, ob er nicht Lust auf ein Match hätte, und er willigte ein.
Fortan spielten sie öfter in wechselnden Teams, mal waren es mehr Deutsche, mal mehr Spanier. Jan war immer dabei. Braun gebrannt, muskulös, gut gelaunt, schmetterte und pritschte er Trojan die Bälle zu, der immer mehr Gefallen an dem Spiel fand.
Anfangs war er noch etwas aus der Übung, er hatte zuletzt in seiner Schulzeit gespielt, doch schon nach einigen Nachmittagen machte es ihm große Freude, auch nach den schwierigen Bällen zu hechten und sie übers Netz zu jagen.
Jan war in Trojans Alter, ebenfalls geschieden. Er leitete ein Sportstudio im Frankfurter Raum. Durch geschickte Organisation und einen sparsamen Lebensstil gönnte er sich viele Auszeiten auf der Insel und mietete stets das gleiche preiswerte Appartement in der Nähe vom Strand.
»Ich nenne das Lebenskunst«, sagte er nach einem Match zu ihm.
»Die entdecke ich auch gerade«, erwiderte Nils.
»Was machst du, wenn du nicht hier bist?«
Trojan schwieg lange. Dann erzählte er ihm von seinem Beruf.
Jan blickte nachdenklich aufs Meer hinaus. »Harter Job?«
»Sehr hart.«
»Hast du noch Feuer in dir?«
»Um das herauszufinden, bin ich hergekommen.«
Im zweiten Monat sprach Trojan bereits ein paar Brocken Spanisch. Wenn die Brandung zu stark war, um schwimmen zu gehen, unterhielt er sich mit den Männern von der Wasserwacht. Sie lachten ihn freundlich an, auch wenn sie ihn nicht immer verstanden, und schon bald winkten sie ihm zu, wenn er sie am Strand traf. Sie warnten ihn vor den Strömungen, erklärten ihm, dass das Vulkangestein steil ins Meer abfiel und die Dünung darum sehr hoch steigen konnte.
An ruhigen Tagen schwamm Trojan bis zur letzten Boje hinaus und ließ sich dann auf dem Rücken treiben. Er träumte davon, sich auf der Insel für immer niederzulassen. Er überlegte, ob er Steffie, mit der er jeden Abend telefonierte, davon erzählen sollte, doch er ließ es vorerst bleiben.
Oftmals skypte er mit seiner Tochter Emily, die nach ihrem Abitur für ein Jahr in Kanada jobbte. Auch ihr erzählte er nichts von seinem Traum.
Vormittags joggte er in einem Naturschutzgebiet einen schmalen Weg oberhalb der Steilküste entlang. Keine Menschenseele weit und breit. Nur gelegentlich kam ihm ein Kleinlaster entgegen, der Bananen aus den Plantagen transportierte. Trojan lief und lief. Er hörte nichts außer seinem Atem. Links von ihm die Pinienwälder auf der Hügelkette, rechts von ihm das Meer, vor ihm nur der Himmel.
Vor der nächsten Kurve breitete er die Arme aus und stellte sich vor abzuheben.
Er war frei, endlich frei.
Ende Oktober besuchte ihn Steffie für eine Woche. Sie hatten vereinbart, nicht über die Arbeit zu reden.
Sie schliefen lange, frühstückten auf der Terrasse. Sie liebten sich leise im Schatten der Dattelpalme. Sie wanderten durch die Vulkanschlucht und schnorchelten in der Badebucht. Abends betrachteten sie den Sonnenuntergang. Einmal übernachteten sie auf der Terrasse, eingehüllt in Decken. Als Trojan mitten in der Nacht die Augen aufschlug, war der Himmel voller Sterne.
Am Flughafen sagte sie zu ihm: »Und? Wirst du überhaupt wiederkommen?«
»Wieso fragst du?«
»Du wirkst so tiefenentspannt. Du lächelst immerzu.«
»Könntest du dir vorstellen, hierher auszuwandern? Mit mir?«
»Wovon sollten wir leben?«
»Von Ersparnissen.«
»Hast du ein Vermögen angehäuft?«
»Eher nicht«, sagte er. »Um ehrlich zu sein, bin ich so gut wie pleite.«
»Ich mag Berlin«, sagte Steff. »Und ich mag meinen Job. Wie ist es bei dir?«
»Gib mir noch ein paar Wochen.«
»Landsberg erwartet dich Ende November zurück. Er hat dich fest eingeplant.«
»Ich weiß.«
»Du bist sein leitender Ermittler. Er zählt auf dich. Er hat mich gebeten, dir das auszurichten.«
An der Absperrung vor der Sicherheitskontrolle drehte sie sich noch einmal zu ihm um: »Auch wenn wir die Dinge unkompliziert halten, Nils: Du fehlst mir.«
»Du fehlst mir doch auch.«
Trojan hatte sich angewöhnt, nach dem Joggen für eine halbe Stunde auf einem Felsstein im Garten zu sitzen und aufs Meer hinauszuschauen. Ohne sich zu bewegen. Ganz still. Tief atmend.
Er nannte es Meditation, ohne genau zu wissen, was das eigentlich war.
Anfangs fiel es ihm schwer. Die Gedanken prasselten auf ihn ein. Er sah die Geister der Ermordeten vor sich. Sie sprachen zu ihm. Sie beklagten sich. Er sah ihre Leichname, die Ströme von Blut, er war wieder an den Tatorten.
Aber er gab nicht auf. Wieder und wieder setzte er sich auf seinen Stein und hörte den Toten bei ihren Klagen zu.
Allmählich beruhigten sich seine Gedanken, und er sah klarer.
An manchen Tagen war sein Geist so ruhig wie das Meer, an anderen aufgewühlt, tobend, wie auch der Atlantik zuweilen. Gelegentlich meldete sich die Angst zurück. Die Furcht, in seinem Job nicht bestehen zu können, die Sorge vor der nächsten Panikattacke.
Doch je länger und öfter er dasaß, desto mehr Raum war in ihm.
Ja, er hatte Angst.
Aber da war auch Mut.
An einem Nachmittag im November sagte er zu Jan: »Ich denke, es brennt noch ein Feuer in mir.«
»Du willst also gehen?«
»Ja.«
Am Abend sprach er mit Steffie am Telefon darüber. Er hatte einen einfachen Plan. Etwas sollte sich ändern.
Es hatte nichts mit dem Außen zu tun.
Es war in ihm.
Er besaß es bereits.
Nur hatte er zeitweilig den Zugang dazu verloren.
Er parkte den Wagen oben an der Straße, stieg aus und ging langsam den Pfad zu der kleinen Badebucht hinunter.
Der Strand war um diese Zeit noch menschenleer. Trojan schlüpfte aus seinen Flip-Flops und ging barfuß weiter. Er spürte den warmen Sand unter den Füßen. Schwarz war er, wie überall auf der Insel, vulkanischen Ursprungs.
Dunkler, schwerer Lavasand.
Achtsam setzte er Schritt für Schritt. Er kam an dem verlassenen Volleyballfeld vorbei. Von Jan hatte er sich bereits am Vortag verabschiedet. Sie wollten in Kontakt bleiben.
Trojan ging weiter.
Der Ozean war so klar und ruhig, dass sich der Himmel darin spiegelte. Leise klatschten die Wellen an den Ufersaum.
Er blieb stehen, schloss die Augen und breitete die Handflächen aus.
Er atmete tief. Er nahm den Meeresduft in sich auf.
Dann holte er das Glas mit dem Schraubdeckel aus seinem Rucksack, öffnete es, kniete nieder und häufte Sand hinein.
Es war ein schlichtes Olivenglas, das er ausgewaschen hatte.
»Wie sieht denn nun dein Plan aus?«, hatte ihn Steffie am Telefon gefragt.
»Wenn sich der Stress zurückmeldet, wenn mich die Arbeit überfordert und ich während der Ermittlungen das Gefühl habe, nicht mehr zum Atmen zu kommen, berühre ich den schwarzen Lavasand dieser Insel. Sie ist mein Kraftort. Ich nehme mir eine Handvoll davon mit.«
»Wirst du den Sand immer bei dir haben?«
»Das wird wohl nicht möglich sein. Aber ich kann das auch in meiner Vorstellung tun, weißt du? In diesem Sand ist das Feuer eines Vulkans gespeichert. Es kommt tief aus dem Erdinneren. Eine Energie, die ich schon immer in mir hatte. Jeder Mensch hat sie. Ich hab nur die Verbindung zu dieser Kraft verloren.«
»Gut, dass du sie wiedergefunden hast.«
»Ja.«
»Dann kann es ja losgehen. Das Team wartet auf dich.«
»Danke, Steff.«
»Wofür?«
»Für deine Geduld mit mir.«
Er hörte sie in den Hörer atmen. »Ich freue mich jedenfalls auf dich.«
»Und ich mich auf dich.«
Er schraubte das Glas zu und steckte es ein. Er schaute noch einmal aufs Meer hinaus.
Dann ging er zurück zu seinem Mietwagen und fuhr direkt zum Flughafen.
FÜNF
MITTWOCH, 24. NOVEMBER, ABENDS
Der ICE aus Köln hatte sechzig Minuten Verspätung. Als er endlich den Berliner Hauptbahnhof erreichte, war Lea so müde und gereizt, dass sie beschloss, sich ein Taxi nach Hause zu nehmen, obwohl ihr das bei ihrem Anfangsgehalt in der Probezeit eigentlich zu teuer war.
Sie nannte dem Fahrer die Adresse, und sie fuhren los. Es war kurz nach zwanzig Uhr, als der Wagen vor dem Haus in der Weichselstraße hielt. Lea zahlte und stieg aus.