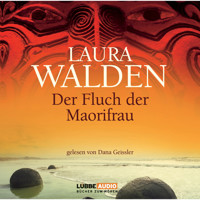9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
"Liebe Miss Williams, ich bin Dorothee Dehn aus Hamburg. Mein Vater war Ludwig Dehn, und ich habe Ihren Artikel über ihn gelesen. Ich möchte Sie dringend bitten, mich anzurufen."
Als die neuseeländische Journalistin Sarah Williams diese Mail liest, greift sie sofort zum Telefon. Sie kann kaum glauben, was sie erfährt: Der deutsche Forscher Ludwig Dehn war ihr Urgroßvater! Kein erfreuliches Erbe, denn Sarah hat selbst nachgewiesen, dass Dehn in den Zwanzigerjahren Papiere fälschte, um ein Maori-Versammlungshaus nach Hamburg zu verschiffen. Doch wie ging die Geschichte weiter? Und was hat das alles mit ihr zu tun? Auf der Suche nach Antworten reist Sarah überstürzt nach Hamburg ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Prolog
1. Teil
Hamburg, Dezember 2013
Russell, Dezember 2013
Auckland, Dezember 1929
Dezember 2013, Flug Sydney - Dubai
Hamburg, Dezember 2013
Auckland, Dezember 1929
Hamburg, Dezember 2013
Auckland, Dezember 1929
Hamburg, Dezember 2013
Auckland, Dezember 1929
Hamburg, Dezember 2013
Auckland, Dezember 1929
Hamburg, Silvester 2013
Auckland, Februar 1930
Hamburg, Januar 2014
Hamburg, Januar 2014
2. Teil
Auckland, März 2014
Auckland, Mai 1930
Hamburg, März 2014
Auckland, März 2014
Auckland, Mai 1930
Dunedin, März 2014
Auckland, Mai 1930
Auckland, März 2014
Hamburg, November 1932
Hamburg, Mai 2014
Nachwort
Laura Walden
DAS ERBEDES MAORI-HÄUPTLINGS
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Antje Steinhäuser
Titelillustration: © mauritius images/age;
© huber-images.de; © shutterstock
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1482-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Prolog
Der Mond und die Sterne leuchteten in dieser Januarnacht so intensiv vom Himmel über Whangarei, dass der Platz hell erleuchtet war. In seiner Mitte stand das prachtvolle neue Versammlungshaus. Der Tag war überaus heiß gewesen, und selbst zu dieser späten Stunde war es draußen noch angenehm warm.
Trotzdem fröstelte Aranga, aber diese Kälte kam von innen. Die schöne Tochter des Häuptlings stand halb versteckt hinter einem Kauribaum und beobachtete, wie ihr Geliebter, der Schnitzer Awapatu, fieberhaft an der letzten Figur arbeitete. Am Abend des folgenden Tages sollte die feierliche Einweihungszeremonie stattfinden, und eigentlich hatte der Schnitzer seine Arbeiten bereits erfolgreich abgeschlossen, doch ihr Vater hatte noch eine Statue verlangt, die seiner jungen Frau, ihrer Stiefmutter, ähnlich war. Sie passte gar nicht in das von dem Schnitzer sorgfältig erarbeitete Gesamtbild des Versammlungshauses, aber Arangas Vater hatte sich nun einmal in den Kopf gesetzt, diese Figur zu Ehren seiner Frau am Eingang für alle Gäste und Besucher sichtbar zu platzieren.
Wer wusste besser als Aranga, wie wenig ihr Geliebter von dieser Statue hielt. Er fand, dass sie nicht mit seinem Kunstwerk harmonierte, und hielt es für eine eitle Geste des Häuptlings, seiner Ehefrau diese Figur zu widmen. Wie er überhaupt grundsätzlich nicht damit einverstanden war, das Versammlungshaus einzuweihen, bevor die Priester es nicht von dem Verstoß gegen die heiligen Regeln befreit hatten. Den Termin am Folgetag hielt er für übereilt und unüberlegt. Er war sogar fest davon überzeugt, dass die Ahnen das Unterfangen missbilligten und dem Häuptling sowie allen, die an der Fertigstellung des Versammlungshauses beteiligt waren, zürnten.
Aranga konnte es an der Art und Weise erkennen, wie Awapatu mit dem Schnitzwerkzeug umging, dass ihr Geliebter wütend auf seinen Auftraggeber war. Er bearbeitete das Holz voller Zorn und gar nicht so liebevoll, wie er das ansonsten zu tun pflegte. Außerdem hatte ihm der Häuptling den Auftrag erst vor wenigen Tagen erteilt, und eine derart schwierige Arbeit war in dieser kurzen Zeit kaum zu schaffen.
Aranga konnte gut nachvollziehen, wie sehr die Aufgabe ihren Geliebten belastete. Auch ihr war es nicht geheuer, wie bedingungslos ihr Vater sich seiner neuen Frau zugewandt hatte. Es hatte sie unendlich gekränkt, dass er ihr die wertvolle Halskette ihrer Mutter aus Grünstein geschenkt hatte, die eigentlich ihr zugestanden hätte. Es handelte sich nämlich um ein einzigartiges Stück. So etwas gab es in ganz Neuseeland kein zweites Mal. Ein Goldschmied aus Schottland hatte dieses Schmuckstück angefertigt. Er hatte jeden einzelnen Jadestein in pures Gold gefasst. Es gab Aranga jedes Mal einen Stich mitten ins Herz, wenn sie die Kette am Hals ihrer Stiefmutter glänzen sah. Natürlich hatte sie sich bei ihrem Vater beschwert, doch der hatte jeden ihrer Einwände einfach beiseitegeschoben. So sehr schien er seine schöne junge Frau zu lieben. Und das, dachte Aranga in diesem Augenblick, hatte fatale Folgen. Weil er vor lauter Liebe blind war, hatte er alle Einwände der Weisen, die sich dafür aussprachen, das Versammlungshaus erst zu eröffnen, wenn es von seinem Tapu-Bruch geheilt war, ignoriert. Ihr Vater hätte das halb fertige Haus nämlich niemals mit einer Pfeife im Mund betreten dürfen. Das widersprach den heiligen Regeln und stellte die Unantastbarkeit auf ungeheure Weise in Frage, und es war bekannt, dass ein solches Verhalten die Ahnen gegen ihn aufbringen würde. Nicht nur Awapatu hatte ihren Vater beschworen, diesen Bruch durch einen Priester heilen zu lassen, nein, auch Aranga hatte ihren Vater angefleht, das Haus erst einmal einem heilenden Ritual zu unterziehen. Doch seine verwöhnte junge Frau hatte ihn einen »Feigling« geschimpft und darauf bestanden, dass das Haus wie geplant eröffnet wurde. Arangas Vater hatte daraufhin alle Einwände, noch zu warten, beiseitegeschoben. Und er hatte ihr überdies auch den Wunsch erfüllt, Awapatu mit dem Schnitzen dieser Figur, die sie in ihrer ganzen Schönheit darstellen sollte, zu beauftragen.
Aranga stieß einen tiefen Seufzer aus, während sie an all die beschwörenden Worte dachte, die ihr Vater ungehört abgetan hatte. Die Häuptlingstochter war unschlüssig, ob sie ihr Versteck verlassen und sich bemerkbar machen sollte. Nie zuvor hatte sie ihren Geliebten derart außer sich erlebt. Aber ihre Sehnsucht nach ihm ließ sie alle Bedenken vergessen, und sie lief zu ihm hinüber.
Er stöhnte laut, und sie fragte ihn, ob er sein Werk denn bis zum morgigen Tag zuwege brächte. Der Schnitzer lachte verbittert auf. Er versicherte ihr, dass er zu einer List greifen würde, und murmelte etwas von einem Aufschub. Aranga fragte nicht nach. Sie spürte, dass er ihr nicht mehr darüber verraten würde. Und zudem war ihr klar, dass sie ihren Geliebten störte. Rücksichtsvoll verabschiedete sie sich von ihm mit einem Kuss. Er wirkte abwesend, schien sich ihrer Gegenwart schon kaum noch bewusst zu sein, da kam mit einem Mal Leben in sein von Sorgen zerfurchtes Gesicht. Er beschwor sie eindringlich, sich am heutigen Abend nicht in der Nähe des Hauses ihres Vaters aufzuhalten, sondern in ihrem eigenen kleinen Häuschen, das etwas abseits ganz für sich allein stand. Das hatte sie ihrem Vater abgetrotzt, nachdem sie sich in den Schnitzer verliebt hatte. Awapatus Familie lebte in einem anderen Dorf, und so war das kleine Haus der einzige Ort, an dem die beiden sich ungestört lieben konnten. Natürlich wusste keiner von dieser verbotenen Beziehung, jedenfalls nicht offiziell. Wobei Aranga des Öfteren in den scheelen Blicken der anderen ein gewisses Misstrauen erkennen konnte.
Ein wenig traurig darüber, dass der Geliebte so abweisend gewesen war, begab sich Aranga auf den Weg zum Fluss. Wenn sie am Ufer des Gewässers entlangwanderte, wurde sie jedes Mal innerlich ganz ruhig. Schon in ihrer Kindheit war der Weg am Ufer ihr Lieblingsplatz gewesen, obwohl ihr Vater es gar nicht gern sah, wenn sie den Weg zum Wasser einschlug. Er hatte stets Angst, dass sie in den reißenden Fluss fallen und ertrinken könnte.
Sie setzte sich in den warmen Sand und beobachtete das wild sprudelnde Gewässer, in dem sich tausend Sterne spiegelten. Manchmal verfiel sie in Ratlosigkeit, wenn sie an ihre Zukunft mit Awapatu dachte. Sie liebten einander ohne Frage, trotzdem gab es diese andere Frau, die er zwar nicht liebte, wie er immer betonte, die er jedoch einst seinem Vater zuliebe geheiratet hatte. Immer wenn Aranga in diese düsteren Gedanken verfiel, war es ein Trost, sich in der Nacht in seine Arme kuscheln zu können. Dann fühlte es sich jedes Mal so an, als ob sie beide ganz allein auf dieser Welt wären. Nichts und niemand konnte ihre Harmonie stören. In dieser Nacht allerdings würde es sicher nicht so sein, weil sie nämlich allein in ihrem Bett schlafen würde. Wie sie ihren Geliebten kannte, würde er die Nacht zum Tag machen, um sein Werk zu vollenden, was auch immer er davon hielt.
Als Aranga in die Zivilisation zurückkehrte, war im Dorf bis auf das gelegentliche Schreien der Nachtvögel alles still. Ja, es lag eine beinahe unheimliche Stille über allem. Sie überlegte, ob sie noch einmal bei Awapatu vorbeischauen sollte. Wahrscheinlich würde er sich sehr freuen, wenn sie ihm zum Zeichen der stillen Verbundenheit noch einen liebevollen Kuss auf die Wange geben würde. Aranga schlug also den Weg zum Marae ein, den mit Steinen umfriedeten Festplatz.
Sie war gerade bei dem Kauribaum angekommen, als sie abrupt innehielt. Aufgeregte Stimmen tönten zu ihr herüber. Aranga vermutete, dass der Schnitzer sich mit seinem Auftraggeber stritt und seinem Zorn Luft machte, weil jedem klar sein musste, dass er mit dieser letzten Statue unmöglich zur Eröffnungszeremonie fertig werden konnte. Trotzdem verbarg sie sich hinter dem Baum und spähte vorsichtig in Richtung des Versammlungshauses. Da alles mondbeschienen war, konnte sie ein paar zwielichtige Gestalten erkennen. Mehrere vierschrötige Kerle redeten gleichzeitig auf Awapatu ein. Ihr Anführer war ein Mann mit einem roten Haarschopf und einem struppigen Bart.
Irgendetwas hielt Aranga davon ab, sich aus der Deckung zu begeben. Sie hatte das üble Gefühl, dass diese Zusammenkunft nicht rechtens war, und deswegen schlich sie sich leise und unbemerkt davon. Ihr fiel ein, dass Awapatu sie davor gewarnt hatte, sich in dieser Nacht zum Haus ihres Vaters und ihrer Stiefmutter zu begeben. Warum, fragte sie sich nun aufgeregt. Dass hier irgendetwas Gefährliches vor sich ging, spürte sie mit jeder Faser. Denn sie wusste wohl, dass diese Männer nicht zu den Freunden ihres Geliebten gehörten.
Von Zweifeln geplagt, tat sie genau das, wovor Awapatu sie gewarnt hatte: Auf Umwegen begab sie sich zum Haus ihrer Eltern. Dort war alles dunkel und still. Die beiden lagen sicherlich schon in tiefem Schlummer. Aranga spielte mit dem Gedanken, einen Blick in das Schlafzimmer zu werfen, denn sie verspürte ein ungutes Gefühl im Magen. Als ob von irgendwoher Gefahr drohte. Die Haustür stand immer offen. In dieser Gemeinschaft gab es keine Räuber und Diebe. Alle ließen die Türen zu ihren Häusern stets unverschlossen. Aranga ging also auf das Haus zu und hatte bereits den Griff in der Hand, als sie leise Männerstimmen vernahm. Geistesgegenwärtig sprang sie zurück in den Garten und versteckte sich hinter dem riesigen Stamm eines alten Eisenholzbaumes.
Ihr Herzschlag drohte auszusetzen, als sie dieselben Männer, die eben noch auf dem Platz mit ihrem Geliebten diskutiert hatten, auf den Eingang zu schleichen sah. Eine innere Stimme warnte sie eindringlich, aus der Deckung zu kommen. Doch was wollten die Fremden im Hause ihres Vaters, und was hatten sie mit Awapatu zu schaffen? Eines war klar: Diese Kerle, die soeben im Inneren des Gebäudes verschwanden, sahen nicht gerade vertrauenerweckend aus.
Aranga spielte mit dem Gedanken, loszurennen und ihren Geliebten zu Hilfe zu holen. Die Erkenntnis, dass er diese Männer kannte und womöglich zum Haus ihres Vaters geschickt hatte, ließ sie davon Abstand nehmen. Was ihn auch immer mit diesen Kerlen verband, es machte ihr Angst.
Angestrengt lauschte sie, ob von drinnen irgendwelche Geräusche zu ihr hinüberdrangen. Doch es blieb alles still. Unheimlich still. Obwohl ihr der Angstschweiß in Strömen in den Nacken rann, zitterte sie vor Kälte.
In diesem Augenblick flog die Haustür auf, und die vier Männer traten in die mondbeschienene Nacht hinaus. Was Aranga nun sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Vor lauter Grauen vermochte sie keinen klaren Gedanken zu fassen. Gegen alle Vernunft stieß sie einen mörderischen Schrei aus.
Sie schrie immer noch, als der Mann mit dem roten Bart auf sie zusprang und ihr eine eiskalte Klinge zwischen die Rippen stieß.
Als Aranga aufwachte, wusste sie nicht, wo sie war. Sie wusste auch nicht, was geschehen war. Es war Nacht, und der Mond schien fahl auf den blutroten Flecken hinter dem Eisenholzbaum. Sie fühlte nichts als einen stechenden Schmerz in der Seite. Trotzdem richtete sie sich stöhnend auf und zog sich an dem Stamm des Baumes empor. In ihrem Kopf war nichts als Leere. Fieberhaft versuchte sie, sich daran zu erinnern, warum sie in ihrem eigenen Blut hinter einem Baum lag. Vergeblich. Das Letzte, an das sie sich erinnerte, war ihr Besuch bei Awapatu auf dem heiligen Platz. Mit letzter Kraft und eisernem Willen schleppte sie sich unter höllischen Schmerzen dorthin. Sie war enttäuscht, am Marae feststellen zu müssen, dass Awapatu nicht mehr an der Statue arbeitete, dieser Figur, die ihr Vater in Auftrag gegeben hatte. Das Ebenbild ihrer Stiefmutter. Und Aranga erinnerte sich dunkel daran, dass ihr Geliebter Schwierigkeiten gehabt hatte, die Statue bis zur Einweihung fertigzustellen. Zu ihrer großen Überraschung stand die fertig geschnitzte Figur vor dem Versammlungshaus. Aranga blieb stehen. Die Luft wurde ihr knapp, und sie strich mit der Hand über ihre Seite. Dort, wo der Schmerz wütete. Ungläubig zog sie ihre Hand fort und betrachtete sie: Sie war voller Blut!
Das Schlimme war, dass sie keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte. In ihrem Kopf sprang alles hin und her wie ein Schwarm aufgescheuchter Vögel. Das Einzige, was sie wusste, war, dass sie das Blut stillen musste. Aranga zog sich ihre Jacke aus und presste sie mit aller Kraft auf die Wunde. Ihr wurde schwindlig. Sie hatte nur noch einen Wunsch: sich auf den Boden zu legen und zu schlafen … doch im selben Augenblick, als sie ihrem Bedürfnis nachgeben wollte, entdeckte sie ihren Geliebten. Er lag hinter der Figur, die er fertig geschnitzt hatte, auf der Erde. Mit letzter Kraft schleppte sich Aranga zu ihm. Er lag da wie tot, doch als sie ihm sanft über die Wangen strich, öffnete er die Augen. Er war keines klaren Blickes mehr fähig, sondern seine Augen flackerten wie wild. Wie ein Ertrinkender griff er nach ihrer Hand. Sie ließ sich neben ihn in den Schmutz fallen und beugte mit letzter Kraft ihr Gesicht über seines. Er öffnete ein paarmal den Mund, um ihr etwas zu sagen. Nach ein paar vergeblichen und verzweifelten Versuchen gelang es ihm schließlich, unter Aufbringung seiner letzten Kräfte zu sprechen. Erst schleppend und dann hastig keuchend weihte er sie in das Ungeheuerliche ein. Sie verstand jedes Wort, aber ihr Verstand weigerte sich, die grausame Wahrheit aufzunehmen. Stattdessen begann sich ihr Körper in unkoordinierten Zuckungen zu winden. Sie konnte nichts dagegen tun. Sie zitterte und bebte, schüttelte sich, und dann war sie ganz ruhig. Seine Stimme brach, aber die aufgeregten Bewegungen seines Mundes signalisierten ihr, dass er ihr noch etwas mitteilen wollte. Unter großen Anstrengungen versuchte sie, die Sprache seiner Lippen zu deuten. Ich habe es nicht gewollt! Ich habe deinen Vater doch nur dazu bewegen wollen, die Einweihungszeremonie zu verschieben. Sie sollten ihn doch nur erschrecken!
Ja, genau das konnte sie seinen verzweifelten Lippenbewegungen entnehmen. Und es ergab einen Sinn, einen grausamen Sinn! Obwohl es ihr schier das Herz brechen wollte, verstand sie nur zu gut, dass er nach diesem mörderischen Betrug nur einen einzigen Ausweg gesehen hatte: den Tod! Er versuchte, sich noch ein letztes Mal aufzurichten, und schaffte es, mit dem ausgestreckten Finger auf seine letzte Schnitzerei zu deuten.
Plötzlich war in ihrem Kopf alles klar und licht. Sie erkannte, was Awapatu ihr damit sagen wollte.
In diesem Augenblick war sie auch in der Lage, die Zeit zwischen dem Messerangriff auf sie und diesem Moment zu rekonstruieren: Sie musste eine Nacht oder länger verletzt und unentdeckt hinter dem Eisenholzbaum gelegen haben. Die Einweihungszeremonie hatte nicht wie geplant stattgefunden. Ihr Geliebter hatte die Beute für die Verbrecher sicher verstecken sollen, aber er hatte sie schließlich vor ihnen versteckt. Awapatu hatte ihr noch mitteilen können, dass nun alle auf die Rückkehr ihres jüngeren Bruders warteten, der entscheiden sollte, was mit dem verfluchten Versammlungshaus zu geschehen habe. Auch, dass die Stammesgemeinschaft geschlossen der Meinung war, der große Häuptling habe sein Schicksal durch den Bruch der Regeln selber verschuldet.
Als sie ihrem toten Geliebten die Augen zudrückte, erinnerte Aranga sich noch an jedes Detail, das ihr Awapatu in seinem Todeskampf zugeröchelt hatte. Und dass sie die Einzige auf dieser Welt war, die die Wahrheit kannte.
Doch Aranga, die schöne Häuptlingstochter, hatte all dies vergessen, nachdem die Weisen des Stammes sie noch in derselben Nacht ohnmächtig neben dem toten Awapatu gefunden und in das Hospital gebracht hatten.
Von diesem Tag an war Aranga weder in der Lage zu denken noch zu sprechen. Sie sagte nie wieder ein Wort, und in ihrem Kopf herrschte fortan nichts als bleierne Schwere.
1. TEIL
Pōkarekare ana ngā wai o Waiapu,Whiti atu koe hine marino ana e.
Wild sind die Wasser des Waiapu,Doch wenn du sie überquerst, werden sie ruhig sein.
Aus dem neuseeländischen Liebeslied Pōkarekare ana
HAMBURG, DEZEMBER 2013
Dorothee Dehn stand auf dem Schild am Briefkasten, der notdürftig an einem mit Grünzeug überwucherten Eisenzaun befestigt worden war. Das Haus konnte man zwischen den alten Eichen und den hohen Tannen von der Straße aus nur erahnen. Das Anwesen hat auf jeden Fall bessere Zeiten gesehen, dachte Jan Gerken, als er die quietschende Pforte öffnete, aber zu der exzentrischen alten Dame hätte ein englischer Rasen auch nicht gepasst. Ein holpriger Weg aus ungleich verlegten, mit Moos überwachsenen Steinen führte durch den Zauberwald zu der Villa, deren Fassade entfernt an den Glanz längst vergangener Zeiten erinnerte. Jan vermutete, dass die grünlich schimmernden Mauern einst weiß gewesen waren. Eine steinerne Treppe führte zu einer prächtigen Eingangstür, die dringend einen Anstrich benötigt hätte. An einigen Stellen war schon das Holz zu sehen. Aber das alles nahm Jan nur nebenbei wahr. Er war nämlich ein wenig aufgeregt bei dem Gedanken, dass ihm die Grande Dame eine Einladung in ihr Allerheiligstes hatte zukommen lassen. Sie war als eigenwillig verschrien. Deshalb hatte er sich sehr gewundert, dass sie auf seinen Brief nicht nur geantwortet, sondern ihn auf einen Kaffee in ihr Domizil nach Othmarschen gebeten hatte.
Er betätigte die Türklingel, doch alles blieb still. Das überraschte Jan nicht. Wahrscheinlich war sie schon vor Jahren kaputt gegangen, und es gab niemanden, der sie reparieren konnte. Schade, schoss es Jan durch den Kopf, mit ein bisschen Arbeit konnte man die alte Pracht dieser Villa sicher wiederbeleben, aber er war nicht gekommen, um über das Restaurieren alter Häuser zu sinnieren, sondern in seiner Funktion als Kurator der Ozeanien-Abteilung des Völkerkundemuseums.
Jan wollte gerade klopfen, als ihm Dorothee Dehn bereits die Tür öffnete.
»Die Glocke hat ihren Geist aufgegeben, aber ich habe Sie schon kommen sehen«, sagte die alte Dame statt einer Begrüßung entschuldigend.
Jan mochte Dorothee Dehn und war jedes Mal überrascht, wie jugendlich sie wirkte. Sie war eine hochgewachsene und elegante Erscheinung. Das Auffällige war ihre Frisur. Sie trug das dichte weiße Haar kinnlang und akkurat geschnitten, was zu ihrem schmalen, ebenmäßigen Gesicht passte. Ihre klaren grünen Augen funkelten vor Lebendigkeit.
»Herzlich willkommen in der Villa ›Schandfleck‹«, fügte sie lächelnd hinzu und reichte ihm ihre schmale Hand zur Begrüßung.
Jan lächelte zurück. Dorothee war unter anderem auch für ihren legendären Humor bekannt, und er ahnte, worauf sie anspielte. In der vornehmen Straße, in der sie wohnte, besaßen die Nachbarn gepflegte Vorgärten vor ihren hochherrschaftlichen Villen. Da fiel dieses Anwesen aus dem Rahmen, und Jan konnte sich lebhaft vorstellen, wie man sich darüber das Maul zerriss.
»Ach, es ist doch alles sehr charmant«, entgegnete er.
»Sie sollen nicht lügen, junger Mann, wenn ich die Kraft hätte, würde ich schon mal etwas Farbe auftragen.«
»Wenn Sie wollen, ich kenne da eine Firma, die sich auf das Restaurieren alter Häuser spezialisiert hat.«
Dorothee lachte und warf ihren Kopf in den Nacken. »Gute Idee, aber die kann ich mir sicher nicht leisten. Nun kommen Sie erst mal rein.«
Jan betrat den Flur und sah sich staunend um. Der Eingangsbereich war original im Art déco-Stil eingerichtet.
»Ist das alles echt?«, fragte er erstaunt.
»Darauf können Sie sich verlassen. Alles, was Sie in diesem Haus sehen, stammt noch von meinem Vater, der das Haus in den Zwanzigerjahren nach dem Tod seiner Eltern komplett umbauen und neu einrichten ließ. Er war ein absoluter Fan von Jugendstil, Bauhaus und Art déco.«
»Das ist ja ein Vermögen wert«, rutschte es Jan heraus.
»Was meinen Sie, soll ich das Haus nach meinem Tod jemandem hinterlassen, der ein Museum daraus macht?«
Jans Lächeln erstarb. Sie vermutete hoffentlich nicht, dass er durch die Blume sein Interesse an der Villa kundtat!
»Sie sind noch weit entfernt, einen Gedanken an Ihr Ableben zu verschwenden, und sicherlich haben Sie Erben für dieses Prachtstück.«
Dorothees Miene verdüsterte sich.
»Schön wär’s«, murmelte sie und führte ihn in ihren Salon. Jan bemühte sich, nicht allzu offensichtlich die wertvollen Möbel zu bestaunen. Wenn er sich nicht täuschte, bestand die Esszimmereinrichtung aus Original-Bauhausstücken. An den Wänden hingen mehrere Portraits. Das eine, das Jan besonders faszinierte, was das Bild einer Maori mit den längsten schwarzen Haaren, die er jemals gesehen hatte. Und das andere ein Gemälde, das die Hausherrin in jungen Jahren mit einem Maori-Baby auf dem Arm zeigte. Ihr eigenes kann es ja kaum sein, dachte Jan, denn soviel er wusste, war die alte Dame unverheiratet und kinderlos geblieben. Sonst würde sie wohl auch kaum den Namen ihres berühmten Vaters tragen.
Der Tisch war liebevoll eingedeckt. Mit altmodisch anmutendem Porzellan im Hutschenreuther-Zwiebelmuster und einem köstlich duftenden Schokoladenkuchen. Dorothee bot ihm frisch gebrühten Kaffee an. Von Hand aufgegossen, wie sie stolz betonte.
Ich sollte zur Sache kommen, dachte Jan gerade, als ihn Dorothee auffordernd ansah.
»Sie möchten also, dass ich zu Ihrer Wiedereröffnung des Hauses Hinemoa eine Rede halte?«, kam sie ihm zuvor.
»Ja, wenn Sie mich so direkt fragen, ja, das fände ich wundervoll, wenn Sie über die Geschichte des Hauses Hinemoa sprechen würden. Und wie Ihr Vater das Versammlungshaus einst aus Neuseeland nach Hamburg gebracht hat.«
»Ich weiß nicht. Können Sie das nicht übernehmen? Ich habe dem Museum alle Informationen aus dem Nachlass meines Vaters zukommen lassen, die mit dem Versammlungshaus im Zusammenhang stehen.«
»Schon, ja, aber ich fände es viel besser, wenn Sie als seine Tochter darüber erzählen könnten.«
Dorothee rollte mit den Augen. »Mir steht nicht der Sinn nach großer Gesellschaft und dem übertriebenen Getue bei solcherlei Veranstaltungen.«
Jan befürchtete schon, dass er sich umsonst auf den Weg nach Othmarschen gemacht hatte. Sollten seine Mitarbeiter Recht behalten? Sie hatten ihm prophezeit, dass er bei ihr auf Granit beißen würde. Sie hatte in letzter Zeit schließlich alle öffentlichen Auftritte gemieden. Da kam ihm plötzlich ein Gedanke. Ein Grinsen huschte über sein Gesicht.
»Ich habe Ihnen etwas zu bieten, wenn Sie mir diesen Gefallen tun würden«, bemerkte er verschmitzt.
»Da bin ich aber sehr gespannt!«
»Ich werde den Chef besagter Firma überreden, dass er die Renovierung für Sie umsonst erledigt, wenn Sie dafür zur Eröffnung eine Rede halten.«
Dorothee musterte ihn skeptisch. »Klingt verlockend. Das sind ja interessante Verbindungen, die Sie als Leiter der Abteilung Ozeanien des Völkerkundemuseums so haben.«
Jan lachte.
»Mein Bruder betreibt eine Firma, die die originalgetreue Sanierung alter Häuser übernimmt.«
»Aber er wird nicht umsonst arbeiten, nur damit Sie mich für die Eröffnungsrede gewinnen.«
»Doch, ich glaube schon. Ja, ich bin mir sogar sicher«, erwiderte Jan geheimnisvoll. »Er schuldet mir noch einen Gefallen«, fügte er hinzu und holte sein Handy aus der Jackentasche. »Sie erlauben?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, tippte er eine Nummer ein.
»Selber hallo. Hier ist dein Bruderherz. Du erinnerst dich an dein Versprechen? … Nein, das würdest du nie vergessen. Ich weiß. Ich hätte es aber nie eingefordert, wenn es nicht einer guten Bekannten von mir helfen würde, dass dein Arbeitstrupp demnächst mal in Othmarschen anrückt. Nein, keine neue …« Jan warf Dorothee einen verlegenen Blick zu. »Jedenfalls nicht in dem Sinn, wie du das vermutest. Danke, die Einzelheiten besprechen wir dann Weihnachten. Ja, natürlich komme ich. Nein, Heiligabend eher nicht. Bis dann.«
Dorothee konnte beobachten, dass sich seine Miene bei seinen letzten Worten sichtlich verdüstert hatte. Nachdem er das Gespräch beendet hatte, wandte er sich Dorothee zu.
»Also, mein Teil des Deals steht. Die Firma meines Bruders steht zu Ihrer Verfügung.«
»Er würde wirklich die Hauswände wieder in Ordnung bringen …«
»… Ja, und die Tür und die Glocke übernehme ich höchstpersönlich. Und was sonst der Reparatur bedarf. Ich bin nämlich nicht gerade ungeschickt in handwerklichen und technischen Dingen. Nur als Gärtner können Sie mich nicht einsetzen. Also, wenn Sie einen Vorgarten mit englischem Rasen bevorzugen, dann …«
»Gott bewahre, nein. Ich werde mich von keinem meiner Bäume trennen. Selbst, wenn sie mir den nicht vorhandenen Elbblick versperren sollten!«
Jan streckte ihr seine kräftige Hand hin. »Schlagen Sie ein! Sie machen einen guten Deal.«
»Sie aber auch«, lachte die alte Dame. »Sie wissen schon, dass sich die Presse darauf stürzen wird, wenn die denken, die Tochter Ludwig Dehns werde aus dem Nähkästchen plaudern.«
»Ich kann nicht leugnen, dass ich mir eine gewisse PR davon verspreche«, gab Jan übertrieben zerknirscht zu.
»Nun langen Sie zu. Das müssen wir feiern. Den Chocolate Mud Cake habe ich selbst gemacht. Das Rezept habe ich noch aus Neuseeland.«
»Heißt das ›Ja‹?«
»Wollen Sie es schriftlich?«
»Nicht nötig«, erwiderte Jan und ließ sich ein riesiges Stück der Köstlichkeit aus Schokolade auf den Teller legen. »Darf ich Sie etwas fragen?«
Dorothee nickte und folgte seinem Blick, der auf das Portrait geheftet war.
»Sie wollen jetzt wissen, wer das Kind auf meinem Arm ist, oder?«
»Wenn Ihnen die Frage zu persönlich ist, dann verzeihen Sie meine Neugier.«
»Ich halte Sie nicht für eine Plaudertasche. Es ist meine Tochter Helen.«
Jan wäre vor Schreck beinahe das Stück Kuchen von der Gabel gefallen, das er sich gerade genüsslich in den Mund schieben wollte.
»Ihre Tochter? Waren Sie denn, ich meine, waren Sie etwa mal …?«
»Ja, das auch! Ich war auch einmal verheiratet. Aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Sache damit auf sich beruhen lassen könnten, denn erstens ist das keine schöne Geschichte, und zweitens würden wir dann noch morgen früh hier sitzen.«
»Was ich durchaus in Kauf nehmen würde«, entgegnete Jan. »Sie können sicher sein, dass ich diese Information für mich behalte und Ihre Schweigsamkeit durchaus respektiere. Es geht mich ja auch gar nichts an. Sie haben schon so viel für mich getan. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll.«
»Eine blitzsaubere Fassade würde genügen.«
Jan nickte verlegen. Er wollte sich auf keinen Fall anmerken lassen, wie ihn diese Information überraschte und dass es ihn überdies brennend interessierte, wie die alte Dame wohl zu einem Maori-Kind gekommen war. Sein Blick blieb an ihren grünen Augen hängen. Sie sah ihrem Vater ähnlich. Ludwig Dehn war ein durch und durch norddeutscher Typ Mann gewesen, jedenfalls, soweit es auf den Fotografien, die von ihm im Museum existierten, zu erkennen war. Wahrscheinlich ist ihr Ehemann ein Maori gewesen, folgerte Jan schließlich.
Dorothee beobachtete belustigt, wie es im Kopf des Kurators zu arbeiten schien.
»Gut, eins noch, damit Sie nicht vor ungestillter Neugier vergessen, den Schokokuchen zu essen.«
Jan fühlte sich ertappt, und schnell schob er sich den Bissen in den Mund.
»Meine Mutter Merima war eine Maori, was Ihnen hiermit das zweite der beiden Bilder erklärt, das sie in ihrer ganzen Schönheit zeigt.«
»Sie ist wirklich wunderschön, aber sie hat auch europäische Züge, nicht wahr?«
»Herr Gerken, ich werde Ihnen jetzt nicht meine gesamte Familiengeschichte erzählen. Also, wann muss ich diese Rede halten?«
Um sein Erstaunen zu überspielen, griff Jan geschäftig in seine Aktentasche und holte die Mappe mit den Unterlagen für die Wiedereröffnung des Versammlungshauses hervor.
»Wir haben den April ins Auge gefasst«, erklärte er hastig. »Aber was den Tag angeht, werden wir das selbstverständlich mit Ihnen absprechen. Es fehlen bislang ein paar Dinge, die noch nicht in Deutschland eingetroffen sind.« Er blätterte seine Zettel durch und zeigte ihr diverse Fotos von Paua-Muscheln, Holz und Bambus.
»Wir erwarten eine große Lieferung dieser Haliotisschalen für die Augen unserer Figuren auf den Schnitzpaneelen. Da hat es doch in den letzten Jahren einigen Schwund gegeben. Manche Leute können einfach nicht widerstehen und klauen sie. Und wir lassen jetzt auch eine richtige Umzäunung bauen, damit es so wirkt, als habe das Haus einen echten Vorplatz, wie es ja normalerweise in Wirklichkeit der Fall ist. Wann haben Sie das Haus zum letzten Mal besucht?«
»Das ist Jahrzehnte her«, seufzte Dorothee. »Seit meiner Rückkehr aus Neuseeland gar nicht mehr. Ich wollte nicht an das Land erinnert werden, in dem …« Dorothee unterbrach sich hastig. »Und was werden Sie noch ändern?«
»Wir werden das Haus aus der Dunkelheit holen. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass es hinter dem schwarzen Hintergrund wie ein Kunstobjekt wirkte. Unsere Maori-Fachleute fanden, es müsse eine natürliche Umgebung bekommen. Wir nehmen die Verkleidung vom Dachfenster der Halle, sodass Tageslicht einfällt. Und mittels unserer Lichtdesigner schaffen wir verschiedene Stimmungen. Sogar einen Sonnenuntergang können wir dann simulieren.« Jan sprach mit solcher Begeisterung über das Versammlungshaus, dass sie selbst Dorothee ansteckte.
»Das hört sich alles wirklich gut an. Ach, vielleicht tut es mir auch gut, wenn ich an dem Tag dabei bin.«
»Und ob. Es wird ein festliches Ritual geben, und wir haben jede Menge Zusagen von Maori-Freunden. Und wenn wir es schaffen, machen wir noch eine kleine Sonderausstellung zur Maori-Kunst. Ein paar Masken werden auf jeden Fall zu sehen sein.«
»Sie können übrigens auch aus dem Keller nehmen, was Sie wollen. Der ist voll mit Dingen, die mein Vater damals mit nach Deutschland hat verschiffen lassen. Da sollten wir vielleicht gleich mal gemeinsam in die Katakomben steigen.«
Jan musterte die alte Dame mit einer Mischung aus Freude und grenzenloser Überraschung. Niemals hätte er gewagt, sie um die legendären Ausstellungsstücke aus dem Besitz ihres Vaters zu bitten. Kein Mensch hatte je einen Blick auf die Artefakte geworfen. Man erzählte sich hinter vorgehaltener Hand von den prächtigsten Stücken, die Ludwig nicht dem Museum geschenkt hatte wie das Haus Hinemoa.
»Es ist ein Segen für uns, dass Sie die Eröffnungsrede halten, die wir dann hoffentlich den neuseeländischen Kollegen in englischer Übersetzung zukommen lassen dürfen, oder?«, stieß Jan begeistert aus.
»Meinetwegen, ich kann die Rede auch gern gleich auf Englisch halten. Aber was sollte die Neuseeländer interessieren, was die Tochter von Ludwig Dehn über die Schönheit des Hauses Hinemoa zu sagen hat?«
Jan runzelte die Stirn. »Es ist weniger die Schönheit des Hauses Hinemoa, die die Kollegen interessiert, als vielmehr die Umstände, wie Ihr Vater das Haus von Neuseeland nach Deutschland gebracht hat.«
»Ach, diese alten Geschichten. Ich weiß, dass man in Auckland immer wieder munkelt, er habe das Verschiffen des Versammlungshauses am Gesetz vorbei betrieben, aber das ist Unsinn und interessiert doch heute, über achtzig Jahre später, nun wirklich keinen mehr.«
»Das würde ich nicht sagen. Gerade ist im New Zealand Herald ein Artikel erschienen, der Ihren Vater ziemlich unverblümt als Dieb wertvollen Kulturguts darstellt.«
Dorothees Stirnader schwoll gefährlich an. »Wer behauptet das?«
Jan zog aus dem Stapel die Kopie des Artikels hervor und reichte ihn der alten Dame.
Sie überflog den Text und fluchte dabei auf Englisch. Dann blieb ihr Blick an dem Foto der Autorin mit der Bildunterschrift Sarah Williams hängen.
Jan konnte förmlich dabei zusehen, wie Dorothee Dehn sämtliche Farbe aus dem Gesicht wich.
»Das ist doch, nein, das gibt es nicht, das …« Sie hob den Blick, und Jan erschrak. Sie sah aus, als hätte sie einen Geist gesehen. »Kann ich das behalten?«
»Sicher, natürlich, aber das sollte Sie wirklich nicht erschüttern, sondern eher ermutigen, unseren Gästen die wahre Geschichte zu präsentieren. Wir haben sogar die Originalkaufverträge im Museum. Vielleicht sollten wir sie der eifrigen Dame einmal zur Ansicht schicken? Wie hieß sie noch gleich?«
Jan wollte nach dem Artikel greifen, doch Dorothee zog ihn energisch weg. »Nicht nötig! Was geht uns deren Geschwätz an?« Mit diesen Worten sprang sie abrupt von ihrem Freischwinger auf, den Artikel immer noch fest in der Hand. »Es war sehr nett, dass Sie mich besucht haben. Wir kriegen das schon hin. Alles andere können wir ja telefonisch besprechen.«
Jan sah sie fassungslos an. Das kam einem Rausschmiss gleich, und was war mit der versprochenen Besichtigung der Artefakte im Keller? Seufzend fügte sich Jan ihren Anordnungen, packte seine Unterlagen zusammen und erhob sich ebenfalls. Da hielt Dorothee ihm auch schon die Tür des Salons auf. »Danke für Ihren Besuch!«, murmelte sie.
»Ich danke Ihnen«, erwiderte Jan höflich, während er sich fragte, was die alte Dame wohl so sehr aus dem Tritt gebracht haben könnte.
In der Haustür drehte er sich noch einmal um. »Und wann kann die Firma bei Ihnen anfangen?«
»Wie? … Was? … Womit?«
Sie ist ja völlig durcheinander, dachte Jan.
»Ich meine, wann kann mit der Restaurierung Ihrer Fassade begonnen werden? Bei Frost sollte man vielleicht davon absehen, wobei es neuerdings auch Farben gibt, die man bis 20 Grad minus anwenden kann.«
»Ja, ja, da rufen Sie mich am besten an. Meine Nummer haben Sie ja!«
Jan kämpfte noch mit sich, ob er sie nicht doch an den gemeinsamen Gang in den Keller erinnern sollte, aber da hatte Dorothee die Tür hinter ihm bereits ohne ein weiteres Wort des Abschieds geschlossen.
Die Hand, in der Dorothee den Artikel aus dem Herald hielt, zitterte leicht, als sie in den Salon zurückkehrte. Sie ließ sich auf einen Stuhl fallen, weil ihr die Knie ein wenig weich waren, und sie ließ ihren Blick immer wieder kopfschüttelnd zwischen dem Portrait, das sie als junge Mutter darstellte, und dem Foto von Sarah Williams schweifen. Die Ähnlichkeit war mehr als frappierend. Wenn nicht der kleine Leberfleck unter dem rechten Auge der Autorin gewesen wäre, hätte man es eventuell noch für einen Zufall halten können, aber so? Dorothees Hand wanderte zu ihrem eigenen Leberfleck an derselben Stelle. Das ist doch nicht möglich, dachte sie, und wusste zugleich, dass es keinen Zweifel gab. Diese Sarah Williams musste mit ihr verwandt sein. Und schließlich wäre es kein Weltwunder, wenn sie dort drüben am anderen Ende der Welt eine Enkeltochter hätte. Helens Tochter? Dorothees Atem ging stoßweise. Mit einem Mal kam ihr die ganze alte Geschichte hoch, der schmerzhafte Teil ihres Lebens, den sie zumindest in den letzten Jahren mühsam zu verdrängen versuchte, weil der Gedanke daran ihr schier das Herz brechen wollte. Nie würde sie den Tag vergessen, als sie gezwungen worden war, ihre Tochter im fernen Neuseeland zurückzulassen. Und daran, wie oft sie ihr Versprechen, aus Helens Leben für alle Ewigkeit zu verschwinden, gebrochen hatte. Sie hatte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um herauszubekommen, wo das Mädchen war, nachdem es volljährig geworden war, aber vergeblich. Die Spuren hatte Tom gründlich verwischt. Und mit Sicherheit hatte er seine Drohung wahrgemacht und Helen vorgelogen, ihre Mutter sei tot.
Wieder heftete sich ihr Blick auf das Portrait. Ihr war nur dieses Bild geblieben, das sie damals unter abenteuerlichen Umständen aus dem Haus geschmuggelt hatte. Nur dank der guten Harere, die bei ihrem Leben hatte schwören müssen, Dorothee niemals nach Deutschland zu schreiben. Tom hatte sie vor die Wahl gestellt: Helen als Kindermädchen zu betreuen oder das Haus auf Nimmerwiedersehen zu verlassen. Dorothee selbst hatte sie angefleht, bei dem Baby zu bleiben, statt Loyalität ihr gegenüber zu beweisen.
Stumme Tränen rannen über Dorothees Wangen. Es tat immer noch so unendlich weh. Daran konnten auch über fünfzig Jahre nichts ändern!
Zärtlich strich sie mit den Fingern über das Foto ihres Ebenbildes, und ganz plötzlich verwandelte sich die Trauer in Hoffnung. War das nicht die Spur, nach der sie jahrzehntelang so verzweifelt gesucht hatte? Wenn diese Sarah wirklich ihre Enkelin war, dann würde sie doch wissen, wo Helen heute lebte. Ein Beben durchlief Dorothees schmalen Körper. Sie fror entsetzlich. Wenn dem so war, hatte Sarah ihren eigenen Urgroßvater Freveltaten bezichtigt, die er niemals begangen hatte. Wenn sie ihre Enkelin war, hatte sie dann nicht ein Recht zu erfahren, warum das Versammlungshaus bei Nacht und Nebel auf das Schiff verfrachtet worden war?
Schwerfällig stand Dorothee auf, ging zur Anrichte und zog ein altes Büchlein hervor. Sie hatte die Aufzeichnungen ihrer Mutter Merima erst vor ein paar Monaten beim Aufräumen in einem der Räume des weit verzweigten Kellers gefunden. Und was sie da hatte lesen müssen, war spannender als jeder Kriminalroman und zugleich erschütternd bis ins Mark. Dorothee hatte nach der Lektüre den Entschluss gefasst, die wahre Geschichte niemals weiterzugeben, sondern das Heft eines Tages zu verbrennen, damit es nach ihrem Tod nicht in die falschen Hände geriet. Natürlich hätte sie es lieber Helen zukommen lassen, aber das war ihr ja nicht machbar erschienen. Bis eben gerade. Helen und ihre Tochter hatten ein Recht, die Wahrheit zu erfahren!
Entschlossen verließ Dorothee den Salon und suchte ihr Arbeitszimmer auf. Dort stand ein Computer, der sie an einsamen Tagen mit dem Rest der Welt verband, zumindest mit Lucy, ihrer englischen Freundin, mit der sie eine unbeschwerte Jugend in London verbracht hatte. Lucy war die Tochter von Susan, der besten Freundin ihrer Mutter gewesen. Lucy und sie hatten auch nach Dorothees und Ludwigs Rückkehr nach Hamburg Kontakt gehalten. Sie hatten sich täglich Briefe geschrieben und einander besucht. Lucy war gemeinsam mit ihrer Mutter Susan zu Ludwigs Beerdigung nach Hamburg gekommen und hatte dann später, nach Dorothees dramatischer Rückkehr aus Neuseeland, sogar für mehrere Wochen mit ihrem Baby in Hamburg gewohnt und ihr in jenen düsteren Wochen beigestanden.
Ja, und ich habe ihr das Leben zu verdanken, dachte Dorothee, denn hätte Lucy mich damals, als die Nacht am düstersten gewesen war, nicht rechtzeitig im Keller gefunden, wer weiß, ob mein Versuch, meinem Leben ein Ende zu bereiten, nicht doch geglückt wäre … Es fiel Dorothee sehr schwer, jenen Tag nicht sofort wieder zu verdrängen, als sie in ihrer Verzweiflung wegen des Verlusts ihrer Tochter Tabletten geschluckt hatte. Mit achtzig Jahren war Lucy dann nach Kanada zu ihrer Tochter gezogen. Dorothee hatte sie angefleht, zu ihr in die Villa zu ziehen, aber Lucy wollte partout nicht, dass ihre Freundin sie womöglich eines Tages pflegen musste, denn es war gerade eine Parkinson-Erkrankung bei ihr diagnostiziert worden. Die beiden Freundinnen aber hatten sich, seit es Mails gab, täglich eine kurze Nachricht geschickt. Bis Dorothee vor ein paar Wochen Lucys Todesanzeige erhalten hatte. Seitdem war sie nicht mehr am Rechner gewesen. Doch nun würde sie ihn noch einmal bemühen müssen. Es war ein Leichtes, die E-Mail-Adresse des New Zealand Herald herauszufinden. Ihre Hände zitterten, als sie die knappen Zeilen auf Englisch tippte, die sie sich mehrmals laut vorlas, bevor sie die Nachricht abschickte.
Liebe Miss Williams, ich bin Dorothee Dehn aus Hamburg. Mein Vater war Ludwig Dehn, und ich habe Ihren Artikel über ihn gelesen. Ich möchte Sie dringend bitten, mich anzurufen. Es ist sehr wichtig! 004940896337 Dorothee Dehn.
Schließlich verließ sie das Arbeitszimmer und kehrte in den Salon zurück. Dort goss sie sich ein Glas Rotwein ein. Ein kräftiger Schluck erwärmte wohltuend ihren vor innerer Kälte bebenden Körper. Zögernd griff sie zu dem Tagebuch ihrer Mutter. Was ihr das Leben auch an Schicksalsschlägen zugemutet hatte, eines hatte ihr selbst Tom nicht nehmen können. Die Sicherheit, dass sie das Kind einer ganz großen Liebe war. Dorothee wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel, als sie die Worte, die sie inzwischen beinahe auswendig kannte, förmlich verschlang, als wäre es das erste Mal.
Auckland, 8. Dezember 1929
Kann es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick wirklich geben? Seit dieser deutsche Forscher im Museum aufgetaucht ist, befürchte ich: ja. Aber für mich darf es dergleichen nicht geben, denn ich werde Tames Frau. Ich habe es Vater auf dem Totenbett versprochen. Und diesen heiligen Schwur darf ich nicht brechen. Niemals!
RUSSELL, DEZEMBER 2013
Das aus über dreißig Kehlen laut gegrölte Happy Birthday der Geburtstagsgesellschaft schallte durch die Sommernacht wie Fangesang. Wahrscheinlich kann man es bis hinüber nach Paihia hören, dachte Sarah und hob ihr Glas. Sie fühlte sich leicht und unbeschwert. So schlimm, wie sie befürchtet hatte, war es gar nicht, dreißig zu werden. Im Kreis ihrer Freunde war dieser Abend zu einem rauschenden Fest geworden. Auf der Terrasse und im Garten wurde wild getanzt und viel getrunken. Bis vor ein paar Sekunden. Bis Mitternacht, denn nun wurde es ernst … was die Freunde mit ihrem Gesang untermalten.
Raiwiris Hände legten sich von hinten zärtlich um ihre Taille. Er gab ihr einen Kuss in den Nacken, und sie war in diesem Augenblick rundherum glücklich. Die letzten Monate zogen wie ein schnell laufender Film an ihr vorbei. Was wollte sie mehr? Sie hatte endlich einen wunderbaren Mann gefunden, den jungen Maori-Anwalt, und hatte gerade für ihren viel beachteten Artikel über illegal ins Ausland verbrachte Maori-Schätze einen Nachwuchspreis gewonnen. Während ihre Maori-Freunde Ra Whanau Ki A Koe, die Maori-Variante von Happy Birthday, zum Besten gaben, huschte ein winziger Schatten über Sarahs Gesicht. Ihre Adoptiveltern hatten den weiten Weg von der Südinsel bis in die Northlands nicht antreten können, denn ihr Vater John war nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt. Aber Jane hatte ihr ein Paket geschickt. Die Ausgelassenheit ihrer Freunde, die sie nun einzeln herzten und küssten, ließ Sarahs Sorge um die beiden geliebten Menschen in den Hintergrund treten.
Auf dem Tisch türmten sich mittlerweile die Geschenkberge, obwohl Sarah sich gewünscht hatte, dass die Freunde spenden sollten, aber daran hatte sich kaum jemand gehalten.
Als der Ansturm der Gratulanten verebbt war, fiel ihr ein, dass sie Raiwiri völlig vergessen hatte. Ihm hätte der erste Kuss zugestanden, doch er schien wie vom Erdboden verschwunden.
»Hat jemand Raiwiri gesehen?«, rief sie in die Runde. Täuschte sie sich, oder versuchten ihre Freunde, ein wissendes Grinsen zu verbergen, während sie eifrig die Köpfe schüttelten. Und da sah sie Raiwiri bereits aus der Terrassentür treten, in den Händen eine Torte mit funkelnden Wunderkerzen. Er strahlte über das ganze Gesicht.
Sarah fühlte die Liebe für diesen hochgewachsenen Mann in jeder Pore. Er war eine Mischung aus einem Pakeha, wie die Maori die Weißen nannten, und einer Maori. Die Figur und die Gesichtszüge hatte er von seinem schottischstämmigen Vater, das schwarze dicke Haar von seiner Mutter. Sarah würde nie vergessen, wie sie sich kennengelernt hatten. Sie hatte ihn interviewt, weil er ein bekannter Anwalt in Sachen Maori-Schätze in aller Welt war und immer wieder in die Schlagzeilen geriet, wenn er Museen auf Herausgabe bestimmter Artefakte verklagte. Während des Interviews hatte förmlich die Luft gebrannt, und es war Sarah nachträglich nicht klar, wie sie es geschafft hatte, daraus noch einen halbwegs anständigen Artikel zu machen. Seitdem waren sie unzertrennlich.
Sarah hatte geahnt, dass er ihr eines Tages einen Antrag machen würde, doch als er jetzt mit der Torte in der Hand vor ihr auf die Knie ging und sie in der Mitte der Torte einen mit Brillanten besetzten Ring funkeln sah, wusste sie, dass der Augenblick gekommen war. Ihr Herz klopfte bis zum Hals.
»Willst du meine Frau werden?«, fragte Raiwiri mit seiner tiefen Stimme.
»Ja«, hauchte Sarah, wischte sich eine Träne der Rührung aus dem Augenwinkel und ließ sich von Raiwiri den Ring anstecken. Er passte wie angegossen. Sarah lächelte in sich hinein. Jetzt konnte sie sich das plötzliche Verschwinden des einfachen Ringes erklären, den sie sonst trug. Sie küssten sich.
Hochrufe ertönten von allen Seiten, und die Band spielte Pōkarekare ana.
»Sarah, Sarah!«, riefen die Frauen im Chor. Raiwiri hielt seine Braut fest im Arm und flüsterte: »Machst du es für mich?«
Sarah schenkte ihm ein liebevolles Lächeln, löste sich aus seiner Umarmung und schwebte wie auf Wolken zu der im Garten errichteten Bühne. Die Band verstummte, als das Geburtstagskind ans Mikrofon ging.
»Offenbar bin ich die Einzige, die nicht geahnt hat, was heute noch alles auf mich zukommt. Aber einen schöneren Augenblick hätte sich Raiwiri nicht aussuchen können«, sagte Sarah gerührt, was ihr euphorische Zustimmung von allen Seiten bescherte. Glücklich ließ sie ihren Blick über die Geburtstagsgesellschaft schweifen. Alle waren sie aus Auckland gekommen, um mit ihr zu feiern. Ihre beste Freundin Margit, ihre Lieblingskollegin Anne, ihr Chef Jerry. Sie waren allesamt ihrer Einladung in das Wochenendhaus von Raiwiris Familie gefolgt, und die meisten würden in einem großen Zelt im Garten übernachten, weil es im Haus bei Weitem nicht so viele Schlafplätze gab. Und für eine Tagesreise lag Russell zu ablegen. Fast drei Stunden fuhr man von Auckland in den subtropischen Norden.
Sarah gab der Band ein Zeichen, das Maori-Liebeslied noch einmal anzustimmen, damit sie es vortragen konnte.
»Für Raiwiri«, hauchte sie mit erotischem Timbre ins Mikro und warf ihrem Verlobten eine Kusshand zu, bevor sie zu singen begann. Sie hatte eine volle Altstimme und gab das Lied auf Maori zum Besten. Obwohl ihre Adoptiveltern weiße Farmer waren, kannte sie alle nur erdenklichen Maori-Lieder. Jane hatte ihr zu ihrem sechsten Geburtstag ein altes zerlesenes Liederbuch geschenkt. Wie oft hatte sich Sarah schon gefragt, wem das wohl einmal gehört haben mochte. Ihre leiblichen Eltern waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als Sarah ein Säugling gewesen war. Mehr wusste Jane, ihre Adoptivmutter, angeblich nicht über die beiden. Etwas, woran Sarah, je älter sie wurde, zunehmend größere Zweifel hegte. Nicht zuletzt, weil Jane sie immer wieder zu Festtagen mit edlem Schmuck und Kleidungsstücken überraschte, die nicht neu waren, sondern mit Sicherheit schon einmal von jemandem getragen worden waren. Und bestimmt nicht von Jane, die Sarah zeitlebens nur in Gummistiefeln, abgewetzten Jeans und Pullovern gesehen hatte. Letztere pflegte sie auch zu Festen wie Weihnachten zu tragen, dann allerdings mit einem Paar Turnschuhen. Nein, diese teils filigranen Stücke konnten unmöglich von der handfesten praktischen Jane stammen. Doch jeder Frage, woher sie diese Kostbarkeiten hatte, wich Jane aus. Diese Gedanken gingen Sarah durch den Kopf, während sie für Raiwiri voller Inbrunst das Liebeslied sang. Ich sollte an ihn denken und an all das Schöne und nicht an das, was im Dunklen liegt, dachte Sarah und verscheuchte die Spekulationen wie lästige Fliegen. Nun war sie ganz bei der Sache und suchte Raiwiris Blick. Er stand direkt vor der Bühne und sah sie aus seinen großen schwarz-braunen Augen voller Liebe an.
Als der letzte Ton verklungen war, herrschte Totenstille in der Sommernacht. Bis Sekunden später frenetischer Jubel losbrach. Sarah verbeugte sich und wollte die Bühne verlassen, doch alle Gäste riefen: »Zugabe!« Sarah zierte sich nicht lange, sondern flüsterte dem Bandleader etwas ins Ohr. Und dann sang sie zusammen mit der Band das Wiegenlied: Hine e Hine. Das hatte Jane oft gemeinsam mit ihr gesungen.
Nach dem Song kletterte Sarah hastig von der Bühne. Der Sinn stand ihr nach einem Mai Tai. Raiwiri konnte offenbar Gedanken lesen. Er hielt schon ein Glas für sie bereit. Nachdem sie es ziemlich schnell hinuntergestürzt hatte, fühlte sie einen kleinen Rausch, aber einen von der angenehmen Sorte. Kein Gefühl von Kontrollverlust, sondern von absolutem Wohlbefinden gepaart mit dem Bedürfnis, die ganze Welt zu umarmen.
Es war eine wunderbar laue Nacht, für eine Gartenparty wie geschaffen. Sarah tanzte, trank und amüsierte sich, bis sich alle – bis auf Raiwiri – schlafen gelegt hatten. Das war irgendwann gegen 6 Uhr morgens, denn die Sonne ging bereits auf. Sarah und Raiwiri sahen sich das Schauspiel der Natur an und machten sich danach noch daran, die gröbsten Spuren des rauschenden Festes zu beseitigen.
Die Geschenke würde sie später auspacken, nachdem sie auch ein paar Stunden geschlafen hatte. Nur das Paket ihrer Adoptivmutter nahm sie mit ins Schlafzimmer. Als ihr Blick auf ihren Rechner fiel, war sie doch neugierig, wer ihr noch so alles gratuliert hatte. Sie überflog die Nachrichten und blieb an einer hängen. Sie kam von der Zeitung. Jetzt erinnerte sie sich wieder. Ihr Chef hatte diese Mail vorhin beim Tanzen erwähnt, weil sie bei ihm gelandet war und er sie an Sarah weitergeleitet hatte. Wenn sie nicht über den Namen Dehn gestolpert wäre, sie hätte bis Montag gewartet, aber die Namensgleichheit mit dem Forscher Ludwig Dehn machte sie neugierig. Die Nachricht war kurz, und dennoch ließ sie ihr Herz schneller schlagen.
Liebe Miss Williams, ich bin Dorothee Dehn aus Hamburg. Mein Vater war Ludwig Dehn, und ich habe Ihren Artikel über ihn gelesen. Ich möchte Sie dringend bitten, mich anzurufen. Es ist sehr wichtig! 004940896337 Dorothee Dehn.
»Ach, du Schreck, jetzt will sie ihren Vater rehabilitieren. Das kannst du gleich löschen.« Sarah fuhr herum. Sie hatte Raiwiri gar nicht kommen hören. Er stand hinter ihr und blickte ihr über die Schulter. Das konnte sie gar nicht leiden. Es gab nicht viel, was sie an Raiwiri störte, nur die Art, wie er sich manchmal lautlos anpirschte und ihre Nachrichten in Handy und Rechner mitlas. Nicht dass sie etwas zu verbergen hatte, aber es störte sie trotzdem. Wie oft hatte sie ihm schon gesagt, er solle sich nicht so anschleichen. Raiwiri konnte ihren Unmut gar nicht verstehen. »Du hast doch keine Geheimnisse vor mir, oder?«
»Darum geht es nicht«, pflegte sie dann zu erwidern. »Ich mag es nur nicht, wenn du meine Nachrichten liest, ohne dass ich dich dazu aufgefordert habe.«
Darauf reagierte Raiwiri jedes Mal verschnupft. Wenn es nach ihm gehen würde, würden sie wirklich alles miteinander teilen. Sarah war in diesem Punkt weitaus abgegrenzter. Sie brauchte ihren Freiraum und hätte Raiwiri nicht schwören können, dass sie niemals ein Geheimnis vor ihm haben würde. Allein, wenn Freundinnen ihr ihr Leid klagten. Was ging das ihren Partner an?
Entsprechend sauer war sie in diesem Moment. Was fiel ihm ein, ihr vorzuschreiben, diese Mail zu löschen?
»Nein, das werde ich nicht tun! Die Mail löschen! Ich bin Journalistin und werde sehr wohl hören, was die Dame mir zu sagen hat.«
Raiwiri stöhnte genervt auf. »Ich finde es völlig überflüssig, dass du dir das antust. Es gibt doch keinen Zweifel, dass Ludwig Dehn das Haus Hinemoa am Gesetz vorbei bei Nacht und Nebel hat verschiffen lassen. Die Papiere sind eine Fälschung. Wer weiß das besser als du? Lies deinen Artikel! Also, was soll sie dir schon erzählen wollen? Dass ihr Vater ein Heiliger war?«
»Ach, Schatz, es stört mich einfach, wie du deine Nase ständig ungefragt in meine Angelegenheiten steckst!«
»Aber als Quellenlieferant für deine Artikel konnte ich gar nicht dicht genug an der Materie sein!« Da war er wieder: Sein gekränkter Unterton, wenn sie ein klein bisschen mehr Distanz einforderte.
»Ich will dich nicht ausschließen. Aber lass mich erst mal selbst darüber nachdenken. Vielleicht gefällt der Dame mein Artikel, und sie liefert mir den Beweis, dass ihr Vater das Versammlungshaus bei Nacht und Nebel nach Deutschland hat verschiffen lassen, so wie ich es behaupte.«
»Blödsinn! Wir beide kennen die Wahrheit über die Geschichte des Hauses Hinemoa. Das Haus gehört hierher und nicht nach Deutschland. Ja, wenn du es genau wissen willst, es passt mir einfach nicht, dass du überhaupt mit dieser Dame kommunizierst. So, das musste einmal gesagt werden!«
Sarah atmete einmal tief durch. Sie wollte unbedingt einen Streit zum Abschluss dieser traumhaften Nacht vermeiden. Also klappte sie ihren Rechner zu und wandte sich ihrem frisch gebackenen Verlobten zu.
»Ich habe eine bessere Idee, wie wir dieses Fest abschließen können«, raunte sie, nahm ihn bei der Hand und zog ihn auf das Bett. Sie liebten sich kurz und leidenschaftlich. Raiwiri schlief danach gleich in ihrem Arm ein, und Sarah widerstand ihrem Bedürfnis, noch einmal aufzustehen und Janes Paket zu öffnen.
Als Sarah aufwachte, war alles still. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihr, dass sie nur eine Stunde geschlafen hatte. Und um acht Uhr war noch keiner der Gäste wach. Vorsichtig schälte sie sich aus der engen Umarmung mit Raiwiri und ging zu ihrem Schreibtisch. Erneut las sie die Mail aus dem fernen Deutschland. Sie recherchierte im Internet, wie spät es wohl in Hamburg war. Zwölf Stunden früher, also 20 Uhr 10 Samstagabend.
Sie konnte gar nichts dagegen tun. Ihre journalistische Neugier trieb sie geradezu zum Telefon. Vorsichtig nahm sie den Apparat aus der Halterung, tippte die Nummer ein und verschwand damit auf die Terrasse. Nicht dass Raiwiri gerade in dem Augenblick aufwachte, in dem sie die fremde Frau am Telefon hatte.
»Dorothee Dehn«, meldete sich eine Stimme, die erstaunlich jung klang. Sie hatte geschätzt, dass die Tochter des Forschers weit über achtzig sein würde.
»Hier spricht Sarah Williams. Sie haben mir eine Mail an den Herald geschickt mit der Bitte um Rückruf.« Sie sagte das in fehlerfreiem Deutsch, denn diese Sprache hatte sie schon in der Schule gelernt. Ihr Adoptivvater hatte deutsche Vorfahren und auf den Deutschunterricht gedrungen, und Sarah hatte nicht nur Spaß an dieser Sprache mit den auffällig vielen gutturalen Lauten gefunden, sondern war auch äußerst erfolgreich beim Lernen gewesen, als wäre ihr die Begabung in die Wiege gelegt worden.
Die Antwort der Dame am anderen Ende der Leitung war ein lang gezogener Seufzer. Dann herrschte Schweigen.
»Frau Dehn? Sind Sie noch dran?«, fragte Sarah verunsichert nach.
»Ja … ich … ich hatte nur nicht erwartet, dass Sie sich so schnell melden. Ich … ja, ich … also ich habe eine sehr persönliche Frage an Sie.«
»Es geht sicherlich um meinen Artikel über Ihren Vater, nicht wahr?«
»Das auch«, erwiderte Dorothee. »Aber in erster Linie bin ich an dem Namen Ihrer Mutter interessiert.«
»Meiner Mutter?« Sarahs Herz krampfte sich zusammen.
»Ja, ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber ich habe Ihr Foto in der Zeitung gesehen, und da kam mir ein ungeheuerlicher Gedanke, dass Sie Helens Tochter …«
»Meine Mutter heißt Jane«, entgegnete Sarah rasch.
»Oh, dann habe ich mich wohl geirrt. Das tut mir leid. Ich war mir so sicher. Wegen des Leberflecks.«
»Leberfleck?«
»Sie haben doch einen Leberfleck unter dem rechten Auge, oder?«
»Ja, habe ich, aber den kann ich nicht von meiner Mutter geerbt haben, ich …« Sarah kämpfte kurz mit sich, ob sie der Fremden die Wahrheit anvertrauen sollte. »Jane hat mich adoptiert«, gab sie schließlich seufzend zu.
»Habe ich’s doch geahnt!«, erwiderte die fremde Dame aus Deutschland triumphierend.
»Was haben Sie geahnt?«, fragte Sarah unwirsch. Der vertrauliche Ton der Fremden missfiel ihr.
»Heißt Ihre leibliche Mutter vielleicht Helen?«
»Keine Ahnung!« Sarah stieß einen tiefen Seufzer aus. Was in aller Welt wollte diese Frau von ihr?
»Was heißt, keine Ahnung? Sie werden wohl den Namen Ihrer Mutter kennen! Und wieso wurden Sie adoptiert? Was ist mit Ihrer Mutter? Wo ist sie? Und sie heißt Helen, oder?« Die Stimme der Dame klang plötzlich flehend. Sarah wurde immer unwohler bei diesem Gespräch. Am liebsten hätte sie aufgelegt, aber ihre berufsmäßige Neugier siegte.
»Nun reden Sie schon! Was ist mit Ihrer leiblichen Mutter geschehen?«
»Meine Eltern sind tödlich verunglückt, als ich ein Baby war.«
Täuschte sich Sarah, oder kämpfte die Dame am anderen Ende der Welt mit den Tränen?
»Oh, mein Gott, Helen«, stieß die Frau nun hervor. Und immer wieder »Oh, mein Gott, Helen«.
Sarah wusste gar nicht so recht, wie sie auf diesen Gefühlsausbruch der Fremden reagieren sollte.
»Nun beruhigen Sie sich. Ich weiß gar nichts über meine Mutter. Wahrscheinlich liegt hier ein Irrtum vor. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dass meine Mutter Helen hieß?«
»Der Leberfleck unter dem Auge, und dann Ihr Bild, das kann kein Zufall sein. Sie sind mir wie aus dem Gesicht geschnitten …«
Sarah empfand nun eher Mitleid mit dieser Dorothee Dehn. Wie konnte sie von einem Leberfleck auf eine Verwandtschaft schließen? Das war doch mehr als an den Haaren herbeigezogen.
»Hören Sie. Selbst, wenn ich Ihnen helfen wollte, ich könnte nicht. Meine Mutter, also Jane, weiß nichts über meine Eltern. Rein gar nichts!«
»Fragen Sie sie! Bitte!«
»Nein! Mein Vater hatte gerade einen Schlaganfall, da werde ich Jane ganz bestimmt nicht mit Fragen nach meinen leiblichen Eltern löchern. Es tut mir leid. Ich glaube, Sie sind auf der falschen Fährte. Außerdem habe ich Eltern! Verstehen Sie? Eltern, die ich über alles liebe. Auf Wiedersehen, Mrs. Dehn.«
Sarah wollte gerade auflegen, als sie die Dame aus Deutschland flehen hörte: »Eine einzige Frage noch. Bitte!«
»Gut«, seufzte Sarah.
»Sind Ihre Adoptiveltern Pakeha oder Maori?«
»Janes Vorfahren sind Schotten, Johns Deutsche, aber nun verraten Sie mir bitte, warum Sie das wissen wollen.«
»Entschuldigen Sie. Ich bin völlig durcheinander. Das geht mich wirklich nichts an. Ich wollte Ihnen nicht zu nahetreten, aber ich dachte, ich hätte endlich eine Spur zu meiner Tochter gefunden. Verzeihen Sie mir. Das mit dem Leberfleck war wohl ein Zufall, aber es wäre zu schön, wenn ich am Ende meines Lebens …«
Sarah hörte nur noch ein leises Schluchzen und atmete ein paarmal tief durch, weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Als sie sich wieder gefangen hatte, hatte die Dame am anderen Ende bereits aufgelegt.
»Schatz, hast du einen Geist gesehen?«, hörte Sarah von ferne Raiwiris besorgte Stimme.
»Ich … ich habe diese Frau Dehn in Hamburg angerufen, und sie stellte mir Fragen nach meiner leiblichen Mutter. Ob sie Helen hieß …«
Raiwiri kniete sich vor ihren Stuhl und nahm ihr das Telefon aus der Hand.
»Du konntest es also doch nicht lassen!«, bemerkte er ärgerlich. »Hätte ich es dir noch deutlicher sagen müssen, dass ich diese Kontaktaufnahme deinerseits nicht wünsche! Und was soll die Fragerei nach deiner leiblichen Mutter?«
Sarah zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Sie hat nach meinem Leberfleck gefragt.«
»Die spinnt. Komm, lass uns frühstücken. Vergiss es! Oder hast du deine Neugier immer noch nicht befriedigt?«
»Doch … doch«, entgegnete Sarah rasch. In Wirklichkeit ging ihr diese Sache mächtig nach.
Raiwiri zog sie an beiden Händen vom Stuhl hoch und führte sie in die Küche. Sarah aber war völlig durcheinander. Was, wenn die Frau wirklich mehr über ihre leibliche Mutter wusste?
»Glaubst du, es stimmt, was Jane und John behaupten? Dass sie nichts über meine Eltern wissen? Was, wenn meine Mutter tatsächlich Helen hieß? Dann wäre diese Dorothee offenbar meine Großmutter«, dachte Sarah laut nach.
Raiwiri lachte laut auf. »Genau, und dann wäre Ludwig Dehn dein Urgroßvater! Das wäre ja wohl das Allerletzte! Lass dir nicht so einen Mist einreden! Die alte Dame hat schlichtweg einen an der Waffel. Das glaubst du doch selber nicht. Ich würde sagen, Schluss mit dem Theater! Du wirst die Frau einfach nicht mehr kontaktieren! Und es ist zudem Jane und John gegenüber äußerst unfair, wenn du auch nur einen weiteren Gedanken darauf verschwendest. Außerdem wirst du bald deine eigene Familie haben. Was kümmert es uns da, was so eine merkwürdige Alte in Deutschland von dir will?«
»Aber …« Mehr brachte Sarah nicht heraus. Sie konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Nur so viel stand fest: Ihr war ganz und gar nicht gleichgültig, wo ihre echten Wurzeln waren. Und dass es besser wäre, Raiwiri nichts von diesen Sehnsüchten anzuvertrauen.
»Machst du das Frühstück? Ich möchte Janes Paket öffnen und mich dann gleich bei ihr bedanken.«
»Lass dir ja nicht einfallen, ihr brühwarm von diesem Anruf zu berichten. Sie hat genug Kummer mit John.«
Sarah schluckte. Da war sie wieder, diese Bevormundung.
»Danke, dass du mich daran erinnerst«, entgegnete sie scharf und verließ fluchtartig die Küche. Dabei hatte er ja recht. Natürlich würde sich Jane schrecklich aufregen, wenn sie davon erfuhr.
Sarah war neugierig, was ihre Adoptivmutter ihr geschickt hatte. Ungeduldig entfernte sie das Packpapier. Zum Vorschein kamen ein Schmuckkästchen und ein Brief. Sarah zögerte, doch dann öffnete sie die Schatulle. Sie enthielt eine Kette mit einem Anhänger. Sarah kannte das Symbol. Es handelte sich um ein sogenanntes Twist oder Maori-Pikorua, bestehend aus drei ineinander verknoteten Körben. Das Zeichen stand für immerwährende Liebe. Das Amulett war aus Perlmutt gefertigt und an einem Lederband befestigt. Hatte Jane von Raiwiris Antrag gewusst, und sollte es ein Zeichen ihrer Liebe sein?
Sarah legte sich die Kette um den Hals und trat damit vor den Spiegel. Der Schmuck sah wunderschön auf ihrer leicht gebräunten Haut aus. Dann öffnete sie den Brief und erstarrte, als sie die ersten drei Sätze las.
Liebste Sarah, ach, hätte ich dir das doch alles persönlich sagen können. Aber es geht John so schlecht, dass wir jeden Tag befürchten, es wäre der letzte. Es war der ausdrückliche Wunsch deiner Mutter, dir erst an deinem dreißigsten Geburtstag deine wahre Herkunft zu offenbaren …
Sarah zögerte. In ihrem tiefsten Inneren ahnte sie, dass sie gleich etwas Ungeheuerliches erfahren würde. Ihr kamen die Tränen, was ihr das Weiterlesen erschwerte. Hastig wischte sie sich über die Augen.