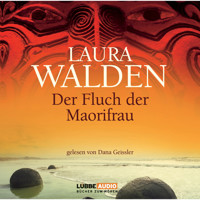6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Im Tal der großen Geysire, auf der Nordinsel Neuseelands, führen die Bradleys ein beliebtes Hotel. Von dort unternehmen sie mit ihren Gästen Ausflüge zu dem achten Weltwunder, herrlichen Sinterterrassen in Weiß und Zartrosa.
Doch im Juni 1886 bricht ein Vulkan aus, der nicht nur das Weltwunder unter Lavabrocken und Asche begräbt, sondern vermutlich auch die kleine Elizabeth, die jüngste Tochter der Bradleys. Seit der Katastrophe ist das Mädchen verschollen. Ihre Familie droht an dem Verlust zu zerbrechen - bis eine geheimnisvolle Maori auftaucht und die Kraft ihrer Liebe alles zum Guten wendet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1. Teil
Rotorua, Februar 1899
Rotorua, Januar 1878
Rotorua, Februar 1899
Auckland, Dezember 1879
Rotorua, Februar 1899
Rotorua, Februar 1888
Rotorua, März 1899
Rotorua, April 1899
Rotorua, Dezember 1879
Te Wairoa/Mount Tarawera, Dezember 1879
Rotorua, April 1899
Wellington, Februar 1888
Rotorua, April 1899
Wellington, Februar 1899
Rotorua, April 1899
2. Teil
Rotorua, 31. Dezember 1899
Dargaville, Juli 1893
Rotorua, 31. Dezember 1899
Rotorua, Ende November 1879
Rotorua, 31. Dezember 1899 bis 1. Januar 1900
Rotorua, 1. Januar 1900
Te Wairoa 9./10. Juni 1886
Rotorua, 1. Januar 1900
Rotorua, 10. Juni 1886
Rotorua, 1. Januar 1900
Ohinemutu, 1. Januar 1900
Rotorua, 2. Januar 1900
Auckland, Mai 1900
Rotorua, Mai 1900
Rotorua, Mai 1900
Auckland, Mai 1900
Auckland, Februar 1888
Rotorua, Mai 1900
Rotorua, Mai 1900
3. Teil
Auckland, September 1900
Rotorua, November 1900
Espa, Hessen-Nassau, Mai 1855
Auckland, 25. Dezember 1900
Sandhurst/Australien, Januar 1858
Auckland, 27. Dezember 1900
Sandhurst, Januar 1858
Auckland, Januar 1901
Auckland, Januar 1901
Auckland, Januar 1901
Rotorua, Januar 1901
Rotorua, Mai 1901
Dunedin, Januar 1875
Rotorua, Mai 1901
Dunedin, Januar 1875
Dunedin, Juni 1901
Rotorua, Juni 1901
Dunedin, Juni 1901
Rotorua, Juni 1901
Rotorua, Juni 1901
Register
Weitere Titel der Autorin
Das Erbe des Maori-Häuptlings
Das Geheimnis des letzten Moa
Das Versteck am Ende der Klippen
Der Fluch der Maorifrau
Der Schwur des Maori-Mädchens
Die Macht des Maori-Amuletts
Die Maori-Prinzessin
Die Spur des Maori-Heilers
Melodie der Zauberbucht
Über dieses Buch
Ein entfesselter Vulkan, ein verschwundenes Kind – und eine Liebe, die Hoffnung schenkt
Im Tal der großen Geysire, auf der Nordinsel Neuseelands, führen die Bradleys ein beliebtes Hotel. Von dort unternehmen sie mit ihren Gästen Ausflüge zu dem achten Weltwunder, herrlichen Sinterterrassen in Weiß und Zartrosa.
Doch im Juni 1886 bricht ein Vulkan aus, der nicht nur das Weltwunder unter Lavabrocken und Asche begräbt, sondern vermutlich auch die kleine Elizabeth, die jüngste Tochter der Bradleys. Seit der Katastrophe ist das Mädchen verschollen. Ihre Familie droht an dem Verlust zu zerbrechen – bis eine geheimnisvolle Maori auftaucht. Doch reicht die Kraft ihrer Liebe aus, um noch alles zum Guten zu wenden?
Über die Autorin
Laura Walden studierte Jura und verbrachte als Referendarin viele Monate in Neuseeland. Das Land fesselte sie so sehr, dass sie nach ihrer Rückkehr darüber Reportagen schrieb und den Wunsch verspürte, es zum Schauplatz eines Romans zu machen. In der Folge gab sie ihren Berufswunsch Rechtsanwältin auf und wurde Journalistin und Drehbuchautorin. Wenn sie nicht zu Recherchen in Neuseeland weilt, lebt Laura Walden mit ihrer Familie in Hamburg.
Laura Walden
IM TALDER GROSSENGEYSIRE
Neuseelandsaga
Digitale Neuausgabe
Copyright © 2009 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © mauritius images/age ; © Getty Images: Iconica | Pete Turner
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-9834-2
www.luebbe.de
www.lesejury.de
PROLOG
Das kleine Mädchen war schweißgebadet aufgewacht und hatte ängstlich nach der Mutter gerufen, denn es hatte von Hexen und Dämonen geträumt. Aber die Mutter war nicht sofort an sein Bett geeilt, wie sie es sonst zu tun pflegte. Mit klopfendem Herzen lag die Kleine nun wach in der Stille der Nacht. Plötzlich hörte sie von weitem ein eigenartiges Gemurmel. Neugierig krabbelte sie unter der warmen Decke hervor, schlüpfte in ihre Hausschuhe und lief – wie magisch angezogen von den tiefen Stimmen – in die kalte Nacht hinaus. Ohne zu überlegen, folgte sie den Lockrufen, die vom See zu kommen schienen. Am Ufer beobachtete sie mit großen Augen, wie aus einer Nebelwand ein Kanu auftauchte. Die Stimmen gehörten dunklen Männern mit bemalten Gesichtern, die das Boot dicht an ihr vorüberlenkten. Gebannt verfolgte das Mädchen jede ihrer Bewegungen. Kraftvoll und im selben Takt stießen sie die Paddel ins Wasser. So schnell, dass sie sich schon wieder vom Ufer entfernten und ihre Stimmen allmählich verklangen. Lautlos paddelten sie dahin.
Die Kleine lachte erleichtert und rief ihnen nach.
Einer der dunkelhäutigen Männer drehte sich noch einmal um, erwiderte ihren Gruß und winkte das Kind zu sich heran. Ohne zu zögern, setzte das Mädchen einen Fuß vor den anderen. Seine Pantoffeln füllten sich augenblicklich mit eiskaltem Wasser, aber das störte es nicht. Es hatte nur noch Augen für den Mann, der das Kind mit kehligen Lauten lockte. Die Kleine war gerade vier Jahre alt, wusste aber dennoch, dass sie nicht mit fremden Männern mitgehen durfte. Das hatte sie ihrer Mutter stets hoch und heilig versprechen müssen, aber sie hatte gar keine andere Wahl. Sie war machtlos, ihre Füße bewegten sich wie von selbst. Bis zu den Knien stand sie bereits in dem ruhigen See, als plötzlich eine Welle heranrollte und sie umzuwerfen drohte. Ein heftiger Windstoß wirbelte ihr Haar durcheinander, verfing sich unter ihrem weißen Nachthemdchen und brachte sie ins Straucheln. Nur mit Mühe konnte sie sich aufrecht halten. Als sie nach dem Schrecken wieder auf den See hinausblickte, war das Boot verschwunden – als habe das Wasser es einfach verschluckt. Eine Regenböe peitschte über den See direkt in ihr Gesicht, und das Mädchen zitterte vor Angst und Kälte.
Wie sehr es sich jetzt nach der Mutter sehnte! Wenn die sie doch nur in die Arme schließen und sie wärmen, ihr eine heiße Schokolade kochen, sie ins Bett bringen und ihr ein Lied singen würde!
»Mama!«, schluchzte das Kind. »Mama!« In diesem Augenblick wurde es aus dem kalten Wasser gerissen. »Mama«, rief die Kleine, aber als sie sich umdrehte, blickte sie in das Gesicht einer schwarzen Frau.
»Wa wairua«, flüsterte die Fremde und deutete auf die Stelle, an der das Kanu so plötzlich verschwunden war. Doch dann wandte sie sich wieder dem Kind zu. »Komm, wir müssen uns beeilen«, erklärte sie ihm und zog es mit sich fort. Kaum dass sie wieder festen Boden unter den Füßen hatten, begann die Frau zu rennen. »Schneller!«, rief sie im Laufen. Dabei hielt sie das Handgelenk des Kindes fest umklammert. »Dort hinauf!«, japste sie und ließ den Arm des Mädchens los.
Die Kleine hatte aufgehört zu weinen. Sie spürte, dass sie der Frau stumm gehorchen sollte. Die schubste sie einen Berg hinauf, stolperte, fiel hin und rappelte sich klaglos wieder auf. Das Kind lief mit ihr über Fels und Geröll, durch einen dichten Wald. Zweige schlugen ihnen entgegen, die Hiebe brannten wie Feuer im Gesicht. Das Mädchen wollte stehen bleiben, die Fremde bitten, den Schmerz fortzupusten, doch die versetzte ihm einen unsanften Stoß ins Kreuz. »Beeil dich!«, schrie sie mit sich überschlagender Stimme. »Schneller!«
Da zitterte die Erde unter ihren Füßen. »Rua Mokos Rache!«, brüllte die Frau wie von Sinnen, während sie das Kind erbarmungslos vor sich herschob. Erst als sie oben auf dem kahlen Berg angelangt waren, hielt sie schnaufend inne und wandte den Blick zurück. Panische Angst stand der schwarzen Frau ins Gesicht geschrieben, doch das Mädchen war fasziniert von dem Schauspiel, das sich ihnen unten am Seeufer bot. Seine Angst war verflogen. »Da! Die Sonne!«, juchzte das Kind und klatschte vor Freude in die Hände, auch wenn es noch immer nach Atem rang.
Glutrot leuchtete der Himmel. Aber es war nicht das Rot der Sonne. Der Berg spuckte Feuer und Steine, die mit ohrenbetäubendem Lärm in den See krachten.
»Renn!«, ächzte die Fremde mit letzter Kraft. »Los! Renn!«, befahl sie noch einmal, bevor ein infernalisches Donnern ertönte und ihre Stimme erstarb.
1. TEIL
ANNABELLE, OLIVIAUND ABIGAIL –DIEDREI SCHWESTERN
ROTORUA, FEBRUAR 1899
Der Schwefelgeruch war an diesem heißen Sommertag besonders intensiv. Wie eine geschlossene Dunstglocke lag er über dem Ort und drang den Menschen in jede Pore.
Hätte ihre Schwester sie nicht darauf aufmerksam gemacht, wäre es Annabelle Parker allerdings gar nicht aufgefallen, weil ihr dieser Geruch so vertraut war, dass sie sich ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen konnte. Er gehörte ebenso hierher wie der grün-gelblich schimmernde See, an dem ihr kleines Hotel lag, und die stinkenden Schwaden, die immer wieder aus den Blumenbeeten rechts und links vom Haupteingang emporwaberten. Auch an das ständige Blubbern in dem braunen Schlammloch im Garten sowie an den kleinen Pool mit trübem Wasser, in den man gar nicht gern steigen mochte, dafür aber herrlich erfrischt herauskam, hatte sie sich gewöhnt. Sie lebte nun einmal auf einem Flecken Erde, unter dessen Oberfläche »das Höllenfeuer« tobte, wie der alte Reverend Alister im Gottesdienst einst gemahnt hatte. »Wir tanzen eben auf dem Vulkan«, erklärte Annabelle lächelnd, wenn die Hotelgäste sie neugierig auf die vulkanischen Aktivitäten in und um Rotorua ansprachen.
Olivia stand im Flur des Hotels und jammerte angewidert: »Wie faule Eier – igitt! Wenn ich mir vorstelle, dass ich hier den Rest meiner Jugend verbracht habe. Ich bekomme sofort Kopfschmerzen. Darling, bitte nimm mir den Koffer ab! Mir wird übel.« In ihrer Stimme schwang, wie immer, ein Vorwurf mit.
Annabelle entfuhr ein tiefer Seufzer. So früh hatte sie ihre Schwester gar nicht erwartet. Hastig wischte sie sich die Finger an der Schürze ab, doch es nutzte nichts. Sie hatte soeben in der Küche eine ihrer selbst gefangenen Forellen ausgenommen, und alles stank nach Fisch. Aber nun blieb ihr keine Zeit mehr zum Waschen und Umziehen. Natürlich hätte Gordon ihr das Ausnehmen der Fische jederzeit abgenommen, aber Annabelle liebte es, am frühen Morgen allein zu einem einsamen Stückchen Strand zu rudern, um dort ihrer Leidenschaft, dem Fliegenfischen, zu frönen. Und anschließend ihre Beute, diese herrlichen Forellen, auch selbst zuzubereiten.
Annabelle setzte ein Lächeln auf, was ihr nicht leichtfiel. Zu sehr lasteten die Ereignisse der letzten Tage auf ihrer Seele. Erst der tragische Unfall ihrer Mutter und in der letzten Nacht schon wieder einer dieser entsetzlichen Träume. Sie war schreiend aufgewacht und hatte nicht mehr einschlafen können. Ihr fehlte die Nachtruhe – und das seit Wochen.
Annabelle schüttelte die Erinnerung an den Albtraum ab, reichte Olivia die Hand und fragte betont höflich: »Meine Liebe, ich hoffe, du hattest eine gute Reise?«
Die beiden Schwestern umarmten einander nicht einmal mehr zur Begrüßung, seit sie erwachsen waren, doch auch diese Berührung war der jüngeren schon zu viel.
Olivia rümpfte ihr wohlgeformtes Näschen, während sie Annabelle hastig die Hand entzog und schnippisch erwiderte: »Entsetzlich, diese Fahrt nach Rotorua. Fast neun Stunden hat der Zug gebraucht.« Dann musterte sie die ältere Schwester von Kopf bis Fuß.
Annabelle wurde rot vor Scham. So ein fadenscheiniges mausgraues Kleid würde Olivia wahrscheinlich nicht mal zum Putzen tragen, fuhr ihr durch den Kopf, bis ihr einfiel, dass ihre Schwester gar nicht erst in die Verlegenheit kommen würde, im Haushalt überhaupt etwas anzufassen. Lady Hamilton hatte schließlich Dienstboten.
Die eisige Begrüßung war sofort vergessen, als Olivias Sohn Duncan seine Tante überschwänglich in die Arme nahm und wild herumwirbelte.
»Lass dich anschauen, mein Junge!«, japste Annabelle völlig außer Atem, als sie wieder festen Boden unter den Füßen hatte.
Wie gut er aussah und wie männlich er geworden war! Annabelle konnte kaum den Blick von ihm wenden. Zwei Jahre lag sein letzter Besuch inzwischen zurück, und aus dem schlaksigen Jüngling war ein Bild von einem Mann geworden: hochgewachsen, schlank, jedoch nicht zu dünn, pechschwarzes Haar, ein kantiges Gesicht, eine gesunde Hautfarbe und volle, wohlgeformte Lippen, die nicht weiblich wirkten, sondern seine Männlichkeit im Gegenteil noch unterstrichen. Er kommt ganz nach Olivia, schoss es Annabelle durch den Kopf, nur die Nase, die hat er nicht von ihr. Duncans Nase war besonders kräftig, fügte sich jedoch harmonisch in sein ausdrucksstarkes Gesicht ein. So, als hätte die Natur ein besonders ansehnliches männliches Wesen schaffen wollen und dabei nicht mit Übertreibungen gegeizt. Er hat jetzt, wo er zum Mann heranwächst, immer weniger von Allan, stellte Annabelle fest. Und doch war er, wenn sie Duncans Briefen Glauben schenken durfte, immer noch der heiß geliebte Kronprinz seines Vaters.
Annabelle war so begeistert, dass sie wiederholt kicherte: »Die Damenwelt wird entzückt sein!« Dann wurde sie wieder ernst. Warum Helen wohl nicht mitgekommen war?
»Wo ist Mutter?«, unterbrach Olivia die Gedanken ihrer Schwester schroff, während sie auf einen Fremden deutete, der soeben eingetreten war. »Das ist Mister Harper, unser Begleiter!«, erklärte sie rasch.
Der große Mann mit dem rötlichen Schopf grüßte Annabelle förmlich. »Ich bin der Anwalt der Familie Hamilton!«, sagte er mit Nachdruck, als wolle er Spekulationen über sein Verhältnis zu der schönen Olivia entgegenwirken.
Duncans spöttisch verzogener Mund weckte bei Annabelle allerdings die Vermutung, dass dieser Herr offensichtlich auch zu den vielen Verehrern seiner Mutter zählte, die sich glücklich schätzten, wenn sie allein in der Nähe ihrer Angebeteten sein durften. Merkwürdig, mir ist so, als hätte ich den schon mal gesehen, dachte sie. Aber wo? Wäre er ein Hotelgast gewesen, würde sie sich daran erinnern.
In diesem Augenblick eilte Jane, Annabelles rechte Hand, herbei, bückte sich rasch, um Olivias Koffer zu nehmen, aber Duncan kam ihr zuvor. »Bitte lassen Sie mich das machen.«
Jane schenkte ihm ein dankbares Lächeln und richtete sich ächzend auf. Beim Anblick ihres Bauchumfanges wurde Annabelle schmerzlich bewusst, dass sie bald auf die junge Frau würde verzichten müssen, die kurz vor der Niederkunft stand. Nach der Geburt des Kindes würde Jane nur noch den eigenen Haushalt führen. Schade, dachte Annabelle bedauernd, ich habe mich so an sie gewöhnt. Und außerdem habe ich eigentlich gar keine Zeit, ein junges Ding anzulernen.
Ihre alte Köchin Ruiha hatte ihr zwar bereits eine Nachfolgerin aus ihrem Stamm angetragen, aber Annabelle spielte mit dem Gedanken, sich lieber bei den weißen Mädchen vor Ort umzuhören. Jetzt, wo zu allem Überfluss auch noch die Betreuung »der unleidlichen Dame aus der Matratzengruft« anfiel, wie Gordon seine Schwiegermutter schon vor deren Unfall manchmal scherzhaft genannt hatte. Annabelle wusste doch, wie kritisch ihre Mutter den Maori gegenüberstand.
»Bitte, zeig Mister Harper die Nummer neun«, bat sie Jane nun nachdenklich.
»Die neun?«, mischte sich Olivia ein. »Ist das ein Zimmer mit Seeblick?«
»Nein, leider nicht, die anderen sind alle belegt. Wir haben das Haus voller Gäste.« Annabelle bemühte sich, an ihrer Schwester vorbeizusehen, denn sie wusste, was für ein Gesicht Olivia ziehen würde. Das hatte sie schon als Kind getan, wenn sie ihren Willen nicht durchsetzen konnte.
Aber es gab noch einen anderen Grund, weshalb sie den Blickkontakt mit ihrer Schwester vermied. Ihr missfiel Olivias Begleiter. Ein Anwalt! Rechnete ihre Schwester etwa damit, dass der Besuch am Krankenbett zu einem Abschied am Totenbett werden würde? Hatte sie einen Anwalt mitgebracht, weil sie einen Streit um das Erbe befürchtete?
Annabelles unschöne Gedanken wurden unterbrochen, als ihr Mann Gordon, schwitzend und in einem Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, von draußen hereinkam und fröhlich in die Runde grüßte.
»Wo ist denn Allan?«, fragte er arglos. Ein breites Grinsen ging über sein gütiges rundes Gesicht, während er Duncan in die Arme schloss. Als er seinen Neffen wieder losgelassen hatte, merkte Gordon, dass man ihm die Antwort schuldig geblieben war. »Es ist ihm doch nichts passiert?«, setzte er hinzu. Er klang besorgt.
Annabelle befürchtete sofort, ihre Schwester könne in der Nachfrage eine böse Unterstellung ihres Schwagers wittern, und sie hatte richtig vermutet.
Olivia hatte die Lippen fest aufeinandergepresst, bevor sie nur »Geschäfte!« schnaubte.
Gordon nickte, als sei ihm das Erklärung genug, warf Annabelle jedoch einen fragenden Blick zu. Sie bedeutete ihm stumm, es dabei zu belassen.
Nun schickte sich auch endlich Olivias Begleiter an, den Hausherrn zu begrüßen. »Harper, ich bin der Anwalt der Hamiltons!«
Gordon sah verwirrt von einem zum anderen, bis sein bohrender Blick bei Olivia verharrte. »Du glaubst doch nicht etwa, wir würden uns hier um Mutters Erbe streiten? Die alte Dame ist zäh und wird uns ohnehin alle überleben«, erklärte er geradeheraus.
»Blödsinn!«, zischelte Olivia. »Mister Harper ist ein alter Bekannter; du müsstest ihn eigentlich noch kennen, liebe Annabelle. Er hat uns freundlicherweise auf der Zugfahrt begleitet, weil so viele schreckliche Leute mitfahren und ich ständig von irgendwelchen Kerlen belästigt werde. Ich weiß zwar nicht, was all diese Menschen in Rotorua wollen, aber das kann mir auch egal sein. Ich würde mich jedenfalls nicht freiwillig auf diese Reise machen, um im stinkenden Schlamm zu waten oder in heißem Wasser zu baden. Und nun würde ich gern wissen, was geschehen ist. Du hast telegrafiert …« Olivia legte eine Pause ein und zog ein fein zusammengefaltetes Blatt aus der Tasche. »… Mutter gestürzt. Seitdem ans Bett gefesselt. Sieht nicht gut aus. Bitte kommt sofort! Also, was ist passiert? Ich möchte schließlich wissen, in welchem Zustand sie ist, bevor ich an ihr Bett trete. Ist sie überhaupt bei Bewusstsein?«
Annabelle war erschüttert. Wie gefühllos ihre Schwester über ihre Mutter sprach! Dabei war Olivia doch immer Mutters erklärter Liebling gewesen. Musste sie auch hier die vornehme Lady Hamilton geben, die stets die Contenance wahrte? Und was würde ihre Schwester erst sagen, wenn sie erfuhr, wie alles geschehen war und wer wieder einmal die Schuld daran trug?
Annabelle suchte noch nach den richtigen Worten, als Gordon ihr zuvorkam. »Olivia, du weißt sicher, dass wir seit damals keine Ausflüge zu den Sinterterrassen mehr machen können, weil es die gar nicht mehr gibt …« Er senkte die Stimme und warf seiner Frau einen hilflosen Blick zu.
Annabelle spürte, wie sehr ihn das alles auch noch dreizehn Jahre nach dem grausamen Unglück berührte. Auch er würde diesen Tag, an dem nicht nur die Landschaft um den Mount Tarawera aus den Fugen geraten und sich von Grund auf verändert hatte, sondern ihr gesamtes Leben, niemals vergessen.
»Seit dem Vulkanausbruch bieten wir unseren Gästen deshalb nur kleine Ausflüge zum Pohutu an«, fuhr Gordon fort. »Eure Mutter hasst den Geysir, aber neulich wollte sie uns unbedingt begleiten. Annabelle konnte ihr diesen Wunsch nicht abschlagen. Sie hat sie in der Kutsche mitgenommen. Ich war an dem Tag mit der Planung unseres Badehauses beschäftigt, sodass Annabelle allein mit den Gästen war. Sie sind alle zum Geysir gefahren, und in einem unbeobachteten Moment ist eure Mutter ausgerutscht und unglücklich auf den Rücken gefallen …«
»In einem unbeobachteten Moment? Heißt das, du hast nicht auf sie geachtet? Du weißt doch, dass sie Probleme hat, das Gleichgewicht zu halten, weil sie immer nur im Bett und auf der Terrasse herumliegt«, bellte Olivia und funkelte ihre Schwester vorwurfsvoll an.
Annabelle wurde über und über rot. Ja, ja, und noch einmal ja, ihre Schwester hatte ja Recht. Sie machte sich selbst die allergrößten Vorwürfe, seit sie ihre Mutter reglos auf den feuchten Steinen der Geysirterrasse gefunden hatte.
»Ich habe es doch nicht gewollt«, stöhnte sie.
»Nicht gewollt? Du hast sie doch sich selbst überlassen! Du hättest sie keine Sekunde aus den Augen lassen dürfen«, warf Olivia ihr nun vor.
Gordon atmete tief durch, bevor er die ganze Gesellschaft energisch in die Privaträume der Familie dirigierte. »Die Gäste müssen unseren Zank ja nicht unbedingt mit anhören«, knurrte er und fügte hinzu: »Einige von ihnen waren Zeugen des Unfalls, und das war schrecklich genug für sie.« Er warf seiner Frau einen tröstenden Blick zu. Annabelle verstand. Den Rest sollte sie ihnen schildern.
Annabelle räusperte sich nervös, bevor sie zögernd erklärte: »Wir standen gerade gespannt in sicherem Abstand vom Pohutu und warteten auf die nächste Fontäne. Da fing er mächtig zu spucken an. Höher, als ich ihn jemals zuvor habe spucken sehen – bis in den Himmel hinein. Der alte Geysir lieferte unseren staunenden Gästen ein unglaubliches Schauspiel, doch mitten hinein, gerade als er auf seinem höchsten Punkt angelangt war, gellte ihr Schrei. Sie war auf die Steine geklettert und gefallen. Ich bin sofort zu ihr geeilt, aber da war es zu spät. Seitdem redet sie noch weniger mit mir.«
Den letzten Satz hatte sie leise an sich selbst gerichtet, doch Olivia hatte ihn offenbar gehört, denn sie sagte mit schneidender Stimme: »Das kann ich gut verstehen!«
Annabelle ignorierte die bissige Bemerkung ihrer Schwester.
»Liebe Misses Parker, Sie wissen wohl wirklich nicht mehr, wer ich bin, oder?«, fragte der Anwalt plötzlich in die peinliche Stille.
»Nein, keine Ahnung, wo wir uns schon einmal begegnet sind.«
»Ich gebe Ihnen ein Stichwort: Misses Beeton!« Er grinste breit.
Annabelle zuckte mit den Achseln, doch dann schwante ihr plötzlich etwas. Natürlich, die kalten blauen Augen! »Tut mir leid, ich kann mich nicht an Sie erinnern«, erklärte sie hastig.
Als alle um den Wohnzimmertisch versammelt waren, platzte es ungeduldig aus Olivia heraus: »Meine Güte, Annabelle, nun schau doch nicht wie ein verletztes Tier. Typisch, dass dir das passiert ist!«
In diesem Moment fühlte Annabelle, wie sich eine männliche Hand unter ihre schob. Zuerst dachte sie, es wäre Gordon, aber dann blickte sie in Duncans mitfühlendes Gesicht. »Nimm es dir nicht zu Herzen!«, flüsterte er.
Annabelle nickte und erwiderte den Druck seiner Hand. Wie sie ihren Neffen liebte! Wie ein eigenes Kind! Bei diesem Gedanke krampfte sich ihr Magen so zusammen, dass ihr übel wurde. War sie nicht auch schuld am Tod ihrer einzigen Tochter gewesen? Brachte sie nicht allen Menschen, die sie liebte, nur Kummer oder sogar den Tod? War sie nicht weit fort gewesen, als ihre Liebsten sie gebraucht hatten? Tränen traten in ihre grünen Augen, aber sie wischte sie energisch fort. Es hatte keinen Zweck zu weinen. Das würde das Unglück nicht ungeschehen machen und ihr Kind nicht zurückbringen.
Olivia fasste sich indessen mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Schläfen. Dass sie ganz offensichtlich Kopfweh hatte, hinderte sie nicht daran, sich in die Vorwürfe gegen ihre Schwester hineinzusteigern.
Während sich Olivia immer mehr in Rage redete, musterte Annabelle sie schweigend. Dabei spielte sie ihr altes Spiel. Sie driftete ganz langsam in ihre eigenen Gedanken ab, bis die vorwurfsvolle Stimme nur noch ein unverständliches Hintergrundgemurmel abgab. So hatte Annabelle sich schon als Kind verhalten, wenn ihre Mutter Maryann ihr wegen irgendwelcher Kleinigkeiten Vorhaltungen gemacht hatte: weil sie einen Fleck auf dem Kleid oder ihr Haar nicht sorgfältig genug aufgesteckt hatte.
Annabelle hörte zwar nicht mehr hin, dafür sah sie ihre Schwester jedoch umso deutlicher. Wie Olivia vor Zorn das Gesicht verzerrte! Aber nicht einmal das minderte die Schönheit ihrer jüngeren Schwester.
Olivia besaß ein so ebenmäßiges Gesicht, dass es schmerzte. Und wie ähnlich sie Maryann war! Nur dass Mutters einst pechschwarzes Haar inzwischen eisgrau ist, sinnierte Annabelle. Ja, sie stammten unübersehbar aus einer Familie. Maryann, Olivia und Duncan. Nur besaß Olivias Sohn ein völlig anderes Wesen als seine Mutter und seine Großmutter. Er war sanftmütig, mitfühlend und herzlich, was Annabelle von den beiden Frauen nicht guten Gewissens behaupten konnte.
»Kommt Abigail eigentlich auch?«, fragte Olivia ganz unvermutet.
Diesen Satz konnte Annabelle beim besten Willen nicht überhören. Sie nickte stumm, bevor sie zurück in ihre Gedankenwelt versank, in der ihr keiner etwas anhaben konnte. Ach, Abi, hoffentlich kommst du wirklich!, flehte sie insgeheim. Ihre immer zu Scherzen aufgelegte Schwester Abigail würde die angespannte Atmosphäre mit Sicherheit auflockern. Annabelle betete inständig, dass Abi über ihren Schatten springen, ihrer Bitte folgen und wenigstens ihr zuliebe nach Hause kommen würde.
Die quirlige, lebenslustige Abigail war ihrer Mutter ebenfalls wie aus dem Gesicht geschnitten. Mit dem einen Unterschied: Sie war blond. Annabelle seufzte bei dem Gedanken an ihre Lieblingsschwester. Olivia, Abigail, Duncan und auch seine Schwester Helen, die hatten etwas abbekommen von Maryanns sagenhafter Schönheit. Eigentlich alle – bis auf sie, Annabelle. Sie selbst ähnelte – und dessen war sich Annabelle sicher – zweifellos ihrem Vater William C. Bradley. Er war der gütigste Mensch, den Annabelle je gekannt hatte. Außer Gordon Parker. Aber schön war er bestimmt nicht gewesen. Genauso wenig wie Gordon.
Annabelle schluckte trocken. Sie konnte die Tränen gerade noch zurückhalten, als sich erneut eine Hand unter ihre schob. Die raue Hand eines Mannes, der zupacken konnte. Sie gehörte Gordon, der seine Frau ein wenig hilflos ansah. Dennoch ging ihr Herz bei seinem Anblick auf. Sie liebte diesen einfachen Mann, den sie einst gegen den erklärten Willen ihrer Mutter und mit der ausdrücklichen Billigung ihres Vaters geheiratet hatte. Diesen aufrechten Menschen, der immer zu ihr stand und sie stets beschützte, besonders vor den Anschuldigungen ihrer Mutter. Er hatte niemals auch nur ein einziges böses Wort oder den leisesten Vorwurf gegen seine Frau gerichtet. Selbst damals nicht, als sie Elizabeth im Stich gelassen hatte.
»Nicht traurig sein!«, flüsterte er und tätschelte unbeholfen ihre Hand.
Aber Annabelle war traurig, denn ihre Gedanken weilten nun bei ihrer Tochter. Letzte Nacht, im Traum, hatte Elizabeth wieder einmal verzweifelt nach ihr gerufen, bevor sie mit einem erstickten »Mama! Mama!« unter einem infernalischen Lava- und Ascheregen begraben wurde. Ihre durchdringenden Rufe klangen Annabelle noch in den Ohren.
»Jetzt mach doch endlich den Mund auf, Annabelle! Wie geht es Mutter?«, forderte Olivia sie nun unwirsch auf.
Annabelle fuhr zusammen, räusperte sich und blickte verlegen an sich herunter, während sie verzweifelt nach den richtigen Worten suchte. O nein, sie hatte in der Hektik vergessen, sich die Schürze abzubinden. Hastig holte sie das nach. Der Gestank von totem Fisch wehte ihr in die Nase. Ihr Blick heftete sich an das sackartige Kleid, das sie darunter trug. Das hatte auch schon bessere Zeiten gesehen. An den Ärmeln war der dunkle Stoff bereits ausgefranst. Außerdem trug sie kein Korsett. Sie wusste, dass dieser Stil nicht schicklich war, aber sie liebte die Bequemlichkeit. Seit sie in einer englischen Zeitschrift ein Schnittmuster gefunden hatte, nähte sie sich nur noch diese praktischen Kleider. Allerdings zu selten, wie sie jetzt feststellte. War es wirklich schon zwei Jahre her, seit sie das letzte Mal zum Nähen gekommen war?
An Olivias schmalem Mund konnte Annabelle erkennen, dass sie nun nicht mehr länger zögern durfte, ihrer Schwester die traurige Wahrheit zu überbringen.
»Sie kann ihre Beine nicht mehr bewegen. Der alte Doktor Fuller sagt, es ist eine Lähmung. Es tut mir leid«, brachte Annabelle schließlich heiser hervor.
»Gelähmt?«, schrie Olivia mit überschnappender Stimme auf. »Gelähmt? Und das sagst du mir erst jetzt? Warum hast du keinen anderen Arzt gerufen? Doktor Fuller muss doch inzwischen steinalt sein …«
Wie fremd und fern ihre Stimme doch klingt!, dachte Annabelle. Olivia schien aus einer völlig anderen Welt zu kommen. Einhundertsiebenundfünfzig Meilen waren zwar keine Ewigkeit entfernt, aber in Annabelles Augen war Auckland ebenso weit weg wie das ferne Deutschland, aus dem ihre Mutter stammte.
»Ich will sie sofort sehen«, verlangte Olivia.
»Sie liegt oben in ihrem Zimmer. Alles ist in bester Ordnung«, versicherte Annabelle, sichtlich um Beherrschung bemüht. »In einer Stunde ist das Essen fertig. Speisen Sie mit uns?« Diese Frage galt Mister Harper, der zustimmend nickte.
Mit einem vernichtenden Seitenblick rauschte Olivia an Annabelle vorbei. Ihr feines Taftkleid raschelte bei jedem ihrer Schritte wie ein einziger Vorwurf. Im Türrahmen blieb sie kurz stehen, um Duncan in scharfem Ton aufzufordern, sie zu begleiten.
Der junge Mann antwortete in seiner ruhigen Art, dass er nachkommen werde.
Annabelle gab vor, dringend in der Küche gebraucht zu werden, was nur die halbe Wahrheit war. Sie wollte einfach allein sein, denn lange würde sie es nicht mehr schaffen, Haltung zu bewahren. Auch wenn sie einen Weg gefunden hatte, nicht jedes Wort an sich heranzulassen, so hatten Olivias Anschuldigungen sie doch mitten ins Herz getroffen.
Kaum hatte sie die Küchentür hinter sich geschlossen, wurde sie auch schon von heftigen Schluchzern geschüttelt. Es klopfte, und, ohne eine Antwort abzuwarten, trat zögernd Duncan ein. Annabelle sah kurz auf und tat nichts, um ihre Tränen zu verbergen. Vor ihm schämte sie sich ihres Kummers nicht.
Duncan nahm sie fest in den Arm und versuchte sie zu trösten. »Bitte, Tante Annabelle, nicht weinen. Nicht ihretwegen! Bitte! Sie ist im Moment unausstehlich. Zu jedermann! Sie wird in letzter Zeit von schrecklichem Kopfweh geplagt. Das soll keine Entschuldigung sein, aber glaube mir, sie meint es wirklich nicht so!«
»Du hast Recht, mein Junge, sie meint es nicht so«, wiederholte Annabelle wider besseres Wissen. Warum sollte sie den Jungen damit belasten, dass sie schon als Kind hatte lernen müssen, an den kränkenden Bemerkungen ihrer Schwester nicht zu verzweifeln und sich damit abzufinden, dass Olivia von der Mutter verwöhnt und allen anderen vorgezogen wurde?
ROTORUA, JANUAR 1878
Das lang gestreckte Holzhaus am Lake Rotorua war an diesem Tag über und über mit Girlanden geschmückt, doch Maryann Bradley war immer noch nicht zufrieden. Noch einmal schickte sie ihren Mann William auf die Leiter, damit er weiteren Raumschmuck anbrachte. William tat, was seine Frau verlangte. Er widersprach ihr eigentlich nur, wenn sie ungerecht gegen ihre älteste Tochter wurde. Dann konnte auch William C. Bradley die Stimme erheben. Ansonsten war er so gutmütig, wie er aussah. Er war groß, beinahe massig, litt mit zunehmendem Alter an Übergewicht und hatte schon in jungen Jahren schütteres blondes Haar besessen. Er hatte warme braune Augen und ein rundliches Gesicht.
Warum ist sie bloß kein Junge geworden?, fragte er sich einmal mehr, als er Annabelle besorgt unten an der Leiter stehen sah. Dann hätte sie die Liebe ihrer Mutter vielleicht trotz ihres Aussehens bekommen, mutmaßte er, während er die Stufen vorsichtig hinabstieg. Ihm floss das Herz über vor Liebe für das Mädchen. In Annabelles Gesicht stand die Sorge geschrieben, dass er von der Leiter fallen könne. Er spürte förmlich, wie sie sich ängstlich gegen das hölzerne Ungetüm stemmte, damit sie auch ja nicht umkippte. Annabelle hing abgöttisch an ihm und fürchtete ständig, ihm könne etwas zustoßen. Er durfte nicht einmal allein in ein Ruderboot steigen, ohne dass sie ihn begleitete. Sie müsse ihn beschützen, sagte sie immer. Maryann fragte ihn manchmal, ob diese Anhänglichkeit seiner Ältesten ihm nicht auf die Nerven gehe, aber William C. Bradley rührte sie nur.
Erst als er sicher einen Fuß auf den Boden gesetzt hatte, trat Annabelle einen Schritt beiseite. Er strich ihr flüchtig über das blonde Haar. Es ist so dünn und fusselig wie mein eigenes, dachte er, man könnte fast glauben, sie kommt ganz nach mir.
»Annabelle, du musst dich umziehen. Du willst doch nicht etwa in diesem Lumpen auf das Fest gehen?«, ertönte Maryanns strenge Stimme.
William Bradley tat es in der Seele weh, mit anzusehen, wie das Mädchen zusammenzuckte. Bestimmt hat sie sich bereits in ihr schönstes Kleid geworfen, vermutete er, aber da sie nun einmal keine solche Taille wie ihre Mutter oder ihre Schwestern besitzt, kann kein Kleid dieser Welt die Silhouette zaubern, die man heutzutage von den jungen Frauen erwartet.
»Annabelle, wird’s bald!« Maryann klang gereizt.
Manchmal bedauerte William insgeheim, dass er sich damals vor knapp zwanzig Jahren bei der Namensgebung seiner Tochter schließlich doch noch durchgesetzt hatte. Er hatte auf dem Namen Annabelle bestanden, getrieben von der Hoffnung, sie würde früher oder später zu einer wahren Schönheit heranwachsen. Heute klang es manchmal wie Hohn, wenn man sie »Annabelle« nannte.
Bella, schön, war die Kleine eben schon bei ihrer Geburt nicht gewesen. Maryann hatte sie eigentlich Hildegard taufen wollen, nach ihrer Mutter, aber William hatte dieser deutsche Name ganz und gar nicht gefallen. Damit wird man sie später bestimmt hänseln, dachte er damals, zumal es für englischsprachige Zungen kaum auszusprechen war. Er hatte einen anmutigen Namen für die Erstgeborene gefordert. Er erinnerte sich noch heute genau an seine Worte: Sagen die Italiener nicht Bella zu schönen Mädchen? Nennen wir sie doch einfach Annabelle. Maryann hatte skeptisch die Augenbrauen hochgezogen und »Meinetwegen!« gegrummelt. Letztlich war es ihr gleichgültig gewesen. William versetzte es noch heute einen Stich, wenn er daran dachte, wie enttäuscht seine Frau auf das faltige, haarlose Bündel reagiert hatte. Sie hatte das Kind kaum stillen wollen, so sehr war sie von der Hässlichkeit des kleinen Wesens abgestoßen.
William hatte damals befürchtet, Maryann sei gar nicht zu Muttergefühlen fähig, doch die Geburten ihrer beiden jüngeren Töchter hatten ihn eines Besseren belehrt. Bei ihnen hatte sich seine Frau schier überschlagen vor Zärtlichkeit und Liebe. Keine Frage, Olivia und Abigail waren ungleich hübscher als die Älteste, und doch schlug sein einfaches Herz insgeheim umso mehr für die benachteiligte Tochter mit dem großen Herzen. Ihr verlässlicher, uneitler Charakter, ihre Liebe zur Natur und ihre offene Art lagen ihm näher als das überhebliche Getue der mittleren Tochter. Bei Abi konnte man noch nicht sagen, wie sie sich entwickeln würde. Sie war noch ein Kind, und was für ein fröhliches! Natürlich liebte er jede Tochter auf ihre Art, aber Annabelles Wesen rührte ihn zutiefst.
»Annabelle, muss ich dir erst Beine machen?«
»Tu lieber, was Mutter sagt!«, raunte er ihr verschwörerisch zu.
Annabelle schaute ihn verzweifelt an.
»Geh und lass dir von Olivia helfen«, riet er mit sanfter Stimme und schob sie aus dem Wohnzimmer und damit aus dem Blickfeld ihrer gestrengen Mutter.
Annabelle ließ sich Zeit, die knarrende Treppe zum Mädchenzimmer emporzusteigen. Es war doch völlig gleichgültig, was sie anzog, sie würde ohnehin niemandem gefallen. Sie wusste, dass der heutige Tag ihrer Mutter überaus wichtig war. Zu Olivias achtzehntem Geburtstag hatte Maryann alle jungen Männer aus den sogenannten guten Familien der gesamten Umgebung eingeladen. Da es in den Augen ihrer Mutter in diesem abgelegenen Flecken Erde nicht genügend angemessene Heiratskandidaten für ihre Töchter gab, hatte sie ihre Fühler sogar bis nach Auckland ausgestreckt. Annabelle bewunderte Maryann grenzenlos. Mit ihrem Charme hatte sie es sogar geschafft, die Hotelgäste mit Söhnen im besten Heiratsalter an das Hotel Mount Tarawera und an die Familie zu binden. Einige waren sogar aus Auckland angereist. Wie die Harpers, deren Sohn Maryann ihr, Annabelle, zugedacht hatte. Sie will mich loswerden und schnellstens unter die Haube bringen, dachte Annabelle, während sie zögernd ins Zimmer trat.
Vor dem Spiegel stand Olivia in einem bezaubernden roten Kleid, dessen Rock über und über mit weißen Stoffrosen verziert war. Maryann hatte es in langen Nächten selbst genäht. Ihr schwarzes Haar hatte Olivia zu einer üppigen Hochfrisur getürmt, und auf ihren Locken thronte keck ein rotes Hütchen, dessen Bänder unter dem Kinn zusammengebunden waren.
»Gefalle ich dir?«, fragte sie strahlend.
»Du bist umwerfend!« Annabelle war beeindruckt.
Im Vergleich zu ihrer schönen Schwester tauchte sie selbst nun im Spiegel auf wie ein Geist aus einer anderen Welt. Ihr dunkelblaues Kleid war wirklich nicht gerade schmeichelhaft, aber ein besseres besaß sie nicht. Olivia aber würde wohl auch so einem Kleid noch den nötigen Glanz verleihen. Das Einzige, was Annabelle an ihrem eigenen Aussehen mochte, war, dass sie alle um einen Kopf überragte. Maryann fand die Größe ihrer Ältesten allerdings eher hinderlich. Sie predigte Annabelle gnadenlos von Kindheit an, eine Frau müsse klein und zierlich sein, sie dürfe dem Mann höchstens bis zur Schulter reichen. Diesem Ideal entsprach Annabelle ganz und gar nicht. Im Gegenteil, es gab kaum einen Jungen in ihrem Alter, dem sie nicht über die Schulter spucken konnte.
»Vater meint, du könntest mir helfen, das richtige Kleid auszusuchen«, bemerkte Annabelle nun zögernd, aber Olivia schien ihre Anwesenheit kaum wahrzunehmen. Sie drehte sich vor dem Spiegel hin und her, als berausche sie sich an ihrem eigenen Anblick. Dann hielt sie plötzlich mitten in der Bewegung inne, sah mit zusammengekniffenen Augen zu ihrer Schwester hoch und stöhnte: »So wird dir John Harper nie einen Antrag machen. Du siehst ja aus wie ein Dienstmädchen!«
Annabelle zuckte mit den Achseln. Sie konnte diesen überheblichen Kerl ohnehin nicht leiden. Außerdem hatte er nur Augen für Olivia. Warum hatte Mutter sich bloß in den Kopf gesetzt, dass sie den Sohn des Richters aus Auckland heiraten sollte?
»Ich weiß. Deshalb bitte ich dich ja, mir zu helfen«, bemerkte Annabelle schwach.
»Oje«, stöhnte Olivia laut. »Dann wollen wir mal schauen, was du noch zu bieten hast. Das wird nicht leicht, aus dir einen schönen Schwan zu machen.«
Mit diesen Worten öffnete sie Annabelles Kleiderschrank und durchwühlte mit Kennerblick die bescheidene Garderobe ihrer Schwester.
»Das ist doch ganz nett!«, murmelte sie, während sie ein himmelblaues Kleid mit gerüschtem Rock hervorzog. »Wenn du das anziehst, wirst du die jungen Herren mit deinem Anblick blenden.« Olivia kicherte und drückte es ihrer Schwester in die Hand.
Die aber schüttelte nur traurig den Kopf. »Das kann ich nicht tragen. Es hängt nur noch im Schrank, damit du es eines Tages erbst.«
»Ich? Nein! So etwas würde ich niemals anziehen! Aber warum willst du das denn nicht tragen?«, gab Olivia schnippisch zurück.
»Es ist das Kleid, in dem ich letztes Jahr in Ohnmacht gefallen bin. An deinem siebzehnten Geburtstag. Schon vergessen?«
Olivia rollte mit den Augen. Nein, sie erinnerte sich nur zu genau. Es war furchtbar peinlich gewesen, als ihre Schwester, die ohnehin mit Abstand das dickste Mädchen war, das sie kannte, plötzlich vor allen Gästen die Augen verdreht hatte und zu Boden gesunken war. Nur, weil ihr Kleid zu eng war und sie keine Luft mehr bekam. Olivias Freundinnen hatten sich das Maul über Annabelle zerrissen. Dass sie wohl schwanger sei, aber von wem bloß?, hatten sie hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Mit einem energischen Griff hängte Olivia das Kleid in den Schrank zurück. Nein, noch einmal sollte Annabelle ihr nicht das Fest verderben.
»Ich glaube, es liegt gar nicht am Kleid«, seufzte Olivia, und ihr Blick fiel auf ein schwarzes Haarteil, das auf der Frisierkommode thronte und das sie für sich selbst zu üppig fand. »Es ist dein dünnes Haar. Wie wäre es damit?«
Annabelle erschrak, als ihr die jüngere Schwester mit einem monströsen Schopf dunkler Haare vor dem Gesicht herumwedelte.
Maryann wurde zunehmend nervöser. Dieses Fest musste einfach ein Erfolg werden. Schließlich konnte sie es sich nur einmal im Jahr leisten, solch einen Aufwand zu betreiben.
Sie warf einen letzten prüfenden Blick in die Küche. Dort bereitete Ruiha, ihre unentbehrliche Maoriköchin, bereits das Lamm vor. Sehr gut. Auf Ruiha war Verlass. Maryann wollte die Küchentür gerade wieder schließen, als sie einen hochgewachsenen Jungen entdeckte, der ungeschickt Kartoffeln schälte.
»Doch nicht so!«, fuhr sie ihn harsch an, während sie zu ihm eilte, ihm das Messer aus der Hand riss, eine Kartoffel schälte und ihn aufforderte, sich das genau anzusehen.
Aber der Junge trat nur einen Schritt zurück und ließ den Blick gelangweilt in die Ferne schweifen. Man sah es ihm förmlich an: Er dachte nicht daran, sich von der weißen Frau vorschreiben zu lassen, wie er zu arbeiten hatte.
Ruiha warf ihm einen strafenden Blick zu und befahl ihm auf Maori, höflich zu Maryann zu sein, aber er starrte sie finster an.
»Tante Ruiha, du kannst es gern in ihrer Sprache sagen. Ich kann nicht nur Englisch lesen, sondern auch sprechen. Damit sie auch weiß, dass du mir mehr Respekt für sie abforderst.«
»Was ist das für ein Junge?«, fragte Maryann erstaunt.
»Verzeihen Sie, Missy, es ist der Sohn einer Freundin aus meinem Stamm; sie ist schwer krank, und der Junge brauchte mal ein bisschen Abwechslung, da –«
»Schon gut«, unterbrach Maryann die junge Maori ungeduldig, legte Messer und Kartoffel in die Schüssel zurück und suchte den Blick des Jungen, der die Augen abwandte. »Wenn er schon hilft, dann soll er das ordentlich machen. Hast du gehört? Meine Sprache verstehst du ja, also tu, was ich dir sage!«
Kopfschüttelnd rauschte sie davon.
Kaum hatte Maryann die Küche verlassen, als Ruiha mit dem Jungen zu schimpfen begann. »Anaru, du bist störrisch wie ein Maultier. Sie wollte dir doch nur zeigen, wie du es richtig machen kannst.«
»Sie ist eine überhebliche Pakeha!«
Ruiha seufzte laut auf. »Nein, sie ist eine nette Frau. Sie ist nur ein wenig aufgeregt, weil ihre Tochter Olivia heute ihren achtzehnten Geburtstag feiert und sie viele junge Herren eingeladen hat, damit ihre Töchter gute Ehemänner bekommen.«
»Du meinst wohl reiche Pakeha!«
»Ach, Anaru, wenn du dich nicht benehmen kannst, dann nehm ich dich nie wieder mit in dieses Haus.«
»Darauf lege ich auch gar keinen Wert. Was soll ich in den Häusern der Weißen, die uns doch nur unser Land gestohlen haben?«, zischte er trotzig.
»Junge, was bist du nur für ein sturer Bengel! Ich arbeite seit drei Jahren hier und bin immer gut behandelt worden. Mister Bradley ist auch nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Er hat als Goldgräber in Australien geschuftet und sich dort das Geld verdient, mit dem er vor drei Jahren in unserer Wildnis noch einmal neu angefangen hat. Für dieses Stückchen Land, mein Junge, hat er einem unserer Stammesführer viel Geld bezahlt. Dass der nachher dem Alkohol verfallen ist, dafür kann Mister Bradley nichts. Die Bradleys haben hart geschuftet, um sich das hier aufzubauen. Mister Bradley hat es mit eigenen Händen getan. Erst haben sie nur ein paar Kammern im eigenen Haus vermietet, später hat er den Anbau für die Herberge gemacht. Die Fremden sind nicht vom ersten Tag an hergeströmt, aber inzwischen hat es sich bis in weite Teile des Landes herumgesprochen, dass es hier ein Hotel für Weiße gibt. Dein Groll missfällt deinen Ahnen und auch dein Neid, mein Junge.« Ruiha hielt erschöpft inne. Es war nicht ihre Art, lange Reden zu halten.
»Ich werde später auch mal reich sein«, erklärte der Junge trotzig, während er ins Leere zu starren schien. »Wenn jemand ein Recht hat, mit Fremden zum Mount Tarawera zu fahren und die Terrassen zu bestaunen, dann die Maori vom iwi der Te Arawa. Aber nicht die raffgierigen Pakeha!« Mit hoch erhobenem Kopf verließ er die Küche.
»O mein Gott, wie siehst du denn aus?«, fragte Maryann voller Entsetzen, als ihre Älteste wackelig die Treppe hinunterstieg. Auf einem schwarzen Lockenkopf thronte ein keckes Hütchen.
»Olivia meinte, mit meinem dünnen Haar guckt mich keiner der Burschen an.«
Maryann schluckte herunter, was ihr auf der Zunge lag. Annabelles Babylöckchen waren wirklich nicht gerade anziehend. Annabelles Äußeres hatte tatsächlich gewonnen. Dunkles volles Haar stand ihr gut. Wenn sie bloß eine schmalere Taille hätte! Gegen ihre üppigen Formen konnte auch das Korsett nichts ausrichten. Selbst wenn man es eng schnürte, würde man nie eine Wespentaille erreichen wie bei Olivia. Außerdem bestand die Gefahr, dass Annabelle dann wieder ohnmächtig wurde.
»Kannst du Ruiha bitte in der Küche helfen?«, bat sie ihre Tochter. Wenn Annabelle etwas perfekt beherrschte, war es jegliche Form von Hausarbeit. Sie wird einmal eine gute Ehefrau, dachte Maryann. Wenn sich doch nur endlich ein junger Mann für sie interessieren würde! John Harpers Mutter hätte wenigstens nichts gegen Annabelle als Schwiegertochter einzuwenden. Jetzt musste der junge Mann nur noch Feuer fangen.
Ob es richtig war, all diese jungen Männer einzuladen?, fragte Maryann sich im selben Atemzug. Wird nicht jeder sofort erahnen, dass ich die Große schnellstens unter die Haube bringen will, damit ich in aller Ruhe einen richtigen Ehemann für meine Olivia suchen kann? Ich hatte doch keine andere Wahl, beruhigte Maryann sich schließlich. Schließlich leben wir nicht mehr in Dunedin, wo es jede Menge guter Partien gibt. In diesem entlegenen Winkel, wo die weißen Siedler in der Minderheit sind, muss ich dem Glück meiner Töchter eben ein wenig nachhelfen.
»Wie schaust du denn aus?«, krähte jetzt Abigail, die mit ihren knapp acht Jahren noch nichts von den Sorgen der Großen ahnte. In ihrem weißen Rüschenkleid sah das Kind herzallerliebst aus. Maryann war immer wieder erstaunt, wie sehr die Kleine ihr ähnelte. Bis auf die Haarfarbe, die hatte Abi wohl von William geerbt. Der hatte als Kind vermutlich einen dichten goldblonden Schopf besessen. Maryanns Anspannung fiel für einen Augenblick von ihr ab, während sie ihrem Goldkind, wie sie Abigail stets zärtlich nannte, über die Lockenpracht strich.
»Hast du dich jetzt sattgesehen an meiner Schönheit?«, fragte Annabelle nun lachend, denn ihrer kleinen Schwester verzieh sie alles. In ihrer Gegenwart fühlte Annabelle sich sofort unbeschwerter. Kein Wunder, Abigails helles Kinderlachen war ansteckend.
»Mama, hast du für mich auch einen Jungen eingeladen?«, kicherte die Kleine nun und warf kokett den Kopf in den Nacken.
»Nein, du bist schön ruhig, wenn sich die Großen unterhalten. Dann darfst du auch recht lange mitfeiern.«
Abigail lachte und ergriff fordernd die Hand ihrer älteren Schwester. »Ich möchte aber nur mit dir feiern. Wir tanzen auch. Ja?«, plapperte sie treuherzig drauflos.
Dann habe ich wenigstens auch jemanden, der mir nicht von der Seite weicht, dachte Annabelle, die trotz des Haarteils, das Olivia geschickt an ihren Kringellöckchen festgesteckt hatte, nicht zu hoffen wagte, dass einer der Gäste ihr heute ernsthaft den Hof machen würde. Im Grunde ihres Herzens hatte sie sich bereits damit abgefunden, ihr Leben als alte Jungfer zu verbringen.
»Na, wie gefall ich euch?«, fragte Olivia, als sie nun die Treppe hinunterstolziert kam. In spöttischem Ton fügte sie hinzu: »Sieht Annabelle nicht umwerfend aus?«
Maryann aber hatte nur Augen für Olivia. Ein zufriedenes Strahlen huschte über ihr Gesicht.
»Du siehst bezaubernd aus, mein Schatz«, entfuhr es ihr, und der Stolz einer Mutter schwang unüberhörbar mit.
»Findest du?«, gab Olivia geschmeichelt zurück und drehte sich einmal um die eigene Achse.
Nach dem Essen wurde auf der hölzernen Veranda, die zum See führte, nach Herzenslust getanzt. Maryann hatte den irischstämmigen Lehrer Gerald O’Donnel überredet, auf dem Harmonium zu spielen. Die Jugend wiegte sich zu einer wilden Polka, und auch Maryann und William hatten sich unter die Tanzenden gemischt.
Maryann konnte sich allerdings nicht auf die Schritte konzentrieren, denn ihr Mann trat ihr ständig auf die Füße; außerdem sorgte sie sich um Annabelle. Das Mädchen stand mit der kleinen Abigail an der Hand in einer Ecke und beobachtete das fröhliche Treiben. Statt mit Annabelle zu tanzen, tobte John Harper mit Olivia im Arm an ihr vorbei, was Maryann außerordentlich missfiel. John Harper war der Mann, den sie für Annabelle ausgesucht hatte, nicht für Olivia. Die Familie Harper war zwar gesellschaftlich anerkannt, aber nicht reich. Für Olivia hoffte Maryann auf den Sohn von Mister Hamilton aus Auckland; doch leider war der Stammgast des Hotels allein angereist und schien nur Augen für die Wirtin zu haben. Jedenfalls schickte er ihr bewundernde Blicke vom Rande der Tanzfläche. Maryann zog es vor, den Kauriharzhändler aus Auckland einfach zu übersehen. Sie beobachtete stattdessen Olivia. Erleichtert stellte sie fest, dass der Tanzpartner ihrer Tochter nicht besonders zu behagen schien, denn sie zog ein säuerliches Gesicht, während John Harper sie anhimmelte. Das war die Gelegenheit, Schicksal zu spielen. Maryann blieb abrupt stehen und erklärte William, dass sie keine Lust mehr zum Tanzen habe.
Er entschuldigte sich betreten für seine Tollpatschigkeit, aber sie versicherte ihm, sie sei nur müde. In Wirklichkeit war Maryann wütend. Ihr schöner Plan schien überhaupt nicht aufzugehen. Es blieb ihr wohl nichts anderes übrig, als ein wenig nachzuhelfen, doch da hatte sich Olivia schon vom Arm ihres Kavaliers losgerissen und war in Richtung Garten gerannt. Eine gute Gelegenheit, Annabelle ins Spiel zu bringen.
Gesagt, getan. Maryann ließ William allein auf der Tanzfläche stehen und eilte zu Annabelle, griff sie am Arm und zog sie mit den Worten »Ich muss dir jemanden vorstellen« mit sich fort. Abigail aber ließ die Hand ihrer Schwester nicht los, sodass sie nun zu dritt vor dem Tisch der Harpers standen, an dem nur noch zwei Plätze frei waren.
»Abi, mein Goldkind, du suchst dir jetzt mal jemanden zum Spielen, hörst du?«, zischte Maryann ihrer Jüngsten zu.
Eleonore Harper, die so rundlich war, dass Annabelle dagegen schlank wirkte, strahlte über das ganze Gesicht, als sich Mutter und Tochter zu ihr setzten. Auch ihr Mann nickte höflich, bevor er wieder interessiert zur Tanzfläche stierte.
Merkt denn keiner, dass er all die jungen Mädchen förmlich mit den Augen verschlingt?, ging es Annabelle durch den Kopf, bevor die alte Harper sie in ein Gespräch über Mrs Beeton’s Book of Household Management verwickelte und von dem »himmlischen Werk« schwärmte. Zum Glück konnte Annabelle mitreden, denn dieses Buch hatte sie zum letzten Weihnachtsfest geschenkt bekommen. Annabelle kochte für ihr Leben gern, und die Rezepte hatten ihr Interesse geweckt. Während Eleonore Harper auf sie einredete, fiel Annabelle ein, dass sich Olivia über dieses Geschenk mokiert hatte. Zum Kochen habe man doch später eine Köchin, hatte sie behauptet. In Rotorua hatte keiner eine Köchin – bis auf ihre Mutter, aber Maryann leitete ein Hotel und brauchte eine Hilfe, weil sie zahlreiche Gäste zu versorgen hatte.
»Ich denke, es kann nichts schaden, wenn wir Hausfrauen die besseren Köchinnen sind als unser Personal, vor allem wenn sie Maori sind«, erklärte Eleonore Harper nun mit Nachdruck, als habe sie erraten, was in Annabelles Kopf vorging.
Damit riss sie Annabelle aus ihren Gedanken. Oder war es der Ellenbogen ihrer Mutter, den sie jetzt unsanft in der Seite spürte? Jedenfalls nickte Annabelle zustimmend. In dem Augenblick trat John Harper an den Tisch. Meine Schwester hat ihm bestimmt einen Korb gegeben, mutmaßte sie schadenfroh angesichts der tief eingekerbten Zornesfalte auf seiner Stirn.
»Haben Sie vielleicht Olivia gesehen?«, fragte er Maryann. Die schüttelte energisch den Kopf.
John wollte sich gerade auf die Suche nach ihr machen, als seine Mutter mit strenger Stimme befahl: »Bitte hol dir einen Stuhl, und nimm bei uns Platz!«
»Aber ich suche Olivia …«
»Kein Aber!«
Mit hochrotem Kopf gehorchte er. Sichtlich verärgert ließ er sich auf einen Stuhl fallen.
»Stell dir vor, Annabelle kennt Misses Beetons wunderbares Buch«, redete Misses Harper nun auf ihren störrisch dreinblickenden Sohn ein.
»Beeton?«, fragte er gelangweilt.
»Das Werk der besten Kochbuchautorin der Welt, der guten Isabella Beeton, die so tragisch verunglückt ist, und das so jung.«
»Kochbuch?« Sein Blick schweifte suchend über die Tanzfläche. Vergeblich. Von Olivia keine Spur.
Wahrscheinlich hat sie sich versteckt. Das ist ihr Lieblingsspiel, dachte Annabelle und grinste schadenfroh in sich hinein.
»Wollt ihr beiden euch nicht einmal die Hand geben?«, schlug Eleonore Harper vor und bediente sich dabei des Tons einer Kinderschwester, die den Nachwuchs ermahnte, den Finger aus der Nase zu nehmen.
Annabelle stieß einen unüberhörbaren Seufzer aus, was ihr einen kleinen Tritt ihrer Mutter unter dem Tisch einbrachte.
John stöhnte ungehemmt auf, streckte Annabelle die Hand entgegen, ohne sie anzusehen, und murmelte: »Guten Tag, wissen Sie vielleicht, wo Olivia steckt?«
Das Desinteresse beruhte ganz offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Annabelle mochte weder seinen hochmütig verzogenen Mund noch seine kalten blauen Augen. Statt ihm zu verraten, wo sie Olivia vermutete, zuckte sie nur mit den Schultern.
»Er wird sicher einmal Richter wie sein Vater. Wir haben ihn auf die beste Schule in Auckland geschickt, und er hat in London studiert. Im nächsten Jahr wird er in der Kanzlei seines Onkels in Dunedin anfangen. Wir werden dort ein Haus für ihn und seine zukünftige Familie bauen lassen«, bemerkte Eleonore Harper, nun sichtlich bemüht, ein Gespräch zwischen den beiden jungen Leuten in Gang zu bringen.
Annabelle hörte nur ein einziges Wort, das ihr Interesse weckte. Das war Dunedin, jene Stadt auf der Südinsel, die sie vor über drei Jahren Hals über Kopf verlassen hatten. Sie hatte sich nicht einmal mehr von ihrer besten Freundin verabschieden können.
Während Annabelle an diesen merkwürdigen Tag zurückdachte, hörte sie John Harper seiner Mutter für alle hörbar zuraunen: »Gib’s endlich auf, mich mit der da verkuppeln zu wollen. Ich werde in meinem Leben nicht so ein dickes Landei heiraten!«
Annabelle lief augenblicklich rot an vor Scham. Dann sprang sie behände von ihrem Stuhl auf, funkelte ihre Mutter an und zischte: »Er hat Recht. Wenn ich ehrlich bin, kann ich gut und gern darauf verzichten, diesen Angeber näher kennenzulernen. Ich konnte ihn vom ersten Augenblick an nicht ausstehen! Und Olivia mag ihn übrigens auch nicht! Sie findet ihn grässlich langweilig.«
Annabelle blickte noch einmal in die Runde, um sich an John Harpers verdutztem Gesicht zu weiden, bevor sie in Richtung See davonstolzierte. Nur nicht umdrehen!, ermahnte sie sich, während sie zum Bootssteg schritt.
Maryann entschuldigte sich mit hochrotem Kopf bei Misses Harper und wollte gerade aufspringen und ihrer Tochter nachlaufen, als Mister Harper sie zum Tanzen aufforderte.
»Aber … ich … ich bin … kann gerade nicht … Meine Tochter …«, begann sie, um sich herauszureden, doch er ließ ihr keine Wahl. Er nahm ihre Hand und führte sie zur Tanzfläche.
»Ich heiße Frank«, flüsterte er Maryann ins Ohr. Sie reagierte nicht auf diese plumpe Vertraulichkeit, sondern überlegte fieberhaft, wie sie den Kerl schnellstens wieder loswerden könnte.
»Maryann, ich darf dich doch so nennen, oder?« Er wartete keine Antwort ab, sondern duzte sie vertraulich, während er ihr ganz unverblümt ein Angebot machte. Nicht nur sein alkoholgetränkter Atem erregte bei ihr Übelkeit. »Verlass deinen Farmer! Der hat doch gar nicht dein Format. Und zieh zu mir nach Auckland!«
Maryann war sprachlos. Schließlich stieß sie fassungslos »Aber Sie sind doch verheiratet!« hervor und versuchte sich loszumachen.
Aber Frank Harper drückte sie nur noch fester an sich. »Das alte Walross werde ich schon irgendwie los. Bei mir musst du bestimmt nicht so hart schuften wie hier, Maryann. Du kannst deine schönen Hände ganz allein auf mich verwenden.«
Unvermittelt blieb Maryann stehen. Sie funkelte den unverschämten Richter voller Empörung an und fauchte: »Nur aus Rücksicht auf Ihre Frau, die uns die ganze Zeit beobachtet, werde ich Ihnen jetzt die Ohrfeige ersparen, die Ihnen gebührt. Aber wenn Sie noch einmal wagen sollten, mich anzurühren oder mir so einen unschicklichen Antrag zu machen, dann werden Sie noch bedauern, jemals geboren zu sein. Mein Mann ist tausendmal anständiger als so einer wie Sie!«
Mit diesen Worten stieß sie ihn von sich, drehte sich auf dem Absatz um und lief geradewegs Mister Hamilton in die Arme.
»Wollen wir tanzen, schöne Frau?«, säuselte er, aber Maryann zischte nur ein schneidendes »Nein« und verschwand im Haus.
Dort atmete sie ein paarmal tief durch und kämpfte gegen die Tränen an. Am liebsten würde sie das Fest sofort beenden, aber so schnell wollte sie sich nicht geschlagen geben – schon gar nicht wegen so einem widerlichen Kerl wie Harper. Sie, Maryann Bradley, würde sich nicht von ihrem Plan abbringen lassen. Sie wollte reiche Ehemänner aus den allerbesten Familien für ihre Töchter! Harper ist ab sofort von der Liste gestrichen, doch wie wäre es mit dem Sohn des Holzhändlers aus Taupo für Annabelle?, ging Maryann durch den Kopf. Entschieden wischte sie sich eine Träne aus dem Augenwinkel, setzte ihr strahlendes Lächeln auf und steuerte auf Mister Hamilton zu, der ihr gefolgt war.
»Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen eben einen Korb gegeben habe, aber ich hatte mich über meine Tochter Annabelle geärgert. Warum haben Sie Ihren reizenden Sohn, von dem Sie mir schon so viel vorgeschwärmt haben, eigentlich nicht mitgebracht? Wissen Sie, ich würde ihn wahnsinnig gern einmal kennenlernen. Wie hieß er noch gleich?«
Mister Hamilton schien förmlich dahinzuschmelzen. »Allan!«, flötete er und fügte einschmeichelnd hinzu: »Ich verspreche Ihnen hoch und heilig: Beim nächsten Mal bringe ich ihn mit!«
Na hoffentlich!, dachte Maryann grimmig.
Annabelle hatte nur noch einen Wunsch: Weg, weit weg zu sein von diesem verlogenen Fest, bei dem es nur darum ging, sie irgendwie unter die Haube zu bringen. Sie schüttelte sich bei dem Gedanken, dass ihre Mutter sie mit so einem dummen Burschen verkuppeln wollte.
Der See lag ganz ruhig da. Kein Lüftchen regte sich, und unter dem blauen Januarhimmel schimmerte das Wasser heute gar nicht so gelblich wie sonst, sondern grün wie in der Sonne blitzende Jade. Ohne nachzudenken, sprang Annabelle in eines der Ruderboote, mit denen die Hotelgäste kleine Lustfahrten auf den See hinaus unternehmen konnten. Sie wollte gerade ein paar kräftige Züge tun, um möglichst schnell weit weg vom Ufer zu gelangen, als sie Abigail rufen hörte: »Bitte, Annabelle, nimm mich doch mit! Es ist so blöd mit all den Erwachsenen.«
Annabelle wäre in diesem Augenblick lieber allein gewesen, aber der Kleinen konnte sie keinen Wunsch abschlagen. Ihr Herz ging auf, als sie ihre süße Schwester mit den blonden Löckchen und dem lachenden Gesicht erwartungsfroh auf dem Steg stehen sah.
»Komm, ich heb dich ins Boot.« Annabelle stand vorsichtig auf, womit sie die Nussschale dennoch gefährlich zum Schaukeln brachte. »Du musst aber still sitzen«, mahnte sie, während sie auf den See hinausglitten.
»Olivia hat sich vor John Harper im Garten versteckt.« Abigail kicherte.
Annabelle holte die Ruder ein und ließ das Boot in der Sonne dümpeln, damit sie sich Schuhe und Strümpfe ausziehen konnte. »John Harper ist ein Dummkopf!«, sagte sie. Dann verfiel sie in Schweigen und schaute über den See. Wie gern würde sie einmal nach Mokoia rudern! Aber sie traute sich nicht. Man erzählte sich, dass die Geister der Toten, die den Überfällen des rebellischen Häuptlings Te Kooti zum Opfer gefallen waren, dort ihr Unwesen trieben und unerlöste Kinderseelen auf der Insel wohnen würden.
»Komm, wir fahren nach Mokoia«, schlug Abigail vor, sprang hoch und klatschte vor Vergnügen in die Hände. Dabei geriet das Boot gefährlich ins Wanken.
»Nein, du weißt doch, dass es viel zu weit ist. Außerdem finde ich es da unheimlich.«
»Ich weiß, du hast Angst vor den toten Kindern, aber das ist nicht wahr. Das haben mir die Maorikinder in der Schule auch weiszumachen versucht, aber ich glaube ihnen kein Wort. Bitte, lass uns zur Insel fahren …«
Schließlich bettelte sie so lange, bis Annabelle nachgab. »Gut, aber nur bis zum Ufer. Wir steigen auf keinen Fall aus. Verstanden?«
Abigail nickte, und Annabelle ruderte kräftig drauflos. Ihre Gedanken schweiften noch einmal zurück zu der peinlichen Situation auf dem Fest. Was dachte sich ihre Mutter eigentlich dabei, sie so einem Fremden anzudienen? Wobei, wenn sie es so recht überlegte, war es ja eher seine Mutter gewesen, die das Ganze auf die Spitze getrieben hatte. Annabelle konnte nichts dagegen tun. Sie gönnte es diesem Bengel von Herzen, dass Olivia ihn hatte abblitzen lassen. Nur fürchtete sie die Schelte, mit der ihre Mutter sie strafen würde. Sie ahnte schon, was sie sagen würde. So redet eine junge Dame nicht. Du wirst nie einen Mann finden!
Dann eben nicht!, dachte Annabelle trotzig. Dann werde ich eben eine alte Jungfer wie die Tante des Doktors, die alte Miss Fuller.
»Da schau nur!«, rief Abigail begeistert und deutete auf einen Vogel, der über ihre Köpfe hinwegflatterte. »Eine Möwe mit rotem Schnabel.«
Annabelle hielt die Augen jedoch starr nach vorn gerichtet. Vor ihnen lag nun wie ein grüner Hügel die Insel Mokoia. Je mehr sie sich dem Ufer näherten, desto stärker wuchs Annabelles Unbehagen. Wahrscheinlich wollen die Maori vom Stamm der Te Arawa uns Weiße mit diesen schaurigen Geschichten wirklich nur davon abhalten, die Insel zu betreten, weil sie ihnen heilig ist, dachte sie und redete sich gut zu. Trotzdem traute sich Annabelle nicht, das Boot festzumachen, auszusteigen und durch den Urwald zu wandern.
»Noch näher!«, bat Abigail begeistert, als das Ufer bereits zum Greifen nahe war.
Annabelle ruderte so dicht heran, dass man nur noch aufstehen und hinüberspringen müsste, wenn man es denn wollte. Ehe sie sich versah, versuchte Abigail genau das, doch sie landete nicht am rettenden Ufer, sondern mit einem lauten Platsch im Wasser.
»Stell dich hin! Versuch, Grund unter die Füße zu bekommen«, befahl Annabelle der Schwester.
Doch die schrie nur »Geht nicht, zu tief!« und zappelte wild umher.
Annabelle überlegte fieberhaft. Was sollte sie tun? Anscheinend war das Wasser der Uferzone tiefer, als sie geglaubt hatte. Sollte sie springen? Aber sie konnte doch nicht schwimmen.
»Ich gehe unter. Hilfe!«, brüllte Abigail aus Leibeskräften und schlug um sich.
Panisch warf Annabelle der Kleinen das Tau zu, mit dem das Boot festgemacht wurde, aber Abigail nahm es gar nicht wahr. Sie versuchte sich mit aller Kraft über Wasser zu halten und brüllte wie am Spieß.
Das wird sie nicht lange durchhalten, durchfuhr es Annabelle, als plötzlich ein Boot auftauchte. Der Mann, der es mit kräftigen Schlägen ruderte, rief wütend: »Ihr verscheucht mir die Fische!« Doch als er erfasste, was passiert war, sprang er, ohne zu zögern, in den See und schwamm auf ihre Schwester zu.
Annabelle zitterte am ganzen Körper, während der Mann Abigail packte und über die Bordwand hielt. Sie spuckte und schrie.
»Zieh!«, brüllte der Mann Annabelle zu. »Nun zieh doch endlich!« Wie von Sinnen zerrte sie am Kleid ihrer Schwester, bis sie die klatschnasse Kleine sicher zu sich ins Boot geholt hatte.
Der Mann schwamm bereits zu seinem Boot zurück und bemühte sich ächzend, wieder hineinzukriechen. Ein Bein hatte er schon über die Bordwand gehievt, während das andere über dem Wasser zappelte. Das sah so komisch aus, dass Annabelle in wieherndes Gelächter ausbrach. Es war eine Mischung aus Erleichterung darüber, dass Abigail nichts geschehen war, und dem Vergnügen, den Mann so strampeln zu sehen. Schließlich plumpste der Retter fluchend in sein Boot, rappelte sich auf und drehte sich um. Annabelle befürchtete schon, er würde sie ausschimpfen, denn wer wurde zum Dank für seine Hilfe schon gern ausgelacht?