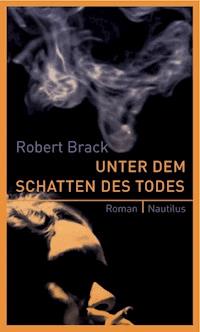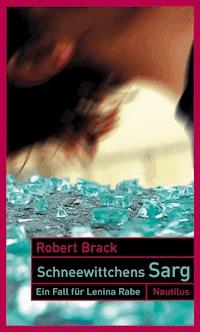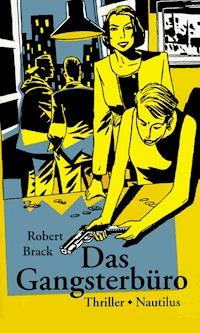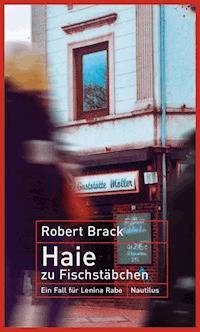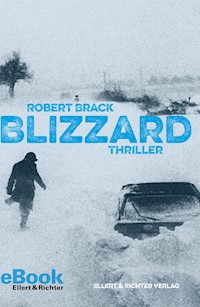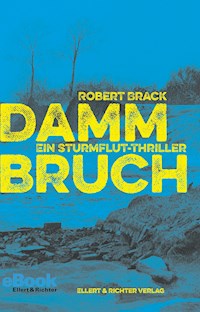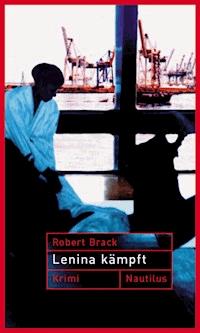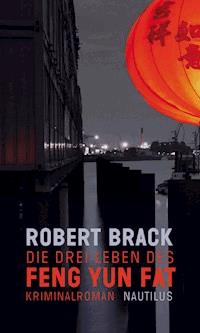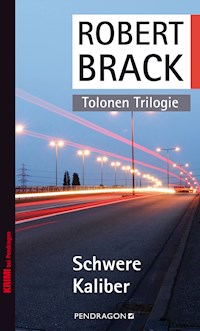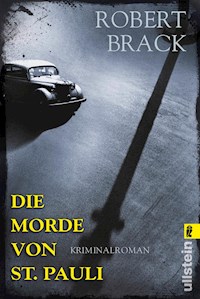
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
1927 – Hamburg in den Goldenen Zwanzigern: Eine Mordserie hält die Unterwelt von St. Pauli in Atem. Die Opfer sind Zuhälter, Betrüger und Einbrecher, und sie werden spektakulär im Viertel zur Schau gestellt: auf dem Kirchhof, im Wachsfiguren-Panoptikum, an der Kersten-Miles-Brücke. Ein Bandenkrieg? Zur selben Zeit ermittelt Kriminalkommissar Alfred Weber in den bürgerlichen Vierteln der Hansestadt, nachdem ein einflussreicher Reeder einem Raubmord zum Opfer gefallen ist. Weber sieht Zusammenhänge, wo andere keine wahrnehmen wollen. Doch dass er kein Phantom jagt, muss er bald schon am eigenen Leib erfahren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Hamburg im Rausch der wilden Zwanziger: Die Wirtschaft brummt, die Hanseaten fahren wieder große Gewinne ein, und auf St. Pauli wird rund um die Uhr gefeiert, während Prostitution, Zuhälterei und Rauschgifthandel florieren. Doch eine Mordserie erschüttert die Unterwelt des Rotlichtviertels. Zuhälter, Betrüger und Einbrecher, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, sind die Opfer. Sie werden spektakulär zur Schau gestellt, aber niemand versteht die Absicht hinter diesen grausigen Inszenierungen. Ist hier ein Wahnsinniger am Werk? Geht ein besonders phantasievoller Auftragskiller seiner Arbeit nach? Oder findet »nur« ein Bandenkrieg statt?
Zeitgleich ermittelt Kriminalkommissar Alfred Weber in den bürgerlichen Elbvororten, wo die heile Welt der Hanseaten durch einen bizarren Raubmord erschüttert wurde. Weber sieht als Einziger einen Zusammenhang zwischen diesem Einbruch und den Morden im Milieu der Gangster und Ganoven. Doch was die Rosenblätter im Mund eines toten Justiziars aus Winterhude mit den immer höher hängenden Leichen auf St. Pauli zu tun haben, bleibt auch ihm leider viel zu lange verborgen …
Der Autor
Robert Brack, geboren 1959, lebt seit 1981 in Hamburg. Er arbeitet als Übersetzer und freier Schriftsteller. Für seine Kriminalromane wurde er mit dem »Marlowe« der Raymond-Chandler-Gesellschaft und dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet. Mehr unter: www.gangsterbuero.de
Von Robert Brack ist in unserem Hause bereits erschienen:
Die Toten von St. Pauli
Robert Brack
Die Morde von St. Pauli
Kriminalroman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1514-0
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage April 2017
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: Getty Images/© FPG; gettyimages/© Sheri Blaney (Auto)
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Könige sind sie der mondlosen Nacht,die Dunkelheit ist ihr Reich.Den Tod haben sie mitgebracht,Entsetzen säen sie gleich.
Louis Feuillade, Les Vampires
Im nächsten Augenblick erzitterte die Stahlkammer leiseund versank gespensterhaft in der Tiefe.
Adolf Sommerfeld, Der Tresor unter Wasser
Erstes Kapitel:DIE MACHT DER FINSTERNIS
Der Tod kam mit dem Ruderboot, nicht auf einer Viermastbark, wie der alte Reeder es sich vielleicht gewünscht hätte. Das Boot glitt in dieser lauen Sommernacht des Jahres 1927 fast lautlos über den Kanal, denn der Eindringling verwendete einen Peekhaken statt eines Paddels, um keine Geräusche zu verursachen. Aufrecht stehend stach er mit der Stange in den Grund und trieb das Boot voran.
Er trug einen eng anliegenden, schwarzen Anzug und eine Maske, die den gesamten Kopf bedeckte und nur Öffnungen für Augen, Nase und Mund hatte.
Auch das Wasser war schwarz, wie der Himmel, denn es war eine Neumondnacht. Das Boot glitt den Leinpfadkanal entlang, bog nach rechts ab, fuhr unter einer kleinen Brücke hindurch und erreichte die Alster. Unter der Brücke hockte die dunkle Gestalt sich hin, um sich nicht den Kopf zu stoßen. Nun ging es nach links, quer über die Alster, dorthin, wo der Fluss zum See wurde.
Vom Wasser aus waren die Schattenrisse herrschaftlicher Villen zu sehen, deren Grundstücke bis ans Wasser reichten. Das größte Haus mit dem weitläufigsten Grundstück hob sich trotz der schwarzen Nacht hell schimmernd vom tiefdunklen Hintergrund ab. Es stand weiter oben auf einem Hügel, um den sich eine Rasenfläche bis zum Ufer ausdehnte. Der Eindringling steuerte zielstrebig die Anlegestelle am Ende des Grundstücks an, die aus unverwüstlichem Tropenholz gezimmert war, aber so gut wie nie benutzt wurde.
Dort band er das Boot mit einem leicht zu lösenden Seemannsknoten fest und stieg mit einem großen Schritt auf den Anleger. Außer einem fingerdicken, langen Hanfseil, das er um den Körper geknotet hatte, trug er noch einige Einbrecherwerkzeuge und eine Taschenlampe bei sich, die mit Karabinerhaken am Gürtel befestigt waren, ebenso wie das Ledertäschchen, dessen Inhalt bald zum Einsatz kommen sollte. Die dunkle Gestalt lief über den Rasen auf das weiße Haus auf dem Hügel zu.
Auf der Rückseite der dreistöckigen Villa, die von einem achteckigen Turm gekrönt wurde, befand sich eine runde, von ionischen Säulen begrenzte Terrasse. Darüber dehnte sich ein großer Balkon mit barocker Brüstung aus.
Hinter den hohen Fenstern im Erdgeschoss war kein Licht zu sehen, sie waren von innen mit schweren Läden aus Holz verbarrikadiert, die Fenster in der ersten Etage lagen im Dunkeln. Die Fenster des darüber liegenden Geschosses waren nicht mehr zu sehen, wenn man dicht vor dem Haus stand, da ein umlaufender zweiter Balkon sie verdeckte.
Der Einbrecher blieb kurz vor der Hauswand stehen, fasste dann mit der Hand in eine Mauerspalte, setzte einen Fuß in eine andere, zog sich hoch und kletterte, Fugen und Vorsprünge nutzend, die Fassade hinauf.
Ein kurzer Blick auf den Balkon, der ebenso kahl war wie die Veranda, und weiter ging’s über Fensterbänke und Simse zur nächsten Etage und vom zweiten Balkon auf den Turm hinauf. Konzentriert und zügig und ohne das geringste Zögern.
Die Falltür im Boden oben auf dem Turm war weder verschlossen noch von innen gesichert. Sie hochzuziehen erforderte nicht viel Kraft, aber sie knarrte leise. Ein Metallstab hielt sie offen. Unter der Tür befand sich eine steile Holztreppe.
Der Eindringling löste die Taschenlampe vom Gürtel, schaltete sie ein und leuchtete kurz nach unten. Er knipste sie wieder aus und ging mit flinken Schritten die Treppe hinunter. Das obere Turmzimmer wirkte wie die Brücke eines Schiffs: Ferngläser, Teleskope, Kladden und Bücher, eine Sternkarte und ein Stadtplan lagen herum, einige Stifte und nicht näher zu identifizierende Geräte. In das untere Turmzimmer gelangte man über eine schmale Steintreppe.
Eine Spindeltreppe führte von dort weiter hinab, und es gab eine Tür zur zweiten Etage. Sie ließ sich mit einem leise schabenden Geräusch öffnen. Dahinter ein Flur mit Teppich, zwei Lüstern unter der Decke, Bildern und Leuchtern an den Wänden. Die erste Tür führte zum Studierzimmer des alten Brunswiek, die zweite in sein Schlafzimmer.
In dieser Nacht war nur der alte Reeder im Haus. Der Gärtner, der auch als Chauffeur diente, wohnte über der separat gebauten Garage. Die Haushälterin kam erst um sieben Uhr, um das Frühstück vorzubereiten. Die dunkle Gestalt tastete nach der Ledertasche links am Gürtel, öffnete sie und zog ein Tuch und ein Fläschchen hervor.
Ein lautes Schnarchen war zu hören, aber der Einbrecher war wegen der Maske leicht schwerhörig. Er schätzte die Herkunft des Geräuschs falsch ein und schob die Tür zum Schlafzimmer auf. Das breite Bett unter dem riesigen Gemälde, das einen Brunswiek’schen Viermaster zeigte, war zerwühlt, aber keiner lag darin.
Der Eindringling warf einen kurzen Blick in alle Ecken und verließ rückwärts das Schlafzimmer. Er trat vor die andere Tür und drückte vorsichtig die Klinke herunter. Schweres Eichenholz. Die Scharniere quietschten leise, als die Tür einen Spaltbreit aufging. Er vernahm ein ungleichmäßiges Schnarchen. Die Tür wurde von etwas blockiert. Durch den Spalt war der Schreibtisch des Reeders zu sehen und er selbst auch. Mit seinem Gesicht mit dem weißen Backenbart à la Bismarck und der breiten, schweren Brust lag er auf dem Pult und machte ein Geräusch, als wollte er die dicke Tischplatte zersägen.
Die dunkle Gestalt drückte fester gegen die Tür. Sie nahm den rechten Fuß zu Hilfe, lehnte sich schließlich auch mit der Schulter dagegen. Und da ging es … und es schepperte und klapperte und klöterte … eine ganze Seehandelsflotte fiel um wie bei einem Dominoeffekt. Dreimaster, Viermaster, schnittige Klipper, breite Ewer und sogar zwei fette Dampfer kippten übereinander.
Der alte Reeder schreckte hoch, seine Augenlider flatterten. Kündigte sich da schon wieder eine Handelskrise an, wollten die Alliierten sich ein weiteres Mal die Brunswiek-Flotte unter den Nagel reißen? Den Stolz der Reederei versenken? Waren es Kanonenboote? Piraten?
Er stemmte sich hoch und sah, wie ein Schatten sich näherte, dessen Umrisse ihn seltsamerweise an einen griechischen Adonis erinnerten. Der alte Reeder sprang auf, ballte die Fäuste, hob sie an, doch auf halbem Weg erwischte ihn etwas im Gesicht. Erst dachte er, ein Putzlumpen, dann spürte er einen eisigen Hauch, dann fühlte es sich an, als würde eine eklige Qualle an seinem Gesicht kleben. Er bekam keine Luft mehr. Etwas anderes strömte in seine Lunge, aber Luft war es nicht. Die Kräfte verließen ihn. Er kippte nach vorn, tastete instinktiv nach dem Messer, mit dem er eben noch ein nautisches Fachbuch aufgeschnitten hatte, verfehlte es aber. Dann wich alle Kraft aus ihm, und sein Kopf fiel auf die Tischplatte. Die scharfe Schneide des Messers ritzte seine Wange auf. Blut tropfte aus der Wunde.
Der Einbrecher hatte, als er nach vorne gesprungen war, die Miniaturflotte zertrampelt, die eben noch stolz den hölzernen Ozean des Studierzimmerfußbodens beherrscht hatte. Segelschiffe und Dampfer hatten Masten und Schornsteine verloren. Ein kleiner Ewer zerknackte jetzt unter den Fußsohlen des Eindringlings. Die Bastelarbeit vieler Jahre war zerstört.
Er achtete nicht weiter auf die zerbrochenen Schiffsmodelle. Er holte eine Rolle Leukoplast aus der Tasche, fesselte dem mit Chloroform betäubten Reeder die Hände auf dem Rücken und klebte ihm den Mund zu. Nach kurzem Zögern fixierte er auch noch die Fußgelenke des Alten an den Stuhlbeinen.
Anschließend wandte sich der Eindringling dem Tresor zu, der unter einem Gemälde mit vergoldetem Rahmen stand. Das Gemälde zeigte einen Brunswiek-Dampfer mit drei Schornsteinen im Hamburger Hafen vor der Silhouette des Kaispeichers A mit dem Zeitball auf dem Dach.
Der Einbrecher kniete sich vor den Panzerschrank und drehte an dem Kombinationsschloss, stellte eine bestimmte Zahlenfolge ein. Aber das Schloss spielte nicht mit. Er packte den Griff, zog, zerrte und rüttelte, aber die Stahltür blieb verschlossen. Weitere Versuche waren ebenfalls erfolglos.
Leise fluchend stand er auf und trat hinter den Schreibtisch. Er packte den alten Reeder und setzte ihn aufrecht in seinen Lehnstuhl. Der Kopf des Alten fiel zur Seite. Das Blut hatte den Backenbart an der rechten Wange rot verfärbt. Es tropfte auf seinen Hausmantel.
Die schwarze Gestalt holte eine Flasche Riechsalz aus ihrem Täschchen, schraubte sie auf und hielt sie dem Alten unter die Nase. Der riss die Augen auf und schaute den Eindringling störrisch an.
»Der Tresor, die Kombination!« Der Eindringling zog dem alten Brunswiek das Pflaster vom Mund, aber der weigerte sich zu sprechen.
»Du willst also leiden?«, schrie er ihn an und gab dem Alten eine Ohrfeige.
Brunswiek blieb verstockt.
Noch eine Ohrfeige. Drohen mit dem Messer. »Ich schneide dir die Finger ab.«
Brunswiek schien das egal zu sein. Er war völlig apathisch, als hätte er mit dem Leben abgeschlossen.
Da griff der Einbrecher zum letzten Mittel. Er zog eine Bleistiftzeichnung aus der Ledertasche und hielt sie ins Licht der Tischlampe.
Auf dem detaillierten, realistischen Bild war eine Frau zu sehen, mit genau gezeichneten Gesichtszügen. Nackt, an einen Pfahl gekettet, stand sie auf einem Scheiterhaufen. Jemand hielt eine brennende Fackel an das Reisig.
Brunswieks Augen weiteten sich.
»Das werden wir mit ihr tun«, blaffte ihn die schwarze Gestalt an. »Es sei denn, du sagst mir die Zahlen.«
Brunswiek flüsterte die Kombination. Der Einbrecher drehte erneut am Schloss und zog die Stahltür des Tresors auf. Darin stapelten sich Papiere und Geldscheine, auch einige Goldbarren waren vorhanden.
Der Einbrecher zog einen Leinensack vom Gürtel. Papiere, Geldscheine und Barren verschwanden darin.
Der Tresor war nun leer.
Der Einbrecher drehte sich um und schaute nach dem Reeder. Der Kopf des Alten war zurückgefallen, sein Mund stand weit offen, die Augen starrten zur Decke.
Der Eindringling beugte sich über den Alten, horchte, ob er noch atmete. Fühlt den Puls am Hals. Nichts.
Er wandte sich ab, griff nach dem Sack mit der Beute und warf ihn über die Schulter. Er drehte sich wieder um und starrte den Toten nachdenklich an.
Das Blut tropfte noch aus dem Backenbart. »Gut, sehr gut«, sagte der Einbrecher schließlich, hob das rechte Bein und versetzte dem Stuhl einen so starken Tritt, dass er umkippte.
Jetzt lag der tote Reeder auf dem Boden vor seiner havarierten Flotte.
Die schwarze Gestalt verließ das Studierzimmer, öffnete ein Fenster am Ende des Flurs, stieg auf den Sims und kletterte flink am Regenrohr nach unten. Die Strecke bis zum Ufer legte sie im Laufschritt zurück. Dort angekommen, warf sie den Sack ins Boot und griff nach dem Peekhaken.
Das Boot glitt über das schwarze Wasser davon. Die Umrisse der Gestalt verloren sich in der Neumondnacht.
Zweites Kapitel:JENSEITS DER STRASSE
Weber saß im Laubfrosch und hatte Grün. Dieser verflixte Verkehr! Automobile, wohin man schaute. Dabei hätte alles so schön sein können. Der Himmel war strahlend blau, die Binnenalster glitzerte silbrig, über dem Hotel Vierjahreszeiten wehten die bunten Fahnen. Ein Alsterdampfer glitt übers Wasser, ein Zug der Verbindungsbahn schob sich kreischend über die Lombardsbrücke. Eine Straßenbahn wartete geduldig neben Webers Opel. Eine junge Frau in hellem Kleid mit Hütchen und Schirm stand lässig auf der Plattform und warf ihm einen Blick zu. Interessiert, wie er fand. Der Schirmrand hatte Rüschen.
»Na los doch, Mann!«, schrie sein Beifahrer ihm ins Ohr. »Grün!«
Die Aufgabe war, die Kupplung mit dem Fuß zu drücken, den Gang einzulegen, die Handbremse zu lösen, den Gashebel am Lenkrad zu betätigen. Dann anrollen, Fahrt aufnehmen, in den zweiten Gang schalten und außerdem noch lenken, damit der Zweisitzer mit dem offenen Verdeck und dem charakteristischen Bootsheck nach links in die Straße Neuer Jungfernstieg fuhr. Möglichst in einem eleganten Bogen – wegen der Rüschen am Schirmrand und des hübschen Gesichts darunter.
Andere Automobilisten kamen ihm aus der Esplanade entgegen und wollten ebenfalls links abbiegen, Richtung Alsterglacis. Schön und gut, aber wie viele Fahrzeuge passten auf so eine Kreuzung? Wie lange blieb die Ampel grün? Außerdem hatte Weber immer noch nicht verstanden, was sein Beifahrer meinte, wenn er befahl, er solle um den entgegenkommenden Linksabbieger herumfahren. Wie ging das, ohne ihn zu schneiden? Und vor allem: Wusste der Entgegenkommende darüber Bescheid?
Der Motor stotterte, der Wagen ruckte. Webers Hände verloren die Orientierung zwischen Lenkrad, Gas- und Schalthebel. Seine Füße wussten nicht mehr, wo die Kupplung und wo die Bremse war. Weber trat auf die Kupplung. Der Motor heulte auf. Erschrocken hob er den Fuß an, und der Opel 4/12 PS machte einen Satz auf den entgegenkommenden Ford zu. Der wich schlingernd aus, und der Fahrer drohte mit der Faust. Weber wurde samt Beifahrer nach vorn geschleudert, als er in unnötiger Panik die Bremse betätigte. Der Motor erstarb, und der Laubfrosch kam schlagartig zum Stehen.
»Rechts vorbei!«, schrie der Beifahrer, als es längst zu spät war.
Die Tram klingelte hämisch und setzte sich in Bewegung. Eine schmale Hand unter dem Rüschenschirm winkte ihm zu, aber vielleicht bildete er sich das auch nur ein. Die Straßenbahn verschwand, und jetzt wurde der Laubfrosch vom Gegenverkehr belagert. Quäkendes Hupen, Geschimpfe, anfeuernde Rufe. Aber der Motor wollte nicht.
Weber fing an zu schwitzen, als er unter dem Armaturenbrett den Schalter der Zündung umlegte und den Anlasser betätigte. Nur zündete nichts. War die Batterie leer?
»Na hören Sie mal, Weber, muss ich jetzt etwa kurbeln?«
Weber zuckte schuldbewusst mit den Schultern. Wieso war Autofahren nur so schwierig, warum konnten die Dinger nicht von allein fahren?
»Soll ich …?«, fragte er.
»Ach was.« Der Beifahrer bückte sich, um die Kurbel zu suchen. Die anderen Verkehrsteilnehmer fanden Wege um den Laubfrosch herum. Trotzdem, der Verkehr stockte, und das konnte der Beamte der Verkehrspolizei nicht zulassen, der von einem kleinen Podest aus die Kreuzung mit der ersten Ampelanlage Hamburgs überwachte. Er hob seinen Polizeistab und deutete damit in den Himmel, als gäbe es ein höheres Gesetz, das ihn ermächtigte, in das Verkehrschaos einzuschreiten. Der Verkehr kam zum Stillstand. Während der Wachtmeister in die Mitte der Kreuzung marschierte, schob Webers Beifahrer mit der Kurbel in der Hand die Tür auf.
Der Polizeibeamte lehnte sich mit seinem ganzen, nicht unerheblichen Gewicht auf die Fahrertür und stellte fest: »Abgewürgt, was?«
Weber nickte schwach. Hilfesuchend schaute er zu seinem Beifahrer, der sich aber gerade vor der Motorhaube verbeugte.
»Dann darf ich mal Ihren Führerschein sehen, bitte!«
Weber fiel wieder ein, was er vor unendlich langer Zeit einmal auswendig gelernt hatte: »Führer von Kraftfahrzeugen müssen ihre Zuverlässigkeit nachweisen. Sie dürfen namentlich nicht dem Trunke ergeben sein oder zu Ausschweifungen, insbesondere zu Rohheitsvergehen, neigen. Sie müssen durch amtsärztliches Zeugnis nachweisen, dass sie keine körperlichen Mängel haben, die ihre Fähigkeit, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen, beeinträchtigen. Nach Darlegung ihrer technischen Befähigung werden sie durch einen Führerschein zur Führung von Kraftfahrzeugen befugt.« So stand es seit dem ersten April 1910 in den reichsrechtlichen Vorschriften. Seit dem ersten April?
»Aber ich habe doch keinen Führerschein.«
»Wie bitte?« Die Augen des Verkehrspolizisten blitzten auf, und er umfasste mit beiden Händen den Stab.
»Sehen Sie, ich bin noch nicht daran gewöhnt, das heißt, genauer gesagt, ist es so, dass …«
»Gang rausnehmen!«, schrie der Beifahrer, dessen Kopf noch immer nicht sichtbar war. Weber trat auf den Pedalen herum und rüttelte an der Schaltung.
Der Beifahrer drehte die Kurbel, sein Rücken erschien in regelmäßigen Abständen oberhalb der Kühlerhaube und verschwand wieder. Der Motor seufzte nur.
»Stopp!«, rief der Beamte. »So geht das nicht!« Seine buschigen Augenbrauen schoben sich zusammen, der Mund hinter dem Vollbart verzog sich missbilligend. Er streckte Weber eine Hand entgegen: »Papiere zur Legitimation!«
»Was?«
»Können Sie sich ausweisen?«, fragte der Polizist und betonte jedes Wort.
Der Motor des Wagens sprang keuchend an und drehte sich dann stotternd im Leerlauf. Weber griff in die Innentasche seines Jacketts und zog seine Brieftasche hervor. Die Polizeimarke fiel ihm in den Schoß.
»Oh«, sagte der Wachtmeister bei ihrem Anblick.
Der Beifahrer stieg wieder in den Wagen. »Na, was gibt’s denn?«, fragte er leutselig.
»Ich soll mich legitimieren«, erklärte Weber, während ihm sein Dienstausweis herunterfiel. Um sie herum quäkten Hupen, Fahrradklingeln rasselten schrill, und eine weitere Tram bimmelte hysterisch.
Der Beifahrer brach in fröhliches Lachen aus. »Mensch«, sagte er zu dem Polizisten, »haben Sie denn das Schild da nicht gesehen?« Er deutete zum Heck des Wagens. Dort war ein Schild angebracht: »Fahrschule Pinkus – Vorsicht!« Allerdings nur auf der dem Bürgersteig abgewandten Seite. Weber hatte sich die ganze Zeit schon gefragt, ob das so korrekt war.
Offenbar nicht, denn der Verkehrspolizist zückte nun den Block mit den Strafzetteln und ging zum Heck des Opels. Er notierte das Kennzeichen und schrieb sich den Namen der Fahrschule auf, den er laut vor sich hin murmelte.
»Na, da haben Sie mir ja was Schönes eingebrockt«, schimpfte der Fahrlehrer.
Weber klaubte seine Papiere auf und drehte sich nach hinten. »Aber hat der denn noch immer nicht verstanden, dass ich …«
»Vorschrift ist Vorschrift, das muss wohl …«, sagte der Fahrlehrer bissig.
Der Verkehrspolizist trat wieder an die Fahrertür und ließ sich von Weber die Papiere geben. Er studierte den Dienstausweis mit gefurchter Stirn und sagte jede Silbe laut vor sich hin. Dann knallte er die Hacken zusammen und salutierte.
»Jawohl, Herr Kriminalkommissar!«
»Herrje, stehen Sie doch bequem …«
»Herr Kriminalkommissar lernen also das Chauffieren.«
»Autofahren, ja. Man muss mit der Zeit gehen«, versuchte Weber die Situation aufzulockern.
Der Verkehrspolizist warf einen kurzen Blick auf die Kreuzung, um die Lage einzuschätzen. Kraftwagen, Pferdedroschken und eine Bierkutsche rollten vorbei. Kein Chaos, keine Gefahr – die Ampel machte es möglich. Der Wachtmeister kniff die Augen zusammen, so fest, dass es aussah, als wollte er sie absichtlich vor etwas verschließen, und sagte: »Könnte es sein, dass dieser Fahrunterricht im Rahmen dienstlicher Belange erfolgt?«
Weber schaute ihn verwirrt an.
Der Fahrlehrer kapierte schneller. »Er soll zukünftig automobilisierte Verbrecher jagen.«
»Verstehe. Offizielle Lehrstunde also. Gut. Sie können weiterfahren, Herr Kommissar.«
»Danke.«
»Keine Ursache.« Der Verkehrsbeamte streckte die Hand aus und hielt dem Beifahrer einen Strafzettel unter die Nase. Der Fahrlehrer sah ihn fragend an.
»Vorschrift ist Vorschrift«, sagte der Beamte.
»Aber das ist doch …«, begann Pinkus zu protestieren.
Der Wachtmeister trat zurück und legte die Hand an die Mütze. Weber kuppelte in den ersten Gang, gab Gas und lenkte den Wagen über die Kreuzung nach links in den Neuen Jungfernstieg. Sie schnurrten am Hotel Vierjahreszeiten vorbei, bogen wieder links ab auf den Jungfernstieg, passierten den Alsterpavillon, wo auf der Terrasse im ersten Stock zwischen den Topfpalmen zahlreiche gerüschte Sommerschirmchen aufgespannt waren, mit hübschen Köpfen darunter.
»Achten Sie auf den Verkehr, Weber!«
Droschkenstau. Weber musste fleißig lenken, bog in den Neuen Wall ein und hielt schließlich am Ende der Straße vor der Polizeizentrale im Stadthaus. Die Fahrstunde war zu Ende.
»Abgesehen vom Linksabbiegen ganz passabel, Herr Weber«, sagte Pinkus. »Prüfung in zwei Wochen. Prägen Sie sich die Verkehrsregeln ein! Und vor allem eins: Konzentration!«
»Jawohl.« Weber stieg aus und verabschiedete sich.
Als er kurz darauf durch den schier endlosen, arg verwinkelten Flur zu seinem Dienstzimmer ging, musste er an den gestrigen Abend denken. Er war mal wieder im Goldenen Anker auf St. Pauli versackt, bei Lore. Und über Nacht geblieben. Was er nicht vorgehabt hatte. Aber der verflixte Alkohol! Und dann ihre Hände, mit denen sie ihn auch ohne Seile fesseln konnte. Er hatte sich mal wieder im Netz dieser Spinne mit den leuchtend blauen Augen und den sinnlichen Rundungen verfangen. Immerhin hatte sie ihn bislang jedes Mal wieder freigelassen. Und er stolperte am nächsten Morgen benommen und verkatert zum Dienst. Heute war er direkt zum Fahrunterricht gegangen, mit peinlichem Ergebnis.
»Das geht so nicht mehr weiter«, murmelte er vor sich hin.
Vor der zweiflügeligen Schwenktür zur Kriminalinspektion 1 hielt er kurz inne und holte tief Luft. Hauptsache, es passiert heute nichts mehr, sagte er sich, dann kann ich die längst fälligen Berichte zu Ende schreiben. Er hatte richtig Lust darauf. Sich einen Bohnenkaffee aus der »Dienstkanne« einschenken, eine neue Feder in den Federhalter stecken, das Tintenfass aufdrehen, die Federspitze eintunken und sorgfältig alles notieren. Später dann Rollmops mit Bratkartoffeln in der Speise-Centrale am Großneumarkt. Obwohl, den sauren Hering hätte er auch jetzt schon gebrauchen können.
Sei’s drum, dachte er und stieß die Tür mit der Aufschrift »Verbrechen gegen das Leben« auf.
Die alten, verwitterten Grabsteine lagen wie immer ordentlich nebeneinander im Gras. Leicht bemoost, angeschlagen und von Rissen durchzogen, schimmerten sie grünlich im Licht der Morgensonne, deren Strahlen auf den St.-Pauli-Kirchhof fielen. Die Umrisse der wenigen aufrecht stehenden Grabmale zeichneten sich scharf ab, das Schattenspiel der Blätter auf dem Gras wurde von einer angenehmen Brise aus Südwest belebt. Heute roch es mal nicht nach Fisch und Kohlenrauch, sondern nach Meer.
Der Kirchhof, der an Werktagen normalerweise still und verlassen dalag, war heute ungewöhnlich stark bevölkert. Vor der Backsteinwand der Kirche, unter der großen, weißen Giebel-Rosette, standen drei Schutzmänner und passten auf fünf Männer auf, die ihrerseits über ihre Schultern hinweg eine dritte Personengruppe beaufsichtigten. Diese war gerade damit beschäftigt, in einem Grab zu buddeln. Das war ungewöhnlich, denn zum einen wurden Leichen auf Friedhöfen ja ein- und nicht ausgegraben, und zum anderen wurde der St.-Pauli-Kirchhof schon lange nicht mehr als Beerdigungsplatz genutzt. Um eine archäologische Ausgrabung handelte es sich ebenfalls nicht.
Das Holzkreuz hatte den Pastor stutzig gemacht. Das frische Grab davor hatte ihn dazu bewogen, den Küster zur Davidwache zu schicken. Die Polizisten auf der Wache hatten nach kurzer Inspektion der Lage mit dem Stadthaus telefoniert, und nun standen die Herren von der Abteilung »Verbrechen gegen das Leben« auf dem Friedhof und warteten.
Der Küster, der mit seinem Rauschebart aussah wie ein Jünger Jesu, musste das Grab aufschaufeln. Er schwitzte und nörgelte vor sich hin, er sei doch nicht im Schaugeschäft, aber der Pastor mit seiner riesigen Halskrause hätte die Arbeit schlecht verrichten können. Und die Polizei war ja bekanntlich ein faules Pack. Von den anwesenden Pressevertretern gar nicht zu reden.
Bald kam ein Bein zum Vorschein, dann ein Arm, dann Hände und Füße und ein schmächtiger Rumpf in Kleidern, die so oft gewaschen worden waren, dass sie eine undefinierbare Farbe angenommen hatten. Nun waren sie zum letzten Mal schmutzig geworden.
Das hagere Gesicht eines Mannes Ende vierzig mit Stoppelbart und schütterem, graublondem Haar und einer Hakennase wurde freigelegt.
»Vorsicht mit der Schaufel, nun nehmen Sie doch die Hände, Mann!«, stieß der Wachtmeister der Davidwache hervor, als die scharfe Kante des Schaufelblatts den hohlen Wangen des Toten zu nahe kam.
»Mach doch selber«, brummte der Küster in seinen Bart.
»Ich denke, ab hier ist es Polizeiarbeit«, meldete sich Kommissar Weber zu Wort.
Erleichtert warf der Küster die Schaufel hin und sah seinen Pastor an. Der nickte, und der Küster schlurfte davon.
»Ich komme noch zu spät zu meiner Beerdigung.« Der Pastor schaute zur Kirchturmuhr und bemerkte gar nicht die Ironie dieser Formulierung. Er wandte sich ab und stapfte davon. »Auf Wiedersehen, meine Herren.«
Gustav Hilbrecht, der Polizeifotograf, der sein Jackett bereits ausgezogen und die Hemdsärmel hochgekrempelt hatte, stellte ein zweites Mal die Kamera mit dem Stativ auf, um nach dem geschlossenen nun auch das geöffnete Grab abzulichten. Der grelle Blitz passte nicht zur sommerlichen Stimmung und würde dem Bild jede Romantik rauben. Aber was war schon romantisch an einer Leiche?
»Das ist Schrammel-Ede«, stellte der Wachtmeister fest, »Eduard Geyer – mit Ypsilon. Erstaunlich, dass den jemand umgebracht hat. Der stand doch sowieso schon mit einem Fuß im Jenseits.«
»Ziemlich mager, der Mann«, bemerkte Weber.
»Hat sich nur noch von Schnaps ernährt«, sagte der Leutnant.
»Und sonst?«
»Kleinere Diebstähle, manchmal auch Erpressung, wenn es ihm gelang, eine abgehalfterte Hure davon zu überzeugen. Alles kaum der Rede wert.«
»Warum macht sich dann jemand die Mühe, ihn zu töten und auch noch zu beerdigen?«, fragte Weber.
»Tja.« Der Wachtmeister blickte sinnierend auf das im Sonnenlicht funkelnde grüne Blattwerk.
Weber schwitzte, aber er wollte das Jackett nicht ablegen, weil er unter den Anwesenden der ranghöchste Beamte war. Auf meine Eitelkeit lass ich nichts kommen, dachte er ironisch. Der Bauch, den seine Geliebte neuerdings »bemerkenswert« fand, spielte bei der Entscheidung allerdings auch eine gewisse Rolle. Rein äußerlich betrachtet ging es dem Kommissar zurzeit bestens. Innerlich neigte er zu grüblerischen Betrachtungen.
Zum Beispiel fragte er sich gerade, was einen Menschen ausmachte, wenn ein bloßer Herzstillstand ihn in ein wertloses Ding verwandelte. Schlimmer noch: Eine Leiche war nicht bloß ohne jeden Nutzen, sie war Abfall, sie verfaulte, in ihr entwickelten sich Gase und giftige Substanzen. Sie musste begraben werden, damit sie keinen Schaden anrichten konnte. Im Krieg hatte Weber erlebt, wie aufgedunsene Leichen in der Sommerhitze regelrecht explodiert waren. Er schüttelte sich. Die Augen des Toten starrten ins Nichts. In ein Nichts, das jenseits aller Ordnung war, eine undurchdringliche, schwarze Leere, in die kein Polizist der Welt Licht bringen konnte. Und der Pastor hatte sich schon davongemacht.
Eine Hand legte sich auf Webers Schulter. »Nun, Alfred, was sagt dir dein Instinkt?«, fragte Hilbrecht, der Fotograf.
»Ein Ritualmord vielleicht oder die Tat eines Irren.«
»Jemand hat sich die Mühe gemacht, ein Holzkreuz in den Boden zu stecken«, sagte Hilbrecht.
»Das ist geklaut«, meldete sich der Wachtmeister zu Wort. Er deutete zur Kirche, wo an der Wand neben den Herren von der Presse weitere Holzkreuze standen. »Die wurden von den Konfirmanden anlässlich einer Theateraufführung in der Karwoche zusammengenagelt. Dreizehn Stück.«
Na, hoffentlich kommen die nicht alle zum Einsatz, dachte Weber.
Ein Mann im weißen Kittel mit einer Arzttasche in der Hand kam um die Kirche herum. Wie immer trug Lindgard, der Polizeiarzt, in der einen Tasche seines Kittels überflüssigerweise ein Stethoskop.
Trotz des Sommers war er recht bleich im Gesicht. Das Weiß seines Kittels und seiner etwas zu kleinen Schirmmütze war nur unwesentlich heller als seine Haut. Er trat ans Grab, grüßte in die Runde und rückte seine eckige Nickelbrille zurecht.
»Na, was sagen Sie, Herr Doktor?«, fragte Hilbrecht scherzhaft.
Lindgard blickte verkniffen um sich. »Ihre Anwesenheit lässt darauf schließen, dass der Mann da tot ist.«
»Gut erkannt«, entgegnete Hilbrecht.
»Er muss noch weiter ausgegraben werden«, sagte der Mediziner.
Alle schauten sich an. Schließlich zuckte der Wachtmeister von der Davidwache mit den Schultern, stieß einen Pfiff aus und winkte einen schlaksigen jungen Beamten heran. Der musste nun die Erde um die Leiche herum mit der Hand wegkratzen.
Als er fertig war, stellte er sich mit schmutzigen Ärmeln und dreckiger Hose neben einen Grabstein und begann, die klebrige Erde von seinen Händen daran abzuwischen.
»He!«, rief sein Vorgesetzter von der Davidwache. »Respekt vor den Toten, junger Mann.«
Der Angesprochene zuckte zusammen.
»Tja«, versuchte es der Wachtmeister versöhnlicher, »da hat deine Mutter gleich am ersten Tag schon ’ne Menge Wäsche. Er hat nämlich gerade angefangen, der Polizeianwärter Schubert.«
Der junge Schubert errötete, ob aus Scham oder Wut war nicht genau zu beurteilen. Erster Tag und schon eine Leiche ausbuddeln, dachte Weber, der arme Kerl. Hilbrecht schoss noch ein paar Fotos von der freigelegten Leiche.
Weber kam der Gesichtsausdruck von Schrammel-Ede jetzt ziemlich verbissen vor. Vielleicht wäre er vor seinem Tod gerne noch was losgeworden, überlegte er. Vielleicht hat er seinen Mörder verflucht, sein Schicksal oder den Teufel oder den lieben Gott. Der hat ihm die ewige Ruhe im Übrigen nur kurz gegönnt. Denn nun sind wir da. Und wir werden uns mit dir beschäftigen, werden herumfragen und Informationen über dich sammeln. Dir wird nun eine Aufmerksamkeit zuteil, die du schon lange nicht mehr bekommen hast, so wie du aussiehst.
»Was wissen Sie noch über ihn?«, fragte Weber den Wachtmeister.
»Dass er sich früher als Kneipenmusikant durchschlug. Als es ihm noch besserging. Soll sogar mal Einbrecher gewesen sein, aber das war vor meiner Zeit.«
»Letzter Wohnsitz?«
Der Wachtmeister lachte. »Der hat schon lange keinen Meldezettel mehr ausgefüllt.«
»Bekanntschaften?«
»Unter den Huren, die im Schatten stehen. Vielleicht auch ein, zwei Kumpane, die gar nicht erst planen, wenn sie auf die Idee kommen, ein Ding zu drehen. Das letzte Mal hatten wir ihn auf der Wache, weil er sich sonntagmorgens in betrunkenem Zustand den Klingelbeutel von St. Joseph unter den Nagel gerissen hatte. Behauptete, als bedürftiger Katholik hätte er einen Anspruch darauf. Ist aber auch schon eine Weile her, über ein Jahr.«
»Suchen Sie mal alles zusammen, was Sie über ihn haben, und schicken Sie es mir ins Stadthaus.«
»Geht in Ordnung, Herr Kommissar.«
Hilbrecht hatte inzwischen Kamera und Stativ abgebaut und richtete sich auf. Sein fleischiges Gesicht glänzte vor Schweiß, sein Hemd klebte feucht an seinem massigen Oberkörper. Als er merkte, dass die Sonne auf seine Glatze knallte, zog er eine Schirmmütze aus der Gesäßtasche und setzte sie auf.
Eine Weile schauten sie zu, wie Lindgard die Leiche untersuchte. Hilbrecht zündete sich einen Stumpen an und setzte sich auf eine der alten Grabplatten. Weber hockte sich auf der Luv-Seite neben ihn, um den Tabakschwaden zu entgehen.
»Ich soll dich schön grüßen«, sagte Hilbrecht nach kurzem Schweigen.
»Von wem?«
»Mathilde, deiner Frau.«
»Ist sie nicht mehr, wir sind geschieden. Jetzt endlich. War nicht einfach. Das Recht ist dagegen.«
»Wie hast du das bloß geschafft?«, fragte Hilbrecht sarkastisch.
»Mehrfacher Ehebruch.«
»Beneidenswert.«
»Sag das nicht.«
»Mathilde meint, du sollst am Wochenende mal was mit deiner Tochter unternehmen. Damit sie dich nicht vergisst.«
»Ja, klar, mach ich.«
»Wie alt ist Erika jetzt?«
»Sechs.«
»Kommt bald in die Schule.«
»Ja.«
»Geh mal mit ihr zu Hagenbeck.«
»Waren wir schon zwei Mal. Sie will immer zu den Affen. Ich mag keine Affen.«
»Na, jetzt im Sommer wirst du schon was finden.«
»Würgemale am Hals!«, rief Lindgard, der noch immer im Grab kniete. »Schätze mal, dass es eher acht als vier Stunden her ist, die Nacht war ja relativ frisch.«
Also hatte jemand zwischen ein und zwei Uhr morgens den ehemaligen Einbrecher und jetzigen Kleinganoven und Alkoholiker Eduard Geyer erwürgt und anschließend hier verscharrt. Wir müssen den ganzen Kirchhof nach Spuren absuchen, dachte Weber müde.
»Erwürgt mit einem Seil«, ergänzte Lindgard. »Ungefähr einen Zentimeter dick. Hanfstrick, würde ich sagen.«
In diesem Moment klappte der Mund des Toten auf, und eine blauschwarze Zunge quoll hervor.
»Gib mir mal deine Pistole«, verlangte Erika.
»Nein.«
»Doch.« Das Mädchen streckte die Hand aus.
»Das darf ich nicht.«
»Ich will ja bloß mal anfassen.«
Weber hielt das Jackett zu, als sie anfing, daran zu zupfen.
»Zu gefährlich.«
»Du kannst ja die Kugeln rausnehmen.«
»Sind gar keine drin.«
Das Mädchen schaute ihn ungläubig an. »Du hast gar keine Kugeln drin? Wie willst du denn dann Verbrecher erschießen?«
»Will ich doch gar nicht.«
Sie legte den Kopf schief und runzelte die Stirn. Dann lachte sie. Und schlug mit ihren Fäusten auf seinen Oberschenkel. »Du willst mich verkohlen.«
»Aber nein«, sagte Weber. »Wir von der Polizei sollen die Verbrecher fangen, damit sie bestraft werden können. Wir bestrafen doch nicht selbst.«
»Nee?«
»Nee, das macht der Richter.«
»Der schießt dann?«
»Nein, der bringt sie ins Gefängnis.«
»Und da wird ihnen der Kopf abgehauen.«
»Um Himmels willen, nein! Dort müssen sie bleiben und …« Ja, was machen sie eigentlich dort, fragte sich Weber. Mit dem Alltag im Gefängnis hatte er ja glücklicherweise nichts zu tun. Menschen hinter Gittern zu sehen, war ihm trotz seines Berufs immer unangenehm gewesen.
»… schmachten«, ergänzte das Mädchen.
»So was in der Art, ja.«
»Und wenn sie genug geschmachtet haben, dürfen sie wieder raus?«
»Ja.«
»Und dann fängst du sie wieder ein.«
»Aber nur, wenn sie wieder was Böses getan haben.«
»Das müssen sie doch, wenn sie Verbrecher sind. Das ist doch ihr Beruf.«
»Sie können sich bessern und einen anderen Beruf wählen.« Weber schaute verstohlen auf seine Armbanduhr. Wo blieb Mathilde denn nur? Jedes Mal kam sie zu spät. Er saß mit seiner Tochter Erika im Park an der Beneckestraße am Grindel, gegenüber der Synagoge. Die Sonne schien, ein laues Lüftchen wehte. Spaziergänger waren unterwegs oder saßen auf Bänken, darunter einige Männer mit Kippa auf dem Kopf. Kinder tollten über den Rasen.
»Ich weiß schon, welchen Beruf ich wähle«, sagte Erika nach kurzem Nachdenken.
»Tatsächlich?«
»Klar, ich werde Polizist.«
Weber schüttelte den Kopf. »Das geht nicht.«
»Wieso denn?«
»Mädchen dürfen keine Polizisten werden.«
»Aber ich meine doch später, wenn ich erwachsen bin.«
»Frauen gehen nicht zur Polizei.«
»Warum?«
»Weil es da keine Arbeit für sie gibt.«
»Nicht?«
»Nein, das ist nicht vorgesehen.«
»Das ist aber komisch.«
»Wieso?«
»Weil es doch auch Frauen gibt, die böse sind und ins Gefängnis kommen sollen.« Erika rückte näher an ihn heran und senkte die Stimme. »Ich hab gehört, dass eine Frau eine andere abgemurkst hat, hier in unserer Straße.«
»Abgemurkst?«
»Ja, und da braucht man doch Frauenpolizisten, um sie zu verhaften. Ich sag dir auch, wieso.« Erika schaute ihn wissend an.
»Wieso?«
»Weil Männer Frauen nicht verstehen. Das sagt Mama. Und weil das so ist, können Männer Frauen auch nicht fangen. Das sage ich. Weil sie die Männer an der Nase herumführen.«
»Wo hast du denn diesen Unsinn her?«
»Mama hat mir eine Geschichte aus dieser Zeitschrift vorgelesen, von einem Mädchen, das viel schlauer war als die Jungen, weil es anders denken konnte.«
»Aha.« Das war bestimmt ein Artikel aus der »Frau« gewesen, dieser Zeitschrift der Frauenrechtlerinnen. So etwas einem kleinen Mädchen vorzulesen, war wirklich Unfug.
»Und weil das so ist, muss es auch Frauenpolizisten geben, verstehst du. Sonst kriegt ihr die Frauenverbrecher nämlich nicht, verstanden?« Erika hob triumphierend den Zeigefinger, wie Mathilde es auch manchmal tat. Eine rechthaberische Geste, die Weber seinerzeit auf die Nerven gegangen war.
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe aber schon viele Frauenverbrecher gefangen«, sagte er.
Erika war enttäuscht und schmollte.
»Warum dürfen eigentlich nur Jungs Cowboy spielen?«, fragte sie unvermittelt.
»Wie bitte?«
»Da.« Sie zeigte auf zwei etwa Achtjährige, die sich gerade ein Duell lieferten und »Peng, peng!« riefen. Einer der Jungen grinste zu ihnen herüber, offenbar kannte er Erika.
»›Boy‹ ist Englisch und heißt ›Junge‹«, versuchte Weber zu erklären. Seine Gedanken gingen etwas durcheinander, als er an seine Jugendlektüre dachte, an Old Shatterhand und Winnetou und dessen Schwester Nscho-tschi, und ohne weiter nachzudenken, sagte er: »Du könntest Indianerin sein und die Cowboys überfallen, ihnen die Sachen wegnehmen und dich dann als Cowboy verkleiden. Dann hättest du sogar eine Pistole zum Schießen.«
Erika sah ihn verblüfft an. »Aber Papa!«, stieß sie dann halb enttäuscht, halb zornig hervor. »Du denkst ja wie ein Mädchen!« Und schon rannte sie los, hinter den beiden Jungs her, johlte wie ein Indianer auf dem Kriegspfad und versuchte sie zu fangen.
Wenige Sekunden später tauchte Mathilde endlich auf. In einem hellgrauen Kleid, mit Hut, ohne Schirmchen. Rüschen schon gar nicht.
Er stand von der Bank auf. Sie gaben sich die Hand und schauten hinter dem Mädchen her. Weber deutete auf die Bank, aber sie blieben beide stehen.
»Erika will eine Pistole erbeuten«, sagte Weber, weil ihm sonst nichts einfiel.
Mathilde schaute ihn missbilligend an. »Sie ist besessen von Pistolen. Weil sie gesehen hat, dass du eine trägst. Sogar, als du uns neulich zu Hause aufgesucht hast.«
»Da kam ich vom Dienst, deswegen.«
»Ich kann das nicht billigen. Die eigene Tochter mit einer Waffe unterm Arm zu besuchen!«
Weber stöhnte. »Ist gut, ich merk’s mir ja.«
Erika hatte jetzt einen der Cowboys zu Fall gebracht und stürzte sich auf ihn.
»Was tut sie denn da, um Himmels willen.«
»Sie ist Indianerin«, erklärte Weber. »Später, sagt sie, will sie Frauenpolizistin werden. Hast du ihr das in den Kopf gesetzt?«
»Polizistin? Von mir hat sie das nicht. Das würde ich nicht zulassen. Obwohl …«
»Sie scheint ja schon eine richtige kleine Frauenrechtlerin zu sein. Setzt du ihr neuerdings solche Flausen in den Kopf?«
»Unsinn, was redest du denn da. Und selbst wenn.«
»Sie sagt, Mädchen sind schlauer als Jungen, und sie will später mal Verbrecherinnen jagen.«
»Das Weibliche ist nichts für die Jagd, Alfred. Das Weibliche ist Fürsorge und Mütterlichkeit. Diese Prinzipien sollten Frauen in die Gesellschaft tragen, um sie zu verbessern. Wenn wir die Männer imitieren, wird alles nur noch schlimmer.«
»Und so was erzählst du ihr?«
»Natürlich nicht. Sie ist doch erst sechs Jahre alt.«
»Aber du liest ihr Geschichten aus diesem Blatt für Frauenrechtlerinnen vor.«
»Das war eine Kindergeschichte.«
»Trotzdem.«
»Was, trotzdem?«
»Tendenziös.«
Mathilde stemmte die Hände in die Hüften. »Tendenziös? Willst du mir vorwerfen, ich erziehe meine Tochter nicht gut? Ausgerechnet du, der du dich davongestohlen hast! Der keine Verantwortung kennt, sondern sich ganz tendenziös nach jedem Rockzipfel umdreht.«
»Jetzt hör mal, das ist doch …«
Hinter ihnen ertönte ein Schmerzensschrei, dann Erikas lautes Schluchzen. Sie lag auf dem Boden, und einer der Cowboys hielt ihr die Mündung seines Revolvers unter die Nase. Gleichzeitig blickte er verwirrt, ängstlich und hilfesuchend um sich. Mit einer weinenden Indianerin wusste er nicht umzugehen.
»Da hast du es!«, schnauzte Mathilde Weber an. »Das kommt dabei heraus, wenn Mädchen und Jungen zusammen spielen. Pistole erbeuten, so ein Unfug …«
Sie eilte über den Rasen. Der Junge sprang auf und suchte das Weite.
»Ich muss zum Dienst«, rief Weber seiner Ex-Frau hinterher, winkte unschlüssig seiner Tochter zu, die ihm einen jammervollen Blick zuwarf, drehte sich um und verließ den Park.
Eigentlich verstehe ich mich doch ganz gut mit Erika, überlegte er. Stell dir mal vor, sie wäre ein Junge. Erik. Hätte ich ihm meine Pistole gegeben? Nur mal so, damit er weiß, wie sich das anfühlt? Nein, entschied er, die Colt M 1911, die er sowieso nur bei sich trug, wenn es sein musste, war eine Mörderwaffe. Er hatte damit einen Menschen getötet. Im Krieg. Die Pistole war mit Schuld beladen. Deshalb hatte er sie als Dienstpistole eintragen lassen. Damit er es sich zweimal überlegte, wenn es nötig erschien, sie einzusetzen. Es war doch besser, eine Tochter zu haben, dachte er weiter, Mädchen schicken sie nicht in den Krieg. Immerhin.
Der schmale Gang zwischen Erichstraße und Friedrichstraße war mit zwei- und dreistöckigen Häusern bebaut, die sich teilweise bedenklich neigten. Das unebene Pflaster war dick bemoost, und an der einzigen Stelle, wo die Sonne hinkam, hatte sich ein Baum durch den steinigen Boden gekämpft und trotzte dem Elend mit sattem Grün. Die Kneipe dahinter, in der es nur einen Tresen und zwei Tische gab, hieß dementsprechend Lindengrün, öffnete aber erst nach Sonnenuntergang. Daneben befand sich ein kleines, zweistöckiges Haus, eher eine Bude, mit einem Verkaufsfenster. »Kurzwaren – Zigaretten – Praktisches« stand auf einem Schild, das, wie Weber wusste, nachts ein klein wenig Licht von der Straßenlaterne schräg gegenüber abbekam. Praktisches waren zum Beispiel Kondome, die zu später Stunde in manchen Nischen der Gasse ganz plötzlich gebraucht wurden. An Festtagen gab es tagsüber sogar selbstgebackenen Kuchen.
Die kleine Frau im Verkaufsfenster der Bude wirkte ein bisschen verloren. Sie trug ein schwarzes Kleid und hatte die langen grauen Haare auf altmodische Art hochgesteckt. Das Kleid hatte kurze Ärmel, und die Frau hatte sich lange schwarze Handschuhe angezogen. Um die Ellbogen, zwischen dem Ende des Handschuhs und dem Ärmel des Kleides, war ihre schlaffe weiße Haut zu sehen. Ihre Augen waren gerötet, als hätte sie geweint. Sie blickte Weber gefasst entgegen und ließ ihn nicht aus den Augen, während er vorsichtig über den rutschigen Boden auf sie zuging.
Weber blieb vor ihr stehen, nahm die Mütze ab, grüßte und sagte: »Es tut mir sehr leid.«
Sie nickte. »Kommen Sie rein, Herr Kommissar.«
Ein abgewetztes Sofa, ein roher Tisch mit zwei verschiedenartigen Stühlen, ein Ausguss, eine Anrichte und ein Regal mit Geschirr. Weiter hinten eine Treppe, die eher wie eine Leiter wirkte und nach oben führte, wo es einen zweiten Raum gab, das Schlafzimmer wahrscheinlich. Hier hatte Schrammel-Ede zuletzt gewohnt, bei seiner Bekannten Elsa Möller, die früher mal auf den Strich gegangen war. Vor zehn Jahren hatte sie es endgültig aufgegeben.
Sie setzten sich nebeneinander auf das Sofa. Weber war unbehaglich zumute, aber nicht, weil er hier gelegentlich mal eine Packung Fromms gekauft hatte.
»Vielleicht möchten Sie mir ja was sagen«, begann Weber das Gespräch.
Die Frau nickte und dachte eine Weile nach. Weber wartete geduldig.
»War das gut gemeint mit dem Grab?«, fragte sie schließlich.
»Wie bitte?«
»Dass er begraben wurde. Oder war das boshaft gemeint?«
»Das wissen wir nicht. Eigenartig ist es schon. Auf dem Kirchhof wird doch niemand mehr begraben. Es war sehr auffällig.«
»Also sollte er gefunden werden«, sagte Frau Möller und verschränkte die behandschuhten Hände.
»Ja.«
»Also war es boshaft. Ihn da zu vergraben, meine ich.«
»Vor allem wurde er umgebracht, nicht wahr?«
»Das ist offensichtlich, Herr Kommissar«, sagte sie harsch. »Aber umgebracht ist einer schnell, nur eingebuddelt nicht, das braucht Zeit.«
»Es hat sich also jemand viel Mühe gegeben.«
Sie lachte freudlos, beinahe hämisch. Ihre verschränkten Hände verkrampften sich.
»Warum nur?«, fragte Weber.
Elsa Möller sah ihn stirnrunzelnd an. Dann glättete sich ihre Stirn, und sie schüttelte andeutungsweise den Kopf. Ihre Mundwinkel sackten herab. »Ja, wirklich«, sagte sie abfällig, als wollte sie den Mörder mit Verachtung strafen. »Der einzige Mensch, den das überhaupt etwas angeht, der es zur Kenntnis nimmt, der betroffen ist von seinem Tod, das bin doch ich. Da war sonst niemand. Er ging nur noch selten aus der Gasse raus, nur zum Einholen. Wenn er trinken wollte, ging er in die Linde.« Sie deutete vage nach nebenan. »Wir haben hier in unserem Winkel gelebt und waren froh, dass man uns diesen winzigen Flecken überlassen hat. Es war ausgemacht, dass wir uns nicht mehr mit anderen einlassen wollen.«
»Nicht mehr einlassen?«
»Das hat zu viel Unheil gebracht.«
»Unheil?«
»Sie haben recht, Herr Kommissar, das ist das falsche Wort. Aber wie soll ich das sagen? Dass die anderen uns lange genug das Leben schwergemacht haben? Dass wir uns mit knapper Not hierher retten konnten.« Sie hob die Hände und deutete auf ihre Umgebung. »Sie sehen ja, was man sich als Hure von seinen Ersparnissen leisten kann.«
»Immerhin.«
»Ja, immerhin. Es war eine glückliche Fügung. So was gibt’s dann doch. Und kaum hatte ich die Bude übernommen, passierte mir noch so ein Glück. Gut zwei Jahre ist das jetzt her. Da steht er vor dem Fenster und will Zigaretten. Hat das Geld umständlich aus der Hosentasche gekramt. Das Komische daran war, dass die Art, wie er es machte, mich angerührt hat. Wie soll ich das sagen … Man ist ja kein Backfisch mehr. Und er, na ja … Wir haben ein bisschen geschäkert.« Sie lachte kurz und leise. »Er kam dann jeden Tag zur gleichen Zeit. Eher am frühen Morgen. Wenn er fertig war.«
»Mit was?«
»Musizieren. Da spielte er noch in verschiedenen Lokalen. Auf dem Klavier, wenn eins reinpasste, oder auf der Geige, wenn es eng wurde. Aber dann wurde die Gicht immer schlimmer, und es war aus mit der Musik. Da hab ich dann gesagt: Wenn du sowieso jeden Tag hier rumlungerst, kannst du auch einziehen. Wissen Sie, was Glück ist, Herr Kommissar?«
»Hm …«
»Wenn man nicht allein ist. Da muss einer sein, der für einen da ist. Einsamkeit ist Verzweiflung, und Verzweiflung zerstört den Menschen. Und da kann mir der Pastor noch so viel von seinem Jesus erzählen und dem lieben Gott, das nützt mir gar nichts, weil ein Gott nämlich keinen Menschen ersetzen kann.«
»Sie waren also glücklich mit ihm?«
»Ja, und wenn seine Sauferei nicht gewesen wäre, dann hätte es sogar schön sein können. War’s ja auch manchmal. Wenn die Sonne an Pfingsten auf unser Schaufenster geschienen hat, und wir standen nebeneinander und haben rausgeguckt. Und wenn’s an so einem Feiertag auch nur Pellkartoffeln gab, war’s doch schön.«
»Woher hatte er denn das Geld zum Saufen, wenn er doch gar nicht mehr gearbeitet hat?«
Sie blitzte ihn an. »Von mir nicht!«
»Woher sonst?«
»Das habe ich mich auch gefragt.«
»Er ging so gut wie nie aus der Gasse und hat trotzdem Geld verdient?«
Sie schaute ihn unbehaglich an.
»Jetzt ist es doch sowieso egal«, sagte Weber.
»Ja … aber ich will nicht schlecht über ihn sprechen. Es waren auch nur Lappalien.«
»Er hat organisiert.«
»Bloß mal ein Kleidungsstück, das jemand an einer Garderobe vergessen hat, oder einen Hut, Sachen zum Verhökern …«
»Und wenn mal eine Brieftasche mit dabei war, hat es auch nicht geschadet.«
Sie rückte ein Stück von ihm weg und sagte böse: »Er war kein Dieb! Er hat nur Sachen gesammelt, die übrig waren. Geld zum Leben haben wir hier genug verdient!«
»Also?«
Sie senkte den Kopf. »Das mit dem Trinken war halt teuer, deshalb.«
»Ich verstehe. Im Nachhinein müssen wir ihn ja nicht mehr richten«, beschwichtigte Weber sie.
»Das habe ich nie getan, ihn gerichtet«, sagte sie resolut. Dann lächelte sie verschämt. »Es war ja auch in Ordnung. Dann bekam er dieses Leuchten in den Augen. Und wurde sanft. Der Alkohol ist nämlich nicht unbedingt ein Teufelszeug, Herr Kommissar. Er kann auch Gutes bewirken.« Sie stand ruckartig auf, verschränkte die Arme vor der Brust, dachte kurz nach und hob dann eine Hand, um ihre Aussage zu unterstreichen. »Aber denken Sie bloß nicht, einer, den er behumst hat, hätte ihn auf den Kirchhof gebracht.«
»Nein, bestimmt nicht.«
»Wahrscheinlich ist es besser, ich erfahre es nie.«
»Ich muss es herausfinden.«
»Lassen Sie mich damit in Ruhe, ja?«
»Wenn es möglich ist …«
»Hier!«, rief sie aus und zerrte an den Handschuhen, zog sie aus und ließ sie zu Boden fallen. »Sehen Sie das? Da!« Sie hielt ihm ihre Hände vors Gesicht. »Das war’s nämlich, um was es ging!«
Weber schaute ihre Unterarme und Hände an. Sie waren aufgerissen, wund und entzündet oder verschorft und verschuppt, sahen schlimm aus.
»Das hat er gelindert!« Sie schrie es beinahe, als wollte sie damit etwas entschuldigen. »Er hat seine gichtigen Hände daraufgelegt, und es ist verschwunden. Und dann kam es wieder. Weil er drei Tage weg war. Da ging es wieder los. Und da wusste ich, dass er nicht mehr zurückkommt. Haben Sie das verstanden, Herr Kommissar?« Sie hielt ihm demonstrativ die Arme hin. »Das kriecht die Arme hoch und will vom ganzen Körper Besitz ergreifen. Das passiert jetzt wieder. Und da nützt es mir gar nichts, dass Sie ihn wieder ausgebuddelt haben. Und auch nichts, wenn Sie seinen Mörder finden. Das ist mir egal, verdammt noch mal. Das ist mir doch ganz egal!«
Sie fing an zu schluchzen.
Mein Beruf ist manchmal wirklich zum Kotzen, dachte Weber, als er das winzige Häuschen verließ.
Ein ehemaliger Ganove und Schrammelmusiker, der sich zuletzt als Gelegenheitsdieb über Wasser gehalten hatte, war ermordet und auffällig verscharrt worden. Was ergibt das für einen Sinn, fragte er sich, als er den Wilhelmsplatz überquerte.
Auf der Reeperbahn herrschte reger Verkehr. Wie immer.
Weber mochte den Paternoster-Fahrstuhl im Stadthaus nicht gern benutzen. Redete sich ein, er sei abergläubisch, obwohl er bloß Angst hatte, er könnte sich beim Ein- oder Aussteigen einklemmen. Treppensteigen war ohnehin gesünder, der Mensch brauchte Bewegung! Im Frühtau zu Berge, dachte er, als er die breiten Steinstufen im Stadthaus in den ersten Stock hinaufstieg. Ja, genau, einen Urlaub sollte man sich auch mal wieder gönnen. Immenstadt im Allgäu, wie lange war das inzwischen her?
Ein Stück weiter oben, im zweiten Stockwerk, traten zwei bestrumpfte Waden in sein Sichtfeld. Schnürstiefel umfassten schlanke Fesseln. Die Stiefel drehten eine Pirouette, gingen zwei Schritte nach rechts, dann vier nach links, blieben stehen, drehten sich im Halbkreis.
Weber erreichte den Treppenabsatz und blieb stehen, weil die zu den Stiefeln gehörende Person ihm den Weg in den dritten Stock versperrte.
Im Augenblick wandte sie ihm den Rücken zu. Sie war etwas kleiner als er, trug eine Art Jackett, darunter ein langes, gerade geschnittenes Kleid, das die bestrumpften Waden zum größten Teil bedeckte. Außerdem eine dunkelblaue Bluse und einen großen, runden Hut, mit dem sie wirkte, als käme sie aus einem anderen Jahrhundert. Nur der blonde Haarschnitt, der den Blick auf einen schlanken Hals freigab, war von heute. Ansonsten unterschied sich diese Person deutlich von den modebewussten Hamburgerinnen, die im Sommer durch die Innenstadt flanierten. Dunkelblaue Strümpfe! In diesem Aufzug musste sie zwischen den luftig gekleideten Bürgerstöchtern am Jungfernstieg aber gewaltig auffallen. In der einen Hand hielt sie eine ziemlich große Handtasche aus schwarzem Leder. Vielleicht eine Krankenschwester oder Hebamme, die die Geburt eines Kindes im Meldeamt bekanntgeben wollte.
Sie drehte sich zu ihm um, und es traf ihn wie ein Blitz. Sie offenbar auch, denn sie stieß einen Schrei aus und hielt sich die freie Hand erschrocken vor die Brust.
»Gott! Haben Sie mich erschreckt.«
»Gummisohlen«, sagte Weber mit schuldbewusster Miene. Was für eine großartige Erklärung. Lächerlich. Fehlte nur noch, dass er ihr versicherte: Keine Angst, Sie sind hier bei der Polizei.
»Suchen Sie etwas, Fräulein?«
Sie lächelte verlegen. Kein Rot auf den Lippen, kein Rouge auf den Wangen, keine auffällig gezupften Augenbrauen und nicht mal ein Hauch von Puder. Und trotzdem, irgendwie beeindruckend. Die kleine Schwester der Garbo, kam es ihm in den Sinn. Er hatte kürzlich erst »Dämon Weib« und »Fluten der Leidenschaft« in Knopf’s Lichtspielhaus am Spielbudenplatz gesehen.
»Oh, Entschuldigung, ich stehe Ihnen wohl im Weg«, sagte sie hastig und lachte. »Es ist jedes Mal das Gleiche, ich komme mit den Stockwerken durcheinander.«
»Na, so viele sind’s doch gar nicht«, sagte er jovial. Fünf, wenn man das Erdgeschoss mitrechnete, und oben unterm Dach die »Photographische Anstalt« und die Archivräume.
»Tja«, sagte sie, »aber bin ich jetzt im zweiten oder dritten Obergeschoss?«
»Wenn Sie zum Meldeamt wollen …«
»Nein, nein. Also, ich arbeite doch hier … Eben das ist es ja … das ist peinlich, wirklich … Dabei bin ich schon seit letzter Woche angestellt.«
»Ah, als Schreibkraft. In welcher Abteilung denn?«
Sie schüttelte den Kopf und errötete leicht. »Nein, nein, Kriminalpolizei … aber …« Sie hob ruckartig die freie Hand und schaute auf eine schmale Armbanduhr. »Ach herrje, meine Chefin wird mir den Kopf abreißen, wenn ich schon wieder zu spät bin.«
»Kriminalpolizei?«, sagte Weber verblüfft. »Dann müssen Sie noch weiter hinaufsteigen. Ich bin selbst …«
Aber die junge Frau streckte nun den Zeigefinger in die Höhe, als wäre ihr gerade etwas Wichtiges eingefallen, und sagte: »Zweiter Stock natürlich, und da bin ich, richtig? Prima, vielen Dank, Herr Kollege!«
Sie wirbelte herum, betrat mit weit ausholenden Schritten den breiten Korridor, der nach links um die Ecke führte, und verschwand im Labyrinth der Polizeibehörde.
Ein bisschen verwirrt, dachte Weber, hoffentlich richtet sie kein Unheil an. Dass Männer sich als Polizeibeamte ausgaben und sich in der Behörde wichtigtuerisch aufführten, kam manchmal vor. Einen »Fall von Köpenick« nannte man das dann. Aber eine Frau, die eine Amtsperson mimte, war ihm bislang noch nicht untergekommen. Auch keine mit hellgrünen Augen. Na, so was.
Er drehte sich um und stieg weiter nach oben.
Nach einigen Windungen des Korridors erreichte er das Dienstzimmer, das er sich mit drei Kollegen, einem Wachtmeister, einem Oberwachtmeister und einem Anwärter, teilte. Jeder hatte einen Schreibplatz. Die erhöhten Pulte, an denen man auf einem Hocker wie am Tresen einer Gaststätte Platz nahm, standen paarweise zusammen, und zwar so, dass die Beamten sich gegenübersaßen. Weber mochte es nicht, von einem Kollegen gemustert zu werden, während er über seinen Berichten brütete, und hatte sich für ein kleineres, niedriges Pult vor dem Fenster entschieden. Von seinem Platz aus konnte er in den Innenhof schauen. Oben war ein Fleckchen Himmel zu sehen, und manchmal sah er, wie Hilbrecht, der Fotograf, oben unterm Dach die Lichtblende aus- oder einfuhr. Oder, nach Einbruch der Dunkelheit, wie es oben blitzte, wenn ein Foto von einem Beweisstück oder einer verhafteten Person geschossen wurde.
Vor seinem Tisch angekommen, holte Weber das sorgfältig in Papier eingewickelte Wurstbrot aus der Jackentasche, zog die Schublade auf und legte es hinein. Er bemerkte ein zweites, ähnliches Paket – es war ihm wohl entgangen, dass er noch eine Stulle da liegen hatte. Recht trocken war sie mittlerweile geworden.
Bevor er seinen Bericht schreiben würde, entschied Weber, wollte er erst mal einige Informationen über den Toten zusammentragen. Vielleicht half das ja dabei, Motive für den rätselhaften Mord und das Verscharren auf dem St.-Pauli-Kirchhof zu finden. Also marschierte er ins Erkennungsamt, um sich bei den Kollegen mit dem vorhandenen Material zu versorgen: Personenangaben aus dem Generalkartenregister, Einträge in der Verbrecherliste, Fahndungskarten vergangener Jahre, die Erkennungstafel des Ermordeten sowie Angaben zu seiner Person im Verbrecheralbum. Viel war es nicht, was die akribischen Kollegen aus der Registratur ihm hinlegten, alles doppelt und dreifach vorhanden, und vor allem veraltet.
Weber packte die Zettel und Karteikarten in einen Klappordner, quittierte den Erhalt und ging dann zur anthropometrischen Registratur, um sich die dortige Karte von Eduard Geyer alias Schrammel-Ede vorlegen zu lassen. Abgesehen von den Vermessungsdaten sämtlicher körperlicher Merkmale inklusive Armspanne, Sitzhöhe, Kopfbreite und Ohrlänge, Augenklasse und Gesichtsfülle, war bei den Personalien vermerkt: »Beruf: ehemals Musikant; Verbrecherklasse: Einbrecher; Bemerkungen: Berufsverbrecher, Bandenmitglied«. Auch Schrammel-Edes Fingerabdrücke waren dokumentiert. Aber was sollte Weber das jetzt bringen, wo der Mann tot war? Eine Narbe am Unterarm war vermerkt mit dem Hinweis: »Biss-Spur vermutl. menschl. Ursprungs«. Außerdem: »Gefängnis: 2-mal, Zuchthaus: 1-mal«. Die letzte Verhaftung lag eineinhalb Jahre zurück: »wg. Diebstahl, mangels Beweisen keine Verurteilung«.
Eduard Geyer hatte also in der kriminalistischen Bürokratie Spuren hinterlassen, aber die vorliegenden Informationen enthielten keine Hinweise, dass jemand aktuell einen Vorteil von seiner Ermordung haben könnte. Es sei denn, ein Teil von Schrammel-Edes Wirken lag noch im Dunkeln.
Weber saß eine Weile an seinem Pult und schaute in den Himmel. Zweifellos waren einige Tage Außendienst vonnöten. Er würde zahlreiche Kneipen und Kaschemmen auf St. Pauli abklappern müssen, vielleicht auch Bars und Nachtklubs. Großartig. Er freute sich darauf wie ein kleiner Junge.
Gut gelaunt zog er die Schublade auf, holte die Wurststulle heraus, wickelte sie aus und biss hinein. Zu spät merkte er, dass er das falsche Brot erwischt hatte, das alte, trockene. Das mit dem durchdringenden Schimmelgeschmack.
Weber spuckte aus, gerade in dem Moment, als Kriminalanwärter Kruse eintrat. Der schlaksige junge Mann schaute ihn erschrocken an und fragte: »Ist Ihnen nicht gut, Herr Kommissar?«
»Wasser!«, stieß Weber hervor.
»Um Himmels willen!« Kruse stürzte nach draußen. Ein Stück weiter hinten im Flur, gleich um die nächste Ecke, gab es ein Waschbecken.
Mit einem verbeulten Zinnbecher in der Hand kam Kruse zurück. Weber hatte inzwischen einen Hustenanfall bekommen.
Dankbar nahm er das Wasser entgegen.
»Oje«, sagte Kruse und deutete auf Webers Schreibtisch. Auf der Karte mit den anthropometrischen Daten von Eduard Geyer lag eine dicke Fleischwurstscheibe, die sich unnatürlich grün verfärbt hatte.
»Soll ich das entfernen?«, fragte Kruse.
»Bitte.« Weber nickte. »Danke.«
Er entschloss sich, so bald wie möglich aufzubrechen. Das Gute an Ermittlungen auf St. Pauli war, dass man zwischenzeitlich aufkommenden Ärger und sonstigen üblen Geschmack mit einem Bier herunterspülen konnte.
Wenig später verließ er das Stadthaus. Das frische Wurstbrot vergaß er in der Schublade.
Drittes Kapitel:MÄDCHEN IN UNIFORM
Das »Verkehrslokal der Diebe und Taschenkrebse«, wie manche bei der Kripo die Gaststätte Goldeisen in der Querstraße zwischen Silbersackstraße und Wilhelmsplatz nannten, lag im Hochparterre. Die Kneipe hatte einen Eingang und drei Ausgänge, darunter einen im Keller, in den man durch eine Falltür hinter dem Tresen gelangte. Der zweite Ausgang war eine schmale Tür in einer brüchigen Mauer hinter der Latrine im Hinterhof, der dritte eine Tapetentür, durch die man in das Treppenhaus des Nebenhauses gelangte. Dort ging ein Fenster nach hinten raus, eine Tür nach vorn, und eine Nebentür führte in eine Cocktailbar, die einem erfolgreichen Ex-Ganoven gehörte.
Die Bar hieß Oho Soho! und war eine beliebte Adresse bei englischen Seeleuten, die spätnachts gerne ein Lied mit dem Namen der Bar improvisierten. Ab 22 Uhr waren vier Animierdamen anwesend, darunter eine Dunkelhäutige und eine aus Asien, die Melone und Schirm trugen und gegen genügend Bezahlung Jacketts und Nadelstreifenhosen ablegten, um in Boxershorts, Herrenunterhemden, Schnürstiefeln und Sockenhaltern dicke Zigarren zu rauchen, die die Gäste ebenfalls teuer bezahlen mussten. Die Melonen nahmen sie nur vom Kopf, wenn ein Gast sie zu einem privaten Glas Champagner in das kleine Zimmerchen im ersten Stock einlud.
Nebenan, bei den Dieben, ging es schlichter zu. Hier wurde Bier getrunken, und man tauschte Erfahrungen und Tipps aus: wo gerade besonders naive Touristen unterwegs waren, die man ausnehmen konnte, oder welche Vergnügungstempel zurzeit unter besonderer Polizeibeobachtung standen. Nach gemeinsamen Überfällen und kleineren Einbrüchen – die Gäste hier waren allesamt eher bescheiden oder vorsichtig veranlagt – wurde im Keller die Beute aufgeteilt.
Weber schob die schwere Tür auf und nickte dem kleinen mageren Wirt mit dem Charlie-Chaplin-Bärtchen zu, der hinter dem Tresen stand.
»Moin, Kommissar«, sagte der und schaute nach unten. »Durstig oder neugierig?«
»Beides.« Weber schob die Schirmmütze in den Nacken und ging zu seinem Stammplatz in der Nische am Fenster. Bänke oder Stühle gab es sonst nur ganz hinten, wo ein großer Tisch stand, an dem gespielt wurde, wenn genug Geld im Umlauf war. Ein Wimpel des Geselligkeitsvereins Goldenes Eisen stand in der Mitte. Das Wappen darauf sah auf den ersten Blick aus wie das Symbol der Raiffeisenbanken, beim zweiten Hinschauen wurde den meisten klar, dass es zwei gekreuzte Brecheisen zeigte.
»Darf’s ein Bier sein?«, fragte der Wirt.
»Gern.«
»Um was geht’s denn heute?« Der Wirt griff nach einem Glas und ließ ein Bill-Bräu einlaufen.
»Der Tote auf dem Kirchhof. Schrammel-Ede«, sagte Weber.
»Traurige Geschichte.« Der Wirt, der das Bier auf die englische Art in einem Zug ins Glas gefüllt hatte, brachte es herüber.
»Vor allem sehr eigenartig, nicht?«
»Eigenartig?« Das Bier tropfte. Der Wirt benutzte seine Schürze, um die Tischplatte trockenzuwischen.
»Man gräbt ihn ein …«
»Auch Mörder können mitfühlend sein, Kommissar.«
»… und will, dass er gefunden wird.«
»Schuldgefühle vielleicht? Ich kannte mal einen Einbrecher, der einen Teil der Beute mit der Post wieder zurückschickte.«
Weber schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ein Mord ist doch kein Witz!«
»Ich kenne keine Mörder«, sagte der Wirt und blickte beleidigt drein. »Hier verkehren nur ehrbare Ganoven.«
»Ja, ja.« Weber wunderte sich selbst über seine plötzliche schlechte Laune. Vielleicht liegt’s ja an meiner Ahnung, dass wir es hier mit einer richtig üblen Sache zu tun haben, überlegte er.
»Sieh mal«, sagte er in vertraulichem Tonfall, »Eduard Geyer war aus allem raus, hatte sich praktisch zur Ruhe gesetzt, bis auf kleine Sachen, nur so für den täglichen Bedarf. Der war krank, der war am Ende. Und einer macht sich die Mühe, ihn zu töten?«
»Vielleicht ein Versehen. Oder ein Unfall. Deshalb auch das Verscharren. Dem Täter war’s peinlich.«
»Peinlich? Ein Mord?« Weber schaute den Wirt entgeistert an.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.