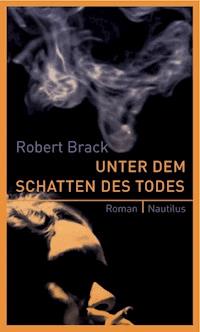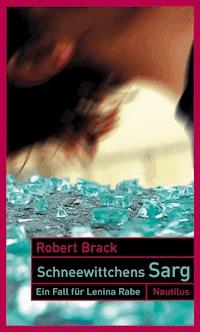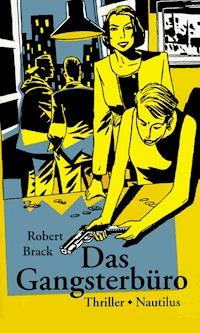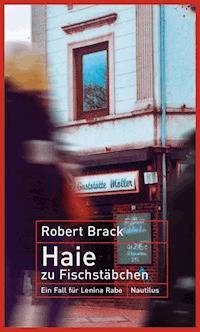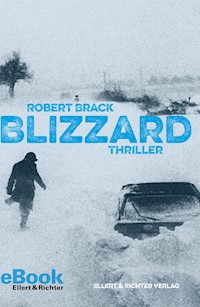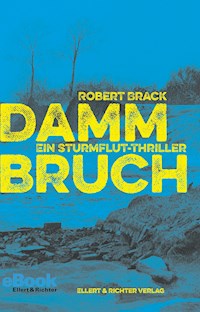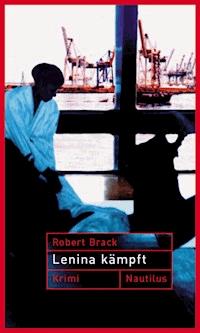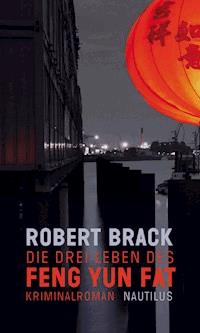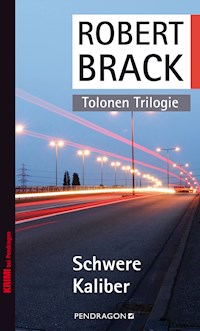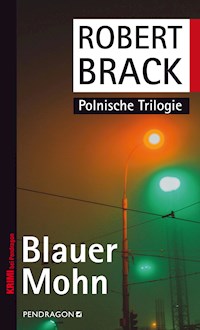8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Mord oder Selbstmord? Alfred Weber ermittelt im St. Pauli der 30er Jahre. Hamburg im März 1931. Eine Serie von mysteriösen Todesfällen erschüttert die Stadt. Auf Strecken der Hochbahn stürzen Frauen vor fahrende Züge - scheinbar ohne Fremdeinwirkung. Die Kriminalpolizei steht vor einem Rätsel, viele Menschen meiden inzwischen Fahrten mit der Hochbahn. Kommissar Alfred Weber ermittelt eigentlich in einem politischen Mord im Umfeld der aufsteigenden Bewegung der Nationalsozialisten. Dabei stößt er auf einen Zusammenhang mit den Todesfällen auf der Hochbahn. Doch seine Vorgesetzten bremsen ihn. Weber ermittelt auf eigene Faust und gerät selbst ins Visier des Mörders ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Kommissar von St. Pauli
Der Autor
Robert Brack, geboren 1959, lebt seit 1981 in Hamburg. Er arbeitet als Übersetzer und freier Schriftsteller. Für seine historischen und politischen Kriminalromane wurde er mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Mehr unter: www.gangsterbuero.deVon Robert Brack sind in unserem Hause bereits erschienen:Die Toten von St. PauliDie Morde von St. Pauli
Das Buch
Hamburg, im März 1931. Kriminalkommissar Alfred Weber ist inzwischen bei der Politischen Polizei und hat ganz andere Sorgen, als sich um die Todesfälle der Hochbahn zu kümmern: Mitten in der Polizeizentrale ist ein Mordanschlag verübt worden. Der Täter ein Nazi, das Opfer Webers Vorgesetzter. Die Lage ist angespannt, rechte Kreise bemühen sich um Zugang zur Macht.Im Zuge seiner Ermittlungen stößt Alfred Weber auf einen Zusammenhang mit den Todesfällen in der Hamburger Hochbahn. Offenbar ist die Unterwelt von St. Pauli mit den Nationalsozialisten eine gefährliche Allianz eingegangen. Weber ermittelt nun auf eigene Faust und gerät selbst ins Visier der Mörder …Ausgehend von zwei wahren Mordfällen im März 1931 erzählt Robert Brack von den sozialen Konflikten und der gesellschaftlichen Stimmung in Hamburg Anfang der Dreißigerjahre und den sich verschärfenden Machtkämpfen innerhalb der Polizeibehörde.
Robert Brack
Der Kommissar von St. Pauli
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage September 2018© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: plainpicture / © Thomas Grimm; © FinePic®, München (Hintergrund)E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-1812-7
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog:
Hurra ich lebe!
Erstes Kapitel:
Voruntersuchung
Zweites Kapitel:
Hokuspokus
Drittes Kapitel:
Vom Täter fehlt jede Spur
Viertes Kapitel:
Einbrecher
Fünftes Kapitel:
Die Eroberung der Luft
Sechstes Kapitel:
Geisterschenke
Siebtes Kapitel:
Der Andere
Achtes Kapitel:
Der Mann, der den Mord beging
Neuntes Kapitel:
Im Geheimdienst
Zehntes Kapitel:
Das gestohlene Gesicht
Elftes Kapitel:
Das letzte Lied
Zwölftes Kapitel:
Die Nacht ohne Pause
Dreizehntes Kapitel:
Hochverrat
Vierzehntes Kapitel:
Der Hampelmann
Fünfzehntes Kapitel:
Das verlorene Paradies
Epilog:
Die Frau, nach der man sich sehnt
Danksagung
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog: Hurra ich lebe!
Motto
»In gewaltiger Anspannung legt sich der gleißende Leib der Hochbahnschienen über Hamburgs Straßen und Wasser, drängt sich hinunter mit wühlenden Kräften in der Erde Dunkelheit, ausgestreckt zu fossiler Größe wie ein Nachkomme der Midgardschlange.«
Hamburgischer Correspondent
Prolog: Hurra ich lebe!
Es war einmal eine U-Bahn-Station von vollendeter Schönheit, in der lauerten Zerstörung und Vernichtung.
Nein, das ist nicht angenehm, aber schauen wir doch weiter:
In Hamburg am Hafentor unterhalb des Stintfangs erhob sich das turmartige Eingangsgebäude der Hochbahn-Haltestelle gegenüber den Landungsbrücken, wo tuckernde Barkassen auf Fahrgäste warteten und kleine Dampfer mit heiseren Sirenen Touristen zu einer Ausflugstour auf der Elbe anlockten.
Das klingt freundlicher und entspricht der Wahrheit.
Das Stationsgebäude stand unterhalb des klassizistischen Seewarten-Gebäudes und war nicht weniger wuchtig. Eine breite steinerne Treppe, die eines venezianischen Palazzos würdig gewesen wäre, führte auf eine zweiflügelige Tür zu, über der sich ein eleganter Turm aus Steinquadern in den Himmel reckte, gekrönt von einem Dachgeschoss mit bunten Bleiglasfenstern und einem geschwungenen Kupferdach.
Ein herrlicher Anblick, das muss ich zugeben.
Auf jeden Neuankömmling, der gerade von einem der hier anlegenden Seeschiffe an Land gestiegen war, musste der kolossale Turm wie ein Festungsgebäude wirken. Tatsächlich aber sollte dieses Monstrum dem Fremden bloß den Weg zur Hochbahn weisen, deren Züge entlang des Hafenrands über eine hohe Eisenbrücke Richtung Innenstadt ratterten.
Wie aufregend kann man doch eine Stadt inszenieren!
So empfand es auch die junge Frau in dem etwas zu großen Wollmantel, unter dem sie ein Hemdkleid aus zu dünnem Stoff trug, weshalb sie wohlig fröstelte. Ich sah sie gut, ich folgte ihr. Über ihrem Bubikopf trug sie eine Baskenmütze, lässig über das rechte Ohr gezogen. Es war erst Anfang März und noch sehr kalt, nicht zuletzt aufgrund der schweren Wirtschaftskrise, die die kapitalistische Welt auch im Jahr 1931 noch nicht überwunden hatte.
Die junge Frau jedoch war optimistisch gestimmt, denn sie hatte seit Anfang des Jahres eine Stelle in einem Schreibbüro, die zwar schlecht bezahlt, aber solide war, und neuerdings sogar einen Freund, der ihr gerade im »St. Pauli Fährhaus« einen Kaffee mit Schuss spendiert hatte.
Jedenfalls bildete sie sich das ein. Täuschte sie sich etwa? Aber nein, für sie war es die reine Wahrheit.
Beschwingt stieg sie die breite Treppe zum Hochbahn-Eingang hinauf.
An Zerstörung und Vernichtung dachte sie gewiss nicht. Sie dachte an ihn: An Jeremias, den netten jungen Mann, der in einem kleinen Handelskontor arbeitete, ein überaus charmanter und witziger Mensch. Na gut, er war offenbar Jude, aber das war ihr einstweilen schnurzpiepegal, solange er etwas hermachte und spendabel blieb.
Man liebt, was man lieben soll, wer wüsste das besser als ich? Wer wüsste besser als ich, was sie dachte: Falls es irgendwann – nicht zu bald, aber auch nicht in allzu weiter Ferne – etwas intimer wurde, wollte sie eigenhändig herausfinden, was es mit diesem kleinen Unterschied auf sich hatte, von dem ihr eine Freundin kürzlich erzählt hatte.
Und nun wurde sie ganz träumerisch: Jeremias und Juliane, das klang doch gar nicht schlecht! Nicht schlecht, Frau Specht, kaum hatte sie sich in Hamburg niedergelassen, hatte sie auch schon ein Rendezvous. Es ließ sich gut an. Und wenn der Sommer kam, vielleicht wurde ihr dann richtig schön heiß. Vielleicht schon an Pfingsten, wenn’s in die Sommerfrische ging, bei der »Pfingsttour«, von der die Kolleginnen so geschwärmt hatten. Sie stellte sich vor, wie sie auf dem warmen Gras lag und die Grillen zirpten und sie sich zurückbog und seine Schultern sich senkten und seine Augen kurz aufleuchteten, bevor er sie schloss, weil ihm genauso schwindelig wurde wie ihr selbst.
Das dachte sie sich, dessen bin ich mir gewiss. Aber wie sie sich das so vorstellte, wurde ihr doch ein bisschen blümerant. Schwummerig. Schwindelig sogar. Hoppla, dachte sie, wieso dreht sich denn jetzt alles in meinem Kopf? Stütz dich doch mal kurz an der Wand ab. Normalerweise sitzt so eine Unpässlichkeit doch tiefer, Mädchen, wieso denn jetzt im Kopf? Sollte das etwa eine Folge aufwallender Gefühle sein? Na, vielen Dank auch, ausgerechnet jetzt, wo die Mittagspause vorbei ist und ich mich sputen muss!
Da hörte sie das Lerchengezwitscher hoch oben über einem weiten Feld. Und stimmte mit ein … und ließ sich fallen …
Na bitte.
Später wurde es im Polizeibericht so formuliert, als Ergebnis zusammengeführter Zeugenaussagen:
»Die Opferperson trat um 13.41 Uhr aus dem Lokal ›Fährhaus‹, blieb kurz stehen und schaute offensichtlich auf ihre Damenarmbanduhr. Anschließend lief sie zügig auf die Treppe zu, die zum Eingang Hochbahnstation führt. Dabei ist sie offenbar kurz mit dem linken Fuß umgeknickt oder gestrauchelt, erreichte aber das Portal, ohne anzuhalten. In der Tür hielt sie inne und stützte sich am Rahmen ab. Dabei soll sie leise aufgelacht haben. Möglicherweise ist das Geräusch, das sie von sich gab, aber auch auf einen Schluckauf zurückzuführen. Sie soll im Lokal ja Alkohol getrunken haben. Nun wandte sie sich nach rechts und bewegte sich auf den Aufgang zu, der zum Bahnsteig in Richtung Innenstadt führt. Nach wenigen Stufen blieb sie stehen und stützte sich mit der rechten Hand an der Wand ab. In dieser Stellung und laut schnaufend, wie mehrere Zeugen übereinstimmend berichteten, verharrte sie einige Minuten. Widersprüchlich wurde berichtet, sie habe gelacht oder geweint. Schließlich stieg sie weiter die Treppe hinauf zum Bahnsteig. Oben angekommen, trippelte sie mit kleinen Schritten ›wie eine aufgezogene Puppe‹ bis zum Unterstand des Haltestellenaufsehers und blieb dort stehen. Nachdem drei Züge abgefertigt worden waren und die junge Frau immer noch dastand, trat der Aufseher zu ihr und fragte sie, wohin sie denn fahren wolle. ›Zur Arbeit‹, sagte sie und starrte dabei zu Boden. Der Aufseher bemerkte hierzu, sie müsse schon in den Zug steigen, um transportiert zu werden. Daraufhin antwortete sie wörtlich: ›Keine Sorge, ich tu’s ja gleich.‹ Dabei schaute sie ihn zum ersten Mal an. ›Ihre Augen waren voller Tränen‹, so der Aufseher, ›sie presste die Lippen zusammen, als müsste sie noch genügend Mut finden für das, was sie sich vorgenommen hatte.‹ Der Aufseher ging zurück auf seinen Posten. Als der Zug aus Richtung Millerntor sich lautstark ankündigte und um die Kurve fuhr, rannte die junge Frau ihm entgegen, wobei sie zwei wartende Passagiere roh beiseiteschob, und warf sich vor den ersten Wagen, der sie erfasste und mit sich zog. Dabei wurde dem Opfer von einem Rad der Kopf abgetrennt. Jede Hilfe kam zu spät, sie war augenblicklich tot. Der Hochbahn-Verkehr wurde sofort gestoppt, die Haltestelle von den Aufsehern umgehend geräumt. Bis zum gleichzeitigen Eintreffen von Polizei und Samaritern wurde an Zug und Opfer nichts verändert. Die Augen der Toten waren weit aufgerissen, der Mund zu einem grotesken Lächeln verzerrt.«
Anmerkung eines bearbeitenden Kriminalbeamten: »Von dem Mann, der mit dem Unfallopfer kurz zuvor in der Gaststätte ›St. Pauli Fährhaus‹ einen Kaffee mit Cognac verzehrt hat, fehlt jede Spur. Sein Name ist nicht bekannt, die Personenbeschreibung dürftig, siehe Anlage 3a (gez. KS Erichs).«
Über das, was im Kopf der jungen Frau kurz vor ihrem Selbstmord vorgegangen war, war im Polizeibericht natürlich nichts vermerkt.
Erstes Kapitel: Voruntersuchung
»Da haben Sie aber noch mal Glück gehabt, Herr Kommissar.«
»Das sehe ich anders.«
»Hmhm.«
»Ich sagte …«
Der Barbier umfasste Webers Nase mit Daumen und Zeigefinger und bog sie nach links. Ein paar Härchen wurden beseitigt. Dann bog er die Nase nach rechts. Und wieder schabte er mit der scharfen Klinge einige dünne Borsten weg, die an der falschen Stelle gesprossen waren.
Nun mussten die Wangen rasiert werden, denn Kommissar Alfred Weber trug seit einiger Zeit einen Henriquatre-Bart. Obwohl oder gerade weil dieser eher unmodern war. Aber welche Bedeutung hatte Modernität schon, wenn man mit Riesenschritten auf die fünfzig zuging?
»Ich sagte, das sehe ich anders.«
»Ja, ja.« Der Barbier war so geschickt, dass Weber kaum bemerkte, wie die Klinge über seine Wangen huschte. Im Nullkommanichts sah er aus wie aus dem Ei gepellt.
»Das Handgas klemmte. Dabei kam der Wagen gerade aus der Werkstatt.«
»Handgas?«
»Ja, ganz recht.«
»Fährt man denn nicht mit dem Fuß? Ich habe kein Automobil, deshalb … Sie fahren einen Ford, Herr Kommissar?«
»Ja, die gute alte Blechliesel, das Model T.«
»Ich bin da nicht auf dem Laufenden, denn wie gesagt, ich chauffiere nicht.«
Weber hob die Hand. »Eben. Und deshalb können Sie das Ausmaß der Situation gar nicht erfassen.« Einen kurzen Moment lang war er erstaunt, dass seine Aussprache wieder sehr klar war. Nach der Zecherei letzte Nacht nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.
»Da haben Sie recht, Herr Kommissar.«
»Sehen Sie, ich hatte mich ja vorher schon geärgert. Ich hatte nämlich Feierabend. Es war erst Nachmittag und meine Bekannte war noch auf der Arbeit. Ein Moment der Entspannung – und dabei gelegentlich einen Blick in die Runde werfen, kann nicht schaden. Man hat schließlich einen Beruf.«
»Immer auf dem Quivive, Herr Kommissar.« Der Barbier bog den Kopf seines Kunden nach hinten, um die Kehle zu bearbeiten.
»Genau. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, das funktioniert in meinem Beruf nicht«, erklärte Weber mit einer Offenheit, die ihn selbst erstaunte.
»Holzauge sei wachsam«, lachte der Barbier.
»Ich saß nun also bei ›Ostermanns‹, weil mir zugetragen worden war, dass ein Hehler dort Kundschaft trifft. Politische Kundschaft. Aber wie gesagt, nach Dienstschluss, also war ein zweites Glas Wein drin. Ostermanns ist nämlich ein Weinlokal. Dort geht es ganz schön etepetete zu.«
»Sehr vornehm soll es dort sein«, sagte der Barbier. »Erstklassige Küche, heißt es, und Künstlerkonzerte.«
»Na ja, ein Streichquartett am Nachmittag ist nicht jedermanns Sache.«
Der Barbier strich jetzt geschickt über die Ränder von Webers Ohren, um dort vereinzelt wachsende Härchen zu beseitigen. »Jeder nach seiner Façon«, sagte er. »Und war denn der Hehler zugegen?«
»Nein. Aber das war mir nur recht, ich konnte noch einen Mosel bestellen. Der war angenehm süß. Und wie gesagt, ich hatte ja Feierabend.«
»Und Ihre Süße war noch fern …«, scherzte der Barbier.
Weber warf ihm einen strafenden Blick zu.
»Und dann steht auf einmal dieser kleine dicke Kerl vor mir. Jung und übereifrig. Rote Wangen vor Begeisterung. Und lockiges Haar.« Weber verzog abfällig das Gesicht.
»Jung und gut aussehend«, vermutete der Barbier.
»Von wegen, vor allem aber aufdringlich. Aber das Schlimme war ja: auch noch ein Kollege! Schmeißt sich an mich ran. Guten Tag, Herr Kommissar, mein Name ist …« Weber dachte angestrengt nach. »Hab ich jetzt vergessen, ist ja auch egal. Ein Kriminalanwärter. Behauptete, er sei mir zugeteilt worden. Dabei habe ich mir derartige Zuweisungen verbeten. Wissen Sie, in meiner Abteilung, also Politische Polizei, kann man nicht einfach jeden nehmen. Da sucht man die Mitarbeiter sehr genau aus.«
»Selbstverständlich.« Der Barbier kürzte einige widerspenstige Haare an Webers Augenbrauen, die in alle Richtungen standen.
»Es geht um Staatsschutz. Da sind nicht mal altgediente Beamte einfach so unverdächtig. Antirepublikanische Umtriebe allenthalben.«
»Gewiss.«
»Und die schicken mir einen unbekannten, unbeleckten Jüngling. Ohne Ankündigung.«
»Unbeleckt …« Der Barbier drehte sich um und griff nach dem feuchten Tuch, das er vor dem Ofen zum Wärmen auf einen Bügel gehängt hatte.
»Ich schicke ihn also weg. Muss ihn mehrfach auffordern. Macht ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Heulsusen können wir schon gar nicht gebrauchen.«
»Harte Männer wie Sie, Herr Kommissar«, sagte der Barbier und warf Weber das feuchte Tuch über das Gesicht.
Weber erinnerte sich, wie er nach dem Fortgang des jungen Kollegen noch ein Glas Wein bestellt hatte. Das war zweifellos eins zu viel gewesen, denn er spürte jetzt unter der heißen Maske seinen Brummschädel. Nach diesem Glas hatte er »Ostermanns« verlassen. Noch immer leicht verärgert, war er an der »Volksoper« vorbeigegangen und in die Eckernförder Straße abgebogen, wo sein Automobil geparkt war. Kurz hatte er überlegt, es stehen zu lassen, weil er sich ein wenig beduselt fühlte, aber dann war er doch eingestiegen. Da er sich unschlüssig gewesen war, wo er hinfahren sollte – zu Hannchen oder doch erst mal nach Hause oder in die Böhmkenstraße, um den Wagen in der Garage unterzustellen? –, war er in die Heinestraße gebogen, hatte die Reeperbahn überquert, auf dem Wilhelmsplatz einen Bogen beschrieben. Dabei entschloss er sich, schnell nach Hause zu fahren, um sich frisch zu machen, bevor er Hannchen besuchte.
Also rüber über die Davidstraße und – trotz des zornigen Klingelns der Tram, der er den Weg schnitt – rein in die Kastanienallee. Und da klemmte der verdammte Gashebel! Was diesen Angeber in seinem offenen Rosengart-Sportwagen nicht davon abhielt, von rechts aus der Taubenstraße herauszuschießen und auf sein Vorfahrtsrecht zu beharren. Webers hochtourig fahrender Ford wurde jäh gestoppt. Weber prallte mit der Brust gegen das Lenkrad und bekam erst wieder Luft, als dem anderen Fahrer die Schimpfworte ausgingen. Er stieg aus, und es hätte beinahe eine Schlägerei gegeben, wenn nicht ein zufällig vorbeikommender Kollege eingeschritten wäre. Dem gelang es mit viel diplomatischem Geschick, die Situation zu entschärfen und die Herren zu einer gütlichen Einigung zu bewegen. Der Rosengart hatte eine Beule und etwas Lackschaden, der Fahrer ein dickes Portemonnaie – was sollte denn die ganze Aufregung?
Übel an der Sache war nur, dass es sich bei diesem so überaus geschickt agierenden Kollegen um den jungen, dicken Kriminalanwärter mit den lächerlichen Locken handelte. Als Weber sich bei ihm bedankte, schwitzte er vor Scham und kochte gleichzeitig vor Wut.
Jetzt fiel ihm auch der Name wieder ein: Fritz Klindworth – so hatte er sich vorgestellt.
Der Rosengart fuhr weiter, aber Webers Ford musste abgeschleppt werden. Das Kühlwasser war ausgelaufen. Als er sehr spät bei Hannchen ankam und ihr von seinem Missgeschick erzählte, schlug sie die Hände überm Kopf zusammen, schluchzte laut auf und begann ihm detailliert vor Augen zu führen, wie schlimm die Sache hätte enden können. Als sie sich immer mehr in anatomischen Details verlor, während es zügig auf Mitternacht zuging, stand er auf, hob sie hoch und trug sie ins Bett, wo sie sich bald beruhigt hatte.
Was war denn auch geschehen? Das bisschen Blechschaden ließ sich beheben. Der Handgashebel konnte repariert oder ausgewechselt werden. Und die Kopfschmerzen vom Moselwein würden auch vergehen. Beinahe waren sie schon verflogen.
Der Barbier nahm das feuchte Tuch von Webers Gesicht und trocknete ihn sanft ab. Massierte sein Gesicht mit einem wohlriechenden Rasierwasser, das er aus einer Glasflasche auf die Hand träufelte. Als Weber vom Frisiersessel aufstand, fühlte er sich beinahe wie ein neuer Mensch. Er warf einen Blick auf die Uhr an der Wand, deren Zeiger verkehrt herum über das Ziffernblatt wanderten, und schüttelte irritiert den Kopf. Ein Blick in den Spiegel und er erkannte, dass es Viertel vor elf war, Zeit für seinen Dienstantritt zur Spätschicht.
Weber legte den üblichen Betrag passend auf den kleinen Ladentresen, verabschiedete sich und wandte sich ab. Da spürte er die Hand des Barbiers auf seinem Unterarm.
»Nur eines noch, Herr Kommissar …«
»Ja bitte?«
»Seien Sie vorsichtig heute.« Der Barbier machte ein besorgtes Gesicht.
Weber drehte sich zu ihm um. »Nanu, was haben Sie denn?«
»Heute ist Freitag, der Dreizehnte.«
Weber lachte fröhlich. »Na und? Ich bin nicht abergläubisch.« Er hob die Hand und gab dem Barbier einen Klaps auf die Schulter. Der hatte damit nicht gerechnet und schreckte zusammen. Dabei entglitt ihm die Flasche mit dem Rasierwasser. Sie fiel auf den Boden und zersprang. Glasscherben flogen herum, der Inhalt spritzte über das Linoleum.
»Nein, lassen Sie nur«, sagte der Barbier, als Weber sich bückte.
»Na gut, aber die Flasche ersetze ich Ihnen«, sagte Weber und legte einen Schein auf den Tresen, während der Barbier nach einem Feudel suchte.
»Vielen Dank, Herr Kommissar, das ist sehr freundlich.«
»Also dann …« Weber ging zur Tür und zog sie auf. Das Klingelzeichen ertönte.
Weber hielt inne und drehte sich ein letztes Mal um. Der Barbier war schon auf den Knien und mit dem Saubermachen beschäftigt.
»Es tut mir wirklich leid«, erklärte Weber leutselig, »aber durch dieses Ungeschick bin ich quasi reingewaschen.«
»Wie bitte?« Der Kopf des Barbiers erschien über einer Sessellehne.
»Das war mein Freitag, der Dreizehnte. Nun kann mir dieser Unglückstag nichts mehr anhaben.«
Dass die zerbrochene Flasche womöglich auf das Schicksalskonto des Barbiers ging, darüber machte sich Kommissar Weber keine Gedanken, als er die Tür hinter sich zuzog und fröhlich pfeifend die Düsternstraße entlangging, Richtung Stadthaus zur Polizeizentrale.
In seinem Büro angekommen, hängte Weber leicht schnaufend Hut, Mantel und Schal an die Garderobe und knöpfte die Gamaschen von den Schnürstiefeln, die er wegen des Schneematschs vorsorglich übergezogen hatte. Das Schnaufen kam vom Treppensteigen, es war ihm unangenehm. Sicher lag es an der Erkältung, die er sich vor einigen Wochen eingefangen hatte und die noch nicht ganz abgeklungen war. Das Treppensteigen hinauf in den dritten Stock konnte kaum die Ursache sein, so viel Bauch schleppte er nun auch wieder nicht mit sich herum.
Nachdem er das Fenster zwecks Frischluftzufuhr kurz geöffnet und wieder geschlossen hatte, setzte er sich an eines der drei Schreibpulte. Die Kollegen, mit denen er sich das Dienstzimmer teilte, ein Kriminalobersekretär und ein Kriminalsekretär, waren schon unterwegs. Sie sollten Auskünfte über ein geheimes Waffenversteck der Roten Marine im Hafen einholen und dazu einen Informanten treffen und inkognito eine Kommunistenkneipe aufsuchen.
Weber war das nur recht. Er war ganz gern allein im Büro. In letzter Zeit hatte er sogar Gefallen am Studieren und Bearbeiten von Akten gefunden.
Er holte seine Thermoskanne mit dem Pfefferminztee aus der mitgebrachten Aktentasche und legte seine Wurststulle in die Schreibtischschublade. Den Tee braute Hannchen ihm immer, wenn er von ihrer Wohnung in der Lilienhof-Terrasse zum Dienst aufbrach. »Der ist gut für deinen Magen«, hatte sie ihm erklärt. Weber hatte sich an das Getränk gewöhnt und fand inzwischen, dass es sogar wohltuend auf das Gehirn wirkte. Eine Illusion wahrscheinlich, aber zweifellos aus der innigen Zuneigung geboren, die er seiner Lebensgefährtin entgegenbrachte, die ihm zuliebe ihre Tätigkeit am Straßenrand auf St. Pauli zugunsten einer Anstellung in einer Wäscherei aufgegeben hatte.
Ach, Hannchen, dachte Weber. Er nippte an dem Tee und schlug eine Akte auf, in der ein eigenartiger, polizeiinterner Konflikt dokumentiert war. Es handelte sich um die Versetzung eines männlichen Beamten, der bei der Weiblichen Kriminalpolizei arbeitete, die vor allem für Delikte an Frauen zuständig war. Kurios daran war, dass der Beamte namens Schlegel aus »sexuellen« Gründen versetzt worden war. Angeblich sei er homosexuell und ein »Onanist«, dem der Dienst in der WKP nicht guttäte. Begründung des Kripo-Leiters Dr. Schlanbusch: Der Mann sei immer sehr blass. Die Leiterin der WKP-Dienststelle, Frau Erkens, die seit einiger Zeit im Clinch mit Schlanbusch lag, fand das empörend. Und nun hatte Weber den Auftrag bekommen, die »Gesinnung« von Schlegel und einigen anderen Beamten innerhalb der WKP zu ergründen.
Was um Himmels willen hatte das denn mit dem Aufgabenbereich der Politischen Polizei zu tun? Sollte Weber die Kollegen etwa beschatten lassen, ihr Privatleben ausforschen, ihnen nachsteigen, wenn sie während der Freizeit ein Lokal oder eine Bar besuchten? Also ehrlich gesagt … Weber sah hier zwei Aspekte, die ihm überhaupt nicht gefielen: Zum einen empfand er es als beleidigend, quasi die Arbeit der Sittenpolizei übernehmen zu müssen. Damit hatte er rein gar nichts zu tun und wollte auch nichts damit zu tun haben. Zum anderen ahnte er, dass es hier um polizeiinterne Machtkämpfe ging, und für die wollte er sich schon gar nicht einspannen lassen. Trotz der fortschrittlichen Führung gab es vor allem in den oberen Rängen viele Beamte, die es als Schwächung, ja sogar als einen Angriff auf die Staatsmacht ansahen, wenn Frauen als Polizistinnen auftraten.
Weber hatte über ein Jahr bei der WKP gearbeitet, bevor er im Herbst 1928 auf eigenen Wunsch zur Politischen Polizei versetzt worden war. Nicht dass ihm die Arbeit bei der WKP unangenehm gewesen wäre. Er arbeitete gern mit Frauen zusammen, hatte sich sogar einmal in eine junge Kollegin verliebt (bevor die Sache mit Hannchen akut wurde), aber als die internen Zwistigkeiten überhandnahmen, war er lieber gegangen.
Und nun hatten sie ihm diese Akte geschickt. Wirklich ungeheuerlich. Ihm war schon klar, wer hinter den Machenschaften zur Untergrabung der Frauenpolizei steckte. »Falls jemals an die Öffentlichkeit dringt, was hier im Stadthaus an Intrigen gesponnen wird, dann fliegt uns der Laden um die Ohren«, hatte Weber einmal zu seinem Freund Hilbrecht, dem Polizeifotografen, gesagt. Der hatte beschwichtigt: »Du übertreibst, Alfred, wie immer. Das sind nur ein paar kleinliche Querelen. Das gehört dazu. Sieh mal, zu Hause bei mir, wenn die Kinder …« Und so weiter. Hilbrecht legte grundsätzlich bei allen Vorkommnissen der Weltgeschichte den Maßstab seiner Familie an.
Weber überlegte, wie er die Akte loswerden könnte. Vielleicht sollte er sie demjenigen zurückgeben, der sie ihm aufgedrückt hatte. Das war Regierungsrat Lassally gewesen, sein Vorgesetzter. Allerdings war nicht so ganz klar, wie der darauf reagieren würde. Er war ein Hundertfünfzigprozentiger, studierter Jurist aus großbürgerlichen Verhältnissen, er verlangte, dass alles exakt nach Vorschrift und auf korrektem Dienstweg bearbeitet wurde. Sich an ihm vorbei an eine höhere Stelle zu wenden, war gänzlich unmöglich, Lassally würde sich sein maßgeschneidertes Sakko zuknöpfen und ihn ganz sachlich zur Schnecke machen.
Die zweite Möglichkeit wäre, sie einem untergebenen Kollegen aufzudrücken. Aber das hätte zwei Nachteile: Erstens würde sie dann irgendwann wieder bearbeitet zu ihm zurückkommen, und zweitens würde ein anderer diese unsauberen Ermittlungen durchführen. Blieb drittens noch die Methode der unschuldigen Provokation: Er konnte mit der Akte zu Frau Erkens, der Leiterin der WKP, gehen und ihr ein paar scheinheilige, nichtssagende Fragen dazu stellen. Frau Erkens würde garantiert an die Decke gehen und eine weitere Intrige gegen sie und ihre Dienststelle wittern. Die Folge wäre ein Konflikt auf der Ebene seiner Vorgesetzten. Die Fetzen würden fliegen und er würde unbemerkt seinen Kopf aus der Schlinge ziehen und sich davonstehlen.
Weber schmunzelte und fing leise an zu lachen. Was für eine grandiose Idee! Er stellte sich vor, wie Frau Erkens sich wie eine Furie auf Dr. Schlanbusch stürzte, der die Verantwortung zweifellos auf Lassally abwälzen würde. Und schon würde Präsident Campe, angelockt von dem lauten Geschrei, durch die endlosen Flure der Polizeizentrale herbeieilen, um den Streit zu schlichten, bevor man sich gegenseitig an die Gurgel ging. Solche Eklats hatte es in der Vergangenheit schon mehrfach gegeben. Weber fiel ein, dass er selbst einmal beobachtet hatte, wie Frau Erkens vor Dr. Schlanbusch einen Hofknicks gemacht hatte mit den Worten: »Ich danke auch vielmals für die fortgesetzten gnädigen Schikanen.«
Was für eine Szene! Hofknicks! »Ich danke vielmals.« Wie eine Madame Pompadour! Das war einfach zu schön gewesen. Weber lachte vor sich hin.
Und da knallte es.
Laut. In unmittelbarer Nähe. Bestenfalls ein oder zwei Zimmer weiter. Womöglich auf dem Flur? Ein Schuss? Weber sprang auf und horchte.
Ein schriller Schrei.
Weber stürzte in den Korridor. Was er dort sah, kam ihm zunächst völlig unverständlich vor.
Zwei Türen weiter stand ein Polizeibeamter der Ordnungspolizei vor dem Büro von Regierungsrat Lassally, in voller Uniform, den Tschako auf dem Kopf, breitbeinig, mit ausgestreckten Armen. Er stemmte die Hände gegen den Türrahmen, um den Durchgang zu blockieren.
Vor ihm ein junger Mann in Zivil, der versuchte, ins Zimmer zu kommen. Dazu müsste er aber erst mal den Orpo-Mann aus dem Weg befördern. Doch der war groß und muskulös und hielt dagegen. Bei dem jungen Mann in Zivil handelte es sich tatsächlich um den Kollegen, den Weber am Vorabend abgewimmelt hatte. Fritz Klindworth, seine Locken waren nicht zu übersehen. Er ballte die Fäuste und hieb damit auf seinen Widersacher ein. Ächzen und Stöhnen, sonst war nichts zu hören. Nur noch gelegentliches Schreien aus dem Büro von Lassally.
Jetzt ließ Klindworth von dem Uniformierten ab, trat zwei Schritte zurück und griff unter seine Jacke. Hatte er dort eine Waffe?
Weber war schon beinahe neben ihm, wollte ihm in den Arm fallen und etwas rufen wie: »Um Himmels willen, keine Schießerei. Der Mann ist doch gar nicht bewaffnet!« Doch der Uniformierte überblickte die Lage besser, machte einen Ausfallschritt, packte Klindworth und schleuderte ihn gegen den hinzukommenden Weber. Beide taumelten zur Seite. Weber strauchelte, Klindworth stolperte. Weber fiel, Klindworth stürzte über ihn. Gottverdammt schwer war er, dieser Dickwanst!
Weber rang nach Luft und sah, wie der Orpo-Mann über ihn sprang und dabei seinen Tschako verlor, der polternd neben ihm auf dem Boden landete. Weber kniff erschrocken die Augen zu.
Er riss sie wieder auf. Der Uniformierte war verschwunden. Weber sah, wie der dicke Klindworth erstaunlich flink auf die Beine kam und hinter dem Flüchtenden herrannte.
Weber rappelte sich auf, stützte sich am Türrahmen ab und stolperte unbeholfen in Lassallys Büro.
Es war eins von diesen Dienstzimmern, von denen Weber klammheimlich träumte. Holzvertäfelung, Aktenschrank, Bücherregal und nur ein einziger Schreibtisch, bestimmt aus Eiche. Dazu ein Sessel mit Armlehne, sehr bequem, auch für den kurzen Mittagsschlaf.
Lassally, sonst immer ein Ausbund an Haltung und Akkuratesse, lag schlaff darin, aber er schlief nicht. Er schnaufte laut und hielt sich die linke Seite seines eleganten Sakkos, unterhalb des Herzens, da wo der Brustkasten endet. Seine sonst blütenweißen Manschetten waren tiefrot getränkt. Der Schuss hatte ihn getroffen, zweifellos. Er war wachsbleich, aber sein Haar wie immer glatt pomadisiert und linear gescheitelt.
Vor dem Schreibtisch stand breitbeinig ein großer breiter Kerl in langem schmutzigem Regenmantel, die Schirmmütze tief ins Gesicht gezogen, leicht schwankend. Nur im Augenwinkel sah Weber auch Lassallys Sekretärin, eine angegraute Dame mit Dutt, die stocksteif vor dem Stuhl stand, auf dem sie eben noch gesessen hatte, um das Verhör zu protokollieren. Jetzt hatte sie die Hände vors Gesicht geschlagen und den Mund weit aufgerissen, nur kam kein Ton mehr heraus. Der Kerl im Regenmantel hielt eine Pistole in der Hand, zielte damit auf Lassally. Hatte schon einmal abgedrückt, wollte noch mal schießen, aber es gelang ihm nicht. Die Waffe versagte, Ladehemmung.
Der Mann stieß einen wütenden Schrei aus, wirbelte herum, sah, dass Weber ihm den Weg blockierte, und schmetterte ihm die Waffe gegen die rechte Schläfe.
Bei Weber gingen die Lichter aus. Dass er zu Boden gestürzt war, merkte er erst, als er wieder zu sich kam. Neben ihm kniete Lassallys Sekretärin und fächelte ihm mit einem Aktendeckel kühle Luft zu. Noch kühler war der nasse Lappen, der an seinem Kopf klebte. Weber fiel auf, dass ihr knöchellanges, schwarzes Kleid aus so viel Stoff bestand, dass es gut für zwei derartig schmale Personen ausgereicht hätte.
»Die Samariter kommen gleich«, hauchte die Frau.
»Wie bitte?«, fragte Weber erschrocken.
»Bleiben Sie ganz ruhig, Herr Kommissar. Man wird Sie sofort ins Krankenhaus bringen.«
»Unsinn«, sagte Weber und rappelte sich mühsam auf.
Niemand sonst im Zimmer. Eigenartig.
»Wo …«, sagte Weber, »was … ist denn passiert?«
Sie zuckte mit den Schultern, wollte etwas sagen, war aber offensichtlich überfordert, wusste nicht recht, wo sie anfangen sollte.
»Ach so«, sagte Weber und nickte verständnisvoll. Denn eben tauchte vor seinem geistigen Auge das besorgte Gesicht seines Barbiers wieder auf: »Heute ist Freitag, der Dreizehnte.«
»Und welches Jahr haben wir, Herr Kommissar, und welchen Monat?«
»1931, wenn ich mich recht erinnere, März, oder?«
Die Sekretärin nickte erleichtert und drückte seine Hand.
»Und wo sind wir hier?«, fragte sie weiter.
»Bestimmt nicht in der Polizeizentrale, oder?« Weber blinzelte ihr schelmisch zu.
Sie schaute ihn verzweifelt an: »Doch.«
Zu Webers großer Verwunderung konnte Fritz Klindworth den flüchtigen Wachtmeister Möller überwältigen, kurz bevor es ihm gelang, am Jungfernstieg in der Grube der im Bau befindlichen U-Bahn-Station zu verschwinden. Bei der kurzen handgreiflichen Auseinandersetzung fing der eifrige Polizeianwärter sich ein Veilchen ein, konnte die Sache aber dank passabler Jiu-Jitsu-Kenntnisse für sich entscheiden. Anschließend legte der kleine dicke Mann in Zivil dem großen Kerl in Uniform Handschellen an und führte ihn unter den erstaunten Augen der Passanten zurück zum Stadthaus.
Dort saß Möller jetzt in einem Vernehmungszimmer, immer noch bewacht von Klindworth. Weber hatte dem jungen Kollegen mehrfach eingeschärft, dem Gefangenen nicht von der Seite zu weichen. Als ob das nötig gewesen wäre. Aber Klindworth hatte immer nur ganz korrekt mit »Jawohl, Herr Kommissar!« geantwortet.
Weber saß nun in Lassallys Dienstzimmer und verhörte die Frau mit dem Dutt. Die Samariter waren weggeschickt worden, sein Gehirn funktionierte wieder ganz gut. Der bohrende Kopfschmerz, der sich im Hinterkopf ausbreitete, konnte seine Ursache auch genauso gut im Alkoholgenuss des Vorabends haben. Viel wahrscheinlicher aber war, dass die Erschütterung beim Autounfall daran schuld war, entschied Weber jetzt.
Er wandte sich der Stenotypistin zu. Sie war sehr bleich. »Sind die beiden Beamten denn zusammen gekommen?«
»Nein, hintereinander.«
Sie hatte aufgehört, die Hände zu ringen, und saß jetzt ganz ruhig auf ihrem Stuhl. Stocksteif, wie in der Kirche.
»Wer kam denn zuerst?«
»Wachtmeister Möller.«
»Und?«
»Und setzte sich hin.« Die Frau deutete durch die offenstehende Tür in den Flur, wo an der gegenüberliegenden Wand eine Holzbank stand.
»Hat er sich angemeldet? Bei Ihnen oder bei Herrn Lassally?«
»Nein, das war nicht nötig, denn als er kam, traf er vor der Tür auf Herrn Regierungsrat, der ihn begrüßte und sagte: ›Gut, Möller, warten Sie hier.‹ Daraufhin setzte der Wachtmeister sich hin.«
»Und dann kam Pohl?«
»Ja, sieben Minuten später. Und damit verspätet. Er sollte zuerst vernommen werden, deshalb warteten wir.«
»Die beiden kamen also nicht zusammen. Hatten Sie den Eindruck, dass sie sich abgesprochen hatten? Oder dass sie sich kannten?«
»Abgesprochen? Das weiß ich nicht. Aber sie kannten sich wohl schon. Jedenfalls begrüßten sie sich mit Handschlag und sprachen sich sofort mit Vornamen an. Möller sagte zu Pohl: ›Na, du hast ja ganz schön geladen.‹ Und Pohl sagte: ›Dass die geladen ist, darauf kannst du spucken.‹ Dabei klopfte er auf seine Manteltasche. Darin war seine Dienstwaffe, wie sich dann herausstellte.« Die Sekretärin hielt inne und schluchzte kurz auf, blieb dabei aber weiterhin stocksteif sitzen.
Weber kam sich brutal vor, weil er immer weiterfragte. Aber was sollte er tun? Die Eindrücke unmittelbar nach dem Geschehen waren noch frisch und deshalb wahrhaftiger als spätere Berichte.
»Und weiter?«
»Dann setzte er sich hin. Ich war allerdings erstaunt, dass der Oberwachtmeister nicht in Uniform erschienen war. Das sagte ich Herrn Oberregierungsrat, dem das auch nicht gefiel. Aber er sagte nur: ›Na, Hauptsache er gibt seine Dienstmarke ab und die Pistole.‹ Das hat er dann ja leider nicht getan …« Sie schluchzte auf und hielt sich ein Taschentuch vor den Mund, das sie blitzschnell aus dem Ärmel ihres Kleids gezupft hatte.
»Was geschah dann?«
»Ich schloss die Tür, weil Herr Regierungsrat die Akten kurz studieren wollte. Dann öffnete ich sie wieder und rief Pohl herein. Dabei sah ich, wie die Männer tuschelten. Pohl stand sofort auf. Aber bevor er eintrat, sagte er noch zu Möller: ›Ich zähle auf dich.‹ Dann kam er rein.«
»Wie hat er das gesagt?«
»Bitte?«
»Der Tonfall!«, blaffte Weber sie an, was ihm augenblicklich leidtat.
»Ja also … für eine geheime Absprache zu laut. Aber er war ja betrunken und lallte sogar ein bisschen. Als er an mir vorbeiging, roch er sehr.«
»Und was erwiderte Möller darauf?«
»Der nickte und sagte: ›Klar doch.‹ Mehr nicht. Aber er stand auf in dem Moment, als ich die Tür schloss. Und spähte in den Flur. Nach rechts und links.«
»Aber die Tür stand doch offen, als ich kam.«
Die Frau wurde noch bleicher, als sie ohnehin schon war. »Ja«, sagte sie ganz leise.
»Wie kam das?«
»Ich … als … Er drohte … da stand ich auf und ging zur Tür.«
»Sie haben sie aufgemacht?«
Sie nickte.
»Stand Möller da schon vor der Tür?«
Sie nickte.
»Sie konnten also nicht hinaus?«
Die Stenotypistin versuchte den Kopf zu schütteln, aber das war jetzt zu anstrengend für sie.
Es wirkte, als würde sie in ihrem umfangreichen Kleid verschwinden.
Sie glitt von ihrem Stuhl wie eine schwere Daunendecke, die ganz langsam über den Rand eines Bettes rutscht. Weber sprang auf und konnte sie gerade noch auffangen.
Er legte sie vorsichtig auf den Boden, erhob sich, eilte in den Flur, rief eine Kollegin herbei und schickte einen vorbeikommenden Büroboten los, um Riechsalz zu besorgen.
Was er erfahren hatte, genügte, um Wachtmeister Möller in die Zange zu nehmen. Und den knöpfte er sich jetzt vor, im Beisein des jungen Kollegen, den er momentan ganz gut leiden konnte. Vielleicht wegen des Veilchens, damit wirkte er erwachsener.
»Sie haben sich also mit Pohl zu einer Mordtat verabredet«, blaffte Weber den Uniformierten an, dessen Arme noch immer mit Handschellen hinter dem Rücken gefesselt waren und durch die Öffnung in der Stuhllehne nach unten hingen.
Wachtmeister Möller, der eben noch zu Boden gestiert hatte, hob ruckartig den Kopf und fragte verblüfft: »Was?«
»Er hat versucht, Regierungsrat Lassally zu erschießen, und Sie haben ihm dabei assistiert. Mittäterschaft, das bringt Sie vielleicht nicht unter das Fallbeil, aber lebenslänglich ins Zuchthaus!«
Ganz kurz zuckte so etwas wie Angst über das Gesicht des Polizisten.
»Niemals!«, schrie er und sprang auf.
Der junge Kriminalbeamte trat ihm in den Weg, und der Wachtmeister fiel auf den Stuhl zurück.
Weber verschränkte die Arme und baute sich vor ihm auf. »Es ist bezeugt, dass Sie mit Pohl getuschelt haben kurz vor der Tat. Wenn das keine Absprache ist …«
»Nein!«
»Was denn sonst? Raus damit!«
»Ich war doch vorgeladen, deshalb war ich hier.«
»Vorgeladen? Warum?«
»Weil ich gewisse Sympathien habe. Und wenn schon! Das ist doch kein Grund …«
»Welche Sympathien?«
»Nationalsozialistisch. Na und? Viele Kollegen haben die. Ich bin aber gar nicht organisiert in der SA oder sonst wo, wie man mir vorwirft. Das ist gelogen. Ich bin doch längst ausgetreten!«
»Aber die Sympathien sind geblieben, was?«
»Darf man keine Sympathien haben? Haben Sie keine, Herr Kommissar? Darf man als Polizist nur Sympathien mit dem Reichsbanner haben, keine anderen? Können nur Sozialdemokraten für Ordnung sorgen? Das ist ja lächerlich. Aber ich bin jetzt still, sonst drehen Sie mir doch nur einen Strick daraus.«
»Was haben Sie denn erwartet, was Regierungsrat Lassally von Ihnen will?«, fragte Weber ruhig.
»Eine Gardinenpredigt habe ich erwartet. Was denn sonst? Und ich hätte ihm schon verklickert, dass er falsch gewickelt ist. Weil er nämlich keine Beweise hat und es auch keine gibt!«
»Und der Pohl?«
»Was ist mit dem Pohl?«
Weber deutete in den Flur. »Sie saßen also schon auf der Bank, und da kam Oberwachtmeister Pohl rein. Haben Sie salutiert, er steht ja höher?«
Möller grinste schief. »Sie sind ja witzig, Herr Kommissar. Ich kenne ihn doch. Da salutiert man nicht. Außerdem war er in Zivil.«
»Woher kennen Sie ihn denn, von der SA?«
Das Grinsen wurde noch schiefer, jetzt kam ein höhnischer Ausdruck in seinen Augen dazu. »Sie wollen mich aufs Glatteis führen. Aber nee, das läuft so nicht. Wir waren lange in derselben Kaserne, so sieht’s aus.«
»Wo?«
»Bundesstraße. Wir haben im selben Schlafraum gefroren. Scheißkalt ist es da. Man rückt einfach zusammen. Man salutiert nicht.«
»Na schön, aber unterhalten haben Sie sich schon, als Sie darauf warteten, hereingerufen zu werden.«
»Klar. Ich hab ihn gefragt wie’s ihm geht. Er sah ja ziemlich fertig aus. Und eine Fahne, zehn Meter gegen den Wind. Nicht gerade die Verfassung, in der man ein Verhör durchsteht.«
»Was hat er gesagt?«
»Bitte?«
»Was hat Pohl zu Ihnen gesagt, als Sie da auf der Bank zusammensaßen? Über seine Mordpläne.«
Möllers Gesichtsausdruck wechselte hastig zwischen Entsetzen, Unglaube und Belustigung. »Mordpläne? So was doch nicht. Ich hab ihn gefragt, wie’s ihm ergangen ist, seit er entkaserniert worden ist. Wir hatten uns ja länger nicht gesehen.«
»Und wie ist es ihm ergangen?«
»Beschissen, sagte er. Mutter gestorben, Freundin weg, Geld zu knapp und jetzt auch noch die Aussicht auf Rausschmiss. Er war ganz schön geladen.«
»Er war geladen und seine Pistole auch, die er in der Manteltasche trug. Das sagte er doch zu Ihnen, das ist bezeugt, Wachtmeister!«
Möller zögerte. »Daran … kann ich mich nicht erinnern.«
»Dann ging Pohl rein zu Lassally und Sie haben ihm Schützenhilfe geleistet …«
»Aber nein, niemals!«
»… Deckung gegeben, Schmiere gestanden!«
»Das ist nicht wahr!« Möller sprang auf, und wäre gefesselt auf Weber zugetaumelt, wenn Klindworth ihm nicht einen Faustschlag seitlich gegen den Kopf verpasst hätte, der ihn zurück auf den Stuhl beförderte.
»Sondern?«, fragte Weber.
»Ich will’s Ihnen ja sagen, um Himmels willen, lassen Sie mich doch erst mal reden.«
»Ich höre«, sagte Weber.
»Pohl sagte, er sei Nationalsozialist und das bleibe er auch. Er hätte bei der Reichswehr 1919 nicht den Kopf hingehalten gegen die Spartakisten, um sich jetzt seine Überzeugung vorschreiben zu lassen. Die Republik sei ein Dreck, aber bald kämen andere Zeiten, und dann würden wir endlich saubere Arbeit machen können. Er jedenfalls bleibe in der Partei, so lange er Lust dazu habe. Und wenn die verlotterte und verluderte und verjudete Polizei ihn nicht haben wolle, dann werde man schon sehen.«
»Und dann sagte er, er würde Lassally erschießen.«
Möller schüttelte den Kopf. »Nee, sagte er nicht. Er sagte was ganz anderes.«
»Und zwar?«
»Er machte einen Witz darüber, dass man die eine Hälfte der Juden ganz gut gebrauchen könne, denn das verdorben sein hätte in mancherlei Hinsicht durchaus seine Vorteile, er hätte da einschlägige Erfahrungen auf St. Pauli gesammelt.«
»Mit Jüdinnen?«
»Genau das. Aber ich kann’s nicht wiedergeben, weil es nicht stubenrein ist. Er war ja betrunken. Aber vor allem tut es nichts zur Sache.«
»Und dann?«
»Dann ging die Tür auf, und er wurde hereingerufen.«
»Und Sie stellten sich schützend vor die Tür, nachdem sie wieder geschlossen war. Weil Sie nämlich wussten, was geschehen würde.«
Möller blieb jetzt erstaunlich ruhig. Aber er rückte endlich raus mit dem, was Weber hören wollte.
»Nee, ich wusste nichts. Er hatte mir bloß zugeflüstert, er werde den Lassally gründlich vermöbeln. Reine Angeberei, dachte ich mir. Aber ich war neugierig. Also bin ich vor die Tür getreten und hab gehorcht. Hätte gar nicht so dicht ran müssen, er schrie ja gleich.«
»Was schrie er?«
Möller dachte kurz nach. »Der Regierungsrat sagte was von Beamtenausschuss und Disziplinarverfahren. Pohl schrie sofort, den Ausschuss könne er sich …. na Sie wissen schon. Weil da sowieso lauter Sozis drin säßen. Drecksgesindel sei das und würde ihn nur reinlegen. Daraufhin sagte Lassally etwas, das ich nicht verstand, aber irgendwas wie ›zu Ihrer Verteidigung, Oberwachtmeister‹ und ›Sie sind doch Nationalsozialist, nicht wahr?‹. Daraufhin schrie Pohl ganz laut: ›Sie gottverdammter, dreckiger Mistkerl! Ich lasse mich nicht von einem Juden vernehmen!‹ Und dann knallte es.«
»Das war der Schuss, den er abgab?«
»Was denn sonst?«
»Und Sie blieben vor der Tür stehen und blockierten sie, damit Pohl seinen Mordanschlag erfolgreich durchführen konnte.«
»Nee, ich horchte bloß. Sie können sich ja denken, wie erschrocken ich war. Ich traute mich da gar nicht rein. War ja praktisch gelähmt vor Angst.«
»Lügner!« Klindworth trat empört vor.
Weber hielt ihn an der Schulter fest. »Ganz ruhig.« Und an Möller gewandt: »Warum haben Sie denn den Kriminalanwärter angegriffen, als der ins Zimmer treten wollte?«
»Hab ich gar nicht, im Gegenteil. Er hat mich …«
»Lüge!«
»… im Übrigen kannte ich den Mann gar nicht. Woher sollte ich wissen, dass er ein Kriminaler ist. Er hätte genauso gut mit Pohl unter einer Decke stecken können.«
»Das ist doch…!«
Weber konnte den jungen Kollegen nur mühsam im Zaum halten, behielt ihn eisern im Griff.
»Das nämlich war meine Idee«, sagte Möller mit scheinheiligem Ernst. »Den Regierungsrat zu schützen.«
»Na schön«, sagte Weber und bekräftigte seinen Befehl mit noch festerem Druck, unter dem der junge Kollege hörbar ächzte. »Klindworth, nehmen Sie ihm die Fesseln ab. Er kann gehen.«
Klindworth starrte ihn erstaunt an und tat dann wie befohlen. Weber drängte ihn zur Seite und wandte sich an Möller: »Gehen Sie zurück in Ihre Kaserne und halten Sie sich zur Verfügung. Wir werden Ihren Vorgesetzten in Kenntnis setzen.«
»Na klar.« Möller grinste triumphierend, als er den Raum verließ.
Weber drehte sich zu Klindworth um: »Und jetzt zu Ihnen. Sie schauen mal nach, wie es Lassallys Sekretärin geht. Wenn Sie wieder einigermaßen beieinander ist, lassen Sie sich von ihr sämtliche Akten zu Pohl geben. Notieren Sie alle wichtigen Informationen. Und mit wichtig meine ich alles, was uns helfen könnte, diesen Burschen dingfest zu machen. Alles! Auch scheinbar unwichtige Kleinigkeiten können zum Erfolg führen!«
»Jawohl, Herr Kommissar!«
»Razzia!«, rief Dr. Schlanbusch. »Sofort!« Dabei warf er Präsident Campe einen forschen Blick zu. Die runden, dunkel umrandeten Brillengläser des Kripo-Leiters waren beschlagen. Sonst war alles an ihm makellos bis hin zu dem exakt getrimmten Zweifinger-Bärtchen.
Weber fühlte sich unwohl hier im Büro des Polizeipräsidenten. Für sein Empfinden standen die Vorgesetzten, mit denen er über den Fall Lassally diskutieren sollte, viel zu weit über ihm. Er war doch bloß ein kleiner Kommissar. Allerdings ein Kommissar, der vor einer halben Stunde einen Anruf vom Polizeisenator persönlich bekommen hatte.
Dies ist der verrückteste Tag meines Lebens, dachte Weber. Freitag, der Dreizehnte, meine Güte! Und er ist immer noch nicht vorbei. Gerade mal vier Uhr nachmittags, wer weiß, was noch kommt.
Senator Schönfelder, den Weber vor Kurzem auf einer Parteiveranstaltung der Sozialdemokraten über ein Glas Bier hinweg gesprochen hatte, hatte ihn am Telefon geduzt. Unter Genossen war das nichts Ungewöhnliches, aber innerhalb der Polizeibehörde stand Weber so weit unten in der Hierarchie, dass ein direkter Anruf seines Dienstherrn ein Ding der Unmöglichkeit war. Eigentlich hätte er stolz darauf sein können, aber er war nur verwirrt.
»Weber, ich verlasse mich auf dich. Dies war ein Angriff auf die Integrität der Polizeibehörde. Womöglich erst der Anfang. Wir müssen wachsam bleiben. Wir wissen, dass wir uns auf Campe verlassen können. Aber es gibt viele widerstreitende Kräfte. Augen auf, Weber! Wir stehen in vorderster Front zur Verteidigung der Republik.«
Um Himmels willen, hatte Weber gedacht, nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, das ist zu viel für mich, ich bin doch nur ein kleines Licht. Hätte ich mich bloß nicht so hervorgetan in den Sitzungen bezüglich der vordringlichen Aufgaben der Politischen Polizei im Kampf gegen republikfeindliche Bestrebungen. Lassallys Sekretärin hatte das alles protokolliert und irgendwie war eine Kopie bis hinauf zu Schönfelder gelangt. Der hatte ihn dann prompt auf der Parteiveranstaltung angesprochen und zu einem Strategietreffen des Reichsbanners eingeladen. Da hatte Weber von seiner Arbeit berichtet und die Hoffnung geäußert, die Politik möge sich mehr um die Loyalität der Polizeibeamten bemühen.
Prompt war kurz darauf Regierungsrat Lassally eingesetzt worden, um radikale Kräfte in der Behörde aufzuspüren und zu »neutralisieren«. Offenbar hatten einige dies als deutliche Kampfansage verstanden und nun zurückgeschlagen. Oder handelte es sich bei der Tat von Oberwachtmeister Pohl nur um den Racheakt eines Einzeltäters? Wie auch immer, die Nervosität war seinen Vorgesetzten anzumerken.
Polizeipräsident Campe saß kerzengerade hinter seinem mächtigen Schreibtisch, wie immer im dunkelbraunen Zweireiher mit dezenten Kreidestreifen, den Blick erhoben, sodass er immer ein kleines Stück über seine Gesprächspartner hinwegschaute, die ihm gegenüber saßen. Ganz der liberale, hanseatische Bürger, dem die kleinlichen Querelen der politischen Parteien im Grunde fern waren. Für ihn war der Staat eine objektive Instanz. Weltanschauungen gleich welcher Art beschmutzten ihn nur.
So wie Campe redete, kam es Weber vor, als würde er den Staat als eine makellose Maschine mit gut geöltem Getriebe ansehen. Nur leider gab es in diesem Getriebe viele Menschen, die nichts lieber taten, als Sand hineinzustreuen.
Aber ich bin ein fleißiges Zahnrädchen im Getriebe, dachte Weber belustigt. Was man nicht von allen Anwesenden behaupten konnte.
Dr. Schlanbusch zum Beispiel, dem die Politische Polizei direkt unterstellt war, sah die Gefahr vor allem auf der linken Seite. Bei der letzten Wahl hatten sechs Prozent der kasernierten Polizisten für die KPD gestimmt. Seither sprach Schlanbusch ständig von der »roten Flut«. Dabei hatten dreimal so viele die Nazi-Partei gewählt.
Der Kripo-Leiter legte nun auch Wert auf die Feststellung, es müsse sich um einen Einzeltäter gehandelt haben.
»Und was ist mit dem anderen Beamten, diesem Möller?«, fragte Campe.
»Der ist rein zufällig da gewesen«, erwiderte Schlanbusch.
»Aber er wurde doch von Lassally hinzitiert«, sagte Campe.
»Sicher. Aber das war eine Routinesache. Der Mann mag vielleicht gewisse Ansichten haben, aber das ist rein persönlicher Natur. Er ist nicht organisiert. Und darum geht es ja. Wir können unseren Beamten die Mitgliedschaft in einer Organisation verbieten, aber ihnen nicht das Gewissen umdrehen.«
»Ja, das ist leider wahr«, sagte Campe nachdenklich. »Wer nicht in der SA ist, ist kaum zu belangen.«
»Gedankenfreiheit ist in der Verfassung garantiert«, dozierte Schlanbusch, der sich sonst nicht als Verteidiger der republikanischen Werte hervortat, wie Weber wusste.
»Aber ein Mordanschlag ist schließlich ein Mordanschlag!« Campe hob die Stimme. »Und dementsprechend muss gehandelt werden.«
Und das war der Moment, wo Schlanbuschs Brillengläser beschlugen und er laut rief: »Razzia! Sofort!«
»Haben wir denn genügend Kapazitäten in der Politischen Polizei?«, fragte Campe und schaute Weber an.
Weber schüttelte den Kopf. »Sicher nicht. Eine Razzia geht nur mit der Orpo. Aber wie soll ich mit der Orpo gegen die Orpo eine Razzia machen? Wir können doch nicht die Polizisten der einen Kaserne auf die Polizisten der anderen Kaserne hetzen. Bloß weil ein betrunkener Wachtmeister Amok gelaufen ist.«
Und damit hatte er sich in die Nesseln gesetzt.
Schlanbusch nahm die beschlagene Brille ab, drehte sich zu Weber herum und versuchte, ihn mit seinen kurzsichtigen Augen zu fixieren.
»Was reden Sie denn da, Weber! Der Mann, dieser Pohl, wurde vor einem Jahr entkaserniert. Er wohnt privat auf St. Pauli. Es geht darum, ihn aufzuspüren. Dass er nicht zu Hause ist, wissen wir. Eine Streife war dort.« Er drehte sich zu Campe um. »Ein Posten wurde selbstverständlich vor Ort belassen.«
»Eine Razzia wegen eines Täters?«, fragte Weber skeptisch.
Schlanbusch zog ein Tuch aus der Jackentasche und polierte seine Brille. »Er hat einen hohen Beamten schwer verletzt. Mutwillig. Wenn wir das durchgehen lassen, machen wir uns zum Gespött. Wenn der Staat nicht einmal seine führenden Polizeibeamten schützen kann, was ist er dann noch?«
»Wohl wahr«, sagte Campe.
»Aber wo fangen wir denn an?«, warf Weber ein. »Wollen wir alle Verkehrslokale der Nationalsozialisten durchkämmen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Gezielt vorzugehen, scheint mir die bessere Methode.«
Schlanbusch setzte die Brille wieder auf. »Kommissar Weber, ich muss mich doch sehr wundern. Bis eben war ich davon ausgegangen, dass Ihnen bekannt ist, in welchen Lokalen dieser Pohl verkehrt. Er stand doch unter Observation.«
»Er stand auf der Liste«, sagte Weber.
»Also ist Ihnen in dieser Hinsicht gar nichts bekannt?«, fragte Schlanbusch scheinheilig, während er das Tuch in die Jackentasche zurückstopfte.
»Nun ja, aber wie gesagt … selbst wenn …« Weber wusste nicht, was er antworten sollte. Innerlich kochte er vor Wut. Das mit der Razzia hatte Schlanbusch also nur deshalb zur Sprache gebracht, um ihn reinzulegen.
Am liebsten hätte er ihn einfach angebrüllt: »Wissen Sie eigentlich, wie viele Brandherde wir unter ständiger Beobachtung haben? Und da kommen Sie mir mit diesem Pohl! Sie haben ja überhaupt keine Ahnung! In Wahrheit wollen Sie doch gar nichts wissen!«
Wenn Campe ihm in diesem Moment nicht zu Hilfe geeilt wäre, hätte er sich um Kopf und Kragen geredet.
»Meine Herren«, sagte der Polizeipräsident und setzte sich noch gerader hin. »Die Lage ist, wie sie ist, und ich sehe die Probleme. Natürlich können wir die Orpo nicht gegen die Orpo einsetzen. Und das wäre auch der falsche Weg. Vielmehr sollte Besonnenheit uns leiten. Wir haben hier einen einzelnen Täter. Darum geht es. Der muss gefunden werden.«
»Ganz recht«, nickte Schlanbusch eifrig. »Machen wir doch aus einer Mücke keinen Elefanten.«
Campe fuhr fort: »Sie, Weber, nehmen sich der Sache an. Suchen Sie sich einen zuverlässigen Kollegen und finden Sie diesen Pohl.«
»Nur einen Kollegen?«
Schlanbusch mischte sich ein.
»Gezielt vorgehen, Weber, das waren Ihre Worte.«
»Na ja, aber …«
»Gezielt und möglichst diskret, Kommissar Weber. Ich vertraue Ihnen die Sache an«, sagte Campe.
»Innerhalb von vierundzwanzig Stunden wäre natürlich wünschenswert«, zischelte Schlanbusch.
»Und Sie, Dr. Schlanbusch, kümmern sich um die Presse. Auch hier gilt es, gezielt und diskret vorzugehen. Ich verlasse mich auf Sie!«
Weber warf Campe einen raschen Blick zu.
Er war in Versuchung, ihm zuzuzwinkern, aber zum Glück schaute Campe schon wieder auf seine Papiere.
»Das wäre dann einstweilen alles, meine Herren. Ich danke Ihnen.«
»Und so fahnden wir nach einem Täter?«, fragte Klindworth.
»Ganz genau.«
Klindworth blickte sich skeptisch um. Vor ihm stand ein großes Glas »Bill-Bräu«. Der Schaum kräuselte sich über den Rand wie die Locken auf dem Kopf des jungen Polizeianwärters. Weber hatte ihm das Bier spendiert, um ihn zu testen. Wenn er nach dem ersten Krug betrunken war und kein vernünftiges Wort mehr herausbrachte, würde er ihn nach Hause schicken. Wenn er angetrunken war und sich noch klar ausdrücken konnte, würde er ihm vorführen, wie er seine Arbeit erledigte. Wenn er nüchtern blieb, würde er ihm vielleicht sogar das eine oder andere Geheimnis verraten.
»Wo kommen Sie eigentlich her?«, fragte Weber, hob den Krug und stieß ihn gegen Klindworths. Der trank mit, schaute sich aber weiterhin skeptisch um.
»Aus Mecklenburg.«
»Ein Landei also«, dachte Weber laut.
»Na, hören Sie mal, Herr Kommissar, Bützow ist seit Jahrhunderten eine Stadt!«
Weber nötigte Klindworth erneut zum Anstoßen.
»Na schön, Sie Stadtmensch«, sagte er, nachdem er sich den Schaum vom Mund gewischt hatte. »Dann schauen Sie sich mal um und erzählen Sie mir, was Sie sehen.«
Klindworth blickte verstohlen um sich. Sein Gesicht drückte Diensteifer aus. Dann merkte er, dass er sich damit verraten könnte, setzte eine Unschuldsmiene auf und nahm einen weiteren Schluck Bier, während er die Gäste musterte.
Die Gaststätte »Zur Hansekogge« lag in der Nähe des Schlachthofs. Es war ein biederes Lokal, wie es viele gab, mit blank geputzten rohen Holztischen und Gardinen vor den Fenstern. Einige Topfpflanzen auf den Simsen bemühten sich, trotz der schlechten Lichtverhältnisse zu überleben. Hinten gab es ein paar Tische mit Spitzendeckchen und Strohblumen, vorne Sitznischen mit Bänken. Der halbrunde Tresen war zu klein und zu schmal, um dort länger zu verweilen, die Gäste saßen deshalb alle. Weber und Klindworth hatten sich die Nische direkt neben der Tür ausgesucht.
»Es sind erstaunlich viele Polizisten anwesend«, sagte Klindworth halblaut.
»Ganz recht.«
»Scheint ein Stammlokal der Ordnungspolizei zu sein.«
»Auch richtig.«
»Die hängen ihre Tschakos an die Garderobenhaken und die Koppeln daneben. Die haben Feierabend.«
»Gut erkannt.«
»Kriminalbeamte sehe ich aber nur zwei«, sagte Klindworth.
»Tatsächlich?« Weber schaute sich um. Seit wann verkehrten hier denn Kollegen von der Kripo? Oder hatten sie Fahndungskonkurrenz bekommen?
Klindworth lächelte andeutungsweise und sogar leicht verschmitzt. »Ich meine doch uns beide, Herr Kommissar.«
»Witzbold.« Weber stieß erneut gegen den Krug seines Kollegen. Sie tranken das Bier aus, und Weber signalisierte dem Wirt, dass sie Nachschub benötigten.
»Kennt man Sie hier?«, fragte Klindworth.
»Nein, sonst hätte das alles doch keinen Sinn.«
Der junge Kriminalanwärter fuhr sich mit der Hand durch die Locken, schaute sich erneut um, sagte aber nichts.
»Und?« Weber beugte sich vor. »Weiter?«
»Hm …«
»Na, irgendwas muss Ihnen doch auffallen. Wieso sind wir überhaupt hier?«
»Ach so, das wollen Sie wissen.« Klindworth beugte sich jetzt seinerseits zu Weber. »Nun, es ist ziemlich eindeutig, welcher Schlag Polizisten hier verkehrt. Das lässt sich an den ausgehängten Zeitungen erkennen.« Klindworth deutete auf die Nische neben der Garderobe. »Da hängt das ›Mittagsblatt‹ neben dem ›Acht-Uhr-Abendblatt‹. Das ist kein Wunder, denn darin wird viel über Kriminalfälle berichtet. Dahinten liest einer den ›Correspondent‹, aber das ist auch ein Oberleutnant, der hält was auf sich und ist bürgerlich orientiert. Aber es gibt zwei Exemplare vom ›Tageblatt‹, der neuen Zeitung der Nazis. Eins liegt auf dem Tresen, da liest der Wirt drin, und eins hat der Kollege da in der Nische aufgeschlagen. Ganz hinten hat einer gerade den ›Völkischen Beobachter‹ verstohlen zusammengefaltet. Das ›Echo‹ der Sozialdemokraten und die kommunistische ›Volkszeitung‹ sind gar nicht zu sehen.«
Klindworth schaute Weber leicht triumphierend an.
»Ich weiß jetzt, warum wir hier sind. Das ist das Stammlokal von Pohl.«
»Wie kommen Sie darauf? Nur wegen der Zeitungen?«
»Nein, wir befinden uns hier nicht weit von der Bundesstraße, wo sich die große Kaserne der Orpo befindet. Dies hier scheint eindeutig ein Treffpunkt der dort stationierten Polizisten zu sein. Sehen Sie: Da hinter dem Tresen hängen zwei Fotos. Auf dem einen ist das Gebäude von außen zu sehen, auf dem anderen der Exerzierhof mit paradierenden Pferden.«
»Sie haben ja ein gutes Auge«, sagte Weber. Und fragte skeptisch: »Waren Sie dort mal kaserniert?«
»Nein, aber ich habe mich in der Stadt umgesehen, als ich meinen Dienst begann. Und ein alter Schulfreund ist dort untergekommen. Wir haben uns allerdings nicht mehr sehr viel zu sagen.«
»Na schön«, sagte Weber und bemühte sich, nicht zu zeigen, wie beeindruckt er war. »Dies könnte Pohls Stammlokal sein. Aber er ist nicht da. Fragen wir den Wirt?«
»Nein, das wäre sicher ein Fehler. Es gibt nämlich Klubräume.« Klindworth deutete auf die dunkle Holztür mit der gerade noch erkennbaren, aufgemalten Aufschrift WC – Klubräume. »Es könnte ja sein, dass Pohl sich dort versteckt. Eine unbedachte Frage und er wird gewarnt. Der Wirt könnte unauffällig in die Küche verschwinden und von dort in die Klubräume. Wir würden es gar nicht bemerken.«
»Sie trauen dem Wirt nicht?«
»Angesichts seiner Zeitungslektüre besser nicht. Außerdem dürfte er sich seinen Gästen gegenüber besonders verpflichtet fühlen.«
»Warum das?«
»Er hätte wohl kaum zwei Fotografien der Polizeikaserne hinter dem Tresen hängen, wenn er nicht selbst einmal dort stationiert gewesen wäre.«
Weber nickte. »Er war sechs Jahre dabei. Vorher Soldat im Krieg, dann Freikorps. Dann Sipo. 1927 auf eigenen Wunsch aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Anschließend wurde er Gastwirt.«
Klindworth bemerkte, wie der Wirt sich mit frisch gefüllten Krügen näherte, und hob warnend die Hand.
»Zum Wohl, die Herren!«, sagte der Wirt, nachdem er sie abgestellt hatte.
Die beiden Kriminalpolizisten stießen schweigend miteinander an.
Dieser Klindworth ist gut informiert, dachte Weber, wenn er nur nicht diese Locken hätte und dieses runde rosige Gesicht. Gleichzeitig wunderte er sich über seine Aversion. Vielleicht neide ich ihm ja seine Jugend, argwöhnte er. Besser wir schreiten zur Tat!
»Ich schau mich gleich mal hinten um«, sagte Weber. »Sie behalten die Türen im Auge.«
»Und Sie sind sicher, dass er dahinten ist?«