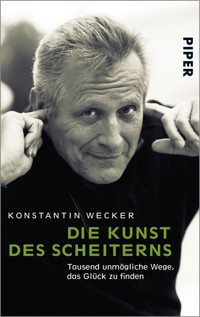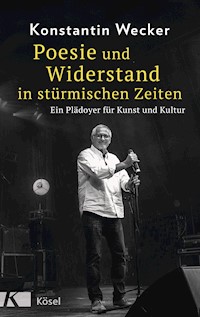9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Sei ein Heiliger, ein Sünder. Gib dir alles, werde ganz.«
(Konstantin Wecker)
Zu Konstantin Weckers 70. Geburtstag am 1. Juni 2017 erscheint seine lang erwartete Autobiographie, die so ungewöhnlich ist wie das Leben und Schaffen des Kraftgenies der großen deutschen Liedermacher. Sein »uferloses« Leben hat dazu beigetragen, dass Konstantin Wecker zu einer öffentlichen Persönlichkeit gereift ist, deren Wort Gewicht hat und in Zeiten von Rechtsruck, Turbokapitalismus und Kriegspolitik absolut notwendig ist.
Entstanden ist ein farbiges Puzzle, aus dem sich das Charakterbild eines Ausnahmekünstlers Stück für Stück zusammenfügt. »Sicherlich kein allzu edles Leben«, so Konstantin Wecker selbstkritisch – und doch ein mutiges, von der Muse überreich geküsstes Leben, das unzählige Menschen inspiriert hat.
- Ein wild-bewegtes Leben
- Die große Biographie zum 70. Geburtstag am 1. Juni 2017
- Die Stimme einer Generation
- Große Geburtstagstour zum Erscheinen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Konstantin Wecker
mit Günter Bauch und Roland Rottenfußer
Das ganze schrecklich schöne Leben
Die Biographie
Günter Bauch, geboren 1949 in München, hat wie Konstantin Wecker das Münchner Wilhelmsgymnasium besucht. Als Fahrer, Roadie und Lichttechniker seit Konstantins Karrierebeginn immer mit dabei. Von den 80er Jahren bis heute auf den Tourneen Konstantins als Tourneebegleiter, Fahrer und Merchandiser tätig.
Roland Rottenfußer, geboren 1963 in München. Nach dem Germanistikstudium Tätigkeit als Lektor, Buch-Werbetexter und Autorenscout für verschiedene Verlage. Von 2001 bis 2005 Redakteur beim spirituellen Magazin »connection«, später für den »Zeitpunkt«, Schweiz, und »Matrix 3000«. Zahlreiche Artikel zu Themen aus Kultur, Politik und Spiritualität. Seit 2006 Chefredakteur www.hinter-den-schlagzeilen.de, Hrsg.: Konstantin Wecker. Zusammenarbeit mit diesem für drei Bücher, u.a. »Mönch und Krieger«. Veröffentlichung: »Schuld-Entrümpelung« (Goldmann Verlag).
INHALT
Vorwort (Konstantin Wecker)
I. Wie ich Musiker wurde: ein Weg mit Umwegen und Abwegen
Meine Kindheit: behütet (Konstantin Wecker)
Mein München: wo Flussmenschen dahoam sind (Konstantin Wecker)
»Die Dinge singen hör ich so gern« (Konstantin Wecker)
Wiedersehen mit Konstantin 1969/70 (Günter Bauch)
Zum ersten Mal im Gefängnis – und endlich frei (Konstantin Wecker)
Die Jahre 1971 und 1972 (Günter Bauch)
Versicherungen (Günter Bauch)
Lasst uns eben weiter irren! (Konstantin Wecker)
Gardasee – Sommer war’s (Günter Bauch)
Sadopoetische Gesänge (Günter Bauch)
Premiere in der Lach- und Schießgesellschaft (Günter Bauch)
Die frühen Aufnahmen (Roland Rottenfußer)
Berlin 1972 (Günter Bauch)
Bin ich ein Schauspieler? (Konstantin Wecker)
»Was passierte in den Jahren?« (Günter Bauch)
II. Geschichten des Erfolgs und des Scheiterns
»Gestern habns an Willy daschlogn« (Günter Bauch)
Toskana-Trilogie (Günter Bauch)
»Wieder dahoam« (Günter Bauch)
Kaffee Giesing, Männerwochen (Günter Bauch)
Lautes Glück und feine Gesellschaft (Roland Rottenfußer)
»Kein rechtes Herz für’s Vaterland« (Roland Rottenfußer)
»Uferlos« und der Sog des Abgrunds (Roland Rottenfußer)
Herbert Rosendorfer (Günter Bauch)
Ein Hauptwerk und eine Mammut-Tournee (Roland Rottenfußer)
Die Justiz macht langen Prozess (Roland Rottenfußer)
Endlich wieder unten (Roland Rottenfußer)
»Mitten hineingestoßen ins Geistige« (Konstantin Wecker)
Sterben und Wiederauferstehen (Roland Rottenfußer)
III. Neue Erkenntnisse und alte Konstanten
Nach der Entlassung (Günter Bauch)
»Die Vergangenheit umwandeln« (Konstantin Wecker)
»Ich bin im Lieben gar nicht so versiert« (Konstantin Wecker)
»Oh, die unerhörten Möglichkeiten!« (Roland Rottenfußer)
»Papa, es schneit« (Konstantin Wecker)
Manfred (Günter Bauch)
»Vaterland« (Roland Rottenfußer)
11. September 2001 (Roland Rottenfußer)
»Die Schwester meines Glücks« (Roland Rottenfußer)
Irak-Reise 2003 (Roland Rottenfußer)
»Das Wasser hat mich gesucht, bevor ich ein Dürstender war« (Konstantin Wecker)
Der Klang der ungespielten Töne (Roland Rottenfußer)
Buchautor Konstantin Wecker (Günter Bauch)
Wut und Zärtlichkeit (Roland Rottenfußer)
Firekeeper in Bleierner Zeit (Roland Rottenfußer)
»Mönch und Krieger« (Roland Rottenfußer)
Ein Ungenügsamer lernt loslassen (Roland Rottenfußer)
»Ohne Warum«: Mystik und Widerstand (Roland Rottenfußer)
»Zum dritten Mal nicht aufgewacht« – neue Kriegsgefahr (Roland Rottenfußer)
»Tut doch, was dein Herz dir sagt« – die Flüchtlingskrise (Roland Rottenfußer)
Warum ich kein Patriot bin? (Konstantin Wecker)
»Man muss das Pack enteignen« – Aufruf zur Revolution (Roland Rottenfußer)
Philosophisches Intermezzo: »Ach, diese verdammten Konzepte von Gut und Böse!« (Konstantin Wecker)
Unterwegs mit Konstantin Wecker (Günter Bauch)
IV. Mit der Zeit: immer dankbarer
Ich bin ein Lober (Konstantin Wecker)
So viele großartige Menschen ... (Konstantin Wecker)
Dass alles so vergänglich ist (Roland Rottenfußer)
Nachwort (Konstantin Wecker)
Das ganze schrecklich schöne Leben
Zeittafel
Text- und Bildnachweis
Bildteil
»Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält.«
(aus Max Frischs »Mein Name sei Gantenbein«)
»Jemand fragt mich: Sind Sie ein guter Mensch? Ich antworte: Zu sagen, ich sei ein guter Mensch, wäre Hoffart, hieße also, ich bin kein guter Mensch; zu sagen, ich sei ein schlechter Mensch, wäre Koketterie. Die Wahrheit ist, ich bin mal ein guter und mal ein schlechter Mensch. Das ganze Leben verläuft so, dass es sich wie eine Harmonika zusammenzieht und dehnt und wieder zusammenzieht – vom Schlechten zum Guten und wieder zum Schlechten. Gut zu sein bedeutet nur, den Wunsch zu haben, häufiger gut zu sein. Und diesen Wunsch habe ich.«
Leo N. Tolstoj
VORWORT
Konstantin Wecker
Das Leben jedes einzelnen Menschen auf diesem Planeten wäre spannend genug, um in einer Biographie erzählt zu werden. Meistens sind es dann doch die eher Prominenten, deren Lebensgeschichten gelesen werden. Prominent aufgrund ihrer Verdienste, ihres Ruhms, ihrer Exzentrik – oder aber aufgrund ihrer Bösartigkeit. Aber auch die Biographien unauffälliger, sich stets dem Rampenlicht verweigernder Wesen wären der Beachtung wert.
Die Frage ist nämlich stets (ob der Mensch nun bekannt oder unbekannt ist): Wie entwickelt sich ein Lebensweg zu diesem einzigartigen Wesen, das es nie vorher gab und auch danach nie mehr geben wird?
Kein Wassertropfen gleicht dem anderen, keine Schneeflocke ist identisch mit einer anderen – und kein menschliches Leben, und sei es noch so angepasst, gleicht einem anderen.
In jedem Menschen lauern Abgründe und Höllen, in jedem ist das Unvergleichliche, Ewige und Göttliche zu erahnen, manchmal sogar zu erspüren. Jeder und jede hat seine eigene Geschichte, Eltern, Großeltern, Schrecknisse und Gnadenmomente, seine ureigene Vita eben, seine Biographie. Auch wenn man über Jahrzehnte hinweg mit anderen die gleiche Geschichte teilt, schon ein falscher oder richtiger Tritt aus dem stets gleichen Trott – und sei es nur der Zufall einer Sekunde, der einen zum Schwanken bringt –, ein Windhauch, ein kurzes Hinüber- oder Zurückblicken, könnte genügen, um die Weltgeschichte zum Beben zu bringen.
Es ist doch gar nicht sicher, ob es immer die Großen und Berühmten waren, die Heerführer und Kaiser, die Großdichter und Propheten, die unsere Weltgeschichte verändert haben – oft zum noch Inhumaneren, manchmal aber auch zum Menschlicheren.
Vielleicht war es die aus dem Moment geborene Befehlsverweigerung des Adjutanten eines Feldherrn, die das römische Imperium zum Einstürzen brachte. Vielleicht sind es aber auch viel weniger geschichtsträchtige Augenblicke, die zählen: das Händchenhalten zweier Verliebter zum rechten Zeitpunkt, ein Lächeln, das aus der Tiefe der Seele sprang, ohne damit etwas erreichen zu wollen, der unbedachte Satz eines im Ozean der Geschichte längst vertilgten Einzelgängers, die Abweisung einer Geliebten, der Pantoffel eines Ehepartners – ach, was weiß ich?
Wir alle drehen ständig am Rad der Geschichte, und keiner von uns, kein Einziger, kann sich da ausklinken. Auch wenn eine solche Vogel-Strauß-Politik einfacher wäre: Nein, so wie wir alle ein unvergleichliches und einzigartiges Leben haben, sind wir auch alle an dem beteiligt, was in der Welt geschieht. Am Schönen wie am Schrecklichen.
Vor über 30 Jahren habe ich fast im Rausch und ohne mir wirklich bewusst zu sein, was ich da in einer Nacht zu Papier gebracht habe, meine Elegien »Uns ist kein Einzelnes bestimmt« geschrieben. Sie enden mit den Worten:
Uns ist kein Einzelnes bestimmt.
Ein jeder ist die Menschheit,
geht mit ihr unter
oder wendet sie
zum Guten hin.
Spannend, wie mich nach drei Jahrzehnten diese Verse wieder einholen und wie sie mein Leben in einem neuen Licht erscheinen lassen.
Kann es überhaupt eine objektive Biographie geben?
Bei Egon Friedell, dem genialen Autor der »Kulturgeschichte der Neuzeit«, einem großen Bekenner des Dilettantismus und der subjektiven Geschichtsschreibung, kann man lesen: »Der Unterschied zwischen dem Historiker und dem Dichter ist in der Tat nur ein gradueller. Alles, was wir von der Vergangenheit aussagen, sagen wir von uns selbst aus. Wir können nie von etwas anderem reden, etwas anderes erkennen als uns selbst. Aber indem wir uns in die Vergangenheit versenken, entdecken wir neue Möglichkeiten unseres Ichs, erweitern wir die Grenzen unseres Selbstbewusstseins, machen wir neue, obschon gänzlich subjektive Erlebnisse. Dies ist der Wert und Zweck alles Geschichtsstudiums.«
Schon als sehr junger Mann war ich von Friedell begeistert. Seine radikale Subjektivität, die sich nicht einmal bemühte, objektiven geschichtswissenschaftlichen Standards zu folgen, ließ uns aufhorchen. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind kein Credo, dem man sich wie in der Kirche beugen muss. Man kann sie umstürzen, verwerfen und dann für sich selbst wieder neu entdecken. Wie sollte es da bei einer Biographie anders sein – zumal bei der eigenen?
Meine Biographie ändert sich ständig. Je nachdem, was ich an Neuem dazulerne, erfahren habe, erlebt und erlitten habe, verwandelt sich mein Gedächtnis. Gewisse Fakten bleiben, aber auch nur, weil sie so geschrieben stehen. Geboren am 1.6.1947 in München. Kann ich mich daran erinnern? Natürlich nicht. Man hat es mir gesagt. Der Eintrag vermodert irgendwo in einem städtischen Archiv. Und heute ist es natürlich in der digitalen Welt für immer im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Oder wird von der NSA irgendwann ausgelöscht. Aber wie erlebe ich heute meine Kindheit, und wie erlebte ich sie mit vierzig Jahren? Was ist mir heute wichtig an meinem einstigen Zusammensein mit meinen Eltern, und was war mir mit 17 wichtig?
In den letzten Wochen habe ich mit vielen Menschen darüber gesprochen, meist nach Konzerten, und fast jeder hat mir das bestätigt: Es gibt keine objektive Sicht auf die eigene Biographie.
Genauso hat natürlich der Blick anderer auf mein Leben in erster Linie mit seinem eigenen Erleben zu tun.
War ich als junger Mann für meine Freunde eher ein Konkurrent oder ein Freund, dem man liebend folgen wollte? In den Augen der einen bin ich heute ein Sturkopf, der sich an seine 68er-Ideale klammert und nichts dazugelernt hat, für die andern vielleicht gerade deshalb ein aufrechter Künstler, der seinen Idealen treu geblieben ist.
In den letzten Jahren habe ich zwei Autobiographien geschrieben: »Die Kunst des Scheiterns« und »Mönch und Krieger«. Aber auch meine anderen bisherigen Bücher waren autobiographisch. Für meinen ersten Roman »Uferlos«, die Geschichte eines Drogenabsturzes, gilt das ohnehin, und bei meinem zweiten Roman »Der Klang der ungespielten Töne« sind Kindheit und Jugend Anselm Hüttenbrenners untrennbar mit denen des Konstantin Wecker verbunden.
Vieles aus all diesen Büchern würde ich heute anders schreiben – nicht weil ich glaube, dass es falsch oder schlecht wäre, sondern einfach, weil ich es anders sehe. Weil sich mein Gedächtnis nun anders erinnert an diese Zeiten, als ich das Erlebte damals gespeichert hatte.
Bei meinen Gedichten und den meisten Liedtexten verhält es sich anders. Die Gedichte passieren mir, sie berühren eine tiefere Ebene des Seins, sie sind auch oft frei von persönlichen Erlebnissen, sie sind eher frei von Ratio, sie ereilen mich wie Melodien, und ich habe keinen Zugriff auf den Akt ihres Entstehens. Wie ich oft auf der Bühne sagte: Sie waren und sind immer klüger als ich.
Aber über seine Biographie muss man zuerst mal nachdenken. Und sein Gedächtnis bemühen.
Und da hapert’s sowieso bei mir.
Mit Jahreszahlen hab ich’s nicht so, und bestimmte Phasen meines Lebens sind völlig im Nirwana abgetaucht. Gesichter konnte ich mir auch nur schlecht merken – einzig Gefühle, die ich in bestimmten Situationen hatte, tauchen immer wieder mal aus dem Nebel der Vergangenheit auf.
Aus welchem Grund auch immer, fiel es mir nie schwer, mehr im Jetzt als im Gestern oder Morgen zu verweilen.
Einen Bruder Leichtfuß mochte man mich deshalb gern schelten, aber ich bedauerte das nie, denn es ließ mich öfter die Gegenwart genießen, wo ich mir sonst quälende Gedanken gemacht hätte.
»Vielsorgerei« nennen die orthodoxen Christen diese Gedanken, die man nicht selbst denkt, sondern die einen denken: Gedanken, die einen daran hindern würden, zu Gott zu finden. Nicht dass sie mich nicht auch oft erwischt hätte, diese Vielsorgerei. Sie hat mich sogar häufig in die Knie gezwungen, und erst seit ich ein Lied darüber geschrieben hatte, vor gerade mal 16 Jahren, wurde mir klar, dass ich auch immer schon schwermütig gewesen bin.
Aber im Großen und Ganzen half und hilft mir mein eher schlechtes Gedächtnis, den Augenblick besser zu genießen.
Das kann man natürlich nicht verallgemeinern.
Mein Freund Günter Bauch zum Beispiel, ein Leuchtturm des guten Gedächtnisses, bei dem ich immer wieder wie in einem Lexikon blättern kann, würde sich wohl sehr verbitten, dass er deswegen den Augenblick nicht genießen könne. Ich glaube vor allem, er genießt sein gutes Gedächtnis, das ihn mit zunehmendem Alter aus allen Gleichaltrigen herausragen lässt.
Günter hat mich mein Leben lang als Freund begleitet.
Wir lernten uns im Gymnasium kennen, als Buben, und bis auf ein paar Jährchen Pause blieben wir einander immer eng verbunden.
Wir wohnten in München oft zusammen, wir lebten in Italien im gleichen Dorf und seit vielen Jahren begleitet er all meine Tourneen als Merchandiser.
Günter ist im schönen Sinn des Wortes mein bester Freund von Kindheit an, und wenn wir früher als jugendliche Gockel noch hin und wieder heftig gestritten haben, so hilft uns nun eine gewisse Altersabgeklärtheit, über derartigen Unsinn milde zu lächeln.
Günter war immer schon ein glühender Thomas-Mann-Verehrer, im Gegensatz zu mir, der ich Thomas Mann zwar mochte, aber seinen Sohn Klaus und seinen Bruder Heinrich viel spannender fand. Aber wir haben Günter natürlich wegen seines ungeheuren Wissens über den Nobelpreisträger schon sehr bewundert.
Seine Abiturarbeit über »Joseph und seine Brüder« – ein mehrbändiges Werk Manns, das selbst Germanisten meist nur vorgeben gelesen zu haben – wurde von den Lehrern natürlich mit einer Eins benotet: mit der Bemerkung, diese Note sei ein Akt der Hilflosigkeit, denn man könne ein solches Werk eines Schülers über das schwierige Riesen-Epos gar nicht angemessen würdigen!
Günter schrieb und schreibt sein Leben lang. Er ist ein wunderbarer Autor, und viele seiner Bücher warten noch auf den würdigen Verleger.
In seinen letzten Büchern beschrieb er oft die Zusammenarbeit mit mir und viele Geschichten aus unserer gemeinsamen Studentenzeit. Da lag es ja auf der Hand, ihn zu bitten, den Teil meiner Biographie zu schreiben, den er sozusagen hautnah mit mir erlebt hatte und erlebt.
Denn aus den erwähnten Gründen finde ich es viel spannender, nicht nur meine eigene Sicht auf mein Leben dem geneigten Publikum vorzustellen, sondern diese 70 Jahre auch aus anderer Perspektive zu betrachten – in diesem Fall aus der des Freundes und Wegbegleiters mit einem Gedächtnis, das meinem weit überlegen ist. Daher stammen einige Kapitel aus Günters Feder.
Ach ja – und wie ich es ja bei meiner Tour »40 Jahre Wahnsinn« bereits aufgedeckt habe, verbirgt sich hinter Günter ja auch noch der im Lied »daschlagne Willy«. Was liegt da näher, als gerade diesem »Willy« das Wort zu erteilen?
Der dritte Mitstreiter ist – versuchen wir’s trotz Egon Friedell eben doch – der eher objektive Betrachter: Roland Rottenfußer. Ihn lernte ich vor 15 Jahren als Journalisten kennen. Er interviewte mich für spirituelle Magazine und offenbarte mir damals schon, dass er ein profunder Kenner des Weckerschen Liedguts war.
Ich mochte sofort seine stilsichere, kenntnisreiche und selbstbewusste Art zu schreiben, und zu meiner großen Freude erklärte er sich nach einiger Zeit (2005) bereit, die Redaktion meines Webmagazins »Hinter den Schlagzeilen« (www.hinter-den-schlagzeilen.de) zu übernehmen.
Wir befreundeten uns, und mittlerweile ist dieser großartige Mensch und Autor aus dem Wecker-Universum nicht mehr wegzudenken. Wir verstehen uns vor allem auch in diesem oft bei mir heftig kritisierten Punkt der notwendigen Verbindung von Politik und Spiritualität.
Bis heute beziehen wir dafür Prügel, sowohl aus dem politischen Lager als auch aus dem spirituellen.
Die einen bekommen einen Brechreiz, wenn das Wort Gott von irgendwo in ihr ausschließlich materialistisches Weltbild einbricht; den anderen rollt es die Zehennägel auf, wenn man sie auffordert, aus ihrer Eso-Ego-Ecke hinabzusteigen in die fleischlichen Niederungen des politischen Engagements.
Dabei gibt es so wunderbare Beispiele sich engagierender spiritueller Meister, wie eben Bernie Glassman, mit dem ein Buch zu schreiben ich die Ehre hatte (herausgegeben von der großartigen Christa Spannbauer).
Die Zusammenarbeit mit Roland wurde immer enger, so dass er auch bei meinen Büchern »Mönch und Krieger«, »Entrüstet Euch« mit Margot Käßmann und »Dann denkt mit dem Herzen« eine große Hilfe war.
Eigentlich gehört ja zu uns drei Autoren noch ein vierter, stets bescheidener, aber unersetzlicher Mann, der mich seit vielen Jahren mit seiner beständigen Aufmerksamkeit, seinem Wissen und seiner Hilfsbereitschaft beglückt. Alexander Kinsky, mein Archivar und mein unermüdlicher Mitstreiter, Stichwortgeber, Freund. Ohne sein fundiertes Wecker-Wissen wären viele Anfragen in den letzten Jahrzehnten wohl unbeantwortet geblieben. Mein schlechtes Gedächtnis hab ich ja nun schon hinlänglich erwähnt und ohne das Kinskysche Fachwissen hätte ich wohl keine Ahnung mehr, welche Lieder, Filmmusiken, Gedichte, Notizen sich welchen Phasen meines Lebens zuordnen ließen. Seine Mitarbeit für »Hinter den Schlagzeilen« und sein Administrator-Auge auf meiner Facebookseite sind von unschätzbarem Wert, und ebenso wäre diese Biographie ohne ihn nicht wirklich möglich gewesen.
Liebe Leserin, lieber Leser, diese Biographie ist ein wirklich neuer Versuch, einem ganz schön aufregenden Leben schreibend näherzukommen. Mir genügt meine eigene Sicht nicht, sie kommt mir etwas einseitig vor, und ich habe mich auch in so vielen Interviews, Internet-Blogs und auf facebook schon über mich ausgelassen.
Vielleicht finden Sie es ja genauso spannend wie ich, diese nicht unbedingt langweiligen 70 Jahre aus drei Blickwinkeln beleuchtet zu sehen. Sie halten die vielleicht einzige Autobiographie mit biographischen Elementen in den Händen. Der Autorenname am Anfang eines Kapitels macht sofort klar, wer sich hier zu Wort meldet und aus wessen Perspektive Sie durch mein Leben geführt werden.
So vielen Menschen gilt es Dank zu sagen für ihre Hilfe, für ihre Anregungen und Anstrengungen, damit dieses Buch entstehen konnte. Meine beiden Mitautoren habe ich schon gewürdigt, aber an dieser Stelle sei von Herzen Thomas Schmitz im Gütersloher Verlagshaus gedankt, der das Projekt auf die Beine gestellt hat und unermüdlich daran glaubte. Ebenso unserem Lektor Peter Schäfer und meiner großartigen Agentin Heike Wilhelmi.
Zu guter Letzt möchte ich Oliver Sacks zitieren, die letzten Sätze aus seiner bewegenden Biographie »On the Move«, die man treffender nicht schreiben könnte:
»Hunderte Menschen sind mir im Laufe eines langen und ereignisreichen Lebens lieb und wichtig gewesen, aber nur wenige von ihnen konnten in dieses Buch Eingang finden. Den anderen möchte ich versichern, dass ich sie nicht vergessen habe und dass sie ihren Platz in meinem Gedächtnis und Herzen behalten werden bis zu dem Tag an dem ich sterbe.« Mir geht es genauso: Danke, dass ich an eurer Seite sein durfte und ihr mein Leben bereichert habt.
I. WIE ICH MUSIKER WURDE : EIN WEG MIT UMWEGEN UND ABWEGEN
MEINE KINDHEIT : BEHÜTET
Konstantin Wecker
Um es vorweg deutlich und für immer gültig zu sagen: Ich hatte wundervolle Eltern. Was für ein Glück! Was für ein Geschenk!
Ja, wird mancher nun sagen, aber gab es nicht auch Streit und Kampf, Tränen und Differenzen?
Vielleicht – aber eben auch zärtliche Stunden, unvergessliche Einigkeit, Musik und Liebe und gemeinsames Lachen. Und was für ein Lachen: aus vollem Hals und gesundem Herzen, nicht spöttisch, sondern im Witz sich selbst vergessend.
Haben meine Eltern Fehler gemacht? Was für Fehler bitte, außer dem einzigen großen Fehler, den wir alle teilen: menschlich zu sein.
Wer wäre ich, wenn ich ihnen etwas vorwerfen würde, was ich mir im Laufe meines Lebens und meines Vaterseins ja auch immer vorzuwerfen hätte?
Werfen wir die Vorwürfe in die Mülltonne.
Entsorgen wir sie in einer getrennten Tonne, neben Papier, Restmüll und Sperrmüll. Entsorgen wir sie in der großen Tonne der moralischen Eitelkeit. Werfen wir sie in den Sumpf unserer eigenen Unzulänglichkeit, die immer wieder darauf bedacht sein wird, anderen anzulasten, was wir an uns selbst unerträglich finden.
Ich liebe meine Eltern, mit ihren Untröstlichkeiten und Einsamkeiten, ihrer Hilflosigkeit und Großartigkeit, meine humanistischen, sich stets bemühenden, sich immer wieder selbst erobernden Eltern.
Ich danke ihnen für mein Aufgehobensein in ihrer Großzügigkeit und ihrer alles umarmenden Liebe, auch und gerade weil sie selbst nie so sehr umarmt wurden. Nicht mal von mir, dem rebellischen, eitlen, kleinkarierten und sicher auch manchmal großherzigen jungen Mann.
Nun bin ich fast 70, die Biographie zu meinem runden Geburtstag steht vor ihrer Vollendung, und ich sage dir, liebe Leserin, lieber Leser: Ich kann dir nicht sagen, wie das ist, fast 70 zu sein.
Oft genug fühle ich mich immer noch wie der 4-Jährige, der auf dem Rücken seiner taffen Mama die isaria rapida (die Isar) durchquert. Alle schimpften, das sei verantwortungslos, und ich bräuchte doch wenigstens einen Schwimmreifen. Ich sei viel zu klein für solche Abenteuer.
Aber was war schon sicherer als eine den kalten Fluten der Isar trotzende Mama, bei der man, wenn man sie umarmte, aufgehoben war im Ewigen?
Was war sicherer als ihre Liebe?
Ja, sie war streng, ehrgeizig und fordernd, aber eben auch immer für mich da, ein steter Anker, der mich zwar tadelte, aber immer wieder auffing. Der mich manchmal auch, meistens später, verurteilte, aber immer auch wieder entschuldigte.
Und der sanfte Vater, geboren in einer Zeit, da der Militarismus die westliche Welt beherrschte und das Autoritäre die Seelen der Kinder vernichtete – dieser sanfte Vater, der mich lehrte, ungehorsam zu sein? Ungehorsam auch gegen ihn selbst, das konnte er vertragen.
Dieser Vater hat sich dem Gehorsam des Militärs verweigert, als Widerstand ungemein gefährlich war. Er sah nicht ein, sich von irgendeinem völkischen Vollidioten anbrüllen zu lassen in einer Kaserne, die viel zu weit weg war von seinem Elternhaus, zu weit weg von seiner Vorstellung einer geborgenen Welt. Mein Vater war es, der mir sagte: Wieso hätte ich auf jemanden schießen sollen, den ich gar nicht kenne?
Meine Eltern waren Humanisten, mit allen Schwächen und Schwierigkeiten, die Menschen nun mal eigen sind. Wenn Thomas Mann im Exil schrieb, er habe Angst vor dem »Abfall der Epoche vom Humanen«, dann konnte er nicht wissen, dass es selbst in dieser schrecklichsten Zeit der Umwandlung des Menschlichen ins unsagbar Unmenschliche, ja, Teuflische, noch Menschen gab, die sich auch von einer bejubelten Ideologie des Wahnsinns nicht entmenschlichen ließen.
Ja, auch dafür liebe ich meine Eltern: für die Standhaftigkeit, mit der sie dem Terror des Naziregimes die Stirn boten. Sie waren keine aktiven Widerstandskämpfer, aber sie widerstanden im Herzen. Und deshalb durfte ich schon als kleiner Junge mit ihnen reden über diese unfassbare Zeit des Schreckens. In meinem Elternhaus wurde nicht aus Scham geschwiegen, sondern diskutiert, gefordert, gelacht und geweint.
Eine Laudatio? Ja, natürlich, ein Psalm, ein Lobgesang. Sie mussten mich ertragen und haben mich getragen – bis zu ihrem Lebensende.
Ich sehe jetzt schon die Psychologen die Ohren spitzen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich weiß, was ihr nun vielleicht denkt: Da verdrängt jemand Kindheitstraumata, indem er verherrlicht, was ihm auch Schmerzen bereitet hat.
Was ich an der Psychologie, die ich ja durchaus auch studiert habe mit heißem Bemühen, so gar nicht mag, ist, dass sie einen oft darin bestärkt, Schuldige zu finden.
Ihr wisst doch: Im Alten Testament gab es ihn noch, den Sündenbock. Das ganze Dorf lud seine Sünden auf ihn, und dann wurde er verjagt oder geschlachtet. Und dann war man ohne Sünd’.
Was aber, wenn es gar keine Sünde gibt? Kein Strafgericht Gottes? Nur Verfehlungen, Irrungen, Wirrungen, ein Sich-Absondern – der ursprünglichen Bedeutung von »Sünde« entsprechend – vom Wesentlichen, uns allen Ureigensten, dem wahren Wesen unseres Seins?
Als mein Vater mich, seinen 19-jährigen Sohn, zum ersten Mal im Knast besuchen durfte, seinen Sohn, der ohne ein Wort zu sagen von zu Hause abgehauen war und die Kasse der Rennbahn Riem in München ausgeraubt hatte, sagte er: »Ich hab dir immer schon gesagt, dass zwischen Künstler und Verbrecher nur ein kleiner Unterschied besteht. Wie es aussieht, taugst du nicht zum Verbrecher.«
Was für ein grandioser Satz eines Vaters, der allen Grund gehabt hätte, zu schimpfen, zu toben, mich zu enterben und sich von mir loszusagen.
Mich erfüllt ausschließlich Dankbarkeit, wenn ich an meine Eltern denke.
Und auch die Mama kämpfte wie eine Löwin für mich, wenn sie die Nachbarinnen aus unserem Stadtviertel Mitleid heuchelnd verhöhnten.
Obwohl sie moralisch war, obwohl sie katholisch war – sie stand zu mir. Sie war eben eine liebende Mutter.
Ach so viele sind so unglaublich schlau und haben Erziehungsmodelle und sprechen davon, wie man Kinder behandeln und bestrafen müsse – dabei muss man nur eines: sie bedingungslos lieben. Ohne Warum.
So bedingungslos wie Gott uns liebt.
Und auch wenn es keinen Gott geben sollte: Es ist ausschließlich diese bedingungslose Liebe, der wir unser Sein verdanken.
Worte sind Symbole. Gott ist ein Symbol, Liebe ist ein Symbol.
Und jetzt fragen Sie mich vielleicht: Ja, wofür denn?
Für das Unbegreifliche, das wir immer in uns spüren, wenn wir einen kurzen Augenblick Zeit haben zwischen den Attacken unserer Gedanken.
MEIN MÜNCHEN: WO FLUSSMENSCHEN DAHOAM SIND
Konstantin Wecker
Wenn ich an München denke, denke ich an die Isar, und wenn ich an die Isar denke, denke ich ans Kindsein, ans Spielen und an Sommer. Vor allem an Sommer. Ich habe den Winter einfach ausgeklammert aus meiner Erinnerung, um genug Platz zu lassen für Wärme und Geschrei. Geschrei vor allem, um den Fluss zu übertönen. Lauter Momentaufnahmen. Alles Standbilder.
Alles auf ein paar tausend Quadratmeter Kieselsteine begrenzt, wo man leichtfüßig drüber wegflog. Ich war allerdings schon damals etwas behäbiger als alle anderen, ich war schon immer ein schwerer Junge. Begrenzt durch die Bäume auf der anderen Isarseite, wo’s nach Haidhausen geht: Feindesland. Wir lieferten uns prächtige Prügeleien, begrenzt auch durch den Wasserfall. Früher war da noch ein Damm, und die Kenner wussten ganz genau, wo man reinhechten musste, um heil zwischen die Felsen tauchen zu können.
Die Fremden schlugen sich oft die Schädel auf, da kamen wir dann recht zum Retten mit unseren Lebensretterhöschen und Lebensretterkappen. Wer den DLRG-Grundschein nicht hatte, brauchte sich sowieso nicht sehen zu lassen auf der Schtoanse. »Schtoanse« kommt von »steinig« – unser Lehel-Lido an der grünen Isar.
Damals aber war noch kein Denken dran, dass man dieser flussgewordenen Lebensfreude mal ein Leid antun könnte, und so hat der Fluss mein Leben geprägt. Du gibst ihm einen Namen, betrachtest ihn, und keinen Augenblick ist er derselbe. Andauernd zieht was anderes, Neues an dir vorbei, denn das Sein eines Flusses ist sein Werden, und so wollt ich mich auch immer neu entwickeln. Auch wenn mir damals als Kind dieser philosophische Gedanke in der Form noch nicht gekommen ist, ist er in meiner Rückschau mit ihm verknüpft.
Die liebe Isar und der Urwald beim Flaucher und der Grand Canyon hinter Grünwald und die Isarfeste an der Isarlust. Und natürlich die Spitzbande, gefährliche Burschen. Ich habe immer tief und ehrfürchtig gegrüßt, wenn sie knastblass und federnd an mir vorbeitigerten. Die Spitzbande, das war einfach alles, was man selbst nicht war: Sex und Crime und Anarchie. Das war die heiß ersehnte Wirklichkeit. Männerfreundschaft und Bizepskult, dahin zog es mich, wenn ich an Frühlingstagen zum Physiksaalfenster hinausträumte, wenn ich in unserem ehrwürdigen Wilhelmsgymnasium Bakuninthesen an die Toilettentüren nagelte. Als Humanist muss man halt alles in einen Vers zwängen, ein Leiden, dem ich bis heute nicht entrinnen konnte.
Die Isar hat mich geprägt wie der Lech den Brecht. Ich denke, ich und die anderen Kinder waren »Flussmenschen«. Das ist eine sehr schöne Verbindung. Ich habe auch immer betont, dass nicht stehendes Gewässer, sondern der Fluss mein Leben geprägt hat. Es macht einen großen Unterschied in der Lebensphilosophie, ob du ein Meermensch bist oder ein Flussmensch, der sich dauernd verändert.
Ach, das war alles noch so nah beisammen, die ganze Welt in ein Stadtviertel gepresst. Und das hat auch genügt, das war mehr als genug, um die ganze Welt kennen zu lernen. Was wäre eine Münchner Kindheit ohne Kirchen? Ohne die bösen Religionslehrer und ohne die lieben Fratres und die Beichte: Ich habe Unkeusches gedacht, gefühlt, gesehen, getan. Mein Gott, wie soll man sowas nur ehrlich beichten, war ich doch schon ganz schön früh frühreif, aber leider nur für mich ganz allein. Die Mädchen waren immer schon von den schöneren Jungs »besetzt«.
Also, die Kirchen: Mit Rom können wir da sicher nicht mithalten. Aber die zwischen die Häuser geduckte und dann innen so ausladend verschwenderisch freche Asamkirche, das Gasteigkircherl oder die St. Annakirch’ (da hab ich immer gebeichtet und war so selten befreit, weil ich halt immer a bisserl lügen musste). Nein, natürlich, mit Rom können wir nicht mithalten, aber die Protestanten müssten vor Neid schon erblassen, wenn sie ehrlich wären. Ich jedenfalls fand es immer schon großartig, dass so viele Jahrhunderte lang so viel Kraft, Zeit, Geld und Arbeit in etwas Übersinnliches gesteckt wurde.
Und wie er mich auch manchmal gequält haben mag, der Katholizismus – speziell dieser bayerische Katholizismus – ich möchte ihn nicht missen mit seinen Zeremonien, seiner Magie, seinen lateinischen Litaneien. Das ist heute alles entzaubert, langweilig geworden. Die Fronleichnamsprozession hat nichts Heiliges mehr. Jesus tut einem heute gar nicht mehr leid. Klar, ich bin älter geworden, muss mich nicht mehr auf die Zehenspitzen stellen, um den Leichnam des Herrn Jesus zu sehen. Achtundsechzig schlich ich mich manchmal heimlich in die Ludwigskirche (wehe, ein Genosse hätte mich dabei ertappt), um ein bisschen in mich zu gehen und den Draht zu meinem Herrgott nicht ganz zu verlieren.
Der Dom zum Beispiel hat mir nie so gefallen, aber dieses bayerische Barock, wo man das Gefühl hat, am liebsten würden sie mit der himmlischen Familie ein Saufgelage abhalten in ihren Kirchen, das kommt mir schon sehr entgegen. Da lässt sich’s einkehren und den Papst auch mal kurz vergessen. Da kann man dann schon auch mal eine Kerze anzünden und sich auf den lieben Gott besinnen, der schon so lange kopfschüttelnd vor dem ganzen Firlefanz steht, der da mit ihm veranstaltet wird.
An der Feldherrnhalle, wo sich die Wüstesten der Nazikrakeler alljährlich trafen, ohne dass der liebe Gott auch nur einmal ein Donnerwetter aus der Theatinerkirche nebenan geschickt hätte (aber er wurde ja auch kein einziges Mal dazu aufgefordert von seinem Stellvertreter), da, wo sich gleich nebenan beim Hofgarten unser gewichtigster ehemaliger Landesvater seinen Kindheitstraum verwirklicht hat – am Odeonsplatz also, bin ich als kleiner Bub zum ersten Mal von der großen Politik berührt worden. Da stand ich mit roten Ohren verklärten Blicks, keine Ahnung von gar nichts und hab dem Charles de Gaulle zugejubelt. Ausgerechnet dem de Gaulle. Aber es haben eben alle gejubelt.
Sonntags sind wir zusammen geradelt, natürlich die Isar entlang, rauf oder runter, Flaucher oder Hirschau, um dann endlich eine Radlermaß zu trinken. Die heißt zu Recht so, denn sie schmeckt nur nach dem Radln. Frag einen Münchner, wonach er sich im Ausland am meisten sehnt, und er wird antworten: nach einem Biergarten natürlich.
Es gibt natürlich auch unangenehme Menschen hier, die mit den Gebrauchtwagenverkäufer-Köpfen, die nachts um vier in den Cocktailbars große, dumme Reden schwingen, die Schweinemetzger-Schickeria, diese selbstgefälligen, erzkonservativen, nie um einen Strauß verlegenen Bajuwaren, die einem diese herrliche Stadt und diesen warmen, weichen Dialekt fast vermiesen könnten. Aber die Stadt ist winkelig genug, damit man ihnen aus dem Weg gehen kann. Man kann ins Volksbad fliehen und sich die letzte Nacht aus dem Blut dampfen, denn auch das Müller’sche Volksbad, dieser Fast-Jugendstil-Tempel, ist nicht aus der Welt.
Am Samstag, wenn’s gemischt ist, sollte man das Dampfbad meiden. Da ist die neue Spießigkeit am Drücker (nackt so schön all ihres progressiven Habitus beraubt). Nein, man gehe am Donnerstag, am Männertag, zum Dampfen, da wird man nicht abgelenkt von großen oder kleinen Busen, da kann man seinen Bauch rausstrecken und auf den FC Bayern schimpfen von Fall zu Fall. Gerade bei strahlendem Sonnenschein suche man das Dampfbad auf, wenn alle anderen bei den Nackerten draußen liegen und wenn die alten Dampfhasen endlich wieder unter sich sind. Und fällt dann ein Stück Sonne durch die Kuppel im Dampfraum, dann gibt’s keinen Ort auf der Welt, wo ich mich weicher fühlen könnte.
Und beim Nachhausegehen höre ich immer noch meine Mutter pfeifen, vom vierten Stock runter, sehe sie aus dem Fenster gebeugt, und dann schimpft sie mich, weil ich natürlich wieder zu spät dran bin, und ruft mir zu, was ich bei der Frau Christmann noch einkaufen soll. Und dann weiß ich wieder ganz genau: Wo auch immer in der Welt ich mich noch aufhalten werde oder muss: »Da bin i geborn und da ghör i hi.«
Mutter: »Stehe immer zu dem, was du tust!«
Oft schnürte mir die Strenge deiner Liebe
wie eine Last den Hals. Die Tür fiel zu.
Mir war so bang, dass mir für mich nichts bliebe
vielleicht stiehlt uns das heute noch die Ruh.
Es tat dir weh, wie ich dich oft verbannte
um jeden buhlte und dich übersah
den Süchtigen versucht das Unbekannte
du warst so selbstverständlich einfach da.
Du warst die Mutter. Die war mein Gewissen.
Was dich bewegte sah ich lange nicht.
Wie einstmals Gott hab ich dich töten müssen
jetzt könnt ihr auferstehen im Gedicht.
Es war doch immer nur die eigne Enge
die mich so oft nicht weiter werden ließ.
Nur so verstummen Verse und Gesänge
so schwindet der Geschmack vom Paradies.
Du bist dein Eigen. Und nur du
kannst mit kaputtem Rücken gehen.
Die Lügner sehen unbeholfen zu
die können nicht mal grade stehn.
Da hast du dich schon lang befreit
wo andre nach Befreiung schrein
die huren mit dem Geist der Zeit
du wirst du selbst für immer sein.
Du warst da groß wo andre meist versagen
und hast dich nie verkauft für schnöden Lohn
und solltest du mich wieder schwer ertragen
vergiss nur nicht: ich bin dein Sohn.
Dass ich nicht fiel, verdank ich dir
mein Dichten fällt auf dich zurück
du lobst, verzweifelst auch in mir
du leihst mir den geraden Blick.
Und nun so sich die Wunde schließt
die du mir warst, die ich dir schlug
jetzt wo du vieles leichter siehst
was sich so schwer mit dir vertrug
bitt ich, dass dich, nein, dass uns beide
dein Engel einst nach Hause führt
und dass Erinnerung, die leide
nun als Vergessen an dich rührt.
Wenn ich so gern auf die Bühne gehe, hat das sicherlich mit dem Drang zu tun, Liebe zu erfahren, also mit dem Wunsch, geliebt zu werden. Ich habe gedacht, wenn man von seiner Mutter so viel Liebe wie ich mitbekommen hat, dann dürfte man das doch gar nicht so sehr brauchen. Mittlerweile sehe ich, dass es umgekehrt ist: Wenn man so viel Liebe bekommen hat, sucht man genau diese starke Liebe immer wieder und ist dann furchtbar enttäuscht, dass es das nicht noch einmal gibt.
Je älter ich werde, mit desto mehr Verständnis betrachte ich meine Eltern. Früher sind sie mir manchmal spießig vorgekommen, heute im Rückblick finde ich sie großartig. Ich habe Phasen gehabt, da habe ich in meiner Mutter das Böse gesehen, obwohl ich wusste, dass sie mich mit Liebe geradezu überschüttet hat. Eine Mutter wie die meine wollte ihr Kind natürlich nie hergeben. Es war traurig, als ich daheim ausgezogen bin. Doch ihre Liebe ging ja weiter, folgte einem. Und da gab’s dann natürlich immer wieder Stationen und Situationen in meinem Leben, die sie nicht begreifen konnte. Ich konnte ihr dabei auch nicht helfen, vor allem, wenn ich mich selbst vor ihr verschlossen hatte. Das ging bis zu ihrem Tod so: Ich war eingepanzert und stur, und sie panzerte auch. Aber bei alldem wusste ich eines ganz genau: Ich hätte einen Mord begehen können – wenn meine Mutter meine ehrliche Hilflosigkeit gespürt hätte, hätte sie mich in die Arme genommen und gesagt: »Jetzt schauen wir mal, wie es weitergehen soll.«
Meine Mutter hatte aufgrund ihrer Liebe zu mir meinen Werken gegenüber die größtmögliche Toleranz. Als ich mit fünfzehn Jahren meine ersten »revolutionären« Gedichte schrieb, in denen noch eimerweise Blut geflossen ist, hat sie mich unterstützt und verstanden. Mein Vater, der in Wirklichkeit gar nicht emotionslos war, aber sehr diszipliniert mit sich selbst umgegangen ist, akzeptierte meine Texte erst Jahre nach meinem Debüt als Liedermacher – seit sie nicht mehr so viel von Sturm und Drang an sich hatten und in seinem Sinne philosophisch geworden waren.
Meine Mutter war immer mehr bereit, auf meine Entwicklung einzugehen. Die Einfühlsamkeit, die sie mitbrachte, hat er nicht für wichtig erachtet. Mein Vater war Philosoph, ein Denker und Idealist. »Er denkt, er ist ein denkender Mensch«, hat meine Mutter vom Vater gesagt. Sie hatte überhaupt immer solche fertigen, druckfertigen Sätze, die ich nie vergessen werde, deren Bedeutung mir teilweise erst heute ganz bewusst wird. Als Kind habe ich immer von ihr gehört: »Meinen Hund würde ich nicht für eine Million verkaufen.« Das habe ich nicht verstanden, weil eine Million einfach ein Haufen Geld für mich war. Und wir hatten doch keins.
Das Schöne an meiner Mutter war ihre ganz und gar unbürgerliche Einfühlsamkeit. Sie mochte zum Beispiel meine allererste LP, die Sadopoetischen Gesänge, über die viele Leute schockiert gewesen waren. Es gab bei mir auch einmal eine Phase, in der der weitere Verlauf meines künstlerischen Wirkens auf der Kippe stand. Da dachte ich: Jetzt schreibst du einmal ein paar Schlager unter einem Pseudonym, das bringt Kohle – und die hätte ich nötig gehabt. Als ich das meiner Mutter erzählte, hat sie gesagt: »Steh zu deinem Namen – mach, was du machen willst, aber wenn du’s machst, dann steh dazu.« Sie hat mich also nicht unbedingt vom Kommerziellen abhalten wollen, aber sie ist derart zu mir gestanden, dass ich es gar nicht fertig gebracht hätte, ins kommerzielle Lager abzurutschen. Auch dies hatte natürlich wieder damit zu tun, dass das Materielle in dieser Familie nie eine Rolle gespielt hat.
Vater: Philosoph und erster musikalischer Mentor
Niemals Applaus. Kein Baden in der Menge
und Lob, das nur vom kleinsten Kreise kam.
Und das bei einer Stimme, die die Enge
des Raumes sprengte, uns den Atem nahm.
Dein »Nessun’ dorma« war von einer Reinheit,
die nur den Allergrößten so gelang.
Du blühtest nur für uns. Der Allgemeinheit
entzog das Schicksal dich ein Leben lang.
Und trotzdem nie verbittert, keine Klage
du sagtest einfach, deine Sterne stehn nicht gut.
Doch gaben dir dieselben Sterne ohne Frage
die Kraft zur Weisheit und unendlich Mut.
Mir flog das zu, was dir verwehrt geblieben
du hattest Größe und ich hatte Glück.
Du hast gemalt, gesungen, hast ein Buch geschrieben
und zogst dich in dich selbst zurück.
Du hast die Liebe zur Musik in mir geweckt
und ohne dich wär ich unendlich arm geblieben.
Du bliebst verkannt und hast dich still entdeckt,
ich war umjubelt und ich hab mich aufgerieben.
Das, was ich heute andern geben kann,
wäre nicht denkbar ohne dich.
Es war dein unbeachteter Gesang
der in mir klingt und nie mehr von mir wich.
Und meistens sagt man erst zum Schluss
was man verdeckt in tausend Varianten schrieb:
wenn ich an meinen Vater denken muss
dann denk ich stets – ach Gott, hab ich ihn lieb.
Konstantin Wecker, »Für meinen Vater«, © Edition Fanfare Musikverlag (bei Chrysalis Music Holdings GmbH)
Ich glaube, am Beispiel meines Elternhauses kann man sehr deutlich sehen, wie wenig es eigentlich auf das Milieu – oder sagen wir, den gesellschaftlichen »Stand« eines Elternpaars ankommt. Wichtig ist, wer die Eltern sind, nicht was. Wir sind eigentlich eine Kleinbürgerfamilie mit wenig Geld gewesen. Aber mein Vater war absolut kein Kleinbürger, sondern ein Künstlertyp. Ich habe ihm als Kind oft vorgeworfen, dass er nicht wie ein Künstler aussieht. »Die, die so aussehen«, hat er gesagt, »sind meistens keine.« Er meinte: »Wer auf Künstler macht, der hat’s irgendwie nötig.«
Ich bin zwanzig Jahre lang eigentlich mit einem Existenzminimum aufgewachsen. Meine Eltern hatten nie Geld, aber immer ein ganz bestimmtes Niveau. Sie haben es geschafft, dass ich nie darunter leiden musste, dass kein Geld da war. Ich hatte ein Fahrrad, und auf dem bin ich mit meinem Vater zum Starnberger See gefahren. Andere Eltern hatten damals schon längst ein Auto. Als ich meinen Vater einmal fragte, warum wir kein Auto hatten, antwortete er: »Weil wir keins brauchen.« Entscheidend ist, dass ich meinen Vater nie deswegen verachtet habe. Heute behaupten so viele Eltern, sie müssten im Beruf Kompromisse machen – wegen des Geldes und weil ihre Kinder dies und das bräuchten. Das ist Irrsinn, weil die Kinder dadurch die völlig falschen Prioritäten beigebracht bekommen: Eltern, die die Finanzkraft besitzen, uns alles Mögliche zu kaufen, aber nicht den Mut, auch im Beruf sie selbst zu sein.
Mein Vater war kein Mensch, dem man sich bei jeder Gelegenheit in die Arme werfen wollte. Dennoch fühlte man sich bei ihm geborgen, weil er einen nie moralisch verurteilte. Meine Mutter hat meinem Vater manchmal mangelndes Engagement für mich vorgehalten. Ich selbst hatte dieses Gefühl nie, weil ich wusste, wenn ich ihn brauchte, dann war er als mein Vater immer da. Er hat mich ja zum Beispiel auf eine wunderbare Art vor der Bundeswehr bewahrt. Ich hatte den Einberufungsbescheid bekommen, weil ich mich nicht darum gekümmert hatte, rechtzeitig zu verweigern. Mein Vater sah den Einberufungsbefehl, bekam vor Wut einen roten Kopf, zerriss den Wisch und ging damit aufs Kreiswehrersatzamt. Dort sagte er, er sei bei den Nazis nicht beim Militär gewesen, und sein Sohn werde nun auch nicht zum Militär gehen. Mit diesen Worten legte er ihnen die Fetzen des zerrissenen Schreibens auf den Schreibtisch. Die haben ihn dann beruhigt, und ich habe einen zweiten Musterungstermin bekommen. Diesmal war das Ergebnis negativ: Ich brauchte wegen seelischer und geistiger Defekte nicht zum Militär. Na ja, vielleicht hatten sie teilweise auch Recht damit, aber mir ist es eben gelungen, besagte Verhaltensauffälligkeiten zum Künstlertum zu überhöhen.
Es gehört schon Mut dazu, einen Einberufungsbefehl zu zerreißen, obwohl jeder Bürger weiß, dass das verboten ist. Ich habe sehr an meinem Vater bewundert, dass er sich nie vor irgendeiner Institution wie Militär oder Polizei geduckt hat. Er hatte keinerlei Respekt vor Machtapparaten. Hier muss ich natürlich sagen, dass ich mit meinem Familienhintergrund großes Glück hatte. So viele in meiner Generation – jener der »Alt-68«, wie wir ja gern genannt werden – haben sich ihr ganzes Leben lang an ihren Nazi-Eltern abgearbeitet. Wer nichts über meine Eltern wusste, mochte aufgrund meiner Texte sogar mutmaßen, ich wolle mit meinen nonkonformistischen Äußerungen gegen ein reaktionäres Elternhaus rebellieren. Nichts könnte falscher sein. In meiner ganzen Familie – väterlicher- und mütterlicherseits – gab es nur Anti-Nazis. Da war kein einziger Mitläufer bekannt. Allen voran mein Großvater (der Vater meiner Mutter): Der ist damals auf die Straße gegangen und hat auf Hitler geschimpft – als Beamter wohlgemerkt! Als sie ihn dann verwarnten, hat er geantwortet: »Ich bin ein alter Mann, mir tut ihr nichts.«
Ich zögere, mich als Nachfolger dieser mutigen Familienmitglieder zu betrachten, denn das Rebellieren ist heute vergleichsweise ohne Risiko. In meinem Lied »Fast ein Held« sang ich: »Hätt ich zu meines Vaters Zeit dasselbe Lied geschrieben? Manchmal beschleicht mich das Gefühl, ich wär sehr stumm geblieben.« In jedem Fall aber haben mich diese Vorbilder geprägt. Es war und ist meine Aufgabe, eine solche Tradition fortzusetzen, nicht gegen sie zu rebellieren.
Mein Vater hat mich ernst genommen. Und er hat vielsagend gesprochen und sich zugleich das Recht vorbehalten, in bestimmten Situationen gar nichts zu sagen. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, mich zu belehren. Obwohl er mir durchaus manche Dinge erklärt hat – oft auf eine schöne Art. Zum Beispiel hat mich als Kind der Begriff »Ewigkeit« beschäftigt, wie sicher jedes Kind einmal. In schlaflosen Nächten habe ich manchmal in den Himmel geschaut. Was war dahinter, etwa die Ewigkeit? Da sagte mein Vater zu mir: »Da brauchst du nicht in den Himmel zu schauen. Ein Baum, der könnte dir viel von der Ewigkeit erzählen – ein Stein noch mehr.« Da hab ich das Wort »Ewigkeit« dann für mich verstanden – zumindest akzeptiert.
Oder eine andere Geschichte: Als Bub habe ich mich furchtbar geschämt, wenn ich in einer Schlägerei plötzlich jemandem gegenüberstand, der viel größer und stärker war als ich, und wenn ich dann aus Feigheit abgehauen bin. Da sagte mein Vater einmal zu mir: »Ich versteh dich gar nicht. Wenn du im Dschungel einem Tiger begegnest, dann haust du doch auch ab auf den nächsten Baum, und nachher erzählst du jedem stolz, dass du dem Tiger entkommen bist.« Diese Erklärung hat bei mir viel ausgelöst. Ich kämpfe heute nicht mehr um jeden Preis, auch wenn ich auf viele standhaft, vehement, ja, aggressiv wirken mag. Früher habe ich Kampfsituationen bewusst aufgesucht, um meine Kräfte zu messen und weil ich Rabatz liebte – heute gehe ich ihnen meist aus dem Weg. Das hat auch mit Respekt vor den Menschen zu tun. Aber auch die Weisheit meines Vaters wirkt hier in mir weiter.
Nicht zuletzt ist mir ja auch die Musik von meinem Vater vermittelt worden, denn er war Sänger. In gewisser Weise bin ich froh, dass mein Vater in diesem Beruf erfolglos war. Denn dadurch hatte er genug Zeit, um mit mir zu musizieren. Wäre er hingegen ein Welttenor gewesen – wozu er zweifellos die Veranlagung und das stimmliche Material hatte –, dann wäre mit mir sicherlich etwas ganz anderes passiert. So jedoch war er fast immer zu Hause, hatte Zeit und konnte mit mir üben. Es war eine Erfahrung der Liebe in zweifacher Hinsicht. Da war erstens die Liebe zur Musik, die er mir vermittelt hat, und zweitens natürlich die Liebe zu meinem Vater. Dies kam vor allem dadurch zum Ausdruck, dass wir zusammen die größten und schönsten Liebesduette der Operngeschichte sangen: ich mit meiner Knabenstimme die Frauen- und mein Vater die Männerpartie.
Alles, woran ich mich erinnern kann, hat mit Musik zu tun. Mein Gedächtnis ist anscheinend nicht in der Lage, Bilder zu bewahren, es hat sich stattdessen mit Tönen vollgesaugt und mit Belcanto. Caruso und Tauber, Björling und Schipa und tagaus, tagein der verführerische Schmelz der Tenorstimme meines Vaters, sein unschuldiges, fast kindliches Timbre – all diese Klänge verzauberten unsere Wohnung, ließen sie über die Dächer der Stadt hinausfliegen in italienische Opernhäuser und Palazzi. Ich lernte mit Verdi zu hoffen und mit Puccini zu weinen, ich starb tausend Tode mit Manot und träumte von einer letzten Reise mit meiner geliebten Violetta. Es herrscht ein reges Frauensterben in den Belcanto-Dramen jener Zeit, und mir, dem die Oper das einzige Tor zur Wirklichkeit war, schienen Liebe und Tod untrennbar verbunden.
Gerade mal fünf Jahre alt, trällerte ich, wie Mutter mir erzählte, die Arien nach, die mein Vater unermüdlich übte. Dann lernte ich Klavier spielen, und schon bald begann ich zu improvisieren und bescheidene Melodien zu komponieren. Einige Jahre vor dem Stimmbruch sang ich mich mit meinem Vater quer durch die Klavierauszüge seiner Lieblingsopern. Was für ein ungewohnter Zusammenklang der verwandten Stimmen in den schönsten Liebesduetten der Musikgeschichte vereint! Was für eine Herausforderung für die Mutter, die in diesen Momenten die Liebe des Vaters wie die des Sohnes der Musik opfern musste! Wir beachteten Mutter nicht mehr, wenn wir sangen.
Ich war Mimi, und als wäre ich die Wiedergeburt einer Geraldine Farrar, ließ sich mein Pathos durch keine musikalische Leitung zügeln. Ich ließ mich von Puccini selbst leiten und von der Liebe, die seinen Melodien und harmonischen Progressionen entströmt. Und damals wenigstens war ich mir sicher: Wer noch nie bei Puccini geweint hat, kann nicht zur menschlichen Spezies gezählt werden. Vater liebte zwar Puccini ebenso abgöttisch wie ich, doch dann verschwand er so sehr im Gesang, war so mit der Vollendung des Tones beschäftigt, mit dem samtenen Gewand des Belcanto, mit der nie versiegenden Atemquelle, der Schlankheit der Atemsäule, dass er das Geschehen der Oper völlig aus den Augen verlor und sich von meiner unprofessionellen Leidenschaft führen ließ.
Mit dem Verlust der engelsgleichen Knabenstimme verlor ich die künstlerische Selbstsicherheit, und mein traumwandlerisches Klavierspiel wich einem trotzigen Aufbegehren gegen alles, was mir geschenkt worden war. Der gefallene Engel sank mit seiner Stimme um ein paar Oktaven tiefer in die Niederungen der Fleischlichkeit.
Als nun mit dem Stimmbruch die himmlische Leichtigkeit, mit der ich vierzehn Jahre lang musikalisch jubilieren durfte, irdischeren Konzepten weichen musste, entdeckte ich die moderne Musik und das dazugehörige Leben. Der kehlige und heisere Bluesgesang, das kurzatmige, immer erregte Schluchzen und Stöhnen des Rock ’n’ Roll, dieser ungeschulte und spontane Aufschrei der Gefühle, schien mir bald ehrlicher und erstrebenswerter als jede Kantilene. Es wollte mir nicht mehr genügen, meinen Melodien, die mir immer noch zuflogen und auf die ich weiterhin wie auf einen verborgenen, nur mir bekannten Schatz zurückgreifen konnte, klassische Harmonien zuzuordnen. Meine Improvisationen begannen, sich im Kreis zu drehen, meine Finger warteten auf neue Ideen, ich war offen für die Klänge der Welt außerhalb der Kartause meines Elternhauses.
Erste Zweifel gegen die musikalische Unfehlbarkeit des Vaters regten sich, und der Verlust der Klarheit und des Schmelzes meiner Stimme zwangen mich geradezu, mich vom Gesangsstil meines Vaters zu distanzieren und mir andere Vorbilder zu suchen. Mit dem Ende unseres gemeinsamen Musizierens zerbrach der wichtigste Zusammenhalt der Familie.
Vater arbeitete, kaum mehr ansprechbar, neben seinen täglichen Solfeggien und seinen unermüdlichen Versuchen, nichts als Licht auf die Leinwand zu bannen, an einem dramatischen Gedicht. Eine göttliche Komödie, die er erst am Ende seines Lebens ins Reine bringen sollte. Viel später bedeutete er mir einmal, er hätte nie etwas vollenden wollen, da ihm immer nur die Arbeit an und für sich wichtig gewesen sei. Nichts Vollendetes würde je von Menschen geschaffen werden, alle Schönheit sei im Ungeschaffenen verborgen.
Vater antwortete auf meine Fragen meistens mit klaren Sätzen, die, je älter ich werde, umso lebendiger vor mir auferstehen. Mutter tadelte ihn oft wegen seiner Naivität, vor allem wenn er uns wieder mal in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hatte. Einmal nahm er mich beiseite und raunte mir zu: »Wie soll man denn ohne Naivität dieses Leben einigermaßen anständig überstehen?« – »Alexander«, pflegte meine Mutter dann zu sagen, »was tuschelst du mit dem Jungen!« Das war keine Frage, das war ein Befehl, sofort die Heimlichkeit einzustellen. Sie hatte immer Angst, man könne sich gegen sie verbünden. Vater grinste darauf verschmitzt und zog sich in seine Komödie zurück.
Bis zur Pubertät war ich durch die Musik und das Singen, durch die Selbstverständlichkeit dieses Talentes, dieses Gottesgeschenks, in anderen Gefilden. Ich war nicht in der Wirklichkeit verankert, meinem Gefühl nach war ich den Engeln nahe. Die Pubertät zog mich dann brutal auf die Erde zurück. Plötzlich forderte mein Körper vehement sein Recht ein, und über viele Jahre hinweg pendelte ich auf diese Weise zwischen zwei Extremen: vom Himmel hinunter zur Hölle, und zurück. Natürlich gehört all das zur musikalischen Entwicklung, aber ich empfand es wohl besonders intensiv und fühlte mich geradezu zerrissen von diesen widerstreitenden Gefühlen. Ich fühlte mich nicht mehr in das gewohnte Urvertrauen eingebettet.
In der Folge begann ich schon sehr früh, von zu Hause auszureißen, was viele zu der Vermutung brachte, ich hätte keine glückliche Kindheit gehabt. Ich glaube im Nachhinein gar nicht, dass ich von meinen Eltern wegwollte; ich fühlte mich nur derart aufgewühlt, dass ich nur einfach irgendwohin wollte. Wahrscheinlich wollte ich mein verlorenes Kindheitsparadies an einem anderen Ort wieder suchen. Vielleicht tue ich bis heute nichts anderes, als dieses Paradies wieder zu suchen.
Genau betrachtet, hatte ich mehr als nur eine glückliche Kindheit. Ich hielt mich durch die fast ausschließliche Beschäftigung mit wunderbarer Musik zum großen Teil in einer ganz anderen Welt auf – einem Bereich, der in gewisser Hinsicht gar nicht von dieser Welt ist. Pathetisch gesprochen ist die Musik für mich eine Treppe zum Himmel. Das ist eine Sprache, die eher an Meditation angrenzt als an unseren Intellekt. Musik ist vielleicht die einzige Möglichkeit, um etwas zu erahnen von der eigentlichen Wirklichkeit.
Ich bin meinen Eltern auch deswegen unendlich dankbar, weil ich nicht kommerziell verheizt wurde, wie es zehn Jahre später mit Heintje geschah. Ich sang gleichwohl als Solist im Rudolf-Lamy-Kinderchor, im Theater am Gärtnerplatz in Benjamin Brittens Kinderoper »Der Schornsteinfeger« und für Schallplatten- und Filmaufnahmen. Auf der 1959 erschienenen Schallplatte »Heimat, deine Lieder« wurde ich erstmals namentlich erwähnt. Die Platte war lange Jahre ein gesuchtes Sammlerstück. Meine Mutter hütete drei Exemplare davon, wie vieles andere auch aus meiner Frühzeit, bis an ihr Lebensende in unserer Wohnung am Mariannenplatz.
Im Februar 2002 rief sie mich und einige Freunde an einem Nachmittag an, ich solle unbedingt sofort den Fernsehapparat aufdrehen. Gesendet wurde der Heimatfilm »Mein ganzes Herz ist voll Musik« von 1959, und der beginnt mit einer ländlichen Kirchenaufführung der Bach-Kantate BWV 71 »Gott ist mein König« unter der Leitung von Erika Köth an der Orgel – und mit mir als Knabensolist, offenbar ganz versunken in das musikalische Geschehen. Ich musste von einer Mitsängerin angestupst werden, um meinen Einsatz auf die Zeile »der alle Hilfe tut« nicht zu verpassen. Bis zu meinem zweiten Filmauftritt sollten dann übrigens 13 Jahre vergehen. Es war ein Werk ganz anderer Art, »Die Autozentauren«, zusammen mit Ingrid Steeger.
Wilhelmsgymnasium: erste musikalische Aufbrüche
Einmal im Jahr war es mucksmäuschenstill im Musiksaal. Da waren selbst die wildesten Musikverächter und Musiklehrerquäler gebannt von den zwei Füßen, zuckend in der Glut. Und von dem aufsprühenden und zischenden Feuermeer und dem ergrauten Herrn, dem gestern »dunkelbraun sich noch gekraust das Haar«. Conrad Ferdinand Meyers »Füße im Feuer« als Bezwinger einer Horde wilder Knaben – oder war’s doch die Vorleserin, eine ältere Dame, deren Name mir entfallen ist, die uns Knaben verzauberte? Auch ich saß geröteten Kopfes in meiner Bank und wagte nicht mich zu bewegen, um auch jedes Detail dieses furiosen Vortrags in mich aufsaugen zu können: Kein Räuspern, kein Augenaufschlag, keine noch so kleine Veränderung ihrer fast singenden Stimme sollte mir entgehen.
Unserem sanften Lehrer Bissinger wollte das nicht gelingen. Was mühte er sich redlich ab, uns die Schönheiten der Musik nahezubringen, Volkslieder und Kunstlieder zuallererst, die er mit seinem samtenen Bariton, sich selbst am Klavier begleitend, vortrug! Keine Chance, die Klasse zu begeistern. Die meisten erledigten ihre Hausaufgaben während der Musikstunde, hielten ein Schwätzchen, träumten sich an die Isar hinüber, wildere Abenteuer im Sinn, als sie Ännchen von Tharau je erlebt hatte.
Musiklehrer Bissingers Paradestück war »Hab mei Wage vollgelade« – da blühte er auf, das war sein Dialekt; und bei der Stelle »voll mit alte Weibse« verzog er den Mund, angeekelt, und bei »voll mit junge Mädle« juchzte er geradezu auf, etwas zu exaltiert, will mir heute scheinen. Ich mochte ihn, den stillen, musikbegeisterten Mann, er nahm mit mir ein paar Kunstlieder auf Tonband auf, bei denen er meinen Sopran kompetent und gefühlvoll am Klavier korrepetierte. An das »Heideröslein«, das wohl später noch öfters Schülern vorgespielt wurde, und ein Wiegenlied von Reger kann ich mich noch gut erinnern. Das Heideröslein habe ich sogar mal auf meine CD »Vaterland« als Hidden Track geschmuggelt.
Ich mochte ihn nicht nur – ich habe ihm viel zu verdanken, diesem Einzelgänger, diesem so aufrichtig von der Musik Besessenen. Er hat mir mit seiner Freude am Musizieren beigebracht, dass einem auch ein Haufen musikalischer Banausen nicht die Lust am Singen nehmen kann, dass man auch über alle Vorurteile und Gemeinheiten hinweg seinem Herzensanliegen treu sein kann, dass man seine Leidenschaft nie verraten sollte. Er hat mich darin bekräftigt, auch gegen rationales Besserwissertum das Pathos zu bewahren. Vermutlich war er zu sensibel für diesen Beruf, er war kein Dompteur, kein Schülerbändiger wie sein Kollege Büchinger. Man kann nie alle erreichen. Auch nicht als Lehrer.
Ja, ich mochte ihn und litt oft mit ihm, wenn ihm wieder mal besonders übel mitgespielt wurde, und ein bisschen schäme ich mich auch, ihm damals nicht tapferer zur Seite gestanden zu haben. Aber wer wollte schon als Streber dastehen oder gar als Lehrerversteher, und so habe ich eben meistens auch mit den Wölfen geheult oder in das große Summen mit eingestimmt, das in den letzten Jahren oft den Beginn seiner Unterrichtsstunde einleitete: Einer begann ein stimmhaftes »S« anzustimmen, und schon bald war der ganze Raum erfüllt von diesem S-Choral. Einige wollten wohl damit etwas andeuten, was immer wieder im Raum stand, aber nie bewiesen wurde und heutzutage schon gar kein Thema mehr ist.
Mich allerdings hat er erreicht. Und mir bleibt er unvergessen. Ich habe mich jedes Mal gefreut auf diesen schönen Raum mit seinen großen Fenstern und dem respektablen Flügel auf der kleinen Bühne.
Zwei Stockwerke tiefer – soweit ich mich noch erinnere – war der Physiksaal: das krasse Gegenteil zu dem Raum mit der verzauberten Stimmung oben. Für mich jedenfalls. Denn das war das Reich des Lehrers Urban, und uns beide verband eine tiefe gegenseitige Abneigung. Noch Jahre nach meinem eher unfreiwilligen Schulabgang drohte er unaufmerksamen Schülern mit den Worten: »Wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr enden wie der Wecker: im Knast!« Mir blieb bis heute verborgen, ob diese martialische Drohung einigen faulen Buben den Weg zum großen Physiker geebnet hat. Bei mir hat der Herr jedenfalls jede mögliche naturwissenschaftliche Karriere im Keim erstickt.
Im Musiksaal aber fühlte ich mich geborgen. Noch heute sehe ich mich manchmal am Fenster sitzen, wohlig geschaukelt von Bach- und Mozartklängen, betört vom Zauber all der großen Komponisten, die uns Herr Bissinger näherzubringen versuchte.
Oft setzte ich mich in der Pause an den geliebten Flügel und improvisierte ein wenig; und manchmal entdeckte ich dann meinen Lehrer, der sich unbemerkt in eine der hinteren Bänke gesetzt hatte und meinen nicht wirklich großartigen Versuchen stumm lauschte. Manchmal setzte er sich dann zu mir auf die Klavierbank, lobte mich und gab mir ein paar Tipps.
Und jetzt, da ich mich wieder zurückversetze in diese Zeit des musikalischen Aufbruchs, tut es mir richtig leid, es ihm nicht schon damals wenigstens einmal gesagt zu haben: Wenn’s auch zu spät ist — danke, Lehrer Bissinger!
»DIE DINGE SINGEN HÖR ICH SO GERN «
Konstantin Wecker
Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus:
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,
und hier ist Beginn und das Ende ist dort.
Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,
sie wissen alles, was wird und war;
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;
ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.
Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.
Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um.
Rainer Maria Rilke
Je älter ich werde, desto intensiver beschäftigt mich die Frage, was mich mein Leben lang mit der Poesie so stark verbunden hat. Sicher ist diese große Liebe zum poetischen Wort erst mal meiner Mama zu verdanken. Sie liebte Gedichte und rezitierte sie oft zu Hause, als ich noch ein sehr kleiner Junge war.
Sie rezitierte sie nicht aus pädagogischen Gründen, um mich damit zu belehren, sondern aus Begeisterung für die Verse und Reime. Sie machten ihr Freude, und ich lauschte, mal bewusst, mal unbewusst, den Klängen und Melodien der geheimnisvollen Sprache.
Damit wurde sicher eine Lunte gelegt, die sich Jahre später in meiner Pubertät zu einem Feuer entfachen sollte.
Mit etwa zwölf Jahren schrieb ich meine ersten eigenen Verse, meistens im Stile Eichendorffs oder Mörikes, romantische Gedichte, die ich in einem Sammelband in der Bibliothek meiner Eltern entdeckt hatte und die mich sehr ansprachen.
Wenn man in diesen frühen 60er Jahren als Kind lesen wollte, musste man sich die Bücher der Erwachsenen greifen, denn Literatur für Kinder gab es kaum. Einzig an den »Münchner Bilderbogen« und »Struwwelpeter« kann ich mich erinnern und natürlich an »Max und Moritz«.
Dann entdeckte ich die Expressionisten, und ich glaube, ohne diese großen Leidenden hätte ich meine Pubertät nicht überstanden.
Wie ich in der »Kunst des Scheiterns« schrieb, war ich auch nicht wirklich schuld daran, dass ich das erste Mal von zu Hause ausgerissen bin.
Georg Trakl war’s.
Er war schuld, dass ich das erste Mal von zu Hause ausriss.
Und Georg Heym und Ernst Maria Stadler und Jakob van Hoddis. Viele Namen dieser oft so früh verstorbenen, so tief empfindenden, so unendlich traurigen Dichter des expressionistischen Jahrzehnts habe ich leider vergessen, aber ich kann mich noch gut erinnern an ein Taschenbuchbändchen, das sich ausschließlich den Gedichten dieser Zeit widmete und das mich nachhaltig davon überzeugte, dass dieses bourgeoise Gymnasium mit seinen bourgeoisen Karriereaussichten jeder freien künstlerischen Entwicklung im Wege stehen musste.
»Lyrik des expressionistischen Jahrzehnts« hieß das Buch, zu dem Gottfried Benn ein Vorwort geschrieben hatte, und kein weiteres Buch hat meine eigene lyrische Produktion auch nur annähernd so beeinflusst.
Ich litt mit diesen großen Leidenden, ich zog mit ihnen in den Krieg, ich lag verwundet im Schützengraben, ein Notizbüchlein auf den blutenden Knien, und reimte von blauen und trüben Stunden im »sinkenden Abend«, in der »austreibenden Flut«.
Ich berauschte mich an Trakls Versen und seinem tragischen Geschick, wie Jahre später an süßem Lambrusco, wir schwänzten die Schule und gaben uns in diversen Kaffeehäusern allmorgendlich eine Dröhnung expressionistischer Gedichte.
Mein Freund Stephan, ein stiller, scheuer Junge, der wunderschön Blockflöte spielen konnte, hörte zu. Ich rezitierte. Das verständnislose Kopfschütteln der übrigen Gäste wertete uns anfangs auf, ihre Verständnislosigkeit bestätigte uns in unserem Kampf gegen die Spießer dieser Welt, später vergaßen wir auch sie.
Die blaue Stunde wurde zum blauen Tag, zur blauen Woche, dem Bürger flog vom spitzen Hut der Kopf, und Anna Blume?