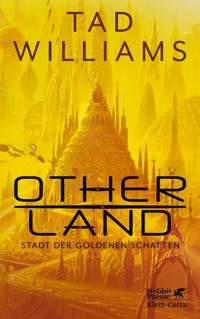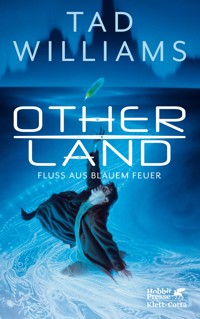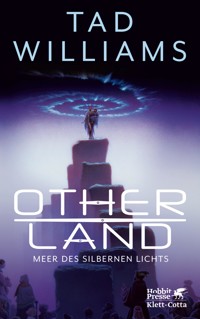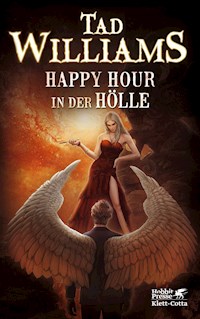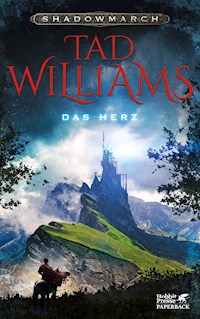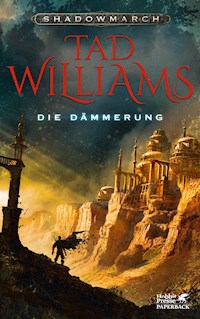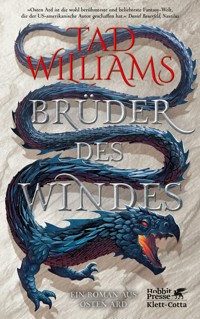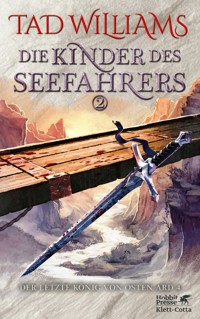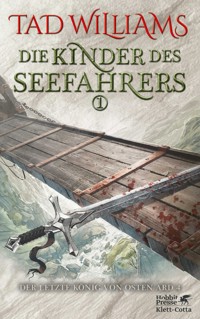19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Geheimnis der Großen Schwerter
- Sprache: Deutsch
Zwischen dem tödlichen Streit der Königsbrüder und einem verheerenden Kampf mit den Elbenvölkern muss der Küchenjunge Simon seinen Weg finden. In dieser Hobbit Presse Gold Edition befinden sich alle vier Teile der Tetralogie "Das Geheimnis der großen Schwerter" von Tad Williams. Über 3600 Seiten entführen den Leser in die Welt von Osten Ard. Die Limited Edition ist nur für begrenzte Zeit lieferbar. Der betagte König Johan liegt im Sterben. Unter seinen Söhnen Elias und Josua entbrennt ein erbitterter Kampf um die Thronfolge, in den der Küchenjunge Simon unfreiwillig verwickelt wird. Auch die anderen Völker von Osten Ard, die Trolle, Nornen und Sithi mischen in diesem Kampf mit, doch niemand weiß, auf wessen Seite sie tatsächlich stehen. Elias wagt ein Bündnis mit ihnen, um seine Ziele zu erreichen und versucht seinen Bruder Josua aus dem Weg zu räumen. Unterdessen sucht Simon die drei Schwerter "Leid", "Mynneyard" und "Dorn", denn eine alte Prophezeiung besagt, dass der Frieden erst in Osten Ard einkehren kann, wenn alle drei Schwerter wieder vereint sind. Dieses E-Book enthält: - Der Drachenbeinthron - Der Abschiedsstein - Die Nornenkönigin - Der Engelsturm
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 5601
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
TAD WILLIAMS
Das Geheimnis der großen Schwerter
GOLDEDITION
DIE GESAMTE SAGA
Inhalt
Dieses E-Book enthält die folgenden Bände aus der Reihe „Das Geheimnis der großen Schwerter“:
Der Drachenbeinthron (Band 1)
Der Abschiedsstein (Band 2)
Die Nornenkönigin (Band 3)
Der Engelsturm (Band 4)
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Übersetzung von Verena C. Harksen wurde neu durchgesehen von Andy Hahnemann.
Hobbit Presse Paperback
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Dragonbone Chair«
im Verlag DAW Books Inc., New York
© 1988 by Tad Williams
Für die deutsche Ausgabe
© 2010 / 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier,
Illustration Melanie Korte, Inkcraft
Illustrationen im Innenteil: © Jan Reiser, www.enter-and-smile.de
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe:ISBN 978-3-608-96161-4
E-Book: ISBN 978-3-608-10149-2
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
»Ich habe mir eine Aufgabe gestellt,
zum Nutzen der Welt
und zum Wohlgefallen der edlen Herzen,
jener Herzen, zu denen ich mich hingezogen fühle,
und jener Welt, in die mein Herz blickt.
Ich meine nicht die gewöhnlichen Menschen;
nicht die, von denen ich höre, dass sie
kein Leid ertragen können
und immer nur in Freude leben wollen.
Die lasse auch Gott in Freude leben!
Diesen Menschen und diesem Leben
ist meine Erzählung unbequem:
ihr Leben und das meine gehen auseinander.
Von ganz anderen Menschen spreche ich,
und zwar denen, die gleichzeitig in ihren Herzen tragen
ihre süße Bitterkeit, ihr liebes Leid,
ihre innige Liebe, ihren sehnsüchtigen Schmerz,
ihr glückliches Leben, ihren leidvollen Tod,
ihren glücklichen Tod und ihr leidvolles Leben.
Dieses Leben erstrebe ich,
zu diesen Menschen will ich gehören,
mit ihnen sterben oder leben.«
Gottfried von Straßburg, Prolog zu Tristan und Isolde
Warnung des Verfassers
Wanderer im Lande Osten Ard werden davor gewarnt, sich blind auf alte Regeln und Gesetze zu verlassen; sie sollten alle Rituale sorgsam beobachten, denn oft verhüllt der Schein das Sein.
Das Qanucvolk der schneebedeckten Troll-Fjälle hat ein Sprichwort: »Wer davon überzeugt ist, das Ende der Dinge zu wissen, die er gerade erst beginnt, ist entweder außerordentlich weise oder ganz besonders töricht; so oder so ist er aber gewiss ein unglücklicher Mensch, denn er hat dem Wunder ein Messer ins Herz gestoßen.«
Um es deutlicher zu sagen: Wer zum ersten Mal dieses Land besucht, sollte sich vor voreiligen Schlüssen hüten.
Die Qanuc pflegen auch zu sagen: »Willkommen, Fremder. Die Pfade sind tückisch heute.«
Vorwort
Das Buch des wahnsinnigen Priesters Nisses, so sagen jene, die es in Händen gehalten haben, ist sehr groß und so schwer wie ein kleines Kind. Man entdeckte es neben seinem Leichnam, der mit lächelndem Gesicht unter dem Turmfenster lag, aus dem vor wenigen Augenblicken sein Gebieter, König Hjeldin, in den Tod gesprungen war.
Die rostbraune Tinte, gebraut aus Lammsblatt, Nieswurz und Raute – und aus einer noch röteren, dunkleren Flüssigkeit –, ist trocken und flockt leicht von den dünnen Seiten. Der Einband wurde aus der unverzierten Haut eines haarlosen Tieres von unbekannter Gattung gefertigt.
Diejenigen der heiligen Männer von Nabban, die es nach Nisses’ Dahinscheiden lasen, erklärten es für ketzerisch und gefährlich, aber aus irgendeinem Grund verbrannten sie es nicht, wie es üblicherweise mit solchen Schriften geschieht. Stattdessen ruhte es viele Jahre in den schier unendlichen Archiven der Mutter Kirche, in den tiefsten, geheimsten Gewölben der Sancellanischen Ädonitis. Nun aber scheint es aus der Onyxschatulle, in der es bewahrt wurde, verschwunden zu sein, und der recht verschwiegene Orden der Archive gibt über den jetzigen Verbleib nur unbestimmte Auskünfte.
Einige Leser von Nisses’ ketzerischem Werk behaupten, dass alle Geheimnisse Osten Ards darin enthalten seien, von der düsteren Vergangenheit dieses Landes bis zu den Schatten der Dinge im Schoß der Zukunft. Die ädonitischen Revisoren sagen nur, der Inhalt sei ›unheilig‹.
In der Tat mag es stimmen, dass Nisses’ Schriften das Kommende so deutlich – und man darf annehmen: auf so verschrobene Weise – voraussagen, wie sie das Gewesene aufgezeichnet haben. Man weiß jedoch nicht, ob die großen Taten unseres Zeitalters – vor allem der Aufstieg und Triumph von Johan dem Priester – Teil der Aufzeichnungen Nisses’ sind; gewisse Andeutungen sprechen jedoch dafür. Vieles von dem, was er schreibt, ist geheimnisvoll und verbirgt seinen Sinn in seltsamen Reimen und dunklen Anspielungen. Ich habe niemals das ganze Werk gelesen, und die meisten von denen, die es getan haben, sind schon lange tot.
Das Buch trägt, in den kalten, harten Runen von Nisses’ Geburtsstätte hoch im Norden, den Titel DU SVARDENV YRD, was so viel heißt wie Das Verhängnis der Schwerter …«
Aus Leben und Regierung König Johan Presbyters von Morgenes Ercestres
Erster Teil Simon Mondkalb
1Grashüpfer und König
An diesem Tag aller Tage rührte sich etwas Fremdartiges tief im dämmernden Herzen des Hochhorstes, im verwirrenden Kaninchenbau der Burg mit ihren stillen Gängen und von Efeu überwucherten Höfen, in den Mönchszellen und den feuchten, schattendunklen Kammern. Höflinge und Dienerschaft, sie alle rissen die Augen auf und flüsterten, Küchenjungen tauschten über den Waschwannen bedeutungsvolle Blicke. In allen Gängen und Torhöfen der gewaltigen Feste schienen sich Menschen mit gedämpfter Stimme zu unterhalten.
Der allgemeinen Stimmung atemloser Erwartung nach hätte es der erste Frühlingstag sein können, aber der große Kalender in Doktor Morgenes’ vollgestopftem Zimmer zeigte etwas anderes: Man befand sich erst im Monat Novander. Der Herbst hielt die Tür auf, und langsam zog der Winter ein.
Was diesen Tag von allen anderen unterschied, war nicht die Jahreszeit, sondern ein Ort: der Thronsaal auf dem Hochhorst. Drei lange Jahre waren seine Pforten auf Befehl des Königs geschlossen gewesen, die bunten Fenster von schweren Vorhängen verhüllt. Nicht einmal die mit der Hausreinigung betraute Dienerschaft hatte die Schwelle übertreten dürfen, was der Obersten Kammerfrau unendliche Qualen bereitet hatte. Drei Sommer und drei Winter war der Saal ungestört geblieben. Jetzt war hier wieder Leben eingekehrt, und die ganze Burg summte von Gerüchten.
Doch gab es einen Menschen im geschäftigen Hochhorst, einen zumindest, der nicht seine ganze Aufmerksamkeit auf jenen lange unbewohnten Raum gerichtet hatte, eine Biene im murmelnden Stock, deren einsames Lied nicht zur Tonart des allgemeinen Gesumms passte. Dieser eine hockte im Herzen des Heckengartens in einer Nische zwischen dem stumpfroten Stein der Kapelle und der Flanke eines zum Skelett entlaubten Heckenlöwen und glaubte, niemand werde ihn vermissen. Der Tag war bisher recht unerfreulich verlaufen. Die Frauen steckten alle mitten in ihrer Arbeit und hatten wenig Zeit, Fragen zu beantworten, es hatte zu spät Frühstück gegeben, und kalt war es. Wie gewöhnlich hatte man ihm verwirrende Anordnungen erteilt, und niemand interessierte sich auch nur im Geringsten für seine Probleme …
Das war, dachte er mürrisch, ja auch nicht anders zu erwarten. Wenn er nicht diesen riesigen, prachtvollen Käfer entdeckt hätte – der da durch den Garten gekrochen war, selbstzufrieden wie ein reicher Dorfbewohner –, wäre der ganze Nachmittag eine einzige Zeitvergeudung gewesen.
Mit einem Zweig verbreiterte er die winzige Straße, die er in die dunkle, kalte Erde an der Mauer gekratzt hatte, aber trotzdem wollte sein Gefangener nicht vorwärtslaufen. Vorsichtig kitzelte er den glänzenden Panzer, aber der dickköpfige Käfer rührte sich nicht. Der Junge runzelte die Stirn und sog an der Oberlippe.
»Simon! Wo im Namen der heiligen Schöpfung hast du dich rumgetrieben!«
Der Zweig fiel ihm aus den Fingern, als hätte ihm ein Pfeil das Herz durchbohrt. Langsam drehte er sich zu der bedrohlichen Gestalt um, die hinter ihm aufragte.
»Nirgendwo …«, wollte Simon sagen, aber noch während das Wort dem Mund entfloh, packte ihn ein knochiges Fingerpaar am Ohr und zerrte ihn ruckartig auf die Füße. Vor Schmerz jaulte er auf.
»Komm mir nicht mit ›nirgendwo‹, junger Strolch«, bellte ihm Rachel der Drache, die Oberste der Kammerfrauen, mitten ins Gesicht, wobei sie nur auf gleicher Höhe mit ihm war, weil sie auf den Zehenspitzen stand und der Junge von Natur aus zu schlechter Haltung neigte; eigentlich fehlte Rachel fast ein Fuß zu Simons Größe.
»Ja, Herrin, es tut mir leid, tut mir leid«, murmelte Simon und bemerkte betrübt, dass der Käfer auf einen Spalt in der Mauer der Kapelle und damit auf seine Freiheit zusteuerte.
»Mit ›tut mir leid‹ kommst du auf die Dauer auch nicht durch«, knurrte Rachel. »Jedermann im ganzen Haus rackert sich ab, damit alles bereit ist, nur du nicht! Und als ob das nicht schlimm genug wäre, muss ich auch noch meine kostbare Zeit verschwenden, um dich zu suchen! Wie kannst du so ein unartiger Junge sein, Simon, wenn du dich doch längst wie ein Mann benehmen solltest? Wie kannst du nur?«
Der Junge, vierzehn schlaksige Jahre alt und in peinlichster Verlegenheit, antwortete nicht. Rachel starrte ihn an. Traurig genug, dachte sie, dieses rote Haar und die Pickel, aber wenn er dann noch so nach oben schielt und verschämt das Gesicht verzieht, sieht er ja geradezu schwachsinnig aus!
Simon starrte seinerseits zurück und sah, dass Rachel schwer atmete und kleine Dampfwölkchen in die Novanderluft pustete. Außerdem zitterte sie, wenn Simon auch nicht sagen konnte, ob vor Kälte oder vor Zorn. Es kam eigentlich auch nicht darauf an, so oder so machte es alles noch schlimmer für ihn.
Sie wartet immer noch auf eine Antwort – wie müde und verärgert sie aussieht! Er ließ Kopf und Schultern noch deutlicher hängen und blickte verlegen auf die eigenen Füße.
»Du kommst jetzt sofort mit. Der Gute Gott weiß, dass ich genug Arbeit habe, um einen faulen Burschen damit auf Trab zu halten. Weißt du nicht, dass der König vom Krankenbett aufgestanden und heute in seinen Thronsaal gegangen ist? Bist du denn taub und blind?« Sie packte ihn am Ellenbogen und schob ihn vor sich her durch den Garten.
»Der König? König Johan?«, fragte Simon überrascht.
»Nein, du dummer Junge, König Katzenkopf! Natürlich König Johan!« Rachel blieb auf dem Absatz stehen, um eine dünne Strähne schlaffes, stahlgraues Haar unter die Haube zurückzuschieben. Ihre Hand bebte.
»So, hoffentlich bist du nun glücklich«, sagte sie endlich. »Du hast mich so durcheinandergebracht und aufgeregt, dass ich sogar respektlos mit dem Namen unseres guten alten Königs Johan umgesprungen bin. Und das, wo er so krank ist, und überhaupt.« Sie schniefte laut, beugte sich dann vor und versetzte Simon einen schmerzhaften Klaps auf den Oberarm. »Nun komm endlich.«
Den Nichtsnutz im Schlepptau, stapfte sie voran durch den Garten.
Simon hatte nie ein anderes Zuhause gekannt als die alterslose Burg mit dem Namen Hochhorst, was so viel bedeutete wie Hohe Feste. Sie trug den Namen zu Recht: Der Engelsturm, ihr höchster Punkt, ragte weit über die ältesten und höchsten Bäume hinaus. Hätte der Engel selbst, der auf der Turmspitze stand, einen Stein aus der grünspanigen Hand fallen lassen, wäre dieser Stein fast zweihundert Ellen in die Tiefe gestürzt, bevor er in den brackigen Burggraben gefallen wäre, um dort den Schlaf der gewaltigen Hechte zu stören, die dicht über dem jahrhundertealten Schlamm dahintauchten.
Der Hochhorst war weit älter als sämtliche Generationen erkynländischer Bauern, die in den Dörfern und auf den Feldern rund um die große Festung geboren worden waren, gearbeitet hatten und gestorben waren. Die Erkynländer waren lediglich die bisher letzten, die Anspruch auf die Burg erhoben – viele andere vor ihnen hatten sie ihr Eigen genannt, auch wenn sie niemandem je wirklich ganz gehört hatte. Die Außenmauer um das weitläufige Festungsgelände zeigte das Werk unterschiedlicher Hände und Zeitalter: den roh behauenen Fels und die groben Balken der Rimmersmänner, das wahllose Flickwerk und die fremdartigen Steinmetzarbeiten der Hernystiri, ja sogar die übersorgfältige Maurerkunst der Handwerker aus Nabban. Alles jedoch überragte der Engelsturm, den die unsterblichen Sithi errichtet hatten, bevor die Menschen ins Land kamen, damals, als sie über ganz Osten Ard herrschten. Die Sithi hatten als Erste hier gebaut und ihre vorzeitliche Feste auf der Landzunge gegründet, die über den Kynslagh und die Wasserstraße zum Meer hinausblickte. Asu’a hatten sie ihre Burg genannt; wenn es einen wirklichen Namen hatte, dieses Haus so vieler Herren, dann lautete er Asu’a.
Das Schöne Volk war längst aus den grasigen Ebenen und dem wogenden Hügelland verschwunden, zumeist in die Wälder und zerklüfteten Berge geflohen oder an andere, für Menschen unbewohnbare Stätten. Das Gerippe der Burg blieb als neue Heimstatt für die Räuber der Macht zurück. Asu’a – der Widerspruch: stolz und schäbig zugleich, festlich und abweisend, scheinbar unberührt vom Wechsel seiner Bewohner. Asu’a – der Hochhorst: Wie ein Gebirge ragte er massig über Umland und Stadt empor, über seinem Lehen zusammengekauert wie eine schläfrige, honigschnauzige Bärin über ihren Jungen.
Oft hatte es den Anschein, als sei Simon der einzige Bewohner der gewaltigen Burg, der seinen Platz im Leben noch nicht gefunden hatte. Die Maurer verputzten die weißgetünchte Verblendung des Wohngebäudes und stützten die bröckelnden Burgmauern – obwohl das Bröckeln manchmal schneller voranzuschreiten schien als die Instandsetzung –, ohne sich je den Kopf darüber zu zerbrechen, wie oder warum die Welt sich drehte. Die Küchen- und Kellermeister pfiffen vergnügt und rollten riesige Fässer mit Südwein und gepökeltem Rindfleisch hierhin und dorthin. An der Seite des Seneschalls feilschten sie mit den Bauern um die Zwiebeln und erdfeuchten Mohrrüben, die jeden Morgen säckeweise in die Küche des Hochhorstes geschleppt wurden. Und Rachel und ihre Kammermädchen hatten immer schrecklich viel zu tun; sie schwangen ihre aus Stroh gebundenen Besen, jagten den Staubflocken nach, als gelte es, ungebärdige Schafe zu hüten, murmelten fromme Verwünschungen über den Zustand, in dem manche Leute bei der Abreise ihre Zimmer hinterließen, und übten eine allgemeine Schreckensherrschaft über die Liederlichen und Nachlässigen aus.
Inmitten all dieses Fleißes war der ungeschickte Simon der sprichwörtliche Grashüpfer im Ameisenhaufen. Er wusste, dass er es nie zu etwas Rechtem bringen würde; das hatten ihm schon viele Leute gesagt, die fast alle erwachsen – und vermutlich klüger – waren als er. In einem Alter, in dem andere Jungen längst lautstark nach männlicher Verantwortung begehrten, war Simon noch ein unsteter Wirrkopf. Seine Gedanken schweiften, ganz gleich, welche Aufgabe man ihm übertrug, schon nach kurzer Zeit ab, und er träumte von Schlachten und Recken und Seereisen auf hohen, glänzenden Schiffen … und auf geheimnisvolle Weise zerbrach dann etwas oder ging verloren oder wurde falsch gemacht.
Manchmal war er überhaupt nicht aufzufinden. Wie ein magerer Schatten drückte er sich überall in der Burg herum, konnte so behende wie die Dachdecker und Glaser jede Wand hinaufklettern und kannte so viele Gänge und Verstecke, dass das Burgvolk ihn den »Geisterjungen« nannte. Rachel gab ihm häufig Backpfeifen und schalt ihn »Mondkalb«.
Endlich hatte Rachel der Drache seinen Arm losgelassen, und Simon zog missmutig die Füße nach, während er der Obersten der Kammerfrauen hinterherschlurfte wie ein Stock, der sich im Rocksaum verfangen hat. Er war erwischt worden, sein Käfer entkommen und der Nachmittag ruiniert.
»Was soll ich machen, Rachel«, murmelte er unwirsch, »in der Küche helfen?«
Rachel schnaubte verächtlich und watschelte weiter, ein Dachs mit Schürze. Voller Bedauern blickte sich Simon nach den schützenden Bäumen und Hecken des Gartens um. Ihrer beider Schritte hallten feierlich in dem langen Steinkorridor wider.
Die Kammerfrauen hatten Simon aufgezogen, aber da er ganz sicher nie eine der ihren werden würde – denn ganz abgesehen davon, dass er ein Junge war, konnte man ihm offensichtlich keine feineren Hausarbeiten anvertrauen –, hatte man sich gemeinschaftlich bemüht, eine passende Arbeit für ihn zu finden. In einem großen Haus, und der Hochhorst war zweifellos das größte Haus überhaupt, war für Leute, die nicht arbeiteten, kein Platz. Simon hatte eine Art Beschäftigung in den Burgküchen gefunden, aber selbst in dieser anspruchslosen Stellung war er wenig nützlich. Die anderen Küchenjungen lachten und pufften einander, wenn sie Simon betrachteten, der – bis zu den Ellenbogen im Wasser, die Augen in selbstvergessener Träumerei zugekniffen – gerade die Kunst des Vogelflugs erlernte oder Traumjungfrauen vor imaginären Untieren errettete, während sein Waschprügel quer durch die ganze Wanne davontrieb.
Der Legende nach war einst Herr Fluiren – ein Verwandter des berühmten Herrn Camaris von Nabban – in seiner Jugend auf den Hochhorst gekommen, um ein Ritter zu werden, und hatte in ebendieser Spülküche ein ganzes Jahr gearbeitet, so unsagbar demütig war er gewesen. Die Küchenleute hatten ihn geneckt, erzählte man, und ihn »Hübschhand« genannt, weil die schreckliche Schufterei das feine Weiß seiner Finger nicht beeinträchtigen wollte.
Simon brauchte nur die eigenen rosagesottenen Pfoten mit den gesprungenen Nägeln anzuschauen, um zu wissen, dass er nicht der verwaiste Sohn eines großen Herrn war. Er war ein Küchenjunge und Eckenausfeger, und damit hatte es sich.
König Johan hatte, wie jedermann wusste, in kaum höherem Alter den Roten Drachen erschlagen; Simon kämpfte mit Besen und Töpfen. Nicht, dass das einen großen Unterschied bedeutet hätte: Die heutige Welt war anders und ruhiger als in des Königs Jugend, was sie großenteils dem alten Herrscher selber verdankte. In den dunklen, endlosen Hallen des Hochhorstes wohnten keine Drachen mehr, zumindest keine feuerspeienden. Allerdings kam Rachel, wie Simon oft innerlich fluchte, mit ihrer sauren Miene und den grässlichen Kneifefingern ihnen nahe genug.
Sie erreichten das Vorzimmer des Thronsaals und damit den Mittelpunkt der ungewohnten Betriebsamkeit. Die Kammerfrauen flogen nur so von Wand zu Wand wie Fliegen in einer Flasche. Rachel blieb mit in die Hüfte gestemmten Fäusten stehen und musterte ihr Reich, und dem Lächeln nach, zu dem sie ihren dünnen Mund zusammenzog, schien sie zufrieden.
Simon, einen Augenblick unbeachtet, kauerte an einer teppichgeschmückten Wand. Krummrückig starrte er aus den Augenwinkeln auf das neue Mädchen Hepzibah, das rundlich und lockenhaarig war und sich mit einem unverschämten Hüftschwung fortbewegte. Als sie mit einem überschwappenden Wassereimer an ihm vorbeikam, fing sie seinen Blick auf und lächelte breit und amüsiert zurück. Simon spürte, wie ihm knisterndes Feuer vom Hals bis in die Wangen stieg, und wandte sich ab, um an den ausgefransten Wandbehängen herumzuzupfen.
Rachel war der Blickaustausch nicht entgangen.
»Dass dich der Herr auspeitschen möge wie einen Esel, Junge! Hab ich dir nicht gesagt, du solltest dich an die Arbeit machen? Los jetzt!«
»Los womit? Was soll ich denn tun?«, rief Simon und hörte tiefgekränkt, wie Hepzibahs silberhelles Lachen aus dem Gang herüberschwebte. In ohnmächtiger Wut auf sich selber zwickte er sich in den eigenen Arm. Es tat weh.
»Nimm den Besen hier und geh die Wohnung des Doktors ausfegen. Der Mann lebt wie ein Hamster, der alles in seinen Bau schleppt, und wer weiß, wohin der König noch gehen will, jetzt, da er wieder auf den Beinen ist!« Ihr Ton zeigte deutlich, dass für Rachel auch Könige von der sonst Männern eigenen Aufsässigkeit keinesfalls ausgenommen waren.
»Die Wohnung von Doktor Morgenes?«, fragte Simon. Zum ersten Mal, seit er im Garten erwischt worden war, besserte sich seine Laune. »Sofort!« Er schnappte sich den Besen und war schon fort.
Rachel schnaubte und drehte sich um, um die Ordnung und Reinlichkeit im Vorzimmer zu prüfen. Sie fragte sich einen kurzen Augenblick, was wohl hinter der gewaltigen Tür des Thronsaales vorgehen mochte, verbannte dann jedoch diese Gedankenverirrung so unbarmherzig, wie sie eine umhersummende Mücke erschlagen hätte. Mit Händeklatschen und stählernen Blicken trieb sie ihre Legionen zusammen und führte sie hinaus aus dem Vorraum und hinein in die nächste Schlacht gegen ihren Erzfeind, die Unordnung.
Dort, in jener Halle hinter der Tür, hingen in langen Reihen verstaubte Banner an den Wänden, ein verschossenes Bestiarium phantastischer Tiere: der sonnengoldene Hengst des Mehrdon-Clans, Nabbans schimmerndes Wappen, der Eisvogel sowie Eule und Ochse, Otter, Einhorn und Basilisk – Glied um Glied schweigender, schlafender Geschöpfe. Kein Luftzug bewegte diese fadenscheinigen Stoffbahnen; selbst die Spinnweben hingen leer und längst verlassen herunter.
Aber trotzdem hatte sich eine Kleinigkeit verändert im Thronsaal: In diesem Raum voller Schatten gab es wieder etwas Lebendiges. Mit der dünnen Stimme eines kleinen Jungen oder eines sehr alten Mannes sang jemand ein leises Lied.
Am äußersten Ende der Halle hing zwischen den Standbildern der Hochkönige des Hochhorstes ein gewichtiger Wandteppich, ein Gobelin mit dem königlichen Wappen, Feuerdrachen und Baum. Die grimmigen Malachitstatuen, eine Sechser-Ehrenwache, flankierten einen riesigen, schweren Sessel, der ganz aus vergilbendem Elfenbein geschnitzt zu sein schien, mit knotigen, knöchrigen Armlehnen, die Rückenlehne überragt von einem ungeheuren, vielzahnigen Schlangenschädel mit Augen wie schattige Teiche.
Auf diesem Sessel und davor saßen die beiden Figuren. Die kleine, buntscheckig gekleidete, sang; es war ihre Stimme, die vom Fuß des Thrones aufstieg, zu schwach, um auch nur ein einziges Echo auszulösen. Zu ihr hinunter beugte sich eine abgemagerte Gestalt, die auf der Kante des Thrones hockte wie ein altes Raubtier – ein müder, gefesselter Raubvogel, angekettet an den stumpfen Knochen.
Der König, drei Jahre lang krank und geschwächt, war zurückgekehrt in seine staubige Halle. Er lauschte dem kleinen Mann, der zu seinen Füßen sang; die langen, fleckigen Hände des Königs umklammerten die Armlehnen seines großen, vergilbenden Thrones.
Er war ein hochgewachsener Mann – einst sogar sehr hochgewachsen, jetzt aber gebeugt wie ein Mönch beim Gebet. Er trug ein Gewand von himmelblauer Farbe, das an ihm herunterhing, und war bärtig wie ein Usires-Prophet. Quer über seinem Schoß lag ein Schwert, das glänzte, als sei es frisch poliert; auf der Stirn saß die eiserne Krone, über und über mit seegrünen Smaragden und geheimnisvollen Opalen besetzt.
Das Männchen zu Füßen des Königs hielt einen langen, stillen Augenblick inne und begann dann ein neues Lied:
Kannst du Tropfen zählen, wenn kein Regen fällt?
Kannst im Fluss du schwimmen, der kein Wasser hält?
Kannst du Wolken fangen? Nein, das kann nie geschehn …
Und der Wind rief ›Warte!‹ im Vorübergehn.
Ja, der Wind rief ›Warte!‹ im Vorübergehn …
Als die Weise verklungen war, streckte der große alte Mann im blauen Gewand die Hand nach unten, und der Narr nahm sie. Keiner von beiden sagte ein Wort.
Johan Presbyter, Herr von Erkynland und Hochkönig von ganz Osten Ard, Geißel der Sithi und Verteidiger des wahren Glaubens, Schwinger des Schwertes Hellnagel, Verderben des Drachen Shurakai … Johan der Priester saß wieder auf seinem Thron aus Drachenbein. Er war alt, sehr alt, und hatte geweint.
»Ach, Strupp«, flüsterte er endlich, und seine Stimme war tief, doch brüchig vom Alter, »das muss wohl doch ein unbarmherziger Gott sein, der mich in diesen elenden Zustand versetzen konnte.«
»Vielleicht, Herr.« Der kleine alte Mann im buntscheckigen Wams lächelte ein runzliges Lächeln. »Vielleicht … aber gewiss würden andere nicht über Grausamkeit klagen, wenn sie Eure Stellung im Leben erreicht hätten.«
»Aber das meine ich ja gerade, alter Freund!« Der König schüttelte unwillig den Kopf. »In diesem Schattenalter schwacher Hinfälligkeit sind alle Menschen gleich geworden. Jeder holzköpfige Schneiderlehrling hat mehr vom Leben als ich!«
»Ach, nicht doch, Herr …« Strupps grauer Kopf wackelte von einer Seite auf die andere, aber die Glöckchen an seiner Kappe, lange schon ohne Klöppel, klingelten nicht. »Herr, Ihr beklagt Euch zu angemessener Zeit, doch ohne angemessene Vernunft. Alle Menschen, ob groß oder klein, müssen den letzten Gang antreten. Ihr hattet ein schönes Leben.«
Johan der Priester hielt den Griff von Hellnagel vor sich wie einen Heiligen Baum. Er fuhr sich mit dem Rücken der langen, schmalen Hand über die Augen.
»Kennst du die Geschichte dieser Klinge?«, fragte er.
Strupp sah mit scharfem Blick zu ihm auf; er hatte die Geschichte viele Male gehört.
»Erzählt sie mir, o König«, erwiderte er ruhig.
Johan der Priester lächelte, ließ aber den lederumwundenen Griff vor sich nicht aus den Augen. »Ein Schwert, kleiner Freund, ist die Verlängerung der rechten Hand eines Mannes … und der Endpunkt seines Herzens.« Er hob die Klinge höher, bis sich ein Lichtschimmer aus einem der winzigen, hohen Fenster darin fing. »Genauso ist der Mensch die gute rechte Hand Gottes – er ist der Scharfrichter von Gottes Herz. Verstehst du?«
Jäh beugte er sich hinab, die Augen unter buschigen Brauen vogelblank. »Weißt du, was das ist?« Seine zitternden Finger deuteten auf ein Stückchen krummes, rostiges Metall, das mit Golddraht im Heft des Schwertes befestigt war.
»Sagt es mir, Herr.« Strupp wusste es ganz genau.
»Das ist der einzige Nagel des wahren Richtbaumes, den es in Osten Ard noch gibt.« Johan der Priester führte den Schwertgriff an die Lippen und küsste ihn. Dann hielt er das kühle Metall an die Wange. »Dieser Nagel stammt aus der Handfläche von Usires Ädon, unserem Erlöser … aus seiner Hand …« Die Augen des Königs, in die von oben ein seltsames Halblicht fiel, waren feurige Spiegel.
»Und dann ist da natürlich auch die Reliquie«, fügte er nach einem Augenblick des Schweigens hinzu, »der Fingerknochen Sankt Eahilstans des Gemarterten, des vom Drachen Getöteten, genau hier im Griff …«
Wieder eine Pause der Stille. Als Strupp aufblickte, hatte sein Gebieter von neuem angefangen zu weinen.
»Pfui, pfui über alles!«, stöhnte Johan. »Wie kann ich mich der Ehre Gottes würdig erweisen, wenn immer noch so viel Sünde, solch schwere Sündenlast, meine Seele befleckt? Ach, der Arm, der einst den Drachen erschlug, kann heute kaum noch die Milchtasse heben, geschweige denn das Schwert des Herrn. Ich sterbe, mein lieber Strupp, ich sterbe!«
Der Narr beugte sich vor, löste eine der knochigen Königshände vom Schwertgriff und küsste sie. Der alte König schluchzte.
»Ich bitte Euch, Gebieter«, flehte Strupp. »Weint doch nicht mehr! Alle Menschen müssen sterben – Ihr, ich, jedermann. Bringen uns nicht jugendliche Torheit oder ein Missgeschick zu Tode, so ist es unser Schicksal, dahinzuleben wie die Bäume, älter und älter zu werden, bis wir endlich schwanken und stürzen. So geht es mit allen Dingen. Wie könnt Ihr Euch dem Willen des Herrn widersetzen?«
»Aber ich habe dieses Reich gegründet!« Johan Presbyter erfüllte bebender Zorn, als er die Hand aus dem Griff des Narren riss und sie jäh auf die Armlehne des Thrones fallen ließ. »Das muss jeden Sündenfleck auf meiner Seele aufwiegen, so schwarz er auch sein mag! Ganz gewiss wird der Gute Gott das in seinem Rechnungsbuch stehen haben! Ich zog diese Menschen aus dem Schlamm, geißelte die verfluchten, heimtückischen Sithi aus dem Land, gab den Bauern Recht und Gesetz … das Gute, das ich getan habe, muss schwer wiegen.« Seine Stimme wurde vorübergehend schwächer, als wanderten seine Gedanken in die Ferne.
»Ach, mein alter Freund«, meinte er endlich mit bitterer Stimme, »und jetzt kann ich nicht einmal mehr die Mittelgasse bis zum Marktplatz hinuntergehen! Im Bett muss ich liegen oder mich am Arm jüngerer Männer durch dieses kalte Schloss schleppen. Mein … mein Reich liegt verfaulend auf der Streu, während vor meiner Schlafzimmertür die Diener flüstern und auf Zehenspitzen gehen! Alles in Sünde!«
Die Worte des Königs hallten von den Steinwänden des Saales wider und zerfielen langsam zwischen den tanzenden Staubkörnchen.
Strupp ergriff von neuem die Hand des Herrschers und drückte sie, bis der König seine Fassung wiedergewonnen hatte.
»Nun gut«, bemerkte Johan der Priester nach einiger Zeit, »wenigstens wird mein Elias mit festerer Hand regieren, als ich es jetzt kann. Als ich heute sah, wie hier alles verfällt«, er machte eine Handbewegung, die den ganzen Thronsaal umfasste, »habe ich beschlossen, ihn aus Meremund zurückzurufen. Er muss sich darauf vorbereiten, die Krone zu übernehmen.« Der König seufzte. »Wahrscheinlich sollte ich dieses weibische Geflenne einstellen und dankbar sein, dass ich habe, was viele Könige nicht haben: einen starken Sohn, der mein Reich zusammenhält, wenn ich nicht mehr bin.«
»Zwei starke Söhne, Herr.«
»Pah!« Der König verzog das Gesicht. »Ich könnte Josua vieles nachsagen, aber ich glaube nicht, dass ›Stärke‹ nun unbedingt dazugehört.«
»Ihr seid zu hart mit ihm, Gebieter.«
»Unsinn. Willst du mich belehren? Kennt der Narr den Sohn besser als sein Vater?« Johans Hand zitterte, und sekundenlang schien es, als wolle er sich mühsam erheben. Endlich ließ die Spannung nach.
»Josua ist ein Zyniker«, begann der König mit ruhigerer Stimme weiterzusprechen.
»Ein Zyniker, ein Melancholiker, kalt und boshaft zu seinen Untertanen. Ein Königssohn ist ja gottgegeben nur von Untertanen umgeben – und jeder Einzelne davon kann ein Meuchelmörder sein. Nein, Strupp, er ist seltsam, mein Jüngerer, vor allem, seit … seit er die Hand verlor. Ach, barmherziger Ädon, vielleicht ist es meine Schuld.«
»Was meint Ihr, Herr?«
»Ich hätte mir vielleicht eine neue Frau nehmen sollen, nach Ebekahs Tod. Ein kaltes Haus war es ohne Königin … vielleicht ist das der Grund für das merkwürdige Wesen des Jungen. Aber Elias ist trotzdem nicht so.«
»Prinz Elias’ Wesen ist von einer gewissen rohen Geradlinigkeit«, murmelte der Narr, aber falls der König es hörte, ließ er es sich nicht anmerken.
»Ich danke dem wohltätigen Gott, dass Elias der Erstgeborene ist. Hat einen tapferen, kriegerischen Charakter, der Junge – ich glaube, wenn er der Jüngere wäre, säße Josua nicht sicher auf dem Thron.«
Bei dem Gedanken schüttelte der König den Kopf, tastete dann nach unten, packte seinen Narren beim Ohr und kniff ihn, als sei der kleine Alte ein Kind von fünf oder sechs Jahren.
»Versprich mir eins, Strupp …«
»Ja, Herr?«
»Wenn ich sterbe – und das wird bald sein, denn ich glaube nicht, dass ich den Winter überlebe –, musst du Elias in diesen Saal führen … meinst du, dass die Krönung hier stattfinden wird? Und wenn schon – dann musst du eben warten, bis sie vorbei ist. Anschließend bring ihn her und gib ihm Hellnagel. Ja, nimm das Schwert jetzt an dich und verwahre es. Ich fürchte, dass ich vielleicht schon sterbe, während er noch weit weg ist, in Meremund oder an einem anderen Ort, und ich möchte, dass das Schwert mit meinem Segen ohne Umwege in seine Hände gelangt. Verstehst du mich, Strupp?«
Mit zittrigen Händen schob Johan der Priester das Schwert in die geprägte Scheide zurück und bemühte sich einen Augenblick vergeblich, das Wehrgehenk abzuschnallen, an dem sie befestigt war. Die Verschnürung hatte sich verhakt, und der Narr erhob sich auf die Knie, um mit seinen kräftigen alten Fingern den verzwickten Knoten zu lösen.
»Wie lautet der Segen, Herr?«, fragte er, die Zunge zwischen den Zähnen, während er an dem Knotengewirr herumzupfte.
»Sag ihm das, was ich dir gesagt habe. Erzähl ihm, dass das Schwert die Spitze seines Herzens und seiner Hand ist, so wie wir die Werkzeuge von Herz und Hand Gottvaters sind … und sag ihm, dass kein Preis, und sei er noch so edel, es wert ist … es wert ist …« Der König zögerte und führte die bebenden Finger an die Augen.
»Nein, vergiss das. Sprich nur von dem, was ich dir über das Schwert erzählt habe. Das genügt.«
»Ich werde es tun, mein Gebieter«, erwiderte Strupp. Er runzelte die Stirn, obwohl er den Knoten gelöst hatte. »Ich werde Euren Wunsch mit Freuden erfüllen.«
»Gut.« Johan der Priester lehnte sich wieder in seinen Drachenbeinthron zurück und schloss die Augen. »Sing mir noch etwas, alter Freund.«
Und Strupp sang. Die verstaubten Banner über ihnen schienen ganz leise zu schwanken, als wandere ein Flüstern durch die zuschauende Menge, durch die uralten Reiher und trübäugigen Bären und die anderen, die noch fremdartiger waren.
2Eine Zwei-Frosch-Geschichte
Müßiggang ist aller Laster Anfang. Über diesen Spruch, eine von Rachels Lieblingsweisheiten, dachte Simon missmutig nach, als er auf das Sortiment von Pferdepanzerteilen starrte, die jetzt über die ganze Länge der Wandelhalle des Burgpfarrers verstreut lagen. Nur einen Augenblick vorher war er noch vergnügt den langen, mit Steinplatten gefliesten Gang hinuntergehüpft, der an der äußeren Längswand der Kapelle entlangführte, auf dem Weg zu Doktor Morgenes’ Wohnung, die er ausfegen sollte. Natürlich hatte er ein bisschen mit dem Besen herumgefuchtelt und sich vorgestellt, es wäre die Baum-und-Drachen-Fahne der Erkyngarde von Johan Presbyter, die er, Simon, gerade in die Schlacht führte. Vielleicht hätte er besser aufpassen müssen, wo er mit dem Besen herumwedelte – aber welcher Trottel hängte auch eine Pferderüstung in die Wandelhalle des Pfarrers? Unnötig zu erwähnen, dass es gewaltig schepperte und Simon jede Sekunde damit rechnete, dass der dürre, rachsüchtige Vater Dreosan herunterkommen würde.
Hastig machte sich Simon daran, die schmuddligen Panzerplatten aufzusammeln, von denen einige aus den Lederriemen gerissen waren, welche die Rüstung zusammenhielten. Dabei dachte er über einen anderen von Rachels Grundsätzen nach: Für leere Hände findet der Teufel schon eine Arbeit. Das war natürlich töricht und erbitterte ihn. Schließlich waren es nicht die Leere seiner Hände oder die Müßigkeit seiner Gedanken, die ihn in Schwierigkeiten brachten. Nein, es waren vielmehr sein Tun und Denken, die ihm immer wieder ein Bein stellten. Wenn sie ihn nur in Ruhe lassen wollten!
Vater Dreosan war immer noch nicht aufgetaucht, als Simon endlich alle Teile der Rüstung auf einen wackligen Haufen geschichtet und diesen dann eilig unter die Kante eines Tischbehangs geschoben hatte. Dabei hätte er fast noch den auf dem Tisch stehenden goldenen Reliquienbehälter umgeworfen. Aber endlich war, ohne weiteres Missgeschick, die verräterische Rüstung außer Sicht, und nur ein blasser Fleck an der Wand deutete noch darauf hin, dass es überhaupt jemals eine solche Rüstung gegeben hatte. Simon ergriff seinen Besen und schabte damit eifrig über den rußigen Stein, um die Ränder zu verwischen, damit der helle Fleck nicht so auffiel. Dann rannte er weiter den Gang hinunter und an der Wendeltreppe zur Chorempore hinaus ins Freie.
Als er von neuem den Heckengarten erreichte, aus dem ihn der Drache gerade so grausam entführt hatte, hielt Simon einen Augenblick inne, um den stechenden Geruch von grünem Laub einzuatmen und so die letzten Reste des Talgseifengestanks aus seiner Nase zu vertreiben. Ein ungewöhnliches Gebilde in den oberen Zweigen der Festeiche zog seinen Blick auf sich. Der Baum am entfernten Ende des Gartens war uralt, knorrig und hatte derart ineinandergewachsene Äste, dass er aussah, als wäre er jahrhundertelang unter einem riesigen Scheffelkorb weitergewachsen. Simon kniff die Augen zusammen und hob die Hand gegen das schräg einfallende Sonnenlicht. Ein Vogelnest! Und so spät im Jahr!
Es war knapp. Schon hatte er den Besen fallen gelassen und war mehrere Schritte in den Garten hineingelaufen, als ihm einfiel, dass er ja mit einem Auftrag zu Morgenes geschickt worden war. Keine andere Aufgabe hätte Simon daran gehindert, in einer Sekunde auf dem Baum zu sein, aber ein Besuch beim Doktor war eine besondere Vergünstigung, selbst wenn er mit Arbeit verbunden war. Simon nahm sich vor, das Nest nicht lange unerforscht zu lassen, und setzte seinen Weg fort, zwischen den Hecken hindurch und in den Hof vor dem Inneren Zwingertor.
Zwei Gestalten hatten soeben das Tor durchschritten und kamen auf ihn zu; die eine langsam und kurzbeinig, die andere noch langsamer und noch kurzbeiniger. Es waren Jakob der Wachszieher und sein Gehilfe Jeremias. Letzterer trug einen großen, schwer aussehenden Sack über der Schulter und bewegte sich, soweit das überhaupt möglich war, noch träger als sonst. Simon rief ihnen im Vorbeilaufen einen Gruß zu. Jakob lächelte und winkte.
»Rachel will neue Kerzen für den Speisesaal«, rief der Wachszieher, »also bekommt sie Kerzen!« Jeremias machte eine saure Miene.
Ein kurzer Trab den grasigen Abhang hinunter brachte Simon an das massive Torhaus. Über den Zinnen hinter ihm schwelte noch ein Splitter Nachmittagssonne, und die Schatten der Banner auf der Westmauer huschten wie dunkle Fische über das Gras. Der rotweiß uniformierte Wächter, kaum älter als Simon, lächelte, als der Meisterspion vorüberjagte, in der Hand den tödlichen Besen, das Haupt gesenkt für den Fall, dass die Tyrannin Rachel zufällig aus einem der hohen Turmfenster blicken sollte.
Sobald Simon unter dem Fallgitter durch und im Schatten der hohen Tormauer allen Blicken entzogen war, verlangsamte er seinen Schritt wieder. Der unbestimmte Schatten des Engelsturms überbrückte den Burggraben; die verzerrte Silhouette des grünen Engels, der auf seiner Turmspitze triumphierte, lag am äußersten Rand des Wassers in einer Lache aus Feuer.
Wenn er schon hier war, entschied Simon, konnte er genauso gut ein paar Frösche fangen. Es würde nicht allzu lange dauern, und der Doktor konnte sie meist gut gebrauchen. Es würde nicht einmal bedeuten, dass er seinen Auftrag hinausschob, sondern war vielmehr eine Erweiterung seines Dienstes. Allerdings würde er sich beeilen müssen, der Abend rückte rasch näher. Simon konnte bereits hören, wie sich die Grillen mühsam auf eine der letzten Vorstellungen des schwindenden Jahres einstimmten und die Ochsenfrösche mit ihrem unterdrückten, dumpf dröhnenden Kontrapunkt einsetzten.
Der Junge stieg in das mit Seerosen bedeckte Wasser, hielt kurz lauschend inne und sah zu, wie sich der östliche Himmel zu mattem Violett verdunkelte. Neben Doktor Morgenes’ Wohnung war der Burggraben sein liebster Ort in der ganzen Schöpfung … jedenfalls von dem, was er bisher davon gesehen hatte. Mit einem unbewussten Seufzer zog er den formlosen Stoffhut vom Kopf und watete an die Stelle, wo Teichgras und Hyazinthen am dichtesten standen. Als Simon endlich am Mittleren Zwinger ankam, war die Sonne bereits untergegangen, und der Wind pfiff durch die Katzenschwänze, die um den Burggraben herum wuchsen. Mit triefenden Kleidern, in jeder Tasche einen Frosch, stand der Junge vor Morgenes’ Tür. Er klopfte an die dicke Täfelung und achtete dabei sorgfältig darauf, das fremdartige Symbol nicht zu berühren, das mit Kreide auf das Holz gemalt war. Einige schmerzhafte Erfahrungen hatten ihn gelehrt, nichts, was dem Doktor gehörte, ungefragt anzufassen. Eine kleine Weile verging, bevor Morgenes’ Stimme sich hören ließ.
»Geht weg«, sagte sie in ärgerlichem Ton.
»Ich bin es … Simon!«, rief der Junge und klopfte nochmals. Diesmal gab es eine längere Pause, gefolgt vom Geräusch schneller Schritte. Die Tür schwang auf, und Morgenes, dessen Kopf kaum bis an Simons Kinn reichte, stand vor ihm. Sein Gesicht lag im Dunkeln, hinter ihm schimmerte die blaue Flurbeleuchtung; einen langen Moment schien er starr vor sich hinzuglotzen.
»Was?«, fragte er endlich. »Wer?«
Simon lachte. »Na, ich natürlich. Möchtet Ihr ein paar Frösche?« Er zog einen der Gefangenen aus seinem Verlies und hielt ihn an einem glibbrigen Bein in die Höhe.
»Oh, oh!« Der Doktor schien wie aus tiefem Schlaf zu erwachen. Er schüttelte den Kopf. »Simon … aber natürlich! Komm herein, Junge! Du musst mich entschuldigen – ich bin ein wenig zerstreut.« Er öffnete die Tür so weit, dass Simon an ihm vorbei in den schmalen Innengang schlüpfen konnte, und schloss sie dann wieder.
»Frösche, wie? Hmmm, Frösche …« Morgenes stakste den Korridor hinunter. Im Glühen der blauen Lampen, die den Gang säumten, schien die dürre Gestalt des Doktors wie ein Affe zu hüpfen, anstatt zu gehen. Simon, dessen Schultern die kalten Wände zu beiden Seiten fast berührten, folgte. Er hatte noch nie verstehen können, wie Räumlichkeiten, die von außen so klein wirkten wie die des Doktors – und er hatte von den Mauern des Zwingers auf sie hinabgeschaut und war im Hof ihre Ausdehnung abgegangen –, wie so eine kleine Wohnung derart lange Korridore haben konnte.
Simons Grübelei wurde von einem plötzlichen Höllenlärm unterbrochen: Pfiffe, Knallen und etwas, das wie das hungrige Gebell von hundert Hunden klang.
Morgenes machte einen überraschten Satz und sagte: »O Name eines Namens, ich habe vergessen, die Kerzen zu löschen. Warte hier.« Mit flatternden weißen Haarsträhnen rannte der kleine Mann den Gang hinunter, öffnete die Tür am Ende einen winzigen Spalt – das Heulen und Pfeifen schwoll an – und huschte schnell hinein. Simon vernahm einen erstickten Ausruf.
Jäh verstummte der entsetzliche Lärm – so schnell und vollständig, als ob … als ob man eine Kerze auslöscht, dachte Simon.
Der Doktor streckte den Kopf heraus, lächelte und winkte den Jungen herein.
Simon, der schon früher Szenen dieser Art erlebt hatte, folgte dem alten Mann vorsichtig in sein Studierzimmer. Ein hastiges Eintreten konnte – und das war noch das Wenigste – bedeuten, dass man auf irgendetwas Sonderbares trat, dessen Bekanntschaft man nicht unbedingt machen wollte.
Von den Urhebern des grässlichen Geheuls war keine Spur mehr zu erkennen. Wieder staunte Simon über den Unterschied zwischen dem, was Morgenes’ Wohnung zu sein schien – eine umgebaute Wachkaserne von vielleicht zwanzig Schritt Länge, die sich unauffällig an die efeuüberwucherte Mauer der Nordostecke des Mittleren Zwingers schmiegte –, und ihrem Anblick von innen, der ein weitläufiges Zimmer offenbarte, das zwar eine niedrige Decke hatte, aber beinahe so lang wie ein Turnierplatz war, wenn auch weitaus schmaler. Im orangefarbenen Licht, das durch die lange Reihe kleiner Fenster zum Hof hereinsickerte, spähte Simon nach dem hintersten Ende des Raumes und stellte fest, dass er große Mühe haben würde, es von der Tür aus, in der er stand, mit einem Stein zu treffen.
Aber dieser merkwürdige Dehneffekt war ihm durchaus vertraut. Tatsächlich sah das ganze Zimmer trotz der angsteinflößenden Geräusche eigentlich aus wie immer – so als hätte eine Horde geistesgestörter Krämer ihre Verkaufstische aufgebaut und dann mitten in einem wilden Sturmwind jäh die Flucht ergriffen. Der große Refektoriumstisch, der sich über die ganze Länge der einen Wand ausdehnte, war übersät mit Rillenglasröhren, Kästen und Tuchbeuteln mit Pulvern und stechenden Salzen sowie mit komplizierten Konstruktionen aus Holz und Metall, an denen Retorten und Phiolen und andere undefinierbare Behälter hingen. Den Mittelpunkt des Tisches bildete eine gewaltige Messingkugel, aus deren glänzender Oberfläche winzige, abgewinkelte Ausgusstüllen hervorragten. Sie schien in einer Schüssel mit silbriger Flüssigkeit zu schwimmen, und Schüssel und Kugel balancierten auf der Spitze eines Dreifußes aus geschnitztem Elfenbein. Den Tüllen entströmte Dampf, und der Messingball drehte sich langsam um sich selbst.
Auf Fußboden und Wandregalen wimmelte es von noch seltsameren Dingen. Polierte Steinblöcke, Kehrbesen und lederne Schwingen lagen auf den steinernen Platten verstreut und machten sich mit Tierkäfigen, teils leer, teils besetzt, den Platz streitig, mit Metallgerüsten voller zerrupfter Pelze oder nicht zusammenpassender Federn unbekannter Geschöpfe, mit Platten aus scheinbar klarem Kristall, die sich an den mit Gobelins verzierten Wänden stapelten … und mit Büchern, überall mit Büchern – halb geöffnet fallen gelassene oder hier und da im Zimmer aufgestellte Bücher, die wie riesenhafte, plumpe Schmetterlinge aussahen.
Es gab auch Glaskugeln mit farbigen Flüssigkeiten, die, ohne dass sie erhitzt wurden, vor sich hinblubberten, und eine flache Schachtel mit glitzerndem schwarzem Sand, der sich unaufhörlich neu formte, als fegten ihn unmerkliche Wüstenwinde. Von Zeit zu Zeit würgten hölzerne Wandschränkchen bemalte Holzvögel hervor, die unverschämt piepten und wieder verschwanden. Daneben hingen Karten von Ländern mit gänzlich fremdartiger Geografie – wobei Geografie zugegebenermaßen ein Gebiet war, auf dem sich Simon ohnehin nicht sonderlich sicher fühlte. Alles in allem war die Höhle des Doktors ein Paradies für einen wissbegierigen jungen Mann … ganz ohne Zweifel der wunderbarste Ort in ganz Osten Ard.
Morgenes war inzwischen am anderen Ende des Raumes unter einer schlaff herabhängenden Sternkarte auf und ab gewandert. Sie verband die hellen Himmelspunkte durch eine gemalte Linie, sodass die Gestalt eines seltsamen Vogels mit vier Flügeln entstand. Mit einem kleinen triumphierenden Pfiff beugte der Doktor sich plötzlich nach unten und fing an zu graben wie ein Eichhörnchen im Frühling. Hinter ihm erhob sich ein Schneegestöber aus Schriftrollen, bunt bemalten Lappen, Miniaturgeschirr und winzigen Pokalen, die offenbar vom Abendbrottisch irgendeines Zwergen stammten. Endlich richtete er sich wieder auf, wuchtete einen großen Kasten mit Glaswänden in die Höhe, watete zum Tisch, stellte den Glaswürfel hin und griff sich, offenbar wahllos, von einem Gestell ein Flaschenpaar.
Die Flüssigkeit in der einen hatte die Farbe des Sonnenuntergangs draußen; sie schmauchte wie ein Weihrauchfässchen. Die andere Flasche war mit etwas Blauem und Zähflüssigem gefüllt, das, als Morgenes die beiden Flaschen umdrehte, ganz, ganz langsam in den Kasten rann. Als sie sich vermischten, wurden die beiden Flüssigkeiten so klar wie Bergluft. Der Doktor breitete seine Arme aus wie ein fahrender Künstler. Einen Augenblick herrschte Stille.
»Frösche?«, fragte er dann und wedelte mit den Fingern. Simon sprang herbei und zog die beiden Tiere, die in seinen Manteltaschen steckten, hervor. Der Doktor ergriff sie und warf sie mit schwungvoller Gebärde in das Aquarium. Die beiden verblüfften Amphibien plumpsten in die durchsichtige Flüssigkeit, sanken langsam auf den Grund und begannen dann energisch in ihrem neuen Heim umherzuschwimmen. Simon lachte erstaunt und erheitert.
»Ist das Wasser?«
Der alte Mann drehte sich um und blickte ihn mit hellen Augen an. »Mehr oder weniger, mehr oder weniger … so!« Morgenes fuhr sich mit langen, verkrümmten Fingern durch den schütteren Bartkranz. »Soso … hab Dank für die Frösche. Ich glaube, ich weiß schon, was ich mit ihnen anfange. Völlig schmerzlos. Vielleicht macht es ihnen sogar Spaß, obwohl ich nicht glaube, dass sie die Stiefel gern anziehen werden.«
»Stiefel?«, wunderte sich Simon, aber der Doktor wuselte schon wieder im Zimmer herum. Jetzt schob er einen Stapel Landkarten von einem niedrigen Hocker und winkte Simon, sich hinzusetzen.
»Nun also, junger Mann, welche Münze schulde ich dir für dein Tagwerk? Ein Fithingstück? Oder vielleicht möchtest du lieber Coccindrilis hier als Haustier?« Kichernd schwang der Doktor eine mumifizierte Eidechse vor Simons Gesicht durch die Luft.
Bei der Eidechse zögerte Simon einen Augenblick – es musste herrlich sein, sie in den Wäschekorb zu schmuggeln, damit sie dort von dem neuen Mädchen Hepzibah entdeckt würde … Der Gedanke an Kammermädchen und Saubermachen wollte sich in seinem Kopf festsetzen und erfüllte ihn mit Unruhe; irgendetwas verlangte, dass er sich daran erinnerte, aber Simon verdrängte es. »Nein«, sagte er schließlich, »ich würde lieber ein paar Geschichten erzählt bekommen.«
»Geschichten?« Fragend beugte sich Morgenes vor. »Geschichten? Du solltest lieber zum alten Shem Pferdeknecht in die Ställe gehen, wenn du so etwas hören möchtest.«
»Nicht diese Art«, erklärte Simon schnell. Hoffentlich hatte er den Doktor nicht gekränkt; alte Leute waren so empfindlich. »Ich meine Geschichten über wirkliche Dinge. Wie es früher war … Schlachten, Drachen – über das, was sich tatsächlich ereignet hat!«
»Aaahh.« Morgenes setzte sich auf, und das Lächeln kehrte in sein rosiges Gesicht zurück. »Jetzt verstehe ich. Du meinst Geschichte, nicht Geschichten.« Der Doktor rieb sich die Hände. »Das ist besser – viel besser!« Er sprang auf und begann umherzuwandern, wobei er gewandt über das auf dem Fußboden verstreute Gerümpel stieg. »Nun, wovon möchtest du hören, Junge? Vom Untergang Naarveds? Von der Schlacht von Agh Samrath?«
»Erzählt mir von der Burg«, bat Simon. »Vom Hochhorst. Hat sie der König erbaut? Wie alt ist sie?«
»Die Burg …« Der Doktor hörte mit seinen Wanderungen auf, raffte einen Zipfel seines abgetragenen, speckig-grauen Gewandes und rieb damit geistesabwesend an einem von Simons liebsten Wunderdingen herum, einer Rüstung von exotischem Schnitt, in grellen Blau- und Gelbtönen der Wildblumen gefärbt und ganz und gar aus poliertem Holz gefertigt.
»Hmmm … die Burg …«, wiederholte Morgenes. »Ja, das ist in der Tat eine Zwei-Frosch-Geschichte, zum allermindesten. Wenn ich sie dir wirklich ganz erzählen sollte, müsstest du wohl den Burggraben trockenlegen und mir deine warzige Beute fuderweise bringen, um dafür zu bezahlen. Aber für heute, glaube ich, tut es erst einmal das nackte Gerüst der Geschichte, und das kann ich dir jedenfalls geben. Halte einen Augenblick Ruhe, bis ich etwas gefunden habe, um mir die Kehle anzufeuchten.«
Während Simon versuchte, ganz still zu sitzen, ging Morgenes an seinen langen Tisch und griff nach einem Becher mit brauner, schäumender Flüssigkeit. Misstrauisch schnüffelte er daran, hob dann den Becher an die Lippen und nahm einen kleinen Schluck.
Den Geschmack prüfend hielt er einen Moment inne, leckte sich dann die kahle Oberlippe und zupfte beglückt an seinem Bart.
»Ah, dieses Stanshire-Dunkel. Da gibt es keinen Zweifel, nichts geht über Bier! Also, worüber sprachen wir? Ach ja, die Burg.« Morgenes räumte eine Stelle des Tisches leer und sprang dann, sorgsam seinen Becher festhaltend, mit verblüffender Behendigkeit in die Höhe und ließ sich auf der Tischplatte nieder, wobei seine Füße in ihren Pantoffeln eine halbe Elle über dem Boden baumelten. Wieder nahm er einen Schluck.
»Ich fürchte, diese Geschichte beginnt lange vor unserem König Johan. Fangen wir mit den ersten Männern und Frauen an, die nach Osten Ard gelangten – einfachen Leuten, die an den Ufern des Gleniwent lebten. Sie waren größtenteils Hirten und Fischer, vielleicht Vertriebene, die über eine Landbrücke, die heute nicht mehr vorhanden ist, aus dem verlorenen Westen kamen. Sie machten den Herrschern von Osten Ard wenig Schwierigkeiten.«
»Aber ich dachte, Ihr sagtet, sie seien als Erste hierhergekommen?«, unterbrach Simon, der sich insgeheim freute, den Doktor bei einem Widerspruch ertappt zu haben.
»Nein, ich sagte, sie waren die ersten Menschen. Die Sithi beherrschten dieses Land, lange bevor ein Mensch es betrat.«
»Ihr meint, es gab wirklich ein Kleines Volk?« Simon grinste. »So wie Shem Pferdeknecht erzählt? Pukas und Niskies und so weiter?« Das war aufregend.
Morgenes schüttelte heftig den Kopf und nahm einen weiteren Schluck. »Es gab sie nicht nur, es gibt sie – obwohl das meiner Erzählung vorgreift –, und sie sind ganz und gar kein ›Kleines Volk‹ … warte, Junge, lass mich weiterreden.«
Simon beugte sich ein wenig vor und gab sich Mühe, geduldig auszusehen.
»Ja?«
»Nun, wie gesagt, Menschen und Sithi waren friedliche Nachbarn. Sicher gab es gelegentlich Auseinandersetzungen wegen Weideland oder ähnlichen Dingen, aber da die Menschen ihnen nicht als wirkliche Bedrohung erschienen, war das Schöne Volk großzügig. Im Lauf der Zeit begannen die Menschen dann, Städte zu bauen, manchmal nur den Fußmarsch eines halben Tages von dem Gebiet der Sithi entfernt.
Noch später entstand auf der felsigen Halbinsel Nabban ein großes Königreich, und die Sterblichen von Osten Ard begannen, sich seiner Führung unterzuordnen. Kannst du mir noch folgen, Junge?«
Simon nickte.
»Gut.« Ein langer Zug aus dem Becher. »Nun, das Land schien groß genug für alle, bis schwarzes Eisen über das Wasser kam.«
»Was? Schwarzes Eisen?« Der scharfe Blick des Doktors ließ Simon sofort wieder verstummen.
»Die Schiffer aus dem fast vergessenen Westen, die Rimmersmänner«, fuhr Morgenes fort, »sie landeten im Norden, bewaffnete Männer, wild wie Bären. In langen Schlangenbooten kamen sie.«
»Die Rimmersmänner?«, fragte Simon erstaunt. »Wie Herzog Isgrimnur am Hof? In Booten?«
»Sie waren große Seefahrer, ehe sie hier sesshaft wurden, die Ahnen des Herzogs«, bestätigte Morgenes. »Aber als sie landeten, waren sie zunächst nicht auf der Suche nach Weide- oder Ackerland, sondern auf Raub aus. Doch das Wichtigste war, dass sie das Eisen mitbrachten, oder zumindest das Geheimnis seiner Bearbeitung. Sie schmiedeten eiserne Schwerter und Speere, Waffen, die nicht zerbrachen wie die Bronze von Osten Ard; Waffen, die selbst das Hexenholz der Sithi bezwingen konnten.«
Morgenes sprang auf den Boden und füllte seinen Becher aus einem zugedeckten Eimer, der auf einem Turm von Büchern an der Wand stand. Statt an den Tisch zurückzugehen, blieb er stehen und strich über die glänzenden Schulterstücke der Rüstung.
»Niemand leistete ihnen lange Widerstand – der kalte, harte Geist des Eisens schien die Schiffer selbst ebenso zu erfüllen wie ihre Klingen. Viele Leute flohen nach Süden, in den Schutz der nahen nabbanischen Grenzstationen. Die Nabbani-Legionen, gut organisierte Garnisonsstreitkräfte, leisteten eine Zeitlang erfolgreich Widerstand. Aber endlich mussten sie doch den Rimmersmännern die Frostmark überlassen. Es … gab große Gemetzel.«
Simon rutschte begeistert hin und her. »Und die Sithi? Ihr habt gesagt, sie hatten kein Eisen?«
»Es war tödlich für sie.« Der Doktor leckte sich den Finger und rieb einen Fleck vom polierten Holz der Brustplatte.
»Auch sie konnten die Rimmersmänner nicht in offener Feldschlacht besiegen, aber«, er wies mit dem staubigen Finger auf Simon, als betreffe die Tatsache den Jungen persönlich, »aber die Sithi kannten ihr Land. Sie waren mit ihm verbunden, waren in gewisser Weise ein Teil davon, wie es die Eindringlinge niemals sein konnten. So hielten sie sich lange Zeit, indem sie sich langsam an Orte zurückzogen, an denen sie ihre Macht behaupten konnten. Und der wichtigste davon – und der Grund dafür, dass ich dir das alles erzähle – war Asu’a, der Hochhorst.«
»Unsere Burg? Die Sithi haben auf dem Hochhorst gewohnt?« Simon konnte den Zweifel in seiner Stimme nicht unterdrücken. »Wann ist die Burg denn erbaut worden?«
»Simon, Simon …« Der Doktor kratzte sich am Ohr und setzte sich wieder auf den Tisch. Aus den Fenstern war der Sonnenuntergang inzwischen gänzlich verschwunden, und das Fackellicht teilte Morgenes’ Gesicht in zwei Teile wie eine Maske beim Mummenschanz, halb beleuchtet, halb im Dunkeln. »Vielleicht – nach allem, was ich und alle anderen Sterblichen überhaupt wissen können – stand hier schon eine Burg, bevor noch die Sithi selbst ins Land kamen … damals, als Osten Ard so neu und rein war wie ein Bach aus geschmolzenem Schnee. Gewiss aber lebte das Volk der Sithi hier schon ungezählte Jahre, ehe der Mensch erschien. Dies ist der erste Ort in Osten Ard, der das Werk gestaltender Hände war. Es ist die mächtigste Stelle des Landes, der Ort, der die Wasserwege beherrscht und über das beste Ackerland gebietet. Der Hochhorst und seine Vorgänger, die noch älteren Festungen, die unter uns begraben liegen, haben hier gestanden, lange bevor die Erinnerung der Menschen einsetzt. Als die Rimmersmänner kamen, war diese Stätte alt, uralt.«
Als die Ungeheuerlichkeit dieser Erklärung in Simons Kopf einzusickern begann, wurde ihm schwindlig. Die alte Burg schien ihm plötzlich bedrückend, ihre Felsenmauern kamen ihm wie ein Käfig vor. Er schauderte und blickte sich hastig um, als griffe jetzt, in dieser Sekunde, etwas Uraltes, Eifersüchtiges mit staubigen Händen nach ihm.
Morgenes lachte fröhlich – ein sehr junges Lachen für einen so alten Mann – und hüpfte vom Tisch herunter. Die Fackeln schienen ein wenig heller zu glühen. »Fürchte dich nicht, Simon. Ich denke – und wer, wenn nicht ich, sollte es wissen –, dass du den Zauber der Sithi nicht zu fürchten brauchst. Heutzutage nicht mehr. Die Burg ist vielfach verändert, Stein wurde auf Stein gesetzt und jede Elle von hundert Priestern kräftig gesegnet. Gewiss, Judith und ihre Küchenhelfer drehen sich vielleicht manchmal um und stellen fest, dass ein Teller mit Kuchen fehlt, aber ich glaube, das kann man mit guten Gründen eher gewissen jungen Männer zuschreiben als Kobolden …«
Eine kurze Folge von Klopftönen an der Zimmertür unterbrach den Doktor. »Wer ist da?«, rief er.
»Ich bin’s«, erwiderte eine trübselige Stimme. Es folgte eine lange Pause. »Ich, Inch«, beendete die Stimme ihre Erklärung.
»Bei Anaxos’ Gebeinen«, fluchte der Doktor, der exotische Ausdrücke bevorzugte. »Dann mach die Tür auf … ich bin zu alt, um herumzurennen und Narren zu bedienen!«
Die Tür schwang nach innen. Der vom Glühen des inneren Korridors eingerahmte Mann war groß, ließ aber den Kopf derart hängen und den Körper vornüberkippen, dass man es ihm nicht auf den ersten Blick ansah. Unmittelbar über seinem Brustbein schwebte ein rundes, leeres Gesicht wie ein Mond, auf dem ein Strohdach aus stachligem, schwarzem Haar thronte, das man mit einem stumpfen Messer ungeschickt geschnitten hatte.
»Tut mit leid, wenn ich Euch gestört habe, Doktor, aber … aber Ihr habt gesagt, ›komm früh‹, sagtet Ihr nicht so?« Die Stimme war dick und zähflüssig wie triefendes Fett.
Morgenes stieß einen ärgerlichen Pfiff aus und zupfte an einer Strähne seines weißen Haares. »Ja, das habe ich, aber ich sagte, früh nach der Essenszeit, die noch gar nicht gekommen ist. Nun, es hat keinen Sinn, dich jetzt wieder wegzuschicken. Simon, kennst du Inch, meinen Gehilfen?«
Simon nickte höflich. Er hatte den Mann ein paarmal gesehen; Morgenes ließ ihn manchmal abends kommen, wenn er Hilfe brauchte, wohl beim Heben schwerer Gegenstände. Anderes kam kaum in Frage, denn Inch machte den Eindruck, als könne man sich nicht einmal darauf verlassen, dass er vor dem Schlafengehen das Feuer auspinkelte.
»Als dann, junger Mann, ich fürchte, das setzt meiner Geschwätzigkeit für heute ein Ende«, bemerkte der Doktor. »Da Inch nun einmal hier ist, muss ich auch Gebrauch von ihm machen. Komm bald wieder, dann erzähle ich dir mehr – wenn du willst.«
»Bestimmt.« Simon nickte Inch noch einmal zu, der die Augen nach ihm rollte wie eine Kuh, und war schon an der Tür, als ihm flammend eine jähe Vision durch den Kopf schoss: ein klares Bild von Rachels Besen, der da lag, wo er ihn fallen gelassen hatte, im Gras am Burggraben, wie der Leichnam eines seltsamen Wasservogels.
Mondkalb!
Er würde gar nichts sagen. Er würde auf dem Rückweg den Besen mitnehmen und dem Drachen sagen, es sei alles erledigt. Sie hatte so viel um die Ohren und redete auch nur selten mit dem Doktor, obwohl sie und er zu den ältesten Bewohnern der Burg gehörten. Ja, das war offensichtlich der beste Plan.
Ohne zu verstehen, warum, drehte Simon sich um. Der kleine Mann inspizierte gerade, über den Tisch gebeugt, eine Schriftrolle, während Inch hinter ihm stand und nur in die Luft stierte.
»Doktor Morgenes …«
Beim Klang seines Namens sah der alte Mann auf und blinzelte. Er schien erstaunt, dass Simon sich noch im Zimmer befand, ganz wie dieser selbst darüber erstaunt war.
»Doktor, ich bin ein Dummkopf.«
Morgenes hob die Brauen und wartete.
»Ich sollte Euer Zimmer ausfegen. Rachel hat mich damit beauftragt. Jetzt ist der ganze Nachmittag einfach so verstrichen.«
»Oh. Ah!« Morgenes’ Nase kräuselte sich, als jucke sie ihn. Dann zog ein breites Lächeln über sein Gesicht. »Mein Zimmer ausfegen, was? Gut, Junge, komm morgen wieder und mach das. Sag Rachel, ich hätte noch mehr Arbeit für dich, falls sie dich freundlicherweise entbehren könnte.« Er wandte sich wieder seinem Buch zu, sah dann erneut zu Simon auf, kniff die Augen zusammen und biss sich auf die Lippen. Während er so in stillem Nachdenken dasaß, wurde Simon unruhig.
Warum starrt er mich so an?
»Wenn ich mir die Sache recht überlege, Junge«, sagte der Mann endlich, »wird es hier demnächst eine ganze Menge Arbeit geben, bei der du mir helfen könntest – und irgendwann werde ich auch einen Lehrling brauchen. Komm morgen wieder, wie ich gesagt habe. Über das andere will ich mit der Obersten der Kammerfrauen reden.« Er lächelte kurz und beugte sich dann wieder über seine Schriftrolle. Simon merkte plötzlich, dass Inch ihn über den Rücken des Doktors anstarrte; unter der ruhigen Oberfläche seines käsigen Gesichts regte sich etwas Undeutbares. Simon machte kehrt und rannte aus der Tür. Voller Begeisterung sprang er den blau erleuchteten Gang hinunter und tauchte unter dem dunklen, bewölkten Himmel ins Freie. Lehrling! Beim Doktor!
Als er das Torhaus erreichte, machte er halt und kletterte zum Burggraben hinunter, um seinen Besen zu suchen. Die Heimchen waren schon mitten in ihrem Abendchoral. Als Simon den Besen endlich gefunden hatte, hockte er sich einen Augenblick an die Ufermauer und hörte ihnen zu.
Während ringsum der rhythmische Gesang aufstieg, ließ Simon die Finger über die Steine neben sich gleiten. Er strich über die Oberfläche eines Blocks, der so glatt gescheuert war wie handpoliertes Zedernholz. Seltsame Gedanken gingen ihm durch den Kopf: Vielleicht steht dieser Stein schon seit … seit vor der Geburt unseres Herrn Usires an diesem Ort. Vielleicht hat hier in dieser Stille einmal ein Sithijunge gesessen und der Nacht gelauscht …
Woher kommt dieser leichte Wind?
Eine Stimme schien zu flüstern, die Worte zu leise zum Hören. Vielleicht ist er mit der Hand über genau diesen Stein gefahren … Und erneut dieses Flüstern im Wind: Wir holen es uns wieder, Menschenkind. Wir holen uns alles wieder.
Simon raffte seinen Mantelkragen eng gegen die unerwartete Kälte zusammen, stand auf und kletterte den grasigen Hang wieder hinauf. Er hatte plötzlich Sehnsucht nach vertrauten Stimmen und Licht.
3Vögel in der Kapelle
Beim gesegneten Ädon …« Klatsch!
»… und Elysia, seiner Mutter …« Klatsch!
»… und allen Heiligen, die da wachen über …« Klatsch! »… wachen über … autsch!« Ein Zischen ohnmächtiger Wut. »Verfluchtes Spinnenpack!« Das Klatschen begann von neuem, vermischt mit Verwünschungen und Beschwörungen.
Rachel säuberte die Decke des Speisesaales von Spinnweben.
Zwei Mädchen krank, ein weiteres mit verstauchtem Knöchel – es war einer von jenen Tagen, an denen die Achataugen von Rachel dem Drachen so gefährlich funkelten. Schlimm genug, dass Sarrah und Jael an der Ruhr darniederlagen – Rachel war eine harte Zuchtmeisterin, aber sie wusste, dass jeder Tag, den man ein krankes Mädchen weiterarbeiten ließ, drei Tage bedeuten konnte, die es am Ende dann doch länger ausfiel – ja, schlimm genug auch, dass Rachel selbst die Lücken füllen musste, die dadurch entstanden.
Als ob sie nicht ohnehin schon für zwei arbeitete! Und nun erklärte der Seneschall, der König wolle heute Abend in der Großen Halle speisen! Zudem war Elias, der Prinzregent, aus Meremund eingetroffen, und nun gab es noch mehr Arbeit!
Und Simon, den sie vor mindestens einer Stunde losgeschickt hatte, um ein paar Bündel Binsen zu holen, war immer noch nicht zurück.
Da stand sie nun mit ihren müden, alten Knochen auf einem wackligen Hocker und versuchte mit einem Besen die Spinnweben aus den hohen Deckenwinkeln zu entfernen. Dieser Junge! Dieser, dieser …
»Heiliger Ädon, gib mir Kraft …«
Klatsch! Klatsch! Klatsch!
Dieser verflixte Bursche!
Es war ja nicht nur, überlegte Rachel später, als sie mit rotem Gesicht und verschwitzt auf den Hocker gesunken war, dass der Junge faul und schwierig war. All die Jahre hatte sie ihr Bestes getan, die Aufsässigkeit aus ihm herauszuklopfen; ganz bestimmt, das wusste sie, war er dadurch ein besserer Mensch geworden. Nein, bei der Guten Mutter Gottes, viel schlimmer war, dass kein anderer Mensch sich um ihn zu kümmern schien!