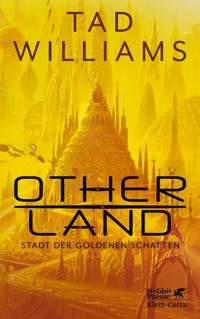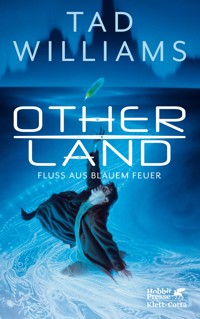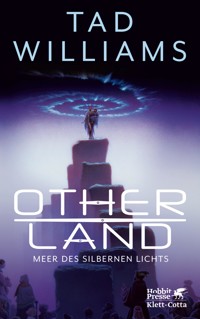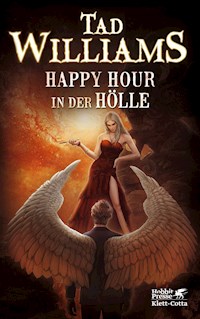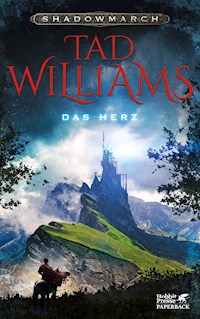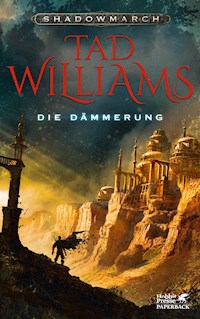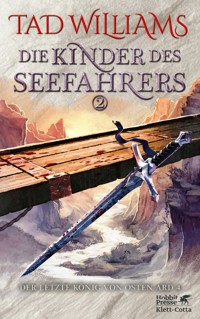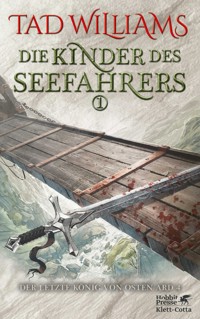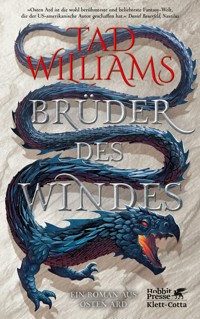
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tausend Jahre vor den Ereignissen, die im Drachenbeinthron geschildert werden: Die (fast) unsterblichen Sithi herrschen über die nördlichen Regionen von Osten Ard. Da tauchen Gerüchte auf, dass einer der ältesten und tödlichsten Drachen von ganz oben im Norden in das Reich eingedrungen ist. Am nächsten Morgen ist einer der beiden Söhne der mächtigsten Familie der Sithi verschwunden … Unter den Sithi Osten Ards gibt es keine anderen zwei, die so geliebt und bewundert werden wie die beiden Söhne der Herrscherfamilie: Hakatri, ein stets verläßlicher Junge, und sein stolzer und leidenschaftlicher kleiner Bruder Ineluki, der spätere Sturmkönig. Sein Temperament reißt den jüngeren hin, einen gleichermaßen kühnen wie schrecklichen Schwur zu leisten: Er will das tödliche und furchtbare Ungeheuer Hidohebhi zur Strecke bringen und vernichten. Aber damit bringt er nicht nur seinen Bruder und sich selbst in die größte Gefahr, sondern er beschwört auch eine Katastrophe für alle Sithi herauf, womöglich sogar auch für das ganze menschliche Geschlecht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tad Williams
Brüder des Windes
Ein Roman aus Osten Ard
Aus dem Amerikanischenvon Cornelia Holfelder-von der Tannund Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Brothers of the Wind« im Verlag DAW, New York
© 2021 Beale Williams Enterprise. All Rights Reserved.
Für die deutsche Ausgabe
© 2022, 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
Illustration: Max Meinzold, München
Karte: Isaac Stewart
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98814-7
E-Book ISBN 978-3-608-11856-8
Inhalt
Erster Teil
Der schwarze Wurm
Zweiter Teil
Der silberne Baum
Dritter Teil
Die weißen Mauern
Vierter Teil
Das graue Land
Fünfter Teil
Das grüne Meer
Widmung
Dank
Für Cindy Yan
Erster Teil
Der schwarze Wurm
Ich unternehme es jetzt, die Geschichte meines Herrn Hakatri zu erzählen oder jedenfalls die Teile, die ich selbst miterlebt habe, doch noch ehe ich beginne, bin ich schon voller Zweifel. Ich kann die Geschichte meines Herrn nicht erzählen, ohne auch von mir zu berichten, aber ich bin nicht mehr der Pamon Kes, der so lange an seiner Seite gereist ist. Das, was uns widerfuhr, hat mich fast so sehr verändert wie ihn, und ich erinnere mich kaum noch an den, der ich damals war. Dennoch: Der Pamon Kes von heute wird sein Bestes tun zu erzählen, was der Pamon Kes von damals in jener schicksalhaften Zeit sah, hörte und fühlte.
Ich habe keine Ahnung, wer diese Worte lesen wird, aber mein Gefühl sagt, ich muss sie niederschreiben. Die Jahre vergehen, irgendwann wird der Tod mir die Augen schließen und mich verstummen lassen. Das Wissen um solch wichtige Geschehnisse gehört nicht mir allein, sondern allen Erben des Verlorenen Gartens.
Trotzdem ist es kein Leichtes, unerfreuliche Wahrheiten auszusprechen, auch wenn man es hinter dem Schild der Ehrlichkeit tut. Viele werden meine Worte mit Hohn und Verachtung aufnehmen, weil ich bin, was ich bin – ein Tinukeda’ya, einer von denen, die oft auch »Wechselwesen« genannt werden und für geringere Kreaturen erachtet werden als unsere Zida’ya-Herren. Aber ich bitte die, die mein Bericht erzürnen könnte, zu verstehen, dass ich mich trotz allem, was geschehen ist, dem Haus der Tanzenden Jahre und dem Volk von Asu’a immer noch in Treue verbunden fühle. Die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, diese Treue zu zeigen und meinen Herrn zu ehren, ist es, die Dinge so darzustellen, wie ich sie in Erinnerung habe, ohne Rücksicht darauf, dass manch einer darüber nicht glücklich sein wird.
»Pflicht ist Ehre«, pflegte mein strenger Vater zu sagen. »Und Ehre ist alles.«
Aber ich würde dem noch etwas hinzufügen. Ich habe gelernt, dass unsere oberste Pflicht die Pflicht zur Wahrheit ist, denn ohne die Wahrheit ist alle Ehre hohl.
Es war in den letzten Tagen des Schlangenmonds, früh in der Zeit der Erneuerung, als das Wetter sich gerade zu ändern begann. Alles schien ganz normal für die Jahreszeit: Der Himmel über der Stadt war, wie schon seit einigen Tagen, kalt, aber hell, und viele Vögel sangen.
In der Früh, nachdem ich ein Gebet an den Verlorenen Garten gerichtet hatte, ging ich in die großen Stallungen des Palastes, um die Pflege der Pferde meines Herrn und die Morgenfütterung zu beaufsichtigen und dabei zu schauen, ob alle Tiere in bester Verfassung waren oder ob eines womöglich irgendeine Kümmernis oder eine Wunde plagte. Es schien ein Tag wie jeder andere. Um mich herum waren niedriger gestellte Tinukeda’ya, hauptsächlich Pferde- und Stallknechte, fleißig bei der Arbeit, auch nachdem die Pferde gefressen hatten; sie striegelten das prächtige Fell der Tiere, führten sie auf dem weißen Sand des Hofs umher, um sie zu bewegen, und umhegten sie auf vielerlei Art und Weise. Die Stallungen von Asu’a sind voll von Pferden stolzer, alter Abstammungslinien, und die, die für sie sorgen, sind ebenfalls stolz.
Yohe, Waffenträgerin – vergleichbar dem, was die Sterblichen des Südens »Knappe« nennen – des Bruders meines Herrn, Ineluki, war die einzige Zida’ya, die ich in den Stallungen antraf. Yohe war dünn, selbst für ihr schlankes Volk, kräftig und pragmatisch, und sie trug das Haar immer eng am Kopf geflochten, damit es sie bei der Arbeit nicht behinderte. Sie sang leise, während sie ein Neun-Jahreszeiten-Fohlen mit dem Mottenzaum bekannt machte. Unsere Blicke trafen sich, aber sie begrüßte mich lediglich mit einem knappen Nicken. Ich war auch Waffenträger, genau wie Yohe, doch die Zida’ya-Knappen verschwendeten kaum je Zeit damit, höflich zu mir zu sein, wobei Yohe immerhin meine Anwesenheit zur Kenntnis nahm. Sie hatte zudem eine Rechtfertigung für ihre knappe Begrüßung: Einem jungen Pferd erstmals einen Zaum anzulegen, ist eine heikle Sache. Unsere Pferde mögen es nicht, irgendetwas im Gesicht zu haben, nicht einmal etwas so Leichtes wie einen Mottenzaum. (Ich habe nie verstanden, wie die Sterblichen ihren Pferden eine Gebissstange ins Maul schieben können, unsere Asu’a-Pferde würden sich das nie gefallen lassen.) Ich beobachtete, wie Yohe die »Flügel« der Motte anhob, indem sie sanft am Zügel zog. Das Fohlen scharrte ein wenig mit den Hufen, aber Yohe hatte eine leichte Hand, und das Fohlen blieb ruhig, eingelullt durch ihren uralten Gesang. Ich fuhr fort, die Pferde meines Herrn zu inspizieren.
Als ich einen Stein aus dem Huf der hellen Stute Gischtkrone kratzte und überlegte, ob der Bronzeschmied sie wohl neu beschlagen müsste, kam ein junger Tinukeda’ya-Stallknecht vom Hof hereingerannt. Es war Nali-Yun, ganz rot vor Aufregung.
»Waffenträger Pamon, da sind Sterbliche im Palast!«, verkündete er laut.
Yohe wandte sich ihm zornig zu. »Bist du verrückt?«, zischte sie ihn an und versuchte dabei, das erschrockene Fohlen zu beruhigen. »Brüllst wie ein Tier! Pass doch auf, Wechselwesen!«
Ich zog Nali-Yun beiseite. »Wann sind denn keine Sterblichen im Palast?«, fragte ich ihn ruhig. »Sie stehen doch jeden Morgen vor Sonnenaufgang an den Toren Schlange, um Dinge einzutauschen oder zu verkaufen. Sie lungern im Besucherhof herum und schreien wie Krähen auf jeden Vorbeikommenden ein, in der Hoffnung auf eine Audienz bei der Sa’onsera und dem Protektor – die ihnen nie gewährt werden wird. Wir können doch kaum einen Schritt aus dem inneren Palast hinaustun, ohne über irgendwelche Sterblichen zu stolpern. Warum schreist du wegen etwas so Normalem derart herum?«
»Du bist immer so streng, Pamon Kes«, beschwerte er sich. »Was ich zu sagen habe, ist überhaupt nicht normal.«
»Im Stall herumzuschreien auch nicht.« Doch es behagte mir gar nicht, einen anderen Tinukeda’ya vor Yohe auszuschelten – sie und die übrigen Zida’ya-Knappen hielten schon wenig genug von uns. »Also, sprich, warum ist die Ankunft weiterer Sterblicher ungewöhnlich?«
»Weil es eine ganze Schar von Sterblichenmännern aus dem Westen ist. Sie haben um eine Audienz ersucht – und Herrin Amerasu hat sie ihnen gewährt. Sie beginnt beim Läuten der Morgenglocke. Du musst schnell hin!«
»Zwing mich nicht, noch mal Ruhe zu verlangen«, warnte ihn Yohe streng.
Ich tat mein Bestes, mich dem jungen Stallknecht gegenüber zu beherrschen. »Warum sollte ich schnell hinmüssen? Um ein paar Sterblichenmänner zu sehen? Das ist doch nichts Neues.«
»Na ja, du solltest dich wohl trotzdem beeilen«, sagte er grinsend. »Weil dein Herr Hakatri wünscht, dass du zu ihm in die Halle der Tausend Blätter kommst.«
»Du Dummkopf.« Jetzt war ich richtig ärgerlich. »Das hättest du mir gleich sagen sollen.«
Ich säuberte mich sofort, so gut es ging, und eilte in die große Halle, doch durch das Geschwätz des Stallknechts hatte ich unnötig Zeit verloren. Als ich die Vorhalle der großen Halle erreichte, strömten die anderen Höflinge bereits hinein. Die allermeisten waren goldhäutige Zida’ya wie mein Herr, aber ich sah auch ein paar knochenbleiche Hikeda’ya, Angehörige des Bruder-Volks der Zida’ya. (Wir Tinukeda’ya haben ebenfalls goldene Haut, aber unser Goldton ist nicht so kräftig wie der unserer Zida’ya-Herren, wie bei verdünntem Wein.) Hikeda’ya waren jetzt in Asu’a selten – die meisten waren ihrer selbsternannten Königin Utuk’ku nach Norden in deren Bergstadt Nakkiga gefolgt –, weshalb sie mit ihren onyxschwarzen Augen und ihrer pergamenthellen Haut umso mehr hervorstachen. Die Hikeda’ya, die in Asu’a geblieben waren, hatten ihr Leben hier unter den Zida’ya über ihre Blutsbande gestellt, und wenn sie auch von ihren Verwandten im Norden dafür verachtet und sogar als Verräter betrachtet wurden, mischten sich die Hikeda’ya von Asu’a weiterhin so selbstverständlich unter das Volk meines Herrn, als hätte die große Trennung der beiden Clans nie stattgefunden.
Als ich eintrat, fiel das erste Sonnenlicht durch die hohen Fenster der Halle der Tausend Blätter auf die vielen verschiedenen Farbtöne von Kleidung und Haaren der versammelten Zida’ya. Hoch über den Köpfen, an den Wänden und unterm Dach des heiligen Kuppelsaals, den die Zida’ya den Yásira nannten, leuchteten die Flügel der zahllosen Schmetterlinge auf, die dort saßen und langsam erwachten.
Auf dem Podest unter der offenen Kuppel saßen die führenden Mitglieder des Hauses der Tanzenden Jahre – die meisten jedenfalls. Die Ehrenplätze gehörten natürlich Sa’onsera Amerasu und Protektor Iyu’unigato, den Eltern meines Herrn Hakatri. Die Ehefrau meines Herrn, Briseyu, saß auch dort oben, auf dem Schoß ihre kleine Tochter Likimeya, der es nicht zu gefallen schien, von den mütterlichen Armen festgehalten zu werden. Selbst der jüngere Bruder meines Herrn, Ineluki, war jetzt eingetroffen und stieß zu seiner Familie. Das einzige wichtige Mitglied des Hauses der Tanzenden Jahre, das nicht auf dem Podest saß, war mein Herr selbst.
Als ich den Hals reckte und mich suchend umsah – Hakatri war gewöhnlich die Pünktlichkeit selbst –, bemerkte ich das halbe Dutzend Gestalten, die am Fuß des Podests knieten und zu den Herrschern des Hauses der Tanzenden Jahre emporblickten wie Kriegsgefangene, die auf Gnade hofften. Die Sterblichen waren wirrhaarig und bärtig, wie bei den Männern dieses Volkes üblich, und trugen grobe Kleidung aus Wolle und Tierhäuten. Tatsächlich fand ich, dass sie mit ihrem ungekämmten Haar und den dicken Pelzjacken selbst ein wenig wie Tiere wirkten.
Der, den ich für ihren Anführer hielt, sah noch jung aus, war aber genauso struppig wie die Übrigen, und seine Augen wirkten klein und verschwiegen, verglichen mit den Augen der Zida’ya oder auch meines eigenen Volkes. Sein Haar und sein Bart waren von einem Feuerrot, wie ich es selten an einem Sterblichen gesehen hatte, so leuchtend, dass es gefärbt sein mochte. Auch glaubte ich, in seinem Gesicht etwas Offenes, Neugieriges zu sehen – eine Intelligenz, die sein primitives Äußeres Lügen strafte.
Amerasu die Schiffgeborene betrachtete die Fremden ebenfalls. Ihr Gesichtsausdruck war ruhig wie der einer Betenden. Die Sa’onsera trug ihre üblichen schlichten Gewänder, grau wie Regenwolken oder wie die weiche Brust einer Taube, aber sie machten sie nicht unsichtbar – im Gegenteil. Selbst ihr Gemahl, der große Iyu’unigato, oberster Protektor aller Zida’ya-Clans, schien neben ihr im Schatten zu verschwinden. Amerasus weises, sanftes Gesicht zog den Blick auf sich wie eine Kerzenflamme in einem dunklen Raum.
Jetzt hob sie die Hand, und die Versammelten verstummten. »Wir heißen Euch willkommen, Männer des Westens.« Ihre Stimme hatte lediglich Gesprächslautstärke, trug aber durch die ganze große Halle. »Ihr seid Gäste in unserem Haus und habt nichts zu befürchten.« Sie wandte sich an den jungen Anführer der Sterblichen. »Nennt uns Euren Namen und Euer Anliegen.«
Der Anführer der Delegation beugte den Kopf. »Danke, Majestät. Wir sind sehr dankbar, dass Ihr und Euer Gemahl bereit seid, uns anzuhören. Es ist eine große Ehre, vor den König und die Königin der Zida’ya treten zu dürfen.«
Amerasus Lächeln war sanft, aber wer sie kannte, hätte darin vielleicht ein leises Flackern von Unbehagen bemerkt. »Das sind Sterblichentitel, junger Mann, nicht unsere. Mein Gemahl ist der Protektor des Hauses der Tanzenden Jahre, und ich bin die Hüterin seiner Rituale. Unsere Entscheidungen haben nur so viel Macht, wie sie an Respekt genießen.«
Der Sterbliche verbeugte sich wieder. »Verzeiht unsere Unwissenheit, Herrin. Es ist lange her, dass jemand von meinem Volk hier im großen Asu’a war, und wir sind nicht vertraut mit Euren Gebräuchen. Nur unsere große Not veranlasst uns, Euch heute zu belästigen.«
»Ihr habt uns immer noch nicht gesagt, wie Ihr heißt und woher Ihr kommt«, half sie ihm auf die Sprünge.
»Was wollen sie?«, fragte ihr Gemahl, der oft mit den Gedanken woanders schien, auch wenn halb Asu’a vor ihm versammelt war. »Wissen wir das schon?«
»Verzeiht, Herr und Herrin.« Der Sterbliche wurde rot, für mich ein seltsamer Anblick: als hätte jemand in ihm ein Feuer entzündet, dessen glühender Schein durch die Haut seines Gesichts und seines langen Halses drang. »Ich bin Prinz Cormach, Enkelsohn König Gorlachs aus dem Geschlecht von Hern dem Großen. Unser Königreich ist das Gebiet, das Ihr M’yin Azoshai nennt, am Rand der westlichen Berge – wie Ihr ja wisst, da diese Lande Herns Volk von Eurem Volk als freier Besitz gewährt wurden.«
Ich kannte diese alte Geschichte nur vage, aber Amerasu nickte. »Ja, die Übereignung dieser Lande an Hern den Jäger wurde von meinen Eltern bestätigt«, sagte sie. »Aber das sagt uns noch nicht, was Euch heute an unseren Hof führt.«
»Zögert nicht, uns Euer Anliegen zu verraten, Sterblicher«, sagte Ineluki mit einem breiten Grinsen. »Vielleicht findet Ihr ja das Wetter auf Azoshas Berg zu unwirtlich und wollt dieses Land den Zida’ya zurückgeben.«
Der Bruder meines Herrn liebte es zu scherzen, obgleich er es sehr schnell übelnahm, wenn jemand anders seinen Witz an ihm erprobte. »Oder sind Eure Schafe in unsere Lande abgewandert?«
Der Sterbliche namens Cormach schien sich unsicher zu sein, ob er veräppelt wurde, und wandte sich eilends wieder an Amerasu. »Weder noch! Wir sind hierhergekommen, um vor Euch zu knien, Herr und Herrin von Asu’a, weil wir gegenwärtig in arger Bedrängnis sind. Nur aus diesem Grund sind wir hier.«
»Beunruhigt Euch nicht«, sagte Amerasu. »Mein jüngerer Sohn hat Gefallen daran, solche Scherze zu machen.« Sie bedachte Ineluki mit einem Blick, der zwar liebevoll war, aber auch deutlich sagte, dass sie es nicht billigte, Gäste auf den Arm zu nehmen, ob Sterbliche oder nicht. »Sagt uns offen, was Euch herführt, Prinz Cormach. Ich verspreche Euch, von jetzt an werdet Ihr höflich angehört.«
Wie alle, die dieser ungewöhnlichen Audienz beiwohnten, war auch ich ganz auf das Geschehen auf und vor dem Thronpodest konzentriert, und als mich plötzlich jemand am Ellbogen fasste, hätte ich vor Schreck fast aufgeschrien.
»Ich habe dich gesucht, Pamon«, flüsterte mein Herr Hakatri, der so lautlos wie ein Schatten neben mir aufgetaucht war. »Wo hast du denn gesteckt?«
»Hier, wie es mir Nali-Yun von Euch bestellt hat.«
Hakatri schüttelte ärgerlich den Kopf, lächelte dann aber. »Ich habe diesem jungen Strolch gesagt, ich wolle dich vor der Halle treffen. Ich habe dort eine ganze Weile gewartet.«
»Das tut mir sehr leid, Herr. Wenn Ihr wollt, werde ich Euch helfen, ihn zu erwischen und zu verprügeln. Er hat den Verstand eines Grashüpfers, dieser Kerl.«
»Ah«, sagte Iyu’unigato von seinem Sitz auf dem Podest aus. »Wie ich sehe, ist nun auch das letzte Mitglied unserer Familie eingetroffen. Komm her zu uns, Hakatri.«
»Wir reden später, Pamon«, flüsterte mein Herr und zwängte sich dann durch die Menge zu seiner Familie durch. Die Sterblichen betrachteten ihn respektvoll, als er an ihnen vorbeikam. Kein Wunder: Viele Sterbliche kannten ihn oder jedenfalls seinen Ruf. In Person war er beeindruckend, groß und anmutig, mehr Kind seiner Mutter als seines Vaters. Ineluki hingegen kam ganz nach seinem Erzeuger Iyu’unigato, mit ausdrucksvollem Gesicht und großen Augen, die unschuldig oder spitzbübisch wirken konnten. Aber bei Ineluki konnte man weder dem einen noch dem anderen Ausdruck wirklich trauen.
»Ich bin froh, dass du es zu uns geschafft hast, mein Sohn«, sagte Amerasu, als mein Herr sich auf einen Platz in ihrer Nähe setzte. »Die Herolde sagten, die Bitte, die diese Gesandten überbringen, sei keine Kleinigkeit.«
»Entschuldigung«, sagte Hakatri. »Es gab ein Missverständnis.«
»Wir sind jetzt also alle hier – aber warum?«, fragte sein Vater Iyu’unigato. »Wir wissen immer noch nicht, was diese Sterblichen von uns wollen.«
»Wir erflehen Eure Hilfe, Herr«, antwortete der Sterblichenprinz. »Wir kommen im Namen unseres Volks – des Volkes Herns –, dem Ihr das Land zuerkannt habt, das einst der Edlen Azosha gehörte. Und ich fürchte, wir bringen schlimme Nachrichten.« Er zögerte, als wollte er die nächsten Worte nicht aussprechen. »Einer der großen Würmer ist wieder aus dem Norden herabgekommen.«
Bei seinen Worten sahen sich viele in der Halle beunruhigt an.
»Ein großer Wurm?«, sagte Iyu’unigato. »Seid Ihr sicher?«
»Viel eher doch wohl ein unbedeutender Spross der älteren Drachen«, sagte Ineluki mit einer wegwerfenden Handbewegung – aufgebauschte Kleinigkeiten. »Irgendein kriechender Schlüpfling, der den Sterblichen Angst eingejagt hat, weil sie so etwas noch nie gesehen haben.«
»Ich bitte um Verzeihung, Herr«, sagte Cormach. »Aber wenn wir auch im Vergleich zu Eurem Volk kurzlebig sind, haben wir Hernsleute doch eine sehr weit zurückreichende Überlieferung, die guten Teils im Wissen Eures Volkes wurzelt. Dies ist nicht irgendein Schlüpfling. Es ist einer der großen Lindwürmer – einer vom alten Blut. Tatsächlich habe ich ihn mit eigenen Augen gesehen. Es ist ein Kalter Drache, schwarz wie ein Käferpanzer, und wenn er von der Nase bis zur Schwanzspitze auch nur eine Handbreit weniger misst als zwei Dutzend Schritt, dann will ich mein Schwert abgeben und Priester werden. Wir sagen Euch, es ist das Ungeheuer, das Ihr Hidohebhi nennt – der Schwarzwurm.«
Bei der Schilderung eines so großen Lindwurms ging ein erstauntes – und auch besorgtes – Flüstern durch die große Halle. Der lange Konflikt, genannt der Drachenkrieg, hatte vor vielen Großjahren geendet, wenn auch der Kampf gegen die Lindwurmbrut immer noch andauert. Keines der ältesten, schrecklichsten Ungeheuer war mehr südlich der Schneefelder gesichtet worden, seit Aisoga die Hochgewachsene und hundert Krieger aus Asu’a und Anvi’janya den mächtigen Weißen Drachen der nördlichen Einöde vernichtet hatten, damals in Senditus Zeit.
»Das ist unwahrscheinlich«, erklärte Ineluki. »Diese grässliche Kreatur wurde schon mindestens hundert Eurer Sterblichenjahre lang nicht mehr gesehen und war auch zuvor nie südlich der Schneefelder unterwegs. Nein, ich glaube wirklich nicht, dass Hidohebhi noch am Leben ist.«
»Ich habe das Monster gesehen, das wir in unserer Sprache ›Drochnathair‹ nennen«, sagte Cormach düster, »und für mich kann es nicht den leisesten Zweifel geben, dass es der sagenumwobene Hidohebhi ist. Alles andere wäre noch schrecklicher – mögen die Götter verhüten, dass mehr als ein solches Ungeheuer existiert!« Er schüttelte den Kopf. »Vor mehreren Monden kam der Drache und bezog sein Versteck in einer Schlucht am Silberweg, am Ostrand unserer Lande – unsere Leute nennen diesen Ort jetzt das Tal der Schlange. Der Wurm hat die umliegenden Hügel allen Lebens beraubt und wagt sich nun auf der Suche nach Beute jeden Tag weiter nach Süden. Unsere Weidetiere, unsere kostbaren Kühe und Schafe, verschwinden selbst von Hochweiden, die Meilen von diesem verfluchten Tal entfernt sind. All unsere Leute sind aus der Umgegend geflüchtet und fürchten sich, zu Fuß oder zu Pferd den Silberweg zu nehmen. Die Ankunft des Ungeheuers hat unser kleines Königreich halbiert. Ich fürchte, wenn nichts getan wird, um diese Kreatur zu töten oder zu vertreiben, wird sie mein Volk vernichten.«
»Aber warum kommt Ihr mit dieser Nachricht zu uns hier im fernen Asu’a?«, fragte Iyu’unigato mit einem leichten Stirnrunzeln. »Was ist mit Enazashi und seinem Silberheim-Clan? Mezutu’a ist doch nur zwei Tagesreisen von da entfernt, wo, wie Ihr sagt, die Kreatur ihr Versteck hat. Enazashi ist ein mächtiger Grundherr mit Tausenden eigener Leute. Was ist mit denen?«
Cormach schüttelte wieder den Kopf. »Enazashi will uns nicht sehen. Er und seine Leute mögen keine Sterblichen, schon gar nicht mein Volk. Sie sind wohlgeschützt innerhalb der Bergwände Silberheims, und ansonsten kümmert ihn nichts.«
Iyu’unigato schien des Ganzen schon müde. Der reservierte Vater meines Herrn hatte für die Aufgaben des Regierens noch nie viel übriggehabt, er zog es vor, seine Zeit in kontemplativer Zurückgezogenheit zu verbringen. »Aber was geht uns das alles an?«, fragte er. »Ihr habt uns immer noch nicht gesagt, warum Ihr nach Asu’a gekommen seid.«
»Ich glaube doch«, sagte Amerasu, aber er schien sie nicht zu hören.
»Liegt es nicht auf der Hand, großer Protektor?«, sagte Cormach flehend. »Die Herren von Asu’a, Eure Vorfahren, haben uns diese Lande gegeben. Jetzt erbitten wir Eure Hilfe bei ihrer Verteidigung, denn dieser Bedrohung sind wir nicht gewachsen. Wer von uns Sterblichen hat je einen der Großen Würmer getötet oder auch nur den Kampf mit einem überlebt?«
»Wir haben immer noch bloß das Wort von Sterblichen, dass es ein solcher ist«, sagte Ineluki, wieder mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Von Sterblichen, die zugeben, wenig von Drachen zu wissen, seien es Große Würmer oder sonstige.«
Der Sterblichenprinz sah ihn an. Einen Moment lang schien Cormach kurz davor, die Beherrschung zu verlieren, doch als er sprach, war seine Stimme ruhig. »Ein Mann braucht nicht niedergestochen zu werden, edler Ineluki, um zu wissen, dass ein Messer scharf ist.«
Iyu’unigato hob entnervt die Hände. »Dieses Gerede führt doch nirgends hin. Hakatri, mein Sohn, du hast noch gar nichts gesagt. Was meinst du?«
Ich vermutete, dass mein Herr geschwiegen hatte, weil ihn das Gespräch beunruhigte. Er stand jetzt auf und sagte: »Ich meine, es ist etwas, worüber wir uns Gedanken machen sollten. Meine Großeltern haben den Sterblichen das Recht auf Azoshas alte Lande zugestanden – niemand hier kann das bestreiten. Und wichtiger noch, wenn dieses Ungeheuer wirklich Hidohebhi – oder irgendein anderer Großer Wurm – ist, dann ist es eine Gefahr für alle, nicht nur für Sterbliche. Aber was mich besorgt, ist, dass Enazashi nichts mit der Sache zu tun haben will.«
»Enazashi ist wie einer dieser Krebse, die ein Gehäuse bewohnen, das jemand anders hinterlassen hat«, sagte Ineluki. »Solange er geschützt ist, kümmert ihn die Sicherheit anderer nicht.«
Amerasu wies ihn sanft zurecht. »Der Herr von Silberheim hat seine Tapferkeit manches Mal bewiesen, mein Sohn. Er hat Riesen mit eigener Hand getötet, ohne eine andere Waffe als seinen Speer. Der Mut Enazashis und seiner Leute steht hier nicht zur Debatte. Die entscheidende Frage lautet vielmehr: Welche Verantwortung hat das Haus der Tanzenden Jahre gegenüber Herns sterblichen Nachfahren in den Landen, die ihnen meine Eltern zuerkannt haben?«
»Wenn Ihr meint.« Ineluki stand auf und verbeugte sich zu ihr hin. »Aber mir erscheint diese Debatte über Verantwortung töricht. Man sagt uns, ein Wurm ist in die Westmark herabgekommen und versteckt sich in den Wogenden Hügeln.« Er breitete die Arme aus, als nähme er eine Ehrbezeugung entgegen. »Ich werde mit diesen Sterblichen dorthin reiten und die Kreatur eigenhändig erledigen. Das scheint doch eine angemessene Aufgabe für einen Spross des Hauses der Tanzenden Jahre.« Er wandte sich an Prinz Cormach. »Wir brechen morgen auf, Sterblicher. Ich habe selbst einen Speer, und wenn er mir auch noch keinen Ruhm gebracht hat« – er sah kurz zu seiner Mutter hinüber, als hätte ihn ihre Verteidigung Enazashis geärgert –, »scheint es doch eine gute Gelegenheit, seine Qualitäten zu erproben … und meine auch.«
»Setz dich hin, Ineluki.« Sein Vater, der Protektor, verbarg seinen Unmut nicht. »Das ist jetzt nicht der Moment für Prahlerei.«
»Es ist keine Prahlerei, wenn es verwirklicht wird.« Ineluki war jetzt in einer seiner seltsamen Stimmungen: Sein Lächeln schien kaum mehr als ein Zähnefletschen. »Traut Ihr mir nicht, Vater? Haltet Ihr mich eines solchen Heldenstücks nicht für fähig?«
»Schon deine Wortwahl zeigt, dass du nicht verstehst, worum es geht.« Iyu’unigato war nun doch noch ganz bei der Sache. »Einen Großen Wurm zu töten, ist nicht, wie einen wilden Eber zu jagen oder auch einen Riesen zu erschlagen. Also setz dich jetzt hin, während ich mich mit deiner Mutter berate.«
Der jüngere Bruder meines Herrn sank auf seinen Stuhl zurück, doch es war offensichtlich, dass Iyu’unigatos Worte seinen Zorn nicht abgekühlt, sondern im Gegenteil angefacht hatten. Sein hübsches Gesicht war verkniffen, die Zähne aufeinandergepresst, die leuchtendgoldenen Augen verengt. Er sah aus, konnte ich nicht umhin zu denken, als ob eine Handvoll Zunder in Flammen aufgehen würde, wenn sie mit ihm in Berührung käme. Mein Herr neben ihm schien ungerührt, doch Hakatri verstand es von jeher besser als sein jüngerer Bruder, seine Gefühle zu verbergen.
»Die Versammelten mögen sich jetzt zerstreuen«, verkündete Iyu’unigato. »Bringt die Sterblichen in den Besucherhof und sorgt dort für ihr Wohlergehen. Die Sa’onsera und ich werden dieses Gespräch morgen wieder aufnehmen und dann eine Entscheidung bekannt geben.«
Nach dem Ende der Audienz fand ich Hakatri im Gespräch mit Tariki Scharfauge, einem Freund aus seiner Generation, der ihm näherstand als irgendjemand sonst, ausgenommen sein Bruder Ineluki.
»Wie du weißt, Pamon, reiten wir morgen auf unsere eigene Jagd«, sagte Hakatri, als ich zu ihnen stieß. »Eine Familie von Riesen ist in den Lichtegrund herabgekommen und treibt sich jetzt im Wald auf der anderen Seite von Shi’ikis Forst herum. Sind meine Pferde bereit?«
»Ja, Herr. Gischtkrone hat gestern ein bisschen gelahmt, aber ich glaube, es war nur ein Stein im Huf. Trotzdem solltet Ihr wohl besser Frostschweif reiten.«
»Ich wollte, mein Waffenträger wäre so gewissenhaft wie deiner«, sagte Tariki lachend, und ich gestehe, dass es mich stolz machte. »Vielleicht sollte ich mir auch einen Tinukeda’ya zulegen.«
Hakatri klopfte mir auf die Schulter. »Es gibt nur einen Pamon Kes«, sagte er, »und der ist meiner. Der erste seiner Art, dem ein Waffenträgerwimpel zuerkannt wurde.«
Während ich mich noch in dem Lob sonnte, kam die wilde kleine Tochter meines Herrn, Likimeya, auf uns zugerannt. Sie jagte einen Vogel und schwang dabei einen Stock wie ein Schwert. Mein Herr fing sie ein, hob sie hoch und presste sein Gesicht an ihre Wange, während sie fröhlich zappelte und sich loszumachen versuchte, um weiter Vögel jagen zu können. Hakatris Gemahlin Briseyu von den Silberzöpfen kam und nahm ihm die Gefangene ab, dann berührten sie und ihr Mann sich mit den Fingerspitzen. Außerhalb von Asu’a ist Briseyu vor allem für ihre Schönheit berühmt, aber sie ist Hakatri rundum eine passende Gefährtin, an Klugheit wie an Unvoreingenommenheit.
»Vielleicht solltest du deine Jagd verschieben, mein Gemahl«, sagte sie. »Wenigstens um ein paar Tage, bis diese Gesandtschaft von Sterblichen Antwort erhält. Dein Bruder scheint sehr erregt, und ich gestehe, die Gerüchte über diesen Wurm beunruhigen auch mich.«
Der Freund meines Herrn, Tariki, entschuldigte sich, damit die beiden unter sich wären, aber ich konnte mich nicht so leicht entfernen, ohne dass mein Herr es mir erlaubte, und ich schaffte es nicht, seine Aufmerksamkeit zu erlangen.
»Meine Liebe«, sagte Hakatri zu Briseyu, »wenn ich meine Pflichten immer verschieben wollte, sobald Ineluki sich irgendwelche Grillen in den Kopf setzt, bekäme ich nichts mehr getan. Wir wissen doch beide, mein Bruder wird noch eine Weile vor sich hin kochen, weil meine Eltern ihn zurechtgewiesen haben, aber er wird sich schon bald wieder beruhigen. Das ist doch immer so.«
Briseyu schüttelte den Kopf – nicht wirklich verneinend, eher beunruhigt. »Ich hoffe, du hast recht, aber nicht deshalb bitte ich dich zu warten. Ich habe zwar nicht die Gabe der Vorhersicht wie deine Mutter, aber bei Inelukis Gerede über den Wurm bin ich erschrocken wie noch nie.« Sie ließ jetzt die kleine Likimeya aus ihren Armen hinabklettern. Das Kind hockte sich zu Füßen seines Vaters hin und begann, mit den Schnürriemen seiner Stiefel zu spielen.
»Erschrocken?«, fragte er.
»Es war eine plötzliche Angst, aber so real wie nur irgendetwas am heutigen Tag. Ich hätte beinah das Kind fallen lassen, so eiskalt ist es durch mich hindurchgefahren.«
»Und wovor hast du Angst?«
»Ich weiß es nicht genau, mein Gemahl – ich bin keine Prophetin. Aber ich fürchte um deinen Bruder, und ich fürchte diesen Wurm.«
Hakatri versuchte zu lächeln. »Du fürchtest um Ineluki? Das ist ja mal was Neues. Gewöhnlich gelten deine Ängste doch mir.«
Sie schüttelte den Kopf. »Verstehst du nicht, wie heftig mein Schreck war? Und wie könnte etwas, das deinem Bruder widerfährt, nicht auch dich betreffen – und mich und unser Kind?«
Ich fühlte mich wie ein heimlicher Lauscher, aber ich konnte ja nichts machen. Ich sah, wie mein Herr ihre Hand nahm. »Glaubst du, ich würde zulassen, dass ihm etwas widerfährt? Und glaubst du, ich würde tatenlos zusehen, wie dir und unserer Tochter etwas geschieht?«
»Nicht freiwillig.«
»Dann bring deine Ängste zum Schweigen, wenn du kannst, und hab ein bisschen Vertrauen in deinen Ehemann … und in meine Eltern. Sie werden keine überstürzte Entscheidung treffen. Und ein Wurm ist nur ein Wurm, so schrecklich er auch sein mag. Unsere Leute haben viele solcher Würmer besiegt.«
Sie schüttelte wieder den Kopf, und diesmal wirkte es resignativ. »Ich fürchte nicht den Drachen selbst. Ich fürchte, was von ihm kommen wird.«
»Ich kann dir nicht folgen«, sagte er und sah sich um. »Du wirst mir deine seltsame Angst genauer erklären müssen, wenn sie nicht bald wieder verschwunden ist. Apropos verschwunden … wo ist unsere Tochter?«
Briseyu sah auf. »Dort ist sie, am oberen Ende der Treppe.« Sie seufzte. »Wenn ich sie nicht zurückhole, wird sie gleich drunten im Teich der Drei Tiefen wild um sich platschen. Aber wir sollten noch weiterreden.«
»Natürlich.« Er sah sie ihrem Kind hinterherlaufen, ihre Bewegungen so leicht wie vom Wind verwehter Nebel. »Ich glaube, meine liebe Gemahlin hat vergessen, dass unsere Reise nur bis in den Lichtegrund führt«, sagte er gleich darauf zu mir, ohne den Blick von der sich entfernenden Briseyu zu wenden. »Zwei, drei Tage höchstens, dann sind wir wieder zu Hause.«
»Wir reiten also doch morgen los?«, fragte ich.
Er nickte. »Selbst wenn es dort in der Westlichen Falte einen neuen, gefährlichen Wurm gibt, müssen wir doch die Riesen lehren, nicht in unsere Lande zu streunen. Wir treffen uns wie geplant vor Morgengrauen im Stall. Sorge dafür, dass alles bereit ist. Wir werden unsere Saufedern brauchen.«
»Und Euer Bruder, Herr?«, fragte ich. »Wird er Euch und die anderen auf Eurer Riesenjagd begleiten?«
Hakatri blickte quer durch den Raum. Sein jüngerer Bruder zeigte keine Betroffenheit darüber, dass ihn sein Vater gescholten hatte. Er hatte eine Gruppe Freunde um sich geschart und unterhielt sie mit einer komödiantischen Demonstration seiner Drachentöterkünste. Doch mir schienen Inelukis Augen allzu glänzend, sein Lachen forciert. Mein Herr schüttelte den Kopf. »Angesichts der Menge an dunklem Gewürzwein, die er bereits getrunken hat – und der Tatsache, dass es die Sonne noch weit hat bis zum Mittagspunkt –, würde ich das eher bezweifeln. Aber mein Bruder ist eigensinnig und, wie du weißt, immer für eine Überraschung gut. Es wäre sicher nicht verkehrt, wenn Yohe für alle Fälle Bronze für ihn bereit machte.«
Ich verbeugte mich und ging. Ich hatte viel zu tun, wenn mein Herr bei Sonnenaufgang auf Riesenjagd reiten wollte.
◆
Es ist schwer, von meinem Herrn Hakatri zu erzählen, ohne zugleich von seinem jüngeren Bruder Ineluki zu sprechen. Sie wirkten in vielem wie zwei Hälften eines Ganzen. Sie waren in ihrer Kindheit und Jugend praktisch unzertrennlich und wussten jeder so genau, wie der andere dachte, dass ich manchmal ein ganzes Gespräch zwischen ihnen in Form eines einzigen Blickwechsels ablaufen sah. Als junge Burschen pflegten sie vor den Toren von Asu’a wilde Galopprennen auszutragen, mit fliegendem hellem Haar und wehenden Mänteln, lachend, wenn ihre Pferde im Gleichtakt Seite an Seite dahinjagten. Und die Leute vom Haus der Tanzenden Jahre, die sie sahen, sagten dann: »Da reiten die Brüder des Windes!« Und tatsächlich schienen sie in solchen Augenblicken Wesen von einer ganz anderen Art als wir Übrigen, selbst ihre eigenen Verwandten.
Aber so nah sie einander auch standen, waren sie doch grundverschieden. Ineluki, der jüngere Bruder, war so wechselhaft wie der Wind. Sein Zorn war manchmal so jäh und so heftig, dass er für alle um ihn herum bedrohlich wirkte. Und seine Momente höchster Belustigung waren kaum weniger alarmierend. Ineluki war ein Geschöpf der plötzlichen Einfälle und heftigen Leidenschaften, so lebhaft wie eine Flamme, und seine wechselnden Launen konnten alles um ihn herum ebenfalls entflammen, zum Guten wie zum Schlechten. Die Stimmungen meines Herrn hingegen waren wie die Glut eines ewigen, heiligen Feuers, oft an der Oberfläche nicht sichtbar, aber nie ganz erloschen.
Hakatri war an Gesicht und Körper kräftiger als sein Bruder, und wenngleich viele seine Züge und seine Gestalt bewunderten, hätte ihn niemand in Asu’a den Schöneren der beiden genannt. Doch ich denke immer zuerst an Hakatris Augen, insbesondere an die Spur von erdigem Braun in dem Gold, die den Farbton tiefer machte und noch dem kürzesten seiner Blicke Gewicht verlieh. Und sprechen muss ich auch von seiner Güte. Er war mir gegenüber immer großzügig, über seine Verpflichtungen hinaus, doch seine größte Gabe an mich war die seiner Zeit und Aufmerksamkeit, obwohl kaum jemand von den Zida’ya meinesgleichen für solcher Großzügigkeit wert hielt. Er behandelte mich immer gut und brach nie ein Versprechen. Vor allem aber lehrte er mich die Bedeutung von Ehre.
Tatsächlich scheint mir manchmal, dass die ganze Familie meines Herrn ihrem Ehrgefühl preisgegeben ist – eine seltsame Formulierung, aber passend. Mein Herr Hakatri trug seines wie eine schwere Krone, aber ohne zu klagen. Sein Vater Iyu’unigato hielt sich an seinem fest wie an einem Stab, und es war manchmal schwer zu sagen, wer da wen stützte. Ineluki konnte durch seines zeitweise schon fast in Raserei verfallen, sich sofort auf sein Pferd schwingen wollen, um diesem Ehrgefühl gerecht zu werden, doch dann drehte der Wind, und er machte sich aufs Höhnischste darüber lustig, als wäre Ehre nur ein Kindermärchen. Und Amerasu die Schiffgeborene, die Mutter meines Herrn und seines Bruders, das Herz ihres großen Clans, bestand so durch und durch aus Ehrgefühl, dass sie nichts anderes sagen konnte als die Wahrheit und weder Höflichkeit noch Tradition sie zum Schweigen veranlassen konnten, wenn sie der Meinung war, etwas müsse gesagt werden. Amerasu sah die Wahrheit, auch wenn sonst niemand sie erkannte.
So sah ich es damals, und so sehe ich es heute, aber was kann einer vom langmissachteten Volk der Tinukeda’ya – ein bloßes Wechselwesen, wie manche mich nennen würden – schon über seine alterslosen Gebieter aussagen?
◆
Vor Morgengrauen, als der Himmel liladunkel war und der Stern namens Nachtherz noch überm Horizont schwebte, erschien mein Herr mit seinem Freund Tariki im Stall. Ich war überrascht, dass Hakatri so früh kam, aber froh, dass er mich schon dort antraf, wie ich gerade noch einmal nach Gischtkrones Huf sah, der erfreulich schnell geheilt war.
»Hast du meinen Bruder gesehen?«, fragte mich Hakatri, und der Ton, in dem er es fragte, ließ mir das Herz tiefer sacken. Ich lief durch den Stall zu dem Abteil, wo Inelukis Pferd Bronze stand – es war leer. Ich spürte einen kalten Klumpen im Bauch.
»Wie ich befürchtet habe«, sagte Hakatri, als ich es ihm meldete. »Er hat Asu’a verlassen. Möge der Garten seinen törichten Stolz verzeihen!«
»Vielleicht ist er ja nur ausgeritten«, sagte Tariki. Er wurde Scharfauge genannt, und tatsächlich hatte er Augen wie ein Falke. Doch er sah auch immer nur das Beste in den Leuten um sich herum, weshalb er einer der engsten Freunde meines Herrn war, aber nicht sein bester Ratgeber. »Ineluki tut das oft, wenn er sich über eure Eltern ärgert.«
»Gepanzert und mit seinem Jagdspeer?« Hakatri schüttelte den Kopf. »Ich habe vorhin mit den Stallwachen gesprochen. Er ist losgeritten und hat niemandem gesagt, was er vorhat.«
Inelukis Waffenträgerin Yohe kam angelaufen, mit ungeflochtenem Haar und geweiteten Augen. »Ist mein Herr bei Euch?«, fragte sie meinen Herrn. »Ich kann ihn nirgends finden.«
»Wie es aussieht, hat er Bronze genommen und ist noch im Dunkeln losgeritten«, sagte Hakatri. »Lauf schnell zum Tor und frage die Wachen, ob sie ihn gesehen haben. Dann geh zu Nidreyu, seiner Herzensfreundin, und bring in Erfahrung, ob er ihr etwas gesagt hat, was seine Abwesenheit erklärt.«
Yohe lief los.
»Er würde doch nicht … er würde es doch nicht allein mit dem Wurm aufnehmen wollen, oder?«, fragte ich.
»Wenn er das Gefühl hat, in seinem Mannesmut nicht ernst genommen worden zu sein? Ganz ohne Zweifel.« Ich erkannte die tiefe Besorgnis unter Hakatris Ärger. Er zeigte es nicht immer, aber er liebte seinen Bruder. Er schickte mich zum Besucherhof, um herauszufinden, ob die Sterblichen noch dort waren und ob sie irgendetwas von Ineluki gehört hatten.
Ich eilte durch den Palast, durch den Geflügelhof, den Tanzenden Pavillon und die immer noch dunklen Schatten der Rauchgärten und erreichte schließlich außer Atem den Besucherhof. Dort konnte ich keine Spur von Ineluki entdecken, und die Sterblichen schliefen noch. Der namens Cormach kam mit dem Wächter, den ich nach ihm geschickt hatte. Sein Gesicht war gerötet, vielleicht vor Beunruhigung, vielleicht vor Verlegenheit – damals wusste ich wenig über Sterbliche und konnte den Unterschied nicht erkennen. »Ich schwöre, wir wissen davon nichts, Herr«, sagte er. »Uns hat man gesagt, wir sollen warten, bis Eure Monarchen entschieden haben, ob sie uns helfen wollen oder nicht.«
»Ich bin kein Herr«, sagte ich. »Und Iyu’unigato und Amerasu sind nicht unsere Monarchen. Sie sind unsere weisesten Ältesten, reich an Vorhersicht und überliefertem Wissen.« Doch selbst diese weisen Ältesten hatten Inelukis plötzlichen Aufbruch offenbar nicht vorhergesehen. »Jedenfalls, verzeiht, dass ich Euren Schlaf gestört habe.«
»Aber können wir denn irgendwie helfen? Unsere Pferde sind ausgeruht. Wir könnten Euch bei der Suche nach ihm unterstützen.«
Ich musste schon beinah lächeln beim Gedanken, dass Sterbliche sich zutrauten, mit Sterblichenpferden einen der Brüder des Windes einzuholen. »Sehr freundlich von Euch, aber mein Herr hat genügend Hilfe. Wartet auf Eure Audienz. Möge Euch das Schicksal gewogen sein.«
Als ich in den Stall zurückkam, erfuhr ich zu meiner Bestürzung, dass Yohes Nachforschungen ebenfalls erfolglos geblieben waren: Nidreyu hatte Ineluki seit dem Vortag nicht mehr gesehen. Hakatri, dem der Vorsprung seines Bruders bewusst war, hatte die Pferdeknechte bereits angewiesen, seine beiden Pferde fertig zu machen. Mir war nicht wohl dabei, dass dies ohne meine Aufsicht erfolgte, aber ich verstand die Eile meines Herrn.
»Waffenträger Pamon«, sagte er, während er seine Hexenholzrüstung anlegte, »du reitest Frostschweif. Ich brauche Gischtkrones Schnelligkeit, wenn ich meinen Bruder einholen will.« Die anderen Gefährten meines Herrn waren inzwischen auch eingetroffen und machten sich aufbruchbereit. Sie schienen bereits zu wissen, dass die Riesenjagd etwas Wichtigerem und Gefährlicherem hatte weichen müssen: Ihre Gesichter waren grimmig, und ich hörte nichts von dem munteren Gerede, das Jagdvorbereitungen normalerweise begleitete.
Als die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne den Himmel erhellten, ritten wir schließlich los, ich auf Hakatris mächtigem Streitross Frostschweif. Ich erwartete nicht, mit meinem Herrn und seinen Freunden mithalten zu können, weil Hakatri ja vor allem seinen Bruder einholen wollte. Und tatsächlich ritten mein Herr und seine Jagdgefährten in rasendem Tempo los, sodass wir Übrigen bald zurückblieben. Die anderen Knappen, allesamt junge Zida’ya, mindere Abkömmlinge des Hauses der Tanzenden Jahre, mussten von Yohe erfahren haben, welch ungewöhnlicher Art die heutige Jagd war. Sie sprachen nicht mit mir darüber – die anderen Waffenträger sprachen auch sonst nur das Nötigste mit mir, und wenn der hohe Rang meines Herrn nicht gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich durchweg so getan, als wäre ich gar nicht da. Aber ich sah sie leise miteinander reden, und ihre Gesten zeugten von Verwirrung und Besorgnis, als Hakatri und seine Gefährten immer weiter davonpreschten, das Ufer der Landfallbucht entlang in Richtung Westmark-Straße.
Ich weiß, es gibt Leute, selbst in der Familie meines Herrn, die der Meinung sind, die Gunst, die Hakatri mir erwies, sei nichts weiter gewesen als das Heischen um Aufmerksamkeit an einem Hof, der das Neue und Außergewöhnliche liebt. Wahr ist, dass ich nur ein Tinukeda’ya war und mein Vater ein gewöhnlicher Pferdeknecht, obwohl selbst die Zida’ya zugeben mussten, dass er ein Geschick im Umgang mit Pferden hatte, an das niemand vom Haus der Tanzenden Jahre heranreichte. Schon lange vor meiner Geburt hatte er sich einen Namen bei den Herren von Asu’a gemacht. Doch ich schwöre, wahr ist auch: Es waren mein eigener Fleiß und die vom Vater ererbten Fähigkeiten, die dazu führten, dass Hakatri mich bemerkte, als ich als Kind in den Stallungen arbeitete. Er sagte oft, als ich ihm das erste Mal aufgefallen sei, habe er nicht gewusst, dass ich Pamon Surs Sohn war, sondern nur meine Tüchtigkeit und meine ruhige Art mit den Pferden bewundert. Niemand konnte meinen Herrn je der Lüge bezichtigen, und warum sollte er auch in einer so unbedeutenden Sache lügen? Ich war bei Weitem nicht der einzige junge Tinukeda’ya, der zu jener Zeit im Stall arbeitete. So leben wir: Wir machen uns bei den Zida’ya nützlich. Ob wir die Schiffe unserer Herren bemannen, ihre Häuser bauen oder uns um ihre Kinder kümmern, wir Kinder des Meeres tun, was man uns zu tun aufgibt, und wir machen es gut.
Fest steht, dass Hakatri mich bemerkte. Als er sah, dass ich das Geschick meines Vaters mit Tieren hatte, machte er mich zu seinem persönlichen Pferdeknecht, und als ihn die jungen Zida’ya, die ihm zur Ausbildung als Waffenträger angeboten wurden, enttäuschten, beschloss er, etwas Ausgefallenes, nie Dagewesenes zu tun, indem er mich dafür erwählte, sein Knappe und seine rechte Hand zu werden. Bald schon sorgte ich nicht nur für seine Pferde, sondern begleitete ihn auch auf seinen Jagden und anderen Reisen. Ich lernte, mich um seine Waffen zu kümmern, und auch durchaus, sie zu gebrauchen, obwohl seine Freunde sich darüber lustig machten, dass er ein Wechselwesen als Waffenträger hatte, und auch auf subtilere Art zum Ausdruck brachten, dass sie von mir und meinesgleichen nicht viel hielten.
»Beachte sie gar nicht, Pamon«, sagte er immer zu mir. »Der gute Ruf, den du dir erwirbst, wird weit mehr Gewicht haben als selbst die bösesten Scherze.«
Ich war mir damals nicht sicher, ob er recht hatte, aber ich wusste, dass Hakatri es glaubte, also versuchte ich, es ebenfalls zu glauben. Ich erzähle das jetzt als Beleg dafür, wie mein Herr dachte und wie anständig er mich behandelte. Tatsächlich war er in vielem netter zu mir als mein eigener Vater, der wenig Geduld mit jedem hatte, der nicht so penibel und zielstrebig war wie er. Mein Vater vermittelte mir Fleiß und Sorgfalt. Mein Herr Hakatri vermittelte mir den Glauben, dass ich mehr sein konnte als nur der Sohn meines Vaters.
Als Heranwachsender lernte ich Kampf- und Kriegskünste, sowohl von Hakatri selbst als auch von anderen Lehrern des Hauses der Tanzenden Jahre. Ich übte mich darin an der Seite vieler junger Zida’ya-Adliger, die zum Teil ebenfalls Waffenträger werden wollten, zum Teil aber auch fahrende Krieger. Eine Zeitlang lernte auch der jüngere Bruder meines Herrn, Ineluki, mit uns, und zum ersten Mal im Leben fühlte ich mich den Zida’ya fast schon gleichgestellt. Das war ein berauschendes Gefühl, aber auch ein gefährliches, weil mir das Getuschel und die Blicke meiner Mitschüler bald klarmachten, dass es vielen von ihnen gar nicht recht war, einen Tinukeda’ya so weit über die üblichen Schranken, die seinesgleichen gesetzt waren, hinausgelangen zu sehen.
Doch nicht lange, und ich begriff, dass ich nie ein besonders guter Krieger werden würde. Ich hatte eine große Reichweite und lernte schnell alles, was mit Denken und Verstehen zu tun hatte, aber ich war nicht so flink, behände und stark wie die jungen Zida’ya-Adligen. Dennoch setzte ich alles daran, das Stangen- und das Sichelschwert nach bestem Vermögen zu meistern und den Weg des Kriegers zu studieren, damit ich meinen Herrn zumindest mit kundigem Blick beobachten könnte. Und als klar wurde, dass ich, was kriegerisches Können anging, für die jungen Männer vom Haus der Tanzenden Jahre keine Bedrohung darstellte, wurden sie mir gegenüber etwas freundlicher. Sie gaben mir nie das Gefühl, einer von ihnen zu sein, aber sie akzeptierten schließlich meine Anwesenheit, wenn das wohl auch guten Teils am hohen Ansehen meines Herrn lag.
Tatsache war nämlich – und daran hat sich bis heute nichts geändert –, dass Hakatri, der älteste Sohn des Protektors von Asu’a und der Sa’onsera, nicht nur von mir hochgeachtet war, sondern von seinem ganzen Volk. Selbst die jungen fahrenden Krieger seiner Generation, die mit ihm rivalisierten, konnten nicht umhin, ihn zu bewundern, was daran lag, dass er einfach bewundernswert war. Nie hörte ich meinen Herrn lügen oder es auch nur erwägen – darin war er ganz das Kind seiner Mutter –, und nie sah ich ihn jemandem den Rücken kehren, der seine Hilfe brauchte. Sein jüngerer Bruder schalt ihn oft deswegen, denn Ineluki sah das als Schwäche an. »Wenn du allen ein Freund bist«, pflegte er zu sagen, »bist du denen, die dir am nächsten stehen, kein besserer Freund als denen, die du kaum kennst.«
Doch Hakatri hatte dafür nur ein Kopfschütteln. »Und wenn ich die Entscheidung, wem ich helfe, nur danach fällen würde, wie nah verwandt oder wie eng befreundet wir sind, dann wäre ich kein fahrender Krieger, sondern ein Zahlmeister, der zuerst rechnet, ehe er darüber befindet, wie viel Unterstützung er anderen zukommen lässt.«
In jenen Tagen des allgemeinen Friedens zwischen den Stämmen des Verlorenen Gartens gab es für die jungen Zida’ya-Adligen kein höheres Ideal als das des fahrenden Kriegers, die Bezeichnung für jemanden, der seinen guten Namen, seinen Verstand und seine Fähigkeiten dafür einsetzte, denen zu helfen, die in Not waren, seien es von Riesen heimgesuchte Bauern oder von Räubern geplagte Siedler. Mein Herr war so berühmt, dass selbst Sterbliche aus weit entfernten Gegenden nach Asu’a kamen, um ihn um Hilfe zu bitten. Ineluki sprach einmal zu mir darüber, und es war schwer zu sagen, ob es ihn mehr belustigte oder ärgerte.
»Dein Herr ist für die Sterblichen wie ein Gott«, erklärte er mir. »Sie bringen ihm Opfergaben an den Toren von Asu’a dar, als wäre es eines ihrer Heiligtümer.«
»Er hat vielen von ihnen geholfen, Herr«, erinnerte ich ihn.
Ineluki bedachte mich mit einem langen Blick, den ich nicht recht deuten konnte. »Ja«, sagte er schließlich. »Und ich fürchte, sein Herz für jeden Dahergelaufenen wird ihn eines Tages teuer zu stehen kommen, auch wenn ich bete, dass ich unrecht habe.«
So ein seltsames Paar, mein Herr und sein Bruder. Hakatri war groß und dunkel, so stabil wie ein senkrecht stehender Langstein, fröhlich und gesprächig, wenn ihm danach war, aber häufiger still und nachdenklich, auch wenn andere noch so unbeschwert waren. Ineluki war fast so groß wie sein älterer Bruder, aber viel schlanker, und alle Zida’ya waren sich einig, dass er das hübschere Gesicht hatte. Während Hakatri am liebsten las oder mit ein, zwei Freunden redete, liebte es Ineluki, unter Leuten zu sein, zu scherzen und zu singen. Doch ebenso, wie die gute Laune des Jüngeren einen ganzen Raum anstecken konnte, so konnte er, wenn er ärgerlich war, eine ganze Festgesellschaft in kürzester Zeit vertreiben. Von der Stunde seiner Geburt an, so hieß es, brannte Ineluki heller – und heißer – als alle anderen seines Volkes.
Doch trotz dieser Verschiedenheit war die Liebe der Brüder zueinander tief und stark. Natürlich stritten sie manchmal, wie es Brüder tun, zumal Ineluki oft das Gefühl hatte, dass ihn sein älterer Bruder wie ein Kind behandelte, wenn er ihm Ratschläge gab und ihn davon abhielt, irgendwelchen jähen Impulsen nachzugeben. Doch in den meisten Dingen wirkten sie schon fast wie eine Seele mit zwei Körpern, und nur selten traf man einen an, ohne dass der andere irgendwo in der Nähe war.
Hakatri und seine Jagdgefährten hatten uns Übrige bald schon weit hinter sich gelassen. Wir folgten einer vielbenutzten Straße, und da nicht leicht festzustellen war, ob unsere Herren vielleicht von dieser abgebogen waren, um irgendwelche Seitenwege zu nehmen, ritten die anderen Waffenträger und ich in recht bedächtigem Tempo durch die steilen, bewaldeten Hügel des Gebiets namens Jagd des Protektors. Nach vielen Stunden kamen wir hinab auf die Westmark-Straße und durchquerten die Furt des Kleinen Rotwasserflusses. Wir machten nicht Halt, als es dunkel wurde – die Zida’ya können tagelang reiten, ohne müde zu werden –, und es fiel mir nicht leicht, mich aufrecht im Sattel zu halten, bis sich der Himmel im Osten endlich aufhellte.
Gegen Mittag überquerten wir die Brücke über den Großen Rotwasserfluss und gelangten hinunter in die Turmfalkenbresche, die Ebene zwischen dem Fluss und den Weißwirbelhöhen, dem Hügelland südlich des Sonnentreppengebirges. Die Zida’ya mochten ja nur selten Schlaf brauchen, aber ihre Reittiere mussten ruhen und fressen, selbst die erstaunlich genügsamen Pferde aus den Ställen von Asu’a. Wir ritten, bis die Sterne hell am Himmel standen, und machten dann halt, um die Tiere zu füttern und zu tränken. Nachdem ich Frostschweif versorgt hatte, holte ich mir dankbar ein paar Stunden Schlaf. Zwei Tage waren vergangen, und wir hatten immer noch keine Spur von Hakatri und seinen Gefährten entdeckt.
Am dritten Tag war die Landschaft um uns herum nicht weiter bemerkenswert und weitgehend flach, denn wir durchquerten ja die Turmfalkenbresche, aber die Wiesen waren voller Schlüsselblumen, Glockenblumen und roter Lichtnelken. Wieder ritten wir nach Einbruch der Dunkelheit weiter, doch gegen Mitternacht erreichten wir den Silberweg in dem Sumpfland am äußersten Rand der Fjälle, und es wurde selbst für meine scharfsichtigen Mitwaffenträger zu gefährlich weiterzureiten. Wir hielten also an und machten ein Feuer. In der Turmfalkenbresche streiften damals große, grimmige Wölfe umher, und sie hatten einen langen Hungerwinter in dieser weitgehend leeren Gegend hinter sich, also neigten nicht einmal die Zida’ya zu allzu großer Unbekümmertheit.
Während die Sterne von Lu’yasas Stab in den südwestlichen Himmel stiegen, sangen die anderen Waffenträger, am Feuer sitzend, Lieder vom Garten. Es fühlte sich etwas seltsam an – nicht, dass sie so viel über jene verschwundenen Lande wussten, die niemand von uns je gesehen hatte, sondern, dass ich so wenig darüber wusste, wo doch unsere beiden Völker sie als ihre Ursprungsheimat bezeichneten.
»Du singst nie mit, Pamon«, sagte Yohe in jener Nacht. Es war so ungefähr das Erste, was sie zu mir sagte, seit wir Asu’a verlassen hatten. »Preist ihr Tinukeda’ya denn nie die Verlorene Heimat?«
»Versteh mein Schweigen nicht falsch – ich würde sie ja preisen, wenn ich wüsste, wie«, erklärte ich ihr. »Aber die Lieder, die ihr singt, habe ich nie gelernt.«
»Wie kann das sein?«
Es kam daher, dass mein Vater nicht von der Sorte war, die ihren Kindern Lieder vorsang, und dass meine Mutter Enla einem Fieber erlegen war, als ich erst vier Sommer zählte. Das Einzige, was sie mir von unserer Tinukeda’ya-Überlieferung erzählt hatte, war, soweit ich mich erinnern konnte, etwas vom Träumenden Meer. Sie sagte, es sei in mir und werde es immer sein, obwohl ich nie genau verstand, was das heißen sollte. Nach ihrem Tod fragte ich meinen Vater, warum sie gesagt habe, das Träumende Meer sei in meinem Blut. Die Frage machte ihn ärgerlich.
»Lass unsere Herren dich ja nie so reden hören«, verwarnte er mich. »Wenn du von solchen Dingen redest, werden sie dich für undankbar und abergläubisch halten.«
»Aber was ist denn das Träumende Meer?«
»Eine törichte alte Geschichte über den Verlorenen Garten. Deine Mutter hätte dir so etwas nie erzählen dürfen.«
Und das war das Letzte, was mein Vater Pamon Sur je dazu sagte. Es verletzte mich – das Träumende Meer war etwas von meiner Mutter, das mir verweigert wurde –, aber ich schnitt das Thema nie wieder an, auch nicht gegenüber den anderen Tinukeda’ya, die ich kannte, und allmählich verblasste die Erinnerung. Als ich dann älter wurde, begriff ich, dass mein Volk über viele Dinge dieser Art nicht spricht, um nicht das Missfallen unserer Zida’ya-Herren zu erregen.
»Pamon, hörst du mir zu?«
Ich merkte, dass ich in Erinnerungen versunken gewesen war. »Verzeih, Yohe.«
Sie sah mich irritierend lange an. »Es muss seltsam sein, seine eigene Geschichte nicht zu kennen«, sagte sie schließlich.
Aber ich kenne meine Geschichte doch, dachte ich. Schließlich war ich nicht irgendein Tinukeda’ya-Knecht: Ich war Pamon Kes, Waffenträger und rechte Hand des edlen Herrn Hakatri. Wenige meines Volkes, da war ich mir sicher, waren je so hoch erhoben worden. Aber davon sagte ich natürlich nichts.
Am Vormittag des nächsten Tages hörten wir lauten Hufschlag, als ob viele Reiter hinter uns den Silberweg entlangkämen. Die anderen Waffenträger und ich drehten uns um, bereit, notfalls zu kämpfen. Wir wussten ja nicht, ob es sich um Boten aus Asu’a handelte, die uns zurückbeorderten, oder aber um eine Horde jener Sterblichenräuber, die angeblich in den dunklen Höhen jenseits der Turmfalkenbresche hausten – wenn ich auch noch nie von Sterblichen gehört hatte, die einen Trupp bewaffneter Zida’ya angriffen. Doch an den Bannern der Reiter, die von Osten her nahten, erkannten wir, dass es ebenjene Sterblichen waren, die in Asu’a den Protektor um Hilfe gebeten hatten.
Der, der Cormach hieß, brachte sein Pferd zum Stehen. »Wir hörten, dass ein Trupp Eures Volkes vor uns sei, und wir haben unsere Pferde beinah zuschanden geritten, um Euch einzuholen,« sagte er. »Aber wie kann das sein? Eure Pferde sind nicht einmal außer Atem.«
Ich lächelte leise. »Die Pferde aus Asu’as Ställen sind flink und ausdauernd, aber so schnell waren wir gar nicht unterwegs.«
»Es überrascht mich allerdings, dass Ihr so wenige seid«, sagte der Prinz. »Haben Eure Leute uns nicht geglaubt, als wir von dem Ungeheuer sprachen, mit dem wir es zu tun haben?«
Inelukis Waffenträgerin Yohe (die unter uns Knappen immer die Rolle der Anführerin einnahm, da mein Herr zwar der Erstgeborene war, ich aber kein Zida’ya) erklärte ihm: »Unsere Herren reiten uns voraus, Sterblicher, aber sie werden auf uns warten, wenn sie ihr Ziel erreicht haben. Es ist jedoch nicht gesagt, dass sie den Drachen zu jagen gedenken, der Euren Leuten solche Angst macht.«
Cormach sah sie unwirsch an. Ich war wider Willen beeindruckt von diesem jungen Sterblichen, der sich offenbar für nicht geringer hielt als irgendwelche Zida’ya. »Ihr sagt das, als würden sich nur Sterbliche fürchten, Waffenträgerin. Wartet, bis Ihr den Wurm erblickt und seinen rauhen Atem hört. Dann werden wir ja sehen, aus welchem Holz ihr Feen geschnitzt seid.«
Seine Worte schienen Yohe zu ärgern, aber Inelukis Waffenträgerin war nicht so impulsiv wie ihr Herr. Sie sagte nur kopfschüttelnd: »Niemand weiß, wie er das Dunkel findet, ehe die Sonne untergeht.«
Nachdem noch einige Worte hin und her gegangen waren, wurde beschlossen, dass wir alle zusammen weiterreiten würden, bis wir entweder die Jagdgesellschaft eingeholt hätten oder unsere Wege sich trennten. Es war gut, dass niemand Zeit mit Streiten vergeudet hatte, denn am frühen Abend, als wir schon ein ordentliches Stück am Rand der Weißwirbelhöhen zurückgelegt hatten, trafen wir endlich auf meinen Herrn und seine Gefährten. Sie waren dort versammelt, wo der Silberweg in ein enges, steilwandiges Tal hineinführte. Ich war unsagbar erleichtert, nicht nur meinen Herrn Hakatri zu sehen, sondern auch seinen Bruder Ineluki, wenngleich klar war, dass die beiden gerade eine Auseinandersetzung hatten. Hakatri war so ärgerlich, dass er mich kaum eines Nickens würdigte, und als Yohe ihren Herrn begrüßen wollte, scheuchte Ineluki sie mit einer rüden Handbewegung weg.
»Du ereiferst dich umsonst, Bruder«, hörte ich Ineluki mit verächtlich geschürzten Lippen sagen. »Ich bin nur hierhergekommen, um diese Kreatur mit eigenen Augen zu sehen. Ich dachte, wenn sie so klein ist, wie ich vermute, könnte ich sie auch gleich erledigen und der Bedrohung der Sterblichen, die hier leben, ein Ende machen. Nicht einmal unser Vater kann doch wohl gegen solche Schutzverantwortung etwas einzuwenden haben.« Er lächelte, aber das aufblitzende Weiß erinnerte mich an eine Eisschicht, die das kalte schwarze Wasser eines winterlichen Sees verbarg, und ich fragte mich, wie tief wohl Inelukis Gekränktheit und Wut sein mochten. Doch seine Stimmungen wechselten ja schnell, und ich hoffte, dass bald eine einsichtigere die Oberhand gewinnen würde.
»Du hast dich töricht verhalten«, sagte Hakatri mit gedämpfter Stimme zu seinem Bruder. »Du hast viele in Sorge versetzt.«
Unterdes warteten die Jagdgefährten meines Herrn auf das Ende des Bruderstreits. Wir erfuhren, dass der Jagdtrupp schon seit dem Mittag hier am Eingang des Tals verharrte, da Hakatri wollte, dass Ineluki mit ihm nach Hause zurückkehrte, sein Bruder sich aber standhaft weigerte.
»Ich möchte mich ja nicht in Euren Disput einmischen, Ihr Herren«, sagte der Sterblichenprinz Cormach, »aber wie Ihr wisst, ist dies der Eingang zum Tal der Schlange, wo der Wurm haust. Er lässt sich nicht oft bei Tag sehen, sondern kommt des Nachts hervor, um sich Schafe und Rinder und manchmal sogar Menschen von den Weiden überall in diesen Bergen zu holen. Es scheint kein guter Ort, um Euer Streitgespräch fortzuführen, schon gar nicht, wenn Ihr nicht glaubt, rasch zu einer Lösung zu gelangen.«
Es war offensichtlich, dass die Sterblichen sich hier gar nicht wohlfühlten, und ich muss gestehen, auch mir war etwas unbehaglich. Die Berge beidseits der Schlucht waren hoch und felsig, und jetzt, da die Sonne so gut wie weg war und Dunkel sich über die Hänge ausbreitete, war es ein beklemmender Ort. Ich hörte keinen einzigen Vogel, nur ein paar Grillen, die das Kommen der Nacht verkündeten. Und nicht nur ich hatte dieses ungute Gefühl: Mehrere Gefährten meines Herrn beobachteten den Taleingang ebenfalls mit besorgter Miene.
»Wir bleiben nicht hier«, beschied Hakatri dem Sterblichenprinzen. »Wir kehren nach Asu’a zurück – alle. Unser Vater wird auch so schon ungemein ärgerlich sein, und selbst unsere Mutter wird die Geduld verloren haben, aber vielleicht können wir ja noch wieder reparieren, was du mit deinem Mutwillen angerichtet hast.«
»Mutwillen?« Ineluki schloss die Augen, als würde seine Geduld unbillig strapaziert. »Diese Sterblichen sind nach Asu’a gekommen und haben etwas von einem mörderischen Drachen erzählt, also bin ich losgeritten, um ihn selbst in Augenschein zu nehmen. Jetzt stehen wir sozusagen an der Türschwelle dieser Kreatur, und du willst umkehren? Was nützt das diesen Leuten?« Er deutete auf Cormach und dessen bärtige Männer. »Welche Lehre werden sie daraus ziehen? Dass das Haus der Tanzenden Jahre keine mutigen Männer mehr hat?«
»Wir sind nicht wegen irgendwelcher Lehren gekommen, Herr«, sagte Cormach, und jetzt schien auch er ärgerlich auf Ineluki. »Wir sind gekommen, um euch um Hilfe zu bitten.«
»Da – hörst du?«, sagte Ineluki. »Alles, was gebraucht wird, ist ein wenig Mut, Bruder.«
»Hier geht es nicht um Mut, es geht um den Willen des Protektors und der Sa’onsera«, entgegnete mein Herr. »Du bist losgeritten, ehe unsere Eltern ihre Entscheidung gefällt hatten. Wie ein Kind, dem das Lernen langweilig ist und das hinausrennt, um zu spielen.«
Kurz schien es, als würde der Ärger Ineluki übermannen. Er starrte seinen Bruder so wütend an, dass ich schon dachte, er würde einfach wieder davonreiten. Doch dann veränderte sich sein Gesicht abermals: Seine Wut war entweder abgekühlt oder hatte sich unter die Oberfläche zurückgezogen. »Deine Argumente kommen zu spät, Bruder«, sagte er in sanfterem Ton. »Vielleicht war ich ja unbedacht. Vielleicht war ich im Unrecht – der Garten weiß, ich verliere manchmal die Geduld mit der übertriebenen Vorsicht unserer Eltern. Aber jetzt sind wir hier! Und zumindest müssen wir das Ungeheuer aufspüren und etwas über seine wahre Größe und Natur herausfinden, damit wir planen können, wie wir mit ihm verfahren wollen.«
Die Brüder debattierten weiter, entfernten sich jetzt aber ein Stück von uns Übrigen. Cormach und seine Sterblichen machten schließlich ein Feuer – ein viel größeres als das, das die Zida’ya und ich in der Nacht zuvor entzündet hatten –, und wir alle warteten, dass mein Herr und Ineluki sich einigten, was wir jetzt tun würden.
Es war schon einiges nach Mitternacht, als Hakatri ans Feuer kam. »Morgen früh werden wir ein kurzes Stück in das Tal hineinreiten, um so viel wie möglich über den Wurm herauszufinden, der laut den Sterblichen dort haust«, erklärte er mir ruhig. »Ich werde Frostschweif reiten, für den Fall, dass es Schwierigkeiten gibt.«
Der jüngere Bruder meines Herrn hatte also gewonnen. Das überraschte mich nicht – Ineluki war, wie sein Vater oft sagte, so hartnäckig wie ein Dachs, der seinen Bau verteidigt. Ich hörte nicht gern, dass wir in dieses düstere Tal vordringen würden, denn schon das, was ich bisher davon gesehen hatte, fand ich abschreckend genug. Fast die ganze restliche Nacht verbrachte ich damit sicherzustellen, dass Speerspitze und Schwertklinge meines Herrn so scharf waren wie ein Eiswind.
Wenn mir schon der Eingang zur Schlucht nicht gefallen hatte, so gefiel mir das, was dahinter lag, noch weniger. Ineluki und mein Herr ritten an der Spitze, dann Yohe und ich, gefolgt von den anderen fahrenden Kriegern und ihren Knappen und schließlich Cormach mit seinen Männern. Einen Führer brauchten wir nicht, denn das Tal war eng und seine Wände hoch. Am Schluchteingang war der Boden übersät mit umgestürzten oder gefällten Bäumen. Mein Herr und Ineluki sahen sich an, wobei Ineluki dem strengen Blick seines Bruders nicht lange standhalten konnte.
Den Talgrund durchzogen Bäche, deshalb war der Boden überall sumpfig, und hervorstehende Teile von Bäumen und Steine machten ihn noch tückischer. Vielleicht wegen der steilen Talwände schien der Himmel tief zu hängen und uns noch von einer dritten Seite her einzusperren. Es fühlte sich an, als wären wir Gefangene, die zum Richtplatz geführt werden.
Trotz des vielen Wassers und Schlamms und frisch gesprossenen Grases wirkte das Tal seltsam leblos. Vögel waren auch heute keine da, und die Grillen waren verstummt. Die einzigen Geräusche außer unseren eigenen waren das gelegentliche Krächzen von Krähen und das Sirren der Bergzikaden, die nichts interessierte außer ihrer kurzen Zeit in der Sonne.