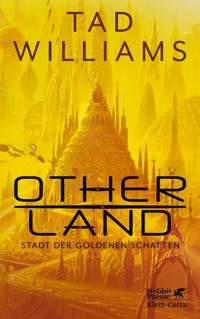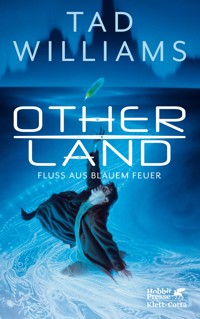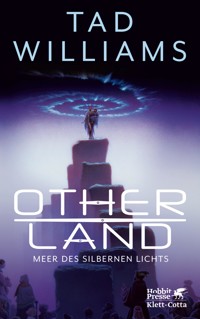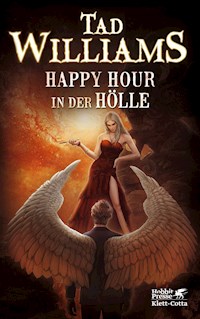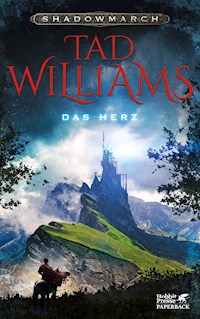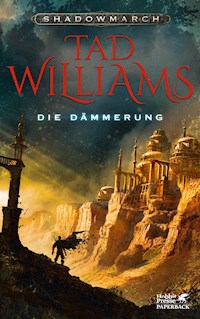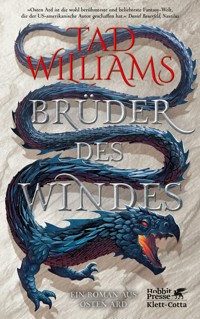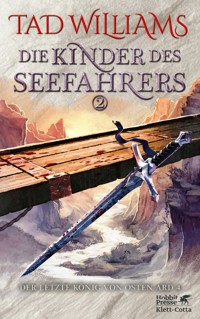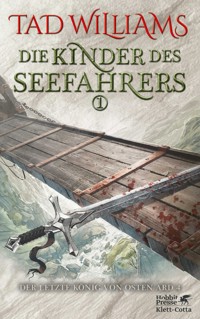13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tinkerfarm
- Sprache: Deutsch
Der erste Band der spannenden Fantasyserie von Bestsellerautor Tad Williams und Deborah Beale jetzt als broschierte Ausgabe. Drachen, Einhörner, seltsame Knechte und Mägde, ein streng verbotener Raum, in dem magische Kräfte und dunkle Geheimnisse lauern … Was Tyler und Lucinda auf der geheimnisvollen Farm ihres Onkels erleben übersteigt jede Vorstellungskraft. »Eine raffinierte Geschichte, geheimnisvolle Figuren, aber das beste sind die Drachen!« Christopher Paolini
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de/hobbitpresse Hobbit Presse Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »The Dragons of the Ordinary Farm« First published by HarperCollins, New York 2009 Aus dem Englischen von Hans-Ulrich Möhring Copyright © 2009 by Tad Williams and Deborah Beale Für die deutsche Ausgabe © 2009/ 2010 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Cover: HildenDesign, München, www.hildendesign.de Coverillustration: © Kerem Beyit Illustrationen: Jan Reiser, www.enter-and-smile.de Printausgabe: ISBN 978-3-608-93821-0 E-Book: ISBN 978-3-608-10140-9
Für Hazel Beale, Tracie Phillips, Lisa Storer und Joanne Clure Mütter und Schwestern allesamtUnd für David Beale Inzwischen eine Treppe höher Aber wisst ihr was? Er weiß es
INHALT
Vorspiel Eine Handvoll Knöchelchen
1 Eine Einladung an den König und die Königin von Rumänien
2 Feuerspeiende Kühe und fliegende Affen
3 Der Mann mit dem falschen Namen
4 Der Krankenstall
5 Meseret
6 Heruntergefallene Muffins
7 Gewitterwolken mit Hörnern
8 Reptilien der besonderen Art
9 Tee mit der Lilienkaiserin
10 Bananenfresser
11 Nach Standard
12 Landarbeit
13 Neckisches Äffchen, tückisches Hörnchen
14 Die größte Mutter der Welt
15 Bezwinger des Großen Krebses
16 Humpty Dumptys Taschentuch
17 Kein Bleiben mehr
18 Ein Loch in der Welt
19 Der geheime Wächter
20 Letzte
21 Ein Schlag auf den Kopf
22 Erste Antworten
23 Entschwundene und Hinterbliebene
24 Hörnchen auf Hörnern
25 Ein Mutterherz
26 Die Kehtoilbib
27 Keine Tricks
28 Flug wider Willen
29 Der Teufelspakt
30 Aus dem Ei gepellt
31 Die normale Welt
Über den Autor und die Autorin
VORSPIEL EINE HANDVOLL KNÖCHELCHEN
Colin drückte vorsichtig die Klinke. Die Tür war wie erwartet fest verschlossen, aber er wollte ohnehin nicht hinein. Er ging auf die Knie und guckte durchs Schlüsselloch.
Seine Mutter, Gideon und Walkwell hatten eine Unterredung im Besprechungszimmer, wo das alte Buntglasfenster Eva im Garten Eden mit dem Apfel, dem Baum und der Schlange zeigte. Gideon hatte einmal gesagt, dass der Künstler, dessen Werk es war, an allem außer der Schlange wenig Interesse gehabt hatte, und das stimmte: Ihr langer Leib zog sich am oberen Rand entlang, die linke Seite hinunter und unten über die ganze Breite, und verglichen mit Eva und dem Baum leuchtete und funkelte sie wie die Schaufensterauslage eines teuren Juweliergeschäfts. Das Zimmer wurde kaum je benutzt – als Colin das letzte Mal darin gewesen war, hatte ihm der Staub in der Nase gekribbelt. Er wünschte sich sofort, er hätte nicht daran gedacht, denn auf einmal bitzelte seine Nase, als ob ihn der Staub wie eine Wolke einhüllte. Wenn er jetzt nieste … Er wollte gar nicht daran denken. Er durfte sich nicht noch einen Fehler leisten. Man konnte seiner Mutter vieles nachsagen, aber nicht, dass sie leicht verzieh.
Colin kniff sich die Nase zu und hielt den Atem an, um das Niesen zu unterdrücken. Die Strafen seiner Mutter sollten ihn »lehren, wie man sich anständig benimmt«, so jedenfalls bekam er es von ihr zu hören. Er hatte nie verstanden, was sie damit meinte. Für sein Gefühl lehrten sie ihn nur eines, nämlich wie schrecklich es war, erwischt zu werden.
Endlich bezwang er den Niesreiz – ein Sieg der Willenskraft. Er ließ seine Nase los und legte das Ohr ans Schlüsselloch.
»… Ich habe für den Sommer zwei Kinder auf die Farm eingeladen«, sagte Gideon gerade. »Es sind entfernte Verwandte, Nichte und Neffe zweiten oder dritten Grades oder wie so was gerechnet wird. Das ist vielleicht auch für Colin ganz gut, wenn hier mal Kinder sind.«
»Fremde«, knurrte Walkwell. »Das ist nie gut, Gideon.«
»Störer.« Colins Mutter sprach es ruhig aus, aber ihre Stimme war härter als gewöhnlich.
»Keine Störer«, versetzte Gideon mit seiner üblichen raschen Gereiztheit. »Verwandte von mir, wenn’s recht ist.«
Walkwell, der Verwalter der Farm, sprach leise wie immer in seinem singenden Tonfall, dessen Schwanken zwischen Hoch und Tief Colin so willkürlich vorkam wie die Formen aufwehender Staubwirbel. Er musste sich anstrengen, um die nächsten Worte zu verstehen. »Aber warum diese Fremden herholen, Gideon, selbst wenn es Verwandte sind? Warum jetzt?«
»Das ist meine Entscheidung«, sagte Gideon unwirsch. »Wollt ihr euch gegen mich stellen?«
»Natürlich nicht!« Colin hörte, wie seine Mutter ihren Stuhl zurückschob und das Zimmer durchquerte. Ihre näher kommenden Schritte erschreckten ihn, so dass er beinahe weggerannt wäre, doch sie hielt ein gutes Stück vor der Tür an. Sie war nur aufgestanden, um Gideon die Schultern zu massieren, was sie häufig machte, wenn der Herr der Farm sich über etwas aufregte.
»Du hast bestimmt lange und gründlich darüber nachgedacht, Gideon, das wissen wir«, beruhigte sie ihn. »Aber wir beide verstehen es eben noch nicht, und dieser Hof liegt uns fast genauso am Herzen wie dir.«
»Ich weiß bald nicht mehr weiter.« Gideons Stimme klang rauh. »Mir geht das Geld aus. Ich bekomme Briefe … von einem Anwalt. Drohbriefe. Ihr habt keine Ahnung, unter was für einem Druck ich stehe.«
»Dann erzähle uns davon«, sagte Colins Mutter. »Wir sind mehr als nur deine Angestellten, Gideon. Das weißt du.«
»Nein, das kann ich nicht. Und hör auf, dich in meine Angelegenheiten einzumischen!«
Weitere Erklärungen schien Gideon nicht abgeben zu wollen. So lief das meistens mit dem Alten, das kannte Colin schon. Ja, so war er: ein alter Mann mit blöden, egoistischen Geheimnissen.
Aber seine Geheimnisse beherrschen unser Leben!, dachte der Junge zornig. Das ist nicht allein seine Farm – auch wir leben hier!
Die große Vordertür des Hauses klapperte und ging auf. Colin sprang vom Schlüsselloch fort, huschte zur Treppe und betete, dass der Eintretende, wer es auch war, ihn nicht im Schatten erspähte. Sein Herz hämmerte so wild, dass er fast meinte, es könnte ihm eine Rippe brechen. Dann hörte er die Stimme leise auf Deutsch singen, und er zitterte nicht mehr ganz so stark. Es war nur Sarah, die Köchin, die irgendetwas durch die Diele in die Küche brachte. Eine andere Tür ging auf und zu, dann war es wieder still.
Colin klebte wieder am Schlüsselloch, als Gideon gerade sagte: »… sind Kinder. Ich bin froh darüber! Sie sind leichter zu kontrollieren.«
»Oder leichter in Gefahr zu bringen«, sagte Walkwell.
»Ihr begreift das nicht«, sagte Gideon. »Ich werde verfolgt, und das nicht zum ersten Mal. Aber ich werde diese Farm mit meinem Leben verteidigen – mit meinem Leben!«
Es wurde wieder still. Colin beobachtete, wie die Stäubchen in den Lichtstrahlen tanzten, die in die Diele fielen.
Es war seine Mutter, die schließlich das Wort ergriff. »Befürchtest du, jemand könnte dir die Farm wegnehmen? Es ist ein heikles Thema, ich weiß, aber vielleicht …« Obwohl sie mutig wie eine Löwin war, wie Colin wohl wusste, hatte sie spürbare Skrupel weiterzureden. »Vielleicht solltest du daran denken – nur einmal darüber nachdenken, wohlgemerkt –, dich wiederzuverheiraten.«
»Bist du von allen guten Geistern verlassen?«, brüllte Gideon. »Was fällt dir ein?« Auf einmal gab es ein allgemeines Stühleschurren, und Colin, darauf nicht gefasst, musste wieder mit einem Satz von der Tür verschwinden und im Schatten neben der Treppe Zuflucht suchen.
Die Zimmertür flog auf, und mit wehendem Bademantel und zornrotem Gesicht kam Gideon barfuß herausgestürzt. Dem ihm folgenden Walkwell sah man seine Emotionen so wenig an, wie man Gideons schon von weitem erkannte. Nachdem sie sich beide verzogen hatten, Gideon stampfenden Schritts in seine Gemächer und Walkwell zur Haustür hinaus und zurück an die Arbeit, erschien Colins Mutter und schloss die Tür des Besprechungszimmers so behutsam hinter sich, als käme sie von einem Krankenlager. Sie ging an Colin vorbei, ohne dorthin zu schauen, wo er sich im Schatten versteckte, und blieb vor der Tür stehen, die zur Küche führte.
»Colin«, sagte sie, ohne sich umzudrehen, »hast du nichts Besseres zu tun, als Erwachsenen nachzuspionieren?«
Nachdem sie durch die Tür getreten war, konnte er noch eine ganze Weile nur schwer atmend in der Ecke kauern, als ob sie ihm in den Bauch geboxt hätte. Schließlich richtete er sich auf und lief ihr nach, voller Selbstverachtung und doch außerstande, es nicht zu tun. Er würde es erklären, er würde ihr sagen, dass es nur ein Versehen gewesen war. Sie würde ihn sicher nicht wegen eines Versehens bestrafen, oder?
Doch, natürlich würde sie das. Das wusste er. Und sie würde auch wissen, dass es gar kein Versehen gewesen war, und wenn er noch so gut log. Das wusste sie immer.
Er würde ihr sagen, dass er nur versucht hatte, sie zu finden. Das stimmte sogar halbwegs. Seit mehreren Tagen hatte er sie kaum gesprochen, ja kaum gesehen. Manchmal war es, als hätte sie ganz vergessen, dass sie einen Sohn hatte.
Die Küche war leer – nicht einmal Sarah war da. Colin lief zur Tür hinaus, die in den Gemüsegarten führte. Das helle Licht draußen blendete ihn, und die Hitze war mörderisch. Der Frühling war noch nicht einmal vorbei, doch in Kalifornien war es seit kurzer Zeit ungewöhnlich heiß, geradezu unerträglich. Weiter hinten erblickte er seine Mutter, die trotz der brennenden Sonne flink und graziös durch den Garten glitt. Wie immer erstaunte ihn ihr Elan, und das Sehnen nach ihr überwog plötzlich alles andere.
»Mutter!«, rief er. »Bitte, Mutter!«
Sie musste ihn hören, sie war ja nur wenige Meter entfernt. Tränen traten ihm in die Augen, und ein Abgrund tat sich in Colins Brust auf, ein altes, nur zu bekanntes Gefühl. Sie eilte vor ihm über die freie Fläche zwischen den Gebäuden, eine Fata Morgana im Staub. Wohin wollte sie? In den Eichenwald weiter hinten? Ständig ging sie allein irgendwohin, in den Wald oder in das verfallene Treibhaus oder in Grace’ altes Nähzimmer. Warum konnte sie nicht wenigstens einmal stehenbleiben und mit ihm reden?
»Mutter!«
Sein erstickter Schrei störte einige der Tiere im Krankenstall gleich um die Ecke auf. Sofort erfüllte Kreischen, Brüllen und Pfeifen die staubige Luft und hallte mit schmerzhaftem Dröhnen in Colins Schädel wider. Etwas stieß ein unheimliches Quäken aus, ein anderes Tier schnatterte und heulte, und wieder ein anderes ließ ein feuchtes Bellen hören wie ein Hund unter Wasser. Colin zog scharf die Luft ein und hielt sich gequält die Ohren zu. »Aufhören«, stöhnte er. »Aufhören!« Doch es hörte nicht auf, jedenfalls nicht gleich. Unruhig gewordene Vögel flogen aus den nahen Bäumen auf und schossen himmelwärts.
Schließlich klang der Lärm ab. Seine Mutter war ein kurzes Stück in den Eichenwald gegangen und stand jetzt mit dem Rücken zu ihm. Als er angestolpert kam, drehte sie sich um und gebot ihm mit einem Blick ihrer grauen Augen, still zu sein. Dann kehrte sie sich wieder der Eiche unmittelbar vor ihr zu, deren helle, trockene Äste in ihrem zackigen und verrenkten Wuchs an Blitze erinnerten. Die meisten der grünen Blätter waren in der verfrühten Hitze bereits gewelkt, weshalb das Vogelnest hoch oben in einem Astknick nur schwer zu erkennen war.
Den Blick nach oben auf das Nest gerichtet begann seine Mutter, eine wortlose Weise zu singen. Colin verfiel augenblicklich ihrem Zauber, wie es ihm immer geschah, schon seit frühester Kindheit. Ihre Stimme war süß und gezogen wie warmer Honig. Colin wurden die Beine schwach. Manchmal, wenn seine schöne, schreckliche Mutter sang, meinte er die Töne zu hören, mit denen die allerersten Menschenfrauen überhaupt ihre Kinder eingeschläfert und die Kranken getröstet hatten. Ihr Gesang war so zwingend, so liebevoll, dass er ihr alles verzieh, wenn sie ihn anstimmte.
Das Lied, das sie sang, funkelte wie klingendes Gold. Ein Vogel mit schwarzweißen Schultern und einem hübschen roten Köpfchen schlüpfte aus dem Nest und kletterte vorsichtig an der Rinde der Eiche nach unten, den Schwanz hierhin und dorthin schnippend. Er kuschelte sich kurz in sein eigenes Gefieder wie jemand, der sich in einem warmen Mantel verkriecht, dann flatterte er auf den ausgestreckten Finger von Colins Mutter, beugte die Knie, dass es aussah, als machte er einen Knicks und böte die prächtigen Flügel und Nackenfedern zum Zausen dar, und dabei wippte und wackelte er so komisch auf dem schlanken Finger wie ein Hündchen, das gestreichelt werden möchte.
»Lass mich den Vogel halten«, sagte Colin, bestrickt von der Macht seiner schönen Mutter. »Bitte …«
Das Singen brach ab. Die Finger seiner Mutter schnappten zu wie eine Falle. In der plötzlichen Stille klang das Zerbrechen der Handvoll Knöchelchen laut wie ein Trommelwirbel. Seine Mutter öffnete die Finger wieder und ließ das zerquetschte Häuflein, dessen einer Flügel noch kläglich flatterte, zu Boden fallen.
Colin schlug sich die Hände vor den Mund. Er hätte es wissen müssen. Er hätte es wissen müssen!
»Geht es dir jetzt besser?«, schrie er sie an. Er wollte weglaufen, doch es ging nicht. Sein Blick wanderte von ihr zu dem sterbenden Vogel. »Geht es dir besser, wenn du das machst?« Er wollte das wirklich wissen, das war das Schreckliche. Als könnte es für eine solche Tat einen stichhaltigen Grund geben und als könnte er, wenn er ihn wüsste, ihr doch wieder verzeihen.
Patience Needle richtete die klaren grauen Augen auf ihren Sohn. »Besser?«, sagte sie. »Ein wenig vielleicht.« Sie drehte sich um und ging mit forschen Schritten zum Haus zurück. »Komm mit, Colin, trödele nicht herum. Wir müssen uns noch eine passende Strafe für einen hinterlistigen kleinen Spion überlegen, nicht wahr?«
1
EINE EINLADUNG AN DEN KÖNIG UND DIE KÖNIGIN VON RUMÄNIEN
Ihr wollt wohl, dass ich gar kein eigenes Leben mehr habe, was?«, sagte Mama.
Tyler spielte mit seinem GameBoss und hatte es bis jetzt geschafft, sich nicht in den Streit hineinziehen zu lassen, aber seine große Schwester hatte noch nie den Mund halten können. Sie biss auf jeden Zankapfel an wie eine Forelle auf einen beköderten Haken.
»Na klar, Mama«, sagte Lucinda. »Kein eigenes Leben – was denn noch? Nur weil wir nicht wollen, dass du den ganzen Sommer über wegfährst und uns bei einer Frau abgibst, die nach Fisch riecht und deren Kinder Popel fressen?«
»Siehst du, so machst du es immer, Herzchen«, erwiderte ihre Mutter. »Immer musst du übertreiben. Erstens ist es nicht der ganze Sommer, es sind nur ein paar Wochen Single-Urlaub. Zweitens riecht Mrs. Peirho gar nicht die ganze Zeit nach Fisch. Das hat sie nur den einen Tag, wo sie so was kochte, irgendwas Portugiesisches.« Mama schlenkerte ihre Finger, damit die Nägel trockneten. »Und ich weiß nicht, was du gegen diese Jungs hast. Sie sind beide richtig gut in der Schule. Martin fährt ins Computercamp und überhaupt. Ihr könntet was von ihnen lernen.«
Lucinda verdrehte die Augen. »Martin Peirho sollte den Rest seines Lebens im Camp verbringen – nirgendwo anders erlauben sie dir, deinen Namen in die Unterhosen zu schreiben.«
Tyler stellte SkullKill lauter, doch er wusste, es würde ihm nichts nützen. Wenn Mama und Lucinda sich stritten und er sie mit Lautstärke zu übertönen versuchte, wurden sie bloß ihrerseits lauter. Es war schon ohne das Keifen im Hintergrund schwer genug, mit blitzschnellen Vampirgnomen und fliegenden Batbots fertigzuwerden.
»Herrje, Tyler, stell das Ding leiser!«, schrie Mama. »Nein, stell es ab! Wir müssen Familienrat halten. Sofort!«
Tyler stöhnte. »Magst du uns nicht lieber Schläge geben?«
Da wurde Mama richtig böse. »Als ob ich euch jemals schlagen würde! Passt bloß auf, dass ihr solche Sachen nicht vor Mrs. Peirho und ihrer Familie sagt – die denken sonst, ich bin eine Rabenmutter.« Sie stampfte zur Tür. »Ich hole die Post. Wenn ich wiederkomme, will ich, dass ihr zwei auf der Couch sitzt und mir zuhört.«
Tyler seufzte. Er überlegte, ob er einfach abhauen und zu Todd gehen sollte. Was konnte ihn daran hindern? Mama würde ihn natürlich nicht schlagen, und wenn sie anfing zu schimpfen, würde er es schon überleben. Außerdem war er sich ziemlich sicher, dass er alles, was ihr in der Beziehung einfiel, schon x-mal gehört hatte.
Er warf einen Blick auf seine ältere Schwester. Sie saß auf der Sofakante, die Arme um sich geschlungen und vorgebeugt, als ob sie Bauchweh hätte. Die Verzweiflung war ihr ins Gesicht geschrieben. »Du willst doch genauso wenig bei den Peirhos bleiben wie ich, Tyler«, sagte sie zu ihm. »Warum sagst du nicht mal was?«
»Weil es nichts bringt.«
Mama hatte ihr Ich-bin-ganz-ruhig-Gesicht aufgesetzt, als sie zurückkam, die Hände voller Prospekte und Rechnungen. Sie setzte sich mit der Post im Schoß in den Sessel. »Also, fangen wir noch mal von vorn an, ja? Statt dass wir uns anschreien, weil ihr dies nicht wollt und das nicht wollt, sollten wir vielleicht darüber reden, was sich aus dieser Situation Gutes ergeben könnte.«
»Wann«, sagte Lucinda, »hätte sich für diese Familie aus irgendeiner Situation jemals etwas Gutes ergeben?«
Mamas Gesicht verdüsterte sich. Tyler machte sich auf den nächsten Ausbruch gefasst – wahrscheinlich würde es ihm noch leid tun, dass er dageblieben war. Doch zu seinem Erstaunen schlug Mama die zugekniffenen Augen wieder auf und versuchte sogar zu lächeln. »Ja, ich weiß, ihr habt es schwer, seit euer Vater und ich geschieden sind. Natürlich habt ihr das …«
Tyler blies in die Luft. Was nützte es, darüber zu reden? Durch Reden kam Papa nicht wieder und wurde Mama nicht glücklicher, auch wenn sie das glaubte. Durch Reden wurde Lucinda nicht wieder zu der älteren Schwester, die ihm am Anfang, als Papa frisch ausgezogen war, was zu essen kochte, die ihm Makkaroni mit Käse machte und sie an den Abenden mit ihm aß, an denen Mama nur vor dem Fernseher hängen und heulen konnte.
»… Und natürlich ist es schwierig für Kinder, wenn ihre Mutter ein wenig Zeit für sich selbst haben möchte«, sagte Mama.
Tyler spürte, wie Lucinda am anderen Ende des Zimmers dagegen ankämpfte, gleich wieder loszuschreien.
»Es ist eine Feriensiedlung für Singles«, fuhr ihre Mutter fort, »es ist nichts Anrüchiges. Es ist ein sicherer und netter Rahmen, um jemanden kennenzulernen.«
Lucinda verlor den Kampf mit sich selbst. »Gott, warum bist du bloß so im Druck, Mama? Das ist ja widerlich.«
Tyler sah, wie Mamas Gesicht erschlaffte und einfiel, und sein Magen zog sich zusammen. Zur Zeit hatte er manchmal das Gefühl, seine Schwester zu hassen. Auch Lucinda sah Mamas veränderte Miene, und Scham flammte in ihrem Gesicht auf, doch es war zu spät: Es war nun einmal heraus.
Mama begann, die Post durchzuschauen, aber sie wirkte mit einem Mal alt und ausgelaugt. Tyler fühlte sich schrecklich. Sie war vielleicht nicht die tollste Mutter der Welt, aber sie tat ihr Bestes – sie kam nur manchmal ein bisschen aus der Spur.
»Rechnungen«, sagte Mama und seufzte. »Das ist alles, was wir kriegen.«
»Warum können wir nicht zu Papa gehen?«, fragte Tyler unvermittelt.
»Weil euer Vater im Moment mit seiner neuen Familie in einer sehr kritischen Phase ist – jedenfalls sagt er das.« Sie kniff die Augenbrauen zusammen. »Ich persönlich glaube, es liegt daran, dass diese Frau ihn völlig um den Finger gewickelt hat.«
»Er will uns nicht haben, und du willst uns nicht haben«, klagte Lucinda. »Unsere Eltern leben, und trotzdem sind wir Waisen.«
Tyler beobachtete fast bewundernd, wie Mama sich erneut zusammennahm – sie las zur Zeit wohl wieder diese Elternzeitschriften. »Natürlich will ich euch haben«, sagte sie. »Und ich verstehe, dass ihr zwei sauer seid. Aber ich hab’s auch nicht leicht, seit euer Vater weg ist. Ich kann euch nicht den Vater ersetzen. Und wie soll ich jemand anders finden, wenn ich die ganze Zeit zu Hause im Bademantel rumsitze und mich bloß mit meinen Kindern streite?«
»Aber warum musst du jemanden finden?«, fragte Lucinda. »Warum?«
»Weil es rauh zugeht in der Welt da draußen. Und weil ich mich manchmal einsam fühle, versteht ihr?« Mama schaute sie beide mit ihrem aufrichtigsten tapferen Tränenrunterschluckblick an. »Könnt ihr zwei mir nicht ausnahmsweise mal helfen?«
»Indem wir verschwinden?«, brauste Lucinda abermals auf. »Indem wir nach Schloss Stinkefuß ziehen und den ganzen Sommer Martin und Anthony dabei zuschauen, wie sie Star Wars spielen und abwechselnd Milch aus der Nase drippeln lassen?«
»Herrje!« Mama verdrehte die Augen. »Für wen haltet ihr euch, für den König und die Königin von Rumänien? Könnt ihr nicht einmal etwas tun, das nicht haargenau nach dem Wunsch eurer Majestäten ist?« Sie stutzte und überflog den offenen Brief auf ihrem Schoß. »Gideon? Ich kenne keinen Onkel Gideon.«
Lucinda hatte sich den Hauskater auf den Schoß genommen und hielt ihn fest, obwohl ihm das nicht sonderlich zu behagen schien. Wenn Lucinda schlecht drauf war, streichelte sie den Kater so heftig, dass sie ihm eines Tages, dachte Tyler, wahrscheinlich das Fell herunterrubbeln würde. »Können wir nicht bei jemand anders unterkommen?«, fragte sie. »Warum kann ich nicht zu Caitlin gehen? Ihre Eltern sind einverstanden.«
»Weil sie nicht genug Platz haben, um Tyler auch zu nehmen, und dass er allein zu den Nachbarn muss, kommt gar nicht in Frage«, sagte Mama, las dabei aber den Brief und gab gar nicht richtig acht. Zwischendurch warf sie einen Blick auf den Umschlag.
Tyler verzog das Gesicht. »Ich gucke lieber Martin Peirho beim Popelfressen zu, als dass ich den ganzen Sommer rumsitze und mir anhöre, wie du und Caitlin über Jungs redet.« Seine Schwester und ihre Freundinnen laberten die ganze Zeit nur über Musiker und Schauspieler im Fernsehen, als ob sie sie persönlich kennen würden, und über Jungen in der Schule, als ob sie die Musiker und Schauspieler im Fernsehen wären – »Ach, ich glaube nicht, dass Barton schon wieder bereit ist für eine echte Beziehung, er ist immer noch nicht über Marlee hinweg.« Tyler kotzte das an. Er wünschte, es gäbe ein Spiel, bei dem man doofe, künstliche Promitypen jagen und sie alle in Fetzen ballern konnte. Das wäre geil.
»Hm, vielleicht bleibt euch beides erspart.« Mama hatte den seltsamen Blick, den sie immer bekam, wenn sie eine gute Nachricht hörte, die sie nicht recht glauben konnte, wie damals, als Tylers Lehrerin ihr erzählte, wie gern sie Tyler bei sich in der Klasse hatte, wie sehr er sich in Mathe anstrengte und wie gut er am Computer war. Tyler war stolz gewesen, aber weil seine Mama so überrascht tat, hatte er sich gleichzeitig gefragt, ob sie ihn eigentlich für bescheuert hielt oder was. »Anscheinend habt ihr einen Großonkel Gideon. Gideon Goldring. Von meines Vaters Seite, vermute ich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich mich vage an ihn und Tante Grace erinnern. Aber er ist doch tot, oder?« Sie merkte wohl, dass sich das ziemlich unsinnig anhörte. »Das heißt, ich dachte, er wäre tot. Ist schon Jahre her … Hier steht, dass er Farmer ist und ein großes Anwesen in der Mitte von Kalifornien hat, und er möchte, dass ihr ihn besuchen kommt. Standard Valley heißt der Ort. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist …« Sie verstummte.
»Nie gehört«, sagte Lucinda. »Wer ist dieser Gideon? Irgendein verrückter alter Verwandter, und du willst uns jetzt einfach bei ihm abladen?«
»Nein, er ist nicht verrückt.«
»Aber das weißt du doch gar nicht!«
»Schluss jetzt, Lucinda! Jetzt lass mich das mal in Ruhe lesen! Geduld hast du offenbar von deinem Vater gelernt.« Mama betrachtete den Brief. »Hier steht, dass er schon seit längerem vorgehabt hat, sich mit mir in Verbindung zu setzen, weil wir fast die Letzten aus der Familie sind. Er sagt, es tut ihm leid, dass er mich nicht schon früher kontaktiert hat. Und er sagt, wie er hört, habe ich zwei entzückende Kinder. Ha!« Mama bemühte sich, sarkastisch zu lachen. »Das steht hier wirklich. Ich frage mich, wer ihm den Klops aufgetischt hat. Und er will wissen, ob sie, das heißt ihr diesen Sommer kommen und etwas Zeit bei ihm auf der Farm verbringen könnt.« Sie sah auf. »Na? Damit wären alle unsere Probleme gelöst, nicht wahr?«
Lucinda starrte sie entsetzt an. »Eine Farm? Da wären wir Sklaven, Mama! Du kennst diesen Mann ja nicht mal, das hast du selbst gesagt. Vielleicht ist er in Wirklichkeit gar nicht dein Onkel. Vielleicht will er sich bloß Kinder angeln, damit sie für ihn bis zum Umfallen Kühe und Schweine melken und so.«
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit eurem Großvater verwandt ist. Und Schweine kann man nicht melken.« Mama wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Brief zu. »Glaube ich jedenfalls.«
»Jetzt willst du uns also auf irgend so eine … Todesranch schicken«, nölte Lucinda leise vor sich hin, dann ließ sie sich die Haare vors Gesicht fallen und schlang wieder die Arme um sich.
Tyler mochte solche Szenen nicht, aber er konnte sich mit dem Gedanken so wenig anfreunden wie seine Schwester. »Keine Ranch. Eine Farm.« Plötzlich fiel ihm ein Bild ein, das er in seinem Geschichtsbuch gesehen hatte, ein verfallender Schuppen mitten in einer riesigen Staubwüste irgendwo in Amerika, öd und leer wie die Oberfläche des Mondes. »M-m. Kommt nicht in die Tüte.« Er glaubte nicht, dass es auf Farmen Internet gab. Von GameBoss und SkullKill hatten die wahrscheinlich noch nicht einmal gehört. »Ich werde um keinen Preis den ganzen Sommer auf irgendeine langweilige Farm gehen.« Er verschränkte die Arme vor der Brust.
»Sei doch nicht so engstirnig«, sagte Mama, als ginge es um die Frage, ob er so was Ekliges wie fritierte Calamari nicht wenigstens mal probieren wollte, und nicht darum, einen ganzen Sommer versaut zu bekommen, der damit fürs Leben verloren wäre. »Wartet ab, am Ende macht es euch noch Spaß. Ihr könntet … auf einem Heuwagen fahren. Ihr könntet vielleicht sogar etwas lernen.«
»Klar«, sagte Lucinda. »Lernen, wie man von Hühnern totgepickt wird. Lernen, wie Leute die Gesetze gegen Kinderarbeit brechen.«
Tyler beugte sich vor, riss Mama den Briefumschlag aus der Hand und musterte die gedrängte Handschrift. Auf der Rückseite waren unter dem Namen Tinkerfarm zwei kunstvoll ineinandergeschlungene altmodische Buchstaben – O und F, wie es aussah – und ein Absender, der die beiden Buchstaben erklärte und seine schlimmsten Befürchtungen bestätigte.
»Mama, sieh dir das an!«, rief er und hielt ihr das Kuvert hin. »O Gott, was für ein Name! Ordinary Farm!«
»Ja, klingt doch nett, nicht?«, sagte sie.
2
FEUERSPEIENDE KÜHE UND FLIEGENDE AFFEN
Mama hatte es derart eilig, sie zum Bahnhof zu bringen, dass Lucinda ihren Fön vergaß. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie ohne Fön über den Sommer kommen sollte, und sie war sich ziemlich sicher, dass es so etwas Modernes und Nützliches auf einer stinkigen alten Farm irgendwo am Ende der Welt nicht gab.
»Reg dich deswegen nicht groß auf«, erklärte ihr Tyler, als sie über den Bahnhofsparkplatz gingen. »Da wird’s nicht mal Strom geben.«
Auf dem Weg zum Bahnsteig, wo laut der Anzeigetafel der Zug nach Willowside abfahren sollte, sah Mama dreimal auf die Uhr. »Sag mal«, maulte Lucinda, »würde es dich wirklich umbringen, wenn du zu diesem Single-Dings ein paar Minuten zu spät kommen würdest? Wahrscheinlich siehst du deine Kinder nie wieder, weil wir von irgendeiner landwirtschaftlichen Maschine verhackstückt werden.«
»Zufällig reise ich erst morgen früh ab«, sagte Mama. »Ich will nur nicht, dass ihr den Zug verpasst.« Sie zog an einem von Tylers Rucksackgurten, damit er sich schneller bewegte, doch er entriss ihn ihr wieder. »Es ist der einzige in den nächsten Tagen, der in Standard Valley hält, es kann keine sehr große Stadt sein. Oh, gut, da steht er. Kommt, Kinder, gebt mir einen Kuss! Vergesst nicht, zu schreiben und mir alles zu berichten. Ich werde Mrs. Fleener von nebenan die Adresse der Feriensiedlung geben, damit sie mir eure Post nachsendet.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!