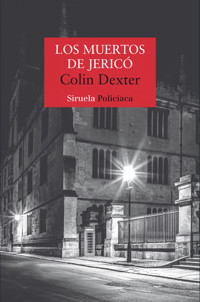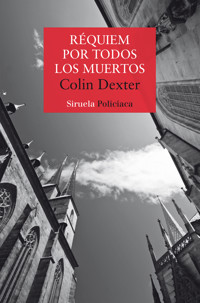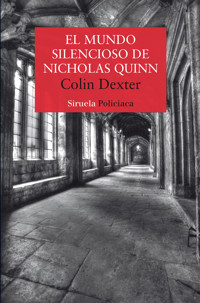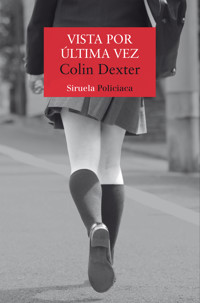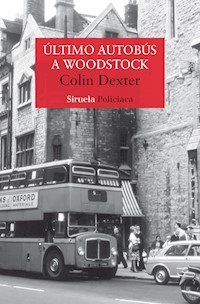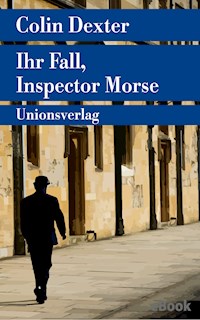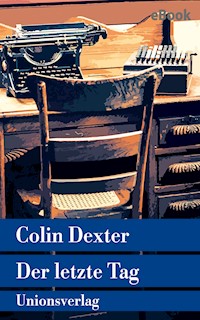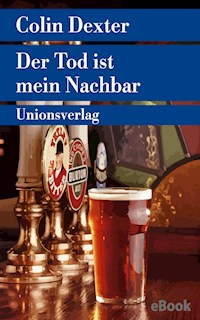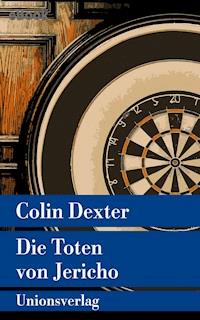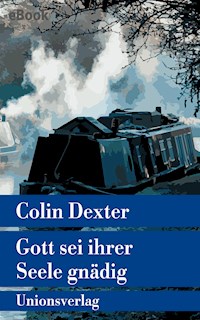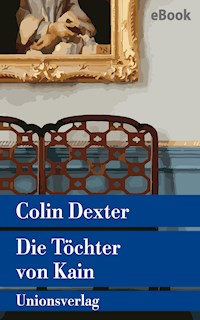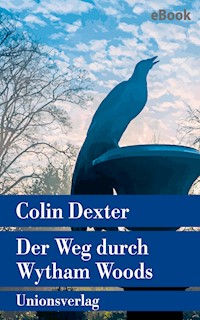9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Gäste des edlen Hotels Haworth freuen sich schon seit Wochen auf die gebuchten Ferien: Drei-Tage-Pauschalangebot über Silvester, Entertainment und Oxford-Führungen inklusive. Für den Höhepunkt, das große Kostümgaladinner, sind die Gäste bestens vorbereitet. Nicht wenige sind kaum wiederzuerkennen. Was der fröhlichen Gesellschaft zwischen Scrabbleturnieren, Cluedomarathons und bunten Cocktails allerdings entgeht, ist, dass sich die Anzahl der Gäste soeben verringert hat – einer der ihrigen liegt ermordet in Zimmer Nummer 3. Inspector Morse ermittelt in einem Fall, in dem jeder eine Maske zu tragen scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Gäste des edlen Hotels Haworth in Oxford fiebern seit Wochen auf den Silvesterabend hin: das große Kostümgaladinner. Was der fröhlichen Gesellschaft zwischen Scrabbleturnieren und bunten Cocktails allerdings entgeht, ist die erkaltende Leiche in Zimmer Nr. 3. Inspector Morse ermittelt in einem Fall, in dem jeder eine Maske zu tragen scheint.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Colin Dexter (1930-2017) studierte Klassische Altertumswissenschaft. Er ist der Schöpfer der vierzehnteiligen Krimireihe um Inspector Morse. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem CWA Diamond Dagger und dem Order of the British Empire für Verdienste um die Literatur ausgezeichnet.
Zur Webseite von Colin Dexter.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Colin Dexter
Das Geheimnis von Zimmer 3
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Marie S. Hammer
Ein Fall für Inspector Morse 7
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die englische Originalausgabe erschien 1986 bei Macmillan, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1988 unter dem Titel Hüte dich vor Maskeraden im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.
Für die vorliegende Ausgabe hat Eva Berié die deutsche Übersetzung nach dem Original überarbeitet.
Originaltitel: The Secret of Annexe 3
© by Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers International 1988
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags, Reinbek
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: imageBROKER (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape und Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31030-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 05:08h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAS GEHEIMNIS VON ZIMMER 3
1 – November2 – November3 – Dezember4 – 30./31. Dezember5 – Dienstag, 31. Dezember6 – 31. Dezember / 1. Januar7 – Mittwoch, 1. Januar8 – Mittwoch, 1. Januar9 – Mittwoch, 1. Januar10 – Mittwoch, 1. Januar11 – Mittwoch, 1. Januar12 – Mittwoch, 1. Januar13 – Donnerstag, 2. Januar14 – Donnerstag, 2. Januar15 – Donnerstag, 2. Januar16 – Donnerstag, 2. Januar17 – Donnerstag, 2. Januar18 – Donnerstag, 2. Januar19 – 2./3. Januar20 – Freitag, 3. Januar21 – Freitag, 3. Januar22 – Freitag, 3. Januar23 – Samstag, 4. Januar24 – Sonntag, 5. Januar25 – Montag, 6. Januar26 – Montag, 6. Januar27 – Montag, 6. Januar28 – Montag, 6. Januar29 – Montag, 6. Januar30 – Montag, 6. Januar31 – Montag, 6. Januar32 – Montag, 6. Januar33 – Dienstag, 7. Januar34 – Dienstag, 7. Januar35 – Dienstag, 7. Januar36 – Dienstag, 7. Januar37 – Dienstag, 7. Januar38 – Dienstag, 7. Januar39 – Dienstag, 7. Januar40 – Dienstag, 7. Januar41 – Mittwoch, 8. Januar42 – Mittwoch, 8. Januar43 – Mittwoch, 8. Januar44 – Mittwoch, 8. JanuarMehr über dieses Buch
Über Colin Dexter
Colin Dexter: »Ich liebe es, von einem Krimi an der Nase herumgeführt zu werden.«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Colin Dexter
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema England
Für Elizabeth, Anna und Eve
1
November
Der Prunk bei Beerdigungen hat mehr mit der Eitelkeit der Lebenden zu tun als mit der Ehrung der Toten.
La Rochefoucauld, Maximen
Die Ankunft des alten Mannes löste im Himmel vermutlich keine besondere Freude aus, und so hatte sein Hinscheiden auf Erden, genauer gesagt, im Charlbury Drive, einer Sackgasse mit unauffälligen Doppelhäusern, wo der Alte seinen Lebensabend verbracht hatte, keine allzu große Trauer hervorgerufen. Obwohl er eher ungesellig gewesen war, hatten sich doch im Laufe der Jahre in der Nachbarschaft oberflächliche Bekanntschaften ergeben, vor allem mit den Frauen, die mit Einkaufstaschen oder Kinderwagen an seinem ordentlichen kleinen Vorgarten vorbeikamen. Seine Beerdigung war auf einen Samstag angesetzt, und zwei der Frauen hatten beschlossen hinzugehen. Eine der beiden war Margaret Bowman.
»Wie sehe ich aus?«, fragte sie.
»Gut«, sagte er, ohne von der Rennsportseite aufzublicken. Wozu auch, es würde schon stimmen: Sie sah einfach immer gut aus. Hochgewachsen und mit sicherem Instinkt für das, was ihr stand, wirkte sie stets elegant, egal, ob sie zu einem Abendessen ging, zu einer Party – oder eben zu einer Beerdigung.
»Du hast ja gar nicht hergesehen!«
Ergeben blickte er hoch und nickte vage, während er flüchtig ihr schwarzes Komplet musterte. Sie sah tatsächlich gut aus. »Gut«, wiederholte er, »du siehst gut aus.« Was sollte er sonst sagen?
Mit unangebrachter Fröhlichkeit vollführte sie auf den Spitzen ihrer kürzlich neu erworbenen schwarzen Pumps eine Drehung. Sie wusste, dass sie gut aussah. Zwar hatte sie seit jenem enttäuschenden Tag, als sie sich, ein fast mager zu nennendes Mädchen von Anfang zwanzig, vergeblich um eine Stelle als Stewardess beworben hatte, um die Hüften herum kräftig zugenommen und würde sich heute, sechzehn Jahre danach, wohl mit größeren Schwierigkeiten durch den Mittelgang einer Boeing 737 hindurchzwängen. Ihre Beine und ihre Fesseln waren jedoch noch immer fast genauso schlank wie damals, als sie, ein Jahr nach ihrer Ablehnung durch die Fluggesellschaft, Tom Bowman geheiratet hatte und zusammen nach Torquay in die Flitterwochen gefahren waren. Und lediglich ihre Füße, das heißt, die kleinen weißen Knötchen entlang der mittleren Gelenke ihrer ohnehin etwas knubbeligen, nicht besonders hübschen Zehen, verrieten, dass sie allmählich auf die vierzig zuging. Doch wenn sie ehrlich war, gab es auch noch andere Anzeichen. Da war zum Beispiel der wöchentliche Besuch der teuren Klinik. Den Gedanken daran schob sie schnell wieder beiseite.
»Mehr fällt dir nicht ein?«, fragte sie.
Er sah sie wieder an, etwas aufmerksamer diesmal. »Du ziehst doch andere Schuhe an, oder?«
»Wieso?« In ihre braunen Augen mit der grünlich gesprenkelten Iris trat ein Ausdruck verwirrter Unsicherheit. Mechanisch richtete sie mit der Linken ihr eben erst frisiertes, blond gefärbtes Haar, während sie mit der Rechten immer wieder fahrig über ihren Rock strich, als gelte es, hartnäckige Flusen zu entfernen.
»Es gießt in Strömen – hast du das nicht bemerkt?« Kleine Rinnsale liefen außen am Wohnzimmerfenster hinab, und noch während er sprach, klatschten ein paar dicke Tropfen gegen die Scheibe und verliehen seinen Worten Nachdruck.
Sie blickte hinunter auf ihre neuen schwarzen Schuhe, die nicht nur elegant waren, sondern auch herrlich bequem. Aber bevor sie etwas sagen konnte, fuhr er schon fort: »Es ist doch eine Erdbestattung, oder?«
Einen Augenblick lang wusste sie nicht, wovon er sprach. Das Wort »Erdbestattung« klang so unbekannt, als sei es einer jener fremdartigen Ausdrücke, die man erst im Lexikon nachschlagen muss, um sie zu verstehen. Doch dann wusste sie, was er meinte: Erdbestattung bedeutete, dass die Leiche nicht eingeäschert wurde, sondern dass man stattdessen in der rötlichen, lehmigen Erde eine längliche Grube aushob, in die man den Toten hinablassen würde. Sie hatte dergleichen schon oft im Fernsehen und im Kino gesehen – es hatte übrigens immer geregnet.
Sie blickte aus dem Fenster. Auf ihrem Gesicht malte sich Enttäuschung.
»In den Schuhen wirst du dir nasse Füße holen – hast du mir nicht zugehört?« Er schlug die Mittelseiten der Zeitung auf und vertiefte sich in einen Bericht über die sexuellen Abenteuer eines prominenten Billardspielers.
Einen Augenblick hing alles in der Schwebe, war es unentschieden, ob das Leben der Bowmans im gleichen Trott weitergehen würde wie bisher. Einen Moment später war die Entscheidung gefallen.
Ihre Schuhe, ihre neuen Schuhe zu ruinieren, darauf wollte Margaret es nun doch nicht ankommen lassen. Zwar hatte sie sie eigens für die Beerdigung angeschafft, aber sie bei diesem Wetter anziehen, hieße fünfzig Pfund zum Fenster hinauswerfen, und das wäre nun doch zu unvernünftig. Es würde den Schuhen schon den Rest geben, wenn sie bloß vor die Tür trat. Erneut schaute sie auf ihre teuer beschuhten Füße, dann auf die Uhr auf dem Kaminsims. Viel Zeit war nicht mehr. Aber trotzdem – sie würde die Schuhe wechseln. Zu Schwarz passte zum Glück fast alles, und die grauen Schuhe mit den dicken Sohlen wären genau das Richtige, und vielleicht sollte sie auch eine andere Handtasche mitnehmen. Sie hatte da noch diese graue Ledertasche, die eigentlich farblich genau zu den Schuhen passen müsste.
Sie stolperte die Treppe hinauf, sehr eilig.
Und das Schicksal nahm seinen Lauf.
Ein, zwei Minuten nach dieser Entscheidung, die niemand für bemerkenswert gehalten hätte, klingelte es an der Haustür. Thomas Bowman legte seine Zeitung beiseite und erhob sich, um sie zu öffnen. Draußen im strömenden Regen stand eine der Nachbarinnen in dunkler Trauerkleidung unter einem grellbunten Regenschirm. Sie hatte sich gelbe Gummistiefel angezogen, die in ihm Erinnerungen weckten an die ersten Farbfernsehaufnahmen von der Landung eines bemannten Raumschiffes auf dem Mond. Ganz offenbar legten nicht alle Frauen in der Siedlung so viel Wert auf Eleganz wie Margaret.
»Sie ist fast fertig«, sagte er. »Schlüpft nur noch rasch in ihre Ballettschuhe, dann kann die Führung über Gottes Acker losgehen.«
»Ich bin etwas spät dran.«
»Wollen Sie hereinkommen?«
»Besser nicht. Wir sollten uns beeilen. Hallo Margaret!«
War sie eben in den zierlichen schwarzen Pumps leichtfüßig die Treppe hinaufgeschwebt, so wirkte Margarets Schritt in den grauen, dicksohligen Halbschuhen nun beinahe schwerfällig. Sie steckte sich, die Hand schon im grauen Handschuh, noch schnell ein weißes Taschentuch in die graue Handtasche, dann war sie für die Beerdigung bereit.
2
November
»Postboten werden irgendwie nie beachtet«, sagte er nachdenklich, »und doch haben sie Leidenschaften wie alle anderen Menschen auch.«
G. K. Chesterton, Der unsichtbare Mann
Nachdem sich die Haustür hinter den beiden Frauen geschlossen hatte, wartete er noch eine Weile, dann trat er ans Wohnzimmerfenster und blickte über den jetzt völlig durchweichten Rasen zur Straße. Er hatte Margaret den Wagen angeboten, da er ohnehin zu Hause bleiben wollte. Aber offenbar waren sie doch im Auto der Nachbarin gefahren, denn sein brauner Metro stand noch in der Auffahrt. Weit und breit war niemand zu sehen, so als sei Charlbury Drive von seinen Bewohnern verlassen worden. Es regnete noch immer.
Er stieg die Treppe hinauf in den ersten Stock, betrat das zweite Schlafzimmer, öffnete die rechte Seite des klobigen Mahagoni-Kleiderschrankes, in dem seine und Margarets abgelegte Kleidung aufbewahrt wurde. In der hinteren Ecke standen aufeinandergestapelt acht weiße Schuhkartons. Mit sicherem Griff zog er den dritten von unten aus dem Stapel heraus, nahm den Deckel ab und holte mit einem tiefen Seufzer die Whiskyflasche heraus. Sie war bereits zu zwei Dritteln leer, oder noch ein Drittel voll – wie es ein nach einem Drink lechzender Mann bezeichnet hätte. Der Karton war sehr alt und diente ihm seit Beginn seiner Ehe mit Margaret als Versteck. Vor Jahren, damals war er noch aktives Mitglied eines Fußballklubs gewesen, hatte er eine Woche lang eine Reihe obszöner Fotos darin aufbewahrt, die in der Mannschaft, angefangen vom schon recht betagten Torhüter bis hinunter zum erst vierzehnjährigen Linksaußen, die Runde gemacht hatten. Inzwischen war er seit Längerem schon der Aufbewahrungsort für seinen Whisky, der, wie er sich selbst eingestand, auf gefährliche Weise für ihn immer unverzichtbarer wurde. Dunkle Geheimnisse, ganz gewiss, die ihm ein schlechtes, wenn auch nicht allzu schlechtes Gewissen bescherten. Im Laufe der Zeit war er zu der Ansicht gelangt, dass ihm seine hübsche, wenn auch etwas übergewichtige Frau die Fotos eher verzeihen würde als den Whisky. Oder würde sie ihm vielleicht auch den Whisky verzeihen? Früher hatte er immer angenommen, dass ihr im Zweifelsfall ein nicht trinkender, untreuer Ehemann lieber sei als einer, der zwar treu, aber ständig alkoholisiert war. In letzter Zeit allerdings war er sich dieser Einschätzung nicht mehr so sicher gewesen. Hatte sie sich vielleicht, was ihre Einstellung zum Alkohol anging, verändert, und wenn ja, seit wann? Sie musste mehr als einmal an seinem Atem gemerkt haben, dass er getrunken hatte, auch wenn sie sich in den letzten Monaten zugegebenermaßen nur sehr selten und dann auch immer nur flüchtig körperlich nahegekommen waren. Aber derlei Gedanken, mochten sie auch des Öfteren auftauchen, nahmen seine Aufmerksamkeit immer nur kurze Zeit in Anspruch, dann pflegte er sie energisch beiseitezuschieben. So auch jetzt. Er packte den Schuhkarton zurück und wollte gerade zwei seiner ausgedienten Anzüge wieder an ihren alten Platz auf der Kleiderstange zurückschieben, als er plötzlich auf dem Boden des Schrankes, direkt hinter der linken Tür – einer Tür, die seiner Erinnerung nach kaum geöffnet wurde, die schwarze Handtasche entdeckte, gegen die sich Margaret im letzten Augenblick entschieden hatte.
Im ersten Moment war er nicht besonders überrascht, erst recht spürte er keine Neugier, doch dann auf einmal kam es ihm merkwürdig vor, und je länger er die Tasche ansah, umso merkwürdiger: Er konnte sich nicht entsinnen, jemals vorher eine ihrer Taschen dort gesehen zu haben. In der Regel befand sich die Tasche, die sie gerade in Gebrauch hatte, neben ihrem Bett. Er ging hinüber in das gemeinsame Schlafzimmer. Vor dem Bett am Fenster, ihrem Bett, lagen unordentlich ihre schwarzen Pumps, so wie sie sie in aller Eile vor ihrem Aufbruch abgestreift hatte.
Er ging wieder zurück und zog die Handtasche hervor. Als Mann, der selten seine Nase in anderer Leute Dinge steckte, wäre er normalerweise nie auf die Idee gekommen, einen ihrer Briefe zu lesen oder ihre Handtasche zu durchwühlen. Normalerweise. Aber warum hatte sie versucht, ihre Handtasche vor ihm zu verstecken? Und wenn sie das jetzt tat, dann konnte es nur einen Grund geben: Es gab irgendetwas in dieser Tasche, das er nicht sehen sollte, das sie aber bei ihrem eiligen Aufbruch auch nicht mehr hatte verstecken können. Der Verschluss der Tasche sprang sofort auf, und er sah den Brief gleich auf den ersten Blick. Er war vier Seiten lang.
Du bist ein egoistisches Biest, aber wenn du denkst, du kannst dich jetzt so ohne Weiteres zurückziehen, wie es dir passt, dann mach dich auf Ärger gefasst, vielleicht habe ich da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wenn du vorhast, mich wie ein Stück Dreck zu behandeln, dann mach dir am besten gleich klar, dass ich es dir heimzahlen werde. Und ich warne dich: Ich kann ganz schön gemein sein, wenn ich will, so gemein wie du jedenfalls allemal. Und wie gern hast du doch alles genommen, was ich dir geben konnte, und die Tatsache, dass ich es dir auch geben wollte, heißt noch lange nicht, dass wir jetzt quitt wären, und du so mir nichts, dir nichts alles hinschmeißen und so tun kannst, als sei nichts gewesen. Nun, der Zweck dieses Briefes ist, dich eines Besseren zu belehren. Und gib dich keinen falschen Hoffnungen hin – ich meine es ernst …
Sein Mund fühlte sich völlig ausgedörrt an. Hastig überflog er die übrigen Seiten. Keine Anrede auf Seite eins – keine Unterschrift auf Seite vier. Die Botschaft des Briefes war dennoch klar genug, er hätte ein kompletter Idiot sein müssen, sie nicht zu begreifen: Seine Frau betrog ihn – und das offenbar schon seit ein paar Monaten.
Hinter seiner Stirn begann es schmerzhaft zu pochen, das Blut dröhnte ihm in den Ohren, und er hatte das Gefühl, keinen klaren Gedanken fassen zu können. Merkwürdigerweise schien sein Körper ihm jedoch zu gehorchen, denn seine Hand war völlig ruhig, als er sich den Whisky in das billige kleine Glas goss, das er immer benutzte. Es gab Tage, da verdünnte er den Alkohol mit Leitungswasser. Heute jedoch trank er ihn pur. Erst einen kleinen Schluck, dann einen größeren, und den Rest kippte er in einem einzigen Zug hinunter. Er goss sich sofort nach und hatte auch das zweite Glas bald geleert. Der Rest aus der Flasche reichte gerade für ein drittes Glas, und bei diesem letzten Glas ließ er sich Zeit und versuchte, das vertraute Gefühl von Wärme zu genießen, das sich allmählich in seinem Gehirn ausbreitete. Und auf einmal, unerwartet und geradezu paradox, spürte er, wie die wütende Eifersucht, die ihn eben noch zu überfluten gedroht hatte, wich, und er wurde sich seiner Liebe zu seiner Frau bewusst. Plötzlich stand ihm wieder jener Tag vor Augen, als sie in völliger Überschätzung ihres Könnens und sehr unzureichend vorbereitet in die Fahrprüfung gegangen und durchgefallen war. Als sie ihm hinterher gefasst und ganz ruhig erklärt hatte, warum sie ihrer Meinung nach gescheitert war, hatte ihn eine Welle von Mitgefühl durchströmt. Und wäre er in jenem Moment dem Prüfer, der sich gezwungen gesehen hatte, seiner Frau Unfähigkeit zu attestieren, begegnet, er hätte ihn erschossen. Er war finster entschlossen gewesen, alles in seiner Kraft Stehende zu tun, um ihr weitere Niederlagen zu ersparen.
Das Glas war leer – die Flasche war leer; Thomas Bowman stieg mit langsamen, aber sicheren Schritten die Treppe hinunter – die leere Flasche in der Linken, in der Rechten den Brief. Er holte sich die Autoschlüssel vom Küchentisch und zog sich den Regenmantel an. Bevor er den Metro aufschloss, ging er hinüber zu den Abfalltonnen und ließ die Whiskyflasche verschwinden, setzte sich dann hinter das Steuer seines Wagens und fuhr los. Es gab da etwas zu erledigen, eine Kleinigkeit nur, aber er wollte es sofort tun.
Seine Arbeitsstelle lag nur etwa einen Kilometer entfernt in Chipping Norton. Auf der Fahrt dahin war er sich der überraschenden unabweisbaren Logik dessen, was er plante, bewusst. Erst bei seiner Rückkehr, etwa eine Viertelstunde später, als er den Brief wieder in die Handtasche zurücklegte, nahm er wahr, wie sehr er den Mann, der ihm die Zuneigung seiner Frau geraubt und sie zur Untreue verleitet hatte, hasste und verachtete – er war ja nicht einmal Manns genug gewesen, den Brief mit seinem Namen zu unterzeichnen.
Die Frau mit der grauen Handtasche stand am Grab, rötlich gelber Lehm klebte an ihren Schuhsohlen. Der Regen hatte fast aufgehört. Der jungenhaft aussehende Geistliche leitete die Trauerfeier mit würdigem Ernst und ohne ungebührliche Hast. Sie hatte hier und da Gesprächsfetzen aufgefangen und so erfahren, dass der Alte bei der Landung in der Normandie dabei gewesen war und bis zum Schluss mitgekämpft hatte. Als zum Abschluss einer der Veteranen aus dem Britischen Frontkämpferverband eine Mohnblume auf seinen Sarg geworfen hatte, waren ihr die Tränen in die Augen gestiegen.
»Das wärs dann wohl gewesen«, sagte die Frau mit den gelben Gummistiefeln. »Mit Port und Schinkensandwiches ist heute wohl nicht zu rechnen.«
»Ist das denn sonst üblich?«
»Na klar, schon um auf andere Gedanken zu kommen. Heute hätten wir es gut gebrauchen können – bei dem Mistwetter.«
Margaret erwiderte nichts darauf, und die beiden Frauen schwiegen, bis sie wieder im Wagen saßen.
»Kommst du noch mit in den Pub?«
Margaret schüttelte den Kopf. »Nein, lieber nicht. Ich möchte schnell nach Hause.«
»Du wirst dich doch wohl jetzt nicht hinstellen und ihm das Mittagessen kochen?«
»Ich habe gesagt, ich würde uns eine Kleinigkeit zurechtmachen, wenn ich wieder zurück bin«, sagte sie beinahe entschuldigend.
Die Frau in den Gummistiefeln unternahm keine weiteren Versuche, Margaret umzustimmen. Es war wohl das Beste, ihre Begleiterin so schnell wie möglich zu Hause abzusetzen und dann allein zum Pub weiterzufahren, wo die anderen schon auf sie warten würden.
Margaret trat sich die Füße ab und schob ihren Haustürschlüssel in das Sicherheitsschloss. »Ich bin wieder da-ha!«, rief sie. Doch sie erhielt keine Antwort. Sie warf einen schnellen Blick in die Küche, ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer – schließlich ins Gästezimmer. Er war nicht da, und sie war froh darüber. Der Metro war nicht in der Auffahrt gestanden, aber es hätte ja auch sein können, dass er ihn wegen des Regens in die Garage gefahren hatte. Wahrscheinlich war er also in den Pub gefahren – es war ihr nur recht. Sie betrat das Gästezimmer, zog die Tür des Kleiderschrankes auf, holte ihre Handtasche hervor und öffnete sie – der Brief war noch da. Sie hatte sich also umsonst Sorgen gemacht und bereute jetzt beinahe, nicht mit den anderen zum Leichentrunk in den Pub gegangen zu sein; einen Gin hätte sie ganz gut vertragen können. Aber seis drum. Der Stapel Schuhkartons in der hinteren Ecke sah etwas wackelig aus, und sie schob die Schachteln wieder ordentlich aufeinander. Erleichtert beschloss sie, in Zukunft vorsichtiger zu sein.
Sie wärmte sich die Reste des Hühnchen-Risotto auf, das es gestern zum Abendessen gegeben hatte, aber die wenigen Bissen, die sie hinunterzuschlucken vermochte, schmeckten wie Stroh. In was für eine Situation hatte sie sich bloß gebracht! Was für eine unselige, aussichtslose Situation! Sie setzte sich ins Wohnzimmer, stellte das Radio an und hörte die Ein-Uhr-Nachrichten. Das englische Pfund hatte sich über Nacht leicht erholt; sie wünschte, von ihrem Herzen ließe sich dasselbe sagen. Sie schaltete den Fernseher ein und sah sich die Übertragung der ersten beiden Rennen aus Newbury an, ohne dass sie allerdings hinterher hätte sagen können, welches der Pferde den Sieg davongetragen hatte. Auch vom dritten Rennen bekam sie so gut wie nichts mit, und erst das Quietschen der Bremsen auf der Auffahrt riss sie aus ihrer Versunkenheit. Er küsste sie zur Begrüßung leicht auf die Wange und erkundigte sich, wie die Beerdigung gewesen sei. Seine Stimme klang erstaunlich nüchtern, doch sie wusste, dass er stark getrunken hatte, und war infolgedessen nicht im Mindesten überrascht, als er erklärte, sich hinlegen zu wollen.
Doch Thomas Bowman fand an diesem Samstagnachmittag nur wenig Ruhe, denn in seinem Kopf begann sich ein Plan zu formen. Niemand außer ihm war im Raum gewesen, als er in seiner Dienststelle den an Margaret gerichteten Brief fotokopiert hatte. Anschließend hatte er auf die Postautos im Hinterhof gestarrt. Wie unauffällig doch solch ein Postauto war. Kein Passant interessierte sich für den Fahrer, den man überhaupt nur von vorne richtig sehen konnte, da an den Seiten keine Fenster waren. Nicht einmal die ansonsten nach Opfern Ausschau haltenden Politessen schenkten ihnen Beachtung, wenn sie sich langsam von einem Haltepunkt zum nächsten bewegten. In dem Brief hatte der Mann, der Margaret offenbar rücksichtslos unter Druck zu setzen versuchte, geschrieben, dass er sie am Montag um zehn vor eins vor der Summertown-Bücherei in der South Parade treffen wolle – und er, Thomas Bowman, würde auch kommen. Ein rotes Zustellauto zu bekommen, war kein Problem, das würde er schon hinkriegen. Er hatte Margaret, bevor sie ihren Führerschein machte, oft zur Bücherei gebracht und auch wieder abgeholt, und ihm fiel wieder ein, dass sich an der Ecke von South Parade und Middle Way ein kleines Postamt befand mit einem Briefkasten davor. Einen günstigeren Treffpunkt konnte es kaum geben …
Doch dann schien plötzlich für einen Moment sein ganzer schöner Plan wieder in sich zusammenzufallen: Wie lange trug Margaret den Brief schon mit sich herum? Er war undatiert, es gab also keinerlei Anhaltspunkt, welcher Montag gemeint war. War es der letzte Montag gewesen? Doch irgendwie war er fest davon überzeugt, dass sie den Brief (vermutlich an ihre Arbeit geschickt) erst am Tag zuvor erhalten hatte. Genauso zweifelte er keinen Moment daran, dass Margaret diese Verabredung einhalten würde. Er sollte in beiden Punkten recht behalten.
Am folgenden Montag um zehn vor eins sah er im Seitenspiegel, dass Margaret sich seinem Auto näherte. Er rutschte auf seinem Sitz ein Stück tiefer, sie ging nur wenige Schritte entfernt vorüber. Eine Minute später hielt plötzlich unmittelbar vor ihm ein Maestro. Der Fahrer beugte sich hinüber, um die Beifahrertür zu öffnen. Margaret stieg ein, und im selben Moment brauste der Wagen mit hoher Geschwindigkeit davon.
Drei Wagen dahinter folgte das rote Postauto. Die Beschattung des Maestros war das erste Glied in einer Kette von Ereignissen, die schließlich in Mord gipfeln würden – clever geplant und mit entschlossener Brutalität ausgeführt.
3
Dezember
»Ich habe ein weiteres Jahr beendet«, sprach Gott,»In Grau, Grün, Weiß und Braun;Ich habe das Blatt auf den Rasen gestreut,Den Wurm in der Erde versiegelt,Und die letzte Sonne herabgelassen.«
Thomas Hardy, New Year’s Eve
Die von Bäumen gesäumte St. Giles’ Street weist sich an vier oder fünf Stellen mit schweren, gusseisernen Schildern aus (weiße Lettern auf schwarzem Grund), die in Lucy’s Gießerei im angrenzenden Stadtteil Jericho angefertigt worden sind. Der Apostroph am Ende des Namenszugs bedeutet vermutlich, dass Oxford glaubt, seinem Ruf als Gelehrtenstadt gerecht werden zu müssen, und es ist nur ein Glück, dass nicht auch noch die Autoritäten der Fakultät für Englisch ein Mitspracherecht haben, denn sie würden ganz sicher darauf bestehen, hyperkorrekt dem Apostroph noch ein weiteres »s« sowie einen zweiten Apostroph folgen zu lassen: St. Giles’s’ Street. Der Kreis derer, die mit dem Rat Fowlers bezüglich des Umgangs mit dem Genitiv vertraut sind, dürfte nicht allzu groß sein, und die Personen der nun folgenden Kapitel gehören ganz gewiss nicht dazu. Sie zählen, hält man sich an die gängige Oxforder Unterscheidung zwischen »Geist« und »Geld«, ganz eindeutig zur letzteren Kategorie.
Die St. Giles’ Street teilt sich an ihrem nördlichen Ende, dort, wo sich auf einem Rasendreieck ein Mahnmal zum Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege erhebt, nach links in die Woodstock, nach rechts in die Banbury Road. Folgt er dieser (an der Inspector Morse seit vielen Jahren lebt), so wird dem Besucher nach einigen Hundert Metern eine Reihe von Häusern auffallen, die alle im selben Stil gehalten sind, einem Stil, den man mit einigem Recht als venezianische Gotik beschreiben darf. Über Fenstern und Türen wölben sich Spitzbögen, und die Fenster selbst sind durch zwei, manchmal auch drei schmale Säulen unterteilt.
Die Häuser sind in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts entworfen worden, und Ruskins Einfluss ist so deutlich zu spüren, dass man meint, er hätte den Architekten während ihrer Arbeit über die Schulter geschaut. Dem Betrachter mögen sie mit ihren gelb-beigen Mauern und den purpurblauen Schieferdächern zunächst ein wenig streng und humorlos erscheinen, doch wird er sein Urteil bei genauerem Hinsehen revidieren müssen: Die eingefügten Reihen orangefarbener Steine mildern den sakralen Eindruck, und die Wiederkehr der Spitzbögen als flächiges Ornament in Orange und Purpur tut sein Übriges, das Ganze aufzulockern.
Geht man weiter, so erblickt man, Park Town rechter Hand hinter sich lassend, eine Anzahl Villen aus rotem Backstein, die – besonders nach den anfangs eher abweisend wirkenden Fassaden der venezianischen Gotik – sofort anheimelnd wirken. Die Dächer sind mit roten Ziegeln gedeckt, und bei fast allen sind die Fenster freundlich weiß umrahmt. Die Architekten, mittlerweile fünfzehn Jahre älter und überdies endlich aus dem Schatten Ruskins getreten, hatten es nun wieder gewagt, Fenster zu entwerfen, deren Sturz in einer schlichten Horizontalen bestand. Und so lassen sich nun, auf nicht einmal einem Kilometer, in dichter Nachbarschaft zueinander, die steingewordenen Zeugnisse zweier sehr unterschiedlicher Architekturrichtungen entdecken, entstanden zu einer Zeit, als die ersten Professoren aus der damals noch klösterlichen Universität auszogen, um zu heiraten und eine Familie zu gründen. In ihren geräumigen Villen waren bald Scharen weiblicher Bediensteter beschäftigt, angefangen beim Stubenmädchen bis hinunter zur Küchenmagd. Die Bebauung rechts und links der Woodstock und der Banbury Road schritt in nördlicher Richtung stadtauswärts unaufhörlich voran, und der Ausdehnungsprozess war anhand der jährlich neu entstehenden Villen beinahe ebenso exakt zu erkennen wie das Wachstum eines gefällten und zersägten Baumes an seinen Jahresringen.
Ziemlich genau zwischen den beiden oben beschriebenen Gruppen von Häusern steht das Hotel Haworth. Es ist nicht notwendig, den Bau, oder vielmehr die Bauten, im Detail zu beschreiben, doch ein paar Einzelheiten über seine Geschichte sollten besser bereits jetzt erwähnt werden. Als das Hotel vor zehn Jahren zum Verkauf stand, wurde es von einem gewissen John Binyon erworben, einem ehemaligen Fabrikarbeiter aus Leeds, der kurz vorher im Toto gewonnen hatte. Er hatte ein Pfund in die Wette investiert, dass der Spitzenreiter der Ersten Liga in einer frühen Ausscheidungsrunde um den Englischen Pokal gegen einen Amateurligisten aus Nord-Staffordshire unterliegen würde – zum nicht geringen Erstaunen aller fußballverrückten Briten. Als Belohnung für so viel Unverfrorenheit strich er vierhundertfünfzigtausend Pfund ein. Das Hotel (das zunächst Three Swans Guest House und dann Haworth Hotel hieß) war sein erster Erwerb. Das etwas von der Straße zurückgesetzte Gebäude zeigte mit seinen gelben Ziegelmauern, dem roten Ziegeldach und den freundlich geschwungenen Fensterstürzen Anklänge sowohl an den Architekturstil der 1880er-Jahre als auch an den fröhlicheren der 1890er-Jahre. Sein Entschluss, das Geld in den Kauf des Hotels Haworth anzulegen, erwies sich als klug. Nach ein paar umsatzschwachen Monaten zog das Geschäft an, und von da an ging es beständig aufwärts. Nachdem Binyon das Haus zwei Jahre mit gutem Erfolg als Bed-and-Breakfast geführt hatte, ließ er es modernisieren, und von nun an gehörte es in die Hotelkategorie. Sämtliche Zimmer besaßen entweder Dusche oder Bad sowie Farbfernsehen, es gab ein Fitnessstudio sowie ein Restaurant, für das er eine Ausschanklizenz erhalten hatte. Vier Jahre später tauchte neben dem Eingang das von allen Hotelbesitzern heiß begehrte Schild auf – die Automobile Association, kurz AA, hatte das Hotel einer Empfehlung in Form eines Sterns für würdig befunden. Dies sorgte für eine weitere Belebung des Geschäfts, sodass Binyon zu expandieren beschloss. Und dies gleich in zwei Richtungen. Zum einen erwarb er weitere, sich unmittelbar an das Hotel anschließende Gebäude, die er nach gründlichen Umbau- und Renovierungsarbeiten als Dependance nutzen wollte, wo er, vor allem in der Hauptreisezeit im Frühjahr und Sommer, weitere Gäste unterbringen konnte. Zum anderen hatte er seit Längerem Überlegungen angestellt, wie der vergleichsweise flauen Auslastung der Zimmer zwischen Oktober und März (insbesondere an den Wochenenden und in der Ferienzeit) begegnet werden könne, und war auf die Idee gekommen, Pauschal-Arrangements anzubieten. Und so ließ er, wie schon in den beiden Jahren zuvor, auch dieses Mal wieder im Herbst halbseitige Anzeigen in die einschlägigen Broschüren »Preiswerte Winterferien-Angebote sowie günstige Weihnachts- und Silvester-Arrangements« der Reiseveranstalter einrücken. Auf Anfrage verschickte Binyon an Interessenten das detaillierte Programm (»Bei diesen Preisen werden Sie kaum widerstehen können«). Das Drei-Tage-Pauschalangebot über Silvester, das die Männer und Frauen, denen wir auf den folgenden Seiten begegnen werden, gebucht hatten, sah folgendermaßen aus:
Dienstag: Silvester
12.30 Uhr
Empfang! John und Catherine Binyon begrüßen alle Gäste, die schon eingetroffen sind, mit einem Sherry.
13.00 Uhr
Lunch-Buffet: eine gute Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen oder neue Bekanntschaften zu schließen.
Am Nachmittag besteht für alle die Möglichkeit, sich Oxford anzusehen; das Stadtzentrum ist zu Fuß in weniger als 10 Minuten zu erreichen. Für diejenigen unter Ihnen, die Spaß an Spiel und Wettkämpfen haben, werden Turniere veranstaltet. Sie haben die Wahl zwischen Darts, Billard, Tischtennis, Scrabble und Videospielen! Den jeweiligen Gewinnern winken Preise!!!
17.00 Uhr
Tee mit Keksen und sonst gar nichts – wir wollen, dass Sie sich Ihren Appetit für den Abend aufheben …
19.30 Uhr
Großes Kostüm-Galadinner
Wir denken, es wird ein Riesenspaß, wenn jeder, wirklich jeder! kostümiert zum Dinner erscheint. Aber keine Angst! Auch wer nicht verkleidet ist, braucht auf seinen Cocktail nicht zu verzichten. Der Abend steht unter dem Motto »Geheimnisvolle Welt des Ostens«, und alle, die Lust haben, bei ihrer Verkleidung ein bisschen zu improvisieren, sind herzlich eingeladen, sich aus unserer »Lumpenkiste« im Aufenthaltsraum zu bedienen.
22.00 Uhr
Prämierung der besten Kostüme, anschließend Live-Kabarett und Tanz, damit Sie, wenn es so weit ist, richtig in Stimmung sind!
24.00 – 1.00 Uhr
Champagner! Auld Lang Syne! Dann ab ins Bett!
Mittwoch – Neujahr
8.30–10.30 Uhr
Ein reichhaltiges kontinentales Frühstück erwartet Sie (und bitte seien Sie möglichst leise, vielleicht hat ja der eine oder andere doch einen Kater).
10.45 Uhr
Schatzsuche per Auto. Die Spuren werden über ganz Oxford verteilt sein, aber die Hinweise sind so klar und eindeutig, dass Sie ganz bestimmt nicht in die Irre laufen, oder besser, fahren. Also, nur Mut! Und steigen Sie ab und zu aus, und genießen Sie die frische Luft in einem hoffentlich zu dieser Stunde noch autofreien Oxford. (Die Schatzsuche wird etwa 1,5 Stunden dauern.) Auf die Sieger warten Preise!!!
13.00 Uhr
Traditioneller englischer Lunch mit Roastbeef.
14.00 Uhr
Für alle, die noch genug Energie haben, veranstalten wir Turniere, die anderen haben Gelegenheit zu einem Mittagsschlaf.
16.30 Uhr
Tee mit Rosinenküchlein und dicker Devonshire-Sahne.
18.30 Uhr
Sie werden abgeholt zu einer Aufführung von Aladin im Apollo-Theater. Bei Ihrer Rückkehr erwartet Sie ein kaltes Buffet, anschließend Tanz, begleitet von der Band Paper Lemon, so lange, bis Ihre Lust und Laune – unser Getränkevorrat bestimmt nie! – erschöpft sind.
Donnerstag
09.00 Uhr
Englisches Frühstück mit allem, was dazugehört.
10.30 Uhr
Letzte Gelegenheit, sich von Ihren alten und neuen Freunden zu verabschieden (und sich vielleicht gleich für nächstes Jahr mit ihnen zu verabreden?).
Natürlich spricht ein solches Angebot nicht jeden an. Es gibt Menschen, denen allein schon der Gedanke, an einem Silvesterabend halb freiwillig, halb gezwungen an einem Darts-Turnier teilzunehmen, sich als Samurai zu verkleiden oder sich auch einfach nur in Gesellschaft anderer ein Stück weit gehen zu lassen, gelinde gesagt, Panik verursacht. Unter den Hotelgästen in den letzten zwei Jahren waren aber immer auch Paare, die, nachdem man sie anfänglich hatte überreden müssen, plötzlich zu ihrer eigenen Überraschung entdeckten, dass sie an den gemeinschaftlichen Aktivitäten, die die Binyons, wenn auch manchmal etwas sehr aufdringlich, anpriesen, tatsächlich Spaß hatten. Einige Paare kamen denn auch in diesem Jahr schon zum zweiten, eines gar zum dritten Mal. Obwohl, um der Wahrheit die Ehre zu geben, gesagt werden muss, dass es sich bei Letzterem um ein eher unangenehmes Gespann handelte, und keiner der beiden auch nur im Traum daran dachte, sich in irgendeiner Form an den gemeinsamen Unternehmungen zu beteiligen. Ihr Spaß bestand gerade darin, den anderen stirnrunzelnd bei ihren, wie sie meinten, pubertären Vergnügungen zuzusehen. Alles in allem waren die Gäste jedoch in der Regel gutwillig, und es kostete in der Regel wenig Mühe, sie zu überreden, sich doch für das große Kostüm-Galadinner eine Verkleidung zu überlegen – mit oft wunderbaren, wenn nicht gar fantastischen Ergebnissen. Auch in diesem Jahr ließ, wie wir sehen werden, der Einfallsreichtum der Gäste nichts zu wünschen übrig. Einige waren so geschickt angezogen und geschminkt, dass selbst alte Bekannte Mühe gehabt hätten, sie zu erkennen.
Zum Beispiel der Mann, der den ersten Preis gewann.
Besonders er!
4
30./31. Dezember
Schläfrig zu sein und nicht ins Bett zu können, ist das mieseste Gefühl der Welt.
E. W. Howe, Sprichwörter aus einem Landstädtchen
Sobald sie müde wurde – dies geschah gewöhnlich in den frühen Abendstunden –, rutschte Miss Sarah Jonstones reichlich groß geratene Brille ein Stück weit die kleine, gerade Nase hinunter. Wenn sie zu dieser Zeit an einem der beiden Telefone einen Anruf entgegennahm, konnte man ihrer Stimme anhören, dass die Freundlichkeit nur noch Routine war, und einem noch spät eintreffenden Reisenden mochte auffallen, dass ihr Lächeln mechanisch wirkte. Aber in den Augen von John Binyon konnte die etwas verblühte Mittvierzigerin wenig, wenn nicht gar nichts falsch machen. Sie war jetzt seit fünf Jahren bei ihm beschäftigt. Angefangen hatte sie als Empfangsdame, doch Binyon hatte schnell erkannt, wie tüchtig sie war, und so war sie bald zur Geschäftsführerin aufgestiegen. Allerdings nur inoffiziell, da Binyons Frau Catherine, eine linkische, reizlose Person, darauf bestand, dass diese Funktion, jedenfalls formal, im Briefkopf und in den Prospekten, mit ihrem Namen verknüpft blieb. In den Prospekten für Ostern, zum Beispiel.
Oder Pfingsten.
Oder Weihnachten.
Oder – wie wir gesehen haben – Silvester.
Weihnachten war nun vorbei, und Sarah Jonstone begann, sich auf ihren Urlaub zu freuen – eine Woche alles hinter sich lassen, vor allem die Silvesterfestivitäten – aus irgendeinem Grund hatten sie Letztere nie in einen Begeisterungstaumel versetzen können.
Das Weihnachts-Arrangement war schon mehr als ausgebucht. Hauptsächlich – wenn auch nicht ausschließlich aus diesem Grund – hatte John Binyon denn auch alles darangesetzt, dass die Umbauarbeiten im frisch hinzuerworbenen Gebäude auf dem Nachbargrundstück zügig vorangingen. Eigentlich war es einmal seine Absicht gewesen, das Hotel mit dem Gebäude auf dem Nachbargrundstück durch einen eingeschossigen Gang zu verbinden. Doch obwohl die Entfernung zwischen den beiden Häusern kaum mehr als zwanzig Meter betrug, hatten sich bezüglich einer möglichen Bodenabsenkung, der Notausgänge und Lieferanteneingänge, der Abflüsse und Gasleitungen derartig komplexe Probleme ergeben, dass Binyon schließlich von seinem ursprünglichen Plan Abstand nahm und sich entschied, die Neuerwerbung als räumlich getrennte Dependance zu führen. Selbst diese Lösung war, wie er fand, noch exorbitant teuer. Der riesige gelbe, dem griechischen Großbuchstaben Gamma ähnliche Kran, der nun schon seit Monaten nebenan im Nachbargarten stand, dort, wo früher Chrysanthemen und Fingerhut geblüht hatten, war für ihn zu einem ärgerlichen Symbol geworden. Seit dem Spätsommer hatten Angestellte wie Gäste des Hotels unter der ständig staubigen Luft oder dem unablässigen Lärm zu leiden gehabt. Doch als der Winter kam und mit ihm ein November, der einen neuen Rekord an Niederschlag brachte, erschienen sowohl Staub als auch Lärm im Nachhinein als völlig unerhebliche Störungen. Denn der Novemberregen hatte die Baustelle langsam, aber sicher in einen Sumpf verwandelt, und der Anblick des zäh-klebrigen, dunkelorangefarbenen Morastes ließ an Bilder des im Ersten Weltkrieg schwer umkämpften westflandrischen Dorfes Passchendaele denken. Der Schlamm war allgegenwärtig: Er klebte an den Rädern der Schubkarren, die die Bauarbeiter benutzten, saß als dicke Kruste auf den Planken, die man ausgelegt hatte, um halbwegs trockenen Fußes von einem Punkt zum anderen zu gelangen, und, was vielleicht am schlimmsten zu ertragen war, verwandelte das Hotelfoyer und auch den Eingang der Dependance, zumindest was die Fußböden anging, in eine Art Stall. Es war ganz klar, dass man unter diesen Bedingungen den Gästen mit den Preisen entgegenkommen musste, und so ließ Binyon seinen Anzeigen in den Prospekten der Reiseveranstalter den Zusatz anfügen, dass zu Weihnachten und Silvester die Preise für die Zimmer im Hauptgebäude einmalig um fünfzehn Prozent, für die drei Doppelzimmer und das Einzelzimmer im Erdgeschoss der erst halb fertigen Dependance sogar um (nicht weniger als) fünfundzwanzig Prozent ermäßigt seien. Und das war nun in der Tat ein günstiges Angebot. Schließlich ruhten während der Feiertage die Bauarbeiten, und es würde weder Lärm noch Staub geben – Schlamm allerdings jede Menge.
Zwar hatten Putzfrauen und Zimmermädchen alles in ihren Kräften Stehende getan, des Drecks Herr zu werden, doch ungeachtet der Tatsache, dass täglich geschrubbt und gesaugt worden war, hatten Läufer, Teppiche und auch das Linoleum auch angesichts einer weiteren Schlechtwetterperiode Anfang Dezember nach den Weihnachtsfeiertagen eine Generalreinigung dringend nötig. Als Termin dafür war der 30. Dezember vorgesehen, damit, wenn am 31. vormittags die ersten Neujahrsgäste eintrafen, alles sauber und bereit wäre. Doch die tatsächliche Durchführung der Reinigungsaktion warf Probleme auf. Personal ist in Hotels sowieso immer knapp, und als ausgerechnet jetzt, wo man eigentlich noch zusätzliche Hilfe gebraucht hätte, zwei Putzfrauen an Grippe erkrankten und ausfielen, gab es keine Alternative: Binyon, seine Frau, Sarah Jonstone und ihre Assistentin Caroline mussten einspringen. Mit Lappen und Bürsten bewaffnet, hatten sie sich an die Arbeit gemacht, und das so erfolgreich, dass gegen Abend in allen Zimmern und auf allen Fluren jeder noch so kleine angetrocknete Lehmkrümel getilgt war. Jetzt erst, als sie fertig waren, spürte Sarah ihre Erschöpfung. Aber alles in allem hatte sie die körperliche Arbeit durchaus als angenehm empfunden. Zwar verspürte sie Muskelkater an Stellen, an denen sie gar keine Muskeln vermutet hatte, vor allem unterhalb der Rippen und in den Kniekehlen, aber gleichzeitig machte die physische Müdigkeit die Aussicht auf die Ferien nur umso verlockender. Zu Hause angekommen, hatte sie sich erst einmal ein ausgedehntes Schaumbad gegönnt. Anschließend hatte sie bei Jenny, ihrer einzigen richtigen Freundin, angerufen, um ihr zu sagen, dass sie sich gerade entschieden hätte, doch an ihrer Party in Nord-Oxford (nur einen Steinwurf von Morse’ Junggesellenwohnung entfernt) teilzunehmen. Jennys Bekannte waren zwar moralisch fragwürdig, aber dafür war kaum einer von ihnen langweilig, und mancher sogar ausgesprochen interessant. Um genau zwanzig nach eins fragte ein dickbäuchiger Deutscher mittleren Alters mit einer Leidenschaft für Thomas Mann eine angetrunkene Sarah plötzlich, ja aus heiterem Himmel, ob sie mit ihm schlafen wolle. Und trotz ihrer kurzen Bekanntschaft hatte sie sich nicht ungern in Jennys Gästezimmer ziehen lassen, wo sie mit dem stark behaarten Rechtsanwalt aus Bergisch Gladbach schnell zur Sache kam. Wie sie in ihre Wohnung im Middle Way zurückgekommen war, daran konnte sie sich nicht mehr sehr deutlich erinnern. Middle Way – wie der aufmerksame Leser sich deutlich erinnern wird – geht ab von South Parade, und an seinem Ende befindet sich ein kleines Postamt.
Sie konnte höchstens drei, vier Stunden geschlafen haben, als es um neun Uhr an ihrer Tür Sturm klingelte. Seufzend warf sie sich ihren Morgenrock über und ging, um zu öffnen. Vor ihr stand John Binyon: Carolines Mutter habe gerade angerufen, um mitzuteilen, dass ihre Tochter die Grippe habe und das Bett nicht verlassen dürfe, geschweige denn zur Arbeit gehen könne. Sie seien in dem Hotel schrecklich in der Klemme, ob sie, Sarah, wohl aushelfen könne? Selbstverständlich würde er ihr für die Überstunden einen Extra-Stundenlohn zahlen, sie könne sich da auf seine Großzügigkeit verlassen. Ob sie also ein paar Tage aushelfen und vielleicht auch im Hotel übernachten könne, so wie es ursprünglich mit Caroline verabredet gewesen sei? Er denke an den kleinen, ungenutzten Raum an der Schmalseite des Hotels, von dem aus man einen Blick hinüber zur Dependance habe.