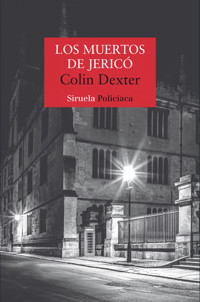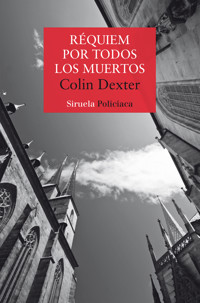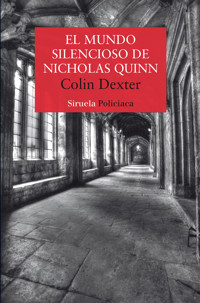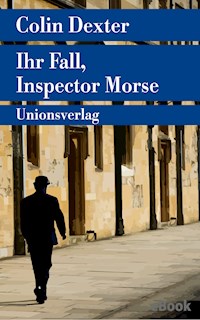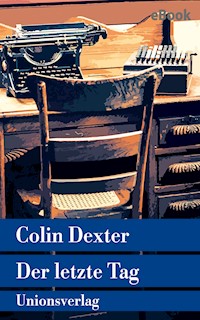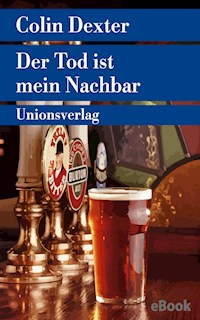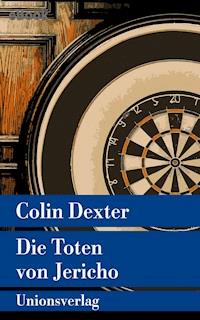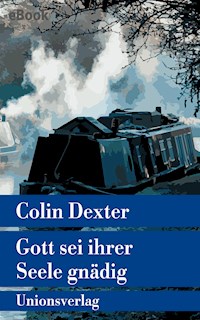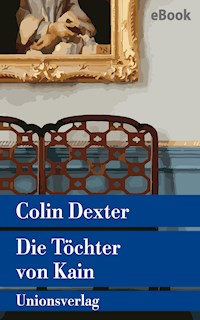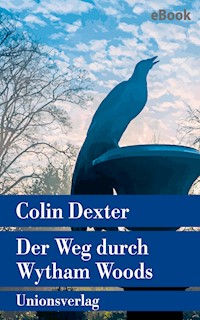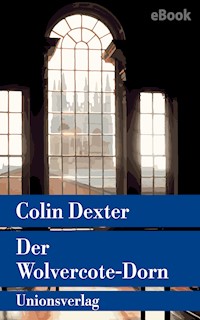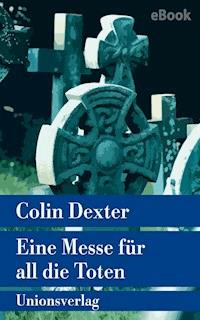9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dr. Browne-Smith, Mitglied der Prüfungskommission des Lonsdale Colleges, ist bei seinen Kollegen nicht unbedingt beliebt. So ist denn auch niemand allzu unglücklich, dass er das Feierabendbier wegen Kopfschmerzen ablehnt. Als er jedoch nicht mehr zur Arbeit erscheint und eine ominöse Abwesenheitsnotiz von ihm auftaucht, wird der Rektor misstrauisch. Sein alter Freund Inspector Morse verspricht, Augen und Ohren offenzuhalten. Kurz darauf hat dieser jedoch ganz andere Sorgen: Aus dem Oxford-Kanal wird eine Wasserleiche geborgen – und mit ihr die Überreste eines Briefs, die Morse scheinbar direkt ins Herz des elitären Lonsdale Colleges führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Als Dr. Browne-Smith, Prüfer am Lonsdale College, nicht mehr zur Arbeit erscheint und eine ominöse Abwesenheitsnotiz von ihm auftaucht, wird der Rektor misstrauisch. Kurz darauf wird im Oxford-Kanal eine Wasserleiche gefunden – und bei ihr die Überreste eines Briefs, die Morse scheinbar direkt ins Herz des elitären Colleges führen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Colin Dexter (1930-2017) studierte Klassische Altertumswissenschaft. Er ist der Schöpfer der vierzehnteiligen Krimireihe um Inspector Morse. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem CWA Diamond Dagger und dem Order of the British Empire für Verdienste um die Literatur ausgezeichnet.
Zur Webseite von Colin Dexter.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Colin Dexter
Das Rätsel der dritten Meile
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Marie S. Hammer
Ein Fall für Inspector Morse 6
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die englische Originalausgabe erschien 1983 bei Macmillan, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1987 im Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek.
Für die vorliegende Ausgabe hat Eva Berié die deutsche Übersetzung nach dem Original überarbeitet.
Originaltitel: The Riddle of the Third Mile
© by Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers International 1987
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags, Reinbek
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Peter Wheeler (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape und Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31029-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 02:35h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAS RÄTSEL DER DRITTEN MEILE
Die erste Meile1 – Montag, 7. Juli2 – Mittwoch, 9. Juli3 – Freitag, 11. Juli4 – Freitag, 11. Juli5 – Freitag, 11. Juli6 – Mittwoch, 16. Juli7 – Mittwoch, 16. Juli, und die darauffolgende Woche8 – Mittwoch, 23. Juli9 – Mittwoch, 23. Juli10 – Mittwoch, 23. Juli11 – Donnerstag, 24. Juli12 – Donnerstag, 24. Juli13 – Donnerstag, 24. Juli14 – Donnerstag, 24. Juli15 – Donnerstag, 24. Juli16 – Donnerstag, 24. Juli17 – Freitag, 25. Juli18 – Freitag, 25. Juli19 – Freitag, 25. Juli20 – Samstag, 26. JuliDie zweite Meile21 – Montag, 28. Juli22 – Hier die Wiedergabe des Briefes, so wie er …23 – Montag, 28. Juli24 – Dienstag, 29. Juli25 – Dienstag, 29. Juli26 – Dienstag, 29. Juli27 – Dienstag, 29. Juli28 – Dienstag, 29. Juli29 – Dienstag, 29. Juli30 – Mittwoch, 30. JuliDie dritte Meile31 – Freitag, 1. August32 – Samstag, 2. August33 – Samstag, 2. August34 – Montag, 4. August35 – Montag, 4. August36 – Montag, 4. August37 – Montag, 4. August38 – Montag, den 4. August39 – Ein voreiliger Epilog40 – Die letzte EntdeckungMehr über dieses Buch
Über Colin Dexter
Colin Dexter: »Ich liebe es, von einem Krimi an der Nase herumgeführt zu werden.«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Colin Dexter
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema England
Zum Thema Spannung
Für meine Tochter Sally
»Und so dich jemand nötigt eine Meile,so gehe mit ihm zwei.«
Matth. 5,41
Die erste Meile
1
Montag, 7. Juli
Ein Veteran der Offensive von El Alamein findet Anlass, sich an den furchtbarsten Tag seines Lebens zu erinnern.
Sie waren einmal drei gewesen – die drei Brüder Gilbert: Alfred und Albert, die Zwillinge, und ihr jüngerer Bruder John, der dann in Nordafrika gefallen war. Das war nun über vierzig Jahre her. An diesem Abend jedoch, während er in einem Nord-Londoner Pub allein vor seinem Bier saß, war in Albert die Erinnerung an seinen Bruder John wieder lebendig. John war weniger robust und auch verletzlicher gewesen als er und Alfred. Aber sie beide, die einander glichen wie ein Ei dem anderen, waren ja auch immer zusammen aufgetreten, Alf und Bert. Sie waren unangreifbar gewesen. Als die Älteren hatten sie stets versucht, John zu beschützen; doch an jenem verhängnisvollen Tag im November 1942 hatten sie nichts für ihn tun können.
In den frühen Morgenstunden dieses Tages war das Unternehmen »Supercharge« gestartet worden, das sich gegen die Wüstenstraße von Sidi Abd el Rahman westlich von El Alamein richtete. Albert hatte in späteren Jahren aufgehört, sich darüber zu wundern, dass diese Operation als Triumph strategischer Planung in die Annalen des Afrikakriegs eingegangen war, da er während seines kurzen, aber heldenhaften Einsatzes vor allem Chaos und Verwirrung um sich herum wahrgenommen hatte. »Das Wichtigste ist, dass die Panzer durchkommen«, hatte die Order gelautet, die am Abend zuvor vom Stab der Panzerbrigade an die Offiziere und Unteroffiziere der Royal Wiltshires, des Regiments, in dem Albert und Alfred dienten, weitergegeben worden war. Sie hatten sich beide im Oktober 1939 freiwillig gemeldet, sich bereits kurz darauf als Panzerfahrer in der Ebene von Salisbury wieder gefunden, waren alsbald zu Unteroffizieren befördert und Ende 1941 nach Kairo verschifft worden. Mitte 1942, als auf beiden Seiten Verstärkung für die bevorstehende Entscheidung zusammengezogen worden war, war auch John zu ihnen gestoßen. Sie hatten es gefeiert, dass sie nun wieder alle drei zusammen waren.
Am Morgen des 2. November drangen Alf und Bert in ihren Panzern entlang der Nordseite des Kidney Ridge vor und gerieten unter heftigen Beschuss von deutschen Flaks und Panzern, die sich bei Tel el Aqqaqir verschanzt hatten. Zwar erwiderten sie das Feuer, aber es war von vornherein ein ungleicher Kampf, da die vorrückenden Panzer der Wiltshires den deutschen Panzerabwehrwaffen ein leichtes Ziel boten, und während sie sich langsam und schwerfällig nach vorn schoben, wurde einer nach dem anderen außer Gefecht gesetzt.
Die Erinnerung war für Albert Gilbert selbst jetzt nach all den Jahren noch immer schmerzhaft, dennoch ließ er die Bilder in sich aufsteigen, ohne sich gegen sie zu wehren. Er hielt es aus. Und es war wichtig, dass er sich erinnerte.
Einer der Panzer an der Spitze, ungefähr fünfzig Meter vor ihm, war in Brand geraten; der Körper des Kommandanten hing leblos aus der Luke, der linke Arm baumelte seitlich am Turm, der Helm auf seinem Kopf war über und über mit Blut bespritzt. Ein zweiter Panzer links von ihm kam schlingernd zum Stehen, als eine deutsche Granate ihm die linke Kette zerfetzte; vier Männer sprangen heraus und rannten, so schnell sie konnten, zurück in die relative Sicherheit der Sandwüste hinter ihnen.
Der Lärm um ihn herum war ohrenbetäubend. Schrapnells stiegen pfeifend auf und brachten im Niederstürzen Tod und Verderben. Männer schrien und flehten und liefen – und starben. Manchen war der Tod gnädig; er kam schnell und unvermittelt. Bei anderen zog sich das Sterben qualvoll hin, während sie tödlich verwundet im Wüstensand lagen. Und wieder andere verbrannten hilflos in ihren Panzern, weil die stählerne Ausstiegsluke sich vor Hitze verzogen hatte oder weil sie durch eine Verletzung nicht mehr die Kraft oder das Geschick hatten, den Panzer zu verlassen.
Dann erwischte es auch den Panzer gleich rechts von Albert. Ein Offizier sprang heraus; mit der Linken hielt er seine blutige rechte Hand umfasst. Er war noch nicht allzu weit von seinem Panzer entfernt, als dieser explodierte und in Flammen aufging.
Alberts Turmschütze schrie ihm von oben zu: »Mein Gott! Hast du das gesehen, Bert? Kein Wunder, dass die Deutschen diese verdammten Dinger ›Tommykocher‹ nennen!«
»Sieh zu, dass du es den Arschlöchern heimzahlst, Wilf«, brüllte Albert zurück. Doch er erhielt keine Antwort mehr, denn Wilfred Barnes, Gemeiner bei der Royal Wiltshire Yeomanry, war tot.
Auf einmal tauchte vor Albert das Gesicht des Soldaten Phillips auf. Er riss die Fahrerluke auf und streckte ihm die Hand entgegen, um ihm beim Aussteigen zu helfen.
»Machen Sie, dass Sie hier wegkommen, Corporal! Die beiden anderen sind hin.«
Sie hatten noch nicht einmal vierzig Meter zurückgelegt, da mussten sie sich hinwerfen, weil vor ihnen ein Geschoss in den Sand einschlug und ein Hagel von Metallsplittern in der Umgebung niederging. Als Albert nach einer Weile aufzublicken wagte, sah er, dass auch der Soldat Phillips tot war – ein Splitter hatte sich tief in seinen Rücken gebohrt. Etliche Minuten saß Albert einfach nur da und starrte vor sich hin, entsetzt und schockiert, aber anscheinend unverletzt. Schließlich ließ er seinen Blick suchend über Beine und Arme wandern, betastete danach erst sein Gesicht, dann seine Brust; zum Schluss probierte er, ob er seine Zehen bewegen konnte. Vor einer halben Minute waren da vier Männer gewesen, jetzt war nur noch einer übrig, er selbst. Sein erster bewusster Gedanke (an den er sich in späteren Jahren immer noch lebhaft erinnerte) galt dem maßlosen Zorn, den er empfand, der jedoch unversehens umschlug in ein Gefühl tiefer Genugtuung, als er plötzlich eine neue Woge von Panzern der 8. Brigade heranbranden und durch die Lücken zwischen den zerstörten, noch immer brennenden Panzern der ersten Angriffsformation hindurch nach vorn stoßen sah. Und dann allmählich verspürte er auf einmal auch so etwas wie Erleichterung – Erleichterung darüber, dass er überlebt hatte, und er stammelte ein Dankgebet.
Und dann hörte er die Stimme.
»Um Himmels willen, Mann, machen Sie, dass Sie hier wegkommen!« Es war der Offizier mit der verwundeten Hand, ein Leutnant aus Alberts Regiment. Er galt, was Disziplin anlangte, als überaus genau und obendrein etwas wichtigtuerisch, war jedoch trotzdem nicht unbeliebt. Er war es gewesen, der ihnen am Abend zuvor das Montgomery-Memorandum zur Kenntnis gebracht hatte.
»Ihre Hand, Sir?«, sagte Albert fragend.
»Das sieht schlimmer aus, als es ist.« Er blickte gleichmütig auf seine rechte Hand hinunter; der Zeigefinger war fast gänzlich abgetrennt und nur noch durch einen Rest von Gewebe mit ihr verbunden. »Und was ist mit Ihnen? Sind Sie verletzt?«
»Nein, ich bin in Ordnung, Sir.«
»Wir gehen nach hinten, zurück zum Kidney Ridge. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig.«
Ungeachtet des grauenhaften Gemetzels um sie herum artikulierte er seine Worte mit der kühlen Präzision eines Radiosprechers, betont und akzentuiert – reinstes Oxford-Englisch.
Sie kamen in dem weichen Sand nur mühsam vorwärts. Nach ein paar hundert Metern fiel Albert plötzlich vornüber.
»Weiter, Mann! Was ist los mit Ihnen?«
»Ich weiß nicht, Sir. Es ist, als ob …« Er blickte auf sein linkes Bein, in dem er plötzlich einen schneidenden Schmerz verspürt hatte, und sah, dass die Kakihose blutgetränkt war. Er beugte sich hinunter, tastete angstvoll nach seiner Wade und spürte unter seinen Fingern eine feuchte, breiige Masse. Er war verwundet worden und hatte es nicht einmal gemerkt. Den Mund zu einem kläglichen Grinsen verzogen, sagte er: »Gehen Sie weiter, Sir. Ich komme schon irgendwie nach.«
Das Zentrum der Schlacht hatte plötzlich begonnen, sich zu verlagern. Ein Panzer, der eben noch auf sie zuzurollen schien, vollführte auf seinen Ketten unvermittelt eine Drehung um 180 Grad, sodass sie nun seine Rückseite sahen; die obere Hälfte war vollständig weggeschnitten. Der schwere Motor lief mit dumpfem Brummen, übertönt vom gequälten Kreischen des Getriebes. Doch Albert horchte auf etwas anderes. Er vernahm den Schrei eines Mannes, einen Schrei in Qual und Todesangst; und ohne zu wissen, was er tat, stand er auf und taumelte auf den Panzer zu, der sich in diesem Moment erneut zu drehen begann, sodass der Sand nach allen Seiten spritzte. Der Fahrer musste noch am Leben sein! Albert vergaß seine Wunde, seine Schmerzen, seine Angst. Vor seinen Augen stand das Gesicht des Soldaten Phillips aus Devizes …
Der Deckel der Fahrerluke war vor Hitze verzogen und ließ sich nicht öffnen – jedenfalls nicht so ohne Weiteres. Es fehlte nicht viel, fast hatte er ihn schon auf … Der Schweiß rann über das Gesicht, als er fluchend und wimmernd zugleich die Luke hochzureißen versuchte. Mit einem sanften, trügerisch harmlosen Plopp! entzündete sich der Treibstofftank, und Albert wusste, dass es jetzt nur noch eine Frage von Sekunden war, bis ein weiterer Soldat zu einem qualvollen Tod verdammt sein würde.
»Um Himmels willen, so helfen Sie mir doch!«, schrie er dem Offizier hinter sich zu. »Ich hab sie schon fast … es …« Ein letztes Mal versuchte er, die Luke zu öffnen, während ihm der Schweiß in Strömen über das Gesicht lief. »Verdammt noch mal, sehen Sie denn nicht, dass …?« Er brach ab und fiel kraftlos zurück auf den Sand, gleichermaßen überwältigt von Erschöpfung wie der Erkenntnis seines Scheiterns.
»Lassen Sie den Unsinn und kommen Sie! Sofort! Das ist ein Befehl!«
Albert kroch zurück über den Sand, tränenblind vor Hass und wilder Verzweiflung. Er hob sein verschmiertes Gesicht, um dem Leutnant in die Augen zu sehen, und erblickte in ihnen einen kalten Glanz … einen Glanz, hinter dem sich gefühllose Feigheit verbarg. Noch immer gellte ihm der Schrei des Panzerfahrers in den Ohren. Erst sehr viel später meinte er, die Stimme des Mannes erkannt zu haben – sein Gesicht hatte er nicht gesehen.
Kurze Zeit darauf wurde er (wie man ihm später erzählte) von einem vorbeikommenden Armeelastwagen aufgenommen. Seine eigene Erinnerung setzte erst wieder ein mit dem Erwachen im Lazarett. Das köstliche Gefühl, in einem bequemen Bett zu liegen, und der Anblick der überaus weißen Betttücher und roten Decken würden ihm wohl bis zu seinem Lebensende im Gedächtnis bleiben. Man wartete zwei Wochen, bis man ihn für gesund genug hielt, um ihm mitzuteilen, dass sein Bruder John, Panzerfahrer bei der 8. Brigade, in der zweiten Phase der Offensive gefallen war.
Damals war er sich fast sicher gewesen, aber eben nur fast. Kein Zweifel bestand jedoch, was die Identität jenes Leutnants anging, der damals am Morgen des Kampfes um Tel el Aqqaqir gewogen worden war – gewogen und für zu leicht befunden. Sein Name hatte sich ihm unauslöschlich eingeprägt: Browne-Smith. Browne mit einem »e« hinten – ein ungewöhnlicher Name, dem er später nicht mehr begegnet war. Bis vor kurzer Zeit.
Bis vor sehr kurzer Zeit …
2
Mittwoch, 9. Juli
Wir wohnen einer Notenkonferenz der Universität Oxford bei,auf der die Prüfer über die Ergebnisseder Bachelor-Abschlussklausuren zu befinden haben.
Was die anderen Arbeiten betrifft, hätte er sonst eine Eins machen können«, sagte der Vorsitzende und blickte erneut auf die sechs vor ihm liegenden Beurteilungen. Keine schlechter als Beta plus und sogar ein paar Alphas dabei. Nur die Note für Griechische Geschichte fiel ab. Ein Beta minus minus/Delta. Nicht gerade Ausweis überragender intellektueller Fähigkeiten.
»Nun, meine Herren, was denken Sie? Ich bin dafür, ihm eine Chance zu geben und ihn in die mündliche Prüfung zu nehmen.«
Fünf der Anwesenden, die um den großen, mit verschiedenen Papieren beladenen Tisch saßen, bekundeten durch ein leichtes Heben der Hände ihr Einverständnis.
»Anderer Ansicht?«, wandte sich der Vorsitzende dem sechsten zu.
»Ganz recht. Ich bin der Meinung, er hat diese Chance nicht verdient – nicht aufgrund dieser Leistungen.« Er wies mit einer abschätzigen Handbewegung auf die Arbeit vor ihm. »Seine Klausur zeigt meines Erachtens eindeutig, dass er von der Geschichte Athens abgesehen vom fünften Jahrhundert so gut wie keine Ahnung hat. Ich bedaure, das sagen zu müssen, aber wenn er es auf eine Eins abgesehen hat, dann hätte er mehr tun müssen.« Er wiederholte seine abschätzige Geste, auf seinem Gesicht einen Ausdruck gelinden Abscheus, der seinen ohnehin stets missmutigen Zügen nicht besonders zuträglich war. Dennoch stand außer Zweifel – und alle Anwesenden hätten dies sofort zugegeben –, dass niemand mit größerer Sicherheit so subtile Entscheidungen wie die zwischen Beta plus und Beta plus plus zu treffen in der Lage war als er. Es gab allerdings auch niemanden, der eine einmal getroffene Entscheidung so unnachgiebig vertrat.
»Wir alle wissen doch aber«, begann einer der anderen Prüfer, »dass unsere Fragen bisweilen etwas nach dem Zufallsprinzip gestellt sind – gerade auch, was griechische Geschichte angeht.«
»Ich habe die Fragen selbst konzipiert«, unterbrach ihn sein Kollege hitzig, »und kann Ihnen versichern, dass sie einen absolut angemessenen Querschnitt repräsentieren.«
Der Vorsitzende wirkte erschöpft. »Meine Herren, wir haben einen langen, anstrengenden Tag hinter uns und sind kurz vor dem Ziel. Lassen Sie uns …«
»Selbstverständlich hat er das Recht auf eine mündliche Prüfung«, sagte einer der Prüfer ruhig, aber entschieden. »Ich habe seine Logikklausur begutachtet – sie ist stellenweise brillant.«
»Das ist auch meine Meinung«, erwiderte der Vorsitzende. »Wir haben durchaus Verständnis für Ihre Haltung, Dr. Browne-Smith, aber …«
Der Angesprochene hob in gespielter Gleichgültigkeit die Schultern. »Bitte. Sie sind der Vorsitzende.«
»Jawohl, ich bin der Vorsitzende, und deshalb erhält dieser junge Mann auch seine Chance.«
Der Logikprüfer mochte diese schroffe Antwort nicht im Raum stehen lassen und griff vermittelnd ein: »Was halten Sie davon, wenn Sie selbst es übernehmen würden, die Prüfung durchzuführen, Dr. Browne-Smith?«
Browne-Smith schüttelte den Kopf. »Nein, ich habe ein Vorurteil gegen den Burschen, und außerdem geht mir die ganze Prüferei, ehrlich gesagt, auch etwas auf die Nerven. Ich habe das Gefühl, als komme ich zu nichts anderem mehr.«
Dem Vorsitzenden schien ebenfalls daran gelegen zu sein, der Konferenz einen friedlichen Abschluss zu geben: »Was meinen Sie, könnten wir nicht Andrews fragen? Glauben Sie, er wäre dazu bereit?«
Browne-Smith nickte uninteressiert. »Er ist ein ganz ordentlicher junger Mann.«
Der Vorsitzende schrieb erleichtert seine Abschlussbemerkung: Am 18. Juli zur mündlichen Prüfung bei Mr Andrews (Lonsdale), während die anderen begannen, ihre Unterlagen einzusammeln.
»Nun, meine Herren, dann darf ich mich bei Ihnen bedanken. Bevor wir uns jetzt trennen, möchte ich Sie aber noch bitten, dass wir uns über den Termin für die abschließende Konferenz einigen. Es kommt eigentlich nur Mittwoch, der 23. oder Donnerstag, der 24. Juli infrage.«
Alle, außer Browne-Smith, zogen ihre Terminkalender aus der Tasche. Man diskutierte kurz und einigte sich schließlich auf Mittwoch, den 23. Juli. Die ganze Zeit über wirkte Browne-Smith, als ob ihn das alles nichts angehe.
Dem Prüfungsvorsitzenden war seine unbeteiligte Haltung nicht entgangen. »Ich hoffe, der Mittwoch ist Ihnen recht, Dr. Browne-Smith?«
Browne-Smith schien einen Moment zu zögern, dann sagte er: »Ich wollte Ihnen gerade mitteilen, dass ich vermutlich an der Konferenz nicht werde teilnehmen können, ich wäre sonst selbstverständlich gern gekommen, aber ich habe an dem Mittwoch … äh … Also, so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich Mitte übernächster Woche gar nicht in Oxford sein.«
Der Prüfungsvorsitzende nickte etwas unbehaglich. Es erschien ihm einleuchtend, dass Browne-Smith nach ihrem Disput keinen besonders großen Wert darauf legte, bei der letzten Konferenz dabei zu sein. »Dann wird uns nichts anderes übrigbleiben, als zu versuchen, so gut wie möglich ohne Sie auszukommen. Auf jeden Fall noch einmal vielen Dank. Sie waren uns bei unseren Entscheidungen eine große Hilfe – wie immer.« Er schloss das dicke schwarze Buch vor sich auf dem Tisch und blickte auf seine Uhr. Fünf nach halb neun. Ja, es war wirklich ein langer Tag gewesen; das mochte ein wenig entschuldigen, dass er gegen Ende so scharf geworden war.
Sechs Angehörige des Prüfungsgremiums beschlossen, noch auf einen Drink in das King’s Arms in der Broad Street zu gehen. Der siebte, Dr. Browne-Smith, bat, ihn zu entschuldigen. Man verabschiedete sich. Browne-Smith verließ das Prüfungsgebäude und schritt die High Street hinunter in Richtung Lonsdale College, das er durch einen Nebeneingang (Nur für Professoren) betrat. In seinen Räumen angekommen, schluckte er sofort sechs Paracetamol und legte sich vollständig angezogen aufs Bett. Es dauerte eine gute Stunde, bis die rasenden Kopfschmerzen nachließen und er einschlief.
Am Morgen des nächsten Tages, es war Donnerstag, der 10. Juli, erhielt er einen Brief. Einen sehr merkwürdigen, geradezu aufregenden Brief.
3
Freitag, 11. Juli
Ein Professor aus Oxford erhält eine Einladung, sich das sündhafte Leben in der Metropole anzusehen.
Dr. phil. Oliver Maximilian Alexander Browne-Smith (mit einem »e« und einem Bindestrich), M. A. war fast siebenundsechzig, doch war es ihm im Laufe der Jahrzehnte nicht gelungen, sich an seine in der Tat reichlich gravitätischen Vornamen zu gewöhnen, geschweige denn, sie zu akzeptieren. Schon zu Beginn seiner Schullaufbahn waren sie – was zu erwarten gewesen war – für seine Mitschüler Anlass gewesen, ihn »Omar« zu nennen. In späteren Jahren hatten sie ihm bei seinen Studenten den Spitznamen »Malaria« eingebracht. Dagegen hatte Omar wirklich noch freundlich geklungen.
Angesichts dieser seiner Unfähigkeit, unangenehme Dinge hinzunehmen, war er deshalb überrascht festzustellen, wie erfreulich schnell, im Verlauf von nur wenigen Wochen, er sich mit der Tatsache abgefunden hatte, dass er vor Ablauf der nächsten zwölf Monate tot sein würde. (»Vermutlich früher, da Sie nun unbedingt darauf bestehen, die Wahrheit zu hören, Dr. Browne-Smith.«) Als er sich an diesem Morgen auf Bahnsteig eins des Oxforder Bahnhofs einfand, konnte er nicht ahnen, dass seine Lebensspanne sogar noch kürzer bemessen war, als sein Arzt, eine anerkannte Kapazität auf seinem Gebiet, prognostiziert hatte.
Wesentlich kürzer.
Den Kopf gesenkt, schritt er zum Ende des Bahnsteigs und registrierte dabei mit Missfallen die vielen leeren Bierdosen auf dem Boden und den überall herumliegenden Abfall. Er wusste, dass etliche Professoren, darunter auch ein paar aus seinem eigenen College, den Morgenzug nach Paddington nahmen, und hoffte, einem Zusammentreffen mit ihnen ausweichen zu können. Unter dem Arm die Times, die er gerade in der Bahnhofsvorhalle gekauft hatte, in der rechten Hand seine braune Aktentasche, stand er leicht fröstelnd da und wartete auf die Ankunft des Zuges; der strahlend blaue Sommermorgen war überraschend kühl.
Die gelbe Schnauze der Diesellok glitt langsam und auf die Minute pünktlich in den Bahnhof. Zwei Minuten später saß er in einem Nichtraucherabteil, ihm gegenüber ein junges Pärchen. Er war an sich ein starker Raucher, der in den vergangenen fünfzig Jahren seinen gequälten Lungen täglich nicht weniger als vierzig Zigaretten zugemutet hatte, doch heute war er entschlossen, während der Fahrt das Rauchen zu unterlassen; eine Übung in Enthaltsamkeit, die ihm den Umständen seiner Reise angemessen erschien. Als der Zug den Bahnhof verließ, wandte er sich der letzten Seite der Times und dem dort abgedruckten Kreuzworträtsel zu. Zu Eins, Zwei und Drei Waagerecht wollte ihm spontan nichts einfallen, doch bei Vier (»Das Erste, worauf der Tourist in Soho aus ist, 10 Buchstaben«) verzog sich sein etwas schiefer Mund zu einem selbstironischen kleinen Lächeln, und er notierte, ohne zu zögern, das Wort »Striptease«. Wie überaus passend! Er fand rasch weitere, sich an Vier Waagerecht oben und unten anschließende Lösungswörter und war mit dem Rätsel fertig, noch ehe sie Reading erreichten. Befriedigt lehnte er sich, soweit es seine langen Beine erlaubten, zurück und schloss die Augen. Einen flüchtigen Moment lang wünschte er sich, das Pärchen gegenüber möge mitbekommen haben, mit welcher Schnelligkeit er die leeren Kästchen gefüllt hatte, und gleich darauf, dass ihnen die Verstümmelung seines Zeigefingers, an dem die letzten beiden Glieder fehlten, hoffentlich entgangen sei. Doch dann begann er sich zu konzentrieren und ernsthaft über den merkwürdigen Anlass seiner Fahrt nach London nachzudenken.
Er verließ den Zug als einer der Letzten. Während er auf die Sperre zuging, warf er einen Blick auf seine Uhr. Erst 10.15 Uhr. Mehr als genug Zeit. Er holte sich bei der Auskunft einen Fahrplan, ließ sich am Buffet des Bahnhofsrestaurants eine Tasse Kaffee geben, zündete sich eine Zigarette an und begann, mögliche Züge für die Rückfahrt herauszusuchen. Er fühlte sich wunderbar locker und entspannt, gönnte sich in Ruhe noch eine zweite Zigarette, die er an der ersten anzündete, und überlegte, um welche Zeit die Pubs und Clubs hier wohl öffneten; schon um elf oder erst später? Aber es war im Grunde nicht wichtig.
Gegen zwanzig vor elf verließ er das Bahnhofsrestaurant und ging hinüber zur Bakerloo Line. Beim Warten in der Schlange vor dem Fahrkartenschalter bemerkte er, dass er den Fahrplan am Buffet liegen gelassen haben musste. Aber auch das war nicht wichtig; ohnehin hatte er sich einige der Verbindungen gemerkt.
Er konnte ja nicht wissen, dass er an diesem Abend nicht mehr nach Oxford zurückkehren würde.
In der U-Bahn öffnete er seine Aktentasche und holte zwei Blatt Papier heraus: einen an ihn gerichteten Brief, der zwar viele Tippfehler aufwies, aber durchaus klar formuliert war (und ihm dennoch Rätsel aufgab) und eine akkurat und fehlerlos von ihm selbst getippte Liste, die die Namen einiger Studenten der Universität Oxford enthielt. Hinter den Namen war in Klammern das jeweilige College angegeben. Die Liste trug in roten Großbuchstaben die Überschrift: Literae Humaniores, Klasse Eins. Browne-Smith warf auf jeden der Bogen nur einen kurzen Blick, so als wolle er sich nur überzeugen, dass sie noch vorhanden seien; dann packte er sie wieder weg.
Als der Zug die Station Edgware Road erreichte, blickte er auf den Linienplan über dem Fenster. Nur noch zwei Stationen. Er spürte ein leichtes Ziehen in der Magengegend. Das lag natürlich an diesem Brief … Ein wirklich merkwürdiger Brief. Das begann schon bei der Adresse. Lonsdale College, Oxford, Zweiter Hof, Aufgang T, Raum 4. Die detaillierten Angaben ließen doch eigentlich nur einen Schluss zu: der Absender wollte auch das kleinste Risiko ausschalten, dass der Brief etwa fehlgeleitet würde. Und er war gut informiert. Browne-Smith sah das College im Geiste vor sich – den zweiten Hof, Aufgang T, sah sich die wenigen Stufen der Treppe zum ersten Absatz hinaufsteigen, so wie er es in den vergangenen dreißig Jahren Tag für Tag getan hatte, sah seine Tür vor sich und das Schild, auf dem handgedruckt in weißen gotischen Lettern sein Name stand. Gegenüber in Nummer 3 wohnte George Westerby. Er lehrte Geografie und war genauso lange am College wie er, tatsächlich sogar ein Semester länger. Ihre gegenseitige tiefe Abneigung war schon beinahe sprichwörtlich; alle im College wussten davon. Das hätte nicht so sein müssen, wenn Westerby zu irgendeinem Zeitpunkt durch eine, wenn auch noch so kleine Geste zu erkennen gegeben hätte, dass er zu einer Versöhnung bereit sei. Aber eine solche Geste hatte es nie gegeben.
Ein Fahrstuhl trug ihn aus der dunklen Tiefe des U-Bahn-Schachtes ins helle Tageslicht von Piccadilly Circus. Er bog in die Shaftesbury Avenue und wandte sich dann nach links in das Gewirr kleiner Straßen und Gassen östlich der Great Windmill Street. Dies war das Viertel der Pornokinos, Sexclubs, der Buchläden mit obszöner Literatur. Browne-Smith ließ sich auf seinem Weg Zeit, blieb hier und da stehen; er genoss es, sich anonym und unbeobachtet in dieser leicht anrüchigen Umgebung zu bewegen. Ohne dass es ihm bewusst wurde, zog ihn Soho mit jedem Schritt mehr in seinen Bann.
In einer kleinen Straße abseits der Brewer Street entdeckte er, ganz wie er erwartet hatte, das Schild mit der Aufschrift: Flamenco Topless Bar. Darunter einen Zusatz: Keine Mitgliedsgebühr. Bitte treten Sie ein! Vom Foyer führten einige flache Stufen, die mit einem schäbigen, völlig abgetretenen Läufer belegt waren, ins Souterrain. Browne-Smith verzögerte den Schritt, und schon stand der picklige junge Mann, der eben noch in der Tür gelehnt hatte, neben ihm.
»Tolle Mädchen hier, Sir. Am besten, Sie gehen hinunter. Keine Mitgliedsgebühr.«
»Mich interessiert nur, ob die Bar geöffnet hat. Ich möchte einen Drink.«
»Aber bitte, ganz wie Sie wünschen. Die Bar hat durchgehend geöffnet.«
Der junge Mann kehrte auf seinen Posten an der Tür zurück. Browne-Smith holte tief Luft und begab sich auf den Weg nach unten. Facilis descensus averno.
Am Fuß der Treppe versperrte ein Samtvorhang den unmittelbaren Zutritt. Browne-Smith überlegte noch, ob er ihn einfach beiseiteschieben solle, als sich der Vorhang oberhalb der Mitte etwas teilte und der Kopf einer jungen Frau erschien. Sie war höchstens zwanzig Jahre alt. Um die haselnussbraunen Augen trug sie dick aufgetragen blauen Lidschatten, ihr voller Mund war jedoch ungeschminkt. Sie blickte ihn an, fuhr mit der Zungenspitze langsam die Konturen ihrer Lippen nach, lächelte ihn dann an und verlangte in freundlichem Ton ein Pfund von ihm.
»Aber draußen steht, Sie erhöben keine Mitgliedsgebühr. Und der Türsteher hat es bestätigt.«
Sie lächelte ihm nachsichtig zu, so wie sie auch all den anderen Männern zulächelte, die Tag für Tag hier vor ihr standen und halbherzig protestierten. »Es ist keine Mitgliedsgebühr, Sir, es ist der Eintritt. Und dafür gibt es ja auch etwas zu sehen.« Sie betrachtete ihn mit einem tiefen Blick, und er beeilte sich, ihr das Geld zu geben.
Die Flamenco Topless Bar war ein niedriger Raum, der an den Wänden entlang in schmale Nischen aufgeteilt war, in denen sich jeweils ein Tisch für zwei Personen befand. Die junge Frau, die ihm das Eintrittsgeld abgefordert hatte, begleitete ihn zu einer der Nischen, reichte ihm eine in imitiertes Leder eingebundene Getränkekarte und zog sich dann ohne ein weiteres Wort wieder auf ihren Platz hinter der Bar zurück, wo sie sich erneut in die Lektüre des Daily Mirror vertiefte.
Browne-Smith studierte aufmerksam die lange Liste der Getränke. Es dauerte ein paar Minuten, bis er sich sicher war, dass ihn jedes auch nur halbwegs alkoholhaltige Getränk mindestens drei Pfund kosten würde. In ihm keimte der Verdacht, dass ein Glas Bier vermutlich noch den reellsten Gegenwert für diesen exorbitanten Preis darstellen würde.
»Was darf ich Ihnen bringen?«
Über den Brillenrand hinweg musterte Browne-Smith fasziniert die junge Frau, die vor ihm stand und sich vorbeugte. Sie war von der Taille an aufwärts nackt. Der enge rosa Rock, den sie trug, war bis hoch hinauf geschlitzt.
»Ein Lager, bitte.«
Sie machte sich auf ihrem Block eine Notiz. »Möchten Sie, dass ich mich zu Ihnen setze?«
»Ja, bitte.«
»Es geht aber nur, wenn Sie mir einen Drink ausgeben.«
»Einverstanden.«
Sie wies mit dem Finger auf die drei letzten der angeführten Getränke auf der Karte.
Flamenco Revenge – eine Liaison von grünäugiger Chartreuse mit erotisierendem Cointreau.
Soho Wallbanger – ein dramatisches Aufeinandertreffen von sinnlichem Wodka und aufreizendem Tia Maria.
Eastern Ecstacy – eine unwiderstehliche Mischung aus stimulierendem Gin und aufregendem Campari.
Preis: Sechs Pfund.
Sechs Pfund!
»Also sechs Pfund, das kann ich mir nicht leisten«, sagte Browne-Smith.
»Ich kann mich nur zu Ihnen setzen, wenn Sie mir einen Drink kaufen.«
»Es ist aber schrecklich teuer. Das kann ich mir wirklich nicht –«
»Dann eben nicht.« Ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen, drehte sie sich um und ging. Nach ein paar Minuten kam sie zurück, stellte schweigend ein kleines Glas Lager vor ihn auf den Tisch und war sogleich wieder verschwunden.
Browne-Smith konnte jedes Wort der Unterhaltung aus der Nebennische hören.
»Wo kommst du denn her?«
»Australien.«
»Ist es dort hübsch?«
»Und ob.«
»Möchtest du, dass ich mich zu dir setze?«
»Aber klar!«
»Dann musst du mir aber einen Drink ausgeben.«
»Mach ich, Baby, such dir was aus!«
Browne-Smith nahm einen Schluck von seinem lauwarmen Lager und blickte sich um. Außer dem Australier in der Nische nebenan gab es nur noch einen Gast, einen Mann unbestimmbaren Alters, der vierzig, fünfzig oder auch schon sechzig sein konnte. Er saß an der Bar und las in einem Buch. Die Tatsache, dass die wenigen ihm noch verbliebenen Kopfhaare bereits grau waren, während sein sorgfältig geschnittener Bart eine durchgängig schwarzbraune Färbung aufwies, ließ in Browne-Smith einen Moment lang die Idee aufkommen, der Mann sei möglicherweise verkleidet, eine Idee, die noch dadurch gestützt wurde, dass der Mann eine unverhältnismäßig große Sonnenbrille trug, die seine Augen vollständig verbarg, erstaunlicherweise jedoch nicht am Lesen zu hindern schien.
Browne-Smith ließ seinen Blick über die schäbige Einrichtung gleiten. Der Teppich, eine Fortsetzung des Treppenbelags, war voller Flecken und in den Nischen und um die Bar herum völlig abgetreten. Die Tische waren aus billigem Plastik, die Korbstühle so wacklig, dass zu befürchten war, sie würden unter dem Gewicht eines kräftiger gebauten Gastes zusammenbrechen. Wände und Decken waren ursprünglich wohl einmal weiß gewesen, hatten jedoch vor allem durch den Zigarettenrauch im Laufe der Jahre eine schmutzig gelbbraune Farbe angenommen. Angesichts dieses offenbaren Mangels an ästhetischem Empfinden erstaunte ihn die Hintergrundmusik umso mehr. Es war der langsame Satz aus Mozarts 21. Klavierkonzert (gespielt von Barenboim, wie Browne-Smith hätte schwören können). Er empfand die Musik an diesem Ort als in höchstem Maße unpassend, etwa so als würde man in der St Paul’s Cathedral Shakin’ Stevens zu Gehör bringen.
Ein neuer Gast betrat die Bar, wurde zu seiner Nische begleitet und, dem anscheinend hier üblichen Ritual entsprechend, von ebenderselben weißbrüstigen Schönen aufgesucht, die auch Browne-Smith sein Bier serviert hatte. Der Mann an der Theke blätterte in seinem Buch eine Seite weiter, der Australier nebenan versuchte lautstark und ohne besonders viel Feingefühl von dem Mädchen an seinem Tisch zu erfahren, wie weit ihr Entgegenkommen reiche. Sie sei genau das, was er sich immer vorgestellt habe, über den Preis würden sie sich doch einigen können. Das Mädchen hinter der Bar hatte den Daily Mirror offenbar ausgelesen und legte das Blatt gelangweilt zur Seite; der langsame Satz des Klavierkonzerts kam zu Ende.
Browne-Smith hatte sein Glas geleert. Da die einzigen zwei anwesenden Hostessen eifrig damit beschäftigt waren, Soho Wallbangers und Flamenco Revenges – aus was auch immer sie bestehen mochten – zu schlürfen, stand er auf, ging hinüber zur Bar und nahm auf einem der Hocker Platz. »Noch ein Bier, bitte.«
»Ich bringe es Ihnen an den Tisch.«
»Nein, machen Sie sich keine Mühe. Ich kann es hier trinken.«
»Ich sagte, ich bringe es Ihnen an den Tisch!«
»Sie haben doch wohl nichts dagegen, dass ich hier sitze, oder?«
»Sie sollen sich wieder an Ihren Tisch setzen! Verstehen Sie kein Englisch?« Sie gab sich keine Mühe mehr, höflich zu sein, ihre Stimme klang hart und giftig.
»Na schön«, sagte Browne-Smith ruhig. »Ich will keinen Ärger machen.« Er setzte sich ein paar Schritte von der Bar entfernt an einen Tisch, beobachtete das Mädchen und wartete.
»Haben Sie nicht verstanden, was ich gesagt habe?« In ihrer Stimme schwang ein drohender Unterton mit, aber Browne-Smith, sonst äußerst empfindlich, was den Ton anging, den man ihm gegenüber anschlug, entschied, es ihr durchgehen zu lassen. Fürs Erste. Es war noch nicht der richtige Zeitpunkt, um schweres Geschütz aufzufahren, und außerdem genoss er die Situation.
»Ich kann Ihnen versichern, dass ich durchaus verstanden habe, was Sie gesagt haben, aber –«
»Sie scheinen noch immer nicht kapiert zu haben! Wenn Sie unbedingt eine Abreibung haben wollen, dann gehen Sie gegenüber in die Sauna. Okay?«
»Aber ich begreife nicht ganz –«
»Noch mal sage ich es Ihnen nicht!«
Browne-Smith stand auf und ging ohne Eile zur Theke. Der Mann mit dem Buch blätterte eine Seite weiter, als ob ihn der sich zuspitzende Streit nicht berührte.
»Ich möchte jetzt ein anständiges Glas Bier, falls es hier so etwas gibt«, sagte Browne-Smith, ohne die Stimme zu heben.
»Wir haben hier nur Lager, und wenn Ihnen das nicht passt …«
Browne-Smith ließ sein Glas auf die Theke krachen und blickte das Mädchen durchdringend an. »Lager? Das Zeug nennen Sie Lager? Pferdepisse ist das, Miss. Lassen Sie sich das gesagt sein.«
Sein dramatischer Auftritt hatte sie sichtlich verstört. Mit zitternder Hand wies sie auf den Vorhang und sagte: »Machen Sie, dass Sie hinauskommen!«
»Ich sehe nicht ein, warum.«
»Sie haben gehört, was die junge Dame gesagt hat.« Es war der Mann mit dem Buch. Er hatte es weder für nötig befunden, den Blick zu heben noch mit besonders lauter Stimme (West-Country-Akzent?) zu sprechen, dennoch besaßen seine Worte eine Autorität, die jeden Widerspruch auszuschließen schien.
Browne-Smith schien ihn gar nicht wahrzunehmen, denn er starrte weiter unverwandt das Mädchen an: »Wagen Sie es nicht noch einmal, so mit mir zu sprechen!«
Die Entschlossenheit, die in seiner Stimme mitschwang, ließ es dem Mädchen geraten erscheinen zu schweigen. Der Mann aber schlug sein Buch zu und hob zum ersten Mal den Blick. Die Finger seiner rechten Hand wanderten langsam über die kräftig ausgebildeten Muskeln seines linken Oberarms, und als er sich bedachtsam von seinem Hocker gleiten ließ und sich direkt vor Browne-Smith aufbaute, stellte er, obwohl er vier bis fünf Zentimeter kleiner war als dieser, durchaus einen ernst zu nehmenden Gegner dar. Die beiden Männer sahen einander schweigend an.
Der Samtvorhang und die Treppe nach oben waren nur etwa drei Meter entfernt, und Browne-Smith hätte durchaus noch Zeit für einen schnellen, wenn auch nicht rühmlichen Rückzug gehabt. Er ließ die Gelegenheit jedoch ungenutzt verstreichen, und noch bevor er irgendwelche weiteren Überlegungen anstellen konnte, fühlte er, wie der andere mit hartem Griff sein Handgelenk umfasste und ihn unsanft in Richtung auf eine Tür mit der Aufschrift Privat vor sich herschob.
Während sein Begleiter an die Tür klopfte, warf Browne-Smith über die Schulter einen Blick zurück und nahm mit geradezu fotografischer Deutlichkeit zweierlei wahr: zum einen das Gesicht des Australiers, auf dem sich Überraschung in milden Schrecken zu wandeln begann, zum zweiten den Titel des Buches, das der Mann gelesen hatte. Er lautete: Führer durch das Köchelverzeichnis.
Dem Australier war bestimmt, später niemals über diese Begebenheit zu sprechen. Doch selbst wenn er es getan hätte, hätte er wohl kaum jenen rätselhaften Augenblick erwähnt, in dem der eine der beiden Männer, derjenige, der offenbar die Störung verursacht hatte, plötzlich auf seine Uhr geschaut und mit bewundernswert ruhiger Stimme gesagt hatte: »Meine Güte! Genau zwölf.«
In den ersten Sekunden, nachdem er die Schwelle überschritten hatte, spürte Browne-Smith wieder jenen stechenden Schmerz, der sich einer Säge gleich durch sein Gehirn zu fressen schien, und war unfähig, irgendetwas um sich herum wahrzunehmen außer eben diesen Schmerz. Doch genauso plötzlich, wie er gekommen war, verging er wieder, und Browne-Smith sah, dass er sich in einem Büro befand, und hatte das Gefühl, durchaus wieder Herr der Lage zu sein.
George Westerby hatte an jenem Morgen zufällig aus dem Fenster gesehen und war, während er seinen Blick über die Rasenfläche des Innenhofs schweifen ließ, Zeuge geworden, wie sich die hochgewachsene Gestalt (er war etliche Zentimeter größer als er selbst) gegen 8.15 Uhr mit energischen, weit ausgreifenden Schritten in Richtung auf das Pförtnerhäuschen entfernt hatte. In diesem Moment traf ihn die Erkenntnis (und wie er sich darüber freute!), dass er seinen verhassten Kollegen Browne-Smith nun wohl die längste Zeit hatte ertragen müssen und ihm sein Anblick in Zukunft erspart bleiben würde. Denn George Westerby hatte kürzlich seinen achtundsechzigsten Geburtstag begangen und traf jetzt Anstalten, sich ins Privatleben zurückzuziehen. Eine Speditionsfirma kümmerte sich bereits um die Unmasse von Büchern; die Hälfte der Regale war schon leer, die Bücher waren in Stößen zusammengebunden und in unzähligen Kartons, die allmählich das ganze Zimmer verstellten, eingepackt. Bald würden die großen Holzkisten ankommen und auch die ungeschlachten, muskelbepackten Umzugsleute eintreffen, die sein kostbares Hab und Gut nach London schaffen würden, in die Wohnung, die er sich dort gekauft hatte. Die neuen Räume boten natürlich sehr viel weniger Platz, als ihm hier zur Verfügung stand, und so sah er, was das Aufstellen seiner Möbel anging, schon einige Schwierigkeiten voraus. Doch darüber wollte er sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen, das hatte Zeit bis nach den Ferien. Erst einmal würde er aufbrechen zu den Ägäischen Inseln … Und dann über das azurblaue Meer hinüber nach Asien …