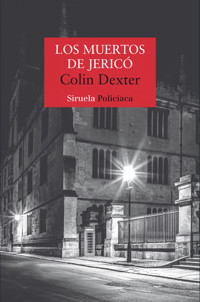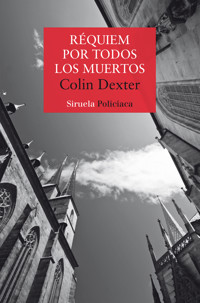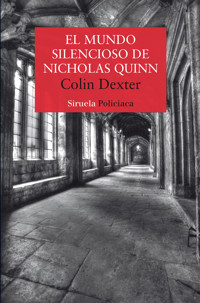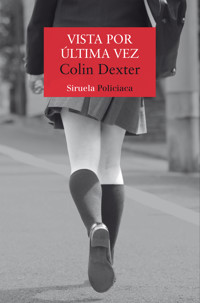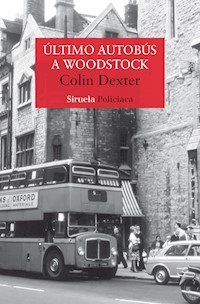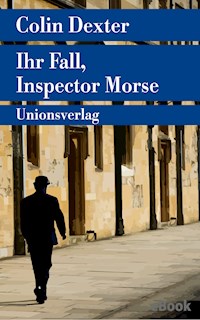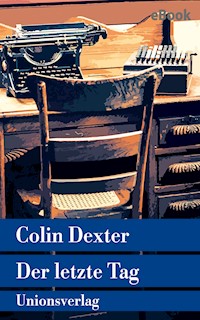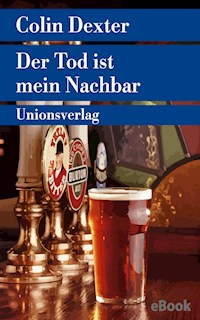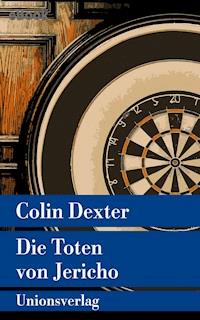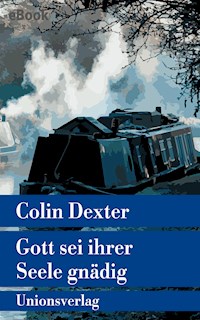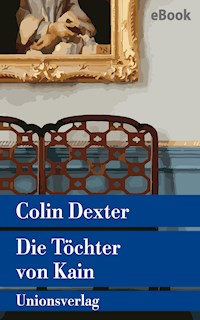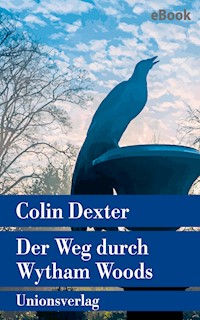4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Inspector Morse hält nicht viel von Vorschriften. Während sein Untergebener, Sergeant Lewis, penibel nach Polizeihandbuch ermittelt, folgt Morse lieber seiner Intuition, wobei ihn das tägliche Kreuzworträtsel der Times immer wieder auf verblüffende Fährten bringt. Vor allem, wenn er bei einem Pint Bitter in einem verrauchten Pub seinen Gedanken nachhängt. Eine herausfordernde Bewährungsprobe ist der Fall der spurlos verschwundenen Valerie Taylor, die vor mehr als zwei Jahren von zu Hause weggelaufen ist. Morse sieht nicht die geringste Chance, das Mädchen noch lebend zu finden. Bis ein Brief eintrifft, der scheinbar Valeries Unterschrift trägt, und der damalige Ermittler kurz darauf bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Morse glaubt nicht an einen Zufall.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
Vor zwei Jahren ist die junge Valerie Taylor spurlos verschwunden. Inspector Morse soll den Fall neu aufrollen, sieht aber keine Chance, das Mädchen noch lebend zu finden. Bis ein Brief eintrifft, der Valeries Unterschrift trägt, und der damalige Ermittler kurz darauf bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Morse glaubt nicht an einen Zufall.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Colin Dexter (1930-2017) studierte Klassische Altertumswissenschaft. Er ist der Schöpfer der vierzehnteiligen Krimireihe um Inspector Morse. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem CWA Diamond Dagger und dem Order of the British Empire für Verdienste um die Literatur ausgezeichnet.
Zur Webseite von Colin Dexter.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Colin Dexter
Zuletzt gesehen in Kidlington
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Marie S. Hammer
Ein Fall für Inspector Morse 2
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die englische Originalausgabe erschien 1976 bei Macmillan, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1985 unter dem Titel … wurde sie zuletzt gesehen im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek.
Für die vorliegende Ausgabe hat Eva Berié die deutsche Übersetzung nach dem Original überarbeitet.
Originaltitel: Last Seen Wearing
© by Macmillan, an imprint of Pan Macmillan, a division of Macmillan Publishers International 1976
Übernahme der Übersetzung mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags, Reinbek
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Marko Pekić (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31023-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 09.12.2022, 19:16h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ZULETZT GESEHEN IN KIDLINGTON
Vorspiel1 – Der Schönheit FahneWeht purpurn noch auf Lipp’ und …2 – Wenn man dort schon singt, lasse man sich …3 – Ein Mann ist wenig nütze, wenn seine Frau …4 – Soweit ich feststellen konnte, hatten sie nichts miteinander …5 – Sie hat sich abgekehrt, doch mit der herbstnen …6 – Freilich hat er viel Einbildungskraft und eine sehr …7 – Französisch sprach sie auch mit feinem Klang8 – Die Striptease-Künstlerin Gypsy Rose Lee traf gestern in …9 – So hören wir von einer Gesamtschule in Connecticut …10 – Mir blieb keine Zeile von ihr11 – Alle Frauen werden wie ihre Mütter. Das ist …12 – Dabei wird der Deckel der Mülltonne mechanisch geöffnetIm …13 – Er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht14 – Denn ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan15 – Es ist doch seltsam, Sam, dass die Leute …16 – Erfahren wollen sie die Geheimnisse des Hauses und …17 – Und all das Leid, das ihn so bewegt18 – In philologischen Werken bezeichnet das Kreuz † ein …19 – Eines Morgens vermisste ich ihn auf dem gewohnten …20 – Alibi (lat. alibi, anderswo); Nachweis der Abwesenheit vom …21 – John und Mary bekommen jeder 20 Pence …22 – Verstehen lässt sich das Leben nur im Rückblick …23 – Wenn er das Nachdenken über Gott und sich …24 – »Ist da jemand?«, rief der Reisende und klopfte …25 – Gesicht und Hals zunächst reinigen, dann leicht mit …26 – … nicht mehr als eine Ausschmückung, um einer …27 – Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie …28 – Ein übel aussehend Ding, Herr, aber mein eigen29 – Incest is only relatively boring30 – Geld kostet oft zu viel31 – Ihr, Herr Gouverneur32 – Wenn man alles Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das …33 – She’ll be wearing silk pajamas when she comes34 – Die Dinge sind nicht immer, was sie zu …35 – »Jetzt hör zu, du kleiner Taugenichts«, flüsterte Sikes …36 – Niemand handelt aus einem einzigen Motiv heraus37 – Der bunte, plauderhafte, scheue Tag38 – Da warens nur noch zwei39 – Die einzige Möglichkeit, die ich kenne, einen Zug …40 – Denn lang schon waren sie und ich vertraut41 – Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit42 – Ich kam offen, um ihn ehrlich zu erdolchenEpilogMehr über dieses Buch
Über Colin Dexter
Colin Dexter: »Ich liebe es, von einem Krimi an der Nase herumgeführt zu werden.«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Colin Dexter
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema England
Vorspiel
Der Zug auf Gleis eins fährt in Kürze ab
Er war recht zufrieden mit sich. Natürlich ließ sich noch nichts Bestimmtes sagen, aber doch, ja – er hatte seine Sache gut gemacht. Er rief sich die einzelnen Phasen des Gesprächs noch einmal ins Gedächtnis zurück: ihre Fragen – klug und zugleich auch wieder töricht – und seine sorgfältig überlegten und, da war er sicher, gut formulierten Antworten. Zwei oder drei erschienen ihm im Nachhinein besonders gelungen, und in der Erinnerung daran huschte, während er dastand und wartete, ein flüchtiges Lächeln um seinen energischen, gut geschnittenen Mund. Eine seiner Erwiderungen war ihm noch im Wortlaut gegenwärtig:
»Meinen Sie nicht, dass Sie für dieses Amt noch etwas zu jung sind?«
»Da haben Sie sicher nicht ganz unrecht. Es ist ein sehr verantwortungsvoller Posten, und ich bin überzeugt, dass es Zeiten geben wird, wo ich – immer vorausgesetzt, dass Sie mir diese Aufgabe anvertrauen – dankbar auf den Rat von Älteren und Erfahreneren zurückgreifen werde.« Einige der betagteren Kommissionsmitglieder hatten bedeutungsvoll genickt. »Leider steht es nicht in meiner Macht, falls die fehlenden Jahre ein Hinderungsgrund sein sollten, daran etwas zu ändern. Das Einzige, was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass dieses Manko – wenn es denn von Ihnen als solches empfunden wird – im Laufe der Zeit von selbst verschwindet.«
Nicht eben originell. Das Argument hatte er von einem früheren Kollegen, der sich rühmte, als Erster darauf gekommen zu sein. Der gedämpften Heiterkeit und dem wohlwollenden Gemurmel nach zu urteilen, hatte es auch hier die beabsichtigte Wirkung erzielt. Und keines der dreizehn Mitglieder des Gremiums schien es vorher schon einmal gehört zu haben.
Man würde sehen.
Wieder lächelte er und sah auf die Uhr. Halb acht. Seinen Zug um 20.35 Uhr würde er auf jeden Fall noch bekommen. Ankunft in London 21.42 Uhr, dann durch die Stadt zum Bahnhof Waterloo. Gegen Mitternacht konnte er zu Hause sein, vorausgesetzt, er hatte ein bisschen Glück mit dem Anschluss. Doch darüber machte er sich im Augenblick nicht viele Gedanken. Er fühlte sich sehr unbeschwert, in einer Art Aufbruchsstimmung und im Einklang mit sich und der Welt. Ob das an den beiden doppelten Whisky lag, die er sich vorhin, nachdem alles vorbei war, genehmigt hatte? Er würde die Stelle bekommen. Auf einmal war er fest davon überzeugt.
Jetzt war Februar. Seine Kündigungsfrist betrug ein halbes Jahr. Er zählte die Monate an den Fingern ab: März, April, Mai, Juni, Juli, August. Das würde also keine Probleme geben.
Er ließ seinen Blick über die Häuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite wandern. Ziemlich elegant. Vier Schlafzimmer, große Gärten. Er würde sich eines dieser kleinen Treibhäuser anschaffen, die in Fertigteilen geliefert wurden, und Tomaten ziehen, vielleicht auch Gurken wie Diokletian – oder war es Hercule Poirot gewesen?
Er trat aus dem scharfen Wind zurück in das hölzerne Wartehäuschen. Es hatte wieder zu nieseln begonnen. Ab und zu sauste auf der nassen Straße zischend ein Auto vorbei. Die Fahrbahn schimmerte im Licht der Straßenlampen orange … Dumm, dass sie kurz vor Schluss noch auf seine Dienstzeit bei der Armee zu sprechen gekommen waren.
»Sie sind also nicht als Offizier entlassen worden?«
»Nein.«
»Gab es dafür einen bestimmten Grund?«
»Ich glaube, ich war nicht gut genug. Ich meine, zum damaligen Zeitpunkt. Als Offizier muss man bestimmte Voraussetzungen mitbringen …« Er geriet ins Schwimmen, zwang sich aber weiterzureden. Nur nicht stocken, sich nichts anmerken lassen! »Und ich war … also, ich brachte diese Voraussetzungen einfach nicht mit. Damals trat eine große Zahl sehr befähigter Männer in die Armee ein, die mir, was natürliche Autorität und Selbstvertrauen anging, überlegen waren.« Belass es dabei. Sei bescheiden.
Ein pensionierter Oberst und ein Major a. D. nickten beifällig. Wenn ihn nicht alles täuschte, hatte er soeben zwei weitere Stimmen gewonnen.
Es war immer dasselbe bei diesen Einstellungsgesprächen. Man musste möglichst dicht an der Wahrheit bleiben, durfte jedoch nicht den Fehler begehen, wirklich aufrichtig zu sein. Fast alle Männer, mit denen er in der Armee näher zu tun gehabt hatte, waren an Public Schools erzogen worden. Ihr Selbstbewusstsein schien grenzenlos, sie hatten den richtigen Akzent. Es waren Leutnants, Oberleutnants, Hauptmänner. Sie hatten die Offizierslaufbahn als ihr Geburtsrecht reklamiert, und ihr Anspruch war zu gegebener Zeit eingelöst worden. Über Jahre hinweg hatte er wegen dieser Bevorzugung einen dumpfen Neid verspürt. Schließlich hatte er genau wie sie eine Public School absolviert …
Die Busse verkehrten offenbar nur in größeren Abständen, und ihm kamen Zweifel, ob er noch rechtzeitig zur Abfahrt des Zuges um 20.35 Uhr am Bahnhof sein würde. Er trat einen Schritt vor und blickte die gut erleuchtete Straße hinunter, ehe er sich wieder in den Schutz des Wartehäuschens zurückzog, dessen Holzwände, wie nicht anders zu erwarten, mit gekritzelten und eingeritzten Obszönitäten übersät waren. Der unvermeidliche Kilroy hatte auf seinen rastlosen Wanderungen auch hier seinen Namenszug hinterlassen, und mehrere ortsansässige Prostituierte hatten die Wände dazu benutzt, potenziellen Kunden ihre Willfährigkeit zu annoncieren. Eine Enid liebte einen Gary und ein Dave eine Monica. Zahlreiche Verwünschungen legten den Schluss nahe, dass Oxford United seine Fans seit einiger Zeit ziemlich frustriert haben musste. Allen Faschisten wurde geraten zu verschwinden. Für Angola, Chile und Nordirland wurde Freiheit gefordert. Eine Scheibe in einer der Seitenwände war eingeschlagen, und hier und dort blinkten zwischen eingetrockneten Apfelsinenschalen, leeren Chipstüten und zerbeulten Coladosen Glasscherben. Abfall! Angewidert verzog er das Gesicht. Solchen Abfall fand er obszöner als obszöne Kritzeleien. Wäre er der Boss, er würde ein striktes Abfallgesetz erlassen. Aber auch auf seinem neuen Posten würde er diesbezüglich einige Möglichkeiten haben. Wenn sie ihn wirklich nahmen …
Wo blieb nur der Bus? Schon Viertel vor acht! Vielleicht blieb er doch besser über Nacht in Oxford. Die Entscheidung stand ihm frei. Und wenn schon Angola und anderen Freiheit gewährt werden sollte, warum nicht auch ihm? Es war schon Jahre her, dass er mehr als einen Tag getrennt von seiner Familie verbracht hatte. Er würde nichts verlieren, im Gegenteil. Die Schulbehörde hatte sich bei der Erstattung der Reisespesen außerordentlich großzügig gezeigt. Das Auswahlverfahren musste die Gemeindekasse einiges gekostet haben. Nicht weniger als sechs Bewerber in der engeren Auswahl – und einer sogar aus Inverness! Der würde die Stelle wohl kaum bekommen. Alles in allem schon eine merkwürdige Erfahrung, so eine Begegnung von Konkurrenten. Mehr als oberflächliche Freundlichkeit kam von vornherein nicht auf. Wie auf einem Schönheitswettbewerb. Alle lächeln sich an, obwohl sie sich am liebsten die Augen auskratzen würden.
Plötzlich fiel ihm noch eine Frage ein, die sie gestellt hatten: »Vorausgesetzt, Sie würden das Amt übernehmen, was denken Sie, wäre zunächst Ihr größtes Problem?«
»Ich könnte mir vorstellen, der Hausmeister.«
Seine Antwort war ganz ernst gemeint, und der begeisterte Ausbruch von Heiterkeit, den er damit auslöste, verblüffte ihn. Erst hinterher hatte er erfahren, dass der jetzige Pedell eine Art Unmensch zu sein schien, den alle wegen seiner Widerspenstigkeit und Übellaunigkeit insgeheim fürchteten.
Ja, er würde den Posten bekommen. Und eine wichtige taktische Maßnahme würde sein, sich die Anerkennung des Kollegiums und der Schüler zu sichern, indem er dieses Ekel von Hausmeister vor die Tür setzte. Als Nächstes kam der Abfall an die Reihe. Und danach …
»Warten Sie auf den Bus?«
Er hatte nicht mitbekommen, wie sie das Wartehäuschen betreten hatte. Unter ihrem Plastikhut glänzte ihr Gesicht von Regentropfen. Er nickte. »Scheint ja nicht gerade häufig zu fahren.« Sie kam auf ihn zu. Ein hübsches Mädchen. Ihr Mund gefiel ihm. Schwer zu sagen, wie alt sie war. Achtzehn? Vielleicht auch jünger.
»Es muss gleich einer kommen.«
»Na, hoffentlich haben Sie recht.«
»Ungemütliches Wetter.«
»Ja.« Er ärgerte sich. Das hatte so abschließend geklungen, dabei hätte er sich gerne noch weiter mit ihr unterhalten. Wenn sie schon beide hier warten mussten, konnten sie wenigstens miteinander reden. Sie schien ähnlich zu denken wie er, hatte aber offenbar nicht seine Hemmungen.
»Wollen Sie nach Oxford?«
»Ja. Ich möchte den Zug um 20.35 Uhr nach London erwischen.«
»Den kriegen Sie noch.« Sie zog ihren glänzenden Plastikmantel aus und schüttelte die Tropfen ab. Ihre Beine waren schlank, fast mager, aber wohlproportioniert. Er spürte eine leichte Erregung. Der Whisky …
»Wohnen Sie in London?«
»Nein, zum Glück nicht. Ich lebe in Surrey.«
»Wollen Sie da heute noch hin?«
Das genau war die Frage. »Wenn man erst in London ist, geht es schnell.«
Sie schwieg.
»Und Sie wollen heute Abend nach Oxford?«, fragte er.
»Ja. Hier ist ja nichts los«, sagte sie. Sie war wohl doch jünger, als er zuerst gedacht hatte. Ihre Blicke trafen sich, und einen Moment lang sahen sie einander in die Augen. Wirklich, ein schöner Mund. Er genoss es, hier bei ihr zu stehen – vielleicht ein bisschen mehr, als er eigentlich sollte. Er lächelte sie an. »Und im großen, bösen Oxford lässt sich was erleben?« In seiner Stimme lag gutmütiger Spott.
Sie betrachtete ihn lauernd. »Kommt drauf an, was man will.« Bevor er in Erfahrung bringen konnte, was sie wollte und welche Vergnügungen die alte Stadt außerhalb der universitären Mauern bot, fuhr ein roter Doppeldeckerbus an die Haltestelle, und ein Schwall schmutzig braunen Regenwassers ergoss sich über seine auf Hochglanz polierten schwarzen Schuhe. Die automatischen Türen öffneten sich geräuschvoll, und er trat zur Seite, um das Mädchen vorzulassen. Den Fuß auf der Treppe zum Oberdeck, drehte sie sich zu ihm um: »Kommen Sie auch hoch?«
Oben war es leer. Sie setzte sich ganz nach hinten und lächelte einladend. Ihm blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Er hatte eigentlich auch nichts dagegen.
»Haben Sie eine Zigarette?«
»Nein, tut mir leid. Ich rauche nicht.« War sie ein Flittchen und wollte ihn ausnehmen? Sie benahm sich fast so. Vermutlich hatte sie ihn nach seiner Kleidung taxiert, dem korrekten dunklen Anzug, dem weißen Hemd, der Krawatte, die ihn als ehemaligen Cambridge-Studenten auswies, dem gediegenen Mantel sowie seiner schwarzen Lederaktentasche, und hielt ihn für einen gut situierten Londoner Geschäftsmann. Vielleicht war sie darauf aus, dass er ihr in einer Lounge-Bar ein paar teure Drinks spendieren würde, aber da hatte sie sich getäuscht. Nach der Fahrt würde er sich sofort von ihr verabschieden. Und trotzdem spürte er sofort wieder, wie sie ihn auf eine merkwürdige Art und Weise anzog. Sie nahm den durchsichtigen Regenhut ab und schüttelte ihr langes dunkles Haar. Es duftete frisch gewaschen.
Der Schaffner kam auf sie zu und blieb vor ihnen stehen.
»Zweimal nach Oxford, bitte.« Er hatte es gesagt, ohne zu überlegen.
»Und wohin genau?« Es klang unfreundlich.
»Ja, also – ich will zum Bahnhof«, sagte er zögernd.
Sie traf die Entscheidung: »Zweimal zum Bahnhof, bitte.«
Der Schaffner gab ihnen die Fahrkarten und stieg müde wieder nach unten.
Darauf war er nicht vorbereitet gewesen, und er wusste auch nicht, was er hätte sagen sollen. Sie schob ihren Arm unter seinen und drückte sanft seinen Ellbogen an sich. »Der würde bestimmt gerne wissen, was wir vorhaben.« Sie kicherte übermütig. »Jedenfalls vielen Dank, dass Sie für mich mitbezahlt haben.« Sie beugte sich zu ihm herüber und küsste ihn leicht auf die Wange.
»Sie haben vorhin gar nicht erwähnt, dass Sie auch zum Bahnhof wollen.«
»Will ich auch eigentlich gar nicht.«
»Wohin wollen Sie denn dann?«
Sie rückte näher. »Weiß nicht.«
Einen schrecklichen Augenblick lang befürchtete er, dass sie etwas beschränkt sei. Dann musste er über sich selbst lächeln. Nein, sie war nicht zurückgeblieben, ganz im Gegenteil; sie wusste besser, was lief, als er. Er war erleichtert, als der Bus vor dem Bahnhof hielt. Erst 20.17 Uhr. Noch über eine Viertelstunde, bis sein Zug fuhr.
Sie stiegen zusammen aus. Vor dem Bahnhofseingang unter einem Hinweisschild mit der Aufschrift FAHRKARTEN/BUFFET blieben sie stehen und sahen sich an. Es nieselte immer noch. »Darf ich Sie zu einem Drink einladen?« Es sollte beiläufig klingen.
Sie nickte, »’ne Cola wär nicht schlecht.«
Ihre Anspruchslosigkeit überraschte ihn. Er hätte erwartet, dass sie die Gelegenheit genutzt und einen Gin oder Wodka verlangt hätte, etwas, was sie sich sonst nicht leisten konnte. Aber was wollte sie dann? »Wirklich nur eine Cola?«
»Ja, vielen Dank. Ich mag keinen Alkohol.«
Sie betraten die Bahnhofsgaststätte. Er bestellte für sich einen doppelten Whisky und für sie eine Cola und eine Schachtel Benson & Hedges. »Für Sie.«
Sie schien sich ehrlich zu freuen, riss die Packung gleich auf, zog eine Zigarette heraus und zündete sie an. An ihrer Cola nippte sie nur. Der Minutenzeiger an der großen Uhr über der Tür zu den Bahnsteigen rückte unerbittlich gegen halb vor. »Es wird Zeit, dass ich auf den Bahnsteig gehe. Also …« Er zögerte, griff dann entschlossen nach seiner Aktentasche, die er neben dem Stuhl abgestellt hatte. Er wandte sich ihr zu, und wieder trafen sich ihre Blicke. »Es war schön, Sie kennengelernt zu haben. Vielleicht treffen wir uns eines Tages mal wieder.« Er stand auf. Sie sahen sich noch immer in die Augen. Jetzt zu gehen, fiel ihm schwer.
Sie sagte: »Ich wünschte, wir könnten etwas Unartiges tun. Sie nicht auch?«
O Gott – ja, natürlich. Sein Atem ging plötzlich schneller, und sein Mund war auf einmal ganz trocken. Über den Lautsprecher kam die Ansage, dass der Zug, Abfahrt 20.35 Uhr, nach London/Bahnhof Paddington über Reading auf Gleis eins Einfahrt habe. Fahrgäste nach … Es rauschte an ihm vorbei. Er hätte jetzt lächelnd gestehen sollen, wie sehr auch ihm das gefallen würde, dann ein freundliches Kopfnicken, schon etwas distanziert, und mit drei, vier Schritten wäre er an der Tür gewesen, die zum Bahnsteig führte, wo sein Zug auf ihn wartete. Nur diese paar Schritte – und alles wäre anders gekommen. Nach Monaten und selbst noch Jahren sollte er immer wieder bitter mit sich ins Gericht gehen, dass er für diese wenigen rettenden Schritte nicht die Kraft gehabt hatte.
»Aber wo können wir denn hingehen?«, hörte er sich fragen. Die Thermopylen lagen unbewacht, und die persischen Heermassen strömten ungehindert nach Griechenland ein.
1
Der Schönheit FahneWeht purpurn noch auf Lipp’ und Wange dir,Hier pflanzte nicht der Tod sein bleiches Banner
Shakespeare, Romeo und Julia, 5. Aufzug, 3. Szene
Dreieinhalb Jahre später saßen sich in einem Büro zwei Männer gegenüber.
»Sie haben die Akten. Mit dem vorhandenen Material sollte sich etwas anfangen lassen.«
»Ihm scheint es aber nicht weitergeholfen zu haben.« Morse’ sarkastischer Ton brachte deutlich zum Ausdruck, was er von der ganzen Sache hielt.
»Vielleicht hat er erfahren, was zu erfahren war.«
»Sie meinen, sie sei von zu Hause weggelaufen, und damit hätte sichs?«
»Wäre doch denkbar.«
»Und was erwarten Sie jetzt von mir? Wo nicht mal Ainley sie gefunden hat?«
Chief Superintendent Strange gab nicht gleich eine Antwort, sondern sah an Morse vorbei auf die mit roten und grünen Aktenordnern vollgestopften Regale. »Stimmt«, sagte er schließlich, »er hat sie nicht gefunden.«
»Und er hat den Fall von Anfang an bearbeitet.«
»Von Anfang an«, sagte Strange.
»Und ist keinen Schritt vorangekommen.«
Strange schwieg.
»Dabei verstand er etwas von seiner Arbeit«, sagte Morse nachdrücklich und fragte sich im nächsten Moment, warum, zum Teufel, er sich überhaupt darauf eingelassen hatte, mit Strange zu argumentieren. Da war eines Tages ein Mädchen von zu Hause weggelaufen und danach nicht mehr gesehen worden. Na und? Jahr für Jahr liefen Hunderte von Mädchen von zu Hause weg. Die meisten meldeten sich früher oder später, wenn der Reiz des Neuen verflogen war und das Geld knapp wurde, und kamen wieder zurück. Es gab allerdings auch einige, von denen hörte man nichts mehr, zugegeben. Und für die, die daheim vergeblich auf sie warteten, brachte jeder Tag neuen Schmerz. Ja, einige kamen nie mehr zurück … Nie mehr.
Stranges Frage unterbrach seinen melancholischen Gedankengang. »Sie übernehmen also den Fall?«
»Hören Sie, wenn Ainley …«
»Nein, Sie hören!«, blaffte Strange. »Ainley war ein verdammt besserer Polizist, als Sie es jemals sein werden. Und genau aus diesem Grund, gerade weil Sie in vielerlei Hinsicht kein guter Polizist sind, habe ich mich entschlossen, Ihnen den Fall zu übertragen. Sie mit Ihrer sogenannten Intuition und … ach, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll.«
Aber Morse war schon klar, was er meinte. In gewisser Weise hätte es ihn freuen können. Vielleicht tat es das sogar ein bisschen. Aber andererseits – zwei Jahre. Zwei volle Jahre! »Der Fall ist doch längst gestorben, Sir, das wissen Sie selbst. Die Leute vergessen. Und das ist gut so. Manche müssen vergessen. Zwei Jahre sind eine lange Zeit.«
»Zwei Jahre, drei Monate und zwei Tage«, präzisierte Strange.
Morse stützte das Kinn in die Linke und rieb sich mit dem Zeigefinger einen Nasenflügel. Mit seinen grauen Augen starrte er auf die Betondecke des Innenhofes. Hier und dort sprossen vereinzelt Grashalme. Ein kleines Wunder. Ob sie sich wirklich durch den harten Beton drängten? Sichere Methode, eine Leiche verschwinden zu lassen – unter Beton. Außerdem schön einfach. Man brauchte bloß … »Sie ist tot«, sagte er plötzlich.
Strange sah ihn an. »Was bringt Sie zu der Behauptung?«
»Das kann ich nicht so genau sagen. Aber wenn es all die Jahre nicht gelungen ist, sie zu finden, nun, ich denke, da liegt die Vermutung nahe, dass sie nicht mehr am Leben ist. Einen Toten zu verstecken ist schon schwer, aber einen lebenden Menschen noch ungleich schwerer. Er liegt ja nicht nur da, sondern steht auf, geht umher, begegnet anderen Leuten. Nein, ich nehme an, sie ist tot.«
»Ainley war auch dieser Ansicht.«
»Und Sie?«
Strange zögerte einen Augenblick. »Ich habe seine Ansicht geteilt.«
»Dann hat er also die Sache in Wirklichkeit als Mordfall behandelt?«
»Offiziell nicht – nein. Da hat er sich an die vorliegenden Fakten gehalten. Das heißt, er hat nach einem als vermisst gemeldeten Mädchen gesucht.«
»Und inoffiziell?«
Strange zögerte erneut. »Ainley ist mehrere Male bei mir gewesen wegen des Falles. Er muss ihn sehr beschäftigt haben. Es gab da einige Aspekte, die ihn, nun, sagen wir mal, beunruhigten.«
Morse sah verstohlen auf die Uhr. Zehn nach fünf. Die National Opera gastierte gerade im New Theatre mit einer Inszenierung der Walküre, und er hatte sich für den heutigen Abend eine Karte besorgt. Die Vorstellung begann um halb sieben.
»Es ist zehn nach fünf«, sagte Strange, und Morse fühlte sich fast wie in seiner Schulzeit, wenn der Lehrer ihn beim Gähnen ertappt hatte. Schule … Valerie Taylor war, als sie verschwand, noch ein Schulmädchen – er hatte damals über den Fall gelesen. Etwas über siebzehn. Ausgesprochen hübsch. Träume vom aufregenden Leben in der Großstadt. Begeisterung, Sex und Drogen, dann Prostitution, Abrutschen ins kriminelle Milieu, Gosse. Zum Schluss die Reue. Wir alle bereuen am Ende. Und danach? Zum ersten Mal, seit er in Stranges Büro saß, fühlte Morse so etwas wie Interesse. Was war mit Valerie Taylor geschehen?
Als Strange wieder zu reden begann, war es fast wie eine Antwort auf Morse’ nur in Gedanken gestellte Frage. »Am Ende hielt Ainley es für möglich, dass sie Kidlington niemals verlassen hat.«
Morse schaute ruckartig auf. »Was hat ihn bloß auf diese Idee gebracht?« Er sprach langsam und spürte dabei eine ihm wohlvertraute innere Erregung. Die Walküre war in diesem Augenblick vergessen.
»Nun, es gab da, wie ich schon sagte, einiges, was ihn beunruhigte.«
»Und was genau war das?«
»Sie finden alles in den Akten.«
Also doch Mord? Das war eher sein Metier. Als der Superintendent auf die verschwundene Valerie Taylor zu sprechen gekommen war, hatte er zunächst befürchtet, dass ihm da wieder eine dieser Vermisstensachen aufgehalst werden sollte, bei denen die Ermittlungsarbeit der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen glich – ebenso undankbar, uneindeutig, unendlich. Er wusste nur zu gut, was ihn in dem Fall erwartet hätte: Zuhälter, Nutten, üble Typen in miesen Schuppen, schäbige Straßen und als Nachtquartier irgendwelche heruntergekommenen Hotels in London, Liverpool, Birmingham. Ihm grauste, wenn er nur daran dachte. Und dann die unsägliche Monotonie der polizeilichen Routinemaßnahmen. Überprüfen. Noch mal überprüfen. Nichts. Das Ganze noch einmal von vorn. Ohne dass ein Ende abzusehen war. Aber das alles blieb ihm ja nun zum Glück erspart. Er konnte aufatmen. Doch schon ließ ihn ein neuer Gedanke wieder unruhig werden: Warum gerade jetzt? Warum ausgerechnet heute, Freitag, den 12. September – zwei Jahre, drei Monate und … wie viel? … zwei Tage, nachdem Valerie Taylor auf dem Weg von ihrem Elternhaus zurück zur Schule am helllichten Mittag verschwunden war? Er runzelte nachdenklich die Stirn. »Ich nehme an, es hat sich etwas Neues ergeben?«
Strange nickte. »Ja.«
Das war eine gute Nachricht. Passt auf, ihr elenden Sünder da draußen. Er würde darum bitten, Sergeant Lewis für den Fall freizustellen. Er mochte Lewis.
»Und ich bin sicher, dass Sie genau der richtige Mann für diese Aufgabe sind.«
»Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen, Sir.«
»Vor ein paar Minuten hatte ich nicht diesen Eindruck.«
»Um ehrlich zu sein, Sir, ich hatte anfangs vermutet, es handle sich um eine dieser unerfreulichen Vermisstensachen.«
»Da haben Sie ganz richtig vermutet.« Stranges Stimme war plötzlich von einer unnachgiebigen Härte. »Und damit kein falscher Eindruck entsteht: Es kann keine Rede davon sein, dass ich Sie bitte, den Fall zu übernehmen, sondern ich ordne es hiermit an.«
»Aber wir waren doch eben noch beide derselben Meinung, dass …«
»Sie waren der Meinung. Es hat sich herausgestellt, dass Ainleys Annahme falsch war. Valerie Taylor ist höchst lebendig.« Er ging zu einem der Aktenschränke, schloss ihn auf und entnahm ihm einen einfachen braunen Briefumschlag, an dem mit einer Büroklammer ein schmaler Bogen billigen Briefpapiers befestigt war. Er gab beides Morse. »Sie können es ruhig in die Hand nehmen. Es war schon im Labor – keine Fingerabdrücke. Da hat sie nun endlich doch noch nach Hause geschrieben.«
Morse sah unglücklich auf die drei kurzen, mit ungelenker Hand geschriebenen Zeilen:
Liebe Mami, lieber Papi, nur damit ihr Bescheid wisst, dass ich gesund bin, und euch keine Sorgen macht. Es tut mir leid, dass ich euch nicht eher geschrieben habe, aber bei mir ist alles okay.
Viele liebe Grüße, Valerie
Der Briefumschlag trug keinen Absender. Morse entfernte die Büroklammer und betrachtete den Poststempel. Der Brief war am Dienstag, dem 2. September, in London EC4 aufgegeben worden.
2
Wenn man dort schon singt,lasse man sich ruhig nieder
Wort mit O, vier Buchstaben
Links von ihm saß ein ungeheuer dicker Mann. Er war sehr knapp vor Beginn der Ouvertüre hereingekommen und hatte sich unter kurzatmig hervorgestoßenen Entschuldigungen ächzend die Reihe »J« entlang zu seinem Platz gequält, einem Schwertransporter nicht unähnlich, der unter Schwierigkeiten eine schmale Brücke passiert. Nachdem er glücklich seinen Sitz erreicht und sich in seiner ganzen erstaunlichen Leibesfülle niedergelassen hatte, stand ihm vor lauter Anstrengung der Schweiß auf der Stirn, und er rang nach Luft wie ein gestrandeter Wal.
Morse zur Rechten saß eine spröde wirkende junge Dame mit Brille in einem langen dunkelroten Kleid. Auf ihren Knien hielt sie die umfangreiche Partitur. Morse hatte ihr, als er seinen Platz einnahm, höflich zugenickt, woraufhin sich ihre Lippen den Bruchteil einer Sekunde lang zu der Andeutung eines Lächelns verzogen hatten, bevor ihr Gesicht wieder einen Ausdruck frostiger Reserviertheit annahm. Morse konnte sich angenehmere Gesellschaft vorstellen.
Aber es blieb ihm ja der Genuss der wunderbaren Musik. Er dachte an das ergreifende Liebesduett im ersten Aufzug. Hoffentlich war der Sänger des Siegmund seiner Partie gewachsen, denn diese Tenorpassage war mit das Schönste, was klassische Oper zu bieten hatte – aber eben auch sehr schwierig. Der Dirigent schritt durch den Orchestergraben, bestieg das Podium und bedankte sich mit einer liebenswürdigen Verbeugung für den Begrüßungsapplaus. Das Licht erlosch, und Morse lehnte sich mit einem Gefühl freudiger Erwartung zurück. Nachdem auch das letzte Husten schließlich verstummt war, hob der Dirigent seinen Stab. Die Walküre hatte begonnen.
Nach kaum mehr als zwei Minuten fühlte sich Morse auf einmal abgelenkt. Er warf einen schnellen Seitenblick nach rechts und stellte fest, dass die bebrillte Mona Lisa neben ihm von irgendwo eine Taschenlampe hervorgeholt hatte und den Lichtstrahl, den Noten folgend, über die Partitur gleiten ließ. Die Seiten knisterten und raschelten beim Umblättern. Der langsam hin- und herwandernde Schein ließ Morse unwillkürlich an einen Leuchtturm denken. Geschenkt. Sobald sich der Vorhang hob, würde sie die Beschäftigung mit der Partitur wohl ohnehin aufgeben. Aber ärgerlich war es schon. Plötzlich fiel ihm auf, dass es im Saal sehr heiß war, und er überlegte, ob er sich die Jacke ausziehen sollte. Im selben Augenblick wurde er gewahr, dass der Koloss links neben ihm in Bewegung geriet. Offenbar hatte er denselben Gedanken gehabt und war jetzt dabei, ihn in die Tat umzusetzen. An den Rand seines Sitzes gedrängt, verfolgte Morse in einer Art ohnmächtiger Faszination die Bemühungen seines beleibten Nachbarn, die Jacke loszuwerden, was diesem mehr Schwierigkeiten bereitete als dem in die Jahre gekommenen Houdini, sich aus einer Zwangsjacke zu befreien. Von aufgebrachtem Zischen der Umsitzenden begleitet, brachte er sein Vorhaben schließlich zu einem guten Ende, hielt einen Moment inne und begann dann, sich schnaufend in die Höhe zu hieven, um das lästige Kleidungsstück unter sich hervorzuziehen. Sein Klappsitz schlug mit einem lauten Knall gegen die Rückenlehne, wurde wieder heruntergedrückt und gab, als der Dicke sich darauf niederließ, eine Art Stöhnen von sich. Erneutes Zischen in der Umgebung – dann endlich herrschte in Reihe »J« wieder Ruhe und Frieden. Die Bebrillte war allerdings noch immer mit ihrer Taschenlampe zugange – für Morse’ empfindsames Gemüt eine unschöne Beeinträchtigung seines Kunstgenusses. Aber mit so etwas musste man vielleicht rechnen. Wagnerianer waren ein verrückter Haufen.
Morse schloss die Augen, um sich ganz den vertrauten Klängen hinzugeben. Exquisit.
Im ersten Moment glaubte er, der kräftige Knuff sei dazu bestimmt, seine Aufmerksamkeit zu erregen, doch als er sich mit fragendem Blick zur Seite wandte, wurde ihm klar, dass dem Dicken mitnichten an Kommunikation gelegen war, dass der Rippenstoß vielmehr Teil seiner raumgreifenden Bemühungen war, an ein Taschentuch zu gelangen. Bei dem sich noch ausweitenden zähen Kampf fand Morse plötzlich einen Zipfel seines Jacketts unter der Leibesfülle des Nachbarn eingeklemmt. Sein vorsichtiger Versuch, ihn dort wieder hervorzuziehen, trug ihm einen strafenden Blick von Florence Nightingale ein.
Gegen Ende des ersten Aufzugs war Morse’ Stimmung auf dem Nullpunkt angelangt. Siegmund krächzte mehr, als dass er sang, Sieglinde schwitzte fürchterlich, und hinter ihm knisterte irgendein Banause unaufhörlich mit seiner Bonbontüte. In der Pause flüchtete er an die Bar, ließ sich erst einen Whisky geben, und gleich hinterher noch einen. Als es zum zweiten Aufzug klingelte, bestellte er sich den dritten. Das junge Mädchen, das eben hinter ihm gesessen und den Hals hatte recken müssen, um über seine Schulter zu sehen, hatte während der beiden noch folgenden Aufzüge einen freien Blick auf die Bühne. Offenbar veranlasste sie das, ihren Süßigkeitenkonsum eher noch zu steigern, denn mit der zweiten Tüte Bonbons war sie noch schneller fertig als mit der ersten.
Es muss allerdings gesagt werden, dass wohl auch unter weniger ungünstigen Umständen die Oper an diesem Abend wohl kaum Morse’ ungeteilte Aufmerksamkeit gefunden hätte, denn immer wieder kreisten seine Gedanken um das Gespräch mit Strange – und um Ainley. Vor allem um Ainley. Chief Inspector Ainley … Morse hatte ihn nicht gut gekannt. Nicht wirklich gut. Ein ruhiger Typ. Freundlich, aber nicht mehr. Ein Einzelgänger. Morse hatte ihn immer etwas fade gefunden. Zurückhaltend, vorsichtig, einer, der sich an die Vorschriften hielt. Verheiratet, keine Kinder. Daran würde sich nun auch nichts mehr ändern, denn Ainley war tot. Nach Aussage eines Augenzeugen hatte er den Unfall selbst verursacht: Er war ausgeschert, um zu überholen. Offenbar hatte er den Jaguar, der sich ihm von hinten mit hoher Geschwindigkeit näherte, nicht bemerkt. Es war auf der M40 in der Nähe von High Wycombe passiert. Der Fahrer des Jaguars war wie durch ein Wunder unverletzt geblieben. Aber Ainley hatte es erwischt. So ein unbedachtes Manöver sah ihm eigentlich nicht ähnlich. Vielleicht war er mit seinen Gedanken woanders gewesen … Er hatte für die Fahrt nach London den eigenen Wagen benutzt und war an seinem freien Tag unterwegs gewesen. Das war erst elf Tage her. Die Nachricht von seinem Tod war natürlich für alle, die ihn gekannt hatten, ein Schock gewesen, aber da war niemand, der wirklich um ihn trauerte und ihn vermisst hätte. Mit Ausnahme seiner Frau … Morse war ihr nur einmal, im vergangenen Jahr bei einem Polizeikonzert, begegnet. Sie war noch ziemlich jung, jedenfalls sehr viel jünger als er; recht hübsch, aber keine Frau, bei deren Anblick ihm die Knie weich wurden. Er meinte, sich erinnern zu können, dass sie Irene hieß. Oder Eileen? Nein, wohl Irene.
Sein Whiskyglas war leer, und er blickte sich suchend um. Das junge Mädchen, das ihn bedient hatte, war nirgends zu sehen. Über den Zapfhähnen hingen ordentlich gefaltet die Wischtücher. Außer ihm war keine Menschenseele mehr da. Es hatte keinen Sinn, noch länger hier sitzen zu bleiben.
Er ging die Treppe hinunter und trat hinaus in den warmen, dämmrigen Sommerabend. Ein großes Plakat neben dem Eingang, das fast die ganze Breite der Wand einnahm, verkündete in schwarzen und roten Lettern: ENGLISH NATIONAL OPERA, Montag, 1. Sept – Samstag, 13. Sept. Er spürte plötzlich ein Prickeln im Rücken. Montag, der 1. September. Das war der Tag, an dem Dick Ainley ums Leben gekommen war. Und der Brief war am 2. September aufgegeben worden. Am Tag darauf. Das konnte natürlich ein Zufall sein, vielleicht aber auch nicht. Es war denkbar, dass … Morse hielt inne. Er musste aufpassen, dass er sich nicht zu voreiligen Schlussfolgerungen hinreißen ließ. Oder? Polizeilich verboten war es ja nicht … Ainley war also am 1. September, einem Montag, in London gewesen, und dort war irgendetwas geschehen, das ihn innerlich sehr beschäftigte. Hatte er dort etwa, nach mehr als zwei Jahren, Valerie Taylor gefunden? Es wäre doch möglich. Und aufgrund seines Besuches hatte sich Valerie gleich am nächsten Tag hingesetzt und nach Hause geschrieben – zum ersten Mal seit ihrem Verschwinden. So ganz zufrieden war Morse nicht mit dem, was er sich zurechtgelegt hatte. Die Akte Taylor war zwar nicht abgeschlossen worden – natürlich nicht –, aber mangels neuer Spuren schon seit längerer Zeit auf Eis gelegt, und Ainley war mit etwas ganz anderem beschäftigt gewesen. Er war an den Ermittlungen wegen der Serie von Bombenattentaten in den letzten Monaten beteiligt gewesen. Warum also plötzlich wieder der Fall Taylor? Doch halt mal! Ainley war an seinem freien Tag nach London gefahren. Hatte er vielleicht …?
Morse drehte um und ging ins Theater zurück. Ein livrierter Logenschließer informierte ihn, dass die Vorstellung erstens ausverkauft und zweitens bereits zur Hälfte vorbei sei. Morse bedankte sich und steuerte die Telefonkabine an. Der Logenschließer kam hinter ihm her und trat ihm fast auf die Hacken. »Ich bedaure, Sir, aber die Benutzung dieses Telefons ist nur unseren Besuchern gestattet.«
»Genau das bin ich«, sagte Morse, hielt ihm seine Karte unter die Nase und zog nachdrücklich die Tür hinter sich zu. Er schlug das Telefonbuch auf, Adderly … Allen, schon zu weit … Ainley. Es gab nur den einen – R. Ainley, Wytham Close 2, Wolvercote. Ob sie zu Hause war? Es war schon Viertel vor neun. Er hielt es gut für möglich, dass Irene oder Eileen, oder wie immer sie nun hieß, sich bei Freunden aufhielt. Oder sie war zu Verwandten gefahren. Sollte er es trotzdem versuchen? Eigentlich war das ganze Hin- und Herüberlegen völlig überflüssig. Am Ende würde er ja doch fahren. Er notierte sich die Adresse. Mit federnden Schritten ging er – an dem vorsichtig lächelnden Logenschließer vorbei – auf den Ausgang zu.
»Auf Wiedersehen, Sir.«
Auf dem Weg zu seinem Wagen, den er in der nahe gelegenen St. Giles Street abgestellt hatte, kam Morse sein Benehmen auf einmal kindisch vor. Er hätte wirklich zurückgrüßen können. Der Mann tat schließlich nur seine Pflicht. Wie ich, dachte Morse, während er ohne große Begeisterung Oxford in Richtung Norden verließ, um nach Wolvercote zu fahren.
3
Ein Mann ist wenig nütze,wenn seine Frau Witwe ist
Schottisches Sprichwort
Am Kreisverkehr, wo die Woodstock Road nördlich von Oxford auf die Umgehungsstraße trifft, bog er scharf nach links, überquerte die Eisenbahnbrücke, auf der er als Junge gestanden und oft wie gebannt den Dampflokomotiven nachgeblickt hatte, und fuhr den Hügel hinunter nach Wolvercote.
Der Ort selbst bestand nur aus den paar schmucklosen grauen Natursteinhäusern, die die Dorfstraße säumten. Morse kannte Wolvercote von früheren Besuchen – oder besser gesagt, seine beiden Pubs. Er war, was Bier anging, eigentlich nicht wählerisch, gab jedoch grundsätzlich einem Ale den Vorzug vor dem schaumreichen Gebräu, das heutzutage in ständig wachsendem Maß produziert wurde, und kehrte deshalb, wann immer er in diese Gegend kam, gern in einem der beiden Wirtshäuser des Dorfes ein, wo man noch Ale vom Fass bekam. So hielt er vor dem King Charles, stellte seinen Lancia im Hof ab, tauschte bei einem Bier mit der Wirtin ein paar Freundlichkeiten aus und erkundigte sich nach Wytham Close.
Er musste nicht weit fahren. Knapp hundert Yards die Dorfstraße zurück und dann rechts. Wytham Close war eine hufeisenförmig geführte Sackgasse. Zu beiden Seiten befanden sich in einigem Abstand von der Straße auf einer kleinen Anhöhe je fünf dreigeschossige Reihenhäuser, deren gewollt anspruchsvolle Fassaden wohl an städtische Bürgerhäuser erinnern sollten. Jedes hatte seine eigene betonierte Auffahrt, die direkt zu der im Haus befindlichen Garage führte. Im blassen Schein zweier Straßenlaternen schweifte Morse’ Blick über eine weitläufige, von keinem Zaun unterbrochene Rasenfläche, die einen überaus gepflegten Eindruck machte. Nummer zwei lag im Dunkeln, bis auf ein Fenster im ersten Stock, wo hinter orangefarbenen Vorhängen noch Licht brannte. Die Türklingel durchschnitt die Stille in der dunklen Sackgasse.
Im Flur wurde Licht gemacht, und hinter den Milchglasscheiben der Haustür erschien ein undeutlicher schwarzer Schatten.
»Ja, bitte?«
»Ich hoffe, ich störe nicht.«
»Oh, Sie sind es, Inspector. Hallo.«
»Ich dachte …«
»Wollen Sie nicht hereinkommen?«
Morse’ Ablehnung, als sie ihm etwas zu trinken anbot, war so offensichtlich widerwillig vorgetragen, dass sie sofort versuchte, ihn umzustimmen, was ihr auch ohne Mühe gelang. Sie brachte ihm einen Gin Tonic, und er bemühte sich, die richtigen Worte zu finden. Im Großen und Ganzen gelang es ihm auch.
Mrs Ainley war eine zierliche kleine Frau mit hellbraunem Haar und zarten Gesichtszügen. Gemessen an dem Verlust, den sie vor elf Tagen erlitten hatte, sah sie nicht einmal allzu elend aus, nur die tiefen Schatten unter ihren Augen verrieten, was sie durchgemacht hatte.
»Wollen Sie hier wohnen bleiben?«
»Ich denke schon. Es gefällt mir hier.«
Morse verstand sie gut. Vor einem Jahr hätte er selbst beinahe ein Haus in der Gegend gekauft. Vor allem der Blick aus den rückwärtigen Fenstern über die grüne Weite von Port Meadow hinüber zu der in blauer Ferne sich abzeichnenden Gruppe majestätischer Türme und zu der mächtigen Kuppel der Radcliffe Camera war ihm im Gedächtnis geblieben. Ein Panorama wie auf einem Ackermann-Druck, aber real, und nur zwei, drei Meilen entfernt.
»Darf ich Ihnen noch einen Gin anbieten?«
»Ach nein, lieber nicht«, sagte Morse, sein Blick eine einzige Bitte.
Sie fragte denn auch noch einmal nach: »Bestimmt nicht?«
»Nun ja, ein kleines Glas könnte ich vielleicht noch vertragen.« Er zögerte und wagte dann einen Schritt nach vorn: »Sie heißen Irene, oder?«
»Eileen.«
Dass ihm das passieren musste! »Denken Sie, dass Sie allmählich darüber hinwegkommen werden, Eileen?«, fragte er leise.
»Ich glaube schon.« Sie senkte den Kopf, beugte sich etwas vor und strich sich abwesend den Rock glatt. »Ich war so unvorbereitet, wissen Sie. Wer hätte denn gedacht, dass Richard …« Die Tränen stiegen ihr in die Augen. Morse ließ sie weinen. Sie fasste sich schnell wieder. »Ich weiß nicht einmal, was er eigentlich in London wollte. Montag war ja sein freier Tag.« Sie schnäuzte sich geräuschvoll, und Morse atmete innerlich auf.
»Ist er oft unterwegs gewesen?«
»Ziemlich oft, ja. Er schien immer irgendetwas zu tun zu haben.« Morse spürte hinter den Worten eine alte Verletztheit und beschloss, seine Fragen möglichst behutsam zu stellen. Aber es musste sein. »Seine Fahrten nach London – könnte es sein, dass er …?«
»Ich weiß nicht, was er da wollte«, unterbrach sie ihn. »Er hat nie viel von seiner Arbeit gesprochen. Er sagte immer, zu Hause wolle er nicht darüber reden.«
»Aber solange ein Fall nicht gelöst war, hat er ihm keine Ruhe gelassen«, stellte Morse fest.
»Ja, das stimmt. Er grübelte fast immer über irgendetwas nach. Besonders …«
»Ja?«
»Ach, ich weiß nicht.«
»Besonders in der letzten Zeit – war es das, was Sie sagen wollten?«
Sie nickte. »Ich glaube, ich weiß sogar, worüber er sich Gedanken machte. Es war diese Sache mit dem Mädchen, das von zu Hause verschwunden war – Valerie Taylor.«
»Woraus haben Sie das geschlossen?«
»Ich habe zufällig gehört, wie er mit dem Direktor ihrer Schule telefoniert hat.« Sie sagte es etwas schuldbewusst, als schämte sie sich, etwas mitbekommen zu haben.
»Können Sie noch sagen, wie lange das her ist?«
»Ungefähr vierzehn Tage, vielleicht auch drei Wochen.«
»Aber es waren doch seit Anfang August Schulferien.«
»Richard hat ihn wohl zu Hause angerufen. Ein paar Tage später hat er ihn dann auch noch aufgesucht.«
Morse fragte sich, was sie wohl sonst noch alles wusste. »An seinem freien Tag?«
Sie nickte langsam und sah Morse dann an. »Warum wollen Sie das alles so genau wissen?«
Morse holte tief Luft. »Ich hätte es Ihnen gleich zu Anfang sagen sollen: Der Fall Taylor wird neu aufgerollt, und man hat mir die Ermittlungen übertragen.«
»Dann muss Richard etwas herausgefunden haben.« Sie sagte es beinahe erschrocken.
»Ich weiß es nicht«, sagte Morse.
»Und deshalb sind Sie heute Abend hier herausgekommen.« Morse schwieg. Eileen Ainley stand abrupt auf und ging mit schnellen Schritten quer durchs Zimmer zu einem Sekretär. »Die meisten seiner Sachen sind schon weg, aber den Taschenkalender hier habe ich noch behalten. Er hatte ihn bei sich, als es passierte.« Sie legte ihn vor Morse auf den Tisch. »Außerdem ist da noch ein Brief für die Buchhaltung im Präsidium. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den für mich abgeben könnten.«
»Selbstverständlich«, sagte er förmlich. Ihre plötzliche Kälte traf ihn. Aber es war leicht, ihn zu treffen. Er hatte keine besonders dicke Haut.
Eileen verließ das Zimmer, um den Brief zu holen. Kaum dass sie draußen war, nahm Morse den Kalender und blätterte ihn hastig durch, bis er beim 1. September war. In Ainleys gestochener, auffallend kleiner Schrift stand dort eine Adresse notiert: Southampton Terrace 42. Das war alles. Morse spürte wieder das Prickeln im Rücken. Auch ohne dass er einen Stadtplan von London hätte zurate ziehen müssen, war er sich völlig sicher, zu welchem Postbezirk die Straße gehörte. Er würde natürlich trotzdem noch einen Blick auf den Plan werfen. Aber er wusste im Voraus, was er finden würde: Southampton Terrace lag in EC4.
Um Viertel vor elf war er wieder in seiner Junggesellenwohnung in Nord-Oxford. Er machte sich sofort auf die Suche nach dem Stadtplan und entdeckte ihn nach einigen Minuten im Bücherregal hinter Swinburnes Gesammelten Werken und einem Band Ausgewählter Beispiele viktorianischer Pornographie. (Den musste er endlich mal an einen weniger ins Auge fallenden Platz stellen.) Eilig überflog er das Straßenverzeichnis. Als er die Straße endlich hatte, zog er ungläubig die Augenbrauen zusammen. Er öffnete den Plan und suchte mittels der angegebenen Koordinaten das betreffende Planquadrat auf. Der Ausdruck von Verwunderung auf seinem Gesicht wandelte sich zu Enttäuschung. Southampton Terrace war eine der vielen Nebenstraßen der Upper Richmond Road, südlich der Themse, jenseits der Putney Bridge. Postbezirk SW12. Er fand auf einmal, dass er für heute genug getan habe und es an der Zeit sei, sich etwas Entspannung zu gönnen.
Er legte den Stadtplan beiseite, brühte sich eine Tasse Instantkaffee, kniete sich vor das Regal mit seinen geliebten Wagner-Platten und entschied sich nach einigem Nachdenken für die von Solti dirigierte Aufnahme der Walküre. Kein dicker Mann und keine bebrillte Spröde weit und breit, die ihn hätten irritieren können. Kein heiserer Tenor, kein schwitzender Sopran, die ihm die Freude an der Oper verdarben. Unbehelligt von Widrigkeiten jedweder Art, lauschte er hingerissen, wie Siegmund und Sieglinde sich in einer Ekstase des Erkennens verströmten. Der Kaffee neben ihm auf dem Tisch wurde kalt.
Die erste Seite war noch nicht ganz abgespielt, da war er, ohne es gleich zu merken, in Gedanken schon wieder dabei, eine neue, überaus interessante Hypothese zu entwickeln, derzufolge Ainleys Besuche in London mit großer Wahrscheinlichkeit einen sehr naheliegenden Grund gehabt hatten. Dass er darauf nicht gleich gekommen war! Freier Tag und sehr beschäftigt, geistesabwesend, wortkarg. Es passte alles zusammen. Er war bereit, jede Wette einzugehen, dass er diesmal richtiglag. Southampton Terrace 42 – soso. Ainley hatte sich also möglicherweise heimlich mit einer Frau getroffen.
4
Soweit ich feststellen konnte,hatten sie nichts miteinander gemein, außer,dass jeder des anderen Nachfolger war
Peter Champkin
Am Montag nach Stranges Unterredung mit Morse gingen an verschiedenen, zum Teil weit voneinander entfernt liegenden Orten des Vereinigten Königreichs vier in keiner Weise bemerkenswerte Personen jeweils unterschiedlichen privaten oder beruflichen Beschäftigungen nach. Was ihre Berufe anging, so waren auch sie nicht besonders bemerkenswert oder interessant – den einen oder anderen hätte man zu Recht stumpfsinnig nennen können. Jeder der vier war mit den übrigen dreien mehr oder weniger gut bekannt, obwohl zumindest einer auf die Bekanntschaft mit einem bestimmten anderen nur zu gern verzichtet hätte, falls das noch möglich gewesen wäre. Ironischerweise sollte ungeachtet der Tatsache, dass sie im Ganzen gesehen mehr trennte als verband, ausgerechnet der eine Punkt, der ihnen gemeinsam war, plötzlich eine solche Bedeutung erlangen, dass sie für kurze Zeit ein Schicksal teilten: Sie alle gerieten in den kommenden Wochen – jeder auf seine Art, doch gleichermaßen unausweichlich – ins Netz polizeilicher Ermittlungen. Denn gemeinsam war ihnen, dass sie alle vier mehr oder weniger gut mit Valerie Taylor bekannt gewesen waren.
Baines war seit ihrer Eröffnung vor drei Jahren stellvertretender Schulleiter der Roger-Bacon-Gesamtschule. Das Gebäude, in dem sie untergebracht war, hatte zuvor eine Hauptschule beherbergt, in der er Konrektor gewesen war. Diese hatte aufgrund des weisen oder auch nicht so weisen Ratschlusses der Schulbehörde von Oxfordshire (Baines mochte sich da nicht festlegen), die meinte, auf die Schulsituation im Allgemeinen und Kidlingtons im Besonderen reagieren zu müssen, ihre frühere Selbstständigkeit verloren und war in der Roger-Bacon-Gesamtschule aufgegangen. Heute war der letzte Tag der Sommerferien, und morgen, Dienstag, den 16. September, würden die Schüler, nachdem sie sich sechseinhalb Wochen hatten ausruhen dürfen, wieder in die Schule zurückkehren. Während viele seiner Kollegen Erholung auf dem Kontinent gesucht hatten, war es Baines überlassen geblieben, sich mit der Erstellung des Stundenplans herumzuschlagen, einer überaus komplexen Aufgabe, die Jahr für Jahr zunächst unlösbar schien und aufgrund eines ungeschriebenen Gesetzes traditionsgemäß in den Zuständigkeitsbereich des stellvertretenden Schulleiters fiel. Baines hatte sich in der Vergangenheit dieser Pflicht allerdings sehr bereitwillig unterzogen. Das vielfältige Fächerangebot des Lehrplans so zu organisieren, dass eine optimale Wahlmöglichkeit gewährleistet war, und dabei gleichzeitig den Wünschen und Vorlieben und – nicht zu vergessen – Fähigkeiten der zur Verfügung stehenden Lehrer Rechnung zu tragen, erlebte er als eine Art intellektueller Herausforderung, der er sich umso lieber stellte, als ihm die Gelegenheit, innerhalb des gegebenen Rahmens nach eigenem Gutdünken frei schalten und walten zu können, auch ein Gefühl von Macht gab, das ihn für so manches entschädigte. Denn Baines täuschte sich nicht länger darüber, dass er zu den Verlierern zählte – der ewige Zweite, der nie Gewinner sein würde. Er war Mathematiker, Mitte fünfzig, unverheiratet. Mehr als einmal hatte er sich während der vergangenen Jahre um einen Direktorenposten beworben. Zweimal hatten sie ihn fast genommen. Seine letzte Bewerbung lag dreieinhalb Jahre zurück. Damals war hier an der Roger-Bacon-Gesamtschule die Stelle des Direktors zu besetzen gewesen. Er hatte das Gefühl gehabt, dies sei noch einmal eine ganz große Möglichkeit. Doch hatte hinter seiner Hoffnung schon die Einsicht gelauert, dass seine besten Jahre vorbei waren und diese Chance für ihn zu spät kam. Warum die Wahl dann ausgerechnet auf Phillipson, den jetzigen Direktor, gefallen war, hatte er aber auch nicht einsehen können. Jedenfalls damals nicht. Erst vierunddreißig und darauf versessen, sofort alles anders zu machen, als ob jede Veränderung notwendig eine Veränderung zum Besseren wäre. Aber im Laufe der Zeit, vor allem während des vergangenen Jahres, hatte er begonnen, Phillipson zu akzeptieren, ja, so etwas wie Achtung für ihn zu empfinden. Die Souveränität, mit der er diesen furchtbaren Hausmeister geschasst hatte – das hätte er selbst nicht besser machen können.
An diesem Vormittag saß Baines in dem kleinen Büro, das er sich mit Mrs Webb, der Sekretärin des Direktors, teilen musste. Sie war der gute Geist der Roger-Bacon-Schule und hatte genau wie er schon in der alten Hauptschule gearbeitet. Es war gegen halb elf, und er hatte gerade den Dienstplan für die Aufsicht beim Mittagessen fertiggestellt. Alle Lehrer waren darin untergebracht, ausgenommen natürlich der Direktor. Und er selbst. Das war eine seiner vielen kleinen Möglichkeiten, sich ein bisschen schadlos zu halten. Den Dienstplan in der Hand, suchte er sich durch den vollgestellten Raum seinen Weg zu Mrs Webbs Schreibtisch. »Hiervon brauche ich drei Kopien, meine Liebe.«
»Und wie immer sofort, nehme ich an«, sagte Mrs Webb, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen, und griff sich von dem Stapel der vor ihr liegenden Post schon den nächsten Brief, um ihn, nachdem ein kurzer Blick auf die Adresse sie davon überzeugt hatte, dass sie dazu befugt war, mit einer geübten Handbewegung aufzuschlitzen.
»Wie wärs mit einem Kaffee?«, fragte Baines.
»Wie wärs mit Ihrem Dienstplan?«
»Na, dann kümmere ich mich eben selber um den Kaffee.«
»Nein, das machen Sie nicht.« Sie stand auf, nahm den Kessel und ging in den kleinen Nebenraum, der vor allem als Garderobe diente. Baines sah auf die Briefe, die sie hatte liegen lassen, und spürte wie immer einen kleinen Stich. Vermutlich Elternanfragen, Handwerkerrechnungen, Tagungsankündigungen, Versicherungsangelegenheiten, behördliche Mitteilungen über Prüfungstermine. Das Übliche eben. Wenn er damals den Posten bekommen hätte, würde dies alles ihm vorgelegt werden … Geistesabwesend zog er einzelne Briefe hervor … Plötzlich wurde sein Blick aufmerksam. Der Brief lag mit der Adresse nach unten, sodass er den Absender hatte lesen können. Thames Valley Police. Interessant. Er nahm den Brief in die Hand und drehte ihn um. Er war an den Direktor gerichtet, und zwar Privat und vertraulich, wie der in roten Großbuchstaben getippte Vermerk unmissverständlich signalisierte.
»Was fällt Ihnen ein, an meine Post zu gehen?« Mrs Webb stellte den Kessel auf die elektrische Kochplatte, trat auf ihn zu und nahm ihm den Brief mit gespielter Entrüstung wieder ab.
»Haben Sie gesehen, wer der Absender ist?«, fragte Baines.
Mrs Webb warf einen kurzen Blick auf den Brief. »Ich wüsste nicht, was Sie das anginge.«
»Ob er bei seiner Steuererklärung geschummelt hat?« Baines gluckste leise.
»Reden Sie keinen Unsinn!«
»Wir könnten ihn öffnen.«
»Nein, das können wir nicht«, sagte sie bestimmt.
Baines trollte sich wieder an seinen mit allen möglichen Unterlagen und Papieren überladenen Schreibtisch und machte sich daran, eine Liste von Schülern aufzustellen, die als Präfekten infrage kamen. Phillipson musste für das kommende Schuljahr ein halbes Dutzend neu ernennen und würde ihn um Vorschläge bitten. Eigentlich gar kein so übler Kerl, der Direktor.
Phillipson kam kurz nach elf. »Morgen, Baines. Morgen, Mrs Webb.« Selbst heute klang er widerlich gut gelaunt. Als ob ihn die Tatsache, dass es morgen wieder losging mit dem Schultrott, völlig kaltließe.
»Morgen.« Baines sparte sich ganz bewusst den »Sir«, mit dem die übrigen Lehrer Phillipson anredeten. Eine Kleinigkeit, zugegeben, aber nichtsdestoweniger geeignet, seine besondere Position hervorzuheben.
Phillipson blieb auf dem Weg in sein Arbeitszimmer einen Moment an Mrs Webbs Schreibtisch stehen. Er deutete auf die Briefe. »Irgendetwas Wichtiges dabei?«
»Ich glaube nicht, Sir. Das heißt, da ist ein Brief an Sie persönlich.« Sie gab ihm den Umschlag mit der Aufschrift Privat und vertraulich. Phillipson nahm ihn mit leichtem Stirnrunzeln entgegen, ging dann in sein Zimmer und machte die Tür hinter sich zu.
In einem unscheinbaren Reihenhaus im nördlichen Wales im County Gwynedd, etwas außerhalb von Caernarfon, war ein anderer Lehrer sich der Tatsache, dass dies sein letzter Ferientag war, nur allzu schmerzlich bewusst. Das wars dann also für dies Jahr. Seit gestern waren sie wieder zurück von ihrem Urlaub. Wenn man so etwas Urlaub nennen konnte! Die Zeit in Schottland war alles andere als erholsam gewesen – Regen, zwei Reifenpannen, eine verlorene Scheckkarte und wieder Regen, Regen und nochmals Regen. Bevor morgen die Schule anfing, gab es noch eine Menge für ihn zu tun. Als Erstes musste er sich um den Rasen kümmern. Im Gegensatz zu ihnen hatten dem die sturzbachartigen Regenfälle der letzten Wochen offensichtlich gutgetan, das Gras hatte während ihrer Abwesenheit eine geradezu beängstigende Höhe erreicht und musste dringend gemäht werden. Gegen halb zehn, er wollte sich gerade ans Werk machen, stellte er fest, dass der Stecker des Verlängerungskabels offenbar einen Wackelkontakt hatte. Seufzend holte er sich einen Schraubenzieher, setzte sich auf die Steinstufen hinter der Küche und begann, ihn auseinanderzunehmen.
Es hätte ihn auch gewundert, wenn es nicht irgendwelche Probleme gegeben hätte. Für David Acum – bis vor zwei Jahren Französischlehrer an der Roger-Bacon-Gesamtschule und seither in derselben Funktion am Städtischen Gymnasium von Caernarfon tätig – war sein Leben, solange er zurückdenken konnte, immer von irgendwelchen Missgeschicken begleitet gewesen.