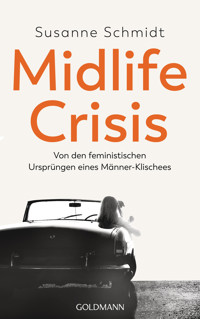7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Gesetz der Krise: Wie Banken die Folgen ihres Handelns abwälzen und die Bürger dafür zahlen müssen Die Finanzkrise, die 2008 mit der Lehman-Pleite ihren ersten Höhepunkt fand, erlebte 2011 ihren zweiten, als immer neue Rettungsschirme in Billionenhöhe aufgespannt werden mussten. Den Banken ist es gelungen, für die Folgen ihres riskanten Handelns andere verantwortlich zu machen, ihre Verluste zu verstaatlichen und gleichzeitig ihre Boni zu sichern. Die Regierungen knicken immer wieder vor der Macht der Finanzmärkte ein, während die Europäische Zentralbank zwar einen Kollaps des Bankensystems verhinderte, aber zu einem hohen Preis: Die Inflationsgefahr ist groß und schon jetzt tragen Sparer und Rentner die Kosten. Susanne Schmidt analysiert in Das Gesetz der Krise, wie es so weit kommen konnte und was nun getan werden muss. Die Politik muss dringend in den Krisenländern wie Griechenland und Spanien Wettbewerb und Wachstum zum Thema Nummer eins machen – und eine stringente Finanzmarktregulierung durchsetzen. Wenn ihr das nicht gelingt, wird am Ende der Bürger die Zeche zahlen müssen. Ein hochaktuelles und brisantes Buch über die Wirtschafts- und Finanzkrise und ihre Folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Susanne Schmidt
Das Gesetz der Krise
Wie die Banken die Politik regieren
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Krise, die im September mit dem Kollaps von Lehman Brothers begann, hält noch immer die Welt in Atem. Zwar hat sich das Augenmerk von einer Banken- auf eine Staatsschuldenkrise vornehmlich in der Eurozone verlagert, doch ob dies so stimmt, ob nicht die Fixierung auf die heillos überschuldeten südeuropäischen Staatshaushalte ein Ablenkungsmanöver der nach wie vor am Abgrund stehenden internationalen Großbanken ist, erörtert Susanne Schmidt, ehemalige Bankerin und Finanzjournalistin, in ihrem neuen Buch. Sie zieht eine Bilanz des politischen und witschaftlichen Handelns seit dem Beginn der Krise, erörtert nüchtern und engagiert unterschiedliche Szenarien, vom Schuldenschnitt über den Zerfall der europäischen Währungszone bis zu einem Schnitt des internationalen Währungssystems.
Ihr Fazit: Ein Ende ist bis auf weiteres nicht zu erkennen, große Risiken werden weiter bestehen – und radikal egoistisch auftretende Akteure sind nur schwer und nur mit großer internationaler Anstrengung im Zaum zu halten.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Krisenherd 1: Das Finanz- und Bankensystem
Wer ist eigentlich »der Markt«?
Das Bankensystem steht auf schwankendem Boden
Die Banker machen weiter wie bisher
Die Neuregulierung des Banken- und Finanzsystems kommt zu langsam voran
Die wichtigsten Punkte einer Neuregulierung
1. Die Verkleinerung der Banken
2. Die Eigenkapitalquote und ihre Berechnung
3. Liquiditätspuffer
4. Derivate
5. Finanztransaktionssteuer
6. Vergütung
7. Ein Banken-Insolvenzmechanismus
8. Ein Gemeinsamer Markt für die Banken
9. Schattenbanken
10. Ratingagenturen
Investoren und Spekulanten
Krisenherd 2: Staatsschulden
Die Staatsschuldenkrise in der Eurozone
Exkurs: Warum verschuldet sich ein Staat?
Maßnahmen zur Überwindung der Krise und zum Schuldenabbau
1. Staatliches Sparen
2. »Kaputtsparen« – eine Begriffsklärung
3. Schuldenbremse
4. »Interne« Abwertung
5. Kreditgewährung
6. Schuldenschnitt
7. Die Politik der EZB
8. Inflation
9. »Finanzielle Repression«
10. Ausgeglichene Leistungsbilanzen
Krisenherd 3: Inflation oder Deflation
Die Droge des billigen Geldes
Die Politik der großen Notenbanken
Die deutsche Angst vor der Inflation
Wie kommt es zu Inflation oder Deflation?
Die gegenläufige Umverteilung bei Deflation und Inflation
Inflation versus Deflation: Was ist wahrscheinlicher?
Krisenherd 4: Vergemeinschaftung von Staats- und Privatschulden
Eine Transferunion
Die EZB-Politik
1. Die EZB als »Bad Bank«
2. Der Kauf von Staatsanleihen
3. LTRO-Kredit
Das Eurosystem und Target 2
Krisenherd 5: Das Auseinanderbrechen der Eurozone
Das Argument der Befürworter
Das wirtschaftliche Kalkül
Die politischen Kosten
Krisenherd 6: Das demokratische Defizit in der Europäischen Union
»Nie wieder Krieg«: Europa als Jurassic Park?
Die europäischen Institutionen
Wie soll es weitergehen?
Glossar
Vorwort
Seit geraumer Zeit sehen wir uns in der Europäischen Union (EU) und in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) einer allumfassenden Krisensituation gegenüber, deren einzelne Krisenherde sich gegenseitig befeuern und anheizen.
Die aktuelle Schuldenkrise ist nur ein Herd. Sie hat jedoch ein solches Ausmaß angenommen, dass sie zu einer existenziellen Bedrohung für die Währungsunion geworden ist und damit auch eine Gefahr für den Zusammenhalt und die politische Bedeutung der Europäischen Union insgesamt darstellt. Es hat sich eine Kluft zwischen so genannten Kern- und so genannten Krisenländern aufgetan, eine Kluft, die sich zunehmend zu verbreitern scheint. Sie offenbart nicht nur ein wirtschaftliches Gefälle zwischen den Staaten, sondern dividiert auch die betroffenen Bürger auseinander.
Die Bürger der prosperierenden Kernländer – wir Deutschen vorneweg – haben Angst vor einer Transferunion und lehnen es ab, als Steuerzahler für die europäische Peripherie zur Kasse gebeten zu werden. Die Bürger in den Krisenländern wiederum sehen nicht ein, warum sie die harschesten staatlichen Sparbemühungen ertragen sollen; ihr Zorn richtet sich nicht zuletzt gegen die deutsche Bundeskanzlerin als diejenige, von der die Rahmenbedingungen offenbar weitgehend diktiert werden. Das Wohl und Wehe peripherer Staaten bleibt der Dreh- und Angelpunkt für die Bewältigung der akuten Krise in der EWU.
Der zweite Brandherd ist das globale Finanz- und Bankensystem, das sich ebenfalls in einer akuten Krise befindet. Die Banken hegen ein tiefes Misstrauen untereinander, jede weiß von der anderen, dass es nicht gut um sie steht. Die Banken sind wenig profitabel, immer noch unterkapitalisiert und ständig in Gefahr, sich nicht mehr am Markt refinanzieren zu können. Weite Teile des europäischen Bankensystems, insbesondere Institute in den Krisenländern, wären ohne die Europäische Zentralbank (EZB) nicht mehr überlebensfähig. Die prekäre Situation des Finanzsystems ist umso problematischer, als sich die Haltung der Topmanager durch die Krise nicht verändert hat. Sie kämpfen weiter verbissen um jeden Zentimeter zur Wahrung ihres Besitzstandes, und das heißt vor allem auch zur Beibehaltung ihrer Geschäfts- und Vergütungsmodelle. Ein robustes Finanzsystem in verantwortungsvollen Händen ist eine Vorbedingung für eine nachhaltige Lösung der Krise.
Weitere Gefahren und Bedrohungen kommen hinzu und schüren das allgemeine Feuer.
Zum einen die Gefahr einer Rezession. Diese Gefahr ist umso größer, als in Europa eine rigide staatliche Sparpolitik eingeläutet worden ist, bei der Wachstums- und Wettbewerbsförderung deutlich zu kurz kommen. Der Fiskalpakt ist nicht genug, es braucht einen parallelen Fokus auf Wachstum. Die rezessive Situation in den Krisenländern, gekoppelt mit schwachem oder sich abschwächendem Wachstum im übrigen Europa, in Amerika und Asien, stellt eine große Gefahr auch für das deutsche Wirtschaftswachstum dar. Neben der Rezession drohen aufgrund der lockeren Geldpolitik in den USA und in der EWU eindeutige Inflationsgefahren. Auf mittlere Sicht scheinen höhere Preissteigerungsraten unumgänglich und damit auch die entsprechenden Umverteilungseffekte von Gläubigern zu Schuldnern, von den Älteren zu den Jüngeren.
Bis heute hat die Europäische Zentralbank mit ihrer lockeren Geldpolitik einen eruptiven Ausbruch der akuten Krisen und Bedrohungen erfolgreich zu verhindern gewusst. Doch ihre unorthodoxen Rettungsmaßnahmen dürfen nur temporäre Maßnahmen sein, die Politik der Notenbank muss schleunigst zu ihrem traditionellen Kerngeschäft zurückkehren. Mit Geldpolitik sind die strukturellen wirtschaftlichen und fiskalischen Probleme innerhalb der Währungsunion nicht zu lösen. Die EZB hat den europäischen Regierungen Ende 2011/Anfang 2012 ein Zeitfenster geöffnet, damit sie sich auf eine nachhaltige Problemlösung einigen. Diese Einigung muss zügig und beherzt angegangen werden, für Trippelschritte wird die Zeit mit Sicherheit nicht ausreichen.
Es ist insbesondere von Bedeutung, dass die unheilvolle Symbiose zwischen Staaten und Banken zertrennt wird. Die Staaten sind zur Befriedigung ihrer enormen Kapitalnachfrage zu sehr von den Banken als Gläubigern und Investoren abhängig. Die Banken ihrerseits sind zur Befriedigung ihrer Liquiditätsvorsorge beziehungsweise zur Risikominimierung zu sehr auf Staatsanleihen angewiesen. Insbesondere in den Krisenländern herrscht eine bedrohliche Korrelation zwischen der Kreditwürdigkeit des Staates und der der nationalen Geschäftsbanken. Die fortwährende Herunterstufung von Staaten und/oder Finanzinstituten durch die Ratingagenturen hat hier eine negative Dynamik ausgelöst, der dringend Einhalt geboten werden muss.
Über den akuten wirtschaftlichen und fiskalischen Krisen sollten wir allerdings nicht vergessen, dass das Ganze von einer veritablen politischen Krise untermalt ist, ich meine die schon seit Jahren schleichende europäische Identitätskrise. Die Akzeptanz der europäischen Institutionen durch die Bürger Europas hat allgemein abgenommen, viele Bürger, ja ganze Mitgliedstaaten berufen sich wieder stärker auf ihre nationale Identität und vermeintliche oder tatsächliche nationale Bedürfnisse. Die Schuldenkrise hat diese Entwicklung zweifellos erheblich verstärkt. Wir sind Zeugen einer Renationalisierungstendenz in Europa und beobachten seit einiger Zeit, dass populistische, Euro- und immigrationsfeindliche Parteien in mehreren europäischen Staaten die Unterstützung eines nicht unbeträchtlichen Teils der Bevölkerung genießen, sich zum Teil sogar in Regierungsverantwortung befinden.
Grund für die Renationalisierung ist das demokratische Defizit, welches der Europäischen Union als Institution innewohnt. Dieses Defizit ist für alle sichtbar und zu einem immer größeren Problem geworden. Es muss endlich bekämpft und verringert werden. Die europäische Politik, einschließlich der Bundesregierung, hat hier eine große Bringschuld, der sie bisher nicht nachgekommen ist. Sie muss diese Schuld endlich begleichen, denn ohne demokratische Legitimation der EU und EWU wird jedwede Krisenlösung ohne Nachhalt bleiben. Wir europäischen Bürger müssen auf dem Weg zur Krisenbewältigung von der Politik mitgenommen werden, wir müssen diesen Weg für den richtigen halten und nicht nur sie.
Den akuten Krisen auf dem Finanzmarkt und der schleichenden politischen Krise ist gemeinsam, dass sie von einem erheblichen Vertrauensmangel begleitet werden. Dieses verlorengegangene Vertrauen muss wiederhergestellt werden, das Heft des Geschehens muss wieder in mutigen und verantwortungsvollen Händen liegen.
Es bedarf auch einer deutlichen Klarstellung: In einer konzertierten Vernebelungsaktion ist es der Banken-Lobby gelungen, den Eindruck zu erwecken, als hätten wir es mit drei verschiedenen Krisen zu tun.
Nachdem die eigentliche Finanzkrise, die im Herbst 2008 in der Lehman-Pleite gipfelte, im Kern überwunden worden sei – so haben es uns die Banker eingeredet –, sei es erst zur Eurokrise und danach zur Staatsschuldenkrise gekommen.
Den Ausdruck Eurokrise haben sich die Banker vor zweieinhalb Jahren ausgedacht, um davon abzulenken, dass es bei Ausbruch der Griechenland-Krise um ihre eigene Existenz ging. Die Alternative lautete damals: Rettet man die Banken, die Griechenland bedenkenlos mit immer höheren Krediten versorgt hatten, deshalb ein viel zu hohes Griechenland-Risiko in ihren Büchern aufwiesen und entsprechende Abschreibungen nicht hätten stemmen können – oder rettet man das Land selbst. Damals, Anfang 2010, schien es, als käme eine Griechenland-Rettung weniger teuer; im Übrigen schien sie bei den europäischen Bürgern weniger unpopulär als eine neuerliche Bankenrettung. Heute, im Nachhinein, ist es beinahe unbegreiflich, wie ein Sonderproblem mit dem wirtschaftlichen Winzling Griechenland innerhalb von so kurzer Zeit zu einer existenziellen Krise der Währungsunion hat führen können.
Der Begriff Eurokrise war schon deshalb unangebracht, weil damit eine Währungskrise suggeriert wird. Doch Währungskrisen gehen immer mit einer schwachen Währung einher. Das ist der Euro mitnichten. Im Binnenraum hat sich der Euro sogar als stärker als die D-Mark erwiesen, die Inflationsraten sind seit seiner Einführung nachweislich geringer als vorher. Im Außenverhältnis ist er ebenfalls stark und nach dem US-Dollar die zweitgrößte Reservewährung der Welt. Die Stabilität des Euro ist ohne Zweifel ein Verdienst der bisherigen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.
Dann kam der Begriff der Staatsschuldenkrise. Es ist leider wahr, viele Staaten haben in der Vergangenheit zu hohe Schulden angesammelt. Wobei man ehrlich bleiben sollte: Das Geld haben nicht etwa nur verantwortungslose Politiker ausgegeben. Nein, es waren auch wir, die Bürger, die mehr Kitas, bessere Schulen, höhere Renten, Pendlerpauschalen und sonstige Annehmlichkeiten einforderten, ohne zu fragen, wie all das denn finanziert werden soll. Und wenn die Politiker nicht lieferten oder gar Kürzungen in Aussicht stellten, dann wurden sie eben abgewählt. Schröders Agenda 2010 ist ein gutes Beispiel.
Wie aber kam es zu dem rasanten Anstieg der Schuldenstände und zu der plötzlichen Defizitausweitung in den Staatshaushalten? Zwischen 2006, dem letzten Jahr vor der Finanzkrise, und 2012 hat die durchschnittliche Staatsverschuldung der OECD-Länder einen Sprung um mehr als ein Drittel gemacht, nämlich von 75 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) auf 106 Prozent. Für diesen Anstieg gab es drei Gründe: Erstens haben die Staaten den Banken die faulen Kredite abgenommen und in die staatsgarantierten Bad Banks gesteckt; zweitens wurden die Banken rekapitalisiert und auf diese Weise gerettet; und drittens führte die anschließende tiefe Rezession in vielen Staaten zu erhöhten Sozialausgaben und verminderten Steuereinnahmen. Die Banken tun so, als sei der Staat, dieser nimmersatte Leviathan, an der Schuldenmisere selbst schuld; diese Argumentation ist unseriös. Leider haben sich nicht nur Laien Sand in die Augen streuen lassen, sondern auch die Bundesregierung – unter dem Einfluss der Bundesbank, für die eine hohe Staatsverschuldung der Häresie gleichkommt.
Mit einem Wort: Sämtliche finanziellen Krisen und Krisengefahren, die wir zurzeit beobachten, sind direkte Folgen der Banken- und Finanzkrise beziehungsweise der zur Rettung des immer noch sehr ungesunden europäischen Bankensystems ergriffenen Maßnahmen. Im Grunde haben wir es mit der Bankenkrise zweitem Akt zu tun. Inhalt dieses zweiten Aktes ist die unheilvolle gegenseitige Abhängigkeit von Staaten und Banken, ihrer jeweiligen Kreditwürdigkeit und ihres Finanzierungsbedarfs.
Im ersten Akt, beim eruptiven Ausbruch der Finanzkrise 2008, waren die USA das Epizentrum, jetzt ist es die Europäische Währungsunion. Auch diese Verlagerung haben wir den Finanzakteuren zu verdanken. Denn obwohl die Schulden- und Defizitprobleme in Großbritannien, den USA oder Japan eindeutig gravierender sind als in der EWU, fokussieren sich die Märkte derzeit ausschließlich auf Europa. Das ist in gewisser Weise erstaunlich, denn die gravierenden Strukturfehler der EWU sind seit ihrer Gründung bekannt. Auch war es seit Jahren offensichtlich, dass eine einheitliche (und sich generell an der deutschen Konjunktur orientierende) Zinspolitik für einige Länder unangemessen ist.
Es gibt seit Ausbruch der Griechenland-Krise also keine wirklich neuen volkswirtschaftlichen oder strukturellen Erkenntnisse, die eine Fokussierung der Märkte auf Europa rechtfertigen.
Aber es gibt eine neue politische Erkenntnis: Ein Auseinanderbrechen der EWU in ihrer jetzigen Form ist nicht mehr undenkbar; die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist sogar deutlich gestiegen. Manche Bürger sehnten sich zwar nach der »guten alten Zeit« zurück, insbesondere in Deutschland war die Sehnsucht nach der D-Mark stark ausgeprägt, dennoch wurde der Euro als Bund fürs Leben akzeptiert. Das ist jetzt anders. Aufgrund der Schuldenkrise und der Renationalisierungstendenzen sind in der gesamten EWU Stimmen laut geworden, die ein Auseinanderbrechen der Währungsunion propagieren und auf die nationale Karte setzen. Was uns diese Heilsverkünder schuldig bleiben, ist eine ehrliche Analyse der horrenden Folgekosten – und ein Plan, wie dem dann mit Sicherheit eintretenden gravierenden Wirtschaftseinbruch zu begegnen ist.
Aufgrund der Interdependenz der finanziellen und wirtschaftlichen sowie der politischen Krise in der EWU müssen wir von unseren Politikern verlangen, dass alle Krisenherde parallel, gleichzeitig und zügig angegangen werden, denn die Probleme dulden keinen längeren Aufschub. Uns Deutschen, mit der größten europäischen Volkswirtschaft und als bevölkerungsreichster Nation, kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Das Zögern und Zaudern von Seiten der Berliner Regierung, das wir seit gut zwei Jahren erleben, muss ein Ende haben.
Im Nachfolgenden werden sechs separate, aber voneinander abhängige Krisenherde identifiziert und analysiert; wo es angemessen erscheint, werden Problemlösungen skizziert. Die ersten fünf dieser Herde beschäftigen sich mit der finanzmarkttechnischen, wirtschaftlichen und fiskalischen Krisensituation. Hier wird der Leser auf einige Tatbestände und Maßnahmen stoßen, die mehrfach behandelt werden, da sie mit mehreren Krisenherden im Zusammenhang stehen. Grund ist die Bemühung, nicht nur erwünschte, sondern auch etwaige unerwünschte Konsequenzen für den jeweiligen Krisenherd aufzuzeigen und Interdependenzen deutlich zu machen. Krisenherd Nummer sechs widmet sich der europäischen Identitätskrise sowie institutionellen und politischen Veränderungen, die zu ihrer Überwindung notwendig wären. Zum Schluss dann der Blick auf das, was jetzt getan werden, angeschoben und passieren muss, damit wir nicht im Treibsand der Krise ersticken.
Der Gedanke, dieses Buch zu schreiben, ist im letzten Jahr aufgekommen. Ich hatte bei einer Reihe von Veranstaltungen die Gelegenheit, mit vielen Menschen zu sprechen, die sich in ihrem alltäglichen Leben und im Beruf nicht mit Märkten oder Renditen oder Rettungspaketen beschäftigen und denen der ganze Finanz- und Wirtschaftsbereich eher fremd ist. Viele von ihnen waren verunsichert, was ihre eigene finanzielle Situation anlangte, und fragten, wie wohl die Krisensituation in der EWU – und etwaige Rettungsmaßnahmen, diese zu meistern – ihre eigene wirtschaftliche Situation beeinflussen werde. In den Gesprächen gewann ich den Eindruck, dass nicht wenige dieser Menschen auch einer »Angstmache« aufgesessen waren. Da gab es Furcht vor einem sich rasant abwertenden Euro, vor Hyperinflation, vor einer deutschen Währungsreform. Da gab es Furcht, dass durch die Krisenländer die eigenen Ersparnisse geplündert werden, dass man auf Gedeih und Verderb zum Zahlen verdammt sei. Diese Angstmache, die verantwortungslos die Unsicherheit der Menschen und ihre Unkenntnis von wirtschaftlichen und finanzmarkttechnischen Zusammenhängen ausnutzt, um die Schlagzeilen zu beherrschen, kann kein guter Zustand sein. Wir alle sollten in der Lage sein, die Krisensituation abgewogen zu beurteilen, und uns darüber klar werden, welche Kosten und Erträge durch Weichenstellungen in die eine oder andere Richtung entstehen – und welche Kosten und Erträge durch alternative Weichenstellungen – oder auch durch Nichtstun – entstehen. Denn eines muss ganz klar sein: Ein Patentrezept hat keiner – es existiert nicht.
Ich habe in diesem Buch versucht, eine ehrliche Darstellung des Für und Wider in einer Form zu geben, die auch für den Finanz-Laien verständlich ist. Bei aller Ehrlichkeit und dem Versuch der Fairness gegenüber den kontrovers diskutierten möglichen Folgen unterschiedlicher Entscheidungen darf der Leser eines nicht vergessen: Dies ist das Buch einer überzeugten Europäerin, die den politischen Opportunismus, der sich in der Debatte breitzumachen scheint, mit großer Besorgnis (und Ärger!) beobachtet.
Kent, im Mai 2012
Susanne Schmidt
Krisenherd 1:Das Finanz- und Bankensystem
Wer ist eigentlich »der Markt«?
Ob in den Medien, ob in der Politik, ob in der Finanzbranche, überall wird von »dem Markt« oder »den Märkten« gesprochen. Zunächst bezeichnet dieser Begriff einen geographischen (Markt-)Platz, einen öffentlichen Ort, an dem Verkäufer ihre Waren anbieten und Käufer diese abnehmen. So gibt es an bestimmten Tagen einen Wochenmarkt um die Ecke oder einen größeren Markt in der nächsten Kleinstadt, auf dem regionale Betriebe ihre Produkte verkaufen; daneben kennen wir eine Reihe spezialisierter Märkte wie Flohmärkte, Antiquitätenmärkte oder Viehmärkte. In diesem Sinne ist der Begriff Markt klar und eindeutig definiert.
Schwieriger wird es, wenn zum Beispiel die Rede davon ist, dass der globale Automobilmarkt schrumpft oder der Apps-Markt wächst. Hier wird unter Markt der Gesamtabsatz und damit steigende oder fallende Produktion verstanden. Wenn es hingegen heißt, der Markt für die Kunst der Moderne habe sich enorm entwickelt, dann liegt die Produktion reichlich hundert Jahre zurück, und das Wort Markt bezieht sich lediglich auf die Nachfrage und damit auf die Preise der betreffenden Kunstwerke. Der Begriff Markt ist jenseits seiner Anwendung auf Marktplätze und Marktflecken recht vage und nebulös, und doch glauben wir alle zu verstehen, was damit gemeint ist.
Sobald der Begriff auf die Finanzbranche angewendet wird, bewegen wir uns endgültig im Reich des Nebels. Die Finanzbranche versteht unter »dem Markt« oder »den Märkten« zunächst ganz allgemein ein System von interaktiven Teilmärkten, auf denen Finanzprodukte gehandelt werden. Die Teilmärkte wiederum werden ausschließlich oder zum großen Teil von Finanzanlagen getragen (doch auch Unternehmen der Realwirtschaft nehmen aus betrieblichen Gründen am Finanzmarktgeschehen teil) und können zum Beispiel Aktienmärkte oder Anleihemärkte, Devisenmärkte oder Rohstoffmärkte sein. Ein Markt kann aber nur bestehen, wenn es Menschen gibt, die kaufen und verkaufen, und so sind in dem Begriff Markt auch die Marktteilnehmer eingeschlossen – wobei die Käufer und Verkäufer heutzutage vielfach nicht mehr Menschen, sondern automatisierte Computerprogramme sind. Neben den Käufern (Investoren) und Verkäufern (meistens Banken) gehören auch die Marktbeobachter –Analysten jedweder Art und Volkswirte – zu den Marktteilnehmern.
Es handelt sich beim Finanzmarkt also um ein globales System von technologisch hochvernetzten und in Echtzeit arbeitenden interaktiven und häufig korrelierenden Teilmärkten, in dem Hunderttausende von Menschen handeln, analysieren, prognostizieren und sich neue Finanzprodukte ausdenken. Diesen Markt kann man nicht sehen, nicht anfassen, nicht dingfest machen, man kann nicht mit ihm verhandeln; er ist häufig irrational und wenig kalkulierbar. Das Einzige, worauf man sich mit Sicherheit verlassen kann, ist die Tatsache, dass er in Sekundenschnelle rund um den Globus reagieren kann – und dass er das auch häufig tut.
Das Bankensystem steht auf schwankendem Boden
Ende 2011, gut drei Jahre nach der Lehman-Pleite, stand die Finanzwelt kurz vor einem neuerlichen eruptiven Ausbruch, was allerdings in der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wurde. Es ächzte ganz gewaltig im Gebälk des Finanzsystems, das Grummeln des Vulkans war deutlich zu hören, der Boden fing an zu schwanken. Zwei Institute waren bereits im Oktober 2011 unter die Räder gekommen: die Brüsseler Bank Dexia und das große amerikanische Brokerhaus MF Global. Dexia hatte im Juli 2011, beim so genannten Stresstest, den die Europäische Bankenaufsicht durchführte, noch recht gut dagestanden, aber nur drei Monate später konnte sie sich ganz plötzlich nicht mehr refinanzieren; sie musste aufgespalten und verstaatlicht werden. Wenige Tage später ging MF Global kaputt: Das Brokerhaus, keine regulierte Bank, sondern ein im Schattenbankensystem tätiges Institut, verursachte die achtgrößte Pleite in der US-Geschichte. Man hatte sich mit europäischen Staatsanleihen verspekuliert, wies einen hohen Fremdverschuldungsgrad von 40:1 auf, stellte sich im allerletzten Moment übers Wochenende selbst zum Verkauf, entdeckte dabei, dass 1,2 Milliarden Dollar Kundengelder fehlten – und war am Montag pleite (den Verbleib der fehlenden Kundengelder hat man übrigens bis heute nicht ermitteln können).
Es war ein ominöses Déjà-vu. Schon 2007 war es in der Finanzbranche zu einer Reihe bedrohlicher Schieflagen von Instituten gekommen; in Deutschland betraf es die IKB, in Großbritannien Northern Rock, in den USA Bear Stearns, sie alle hatten entweder verstaatlicht, aufgespalten oder zwangsverkauft werden müssen. Mit der Pleite von Lehman Brothers im September 2008 erreichte die Krise dann ihren bis heute gefährlichsten Ausbruch.
Auch wenn seither manches repariert werden konnte, so stehen die Banken doch nach wie vor auf einem brüchigen Fundament. Ihre Profitabilität ist angeschlagen und wird noch auf längere Zeit unter Druck stehen. Zum einen liegt das an der schon erfolgten oder in Aussicht genommenen Neuregulierung. So müssen zum Beispiel mehr Kapital und Liquidität vorgehalten und gewisse risikoreiche Aktivitäten vermindert werden: Das erhöht die Kosten und senkt die Erträge. Zum anderen sind die Erträge aufgrund der Schuldenkrise drastisch eingebrochen. Vormals als sicher geltende Staatsanleihen mussten wertberichtigt oder mit Verlust am Markt verkauft werden – und der griechische Schuldenschnitt tat ein Übriges. Die Interdependenz zwischen Staatsfinanzierung, Staatsbonität und Banken stellt nicht zuletzt die Banken selbst vor enorme Probleme und schmälert ihre Erträge. Auch die prekäre konjunkturelle Situation in weiten Teilen Europas wirkt sich negativ auf die Profitabilität aus. Die allgemeine Unsicherheit auf den Finanzmärkten schließlich hat zu einer signifikanten Verringerung der Gewinne am Kapitalmarkt und im M&A-Geschäft geführt.
Aufgrund der mangelnden Profitabilität und trüber Zukunftsaussichten sind viele Institute von den Ratingagenturen heruntergestuft worden, und das wiederum bedeutet eine Verteuerung ihrer Refinanzierungskosten am Markt. Insbesondere für einige Banken in den Krisenländern ist die Situation bedrohlich. Hinzu kommen hausgemachte Fehler, die von den Banken selbst zu verantworten sind; zum Beispiel höhere Personalkosten durch eine drastische Anhebung der Grundgehälter – als Ausgleich für eine geringere Barkomponente bei den Boni – und ein rasantes Anheuern von Personal im Jahr 2010, da man meinte, der Buße für die Finanzkrise sei nun Genüge getan und man könne wieder beginnen, lukrative Geschäfte nach altbewährtem Moral Hazard-Muster zu tätigen.
Zurzeit gibt es eine Vielzahl von Banken, deren Aktiva deutlich wertberichtigt werden müssten. Das ist insbesondere in Europa der Fall, aber auch in den USA. Ein guter Indikator für eine notwendige Wertberichtigung ist die Börsenkapitalisierung. Bei den meisten börsennotierten Banken erreicht diese noch nicht einmal den Buchwert, was darauf hindeutet, dass Marktteilnehmer noch manches in den Bilanzen vermuten, was eigentlich abgeschrieben gehört. Die europäischen Banken erreichten Anfang 2012 im Durchschnitt nur eine 40-prozentige Börsenkapitalisierung des Buchwertes, das heißt, sie waren an der Börse nicht einmal die Hälfte dessen wert, was ihnen ihre Wirtschaftsprüfer bescheinigt hatten. Wenn höhere Abschreibungen nötig sind, benötigen die Banken mehr Eigenkapital, um die Abschreibungen zu verkraften. Die Europäische Bankenaufsicht bezifferte den Fehlbetrag Ende 2011 europaweit auf 115 Milliarden Euro, davon 13 Milliarden für deutsche Institute. Sie forderte die Banken deshalb auf, ihre Kernkapitalquote bis Ende Juni 2012 auf neun Prozent zu erhöhen.
Aufgrund der sich Ende 2011 verdichtenden Anzeichen, dass das Bankensystem auf eine neuerliche Explosion zuraste, zog die EZB die Notbremse. Sie flutete das System mit zusätzlicher Liquidität, und zwar mit Hilfe des so genannten LTRO-Kredites (long term refinancing offering). Dieser Kredit wurde in zwei Tranchen, Ende Dezember 2011 und Ende Februar 2012, ausgezahlt und läuft über drei Jahre. Er war in seiner Höhe unbegrenzt, die Banken konnten also so viel Geld nachfragen, wie sie nur haben wollten. Im Dezember wurden 489 Milliarden Euro, im Februar 530 Milliarden nachgefragt, insgesamt also gut eine Billion Euro. An der ersten Tranche beteiligten sich 523 Banken, an der zweiten sogar 800 Banken. Von diesen 800 Banken kam über die Hälfte aus Deutschland! Und sogar die deutsche Autoindustrie konnte sich nicht beschweren. Sowohl Daimler als auch Volkswagen waren mit ihren Auto-Finanzierungsgesellschaften dabei, desgleichen andere europäische Industriekonzerne, die Konsumfinanzierung betreiben. Es ist eine groteske Konsequenz unseres aufsichtsrechtlichen Bankensystems, dass höchst gesunde, global agierende, realwirtschaftliche Konzerne auf billige Rettungskredite der EZB zurückgreifen können.
Mit dem sagenhaften Kredit von gut einer Billion Euro hat die EZB erreicht, dass die bei vielen Banken ganz akuten Refinanzierungsprobleme zunächst unter den Teppich gekehrt werden konnten (laut EZB hatten die europäischen Banken Anfang 2012 einen Refinanzierungsbedarf von 1,5 Billionen Euro innerhalb der nächsten drei Jahre, davon 550 Milliarden in diesem Jahr). Das laute Grummeln des Vulkans ließ nach.
Auch war befürchtet worden, dass die Banken aufgrund mangelnder Refinanzierungsmöglichkeiten zu hastig große Teile ihrer risikogewichteten Aktiva (im Wesentlichen an das Schattenbankensystem) verkaufen würden und es damit zu einer Kaskade von Fire Sales und entsprechenden Preisverzerrungen käme. Dieser Furcht war nun ein Ende gesetzt. Die Märkte empfanden die Geldspritze als einen Befreiungsschlag. Die Aktienmärkte und die Kurse der Banken stiegen, und viele Banken konnten sogar wieder ihre eigenen Anleihen im Markt unterbringen (der DAX schloss das erste Quartal mit einem Rekordplus von 17,8 Prozent ab – trotz des zum Teil flauen März –, der S&P 500 mit einem Plus von 12 Prozent, dem besten Ergebnis seit 1998).
Das Vertrauen der Banken untereinander blieb allerdings weiterhin gestört. Die so genannte »Angstkasse« der Banken, also ihre eintägigen Einlagen von Überschussliquidität bei der EZB, schoss Anfang März auf ein Rekordhoch von 821 Milliarden Euro. Wenn das Bankensystem normal funktioniert, wird diese Überschussliquidität im Interbankenhandel ausgeliehen. Der allergrößte Teil der Einlagen hatte seinen Ursprung im LTRO. Der kostet ein Prozent, für ihre Einlagen bekommen die Banken aber nur ein Viertel Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet bedeutet das also gewaltige Zinskosten von etwa 6,16 Milliarden Euro für das Bankensystem (821 Milliarden x 0,75 %). Weil es sich um extrem kurzfristige Übernachteinlagen handelt, kommt es zwar nicht effektiv zu diesen Zinskosten, aber die Rechnung zeigt, wie groß das gegenseitige Misstrauen der Banken war und ist.
Der (temporäre) Befreiungsschlag für das Bankensystem hatte allerdings ein saftiges Preisetikett. Zum einen hatte die EZB die Besicherungsvorschriften für die zweite LTRO-Tranche deutlich gelockert und gab sich nun auch mit Wertpapieren niederer Bonität als Besicherung zufrieden. Sie akzeptierte also auf gut Deutsch auch Schund. Zum anderen gab es erhebliche Mitnahmeeffekte, denn auch solche Banken fragten das billige Geld nach, die es eigentlich gar nicht brauchten (siehe Autoindustrie). Nirgendwo sonst hätten sie sich zu einem so billigen Kreditzins am Markt finanzieren können, sie wären sträflich dumm gewesen, dies nicht zu tun. Der so genannte Carry Trade wurde damit faktisch subventioniert, das heißt, die Banken nahmen das Geld von der EZB zu einem Prozent auf, um es in höher verzinsliche Anleihen oder andere risikoreichere, aber gewinnversprechende Finanzanlagen zu investieren.
Zu den Nachteilen zählt auch, dass sich die Banken von dem Druck befreit sehen, ihr Geschäftsmodell zu ändern. Sie können weitermachen wie bisher, denn sie sind nicht mehr auf den Markt als Hauptrefinanzierungsquelle angewiesen. Auf diese Weise werden auch solche Banken am Leben erhalten, die eigentlich aufgespalten und abgewickelt oder verkauft werden müssten. Zusätzlich besteht die Frage, ob der LTRO-Kredit nicht indirekt auch die Boni der Banker und die Dividenden der Bankaktionäre finanziert hat. All das sind ungute, wenn nicht sogar ausgesprochen kontraproduktive Konsequenzen.
Es besteht die große Gefahr, dass der LTRO-Kredit die notwendige Anpassung des Banken- und Finanzwesens nur hinauszögert und damit das Fundament für neuerliche Krisen legt.
Außerdem bleibt die ganz große Frage: Was passiert bei Fälligkeit des Megakredits? Verlängerung? Die Banken haben sich sehr komfortabel mit all dem vielen Geld eingerichtet. Schon jetzt kann man mit Sicherheit vorhersagen, wie sehr sie in Hinblick auf ihre Rückzahlungsverpflichtungen lamentieren und welchen Verlust von Wachstum und Arbeitsplätzen sie als Menetekel an die Wand malen werden. Und wer kann schon garantieren, dass in zweieinhalb Jahren die Banken, insbesondere die der Krisenländer, auf gesünderen Beinen stehen als heute? Ich würde nicht darauf wetten wollen. Doch selbst wenn alles wieder gut läuft, selbst wenn sich die Konjunktur in der EWU erholt, selbst wenn die Staatsschulden wieder abgebaut werden, der Kredit müsste innerhalb von nur zwei Monaten Ende 2014/Anfang 2015 am Markt refinanziert und dann bei der EZB zurückgezahlt werden (eine Rückzahlung aus vorhandenen Mitteln ist unrealistisch). Mehr als eine Billion Euro ist aber zu viel, dieses Volumen an Bankenanleihen werden Investoren nicht aufnehmen wollen, da wird Panik ausbrechen.
Aus diesem Grund ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir beim Rückzahlungstermin wieder genau da stehen, wo wir schon 2008 oder 2011 gestanden haben: entweder neuerlicher Ausbruch der Bankenkrise oder weitere Bankenrettung mit billigem Geld.
Zum Zweiten hat der Carry Trade bewirkt, dass die fatale Interdependenz zwischen Banken und Staaten noch enger geworden ist. Insbesondere Banken aus den Krisenländern haben einen großen Teil des Kredites, welchen sie nicht zur sofortigen Refinanzierung benötigten, in Staatsanleihen ihrer eigenen Regierung investiert. Dazu sind sie auch von ihren Regierungen und Aufsichtsbehörden gedrängt worden, aber der unheilvollen Symbiose ist eine heftige Vitaminspritze verabreicht worden.
Ich frage mich, ob es wirklich zweier Tranchen bedurfte, ob es wirklich über eine Billion Euro hat sein müssen. Mir scheint, mit der Hälfte des Betrages hätte die EZB ihr Ziel genauso gut erreichen und einen weiteren Ausbruch der Bankenkrise verhindern können, und kombiniert mit einer zügigeren und strikteren Neuregulierung hätte man die Banken auch schneller zum geschäftlichen Umdenken gezwungen. Auf gar keinen Fall darf es noch einmal zu einem ähnlichen Kredit an das europäische Bankensystem kommen, wie einige Beobachter das schon seit Anfang des Jahres fordern.
Genau wie bei den globalen Bankenrettungen 2008/09 brüsteten sich einige Bankenvertreter auch beim LTRO-Kredit, dass sie das Geld von der EZB