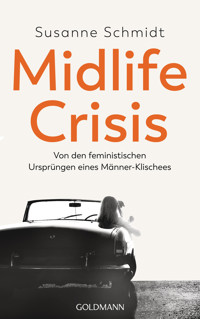13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Susanne Schmidt ist eine scharfe Beobachterin deutschen Sozialverhaltens." Die Zeit Busfahren in Berlin: des einen Leid, des anderen Freud. Aber immer ein Griff in die Wundertüte. Susanne Schmidt ist ehemalige Busfahrerin und fährt noch immer mit Leidenschaft gerne Bus – nur eben als Passagierin. Wir begleiten sie im M19 quer durch die Großstadt vom Villenviertel im Berliner Westen, über Deutschlands bekannteste Shoppingmeile in Charlottenburg bis zum Gemüsedöner nach Kreuzberg. Anhand einer Buslinie porträtiert Susanne Schmidt die Menschen. Liebevoll, scharf beobachtet, voller wahrhaftiger Begegnungen, und unvorhergesehener Überraschungen, von denen man gerne liest - und die einem manchmal bekannter vorkommen, als einem lieb ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
»Susanne Schmidt ist eine scharfe Beobachterin deutschen Sozialverhaltens." Die ZeitBusfahren in Berlin: des einen Leid, des anderen Freud. Aber immer ein Griff in die Wundertüte. Susanne Schmidt ist ehemalige Busfahrerin und fährt noch immer mit Leidenschaft gerne Bus — nur eben als Passagierin. Wir begleiten sie im M19 quer durch die Großstadt vom Villenviertel im Berliner Westen, über Deutschlands bekannteste Shoppingmeile in Charlottenburg bis zum Gemüsedöner nach Kreuzberg.Anhand einer Buslinie porträtiert Susanne Schmidt die Menschen. Liebevoll, scharf beobachtet, voller wahrhaftiger Begegnungen, und unvorhergesehener Überraschungen, von denen man gerne liest — und die einem manchmal bekannter vorkommen, als einem lieb ist.
Susanne Schmidt
Please leave the bus hier
Ein Bus, 26 Haltestellen, eine Berlinerin erzählt
hanserblau
»Alle Einsteigen!«
Dieses Buch ist wie die Stadt: verworren, überraschend, verrückt, unvollständig. Im Mittelpunkt stehen immer die Menschen in Berlin, ganz egal, ob sie ein paar Tage zu Besuch sind oder seit Jahrzehnten hier leben. Sie sind alle so liebenswert, so eigen, urkomisch oft. Sie sind zum Staunen und zum Wegrennen. Sie machen diese Stadt aus, füllen die Straßen mit prallem Leben, lärmen die Nächte durch, sie verändern und bewahren. Sie scheren sich einen Dreck um Verkehrsregeln und Höflichkeit. Sie mischen sich ein, kümmern sich um verwaiste Tiere, Blumenbeete, Vogelnester. Sie schenken traurigen Männern, Frauen, Kindern mindestens ein Lächeln, oft ein offenes Ohr. Sie lachen über sich wie über andere, sie schimpfen, lamentieren und sind immer in Bewegung. Wie die Stadt.
In welches System, welche Ordnung könnte ich die folgenden Seiten bringen, wo ich doch gerade den Charme der Berliner Unordnung so liebe? Welche Inhaltsangaben könnte ich schreiben für Sie, die Leserinnen und Leser, die meine Neugier teilen?
Ich will nicht regeln, nicht sortieren. Ich lade Sie ein, mitzukommen, durch Zeit und Stadt zu schlendern, ziellos, arglos, ohne Netz und doppelten Boden. Wir brauchen nur ein gültiges Ticket für die BVG.
Es gibt 6589 Bushaltestellen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Eine Auswahl der Route fällt schwer, ist aber unbedingt nötig:
Unsere Fahrt beginnt und endet an den Bushaltestellen der Linie M19. Dieser Bus fährt uns von Kreuzberg durch Schöneberg und Charlottenburg bis nach Grunewald und zurück. Es ist eine ganz durchschnittliche Linie. Und doch birgt jede Haltestelle Schatztruhen voller unverwechselbarer Besonderheiten, an Geschichten und Geschichte, an großen und auch an nicht so großen Gefühlen. Mit jedem Schritt aus den Mitteltüren tauchen wir ein ins Leben. Alle fünf Sinne ziehen uns durch die Straßen, über die Plätze, in die Häuser. Wir stolpern vom Damals ins Heute, fliegen ins Morgen, bleiben im Gestern kleben, überqueren das Hier und ruhen aus im Jetzt.
Eigentlich wollte ich ganz übersichtlich und anständig nach und nach ein- und aussteigen und jeweils berichten, was war, ist, sein wird. Doch genau das lässt die Stadt nicht zu. Es gibt kein einziges Geradeaus und sehr wenige Anfänge mit einem Schluss. Ich fahre kreuz und quer mit den Bussen durch die Stadt und verlasse manchmal sogar die ganze Linie, denn es gibt so viel zu sehen und zu fühlen. Diese Umwege gehören dazu.
Um uns nicht ganz aus den Augen zu verlieren, notiere ich gewissenhaft, welcher Bus mich wohin gebracht hat. Meine Hoffnung ist dabei, vielleicht gerade durch diese Verwirrung, dieses Übereinander an Orten und Zeiten und Bussen eine zuverlässige Gültigkeit des Großstadtlebens zu erfinden. So wie aus Musik, Romanen und Kunst eine Mahlzeit entsteht für uns, die wir hungrig nach Sinnlichkeit und Gefühlen sind, könnte am Ende eine Geschichte gelesen worden sein, die aus lauter Einzelstücken ein Bewusstsein zusammenfügt.
Oder dass wenigstens eine Lust erwacht, mit dem nächsten Bus zu fahren. Sich hineinzubegeben in das Schaukeln und Quietschen, in die Gerüche und Begegnungen, die das Leben im Bus ausmachen.
Nirgends ist die Bereitschaft der Stadtbevölkerung, richtig laut zu sagen, was Sache ist, freimütiger.
Der Bus ist unser gesellschaftlicher Reichtum, er befördert unbesehen alle Menschen gleich. Im Bus gibt es nur wenige Regeln. Die wichtigste ist, gegenseitige Rücksichtnahme zu üben. Nirgendwo funktioniert das direkter und beständiger als im Gedränge eines überfüllten Busses. Man rutscht zusammen, zieht den Bauch ein, kommt Unbekannten viel zu nah, lernt Parfums und Aftershaves kennen, tritt sich auf die Füße. Niemand regelt das Zusammensein im Bus, und doch regelt es sich immer wieder neu.
An jeder Haltestelle ändert sich die bunte Mischung. Nirgendwo sonst ist demokratisches Verhalten unverfälschter als hier.
Die sprichwörtliche Berliner Laune, vor der oft gewarnt und berichtet wird, erklärt sich im Bus und an den Haltestellen fast von selbst. Wer sich das Wohnzimmer mit knapp vier Millionen Menschen teilt, achtet anders auf die Dinge. Da wird gemeckert und geschimpft, wo andere nur mit den Schultern zucken. Da wird aber auch bestärkt, gelacht und unterstützt. Und spätestens, wenn der Bus kommt, ist der gröbste Ärger vergeben und vergessen.
Das Staunen über diese ununterbrochene gesellschaftliche Leistung hört nie auf. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und insbesondere der Bus ist in aller Selbstverständlichkeit der schönste Beweis, wie gut unsere Stadt funktioniert.
Ich kann nicht genug bekommen von diesem Durcheinander, dem Gedrängel und Platzmachen, dem Sehen und Hören, den Begegnungen im Takt der Haltestellen.
Dieses Buch erklärt die Großstadt nicht. Es existiert aus reiner, unstillbarer Lust am Sein und am Dasein. Und am Busfahren.
Vertrauen Sie mir, ich war Busfahrerin.
Dezember
Mit und mit ohne Corona
M19 — Mehringdamm/Kreuzberg
Der M19 beginnt und endet an der riesigen Kreuzung Yorckstraße, Mehringdamm, Gneisenaustraße. Hier gibt es alles, was man von einer Großstadt erwarten darf. In Sichtweite buhlen dreiundzwanzig Restaurants und Imbisse mit Köstlichkeiten aus aller Welt um Kundschaft. Die legendäre Pommesbude bietet neben Currywurst und Ketchup einzigartige Gespräche zwischen Berliner Originalen, echten und gewollten Berühmtheiten, ehrenwerten Berüchtigten, den üblichen Verdächtigen und Touristen. Jede Begegnung mit den Verkäuferinnen und Verkäufern ist ein Erlebnis, sie sind unbeschreiblich freundlich, sagenhaft direkt.
Wenige Schritte weiter stehen Tag und Nacht Menschen in langen Schlangen vor dem begehrtesten Gemüsedöner der Stadt. Für sie gehört das Anstehen um einen Döner zum Spaß, den man unbedingt erlebt haben muss. Wie faszinierend ist gerade diese ausgesuchte Langeweile, die nirgendwo sonst freiwillig und abenteuerlich verstanden wird.
Es gibt ein großes Hostel für Schulklassen und Reisende, ein traditionsreiches Berliner Kabarett-Theater (BKA) im fünften Stock, einen Bierhimmel für trunkene Stunden, Tage, Wochen, eine Erotik-Bar im alten Stil mit Tabledance, ein Beerdigungsinstitut, eine sehenswerte Kirche, etliche Klubs und Räume, die Sehnsüchte stillen und Pläne ermöglichen. Und ein paar Banken. In unmittelbarer Nähe liegt ein alter Friedhof. Cafés und kleine Bars in Kellerräumen oder im Hochparterre bieten Kaffee oder Bier, Kuchen oder kleine Speisen.
Es gibt alte und neue Ladengeschäfte, Buchhandlungen, Büros, Arztpraxen, Hinterhofidylle, Kinos, Supermärkte, Wohnungen, Kinderbetreuung und so vieles mehr. Jedes Bedürfnis wird nah, laut und heftig gestillt. Man könnte ein ganzes Leben hier verbringen, und es gibt Menschen, die genau das tun.
Für viele Stadtbesucher ist das ein Ausnahmezustand, den sie lange ersehnt haben und von dem sie noch länger schwärmen: die ganze schöne, wilde Großstadt in einem kleinen Radius, für den es trotzdem ungezählte Tage und Nächte braucht, um wirklich alles zu erkunden, auch die private Kellerkneipe im dritten Hinterhof.
Heute allerdings ist es still und dunkel, alles hat geschlossen, es sind kaum Fußgänger oder Fahrradfahrerinnen unterwegs. Die Pandemie beherrscht uns mehr, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Meinen Bus habe ich verpasst und treibe während der Wartezeit auf den nächsten in Gedanken verloren über die breite Straße. Ein später Winternachmittag vergeht im Feierabendverkehr.
Und weil es wirklich nichts zu sehen und zu hören gibt, überquere ich die laute Straße bis zur winzigen Mittelinsel. Sie dient dem Schutz vor Unfällen rund um den Lichtmast und einigen Ampeln. Dieses Pflaster habe ich nie zuvor betreten, es ist allein die Pandemie, die mich, wie so viele, auf unbekanntes Terrain führt. Rund um das Eiland verbiegen sich die vielspurigen Straßen.
Ich lehne am dicken Laternenmast und schaue. Im Rhythmus der Ampelschaltungen fahren die Autos linksherum, rechtsherum, geradeaus. Ein Großstadtballett auf schnellen Reifen.
Es ist ein ungewöhnlich schöner Blick. In Touristenführern könnte diese winzige Mittelinsel als besonders sehenswerter Ort gekennzeichnet werden. Ein Fleckchen Illusion inmitten des Verkehrsflusses.
Ich schaue und schaue. Die roten Lichter der Autos links mischen sich mit den weißen Lichtern rechts, alle weiteren Farben verschwinden in der Abwechslung. Es braust und hupt und rast die Stadt im Kreis, dreht sich im Rot-Gelb-Grün der Ampeln, fährt, steht, holt ganz kurz Luft.
Überwältigt von so viel Verkehr hocke ich mich hin, den Laternenmast als festen Leuchtturm im Rücken. Die veränderte Perspektive ist sofort hässlich. Stoßstangen, Auspufftöpfe, Reifen, Lärm, Staub und Abgase mischen sich hier unten zu einem gefährlichen Cocktail. Hastig stehe ich auf, umrunde die Insel, eine Hand immer an der Laterne, auf der Suche nach einem sicheren Überweg zum Bürgersteig.
Nach langen Minuten endlich eine Lücke. Hupen begleiten meine Schritte. Die Gebietsrechte sind klar verteilt: Eine Fußgängerin hat hier nichts zu suchen! Aus der Harmonie des Feierabendverkehrs wird für Sekunden eine kläffende, wütende Meute: »Weg hier, hau ab, die Straße gehört uns.«
Es ist zu dunkel, um Gesichter hinter den Windschutzscheiben zu erkennen. Für einen Moment fühle ich die Einsamkeit der Pandemie mit voller Wucht, dabei ist jetzt keine Zeit für Gefühle. Zwischen den Stoßstangen Haken schlagend überquere ich die Fahrbahnen und atme erleichtert auf, als ich auf dem grünen Mittelstreifen stehe.
Hier wohnt manchmal ein Mensch, in der Mitte des Lärms. Sein Zuhause sind ein paar dicke Pappen, eine alte Matratze und viele Kleinigkeiten, die in den Augen der meisten einfach leere Flaschen, Büchsen, Dosen, Plastikschachteln, verbogene Blechteile, verlorene Zettel, Bindfäden sind. Was mag er sehen, wenn er seine paar verstreuten Habseligkeiten betrachtet? Was mag er träumen unter seiner Decke?
Dieser Mittelstreifen ist ein unsichtbarer Ort, obwohl täglich Tausende Menschen genau hier entlangkommen. Das kurze Warten schafft keine Blicke, man steht unruhig und will nur weiter. Die Zeit bekommt keine Aufmerksamkeit, sie soll nur möglichst schnell vergehen. Und vielleicht sind solche Plätze eben deshalb auch Schlafzimmer für Menschen ohne Wohnung.
Ein Rettungswagen rast über die Kreuzung, ein zweiter folgt. Ihre Sirenen heulen weit. Der Abend verfliegt mit kaltem Wind in die Nacht. Die wenigen Passanten ziehen sich noch ein bisschen tiefer in ihre Kapuzen und Schals zurück. Es ist Dezember, der Monat, den man am liebsten Geschichten erzählend bei Kerzenlicht verbringt.
Mir wird es nun doch unheimlich in diesem vom Virus erzwungenen Vakuum. Hoffentlich kommt gleich der M19.
Selbst in tiefster Dunkelheit leuchtet das Gelb. Der Bus trägt Licht durch die Nacht und erfüllt bei jedem Halt das Versprechen: »Steige ein, du bist willkommen, hier ist es warm, hell und sicher. Auch für dich habe ich ein Plätzchen frei.« Schlafen und Wachen werden eins, das Leben rumpelt mit uns durch die Nacht.
Ich haste an die Haltestelle, ziehe noch im Laufen die Gummis der FFP2-Maske um die Ohren, rufe dem Busfahrer »Guten Abend« zu und klettere hoch in den oberen Stock.
Hier bin ich ganz alleine, aber das Rumpeln und Rattern des Doppeldeckers tröstet. Erschöpft lasse ich mich bis nach Hause kutschieren. Mit ein paar freundlichen Worten verabschiede ich mich vom Busfahrer und winke dem Gespann noch lange hinterher.
Januar
Anfang und Veränderung
M19 — Mehringdamm / Bülowstraße / Kurfürstendamm / Europa-Center
An Silvester herrscht normalerweise Ausnahmezustand. Mit Beginn des Feuerwerkverkaufs versinkt die Stadt in einer Wolke aus Euphorie und Angst. Wer Berlin kennt, ist in diesen Tagen ständig auf der Hut, denn die voreiligen Knallkörper können aus allen Richtungen kommen, werden aus Fenstern geworfen, in U-Bahn-Eingänge oder in die sich schließenden S-Bahn-Wagen. Wer kann, fährt irgendwo anders hin. Wer nicht kann, trägt Mützen, Ohrenschützer oder Regenschirme. Alle anderen genießen diese wilden Tage und Nächte zwischen den Jahren.
Berlin ist kaum wiederzuerkennen — die Bürgersteige sind voller brandgefährlicher Kartons, denn Feuerwerk darf an jeder Ecke verkauft werden, und normal gültige Regeln der Rücksichtnahme werden vor, zu und nach Silvester Nebensache. Die Lust auf ein bisschen allgemein anerkannte Anarchie ist groß.
Die Silvesternacht selbst gleicht einer rauschenden Orgie.
Nur eine Sorge stört: »Bin ich wirklich auf der angesagtesten Party des Jahres?«
Nach den ersten Getränken, Küssen, Tänzen, nach den ersten Griffen zum Nudelsalat oder den Austern, der zweiten vielleicht oder doch nicht veganen Bulette kommen die Zweifel. Die Gefahr rüttelt an allen Champagnerflöten, nur durch das Feiern im falschen Haus nicht mehr dazuzugehören im neuen Jahr, die Drohung, das Highlight dieser Nacht zu verpassen. Die Angst davor, zu feiern und doch den größten Spaß zu verpassen, den einen Moment nicht mitzuerleben und noch Jahre später davon erzählt zu bekommen, dass man nicht dabei war.
Tausendfach werden ähnliche Sätze gesprochen, so verlegen wie zielstrebig:
»Ach, weißt du eigentlich, wie schön du heute bist und wie froh ich über deine Einladung bin? Nächstes Jahr feiern wir bei mir, und du bist dann mein Ehrengast. Aber heute muss ich leider jetzt gleich los.«
»Es war wirklich ganz toll hier mit dir und dir und dir. Mit euch allen! Aber James und Johannes warten schon auf mich, ich musste ihnen schwören, sie zu besuchen, noch im alten Jahr, sonst sprechen sie nie wieder ein Wort mit mir.«
»Verpeilt wie ich bin, habe ich Kim und Leander fest versprochen, noch vorbeizukommen, und ihr seid mir doch nicht böse, oder, wenn ich schon verschwinde?«
»Rutscht gut rein, wir sehen uns im nächsten Jahr, tschüsschen mit Küsschen, ihr Lieben. Es war schön hier. Wir sehen uns im neuen Jahr!«
»Ich würde liebend gern noch bleiben, aber jetzt muss ich wirklich los!«
Und runter die Treppen auf die Straße in der Hoffnung, ein Taxi zu erwischen oder wenigstens irgendeine schnelle Mitfahrgelegenheit.
Auf den Straßen ist längst jede Zurückhaltung passé. Es ist diese eine Nacht, die alles erfüllen muss. Freie Taxis sind Mangelware.
Der Frust, warten zu müssen, ist riesig, denn die Zeit steht nicht still, egal, wer du bist. Silvester ist plötzlich sehr stressig. Zum Glück haben die Spätis auf, ein kaltes Bier und ein Schokoriegel beruhigen für einen Moment.
Und dann kommt zwischen Böller- und Raketenrauch ein gelbes Licht angerattert, hält und öffnet alle Türen.
In der Silvesternacht gibt es kein besseres Verkehrsmittel als den Bus. Dicht gedrängt stehen und sitzen die Fahrgäste, schwenken Sekt- oder Bierflaschen, singen, grölen, kommen sich schnell näher, tauschen kleine Küsse und Getränke, machen sich blaue Flecken und laute Beschimpfungen.
Wer mit lachendem Gesicht einsteigt, wird mit übermütigem Jubel begrüßt. Eine abenteuerliche Fahrt durch die lauteste Nacht des Jahres beginnt. Spätestens ab 23 Uhr ist alles außer Rand und Band, Leute tanzen mitten auf den großen Kreuzungen, die Luft wird immer dicker, und mit jeder weiteren Ladung Böller aus China oder Polen wird die Sicht schlechter.
Bald schon kann man die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite nicht mehr sehen. Menschen tauchen auf und verschwinden im Nebel der Raketen. Lichter sprenkeln den bedeckten Himmel, ein verirrter Superheuler erschreckt selbst die abgebrühten jungen Männer.
Der Busfahrer behält die Nerven und schleicht im Schritttempo von ungefährer Haltestelle zu ungefährer Haltestelle. Er muffelt dabei gerne vor sich hin und freut sich innerlich über den Feiertagslohn und die frechen Blicke und Sprüche der Damen und Herren.
Am Brandenburger Tor steigt die größte Silvesterparty des Landes. Hunderttausende Gäste aus aller Welt reisen extra an, um die außergewöhnliche Atmosphäre zwischen Livemusik und Moderation, Bratwurst und Falafel, Bier und Champagner im Gedränge mitzuerleben. Sie lieben dieses atemlose Durcheinander unter freiem Himmel, umgeben von den Bäumen und Wiesen des Tiergartens. Sie lieben den wohligen Schauer dieser unvorhersehbaren Stunden und erzählen zu Hause begeistert von ihren Fahrten in den verkehrten Bussen, der Freundlichkeit der anderen.
Je später der Abend, umso sorgloser wird die Stimmung unterwegs. »Feiern kannste überall, wo’s was zu trinken gibt. Und Musik!«, sagt sich der angesäuselte Berliner und hält sich an der Mitteltür fest. Luftschlangen und Liederfetzen wehen über die Sitze, und auf den Stehplätzen wird geschunkelt. In den langen Schlenkerbussen tanzen die Fahrgäste schon mal die engste Polonaise des Abends und fahren einfach bis irgendwohin, wo es ihnen lustig genug erscheint, um auszusteigen. Auf das eigentliche Ziel kommt es gar nicht so genau an, sobald gleichgesinnte Menschen aufeinandertreffen. Auf den hinteren Plätzen schlafen manche ihren ersten Rausch kurz aus, um an der Endhaltestelle ins Gebüsch zu pinkeln und erleichtert in den nächsten Bus zu springen. Es ist so einfach, sich für eine Nacht zu verlieren und später aufzuwachen, ohne zu wissen, ob man etwas verpasst oder im Zentrum des Vulkans alles miterlebt hat. Die Busse fahren schließlich zuverlässig die ganze Nacht lang durch.
So herrlich und schrecklich ist es normalerweise.
Diesmal aber liegt Silvester in einer schweren Welt. Die Pandemie zerstört seit langen Monaten Leben und Alltag; das Virus trägt den Tod in einer Häkeltasche aus Luftmaschen durch alle Länder, über alle Grenzen. Es teilt wahllos aus: Krankheit, Angst, Entsetzen, Sterben.
Die großen Feiern fallen erneut aus, um Ansteckungen zu vermeiden. Das Feuerwerk fällt auch ins Wasser: Es gibt keinen Verkauf in Berlin, um Feuerwehr und Krankenhäuser zu entlasten. Im weiteren Umland sind die Regeln etwas anders. Aber insgesamt ist es sehr still, und die Straßen sind verlassen. Das neue Jahr wird höchstens in ganz kleinem Rahmen und vor allem privat begangen.
Viel zu feiern ist im zweiten Jahr der Pandemie nicht, viel zu hoffen umso mehr.
Die meisten bleiben zu Hause, gehen früh ins Bett, betrinken sich am Nachmittag, heulen zusammen in die Sofakissen und beschwören insgeheim alle guten Geister. Man kann frisch getestet ins Kino gehen und den Jahreswechsel dort mit einem Glas Sekt und einem ausgewählten Film angenehm verpassen. Man kann allein oder zu zweit auf die »Berliner Berge«, den Kreuzberg oder den Teufelsberg, klettern und auf eine winzige Stimmung und ein paar Raketen aus den Vorräten der letzten Jahre zählen.
Und man kann in den Bus steigen und sich einfach treiben lassen.
Ich verstaue eine kleine Flasche Sekt, packe Luftschlangen und Wunderkerzen dazu und gehe voller Neugier zur Haltestelle. Unterwegs entspanne ich nach ein paar Hundert Metern, denn es gibt kaum andere Menschen auf den Straßen, und vor allem zündet niemand Heuler oder Funkenteufel.
Die Haltestelle ist hell beleuchtet und leer. Hier fängt die Linie an, der Busfahrer steht mit seinem Doppeldecker ein paar Meter weiter weg und raucht mit Hingabe eine Pausenzigarette. Das alte Jahr hält noch vier Stunden. Es gibt keinen Grund zur Eile.
Dann steigt er umständlich ein, dreht den Zündschlüssel, fährt langsam vor und würdigt mich keines Blickes. Ich suche mir den besten Sitzplatz aus und starre aus dem Fenster. Mein Plan ist simpel: Ich steige spontan aus, schaue alles an und allem zu und warte danach auf den nächsten Bus. Einmal bis zur Endstation und zurück.
Worauf ich nicht vorbereitet bin: Es passiert nichts, die Straßen und Haltestellen sind dunkel und leer, zwar sitzen jetzt vier weitere Fahrgäste im Bus, aber die sind müde und still. Und weil das sehr langweilig ist, steige ich spontan an der nächsten Haltestelle aus. Ich laufe durch die dunkle Nacht, schaue in leere Fenster und geschlossene Geschäfte.
Hier ist die U-Bahn eine Hochbahn und rattert über dem Mittelstreifen an den Häusern vorbei. Ihre Waggons sind voller verlassenem Licht, nur wenige Menschen sitzen und stehen hinter den Fenstern. Es ist ein so seltsamer Spaziergang durch die fremde Stille. Ich höre den Sekt in meiner Tasche gluckern und suche den abnehmenden Mond vergeblich.
Weit vor mir endlich ein paar Menschen. Beim Näherkommen erkenne ich, es sind miteinander befreundete Jugendliche. Sie sind dunkel gekleidet mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen. Sie rennen aufgeregt hin und her und johlen laut. Die ganze Gruppe hat Rucksäcke und sonstiges Zeug im finsteren Hauseingang hinter sich gelagert.
Die Situation verunsichert mich. An Silvester weiche ich jugendlichen Gruppen aus Erfahrung eher aus, als mitten durch sie zu gehen.
Hier sind nur sie und ich, und ihre Stimmung dort, noch etwa 100 Meter vor mir, ist nicht einzuschätzen. Sind sie aggressiv, wütend, im Rausch irgendwelcher Drogen? Ausweichen geht auch nicht, und zurück will ich nicht. Meine Schritte werden immer kleiner.
Plötzlich bewegt eine große Aufregung die ganze Gruppe, es ist kein Grund zu erkennen. Eine U-Bahn kommt, rauscht vorbei und wirft ihr streifiges Licht auf die dunklen Häuser. Und jetzt sehe und höre ich es.
Die Jugendlichen schießen Böller auf die Waggons, johlen bei jedem Treffer, zünden neue Knaller und versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen. Es sind besonders laute Kanonenschläge. Jeder Knall lässt die Luft und auch die Fensterscheiben erzittern. Alles dauert nur wenige Sekunden, denn die U-Bahn ist schnell außer Reichweite. Aber die Frontlichter der nächsten sind schon zu sehen.
Trotz aller Langsamkeit bin ich mittlerweile kurz vor den Jungs, versuche, ganz unauffällig zu sein.
»Halt mal, stopp!«, ruft plötzlich einer.
»Wart mal kurz«, brüllt ein anderer.
Mein Herz bleibt fast stehen. Ich zwinge mich weiterzuschlendern. Ein leerer Bus fährt an uns vorbei. Die U-Bahn ist kurz vor Wurfweite.
Trifft man auf Bären in der Wildnis, soll man sich totstellen, um nicht gebissen zu werden, fällt mir ein. »Ich bin gar nicht da und eh gleich wieder weg«, beschwöre ich innerlich die Anführer. Es scheinen allerdings alles Anführer zu sein, heutzutage sind Jugendliche oft sehr viel demokratischer organisiert.
Alle gucken mich jetzt abwartend an — ich muss zurückgucken und suche in ihren Gesichtern einen Hinweis darauf, was jetzt gleich geschehen wird.
»Schön’ guten Abend und rutscht gut rein nachher«, grüße ich sie mit gespieltem Mut.
Sie reagieren nicht. Ich überlege, wie viel Geld in meinem Portemonnaie liegt und ob mein altes Smartphone überhaupt noch attraktiv genug zum Klauen ist. Verdammte Pandemie, ohne die würde ich jetzt auf einem rauschenden Fest mit Freundinnen und Freunden feiern. Blöde Idee, ausgerechnet in der gefährlichsten Nacht des Jahres durch dunkle Straßen zu laufen. Ob ich ihnen einfach alles »schenke«, auch die kleine Flasche Sekt und meinen Stolz?
Unschlüssig, was die bessere Taktik ist — wegrennen oder aufgeben —, beobachte ich aus den Augenwinkeln: Sie packen Feuerzeuge ein und legen Knaller sorgfältig auf einen Haufen.
»Leute, lasst mal die Frau durch!«, fordert einer mit heiserer Stimme.
»Wir warten, bis Sie weiter weg sind. Ist sonst zu laut«, sagt ein anderer und grinst sehr freundlich. Der Nächste zieht die Kapuze ab und zeigt mir seine Ohrstöpsel: »Wir haben die starken Kanonenschläge besorgt, die knallen so richtig rein!«
Die ganze Gruppe lehnt sich in den Hauseingang, trinkt einen Schluck aus mitgebrachten Wasserflaschen.
Ich durchquere die Gefahrenstelle, gleichermaßen erleichtert und beschämt.
»Alles klar, Jungs. Passt gut auf euch auf, und macht keine Dummheiten«, rufe ich der Gruppe zu.
»Wir doch nicht! Schönes neues Jahr dann, und bleiben Sie gesund«, antworten sie.
Sie warten tatsächlich, beobachten mich genau, lassen zwei Bahnen einfach durchfahren und legen mit ihrem beängstigenden Sport erst wieder los, als sie sicher sind, dass ich außer Schmerzweite bin. Vorher aber winken mir alle zu, und ich winke zurück.
Mit frohem Herzen steige ich in den nächsten Bus. Es riecht nach Rauch und Bier. Der Busfahrer hat ein kleines Radio dabei und hört in Flüsterlautstärke eine Schlagerparade. Je leiser etwas ist, umso konzentrierter muss man hinhören.
Hier sind die Haltestellen nie weit voneinander entfernt. Schnell treibt mich die Mucke des Busfahrers wieder auf die Straße, und was für ein Glück — es ist eine Lieblingsstraße, die Potsdamer!
Links runter blinken viele blaue Signallichter der Polizei, dort ist weiträumig abgesperrt.
Eine alte Frau geht mit ihrem Hund spazieren. Aus einem offenen Fenster wirft ein Mann mit nacktem Oberkörper eine vertrocknete Zimmerpflanze auf den Bürgersteig. Ein Auto fährt vorbei, ohne auf die Ampel zu achten. Hin und wieder knallt es in der Ferne, ein paar wenige Raketen zeigen ihre Goldregenpracht.
Mich interessiert natürlich vor allem die abgesperrte Zone. Ich schlendere hin, laufe mitten auf der leeren Straße, nehme den ganzen Platz auf, würde am liebsten die Arme ausbreiten auf der riesigen Kreuzung und mich drehen.
Erst in solchen Momenten fällt einem auf, wie viel Raum ganz selbstverständlich dem Autoverkehr gegeben wird. Ein ganzer Park könnte hier wachsen, mit kleinem See und Schaukeln für die Kinder. Große Bäume könnten Schatten werfen auf Wiesen und Sportplätze. Ein Biergarten würde Eis am Stiel verkaufen.
Mitten in meinen Träumen von mehr Grün fallen mir wieder die vielen Polizisten und Polizistinnen auf. Sie stehen lässig an ihren Wagen, rauchen, lachen, unterhalten sich. Zielstrebig gehe ich durch die Absperrungen, schaue knapp nach links und rechts, deute ein Nicken an. Sie beachten mich gar nicht, das gefällt mir.
Die Kreuzung Potsdamer Straße/Pallasstraße ist an allen Ecken voller Leben. Hier ist die Großstadt große Stadt. Sie streckt und dehnt sich in der Zeit — der legendäre Sportpalast stand genau hier. Die Verbrechen der Nationalsozialisten fanden hier ein hunderttausendfaches Echo.
Ein Hochbunker, erbaut von russischen Zwangsarbeitern, verschwindet fast in der täglichen Sicht. Angeknüpft ist der sogenannte Sozialpalast. Über 2000 Menschen wohnen im denkmalgeschützten Bau aus den 70er-Jahren. Früher galt das sehenswerte Bauwerk im Stil des Brutalismus als Ort für »Andere«. Naserümpfend mieden viele Menschen und Politiker diese Ecke Berlins. Hier wollte die sogenannte gute Gesellschaft ganz und gar nicht wohnen. Autos wurden schnell verriegelt vor den roten Ampeln.
Nur der Sensationstourismus liebte diesen Kiez. Sicher und warm hinter den großen Fenstern der Sightseeingbusse sitzend, führten die Veranstalter am durch den Volksmund treffend getauften »Sozialpalast« vorbei. Mit den Fingern auf die vielen Menschen zeigend, die aus allen Himmelsrichtungen mehr oder weniger zufällig hier ein Dach über dem Kopf fanden und in gemeinsamer Enge immer versuchten, das Beste aus allem zu machen.
Die vielen Satellitenschüsseln auf den Balkonen zeugen von der Sehnsucht nach den alten Ursprüngen und werden tausendfach fotografiert.
Hier galt das Recht des Stärkeren, und es waren lange die Falschen, die mithilfe von Angst und Skrupellosigkeit das Sagen hatten. Als die Stadt aber Verantwortung zeigte, die Häuser gar abreißen wollte, geschah, was Berlin so liebenswert macht: Mieterinnen und Mieter krempelten die Ärmel hoch, gründeten einen Mieterbeirat, wehrten sich gegen Drogendealer, Zuhälter und Schimmel. Gemeinsam mit der Eigentümergesellschaft und der Stadt suchte und fand man Lösungen für die dunklen Winkel, die illegalen Geschäfte in verwinkelten Treppenhäusern und unübersichtlichen Verbindungsgängen. Einiges wurde umgebaut, vieles saniert. Seitdem ist aus der seelenlosen Wohnmaschine ein lebhafter, lebenswerter Ort gewachsen.
Irgendwann wurde offiziell ein neuer Name für diesen Gebäudekomplex gesucht. Statt »Sozialpalast« heißt er jetzt »Pallasseum«. Die Lebens- und Wohnqualität hat sich allerdings durch Taten statt Namen gewandelt. Früher hauste in den heruntergekommenen Blöcken die soziale und bauliche Verwahrlosung.
Es gibt weiterhin Probleme und Auseinandersetzungen, wo so viele Menschen auf so wenig Raum zusammenwohnen. Aber es gibt auch positive Entwicklungen und ein ständiges Miteinander. Die Wohnungen sind begehrt und schwer zu bekommen.
Gegenüber künden die Fenster des legendären »Drugstore«, dem ältesten selbstverwalteten Jugendzentrum in Berlin, von der unverständlichen Zukunft: Dem »Drugstore« wurden die Mietverträge nicht verlängert, das Jugendzentrum muss ausgerechnet dem Kapitalismus weichen.
Dass eine derartige Kündigung nicht stumm akzeptiert wird, ist allen klar. Gut organisiert besetzten die Betroffenen die Räumlichkeiten. Sie wehren sich. »Wir gehen hier nicht raus« steht in die Fenster gemalt. Es gibt immer noch die vergebliche Hoffnung auf ein Weiterbestehen. Die Proteste gegen die Kündigung sind laut und, wie es der Sache angemessen ist, verzweifelt.
Seit 1972 sind die Räumlichkeiten des »Drugstore« eine feste Adresse im Leben der Jugend. Legendäre Konzerte, Diskussionsrunden, Austausch und Aufnahme von Meinungen, Plänen, Kunst und Kultur, Aktionen und Demos gegen Gewalt und vor allem gegen jeden Faschismus füllen die Räume.
Die Unbedingtheit, mit der geschützte Räume für Jugendliche da sein müssen, weil sie die Bildung von Meinungen, Lebenswegen und der Auseinandersetzung mit dem wachsenden Ich und dem Du ermöglichen, wird hier mit Geldscheinen getreten.
Wo Heranwachsende nicht erwünscht sind, wo sie vertrieben werden, gerät die Gegend in einen Schwindel. Sie taumelt. Wer sich nicht festhält, fällt.
Was wird aus dieser ehemals gesunden Mischung, wenn junge Sehnsucht nach einer besseren Welt verdrängt wird? An welchem Anderswo finden dann Diskussionsrunden, Konzerte, Lesungen, solidarische Arbeit gegen Rechts, gegen Sexismus, Armut und Gewalt statt?
Eine Feuerwehrsirene weckt mich aus meinen Gedanken. Normalerweise hallt die Stadt an Silvester von Feuerwehrsirenen wider, pünktlich um wenige Sekunden nach 00:00 Uhr brennen Balkone, bluten Fingerstümpfe, knallen leere Flaschen auf volle Streithähne.
Diesmal zerreißt die Stille der Pandemie den Lärm der vergangenen Unbeschwertheit.
Ich schaue mich um. Meine Augen treffen den kritischen Blick einer Polizistin.
»Guten Abend, warum ist denn hier abgesperrt?«, frage ich sie neugierig.
Mit geübtem Blick checkt sie mich ab und steckt mich in die »Harmlos«-Schublade.
»Hier ist doch überhaupt nichts los?«, bekräftige ich.
»Abwarten«, antwortet sie mit einem rätselhaften Lächeln.
»Erwarten Sie denn was?«
»Wir passen auf.« Zwei Kollegen stellen sich zu uns.
»Alles in Ordnung?«, fragen sie.
»Sie will wissen, warum hier abgesperrt ist.«
»Auf der Kreuzung hier kloppen sich sonst die Leute die Köppe ein. Wir passen nur auf, dass sich niemand was tut«, richtet sie sich nun ruppig an mich.
Ich gucke fragend.
»Hier verabreden sich die Jungs und beschießen sich gegenseitig mit Feuerwerk. Die binden Böller zusammen, was meinen Sie, was das für Explosionen sind! Die beschießen alles, was sich bewegt. Das ist wie im Krieg. Da wird Vorrat angelegt, ganze Kisten voller Polenböller, und dann immer ruff, ohne Sinn und Verstand.«
»Die sind völlig außer Rand und Band. Ich möchte nicht hier wohnen müssen. Das wäre mir zu gefährlich, der Kiez ist berüchtigt für die Typen.«
»Sie sind wohl keine Zeitungsleserin, steht doch überall drin in der Presse. ›Dramatische Zustände in der Pallasstraße‹, ›Eskalation der Gewalt‹, und was sie alles schreiben. Und zum Schluss sind immer wir schuld, egal, ob wir einschreiten oder nicht.«
Ich freue mich, dass der Polizeibeamte so korrekt antwortet.
»Aber diesmal sind Feuerwerk und Party doch eh verboten?«
»Verboten ist vieles«, antwortet er und dreht sich zum Gehen.
»Gehen Sie weiter, Aufenthalt ist hier jetzte nicht!«, ruft die Polizistin zwei jungen Männern zu, die sich in eine leere, heute nutzlose Bushaltestelle setzen wollen. »Aber bisschen dalli!«, ergänzt ihr Kollege.
»Wir sitzen doch nur hier, mach mal nicht so ,