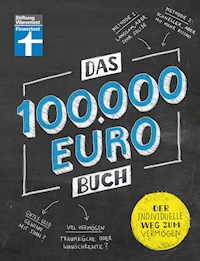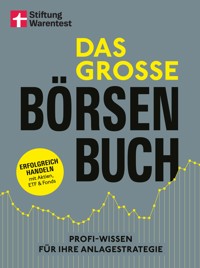
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das große Börsenbuch – Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Aktienhandel Sie möchten nachhaltig Vermögen aufbauen und die Chancen der Finanzmärkte optimal nutzen? Mit der Expertise der Stiftung Warentest erhalten Sie in diesem Handbuch fundiertes Wissen und praxisnahe Empfehlungen – wissenschaftlich erwiesen, einfach zu verstehen und direkt umsetzbar. Was Sie im Buch erwartet: - Tiefgang für Profis: Kennzahlen richtig deuten, Märkte bewerten, ein effizientes Portfolio aufbauen – alles auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. - Klarheit für Einsteiger: Die wichtigsten Börsengrundlagen, von Aktienstrategien über ETFs bis zur Depotwahl – klar und praxisnah erklärt. - Praxisnah & aktuell: Neueste Forschungsergebnisse zu erfolgreichen Investmentstrategien und konkrete Handlungsempfehlungen für Ihre Kapitalanlage. - Umfassend, aber fokussiert: Alles Wichtige zu Wertpapieren, Anlagestrategien, Risiken und Steuervorteilen – ohne unnötigen Ballast. Warum dieser Leitfaden einzigartig ist: - Stiftung Warentest-Expertise: Neutral, unabhängig und faktenbasiert – eine verlässliche Quelle für langfristig erfolgreiche Investments. - Wissenschaft statt Mythen: Welche Strategien sich bewähren und welche nur leere Versprechungen sind – klar belegt, verständlich vermittelt. - Theorie & Praxis kombiniert: Von der Wahl des richtigen Aktiendepots über die erste Order bis zur steueroptimierten Anlage. Vertrauen Sie auf die renommierte Finanzexpertise der Stiftung Warentest und nutzen Sie die besten Anlagetipps für Ihren Vermögensaufbau sowie finanziellen Erfolg. Jetzt investieren und langfristig profitieren!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 800
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Victor Gojdka
Das große Börsenbuch
Profi-Wissen für Ihre Anlagestrategie
Inhaltsverzeichnis
Schnellkurs Börse
An der Börse zum Vermögen
Vermögensaufbau – wie geht das?
Aktien – einfach unschlagbar
Wie die Börse funktioniert
Fünf Prinzipien für die Börse
Zinseszins – wie die Vermögenskraft wirkt
Effizienz – wie die Kurse wirklich ticken
Ruhe – warum sie sich auszahlt
Risiko – wann es Rendite bringt
Balance – warum eine gute Mischung clever ist
Die Börse – einfach alles kaufen
Grundwissen Börse
So läuft der Börsenhandel heute
Diese Aktiensegmente gibt es
Wie die Leitbörse Xetra funktioniert
Wer die Börse kontrolliert
Die Barometer der Börsenwelt
Wie Aktienindizes funktionieren
Die wichtigsten Weltindizes
Die wichtigsten Europa-Indizes
Die wichtigsten Deutschland-Indizes
Die wichtigsten Schwellenländer-Indizes
Die wichtigsten US-Indizes
Mit ETF der ganzen Börse folgen
So funktionieren ETF
Der ETF-Baukasten für Ihr Portfolio
Die Kurse – Trends erkennen und nutzen
Was die Kurse bewegt
Das Börsenklima verstehen
Wie die Konjunktur die Kurse bewegt
Wie die Notenbanken die Kurse bewegen
Wie die Politik Kurse macht
Wie die Psychologie Kurse macht
Auf Trends und Branchen setzen?
Die Marktlage interpretieren
Aus dem Börsentrend eine Strategie formen
Eigene Branchenideen umsetzen
Die Aktien – den Kurszettel verstehen
Grundwissen Aktie
Was sind Aktien?
Welche Rechte Aktien bringen
Diese Arten von Aktien gibt es
Was im Aktienleben passieren kann
Aktien einordnen und verstehen
Die Aktienwelt durchforsten
Den Kurszettel sortieren
Mit Kennziffern auf Kurs
Was Charts verraten
Den optimalen Anlagemix finden
Einfach anlegen
Die eigene Börsen-Balance finden
Das Portfolio für alle
Das Weltportfolio mit Varianten
Zum Portfolio-Profi werden
Die wichtigsten Portfolio-Kniffe
Die besten Beimischungen
Die Faktorstrategien für ein Renditeplus
Die Portfolios der Börsenlegenden
Einzelaktien mit Strategie
Auf Einzeltitel setzen
Einzelaktien gekonnt einsetzen
Wie riskant sind Einzelaktien?
Mit Checklisten zum Erfolg
Firmen unter die Lupe nehmen
Das Unternehmen verstehen
Die Unternehmenszahlen lesen
Firmen mit Kennziffern einschätzen
Eine Strategie finden und umsetzen
Die Value-Strategie
Die Growth-Strategie
Die Dividenden-Strategie
Ein Börsentagebuch führen
Mit ETF und Fonds anlegen
Das Fondsprinzip
So funktionieren Fonds
ETF – einfach und erfolgreich
ETF – im Detail erklärt
Der Börsenhandel von ETF
Diese ETF-Kategorien gibt es
Aktive Fonds
Fonds in allen Varianten
Was aktive Fonds kosten
Aktive Fonds analysieren
Aktive Fonds kaufen
Anleihen
Grundwissen Anleihen
Was sind Anleihen?
Die Kennzahlen verstehen
Welche Anleihen gibt es?
Staatsanleihen
Ausländische Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Hochzinsanleihen
Weitere Anleiheformen
Am Anleihemarkt navigieren
Die Ratings nutzen
Die Zinsentwicklung beobachten
Die passende Anleihestrategie finden
Einzelanleihen finden und kaufen
Anleihe-ETF finden und kaufen
Renditebooster fürs Depot?
Was Risikoanlagen wirklich bringen
Gold – wie hell glänzt es?
Gold an der Börse kaufen
In Rohstoffe investieren
Bitcoin & Co.
Zertifikate – mit Brief und Siegel?
Aktien richtig kaufen
Bank und Broker finden
Die Depottypen kennen
Das beste Depot auswählen
Richtig ordern
Die Börsenkurse verstehen
Der richtige Börsenplatz für die eigene Order
Der Laufzettel für jede Order
Die Orderfinessen für Profis
Das Depot managen
Immer am Ball bleiben
Wenn sich das Leben ändert
Das Depot kontrollieren
Im Crash richtig handeln
Das Vermögen auszahlen
Was nach Steuern bleibt
Die eigene Anlage richtig versteuern
Mit Verlusten Steuern sparen
Steuerspezial für Fonds und ETF
Steuerspezial für Aktien
Die Steuerlast überschlagen
Hilfe
Basis-ETF: Globale Aktien und Euro-Anleihen
Weitere ETF: Beimischungen
Adressen
Fachbegriffe erklärt
Stichwortverzeichnis
Impressum
Schnellkurs Börse
An der Börse zum Vermögen
Vermögensaufbau – wie geht das?
Aktien – einfach unschlagbar
Wie die Börse funktioniert
Fünf Prinzipien für die Börse
Zinseszins – wie die Vermögenskraft wirkt
Effizienz – wie die Kurse wirklich ticken
Ruhe – warum sie sich auszahlt
Risiko – wann es Rendite bringt
Balance – warum eine gute Mischung clever ist
An der Börse zum Vermögen
Für viele Menschen ist die Börse ein Faszinosum: Große Gewinne und verheerende Verluste liegen eng beieinander. Und trotzdem lässt sich dort ein Vermögen machen – solide und mit Plan.
Vermögensaufbau – wie geht das?
Kurskapriolen, Rezessionen und steigende Preise: Wie können Sparerinnen und Sparer da noch ein Vermögen aufbauen? Ganz einfach – an der Börse.
Beim Blick auf die Nachrichten aus der Finanzwelt kann einem seit Jahren angst und bange werden. Erst kollabierten in der Finanzkrise weltweit Banken, dann brachte die Eurokrise manche Staaten an den Rand der Zahlungsunfähigkeit. Anschließend gab es auf dem Konto jahrelang vor allem Null- und Negativzinsen, bis in der Corona-Pandemie die Wirtschaft nahezu stillstand – und im Anschluss viele Preise scheinbar nur noch stiegen.
Die Schlagzeilen der Zeitungen, Nachrichtenportale und Videokanäle im Netz zeugen davon: „Angst vor dem Euro-Aus“, schrieb ein Nachrichtenmagazin 2015. „Der schnellste Aktiencrash aller Zeiten“, wusste eine Tageszeitung zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020. „Wie schafft man es, endlich für das Alter zu sparen?“, fragte ein Videokanal im Netz nur ein Jahr später. Und zum Weltspartag 2022 titelte eine Boulevardzeitung: „Inflation frisst unser Geld auf: Der traurigste Weltspartag seit Jahrzehnten!“
Wenn Lohn und Rente nicht reichen
Die Schlagzeilen sind selbstverständlich zugespitzt, aber die tiefer liegende Frage ist einfach und kompliziert zugleich: Wie lässt sich in diesen Zeiten noch ein Vermögen aufbauen? Einerseits lässt sich angesichts gestiegener Preise vom Ersparten oft weniger kaufen. Andererseits reicht das Arbeitseinkommen allein oft nicht aus, um größere Sprünge zu machen. Und ob die Rente so sicher ist, wie der ehemalige Bundessozialminister Norbert Blüm einst meinte, ist ebenfalls fraglich.
Die Deutschen entdecken die Aktie neu
So viele Menschen hierzulande halten Aktien, Mitarbeiteraktien oder Aktienfonds
Quelle: Deutsches Aktieninstitut
Überlegen sich die Menschen hierzulande, wie sie dennoch ein kleines Vermögen aufbauen können, fallen ihnen vor allem zwei Wege ein: entweder eine große Summe erben – oder Lotto spielen. Doch ein großes Erbe bekommt nicht jeder, und die Chance auf den Hauptgewinn im Lotto ist verschwindend gering. Finanzwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen raten daher bereits seit Jahren zu Aktien, Fonds oder ETF. Kurz: Die Deutschen sollten ihren persönlichen Börsengang wagen.
Ist die Börse besser?
Vielen scheint die Börse dennoch wie ein Buch mit sieben Siegeln, das sie endlich verstehen wollen. Andere haben schlechte Erfahrungen gemacht, als zur Jahrtausendwende die Dotcom-Blase der Internetaktien platzte, und wollen nun einen zweiten Anlauf wagen. Manche haben in der Corona-Pandemie mit dem Handy wiederum eher zufällig an der Börse losgelegt und wollen ihr Depot nun professionell aufstellen.
Professionelle Vermögensverwaltungen argumentieren gerne, Privatleute hätten an der Börse sowieso keine Chance gegen die vermeintlichen Profis. Hochfrequenzhändler handelten Aktien schließlich im Takt von Nanosekunden, die Konstruktion komplexer Derivate sei selbst für Expertinnen und Experten höhere Mathematik, und nur Fondsleute hätten Wissen aus erster Hand über aussichtsreiche Unternehmen. Klar, wer die eigenen Finanzprodukte verkaufen will, muss so argumentieren. Fachleute aus den Finanzwissenschaften und dem Verbraucherschutz sind sich mit Stiftung Warentest jedoch seit Jahren einig: Trotz des Aufs und Abs können auch Privatmenschen an der Börse ihren Schnitt machen – und am Ende oft genug sogar die Profis schlagen. Wie solider Vermögensaufbau an der Börse gelingen kann, zeigt Ihnen dieses Buch von A bis Z.
Aktien – einfach unschlagbar
Kurzfristig können die Kurse ordentlich schwanken. Langfristig aber schlugen Aktien die Inflation – und sogar andere Anlageformen.
Lassen Sie sich zu Beginn kurz auf ein kleines Experiment ein: Versetzen Sie sich gedanklich einmal zurück in die Vereinigten Staaten des Jahres 1900, als der New Yorker Bürgermeister noch Theodore Roosevelt hieß, die Farbfotografie als neueste Innovation galt und im Finanzteil der New York Times über Eisenbahnaktien berichtet wurde. Keine Angst, Sie haben bei diesem Gedankenspiel im Grunde nichts zu verlieren, der Einsatz ist bloß ein US-Dollar. Diese Münze mit dem Adler auf der Rückseite hätten Sie entweder in weltweite Aktien, in Staatsanleihen vieler Länder oder sogenannte Schatzpapiere der Vereinigten Staaten investieren können, also sehr sichere Staatspapiere.
Zur Entscheidung gibt es eine kurze Handreichung: Mit äußerst sicheren Schatzpapieren hätten Sie den USA als Staat für drei Monate Geld besorgt und es mit größter Sicherheit anschließend wiederbekommen, um es erneut anzulegen. Bei den Staatsanleihen wiederum hätten Sie unterschiedlichsten Regierungen weltweit auf mehrere Jahre Geld geliehen, um Zinsen zu kassieren. Und als Aktionär oder Aktionärin wären Sie Miteigentümer vieler großer Börsenfirmen rund um den Globus geworden, um von Kurssteigerungen und Gewinnausschüttungen zu profitieren. Was, glauben Sie, wäre aus heutiger Sicht die beste Anlage gewesen?
Was wäre die beste Anlage gewesen?
Wer das Geld damals in die sicheren Schatzpapiere steckte, hätte Ende 2022 nominal mit 61,10 US-Dollar dagestanden. Hätten Sie das Geld stattdessen in länger laufende Staatsanleihen investiert, wäre Ihr Ertrag auf immerhin 284 Dollar angewachsen, also knapp fünfmal so stark. Wer stattdessen im Jahr 1900 bloß einen Dollar in weltweite Aktien angelegt hätte, dürfte sich heute über 15 645 US-Dollar freuen.
Rückblickend wäre die Aktienanlage also die ertragreichste Wahl gewesen, und zwar mit weitem Vorsprung. Die einzigen beiden Voraussetzungen in unserem Gedankenexperiment: Anlegerinnen und Anleger hätten das Geld über den gesamten Zeitraum an der Börse investiert lassen müssen und ihre Aktien auch bei Crashs nicht aus Panik verkaufen dürfen. Außerdem hätten sie alle Erträge immer wieder mitanlegen müssen, also die Zinsen der Anleihen oder bei Aktien die Gewinnausschüttungen in Form von Dividenden.
Aktien langfristig vorne
Vielleicht ist diese Langfristbetrachtung das stärkste Argument: Aktien haben langfristig die besten Erträge aller Geldanlageformen gebracht. Zieht man die Inflation ab, ändern sich zwar die Endwerte – nicht aber die Grundaussage. Die Grafik rechts oben ist deswegen die wichtigste Darstellung in diesem Buch. Sie stammt aus einem Datensatz der Finanzhistoriker Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton von der London Business School, die im Auftrag der Großbank UBS die Entwicklung unterschiedlicher Anlageformen bis ins Jahr 1900 zurückverfolgt haben.
Jährlich aktualisieren sie ihre Langfrist-Rechnung im „UBS Global Investment Returns Yearbook“, inzwischen umfasst es mehr als 120 Jahre Kapitalmarktgeschichte. Laut Rechnungen der drei Londoner Forscher ergaben sich in US-Dollar seit dem Jahr 1900 im Schnitt bis zum Ende des Jahres 2022 aus nominaler Sicht folgende Renditedaten:
Weltweite Aktien: 8,1 Prozent pro Jahr,
Weltweite Staatsanleihen: 4,7 Prozent pro Jahr,
Sehr sichere US-Schatzwechsel: 3,4 Prozent pro Jahr.
Die Jahrhundertbilanz der Börse
Reale Langfristentwicklung von Welt-Aktien, Welt-Anleihen, US-Schatzwechseln seit 1900
Copyright © 2024 Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, London Business School
Weil natürlich kaum ein einzelner Anleger oder eine einzelne Anlegerin mehr als ein Jahrhundert lebt, könnten so manche die Daten der Forscher als unrealistisch abtun. In den Finanzwissenschaften ist der Datensatz jedoch zum Goldstandard für Renditedaten geworden. Denn in den mehr als 120 Jahren Börsengeschichte steckt eine Menge drin: Positiv spiegelt sich eine atemberaubende, industrielle Transformationsgeschichte. Im Jahr 1900 hatte schließlich praktisch niemand je ein Auto gefahren, Radio gehört, in einem Flugzeug gesessen, geschweige denn ein Smartphone in der Hand gehalten.
Trotz Kriegen, Krisen und Crashs
Umgekehrt brachte die Zeit seit der Jahrhundertwende zwei Weltkriege, zahlreiche regionale Konflikte und eine Terrorwelle nach der Jahrtausendwende. Ob beim Großen Börsenkrach 1929, beim Blitzcrash an der Wall Street im Jahr 1987, mit der Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende, der Finanzkrise und der Eurokrise nur wenige Jahre später – immer wieder bebten die Kurse an den Börsen. Selbst die vermeintlich völlig neue Pandemiesituation rund um das Coronavirus ab 2020 hat in den Daten des Forschertrios bereits einen historischen Vorgänger: Ab 1918 verbreitete sich die Spanische Grippe rund um den Globus und forderte geschätzt 25 bis 50 Millionen Tote.
Trotz all dieser Krisen, Kriege und Crashs haben die weltweiten Aktienmärkte ihre alten Höhen immer wieder erreicht und sogar nachhaltig übertroffen. Der gravierende Aktiencrash von 1929 mit dem berühmt gewordenen „Schwarzen Freitag“ ist im Diagramm oben auf dieser Seite aus heutiger Sicht bloß noch eine kleine Delle. Dass wohl auch automatische Verkaufsorders den US-Index Dow Jones am 19. Oktober 1987 an nur einem Tag um rund 23 Prozent in die Tiefe drückten, ist in der Kursgrafik nicht einmal mehr zu erkennen. Auch Finanzkrise und Coronacrash sind nurmehr winzige Einkerbungen auf dem unaufhaltsamen Aufwärtsweg des Aktienmarktes.
Diese historischen Renditedaten sind inzwischen von unzähligen Forscherinnen und Forschern bestätigt worden: US-Finanzprofessor Jeremy Siegel von der Wharton School der University of Pennsylvania rechnete 2021 für die US-Kapitalmärkte sogar bis ins Jahr 1802 zurück – also noch ein Jahrhundert länger – und fand ganz ähnliche Zahlen: Aktien brachten nach seiner Rechnung in US-Dollar im Schnitt 8,4 Prozent Rendite pro Jahr, US-Staatsanleihen 5,0 Prozent, die sicheren Schatzwechsel 4,0 Prozent und Gold im Schnitt 2,1 Prozent pro Jahr.
30
SEKUNDEN FAKTEN
10,6%
des weltweiten Börsenwerts entfielen im Jahr 1900 auf Unternehmen an den deutschen Börsen, heute sind es nur noch 2,0 Prozent.
63%
des Börsenwerts US-amerikanischer Firmen entfiel 1900 auf Eisenbahnaktien. Heute sind Techaktien die wichtigste Branche.
5,0%
betrug die jährliche, inflationsbereinigte Rendite der Weltbörsen seit 1900. Mit 0,0 Prozent lag Österreich ganz hinten, am besten schnitten Australien und die USA mit 6,4 Prozent ab.
Quelle: Credit Suisse/Dimson/Marsh/Staunton (2023), MSCI
Aktienplus in allen Ländern
Auch für andere Länder ist dieses Muster an den Börsen erstaunlich stabil. Die drei Londoner Finanzforscher haben die wesentlichen Anlageformen inzwischen in 21 Ländern bis ins Jahr 1900 zurückverfolgt, von Australien bis Südafrika. In anderen Ländern wie Malaysia, Singapur oder Chile fehlen oft durchgängige und belastbare Finanzdaten, dort beginnt die Analyse der Forscher erst später. Das Ergebnis: In keinem einzigen entwickelten Land liegt die langfristige Aktienrendite über die gesamte Zeitspanne seit 1900 gerechnet hinter Staatsanleihen oder den kurzlaufenden und besonders sicheren Schatzwechseln des Staates.
Für Deutschland ist die Sache nicht ganz so einfach, da die Hyperinflation 1923/1924 das komplette Vermögen von Anleihehaltern auslöschte. Den deutschen Leitindex Dax gibt es ebenfalls erst seit 1988, sodass erst seitdem belastbare Daten vorliegen. Zuvor berechneten Banken und Tageszeitungen zwar eigene Börsenindizes, viele dieser Kursbarometer ließen aber die Dividenden bei ihren Rechnungen außen vor. Finanzprofessor Richard Stehle von der Berliner Humboldt-Universität hat daher im Jahr 2018 die Renditen deutscher Staatsanleihen und heimischer Aktien inklusive Dividenden bis ins Jahr 1955 zurückgerechnet. Auch hier liegen Aktien im Langfristergebnis deutlich vor den Staatsanleihen.
Durchschnitte sind keine Regeln
Anlegerinnen und Anleger sollten diese Langfristrenditen jedoch nicht wie ein physikalisches Gesetz betrachten. Um das zu zeigen, trug der kanadische Finanzprofessor Edward McQuarrie von der Santa-Clara-Universität einen Datensatz über mehr als 200 Jahre Kapitalmarktgeschichte zusammen: Rollt man alle Phasen von 30 oder 50 Jahren innerhalb dieses Datensatzes auf, schnitten Aktien nur in rund zwei Dritteln der Fälle besser ab als Staatsanleihen. In rund einem Drittel aller Zeiträume von 30 oder 50 Jahren hatten Anleihen die Nase vorn – in den USA zum Beispiel oft im 19. Jahrhundert. Soll heißen: Während Aktien im langfristigen Schnitt über mehr als zwei Jahrhunderte vorne landeten, muss das nicht in jeder einzelnen Unterperiode so sein. Die Lösung für dieses Dilemma ist aber simpel: Im eigenen Portfolio auf Aktien und Anleihen gleichzeitig setzen.
Wertvernichter Inflation
So reduziert ein steigendes Preisniveau die Kaufkraft eines Euro im Zeitverlauf
Quelle: eigene Berechnungen
Mit der Inflation rechnen
Anlegerinnen und Anleger sollten sich von den üppigen Renditen der vorangegangenen Seiten auch aus einem anderen Grund nicht täuschen lassen. Denn Werte von rund acht Prozent jährlicher Durchschnittsrendite am Aktienmarkt sind sogenannte nominale Daten. Das bedeutet: Diese Daten lassen die Inflation unberücksichtigt, also die steigenden Preise. Gerade bei langen Zeiträumen sollte man jedoch immer mit der Inflation rechnen. Buchstäblich und in Zahlen.
Nicht nur in Phasen hoher Inflation wie infolge der Ölkrise in den 1970er-Jahren oder der Corona-Pandemie zu Beginn der 2020er-Jahre wird Inflation zum Problem für das eigene Vermögen. Selbst eine Inflationsrate von nur zwei Prozent – dort liegt das offizielle Inflationsziel der Europäischen Zentralbank – würde den Wert des angesparten Vermögens in der realen Lebenswelt empfindlich mindern.
Ein Beispiel: Würden Anlegerinnen und Anleger 1 000 Euro unter ein Kopfkissen legen, lägen dort nach einem Jahr immer noch 1 000 Euro. Allerdings wären in der Zwischenzeit beispielsweise Mieten, Lebensmittel oder Friseurbesuche teurer geworden. Beträgt die allgemeine Teuerungsrate zwei Prozent, wären nach einem Jahr nur noch rund 98 Prozent des Vermögenswertes erhalten. Sparer könnten sich dann mit 1 000 Euro nur noch das leisten, was sie heute für 980 Euro kaufen können.
Persönlicher Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes service.destatis.de/inflationsrechner
Bloß zwanzig Euro Unterschied nach einem Jahr mögen überschaubar wirken und sind der Grund, warum viele Menschen die Inflation im Alltag etwas vernachlässigen. Die Kraft der steigenden Preise wirkt nur schleichend, langfristig jedoch zerstörerisch. Nach 20 Jahren mit jeweils zwei Prozent Inflation wären bloß noch rund zwei Drittel des aktuellen Geldwertes erhalten, nach 40 Jahren gerade einmal knapp die Hälfte. Würde die Inflation über 40 Jahre sogar bei drei Prozent liegen, könnten sich Sparer von dem Geld am Ende nicht einmal ein Drittel so viel kaufen wie zu Beginn des Zeitraums (siehe Tabelle oben).
Aktien schlugen auch die Inflation
Besonders deutlich wird das am Beispiel der Aktienmarktrenditen in Portugal: Seit 1900 hätte man dort im jährlichen Schnitt eine Rendite von elf Prozent erwirtschaften können und damit besser abgeschnitten als an den Landesbörsen vieler anderer Nationen. Berücksichtigen Sparerinnen und Sparer allerdings die Inflation, sieht das Bild ganz anders aus. Weil Portugal im vergangenen Jahrhundert immer wieder mit steigenden Preisen zu kämpfen hatte, verringert sich die Aktienrendite abzüglich der Inflation auf nur noch 3,7 Prozent pro Jahr. Deswegen heißt diese Betrachtungsweise inflationsbereinigte Rendite oder „reale“ Rendite, was geläufiger ist.
Auch wenn diese ehrlichen Renditezahlen selten gezeigt werden, sollten Sparerinnen und Sparer sie kennen. Unsere Inflationstabelle zeigt schließlich, dass schon geringe Inflationsraten zumindest auf lange Sicht einen erheblichen Unterschied machen können. Lag die nominale Rendite von weltweiten Aktien laut Auswertung der Londoner Forscher langfristig im Schnitt bei 8,1 Prozent pro Jahr, schrumpft dieser Wert auf nur noch 5,0 Prozent, sobald man die Inflation herausrechnet. Auch Anleihen brachten statt 4,7 Prozent abzüglich der Preissteigerungen nur noch 1,7 Prozent Rendite pro Jahr. Und die nahezu risikofreie Anlage („Schatzwechsel“) kam statt 3,4 Prozent nominaler Rendite im Schnitt nur noch auf 0,4 Prozent Realrendite im Jahr.
Anlegerinnen und Anleger sollten sich deswegen jedoch nicht entmutigt fühlen. Einerseits ist es besser, von vornherein realistische Renditeerwartungen zu hegen. Andererseits zeigt gerade die Rechnung mit der Inflation, wie wichtig Aktien als Teil des eigenen Vermögensaufbaus sind. Während deutsche Aktien real – also abzüglich der Inflation – laut Forscherteam im Schnitt auf 3,1 Prozent jährliche Rendite kamen, sorgten Anleihen und die vermeintlich sicheren Schatzwechsel in den 120 Jahren seit 1900 real sogar über diesen langen Zeitraum für Verluste. Heißt im Klartext: Mit diesen beiden Anlagen hätte sich die Kaufkraft über den Zeitraum nicht erhalten lassen.
Zum ganzen Bild gehört jedoch auch, dass sich die Überlegenheit von Aktien vor allem langfristig und im internationalen Schnitt zeigte. Nicht in jedem Inflationsjahr kompensierten Aktien den Kaufkraftverlust wie ein Naturgesetz, der Werterhalt mit Aktien funktionierte zuverlässig nur über lange Zeiträume mehrerer Jahrzehnte. Zwischenzeitlich konnten schließlich Crashs die Kurse zumindest auf dem Papier schnell einmal um 50, 60 oder 70 Prozent in sich zusammensacken lassen.
An den Weltbörsen dauerte es im schlimmsten Fall seit 1970 nach Kalkulationen von Stiftung Warentest in D-Mark und Euro gerechnet rund 13 Jahre, bis sich die Notierungen wieder erholt hatten. Ganz konkret: Im Zuge des Dotcom-Crashs sackte der Industrieländer-Index MSCI World ab September 2000 immer weiter ab und erreichte erst im November 2013 wieder sein vorheriges Rekordniveau aus den Zeiten des Dotcom-Booms.
Einzelne Länderbörsen können viel länger im Kurstal verharren: Nach Auswertungen des Finanzprofessors McQuarrie mussten 13 von 21 untersuchten Länderbörsen irgendwann in den untersuchten mehr als 200 Jahren Börsengeschichte eine Verlustphase von mehr als 20 Jahren verzeichnen. Acht von 21 Ländern kamen sogar auf negative Phasen von mehr als 30 Jahren. Italien musste gar eine negative Aktienphase von rund 75 Jahren hinnehmen.
Im Zweifel kam es sogar noch schlimmer: In China und der ehemaligen Sowjetunion wurden Anleger durch die kommunistischen Regimes zwischenzeitlich enteignet. Oft vergessen Menschen hierzulande, dass das nicht nur Menschen in weiter Ferne passierte: Auch in der DDR mussten viele ihr Aktienvermögen abschreiben und kamen auch nach dem Fall der Mauer oft nicht mehr an das alte Aktienvermögen ihrer Vorfahren heran.
Einzelne Aktien können übrigens ganz ohne politischen Eingriff nahezu wertlos werden: Laut der Investmentbank JP Morgan mussten rund 44 Prozent aller US-Aktien aus einem Datensatz von rund 13 000 Titeln irgendwann zwischen 1980 und 2020 einen Verlust von mehr als 70 Prozent hinnehmen und erholten sich hinterher kaum mehr. Viele Anlegerinnen und Anleger hierzulande erinnern sich an den Skandalfall des Zahlungsvermittlers Wirecard. Dessen Aktien waren am Hochpunkt mehr als 200 Euro wert, Ende Juni 2024 jedoch gerade noch rund zwei Cent.
Die ehrliche Börsenbilanz
Verlauf des Industrieländerindex MSCI World mit Inflation – und ohne
Anmerkungen: MSCI World Gross Total Return; Deutscher Verbraucherpreisindex (VPI) Ursprungswerte
Quelle: eigene Berechnungen, MSCI, BIZ, Deutsche Bundesbank
Zeitraum: 31.12.1969 – 30.09.2024
Zusammengefasst stellen sich Chancen und Risiken am Aktienmarkt so dar:
Der Welt-Aktienmarkt brachte im Langfristschnitt rund 5,5 Prozent Rendite pro Jahr, die Inflation ist da bereits abgezogen.
Rücksetzer sind völlig normal. Innerhalb eines Kalenderjahres erlebten selbst breite Börsenindizes vom Hoch zum Tief im historischen Schnitt einen Rücksetzer von 15 Prozent.
Betrachtet man längere Zeiträume, ist der Welt-Aktienmarkt im schlimmsten Fall um rund 60 Prozent gefallen. Das war in den Nullerjahren mit Dotcom-Crash und Finanzkrise.
Langfristig stiegen die Weltbörsen aber und bügelten Dellen stets aus. Spätestens nach rund 13 Jahren waren zumindest Welt-Aktienindizes stets auf null raus.
Das gilt nicht für Länderbörsen: Einzelne Länderbörsen fielen in heftigen Kurskrachs teilweise um mehr als 70 oder 80 Prozent und lagen mitunter auch mehr als 50 Jahre lang unter Wasser.
Viele Einzelaktien wurden sogar immer wieder komplett wertlos. Rund 40 Prozent aller Einzelaktien erlebten historisch auf längere Sicht irgendwann einen Verlust von mehr als 70 Prozent und erholten sich kaum noch davon.
Fazit: Privatleute sollten ihr Geld breit gestreut über Hunderte oder Tausende Titel anlegen und über Kontinente, Länder sowie Branchen verteilen (Diversifikation). Noch besser ist es, neben Aktien auch auf Anleihen zu setzen. Wer zusätzlich Gold, Rohstoffe oder Immobilien dazu nehmen will, streut noch breiter – diese Anlagen laufen selten in eine Richtung.
Mehr zum perfekten Anlagemix: Kurz ab Seite 38, Im Detail ab Seite 178.
Wie die Börse funktioniert
A wie Aktien, B wie Börse: Bevor Anleger und Anlegerinnen aufs Parkett gehen, sollten sie die Grundbegriffe verstehen. Das ist eigentlich ganz einfach.
Wenn Millionen Menschen abends kurz vor der „Tagesschau“ den Fernseher einschalten, zoomt die Kamera irgendwann zuverlässig durch den Frankfurter Börsensaal. Aktienhändlerinnen und -händler sitzen vor blinkenden Monitoren, im Hintergrund klackert die große, schwarze Kurstafel. Was sich hinter Begriffen wie Börse und Aktien konkret verbirgt, ist aber längst nicht allen klar. In einer Umfrage der Marktforschungsgesellschaft Infas quo sagen 54 Prozent der Deutschen, sie hätten „keine Ahnung vom Geschehen an der Börse“. Woher auch? In vielen Schulen steht die Börse nicht auf dem Lehrplan. Dabei ist es gar nicht kompliziert, die Grundlagen zu verstehen.
Eine Börse ist ein Ort, an dem Anbieter und Nachfrager bestimmte Waren handeln. Das können klassische Waren wie Öl sein, aber auch Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen. Im Grunde verhält es sich damit ähnlich wie auf einem Wochenmarkt: Auch hier handeln Anbieter und Käufer Dinge wie Brot, Tomaten oder Rosen an einem festgelegten Ort, zu festen Zeiten – und übrigens ganz ähnlich wie an einer Börse unter behördlicher Aufsicht.
Der Kapitalmarkt – mehr als Zockerei
Auch wenn viele Menschen die Börse für reine Spekulation halten, haben die Wertpapierbörsen einen klaren Auftrag: Sie sollen Kapital in aussichtsreiche Investitionsprojekte lenken. Unternehmen benötigen schließlich laufend Geld, um neue Fabriken zu bauen, innovative Produkte zu entwickeln oder Konkurrenten vom Markt wegzukaufen. Viele Konzerne brauchen dafür so viel Geld, dass ihr Jahresgewinn oder Bankkredite für alle diese Großvorhaben nicht ausreichen würden.
Umgekehrt gibt es weltweit Milliarden Menschen, die Teile ihres Vermögens gewinnbringend anlegen möchten, zum Beispiel als Vorsorge für das Rentenalter. Egal ob sie sich mit dem Geld als Privatleute selbst an die Börse wagen oder es einem Aktienfonds, einer Versicherungsgesellschaft oder einer Pensionskasse anvertrauen: Dieses überschüssige Kapital kann in Wertpapiere von Firmen fließen, die auf der Suche nach Geld sind. Die bekannteste Möglichkeit? Aktien.
Ein Beispiel: Für eine neue Fabrikhalle benötigt ein Unternehmen 20 Millionen Euro. Statt sich einen Kredit zu besorgen, kann es auch 20 Millionen Aktien für je einen Euro herausgeben. Die Firma verkauft also einen Teil des eigenen Unternehmens gegen Geld. Das Firmenmanagement kann die Summe dann verwenden – und muss sie auch nicht zurückzahlen. Im Gegenzug bekommen die Käuferinnen und Käufer der Aktien Stimmrechte und können fortan also mitbestimmen, was in der Firma passiert. Vor allem aber können sie als Anteilseigner einen Teil der Unternehmensgewinne zum Beispiel in Form von Dividenden bekommen, was die Angelegenheit finanziell interessant macht.
Was sind Aktien?
Jeder Mensch, der Aktien kauft, wird also Miteigentümer an „seinem“ Unternehmen. Wer eine Apple-Aktie besitzt, dem gehört ein winziger Teil des Weltkonzerns. Wirtschaftet das Unternehmen gut und wächst es, schreibt es irgendwann Gewinne. Einen Teil dieser Gewinne können die Manager und Managerinnen als Dividende auskehren. Das nennt man auch Gewinnausschüttung. So profitieren Anlegerinnen und Anleger im Idealfall gleich doppelt: Einerseits können die turnusmäßigen Dividenden steigen, andererseits möglicherweise auch der Aktienkurs. Wirtschaftet das Unternehmen schlecht, kann es in mageren Jahren die Dividenden jedoch kürzen oder gleich ganz streichen. Schlittert das Unternehmen gar in die Pleite, wird in aller Regel auch die Aktie fast vollständig wertlos.
Wie viel Gewinn ein Unternehmen macht, entscheidet damit langfristig über den Aktienkurs. Im Grunde hängt der Wert einer Aktie an allen künftigen Gewinnausschüttungen, die Anleger und Anlegerinnen mit ihr in der Zukunft bekommen können. Die Krux ist aber, dass natürlich niemand genau sagen kann, wie viel Gewinn ein Unternehmen in den kommenden Jahren machen wird. Man kann darüber höchstens begründet mutmaßen. Die Kurse spiegeln also, wie sich diese Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger verändern.
Ein Beispiel: Ergattert ein Flugzeugbauer einen lukrativen Großauftrag, von dem vorher niemand etwas geahnt hatte, könnte der Kurs steigen. Viele Anlegende rechnen plötzlich mit größeren Gewinnen und entsprechend auch üppigeren Dividenden für die eigene Tasche. Kommt umgekehrt ein Skandal ans Licht, der in den kommenden Jahren viele Kosten für Rechtsanwaltskanzleien verschlingen dürfte, könnte der Wert der Aktien sinken. Die Kurse steigen und fallen also zusammen mit den Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger.
Was sind Anleihen?
Ganz anders verhält es sich, wenn Unternehmen oder Staaten Anleihen ausgeben: Hier leihen ihnen die Anlegerinnen und Anleger das Geld lediglich für eine begrenzte Zeit. Können sich Firmen auf diese Weise zum Beispiel für fünf Jahre Geld borgen, versprechen sie dafür einen turnusmäßigen Zins – am Ende sollen die Investorinnen und Investoren natürlich auch das geliehene Geld zurückerhalten. Für Unternehmen haben Anleihen den Vorteil, dass sie den Investoren kein Mitspracherecht einräumen müssen. Anlegerinnen und Anleger profitieren wiederum von einer planbaren Geldanlage: Wirtschaftet das Unternehmen einigermaßen solide, können sie sich schon zu Beginn ihres Investments ausrechnen, was am Ende der Laufzeit für sie herauskommt. Solange das Unternehmen zahlungsfähig ist, müssen sie sich nicht fürchten.
HÄTTEN SIE’S GEWUSST?
Der Begriff Börse geht angeblich auf die alte Patrizierfamilie Van der Beurse zurück. Im Haus dieser Familie im belgischen Brügge sollen ab dem Jahre 1409 Währungen und Wechsel gehandelt worden sein.
Die erste Aktie war 1602 die der „Vereinigten Ostindischen Kompanie“ an der Amsterdamer Börse. Das Handelsunternehmen brauchte Geld für Expeditionen nach Indien und gab im Gegenzug Anteilsscheine heraus.
Mit der aufkommenden Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert wollten Unternehmen Bergbauschächte, Eisenbahnen und Schienennetze finanzieren. Ein teures Unterfangen, das ohne das gesammelte Geld vieler Investorinnen und Investoren an der Börse überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
Das sind die größten Börsenplätze
Weltweit gibt es rund 60 wichtige Börsen – das sind die größten.
Quelle: World Federation of Exchanges
Stand: 31.12.2023
Während Aktienleute also tatsächlich von „ihrem“ Unternehmen sprechen dürfen, bleiben Menschen am Anleihemarkt bloß Externe, die auf Zeit Geld leihen. Fachleute sprechen bei Aktien daher auch von „Eigenkapital“, bei Anleihen von „Fremdkapital“. Während sich der Ertrag bei Anleihen bis zum Ende der Laufzeit meist vorher fest ausrechnen lässt, steht der Ertrag bei Aktien nicht im Vorhinein fest, was die Kurse stärker schwanken lässt.
Was ist die Börse?
Hat ein Unternehmen seine Aktien oder Anleihen mithilfe von speziellen Banken (Investmentbanken) einmal an Investorinnen und Investoren verkauft, kommt die Börse ins Spiel. Hier können die Eigentümerinnen und Eigentümer ihre erstandenen Wertpapiere laufend weiter handeln. An der Börse kaufen Sparerinnen und Sparer ihre Aktien also mitnichten immer direkt dem Unternehmen ab, sondern meistens irgendeinem vorherigen Eigentümer. Statt sich auf eigene Faust eine Gegenpartei beispielsweise via Ebay zu suchen, gibt es genau für diesen Zweck die Börse. Kaufwillige und Verkaufswillige leiten ihre Aufträge zu festen Handelszeiten an einen zentralen Ort. Dieser Sammelpunkt ist die Börse.
Der Vorteil solcher Einrichtungen für Anlegerinnen und Anleger: Dass sich Angebot und Nachfrage für Wertpapiere an den Börsen konzentrieren, sorgt für ein reges Handelsgeschehen. Wer Aktien oder Anleihen kaufen oder verkaufen will, wird meistens problemlos ein Gegenüber finden. Da sich an den Börsen viel Handelsgeschehen wie in einem Brennglas bündelt, herrscht besonders große Klarheit über die Preise. Der Börsenhandel konzentriert also die Geldflüsse, Expertinnen und Experten sprechen daher auch von der „Liquidität“ als Vorteil des Handels am Parkett.
Ein Vergleich mit dem Immobilienmarkt macht diesen Vorzug der Börsen deutlich: Weil Häuser und Wohnungen oft privat den Besitzer oder die Besitzerin wechseln, gibt es oft nur wenige Interessensbekundungen zu teils sehr unterschiedlichen Preisvorstellungen. Zwar können Gutachten, Onlineportale oder Maklerbüros beim korrekten Schätzen helfen, aber so einfach wie an einer Börse ist die Preisfeststellung nicht. Die Gefahr, am Ende doch mit einem wenig marktgerechten Preis dazustehen, ist beim Immobilienhandel größer als beim hochgradig transparenten Aktienhandel. Ohne die Börse würden mutmaßlich niemals so viele Menschen Aktien kaufen – zu unsicher wäre, ob sich im Falle des Falles tatsächlich genügend Kaufwillige fänden.
Diese Börsen sind wichtig
Wenn deutsche Sparer und Sparerinnen an „die Börse“ denken, kommt ihnen meist das Bild der Frankfurter Börse in den Sinn. Doch das Gebäude mitten im Frankfurter Stadtzentrum ist bei Weitem nicht der einzige Handelsplatz für Wertpapiere. Global gesehen gibt es wichtigere Börsen als das Frankfurter Parkett. Die wohl entscheidendste Börse weltweit ist die New York Stock Exchange (NYSE). Im Jahre 1792 gegründet, lassen sich dort inzwischen die Aktien von mehr als 2 400 Unternehmen handeln. Zusammen kommen die handelbaren Aktien dieser US-Firmen auf einen Gesamtwert von unvorstellbaren 25 500 Milliarden US-Dollar (Stand: 12/23). Im Volksmund heißt diese Börse auch „Wall Street“, weil an jener Stelle im New Yorker Ortsteil Manhattan einst ein Schutzwall entlanglief. Heute steht die Wall Street im Zentrum des weltweiten Finanzsystems, oft sind die Bewegungen an der New Yorker Börse tonangebend für den Aktienhandel rund um den Globus.
So beginnt nach Handelsschluss in den USA schon bald der Aktienhandel an der japanischen Börse mit Zweigstellen in Tokio und Osaka, dort beginnen die Händler bereits um 1 Uhr nachts unserer Zeit mit ihrem Tagesgeschäft. Meist um 2.30 Uhr deutscher Zeit öffnen die chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzhen sowie die Hongkonger Börse. Gegen 9 Uhr startet dann der reguläre Börsenhandel an den europäischen Computerbörsen, von Frankfurt über Paris bis London. Am Nachmittag, meist um 15.30 Uhr, starten dann wieder die US-Börsen in den Handel. Sobald die Profis an deren Hauptbörse NYSE ihr Tagewerk vollendet haben, steht in Asien bereits der nächste Handelstag vor der Tür.
Längst kein Geschrei mehr am Parkett
Früher kamen an den Börsen täglich Hunderte Menschen auf dem Parkett zusammen: Amtlich bestellte Kursmakler und die Aktienhändler der wichtigsten Banken riefen sich Kaufund Verkaufsgebote zu, rannten durch den Handelssaal und fuchtelten mit den Händen. Die Zeiten dieses „Handels per Zuruf“ sind in vielen Börsenfilmen zwar noch präsent, in der Realität allerdings weitestgehend Geschichte. Inzwischen läuft der Börsenhandel zu weit mehr als 90 Prozent vollelektronisch. Längst übernehmen Computerprogramme den Ausgleich zwischen Kauf- und Verkaufsgeboten.
Das zeigt sich beim wichtigsten deutschen Börsenbetreiber, der Deutschen Börse mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main. Mehr als 97 Prozent des Handels laufen dort über die elektronische Computerbörse Xetra. Nur zwei bis drei Prozent des Handels finden laut Umsatzstatistik der Börse noch im Parketthandel statt, an der sogenannten Börse Frankfurt. Dort stellen tatsächlich noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spezieller Wertpapierhandelsbanken die Kurse, inzwischen auch weitgehend mit Computerunterstützung.
Details zu Xetra ab Seite 48, 53 und 352.
Daneben gibt es in Deutschland zahlreiche regionale Börsen, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend spezialisiert haben: Die Stuttgarter Börse verfügt über einen besonders regen Anleihehandel. An der Börse Hamburg lassen sich mitunter Aktien von Unternehmen handeln, die sich von anderen Börsen zurückgezogen haben. Und die Börsen München, Hamburg, Hannover und Düsseldorf haben eigene Segmente für neue und riskantere Mittelstandsaktien aufgemacht, bei denen jedoch äußerstes Augenmaß gefragt ist.
Das sind die wichtigsten Börsenindizes
Wichtige Aktienindizes nach Regionen und Ländern
Das sind die Barometer der Börse
Wer sich einen Überblick über die Lage am Aktienmarkt machen will, muss nicht Hunderte Aktienkurse parallel verfolgen. Sogenannte Aktienindizes bündeln die Entwicklung vieler Wertpapiere. Am bekanntesten ist hierzulande der deutsche Leitindex Dax, der den Lauf der 40 wichtigsten heimischen Börsenunternehmen in eine Kurve bannt. International spielt jedoch der US-Leitindex S&P 500 eine viel wichtigere Rolle. Ansonsten schauen gerade Finanzprofis auf den Stoxx Europe 600, der Aktien aus vielen europäischen Ländern des europäischen Kontinents spiegelt. Die Kurse von mehr als 1 400 Unternehmen aus 23 Industrieländern bindet wiederum der MSCI World zusammen. Üblicherweise hat in einem Index übrigens nicht jede Firma dasselbe Gewicht, schließlich sind kleine Firmen an der Börse ebenso vertreten wie Großkonzerne. Meist erhalten die Aktien der großen Konzerne in einem Index auch größeres Gewicht, können den Lauf des Index also stärker beeinflussen. So kommt die größte Aktie im deutschen Leitindex Dax auf rund 15 Prozent Gewicht, das sind die Titel des Softwarekonzerns SAP. Der kleinste Wert kommt bloß noch auf 0,5 Prozent Gewicht, die Aktien des Modehändlers Zalando (Stand: 06/24). Fachleute sprechen davon, dass solche Aktienindizes nach Marktkapitalisierung gewichten. Einfach gesagt: Je mehr die Aktien des Unternehmens zusammengenommen wert sind, desto mehr Gewicht bekommt es im Aktienindex. Diese Gewichtungsmethode hat sich als weltweiter Standard für die allermeisten Aktienindizes durchgesetzt, abweichende Kalkulationsmethoden gelten inzwischen als antiquiert.
Details zu diesen Börsenbarometern und wie Sie ihrem Lauf ganz einfach folgen können finden Sie ab Seite 60.
Fünf Prinzipien für die Börse
Die Welt am Parkett muss nicht kompliziert sein. Schon mit fünf einfachen Regeln machen Anlegerinnen und Anleger vieles richtig – und verstehen nebenbei die wichtigsten Wirkkräfte der Börse.
Zinseszins – wie die Vermögenskraft wirkt
Die Wucht des Zinseszinses kann Anlegerinnen und Anlegern an der Börse helfen. Wer clever vorgeht, kann sein Vermögen erheblich steigern.
Welchen Unterschied macht ein Prozentpunkt? Viele Anlegerinnen und Anleger dürften abwinken und kaum darauf achten. Ob eine Anlage sieben oder acht Prozent Rendite bringt, lässt vermutlich niemanden wirklich aufmerken. Am Ende kann aber bereits ein Prozentpunkt den Unterschied machen zwischen einem mittleren Börsenvermögen – und einem großen.
Wie gravierend der Unterschied zwischen sieben und acht Prozent Rendite sein kann, zeigt folgendes Beispiel: Wer zu Beginn einmalig 10 000 Euro anlegt und 40 Jahre lang jedes Jahr sieben Prozent Rendite erhält, hätte im hohen Alter rund 150 000 Euro. Wer mit acht Prozent Rendite nur einen Prozentpunkt mehr erwirtschaftet hätte, dürfte sich jedoch über ein Endvermögen von rund 217 000 Euro freuen. Woher kommt diese beträchtliche Differenz?
Die Antwort liegt im Zinseszins, den manche Menschen gar als das „achte Weltwunder“ bezeichnen. Das Wort meint, dass Erträge bei der Geldanlage nicht einfach nur ausgezahlt werden, sondern zur ursprünglichen Anlagesumme hinzukommen und sich anschließend mitvermehren. Bringt eine Anleihe im ersten Jahr also fünf Prozent Zinsen, können sich ab dem zweiten Jahr auch diese Zinsen mitvermehren. Fließen an den Aktienbörsen Gewinnausschüttungen in Form von Dividenden an die Anlegerinnen und Anleger, lassen sich solche direkt wieder anlegen: So können sie folglich auf eine Art Schneeballeffekt für ihr Geld setzen, wenn sie die Weichen richtig stellen.
Die Wucht der Wiederanlage
So viel wurde aus 25 000 Euro bei unterschiedlichen Erträgen, wenn Sparer die Gewinne ebenfalls anlegten.
Quelle: eigene Berechnungen
So arbeitet das eigene Geld
Wer das kaum glauben will, kann nachrechnen: Legt eine Frau 10 000 Euro an und erhält dafür fünf Prozent Zinsen, würden im ersten Jahr 500 Euro auf ihrem Konto landen. Legt sie dieses Geld wieder an, würden im nächsten Jahr schon 10 500 Euro für sie arbeiten. Bekommt sie am Kapitalmarkt dann wieder fünf Prozent Rendite, würde sie bereits 525 Euro erhalten. Läuft es gut, würde ihre Anlage also jedes Jahr mehr Gewinn bringen. Nach zehn Jahren hätte sich das Geld bei jeweils fünf Prozent Rendite bereits auf rund 16 300 Euro vermehrt, nach 30 Jahren sogar auf rund 43 200 Euro. Nach 40 Jahren würde die Anlegerin wohlgemerkt rund 70 400 Euro im eigenen Depot leuchten sehen. Auch hier reden viele von einer Art Schneeballeffekt für die Geldanlage.
Wie Sie das passende Depot finden, lesen Sie ab Seite 342 und unter test.de/depot.
Dividenden stets mitvermehren
Natürlich erzielen Anlegerinnen und Anleger an der Börse nicht jedes Jahr dieselbe Rendite, mitunter schwanken die Erträge von Jahr zu Jahr stark. Wer jedoch über lange Zeiträume schaut, konnte von der Wiederanlage der eigenen Erträge durchaus profitieren. Das zeigt zum Beispiel der deutsche Leitindex Dax sehr eindrücklich, dessen Startpunkt die Börsenoberen für Ende 1987 bei genau 1 000 Punkten festsetzten. Wo der Index rund 35 Jahre später stand, hing entscheidend davon ab, was Anlegerinnen und Anleger mit den Dividenden gemacht hätten.
Ohne Dividenden wäre der Index von seinen 1 000 Punkten ganz zu Beginn auf 7 005 Punkte gestiegen (Stand: 06/24). Legt man in der Rechnung die Dividenden jedoch direkt wieder in den Dax an, stünden 18 235 Punkte an der Kurstafel. Fachleute sprechen beim Dax mit Dividenden übrigens vom „Performance-Dax“, bei der Indexvariante ohne Ausschüttungen vom „Dax-Kursindex“. Im Fernsehen, in Zeitungen und an der Kurstafel im historischen Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse prangt natürlich stets der deutlich üppigere Performance-Dax.
Wer Kosten spart, nutzt den Effekt
Solche Rechnungen zeigen, warum Zinsen und Dividenden kein Zubrot, Geschenk oder laufendes Einkommen sein sollten. Wer Dividenden stets wieder anlegt, profitiert auf lange Sicht nämlich vom Wiederanlageeffekt. Manche Börsenprodukte weisen zum Beispiel den Zusatz „akkumulierend“ oder „thesaurierend“ auf, sie legen die Dividenden automatisch wieder an. Auch bei manchen Banken lässt sich von vornherein bestimmen, dass sie die Dividenden direkt wieder anlegen sollen.
Besonders rasant vermehrt dieser Wiederanlageeffekt das eigene Vermögen übrigens nach mehr als 25 Jahren Anlagedauer (siehe Grafik links). Das zeigt, wie wichtig es ist, möglichst früh an der Börse zu starten. Doch selbst wer bereits 50 Jahre alt ist, hat bis zum wohlverdienten Ruhestand noch 17 Jahre Zeit. Und angesichts der steigenden Lebenserwartung muss heutzutage selbst bei Rentenbeginn niemand mehr zwangsweise all sein Geld von der Börse auf ein Konto schieben. Selbst dann kann aus unserer Sicht zumindest ein gewisser Teil des eigenen Vermögens weiter an der Börse arbeiten.
Zinseszins mal umgekehrt
Umgekehrt lässt sich mit dem Zinseszinseffekt übrigens auch Banken ein Schnippchen schlagen, wenn Privatleute Kosten sparen.
Ein Beispiel: Ein Anleger und eine Anlegerin haben bei gleichen investierten Geldbeträgen mit einem Aktienfonds über 30 Jahre im Schnitt jeweils fünf Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet. Der Anleger zahlte bei seiner Bank jedoch 1,5 Prozent jährliche Depotkosten, am Ende lagen in seinem Depot rund 27 600 Euro. Die Anlegerin hatte jedoch clever verglichen und bloß 0,5 Prozent Depotgebühr gezahlt. Ihr Endwert? Rund 37 200 Euro. Im Klartext: Nur ein Prozentpunkt weniger Kosten bescherte ihr am Ende nach 30 Jahren Anlagedauer rund 10 000 Euro mehr Vermögen. So lässt sich der Zinseszinseffekt beim Vermögensaufbau also gleich doppelt nutzen – bei Erträgen und Kosten zugleich.
BÖRSENKOPF
Reichtum muss nicht abgehoben machen: Mit einem Vermögen von 120 Milliarden Dollar liegt Investorenlegende Warren Buffett zwar auf Platz sieben der Liste der reichsten Menschen der Welt, tagsüber hält sich der 93-Jährige jedoch einfach mit mehreren Dosen Cherry-Cola fit – die Aktie des Getränkekonzerns besitzt er übrigens auch.
Seit 1956 mehrt Buffett sein Vermögen an der Börse, Mitte der 1960er-Jahre kaufte er die darbende Textilfirma Berkshire Hathaway auf und formte sie zu einer Anlagegesellschaft um. Während der US-Leitindex S&P 500 mit Dividenden seitdem im Schnitt um 10,2 Prozent pro Jahr stieg, kletterten die Aktien von Buffetts Firma im Schnitt um sagenhafte 19,8 Prozent pro Jahr.
Fans bewundern Buffett für seinen bescheidenen Lebensstil: 100 US-Dollar sind für ihn nicht einfach 100 US-Dollar, sondern die Möglichkeit für größere Erträge in Zukunft. Er kennt die Wirkung des Zinseszinses, hat immer wieder auf den Effekt hingewiesen. „Wenn ich eine Aktie einmal habe, gebe ich sie am liebsten nie wieder her“, sagt der Investor gerne. Mehr zu seinem Investmentstil ab Seite 231.
Effizienz – wie die Kurse wirklich ticken
Von außen wirken die Aktienkurse oft kurios, dabei sind die Börsen erstaunlich effizient. Neues fließt binnen Nanosekunden in die Kurse – und langfristig stiegen sie sogar ziemlich verlässlich.
Für Interessierte kann das Geschehen an den Aktienbörsen schnell verwirrend wirken: Aus dem Nichts jagen Kurse um 30 Prozent in die Höhe. Manchmal reagieren die Kurse sogar auf reine Gerüchte, die noch gar nicht bewiesen sind. An anderen Tagen haben Unternehmen gute Zahlen vorgelegt und die Kurse sinken trotzdem. Wie lässt sich da durchblicken?
Das Geschehen an der Börse müssen sich Anlegerinnen und Anleger wie auf einem Markt vorstellen, wo um den Preis von Weintrauben gefeilscht wird. Kaufwillige und Verkaufsinteressierte treffen aufeinander, an der Börse sind es oft Dutzende pro Sekunde. Aus diesem Feilschen um den richtigen Preis ergibt sich ein fortlaufender Aktienkurs, eine Art Fieberkurve für Unternehmen an der Börse.
Die Erwartungen entscheiden
Entscheidend ist dabei nicht die aktuelle Lage einer Firma, sondern stets die Erwartungen für die Zukunft. Wird der Ölpreis steigen, könnten Energieunternehmen bessere Gewinne einfahren. Verschlechtert sich die Wirtschaftslage in China, dürften deutsche Autobauer darunter leiden. Egal ob Informationen über die Geschäftslage, die Zinspolitik der Notenbanken, neue Gesetze der Bundespolitik oder Gerüchte – all diese Dinge stecken in den Kursen.
Die Finanzmärkte verarbeiten neue Informationen heute in Windeseile. Melden Unternehmen neue Quartalszahlen, fließen die Ergebnisse im Grunde direkt in die Kurse. Stehen Informationen in der gedruckten Zeitung, ist die Nachricht buchstäblich „von gestern“. Hochfrequenzhändler reagieren mit automatisierten Programmen binnen Nanosekunden.
Egal ob Produktrückrufe, Zulassungen von Arzneimittelbehörden oder maue Geschäftsergebnisse: In einer Studie haben drei US-Ökonomen um Andreas Neuhierl rund 270 000 Pressemitteilungen von Unternehmen analysiert und mit den Kursreaktionen verglichen. Ihr Ergebnis? Die Kurse reagieren sprunghaft auf neue Nachrichten, bevor sie sich auf dem neuen Niveau einpendeln.
In den Finanzwissenschaften hat sich für diese Einsicht das Wort „Effizienzmarkthypothese“ durchgesetzt. Sie besagt, dass die Menschen am Markt alle öffentlich verfügbaren Informationen rasend schnell in die Kurse einpreisen. Aus dieser Sicht spiegeln die Aktienkurse also alle bekannten Informationen korrekt, vollständig und zeitnah wider. Die meisten Fachleute halten die Börse daher auch für einen „informationseffizienten“ Markt.
Dass alle verfügbaren Informationen, Fakten, Gerüchte und Erwartungen bereits im Kurs stecken, mag wie eine Binsenweisheit klingen. Der Gedanke hat jedoch weitreichende Konsequenzen: Stecken bereits alle bekannten Informationen im Kurs, können nur noch völlig neue, bislang unbekannte Informationen den Kurs bewegen. Da völlig neue Informationen aber unbekannt sind, kann niemand die künftige Richtung der Kurse vorhersagen. In diesem Sinne sind sie auf kurze Sicht „zufällig“. Unter vielen Fachleuten hat sich daher der Begriff vom „Zufallslauf der Aktienkurse“ durchgesetzt (engl. Random Walk).
Wie willkürlich die Kurse auf kurze Sicht sind, hat Stiftung Warentest am Beispiel des Weltaktienindex MSCI World seit 1971 überprüft. Das Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse an einem Tag steigen oder fallen, liegt ziemlich genau bei 50 Prozent. Mal folgt auf einen schwachen Tag ein guter, oft aber auch noch ein schlechter. Umgekehrt folgt auf einen tollen Börsentag mal ein schlechter, mal ein guter (siehe Diagramm oben). Wenn also alles bereits im Kurs steckt, ist der Rest Zufall. Aus dieser Erkenntnis können Privatleute einige wichtige Einsichten für ihre Börsenstrategie ableiten:
An der Börse geht es nicht darum, ob ein Unternehmen im Hier und Jetzt gut dasteht – das ist längst allen bekannt.
An der Börse geht es nur bedingt darum, ob eine Firma künftig gut oder schlecht dastehen wird. Auch diese Erwartung wäre nicht neu, sondern bereits in den Kursen enthalten.
An der Börse ist für den Kurs aus Sicht der Effizienzmarkthypothese alleine entscheidend, ob die Firma künftig besser oder schlechter dastehen dürfte als bislang vom kapitalgewichteten Schnitt der Anlegerinnen und Anleger auf Basis aller Informationen gedacht.
Auf kurze Sicht ist alles Zufall
Aus den Renditen des aktuellen Tages lässt sich nichts für den Folgetag lernen. Mal folgte auf einen guten Tag für den Industrieländer-Index MSCI World noch ein guter, mal ein schlechter.
Quelle: eigene Berechnungen, Refinitiv
Zeitraum: 23.08.1971 – 31.12.2020
Das alles sind gute Argumente, um nicht aus den falschen Gründen mit einzelnen Aktien zu spekulieren. Wenn schon in der Presse steht, dass Wasserstoff, E-Autos oder Impfpräparate boomen, wird es in den Kursen längst drinstecken. Was die Aktienkurse tatsächlich treibt, wären bloß unerwartete Veränderungen. Was niemand kennt, kann aber auch niemand korrekt vorhersagen.
Natürlich können Anlegerinnen und Anleger hin und wieder auf das richtige Pferd setzen – ein Gewinn wäre dann aber nicht ausführlicher Analyse zu verdanken, sondern reinem Glück. Alternativ können Insider aus Unternehmen öffentlich bislang nicht bekannte Informationen zu ihren Gunsten ausnutzen, das ist jedoch Insiderhandel und strafbar.
Ist der Markt wirklich effizient?
Privatanlegerinnen und Privatanleger sollten die Lehre von der Effizienz der Märkte nicht so verstehen, dass die Kursbewegungen an den Börsen völlig losgelöst von Fakten wären. Im Gegenteil: Dass die Kurse laufend steigen und fallen ist vielmehr ein Kennzeichen der besonderen Informationseffizienz der Märkte. Neue Informationen schlagen also tatsächlich schnell auf die Notierungen durch – und so soll es schließlich sein.
Langfristig ging es aufwärts
Nominale Wertentwicklung der Börsenindizes MSCI World, MSCI Germany und MSCI USA
Quelle: LSEG, eigene Berechnungen
Zeitraum: 30.12.1969 bis 30.09.2024
Dass die Börse dabei einzelne Informationen mal unterschätzt oder überschätzt, kann vorkommen. Die Effizienzmarkthypothese sagt nicht, dass jeder einzelne Kurs unter allen Umständen „richtig“ ist. Selbst der emeritierte Finanzprofessor Burton Malkiel von der Universität Princeton gab als Verfechter der Hypothese offen zu, dass viele Menschen faktische Informationen aufgrund kognitiver Muster falsch verarbeiten. Nur dass man das mit Blick auf die Anlegermasse nie sicher diagnostizieren könne.
Selbst bei den rationalsten Investorinnen und Investoren flössen in die Bewertungen außerdem Prognosen ein, die per se unsicher seien. Die Börsenkurse seien daher genauso „richtig“ wie „falsch“ – und selbst darin stets unvorhersehbar. Privatleute könnten daher genauso gut von einem effizienten Markt und korrekten Preisen ausgehen.
Zu hoch oder zu tief?
Warum das so ist? Um den „fairen Preis“ einer Aktie angesichts aller Fakten und Annahmen zu bestimmen, braucht man immer ein Bewertungsmodell. Darunter verstehen Fachleute ein Rechenmodell, wie sich der fundamentale Wert einer Aktie bestimmen lässt. So könnten Profis beispielsweise die künftig prognostizierten Dividenden über mehrere Jahre mit den Leitzinsen in ein Modell zusammenfließen lassen und daraus den aktuell „fairen Wert“ einer Aktie errechnen. Am Ende könnte sich herausstellen, dass der aktuelle Kurs einer Aktie angesichts der fundamentalen Überlegungen „zu hoch“ oder „zu niedrig“ liegt. Das Problem: Genauso gut könnte der Kurs richtig liegen und das fundamentale Rechenmodell falsch sein, etwa weil es bestimmte Faktoren außer Acht lässt. Man kann die Effizienzmarkthypothese und den eigenen Bewertungsmaßstab also immer nur zusammen testen. Stellt man Abweichungen fest, könnte entweder die Effizienzmarkthypothese das Problem sein – oder das Bewertungsmodell.
Wie lassen sich Blasen erklären?
Trotzdem fragen sich manche Privatleute, ob nicht mindestens Phänomene wie die Dotcom-Blase der Internetaktien in den 1990er-Jahren eindeutig der These effizienter Kapitalmärkte widersprechen. Damals jagten selbst unsolideste Internetaktien in rasante Höhen, um ab März 2000 in die Tiefe zu rauschen.
Was irrational erscheint, war angesichts der Chancen des Internets vielleicht nicht völlig abwegig. Allein die drei Firmen Apple, Microsoft und die Google-Mutter Alphabet sind rund 25 Jahre später so viel wert wie der gesamte Techindex Nasdaq Composite zum Höhepunkt 2000 (Stand: 11/24). Vielleicht gab es also lediglich falsche Erwartungen an die Schnelligkeit von Gewinnen bei Internetaktien, die sich plötzlich korrigierten.
Fehler lassen sich nicht nutzen
Und selbst wenn Privatleute die Dotcom-Blase trotzdem abwegig finden: Niemand sollte die Effizienz der Börse mit einem physikalischen Naturgesetz gleichsetzen, das immer exakt zutrifft. Stattdessen gleicht die Effizienz der Börsen eher einem biologischen Phänomen: Die Menschen am Markt reagieren schnell auf neue Informationen, was im Normalfall recht gut gelingt – im Einzelfall auch mal schlechter.
Doch selbst wenn es mal eine eindeutige Überbewertung geben sollte, heißt das nicht, dass sie sich ausbeuten lässt. Wetten auf fallende Kurse sind zum Beispiel meist nur für Finanzprofis möglich. Und zum Beispiel bei kleinen Aktien sind sie auch recht teuer, was solche Geschäfte weniger wirtschaftlich macht.
Die Schlussfolgerung bleibt daher dieselbe: Selbst wenn es falsche Bewertungen geben sollte, lassen sie sich nicht zweifelsfrei identifizieren oder nicht gewinnträchtig ausnutzen. Privatleute können an der Börse also trotzdem so handeln, als hätte die Effizienzmarkthypothese stets Bestand: Die Kurse von Aktien lassen sich nicht vorhersagen. Einzig ein langfristig relativ konstanter Aufwärtsdrang des Gesamtmarkts zeigte sich recht konstant (engl. drift). Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
BÖRSENKOPF
Als Benjamin Graham mit 30 Jahren eine Investmentgesellschaft gründete, hatte er vor allem ein Ziel: Er wollte herausfinden, was die Kurse wirklich bestimmt – und legte den Grundstein für die Anlagestrategie des „Value Investings“.
Aktien waren für Graham anders als für viele seiner Zeitgenossen kein Spekulationsgut. Stattdessen sah er die Papiere als Beteiligungen an Unternehmen: Graham analysierte Marktforschungen und Bilanzen, um den „inneren Wert“ einer Aktie zu bestimmen. Fand er Unternehmen, deren Aktien an der Börse weniger wert waren als der innere Wert, schlug Graham zu. Die Lehre des Investors geht davon aus, dass die Börsen nicht immer zu hundert Prozent effizient sind, sondern sich Fehlbewertungen ausbeuten lassen.
Dabei machte er viele bekannte Kennzahlen populär: So schaute auch Graham akribisch auf Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite oder Kurs-Buchwert-Verhältnis. Noch heute versuchen Anlegende damit unterbewertete Titel zu finden. Ob das funktionieren kann, und wie sich die Value-Strategie praktisch umsetzen lässt, lesen Sie ab Seite 231.
Ruhe – warum sie sich auszahlt
Ambitionierte Privatleute handeln gerne besonders schnell und häufig. Dabei ist Zeit an der Börse das beste Erfolgsrezept.
Dieses Bonmot ist mittlerweile zum Sprichwort am Parkett geworden: „In die Apotheke gehen, Schlafmittel kaufen, die Schlafmittel einnehmen und eine Palette internationaler Papiere kaufen“, so hat es der berühmte Börsenspekulant André Kostolany einmal im Sender ARD-alpha gesagt. Wer nach vielen Jahren wieder in sein Depot schaue, werde meist eine angenehme Überraschung erleben. Was Kostolany mit dem berühmt gewordenen Ausspruch wohl meinte: Blieben Anlegerinnen und Anleger dem Aktienmarkt über Jahrzehnte treu und ließen sich auch von zwischenzeitlichen Kurskapriolen nicht aus der Ruhe bringen, wurden sie dafür oft genug belohnt. Die Erkenntnis ist inzwischen so populär, dass Experten und Expertinnen auch von der sogenannten Buy-and-Hold-Strategie sprechen. Auf Deutsch: kaufen und halten.
Können sich Anlegerinnen und Anleger also mit zunehmender Anlagedauer ihrer Sache an der Börse tatsächlich sicherer sein? Die Antwort lautet: Ja, allerdings mit Einschränkungen. Im Großen und Ganzen stimmt die Grundidee durchaus; Stiftung Warentest hat dafür die weltweiten Börsen seit 1970 untersucht. Im größten Crash fiel ein Weltaktienindex wie der MSCI World mit mehr als 1 400 Aktien aus 23 Ländern zwar um mehr als 50 Prozent, vorübergehend hätte sich das Börsendepot mancher Sparerinnen und Sparer also mehr als halbiert. Bislang allerdings haben sich die Weltbörsen von Krisenphasen zuverlässig erholt. Wer einem globalen Index wie dem MSCI World länger als 13 Jahre folgte, hätte laut der Stiftung Warentest-Untersuchung nominal nie einen Verlust erleiden müssen.
Auf lange Sicht keine Verluste
Wer dem Industrieländer-Index hierzulande sogar 30 Jahre lang die Treue gehalten hätte, wäre selbst im schlechtesten Zeitraum mit einer positiven Rendite von durchschnittlich 6,8 Prozent im Jahr belohnt worden. Natürlich sind solche Zahlen keine Garantie für alle Ewigkeit, nichtsdestotrotz sind sie ein wichtiger Anhaltspunkt der Kapitalmarktforschung (siehe Grafik rechts). Und sie zeigt sich ähnlich auch in den Daten anderer Börsenbarometer.
Renditerechnungen des Deutschen Aktieninstituts für den hiesigen Leitindex Dax und eine längerfristige Rückrechnung weisen dasselbe Muster auf: In den 50 Jahren seit 1974 schloss das Leitbarometer der Börse immerhin 13 Kalenderjahre mit einem Verlust ab, also knapp jedes dritte Jahr. Wer zehn Kalenderjahre am Stück investierte, lag bloß noch in vier Prozent aller Fälle unter Wasser (Stand: 12/23).
Dass die Börsenbilanz auf lange Sicht also oft überraschend positiv ausfällt, ist vielen Privatanlegern gar nicht klar. Forscherinnen und Forscher der Goethe-Universität Frankfurt und der Frankfurt School of Finance and Management sprachen in einer Umfrage mit rund 2 100 Verbraucherinnen und Verbraucher, die bislang nicht an der Börse investiert hatten: Sie taxierten die Verlustwahrscheinlichkeit im Dax nach einem, fünf oder zehn Jahren nahezu identisch auf rund 30 Prozent. In Wirklichkeit wären Anleger allerdings mit zunehmendem Zeithorizont immer seltener in der Verlustzone geblieben.
Kurzsichtige Börsenleute Die Finanzökonomen Benartzi und Thaler erforschten: Wer kurzfristige Kursdaten betrachtet, scheut Aktien stärker. Wer Renditen über 10 oder 15 Jahre ansieht, entscheidet sich eher für Aktien. Der Grund: Kurzfristiges Auf und Ab verstellt den Blick für die langfristig soliden Erträge am Aktienmarkt.
Auf lange Sicht kam der Weltindex immer ins Plus
Diese Renditen waren je nach Anlagezeitraum im MSCI World möglich.
Quelle: LSEG, eigene Berechnungen
Zeitraum: 31.12.1969 – 30.09.2024
Keine pauschale Garantie
Anleger und Anlegerinnen dürfen die Ergebnisse aber nicht als pauschale Gewinngarantie auf lange Sicht missverstehen. Fachsprachlich formuliert nähern sich die Aktienrenditen auf lange Sicht nämlich bloß ihrem Durchschnitt an. Während es auf Sicht von einem Jahr große Ausreißer nach oben und unten gibt, liegen die besten und schlechtesten durchschnittlichen Renditen über 10, 20 oder 30 Jahre deutlich enger beieinander. Die Durchschnittsrenditen streuen also weniger um ihren Mittelwert. Oder anders formuliert: Man kann sich über längere Zeiträume tendenziell sicherer sein, dass die durchschnittlich erzielte Rendite nah an der langfristigen Durchschnittsrendite liegt. Das beinhaltet also keine Garantie, aber eine Tendenz – und es galt nur für die breiten Börsen, nicht für einzelne Unternehmen.
Der Grund dafür ist simpel: Je länger man an der Börse schaut, desto wahrscheinlicher ist es aus Sicht vieler Finanzwissenschaftler, dass sich schlechte und gute Perioden abwechseln. Dahinter steht eine Art Radrenn-Effekt: Spitzenfahrer fallen mit der Zeit wieder ins Mittelfeld zurück, vermeintliche Verlierer schließen irgendwann wieder auf. Übertragen auf die Börse heißt das: Die Renditen bestimmter Börsenindizes können eine Zeit lang besser ausfallen, fallen dann aber wieder zum Schnitt zurück. Oder sie laufen vorübergehend schlechter, schließen dann renditemäßig aber wieder auf. Fachleute nennen dieses Phänomen die „Regression zum Mittelwert“.
Ein Beispiel: In den 1990er-Jahren trieben Technologie-Aktien die Börse an, pünktlich mit der Massenverbreitung des Internets. Nach der guten Phase schloss sich in den 2000er-Jahren eine Schwächephase an, da Hoffnungen enttäuscht wurden. Erst ab 2010 ging es wieder stärker aufwärts, als sich Großkonzerne wie Amazon oder Apple große Marktmacht erobert hatten und üppige Gewinne schrieben.
BÖRSENKOPF
Es war im Jahr 1976, als John Bogle der US-Fondsgesellschaft Vanguard einen ungewöhnlichen Vorschlag machte: Fortan wolle er Produkte vermarkten, die sich bloß am Börsenschnitt orientierten. Viele Profis belächelten den Ansatz jedoch, kritisierten ihn gar als „unamerikanisch“.
Die Idee des Investors: Statt den vermeintlich aussichtsreichsten Papieren hinterherzujagen, sollte die Fondsgesellschaft mit neuen Produkten einfach den US-Leitindex S&P 500 kopieren. Indexfonds nannte Bogle seine Papiere, die der Entwicklung des Börsenbarometers eins zu eins folgen sollten. Da sich die Kurse nicht vorhersagen ließen, könne kaum jemand dauerhaft besser abschneiden als der breite Markt, so Bogles Grundannahme.
Weil solche Fonds einfach zu verwalten sind und kein großes Fondsmanagement brauchen, lassen sie sich günstig anbieten. Heute sind solche Indexpapiere unter dem Kürzel ETF auch hierzulande bekannt und beliebt. Wie Sie beim Vermögensaufbau schlicht einem Börsenindex folgen können, lesen Sie ab Seite 85.
Sind 40 Jahre übertrieben?
Manche Investorinnen und Investoren fragen sich allerdings, ob 20, 30 oder gar 40 Jahre an der Börse tatsächlich ein realistischer Anlagehorizont sind. Fakt ist, dass viele Menschen mit 30 Jahren noch 37 Jahre bis zum Renteneintrittsalter haben. Selbst mit 65 Jahren leben Männer hierzulande nach Prognosen des Statistischen Bundesamtes noch knapp 18 Jahre, Frauen sogar noch knapp 21 Jahre. Diese Angaben sind die Mittelwerte, ein Teil dürfte weit länger leben. Anlegerinnen und Anleger sollten ihren Anlagehorizont also nicht unterschätzen. Natürlich können sie ihre Geldanlagen mit der Rente konservativer aufstellen, sich allerdings sofort von allen Aktien zu trennen ist in den meisten Fällen nicht nötig.
Warum die Kurse langfristig steigen
Viele Interessierte fragen sich, wie die Theorie der zufälligen Kurse mit dem langfristigen Aufwärtstrend an den Börsen zusammenpasst. Nur weil Anlegerinnen und Anleger in der Vergangenheit mit Aktien besonders gut abgeschnitten haben, muss das in der Zukunft nicht genauso sein. Dennoch gibt es zwei überzeugende Erklärungen für die dauerhaft hohen Aktienerträge auf lange Sicht.
Erstens: Langfristig haben Börsenfirmen ihre Gewinne insgesamt gesehen kräftig steigern können. Das ist wiederum die Grundlage für üppigere Gewinnausschüttungen – und genau sie bestimmen in den Augen von Finanzprofis langfristig den Wert der Aktien.
Zweitens gibt es noch eine theoretische Sichtweise: Weil Aktien mehr Risiko als Anleihen bedeuten, verlangen Anlegerinnen und Anleger dafür eine höhere Rendite, gewissermaßen als Schmerzensgeld. Einerseits schwanken Aktien kurzfristig stärker als Anleihen. Andererseits bergen Aktien im Ernstfall einer Unternehmenspleite ein höheres Verlustrisiko: Geht eine Firma pleite, sind Anleihen in der Insolvenzreihenfolge im Normalfall früher dran als Aktien. Auch dafür wollen die Aktienleute gerne eine Kompensation sehen, zum Beispiel in Form von satten Gewinnausschüttungen.
Risiko – wann es Rendite bringt
Viele Menschen wollen partout kein Risiko eingehen. Doch ohne Risiko gibt es an der Börse keine Rendite. Da hilft nur eines: Die Gefahren so gut zu verstehen, wie es nur geht.
Fragt man Anleger und Anlegerinnen in Deutschland, was sie sich von ihrer idealen Geldanlage wünschen, ist die Antwort meist eindeutig-zweideutig: Einerseits wären solide Renditen natürlich schön, andererseits soll bitte das Risiko gering sein. Diese beiden Wünsche an die perfekte Geldanlage sind verständlich, wir alle würden wohl gerne auf sicherem Wege ein kleines Vermögen aufbauen. Doch auch am Finanzmarkt hat jede Medaille zwei Seiten: Die buchstäbliche Kehrseite für die auskömmliche Rendite des Aktienmarkts war und ist sein beträchtliches Risiko. An der Börse haben Anlegerinnen und Anleger diese Erkenntnis in einen Spruch gekleidet: „Gewinne an der Börse sind Schmerzensgeld.“
Das ist keine „Bauernregel“, sondern eine zentrale Erkenntnis jahrzehntelanger finanzwissenschaftlicher Forschung: Zwischen Rendite und Risiko gibt es einen wesentlichen Zusammenhang. Erwartete Rendite ist am Finanzmarkt immer der Lohn dafür, dass Anlegerinnen und Anleger Risiko eingehen. Wer sich langfristig also mehr Renditechancen sichern will, muss dafür in aller Regel auch stärker ins Risiko gehen.
Risiko hat verschiedene Facetten
Aber was meint Risiko überhaupt? Ein Wörterbuch definiert Risiko als „Gefahr des Verlustes bei einer Unternehmung, deren Ablauf und Ausgang unsicher ist“. Bei einer sicheren Geldanlage bekommen Anleger und Anlegerinnen ihr Geld schließlich auf jeden Fall in voller Höhe zurück. Risiko an der Börse ist dagegen bei genauerem Hinsehen gar nicht so eindeutig zu definieren. Viele Leute werden darunter verstehen, Kursverluste zu erleiden, und an die größten Börsencrashs der Geschichte denken.
Andere Anlagenaturen lassen sich von kurzzeitigen Minuszahlen nicht schrecken, würden aber ungern zehn Jahre und mehr im Minus liegen. Für sie wäre Risiko also eine darüber hinaus gehende Minusperiode. Für wieder andere Privatleute ist hingegen entscheidend, mindestens zwei Prozent im Jahr zu verdienen und damit ungefähr die langfristige Inflation auszugleichen. Ihr Risiko wäre, diese eigene Zielmarke zu unterschreiten.
Das Gedankenspiel soll klarmachen: Risiko hat sehr unterschiedliche Facetten. Anlegerinnen wie Anleger sind gut beraten, mögliche Risiken bei der Geldanlage aus vielen Perspektiven zu betrachten. Ganz praktisch bedeutet das zuallererst, sich dem Risiko zu stellen. Statt sich von Aktiencrashs überraschen zu lassen, sollten Interessierte wissen, dass es im Schnitt alle zehn Jahre an den Börsen deutlich nach unten ging. Ein Aktiencrash ist also gerade keine böse Überraschung, mit der niemand rechnen konnte. Im Gegenteil: Egal ob Privatleute über 10, 20 oder 30 Jahre anlegen, dürften sie es irgendwann mit einem Aktiencrash zu tun bekommen – wahrscheinlich sogar mit mehreren. Diesen Ernstfall gilt es schon vorher einzukalkulieren.
So stark wirken Börsencrashs
Egal ob Ölkrise in den 1970ern, die Dotcom-Blase zur Jahrtausendwende oder der Corona-Crash: In einem Kurskollaps können selbst weltweite Börsenindizes rasant an Wert verlieren. In der Internetblase 2000 ging es schrittweise immer weiter bergab, sodass die Kurse im MSCI World erst Ende Februar 2003 ihren Boden fanden – bei einem Minus von mehr als 50 Prozent. Der Weltindex schnitt noch vergleichsweise gut ab, der deutsche Leitindex Dax verlor im schlimmsten Zeitraum sogar rund 70 Prozent seines Wertes. Verluste zwischen 40 und 60 Prozent sind bei Großkrisen in globalen Aktienindizes immer drin, nationale Börsenbarometer trieb es mit Verlusten von 70 oder 80 Prozent oft sogar noch tiefer. Betrachten Anlegende auch die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts mit zwei Weltkriegen und einer Hyperinflation, sieht die Bilanz teilweise noch schwärzer aus.
Risiko hat viele Facetten
Unterschiedliche Risikomaße der wichtigsten Anlageklassen
Quelle: LSEG, eigene Berechnungen
Zeitraum: 31.12.1969 – 30.09.2024, abweichend Schwellenländeraktien: ab 31.12.1987;
Anmerkungen: Rechnung: nominal; mit Indexwerten, ohne Kosten und Steuern; in DM/€; Indizes: Industrieländeraktien: MSCI World TR, Aktien Deutschland: MSCI Germany TR; Aktien Schwellenländer: MSCI EM TR; Staatsanleihen: RexP; Geldmarkt: Dreimonatsgeld Frankfurt, ab 01/99 3-Mo-Euribor; Gold: LSEG Spot; Rohstoffe: GSCI; Inflation: Verbraucherpreisindex VPI.