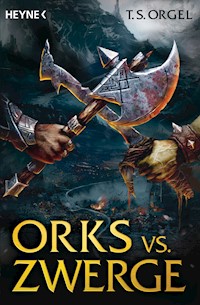11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das Leben in den verwinkelten Gassen Atails ist hart, vor allem, wenn man nicht zu einer der großen Magierfamilien gehört. Die Straßenzauberin Stern schlägt sich mehr schlecht als recht durchs Leben, als ihr eines Tages der Schlüssel zum Haus der tausend Welten in die Hände fällt, das einst der Sitz der Magiergilde war. Der Legende nach soll es unendlich viele Räume beherbergen, gefüllt mit Schätzen und Artefakten, die selbst aus einfachen Zauberern die mächtigsten Magier der Welt formen können. Gemeinsam mit ihren Gefährten Fuchs, Ako, Baelis und Salter macht Stern sich auf den Weg dorthin. Aber sie sind nicht die Einzigen, die die Geheimnisse des Hauses ergründen wollen. Noch ahnen die Schatzsucher nicht, was im Inneren des Hauses wirklich auf sie wartet ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 735
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Wer im Kaiserreich der Drachennation überleben will, braucht entweder viel Geschick, viel Geld, viel Macht – oder viel Glück. Am besten, man hat von allem etwas, denn sonst müsste man sich womöglich auf einen waghalsigen Auftrag einlassen. Vor dieser Situation stehen die Zauberin Stern, die Söldnerin Baelis, der Gelehrte Salter, der Straßendieb Fuchs und die Reisende Ako – dabei können sie noch nicht ahnen, worauf sie sich bei ihrem Auftrag gerade eingelassen haben. Hier in Atail, der sagenumwobenen Stadt hoch in den Bergen, sollen sie für eine geheimnisvolle Auftraggeberin in das sogenannte Haus der tausend Welten einsteigen und ein seltenes Artefakt bergen. Es winken Ruhm und Ehre, und natürlich ein Anteil an allem, was sie dort finden. So weit, so gut. Das Problem ist nur: Noch nie ist jemand, der sich in dieses Haus gewagt hat, lebendig vor dort zurückgekehrt, von »unermesslich reich« ganz zu schweigen. Außerdem sind Stern und ihre Gefährten nicht die einzigen, die hinter dem Geheimnis des Hauses her sind. Aber der versprochene Lohn ist zu verlockend – und wie gefährlich können ein paar Fallen in einem alten Haus schon sein?
Die Autoren
Hinter dem Pseudonym T. S. Orgel stehen die beiden Brüder Tom und Stephan Orgel. In einem anderen Leben sind sie als Grafikdesigner und Werbetexter beziehungsweise Verlagskaufmann beschäftigt, doch wenn beide zur Feder greifen, geht es in fantastische Welten. 2012 erschien ihr erster gemeinsamer Roman »Orks vs. Zwerge«, für den sie im Oktober 2013 den Deutschen Phantastik Preisfür das beste deutschsprachige Debüt erhielten. Seitdem begeistert das Bestseller-Autorenduo mit Epen wie der »Blausteinkriege«-Trilogie und dem Science-Fiction-Roman »TERRA« Zehntausende Leser.
Mehr über Tom und Stephan Orgel auf: ts-orgel.de
Von T. S. Orgel sind im
WILHELM HEYNE VERLAG
erschienen:
Orks vs. Zwerge
Orks vs. Zwerge – Fluch der Dunkelheit
Orks vs. Zwerge – Der Schatz der Ahnen
Die Blausteinkriege I – Das Erbe von Berun
Die Blausteinkriege II – Sturm aus dem Süden
Die Blausteinkriege III – Der verborgene Turm
Das Haus der tausend Welten
TERRA
T.S. ORGEL
DAS HAUS DER
TAUSEND
WELTEN
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
»There is a house in New Orleans,
it’s called the Rising Sun.
It’s been the ruin of many a poor girl
Great God and I for one.«
Rising Sun Blues, Amerikanischer Folk Song,
Autor unbekannt
Originalausgabe 03/2020
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2020 by Tom & Stephan Orgel
Copyright © 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlagillustration: Franz Vohwinkel
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-23388-4V001
@HeyneFantasySF
INHALT
Prolog
Baelis
Salter
Fuchs
Atail
Ako
Die Goldene Halle
Mlima
Stern
Ein schönes Stück Stahl
Hoch und davon
Mottenzerfressen
In den Schroggra-Bau
Butsu
Leere Hallen
Bücher
Tanzende Blüten
Lauft!
Heldenmut und Reue
Geheimnisse und Legenden
Freund und Feind
Fuchs auf der Flucht
Bäume sind zähe Burschen
Der unmögliche Garten
Die Vergessenen
Mahlstrom
Tote Schatten
Die ganze Wahrheit
Erkenne dich selbst
Der tausendste Raum
Drachenkaiser
Einer für alle …
Auf die Dinge, wie sie sind
Eine dieser Nächte
Anhang I – Namensverzeichnis
Anhang II – Glossar
PROLOG
Das Jahr 464 der Drachennation
Das Haus der Aufgehenden Sonne hatte tausend Arten, jemanden zu töten. Für Roru jedoch hatte es sich anscheinend etwas geradezu Langweiliges ausgesucht. Es war nur ein Kratzer gewesen, kaum der Rede wert, beiläufig zugefügt, als ein weniger geschickter Mann seinen Kopf verloren hatte. Er jedoch war dem Monster fast spielend leicht ausgewichen, und ein Dolch durch das Auge hatte dem Leben der Kreatur ein Ende gesetzt, noch bevor sie einen zweiten Angriff hatte führen können. Den Kratzer hatte er erst Stunden später bemerkt, als sie Rast in diesem Stockwerk eingelegt hatten, das bis unter die hohe Decke mit Büchern und Schriftrollen aller Art gefüllt gewesen war. Dort war Pwyl gestorben. Eine der Kreaturen, die drei Ebenen tiefer hausten, hatte ihn erwischt. Hatte ihm die Brust durchstochen und den halben Bizeps abgebissen. Für eine Weile hatte es ausgesehen, als würde er es trotzdem schaffen. Er tat es nicht. Und während die anderen diskutierten, was sie mit dem Toten tun sollten, hatte er festgestellt, dass das Jucken in seiner Wade nicht aufhörte. Unauffällig hatte er nachgesehen. Es war nur ein unbedeutender Riss in seinem Beinkleid, doch die Haut darunter war beinahe schwarz, und feine dunkle Adern streckten sich wie zarte Wurzeln von dort aus in Richtung seines Knies. Roru hatte die Hose zurück über die Wunde geschoben und geschwiegen. Und er schwieg bis jetzt. Was sollte er auch sagen? Die Taruki, Meret, war eine ziemlich gute Heilerin, soweit er das beurteilen konnte, aber was sollte sie tun? Ihm das Bein abnehmen? Das würde vielleicht, nur vielleicht, helfen – in einem Lazarett. Aber hier drin? Wenn er liegen blieb, war er bereits so tot wie Pwyl. Also blieb ihm nichts anderes, als zu laufen. Zu klettern. Hoch und immer höher. Wer wusste es schon– wenn sie es ganz nach oben schafften, bekam er vielleicht seinen Wunsch erfüllt. Den Wunsch, der jeden Fehler rückgängig machen konnte. Er hatte etwas anderes damit im Sinn gehabt, aber bei Ragots Messern – der größte Fehler, den er begangen hatte, war mit Sicherheit, dieser Frau auf ihrer Suche nach dem Tod zu folgen. Es war dämlich gewesen hierherzukommen.
Roru lehnte sich gegen das steinerne Geländer, das den Schacht umgab, und starrte in die Tiefe. Irgendjemand, vermutlich der große Ragot, hatte irgendwann gesagt, in den Abgrund zu starren wäre eine schlechte Idee. Irgendwann starre der Abgrund zurück, und das sei dann aus irgendeinem Grund nicht gut. Roru hatte nicht genau verstanden, was das Problem daran war, aber in diesem Fall gab es Dinge dort unten, von denen man besser nicht gesehen wurde.
Er hatte keine Ahnung, wie hoch sie inzwischen waren. Zwanzig Stockwerke? Dreiundzwanzig? Er hatte irgendwann die Orientierung verloren, und das beunruhigte ihn beinahe noch mehr als die Tatsache, dass dieses Haus keine dreiundzwanzig Stockwerke haben dürfte.
War da eine Bewegung gewesen? Roru kniff die Augen zusammen und starrte in die Finsternis des Schachts hinab, in dessen Tiefe Lichter glommen wie manchmal in der Tiefe der See in einer windstillen, mondlosen Nacht. Er war zu hoch, um das Licht am Grund sehen zu können, doch allein der Gedanke, dass dort unten Menschen ihrem ganz normalen Leben nachgingen, dass außerhalb dieser Mauern eine Stadt lag, die nichts davon ahnte, was in diesem Haus lauerte, erfüllte seinen Schädel mit dumpfem Pochen. Vielleicht war es aber auch besser, dass niemand von alldem hier wusste. Wie hätte irgendjemand in Atail noch ruhig schlafen sollen, wenn dieser Mist hier bekannt wäre? Wenn bekannt wäre, welche Reichtümer – und welche Schrecken dieser Ort bereithielt, direkt im Herzen der Stadt? Unwissenheit war öfter ein Segen, als man gemeinhin annahm.
Ja. Definitiv eine Bewegung. Irgendjemand – oder etwas – kam die Treppe herauf, die sie erklommen hatten, nachdem Pwyl gestorben war. Wenn es denselben Weg nahm wie sie, würde es sie in einer halben Stunde erreicht haben.
»Wir sollten weitergehen«, sagte Meret leise. Die Haut der hochgewachsenen Taruki war so dunkel, dass er sie im Dämmerlicht kaum sah. Nur auf ihrem glatt rasierten Schädel schimmerte der Widerschein der einsamen Laterne hinter ihnen – und in ihren Augen, als sie sich jetzt zu ihm umwandte. »Kannst du gehen?«
Roru gelang es, nicht zusammenzuzucken. »Warum sollte ich nicht?«
»Du schonst dein Bein«, stellte sie ungerührt fest. »Du bist langsamer. Du weichst mir aus.«
Er grinste halbherzig. »Ich weiche denen da aus.« Er nickte in Richtung der drei verbliebenen Söldner. Er hatte sie beinahe sein ganzes Leben lang gekannt. Sie waren Straßenschläger aus dem Viertel, in dem er aufgewachsen war. Und doch schienen ihm ihre Gesichter, jetzt, da sie am Ende ihrer Kräfte waren, eigenartig fremd. »Mein Volk glaubt, es bringt Unglück, sich in der Nähe von Totgeweihten aufzuhalten, wenn man nichts zu trinken hat.«
»Ich kann dir einen Schluck Wasser anbieten.«
Roru verzog das Gesicht und rieb sich die Augen. Das Klopfen in seinem Kopf wurde nicht besser. »Du weißt, was ich meine.«
Meret zuckte mit den Schultern. »Ich hoffe nur, dass du durchhältst. Das dort drin ist alles, was wir noch an Karte haben.« Ihr langer Zeigefinger tippte gegen Rorus Kopf. »Wir sind so weit gekommen.«
»Und wir müssen noch ein ganzes Stück höher.« Er wischte ihre Hand beiseite. »Ich wünschte nur, ich hätte mich nie zu diesem Dreck hier überreden lassen. Ich könnte in Tenburro am Hafen sitzen und mich in Ruhe betrinken. Aber nein, ich musste mich ja zu dieser von den Göttern verfluchten Schatzjagd überreden lassen. Bezwingt das Haus der Aufgehenden Sonne, und ihr könnt euren sehnlichsten Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Ihr werdet die Welt verändern. Es ist eure Bestimmung!« Er schnaubte abfällig. »Sieh uns an. Es ist fast niemand mehr von uns übrig, wir haben keine Karte mehr, keine Vorräte, keinen Ausweg. Keine Zeit.« Er seufzte und sank ein wenig in sich zusammen. »Was hättest du dir gewünscht, wenn wir es geschafft hätten?«
Meret sah ihn mit unlesbarer Miene an. »Wir haben alle unsere Wünsche, oder? Und ich bin noch nicht bereit, meine aufzugeben.« Sie deutete auf sein Bein. »Soll ich es mir ansehen?«
Er schnaubte erneut. »Was sollte das bringen? Du kannst es nicht heilen, oder?«
Die Taruki zögerte, dann schüttelte sie den Kopf. »Vermutlich nicht. Aber ich kann dich vielleicht etwas länger am Leben halten.«
»Und dann? Wenn ich einer der Noru werde, werde ich dich umbringen. Das weißt du.«
»Keine Sorge.« Meret zuckte wieder mit den Schultern. »Wenn du so weit bist, dass dir schwarzer Rotz aus den Augen läuft, werde ich dich schon töten, bevor du Schaden anrichtest.« Sie klopfte ihm auf den Rücken. »Aber noch sind wir nicht tot. Und wenn wir ein wenig Glück haben, schaffen wir es nach oben, und nichts von dem Mist hier wird dann noch eine Rolle spielen.« Sie sah über die Brüstung nach unten. »Und wenn wir noch ein wenig mehr Glück haben, treffen wir noch mal dieses verdammte Miststück. Der Prophet Mora sagt, man trifft sich immer zweimal im Leben.«
Roru biss die Zähne so fest aufeinander, dass es schmerzte. »Ich verstehe es immer noch nicht. In Ordnung, ja, die Sache mit dem Wunsch ist ein guter Grund für so ziemlich alles. Aber hast du dich mal gefragt, was für sie drin ist? Wenn wir unseren Herzenswunsch erfüllt bekommen, egal, was er ist – was ist ihrer?« Er sah Meret von der Seite an. »Und ist es eigentlich eine gute Idee, wenn wir ihr dabei helfen?«
Meret sah in die Tiefe und schwieg. Schließlich seufzte sie. »Es ist ein wenig spät für diese Frage, oder? Aber wenn du’s genau wissen willst: Die Lieder meines Volks sagen, dass hier ein Gott gestorben ist. Und ein anderer begraben liegt und wartet. Darauf, dass ihn jemand weckt.«
»Oh.« Roru starrte einen Moment vor sich hin. Dann nickte er sehr langsam. »Das erklärt einiges. Aber die Frage bleibt: Ist das eine gute Idee?«
BAELIS
Das Jahr 611 der Drachennation
Was den erfolgreichen vom erfolglosen Bauern unterscheidet? Dass er vorausschauend denkt. Dass er zu den richtigen Zeiten die Saat ausbringt. Dass er die Zeichen der Natur erkennt und zu deuten vermag. Ein Ziehen in den Knochen. Ein Wolkenbild. Eine sanfte Brise. Wann handelt es sich nur um Zufälle, und wann sind es die ersten Anzeichen für einen aufkommenden Sturm?
Bauern mit schlichterem Gemüt verlassen sich auf die Worte anderer. Wenn sie Glück haben, geraten sie an einen klugen Mann. Haben sie Pech, bekommen sie es mit einem Dummkopf zu tun. Oder mit einem Quacksalber, der ihnen das Geld aus den Taschen zieht. Der kluge Bauer beobachtet und lernt und zieht seine eigenen Schlüsse. Er sieht die Wolken aufziehen und wappnet sich für den Sturm. Und der wird kommen. Eines Tages. Das ist so sicher, wie der Mönch dir das Himmelreich verspricht, wenn du ihm nur genügend Gold spendest.
Was einen erfolgreichen von einem erfolglosen Bauern unterscheidet? Glück. Meistens ist es einfach nur Glück.
Es war eine dieser Nächte, in denen unerwartet Wind aufkam und die Fensterläden klappern ließ. In denen vereinzelte Tropfen durch die Gassen wirbelten. Noch nicht genug, um sich Regen zu nennen, aber ausreichende Anzeichen für ein nahendes Gewitter – oder einen Sturm. Baelis hatte so etwas nicht zum ersten Mal erlebt. Die Stimmung in der Stadt, die schon seit Tagen seltsam aufgeheizt war – so als ob die Menschen auf ein Ereignis warteten, dass sich seit langer Zeit angekündigt hatte.
In einem Vorort hatte eine Handvoll Oantan-Treiber den Aufstand geprobt. Ihre Rädelsführer waren auf dem Richtplatz gevierteilt worden. Ihr Blut war in Strömen über das Pflaster geflossen, doch dieses Opfer schien die Götter nicht im Geringsten besänftigt zu haben – wenn die Götter überhaupt jemals durch irgendetwas zu besänftigen waren … Jedenfalls hatte kurz darauf im Gerberviertel eine heftige Feuersbrunst gewütet. Man hatte Brandstiftung vermutet. Die Bewohner hatten sich bei ihren Löschversuchen gegenseitig behindert, mehr damit beschäftigt, die brennenden Häuser zu plündern, als die Flammen am Übergreifen zu hindern. Am Nachmittag sollte es Gerüchten zufolge dann zu weiteren Unruhen unten am Osttor gekommen sein, und Gardisten waren den ganzen Abend über damit beschäftigt gewesen, die Ordnung wiederherzustellen. Doch noch immer zogen vereinzelte Gruppen randalierend und plündernd durch die Unterstadt. Aufgeputscht durch Langeweile, Bitterpilze und die reine Lust an der Gewalt.
So wie die drei Gestalten, die in das kleine Gasthaus am Tanisblütenplatz eindrangen, das Baelis als Rückzugsort vor all dem Chaos in dieser verrückten Stadt diente. Aufgeputscht, stinkend vor Schweiß und Erregung und mit fiebrig glänzenden Augen. Der Erste war ein stiernackiger Kerl mit dem Blick eines kampfgestählten Kriegers. Seine Stiefel sahen schlicht und abgewetzt aus, schienen aber von ordentlicher Qualität zu sein. Nockleder. Einen guten Krieger konnte man an der Wahl seiner Stiefel erkennen. Und natürlich daran, dass er noch am Leben war.
Der Zweite war fett und aufgedunsen, seine rote Knollennase von unzähligen feinen Äderchen durchzogen. Ein Säufer vermutlich, und ein Mitläufer. Trotzdem keiner, dem man leichtfertig den Rücken zudrehen sollte. Genauso wenig wie dem Dritten, dessen federnder Gang auf regelmäßige Körperertüchtigung schließen ließ. Er war jung und gut aussehend, und er war sich dessen bewusst. Außerdem war er ziemlich betrunken und warf ein Auge auf Naka, die hübsche Bedienung, die ihm ganz unbewusst ihr berühmtes Lächeln schenkte, das schon unzählige Herzen gebrochen hatte. An diesem Abend konnte so ein Lächeln allerdings für eine Menge Ärger sorgen.
»Was kann ich euch bringen?«
»Dich«, sagte der Schlanke selbstbewusst. »Ich will dich.«
Nakas hübsche Gesichtszüge verhärteten sich nur ganz wenig. Bedauernd schüttelte sie den Kopf. »Das ist nicht im Angebot. Ich kann euch aber Wein ausschenken, wenn ihr wollt.«
»Wein für uns drei«, sagte der Aufgedunsene. Er zog eine Handvoll Farsha unter dem Hemd hervor und warf sie auf die Theke. »Den besten, den du hast.«
»Warum sollte ich bezahlen, wenn ich nicht das bekomme, was ich will?« Mit einer lässigen Handbewegung fegte der Schlanke die Münzen von der Theke, wobei sie klimpernd zu Boden fielen. Der Aufgedunsene verzog das Gesicht und bückte sich ächzend, um die Münzen wieder einzusammeln.
Naka stellte einen Krug unter das Weinfass und füllte ihn. Dann nahm sie drei Becher aus dem Regal und stellte sie vor ihren Gästen ab. Blitzschnell beugte sich der Schlanke nach vorn und griff nach ihrem Handgelenk.
»Ich habe Geld, und du hast das, was ich jetzt brauche. Also zier dich nicht so, Mädchen.«
»Ich serviere nur den Wein«, sagte Naka mit einem verunsicherten Blick auf ihr Handgelenk. »Ich will keinen Ärger.«
»Ich doch auch nicht.« Der Schlanke zog sie ein Stück näher zu sich heran und grinste dabei unverschämt. »Ich will nur meinen Spaß. Ich meine: Sieh dich um, wir sind hier ganz allein. Da kannst du doch mal eine kleine Pause machen …«
»Ich bitte Euch, Herr.« Hilflos versuchte Naka, sich aus seinem Griff zu befreien. »Trinkt Euren Wein aus und geht. Ich möchte wirklich nicht …«
»Aber ich! Und keine Sorge: Niemand wird etwas erfahren. Mondo wird aufpassen, dass uns keiner stört. Habe ich recht, Mondo?«
»Dort drüben sitzt noch jemand, Dubash«, sagte der Stiernackige, der das Geschehen bis dahin reglos verfolgt hatte, aber offenbar heller war, als er aussah. Er wies über die Schulter in die dunkle Ecke, in der es sich Baelis mit einem kühlen Becher Wein gemütlich gemacht hatte.
Der Schlanke drehte den Kopf und kniff die Augen zusammen.
Baelis konnte sich seine Gedanken beinahe bildlich vorstellen. Die Frau, die er im Halbdunkel erblickte, war hochgewachsen und sehnig, und sie trug ihre Haare kurz geschoren wie ein Mann. Sie entsprach beileibe nicht seinem Schönheitsideal, und der Anblick wurde noch zusätzlich durch die hässliche Narbe getrübt, die sich von ihrem linken Ohr bis hinunter zum Mundwinkel zog. Sie verlieh ihr den Anschein, spöttisch zu grinsen, und das machte ihn irgendwie nervös.
Dabei war das nichts Besonderes, denn es machte die meisten Menschen nervös. Baelis wusste das durchaus zu schätzen. Es errichtete eine natürliche Barriere, die dafür sorgte, dass man sie die meiste Zeit über in Ruhe ließ. In diesem Augenblick jedoch waren die Augen sämtlicher Anwesender auf sie gerichtet.
Der Schlanke brauchte am längsten, bis er sich von der Überraschung erholt hatte. Dann stieß er ein spöttisches Lachen aus. Er drückte den Brustkorb heraus wie ein Hahn auf dem Misthaufen. Streitlustig hob er das Kinn. »Was glotzt du so blöd, Vogelscheuche?«
»Baelis …«, sagte Naka. In ihrer Stimme lag ein flehentlicher Unterton.
Baelis konnte es ihr nicht verübeln. »Schon gut«, sagte sie gelangweilt. Ihre Worte klangen ein wenig verwaschen, weil sie schon eine ganze Menge getrunken hatte. »Ich bin daran gewöhnt.« Sie nippte an ihrem Trinkbecher und musterte den Schlanken dabei von Kopf bis zu den Füßen. »Du solltest auf das Mädchen hören, Dubash. Trink deinen Wein aus und geh nach Hause. Das ist keine Nacht, um sich in diesem Teil der Stadt herumzutreiben.« Sie hielt inne, und ihr Blick wanderte zur Decke. »Ich habe das Gefühl, dass irgendwo da draußen ein mächtiger Sturm aufzieht.«
Dubashs Augen folgten ihrem Blick, ehe er die Stirn runzelte und verwirrt blinzelte. »Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich nehme doch keine Befehle von einer Vogelscheuche an.«
Baelis seufzte gequält. »Es gehört sich wirklich nicht, in der Gegenwart von Damen auf diese Art zu reden.«
»Damen? Ich sehe hier nur Schlampen. Eine hässlicher als die andere. Vor allem du. Du bist so hässlich wie ein … wie ein Ruk.«
»Ich wurde schon Schlimmeres genannt. Aber Naka hat das nicht verdient. Sie ist wirklich ein verdammt hübsches Mädchen.«
»Sie ist eine Schlampe. Eine perverse kleine Schlampe.«
»Jetzt solltest du aber wirklich gehen.«
Mit einer schroffen Geste schlug Dubash seinen Umhang zurück und enthüllte die Scheide einer kurzen, geraden Schwertklinge. Er legte die Hand auf den Griff der Waffe und zog sie ein kleines Stück heraus. Das Kerzenlicht des Kronleuchters an der Decke spiegelte sich in einer kunstvoll mit Blumenmustern verzierten Klinge. Ein Ralgri. Eine Waffe, die normalerweise ausschließlich Adligen und Magistern vorbehalten war. Doch so weit konnte Baelis an diesem Abend schon nicht mehr denken.
»Wenn du noch mal das Maul aufreißt, sorge ich dafür, dass sich dein dämliches Grinsen bis zum anderen Ohr zieht.« Brüsk wandte sich Dubash zu Naka um. »Und du gieß mir endlich den verdammten Wein ein, Schlampe! Ich habe Durst.« Kaum hatte sie den Becher gefüllt, riss er ihn ihr aus der Hand und kippte den Inhalt in einem Zug hinunter. Er leckte sich über die Lippen und stieß sich von der Theke ab. Erneut wanderte seine Hand zu dem Ralgri hinab und riss es nach kurzem Suchen aus der Scheide.
»Dubash«, zischte der Aufgedunsene. Ängstlich hielt er den Schlanken am Ärmel fest.
Dubash stieß ihn grob beiseite und schwankte breitbeinig auf Baelis zu. Er hob das Ralgri und richtete die Spitze gegen ihre Brust. »Deine hässliche Fresse widert mich an. Ich werde dich an Ort und Stelle aufspießen – oder, weißt du, was noch besser ist? Ich überlasse dich zuerst Mondo.« Sein Kinn zuckte zu dem Stiernackigen hinüber. »Der scheut sogar vor so etwas Hässlichem wie dir nicht zurück. Und wenn er mit dir fertig ist, verfüttere ich deine Reste an meine Zierfische.«
Naka stieß erschrocken die Luft aus. »Bitte, Herr, ich flehe Euch an.«
»Dubash«, krächzte der Aufgedunsene. »Lasst es endlich gut sein.«
Baelis sagte nichts, blickte Dubash nur ruhig in die Augen.
Er hätte das als Warnung verstehen sollen, doch Leute seines Schlags verstanden sich selten auf solche Dinge. Vor allem nicht, wenn sie betrunken und in der Überzahl waren. »Jetzt bist du plötzlich still«, sagte er triumphierend. »Hat es dir etwa die Sprache verschlagen?« Die Spitze seines Ralgri wanderte langsam nach oben. Sanft stieß sie gegen die Narbe auf Baelis Wange. »Soll ich dich zum Reden bringen? Oder besser noch zum Schreien? So richtig laut, ja? Würde dir das gefallen?« Langsam bohrte sich die Spitze des Degens in ihre Wange.
Baelis wich ein winziges Stück vor der Klinge zurück und seufzte. »Du weißt doch, wie das hier endet, nicht wahr?«
»Ja«, sagte Dubash mit einem bösartigen Glitzern in den Augen. »Ich kann es mir bildhaft vorstellen.«
»Ich auch«, sagte Baelis, und dann …
… ging alles ganz schnell.
Baelis Linke schoss nach oben, packte das Ralgri vorn an der Klinge – zum Glück trug sie robuste Handschuhe aus Nockleder – und riss es zur Seite. Gleichzeitig schlug der Becher in ihrer rechten Hand hart gegen Dubashs Kinn und schickte ihn krachend zu Boden. Mit der Klinge in der Linken wirbelte sie herum und schleuderte die Waffe kraftvoll auf den Stiernackigen, sodass der Knauf dumpf gegen seine Stirn prallte. Der Stiernackige machte einen unsicheren Schritt auf sie zu, doch dann verdrehte er die Augen und verlor das Gleichgewicht. Er stolperte, verhedderte sich in seinen eigenen Beinen und schlug mit dem Gesicht hart auf eine Tischplatte. Der Aufgedunsene nutzte die Gunst der Stunde, um sich aus dem Staub zu machen.
Baelis blickte ihm einen Moment hinterher und entschied sich, ihn laufen zu lassen. Er hatte sich eigentlich ganz anständig benommen, und sie hatte heute ausnahmsweise mal einen guten Tag. Außerdem war ihr ein wenig schwindelig. Der Wein war ihr wohl nicht so ganz bekommen. Sie erhob sich unsicher von ihrem Sitzplatz und stützte sich an der Wand ab, bis der Gastraum aufhörte, sich um sie zu drehen. Als sie einigermaßen sicher stand, versetzte sie Dubash einen herzhaften Tritt in die Seite und drehte den winselnden Mann auf den Rücken, um seine Taschen zu durchwühlen. Sie fand einen ordentlich gefüllten Geldbeutel und einen hübschen Dolch. Den Dolch steckte sie in ihren Gürtel, den Beutel warf sie Naka zu, die ihn geschickt auffing. Dann packte sie Dubash unter den Armen und zog ihn durch die Tür nach draußen, wo sie ihn achtlos in den Straßenschlamm fallen ließ. Sie wischte sich die Hände an den Hosenbeinen ab und stieß ihn mit der Stiefelspitze an. »Und? Hast du es dir auch genauso vorgestellt?« Als sie zurück in den Schankraum trat, starrte Naka sie mit weit aufgerissenen Augen an. »Was ist? Hast du einen Geist gesehen?«
»Schlimmer«, sagte Naka und hob etwas zwischen Daumen und Zeigefinger in die Höhe. Einen Ring. Sie hielt ihn so, dass Baelis das Wappen darauf erkennen konnte. Das Wappen der Sando, einer der sieben Magistratsfamilien von Atail.
»Scheiße«, sagte Baelis und wurde schlagartig nüchtern.
Einige Adlige machten sich ein Spiel daraus, die regelmäßig wiederkehrenden Unruhen in der Unterstadt zu ihrem eigenen Vergnügen zu nutzen. Junge Männer, die ihre Fortschritte im Fechtunterricht an hilflosen Opfern ausprobieren wollten und sich zu diesem Zweck in Verkleidung unter die Menschen auf den Straßen mischten. Meistens suchten sie sich Schwächere für diesen Spaß, aber diesmal waren sie an die Falsche geraten – oder Baelis war an die Falschen geraten, je nachdem, wie man es sah. Es war wirklich verdammtes Pech. Sie stieß einen Seufzer aus und warf einen Seitenblick auf den ohnmächtigen Stiernackigen, bei dem es sich vermutlich um den glücklosen Leibwächter handelte. »Tut mir leid, Naka.«
»Schon gut.«
»Sag ihnen, dass du nichts damit zu tun hattest. Dass es ganz allein meine Schuld war.«
»Nichts anderes hatte ich vor.«
Baelis grinste. »Kluges Mädchen.«
»Scheiße«, murmelte Baelis erneut, als einige Straßen weiter drei dunkle Gestalten vor ihr in der Gasse auftauchten. Das war wirklich verdammt ungeschickt von ihr gewesen. Sie hätte sich doch denken können, dass die Sandos mit Vergeltung nicht lange zögern würden. Das hatten Magistratsfamilien so an sich. Bei Leuten wie denen ging es nämlich immer um die Ehre. Du hast meinen Namen beleidigt. Du hast meine Mutter schräg angeschaut. Du stehst mir im Weg.Du hast meinen Leibwächter niedergeschlagen, mir den Kiefer gebrochen und mich ausgenommen wie eine Festtagsgans, um mich anschließend kopfüber in den Straßenschlamm zu befördern – irgendein fadenscheiniger Grund fand sich immer. Dummerweise hatte Baelis viel zu viel getrunken gehabt, um einen klaren Gedanken fassen zu können. Sonst hätte sie sich gar nicht erst auf diesen Streit eingelassen – oder wäre zumindest jetzt schon auf dem schnellsten Weg zum Stadttor. Stattdessen war sie zurück zu ihrer Unterkunft gewankt, um dort in aller Ruhe ihren Rausch auszuschlafen.
Die Männer trugen schwarze Umhänge, robuste Messer mit langen Klingen und die finsteren Mienen schlecht bezahlter Söldner. Baelis musste sich nicht umdrehen, um zu erahnen, dass hinter ihrem Rücken mindestens drei weitere Männer den Weg versperrten. Söldner kämpften nicht gern in Unterzahl, da sie leicht verdientes Geld mehr zu schätzen wussten als ehrbare Zweikämpfe. Seufzend zog sie ihren eisenbeschlagenen Uai-Stock aus dem Gürtel und lockerte die Schultern.
Sie schätzte den Mittleren als den Anführer ein, da die anderen beiden auf sein Zeichen rechts und links auszuschwärmen begannen. Er würde sie wohl als Ablenkung benutzen, um ihr im geeigneten Augenblick gefahrlos das Messer zwischen die Rippen zu jagen. Um den Rechten musste sie sich keine Gedanken machen. Der sah zwar besonders finster drein, allerdings hielt er die Hand so verkrampft um den Griff seiner Waffe, dass er sich eher selbst damit verletzte, als ihr gefährlich zu werden. Vermutlich war das hier sein erster ehrlicher Kampf – wenn man das überhaupt so bezeichnen konnte.
Baelis würde sich zunächst den Linken vorknöpfen, der seine Waffe ein Stück zu selbstbewusst um das Handgelenk kreisen ließ. Geduldig wartete sie ab, bis er auf drei, vier Schritte herangekommen war, ehe sie einen Satz nach vorn machte und ihm das Messer mit einem gezielten Hieb aus der Hand schlug. Noch im selben Atemzug wirbelte sie herum und schmetterte dem Anfänger ihren Uai gegen die Kehle. Ein trockenes Knirschen ließ erahnen, dass dessen Straßenschlägerkarriere beendet war, ehe sie so richtig begonnen hatte. Als der Anfänger gurgelnd zu Boden ging, wich der Anführer instinktiv einen Schritt zurück – vermutlich aus der Erfahrung eines langen, einigermaßen unbeschadet überstandenen Söldnerlebens – und eröffnete ihr den Fluchtweg in eine schmale Seitengasse. Manchmal war Flucht eben die klügste Wahl.
So schnell sie ihre Füße trugen, hastete Baelis die Gasse hinunter. Farbenfrohe Häuserfronten rauschten rechts und links an ihr vorüber, dunkle Hauseingänge und schmale Fensterhöhlen. Sie kannte sich in diesem Teil der Stadt nicht besonders gut aus, hatte sich bislang nur wenige markante Punkte einprägen können. Doch der weiße Turm war so ein Punkt, an dem sie sich orientieren konnte. Keuchend hielt sie im Dächermeer über ihrem Kopf nach seiner schlanken Form Ausschau, und als sie ihn fand, hielt sie direkt darauf zu.
Sie rannte an Ladenpassagen vorüber und durch einen Torbogen hindurch, ehe sie einen Haken schlug und spontan die Richtung wechselte. Eine Brücke tauchte vor ihr auf. Das musste der Kerzensteg sein. Danach kam ein weitläufiger Platz, auf dem um diese Zeit immer Markt abgehalten wurde. Sie wurde langsamer und warf einen Blick über die Schulter. Schnell zog sie die Kapuze über den Kopf und mischte sich unter die Marktbesucher.
Das lief ja besser als gedacht. Lächelnd hielt sie vor einem der Stände inne. Sie griff nach einer Tanisfrucht und warf dem Händler eine Münze zu. Das gelbe Fleisch schmeckte herrlich süß und erfrischend. Sie aß die Frucht mitsamt der Schale auf und leckte sorgfältig jeden Finger ab, ehe sie sich umwandte und auf das westliche Ende des Platzes zuhielt. Dort begann die Kura, die dicht bevölkerte Straße, die durch das Tor der Flammen hinaus in die südlichen Berge führte. Es wurde langsam wirklich Zeit, diese Stadt zu verlassen. Sie hatte sich hier ohnehin nicht mehr so richtig wohl in ihrer Haut gefühlt. Vielleicht hatten die Götter ihr ja einfach nur einen letzten Wink geben wollen.
Aber vielleicht auch nicht.
Sie stieß einen Fluch aus, als sie den Riesen entdeckte, der beinahe einen Kopf über das Gewühl auf dem Marktplatz hinausragte. Groß wie ein Berg, ohne erkennbaren Hals und mit einem Gesicht bestraft, das mit einem Hammer bearbeitet zu sein schien. Er sah ihr direkt in die Augen, und sein Blick ließ keinen Zweifel daran, dass er nach ihr Ausschau gehalten hatte. Für einen Moment verharrten sie beide regungslos auf der Stelle und musterten sich gegenseitig. Der Mann war ein echter Riese. Beinahe so breit wie hoch, mit einer Haltung, die darauf schließen ließ, dass er es gewohnt war, sich in schweren Rüstungen zu bewegen. Möglicherweise sogar in Plattenpanzern. Kein Reiter, so viel war sicher. Für ein Lopec war er mit Sicherheit zu schwer. Ein Fußsoldat – höchstwahrscheinlich ein Brescher. Einer dieser Verrückten, die mit purer Gewalt Breschen in die Phalanx ihrer Gegner schlugen, damit wendigere Krieger hineinstoßen und die Formationen aufbrechen konnten. Die unzähligen Narben in seinem Gesicht erhärteten den Verdacht.
Einen Brescher besiegte man nicht in einem ehrlichen Zweikampf. Man brachte ihn mit einem langen Spieß zur Strecke oder besser noch mit einem Bogen. Hatte man keine dieser Waffen zur Hand, nahm man die Beine in die Hand und wartete auf einen günstigeren Zeitpunkt. Langsam wich Baelis zurück, und der Riese breitete die Arme aus und schob sich durch die Menge auf sie zu. Langsam und unaufhaltsam wie die Flut.
Mit einem schicksalsergebenen Seufzer wandte sich Baelis um und tauchte zurück in das Gewühl des Markts. Die Wendigkeit war ihr größter Vorteil. Deshalb rannte sie auch nicht in die Hauptgasse hinein, sondern drängte sich zwischen den Ständen hindurch in eine schmale Seitengasse. Aus dem Augenwinkel sah sie erneut die schwarzen Umhänge flattern. Wie zum Teufel hatten ihre Verfolger sie so schnell gefunden? Sie hastete in einen Durchgang und fand sich nach wenigen Schritten in einem schattigen Innenhof wieder. Grüne Bäume, ein lauschiger Springbrunnen, ein Säulengang, über den sich eine Galerie hinwegzog. Sie sprang auf den Sockel einer Statue, zog sich an einem ausgestreckten steinernen Arm in die Höhe und schwang sich auf die Brüstung hinauf. Unten im Hof polterten schwere Stiefel über das Kopfsteinpflaster. Aufgeregte Rufe waren zu hören und gleich darauf das charakteristische Surren einer Armbrustsehne. Ein Bolzen schoss an ihrem Kopf vorüber und schlug dumpf in die bunt bemalte Kassettendecke ein. Schnell rollte sie sich über die Brüstung und ließ sich auf den Boden fallen. Ein kleiner Junge starrte ihr mit großen Augen entgegen. In der Hand hielt er einen Stock, auf dessen Ende ein winziger Kopf mit einer Narrenkappe steckte. Sie fragte ihn nach dem Weg aufs Dach, und der Junge wies ihr wortlos mit dem Stock die Richtung. Die Schellen an der Narrenkappe klimperten leise.
Der Ausblick vom Dach war atemberaubend. Ein Meer aus Farben, das Funkeln des Sees und dahinter die schneebedeckten Gipfel der Himmelssäulen. Unter anderen Umständen wäre da ein wirklich schöner Ort zum Entspannen gewesen. Nun ja, man konnte im Leben eben nicht alles haben, und sie war ja ohnehin schon immer ein unsteter Geist gewesen. Seufzend riss sie sich von dem Anblick los, nahm Anlauf und sprang auf das benachbarte Dach, das nur wenige Schritte tiefer lag. Geschickt rollte sie sich ab, lief, ohne innezuhalten, über die Schindeln nach oben und sprang über eine schmale Gasse hinweg. Sie warf einen Blick nach unten, wo ein halbes Dutzend Umhänge auf der Straße standen und wild gestikulierend zu ihr heraufdeuteten. Wieder ertönte das hässliche Klackern von Armbrustbolzen, und sie trat schnell von der Dachkante zurück und blickte sich um. Sie entdeckte einen Kamin, an dem sie hinaufklettern konnte, um von dort aus mit einem gewagten Sprung das nächste Haus zu erreichen. Ihre Verfolger waren in der Zwischenzeit ebenfalls oben angekommen und schwärmten über die benachbarten Dächer aus. Es mussten sieben oder acht Mann sein, und sie waren ziemlich hartnäckig. Auf ihrer wilden Flucht über die Dächer kamen ihr zwei von ihnen bedrohlich nahe, und einmal wäre es ihnen beinahe gelungen, sie in die Enge zu treiben. Sie hatte die Wahl zwischen einem todesmutigen Sprung, der sie mit großer Wahrscheinlichkeit auf direktem Weg auf das Straßenpflaster befördert hätte, und dem Weg über ein durchlöchertes Spitzdach aus morschem Holz. Sie entschied sich für die dritte Möglichkeit und sprang den nächsten Gegner mit einem lauten Kampfschrei an. Gemeinsam stürzten sie auf ein über fünfzehn Fuß tiefer gelegenes Gebäude hinunter. Der Körper des Mannes federte die Härte des Sturzes zwar ein ganzes Stück ab, doch die altersschwachen Schindeln gaben unter dem plötzlichen Gewicht mit einem missgelaunten Knirschen nach. In einem Schauer aus Schindeln und Staub brachen sie durch das Dach und gleich darauf noch durch den darunter liegenden Holzboden. Zwei Stockwerke tiefer schlugen sie schmerzhaft in einem Berg aus Schutt und Geröll auf. Baelis wurde die Luft aus der Lunge gepresst, sie röchelte und hustete und wälzte sich stöhnend von ihrem Gegner herunter. Einen Augenblick lang blieb sie keuchend auf dem Rücken liegen, zählte ihre Gliedmaßen und horchte in sich hinein, ob irgendetwas Lebensnotwendiges verletzt worden war. Offenbar hatte sie Glück gehabt. Ihr Gegner allerdings weniger, denn seine Arme und Beine waren in unnatürlichen Winkeln verbogen, und sein Hinterkopf schien zerschmettert zu sein. Obwohl er noch atmete, würde er diesen Tag wohl nicht mehr lange überleben. Stöhnend stemmte sie sich in die Höhe und wankte zur Tür. Sie warf einen Blick hinaus auf den Flur und lauschte in die Dunkelheit. Die Bewohner des Hauses schienen entweder genug Verstand zu besitzen, um sich nicht in fremde Angelegenheiten einzumischen, oder waren es schon gewöhnt, dass hin und wieder Teile der Behausung über ihren Köpfen zusammenbrachen.
Draußen auf der Straße hörte Baelis bereits die aufgeregten Rufe ihrer Verfolger. Also schlich sie zum hinteren Teil des Gebäudes, wo sie ein schmales Fenster fand, durch das sie sich mit etwas Mühe hindurchwinden konnte. Sie gelangte in einen Innenhof mit einem winzigen Stück Garten und einem Hühnerstall. Von einer Wäscheleine riss sie ein großes Tuch herunter und zog sich am anderen Ende des Gartens die Mauer hinauf. Nach einem prüfenden Blick in die dahinter liegende Gasse rollte sie sich über die Mauer hinweg und ließ sich auf der anderen Seite vorsichtig wieder hinab. Sie schlang sich das Tuch um die Schultern, zog es über den Kopf und wandte sich um. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie eine Bewegung und sah eine gewaltige Faust auf sich zurasen. Noch ehe sie reagieren konnte, krachte sie schmerzhaft gegen ihren Kiefer. Ihr Kopf wurde herumgerissen und prallte gegen die Mauer.
SALTER
Das erste Mal fiel Salter die Frau ins Auge, als er gerade einen Hügel überquert hatte und ein Wegkreuz passierte. Sie saß auf einem Stein, ihren Wanderstock quer über die Knie gelegt und ein schmales Lächeln auf den Lippen. Der Anblick machte ihn nervös.
Es war nicht so, dass Frauen ihn normalerweise nervös machten. Nicht sehr jedenfalls. Es sei denn, sie sprachen ihn an. Oder lächelten. Salter war im Umgang mit Frauen nicht besonders geübt. Seine Studien hatten ihm nur wenig Zeit gelassen, sich um weltliche Dinge zu kümmern. Dinge wie das Ansprechen von Frauen, das Artikulieren verständlicher Laute in ihrer Gegenwart oder die Vermeidung peinlicher Missgeschicke. Solche Dinge eben. Dennoch hätte unter anderen Umständen kein Grund zur Sorge für ihn bestehen müssen. Er hätte den Kopf senken und die Frau einfach ignorieren können. Sie war schließlich um einiges älter als er und sah nicht gerade bedrohlich aus. Ein spindeldürrer Strich in der Landschaft, mit angegrautem Haar und dem schlichten Gewand einer Pilgerin. Außerdem schien sie allein unterwegs zu sein.
Das war vermutlich auch der Grund, warum ihn bei ihrem Anblick dennoch ein ungutes Gefühl beschlich. Eine einsame Frau ohne Begleitung auf der Fernstraße zwischen Bashun und den Säulen des Himmels – wenn das mal nicht äußerst verdächtig war. Nervös rückte er den Schwertgurt zurecht, sodass die Frau die Länge seines Ralgri gut abschätzen konnte. Es war eine kampferprobte Waffe, die Klinge vielfach nachgeschliffen und der sorgfältig mit Leder umwickelte Griff schon speckig. Ein aufmerksamer Beobachter musste ganz unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass sie schon häufig gezogen worden war. Dafür konnte Salter sich verbürgen, denn er hatte das Ralgri einem Palastwächter gestohlen, der für seine Fähigkeiten außerordentlich gut bezahlt wurde. Seine eigenen Schwertübungen lagen dagegen schon eine ganze Weile zurück. Trotzdem hoffte er, dass allein der Anblick der Waffe potenzielle Wegelagerer von ihrem Vorhaben abbringen würde. Die Pilgerin nickte ihm zu, als er vorüberritt. Er senkte den Kopf und tat so, als hätte er den Gruß übersehen. Unauffällig trieb er sein Lopec zu einer schnelleren Gangart an. Als die Pilgerin außer Sicht war, ließ er sich im Sattel zurücksinken und stieß einen erleichterten Seufzer aus.
Er war jetzt schon beinahe eine Woche auf der Flucht. Die Landschaft hatte sich merklich verändert, war schroffer geworden und viel karger, als er es gewohnt war. Das satte Grün und Rot des kaiserlichen Ahorns und die blühenden Wiesen rund um Bashun waren von Tag zu Tag mehr dem deprimierenden Anblick verkrüppelter Kiefern und dorniger Büsche gewichen, die sich dem stetig zunehmenden Wind aus Norden entgegenstemmten. Schon seit über drei Tagen hatte Salter keine Felder oder Bauernhöfe mehr zu Gesicht bekommen. Die wenigen Gasthäuser, an denen er vorübergeritten war, ähnelten eher Ruinen als den Behausungen menschlicher Wesen. Schäbige Baracken hinter Holzpalisaden, die alles andere als einladend wirkten. Im Grunde war ihm das aber auch ganz recht gewesen, denn je weniger Interesse die Wirte an ihren Gästen zeigten, desto weniger verfängliche Fragen stellten sie.
Das Gasthaus, in dem er zur Nacht abstieg, wurde von einem zahnlosen Alten und seinen drei grimmig dreinblickenden Söhnen betrieben. Das Essen wurde im Haupthaus ausgeteilt: ein stinkender Brei aus fermentierten Bohnen, den der Wirt aus einem dreckverkrusteten Kessel kratzte. Dem Aussehen nach war er schon seit unzähligen Generationen in Gebrauch und seitdem kein einziges Mal gereinigt worden. Der Geschmack des Breis ließ erahnen, dass seine Grundlage noch immer aus dem Jahr des Nock stammte, als Kaiser Tohu die Ukaren besiegt hatte. Nachdem er den widerlichen Fraß heruntergewürgt hatte, schlurfte Salter mit hängenden Schultern zurück auf den Hof, um sein Lager in der Nähe einer wärmenden Feuerstelle aufzuschlagen. Auf dem Weg nach draußen fiel ihm erneut die Pilgerin auf, die ihm im Vorbeigehen zuzwinkerte. Irritiert runzelte er die Stirn. Im Kopf überschlug er die Geschwindigkeit, mit der sie gegangen sein musste, um noch am selben Tag dieses Gasthaus zu erreichen. Er kam nicht so recht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Andererseits waren die heiligen Männer und Frauen das Wandern ja gewöhnt, und vielleicht hatte sich ein gutwilliger Händler erbarmt und die Frau ein Stück auf seinem Wagen mitgenommen. Ja, das musste die Erklärung sein. Alles andere ergab einfach keinen Sinn. Um einem Gespräch aus dem Weg zu gehen, senkte Salter den Kopf und marschierte grußlos an ihr vorüber.
Er schlug sein Lager neben einer Gruppe bruggischer Pilger auf, die vertrauenswürdig genug erschienen, ihn nicht im Laufe der Nacht um seine Habseligkeiten zu bringen. Die Brugger waren ein ernsthaftes, schwer arbeitendes Volk. Nicht sehr gesprächig, aber von seltener Aufrichtigkeit, die schon beinahe etwas Rührendes an sich hatte. Sie beteten einen Gott an, der aus zwei sich widerstrebenden Persönlichkeiten bestand. Beide besaßen keinerlei Sinn für Humor, was vermutlich daran lag, dass sie sich den alles andere als stattlichen Körper eines Pidi teilen mussten. Ihr stundenlanger, gleichförmiger Singsang wiegte Salter in einen tiefen, traumreichen Schlaf. Er träumte von Pilgern und Fischen und von jähzornigen Göttern, die sich um einen Kessel voller Bohnenpampe balgten und schließlich jämmerlich darin ersoffen. Später kletterte auch noch ein Philosoph in den Kessel hinein, um diesen Traum zu deuten. Doch auch er ertrank, und am Ende war Salter so klug wie zuvor.
Als er am nächsten Morgen schweißgebadet erwachte, hatten die Brugger bereits ihr Lager abgebrochen. Er wusch sich am Brunnen und nahm ein Frühstück ein, das aus den Resten des gestrigen Abends bestand. Zwei zu handtellergroßen Bällen geformte Bohnenbällchen, die in Sav getränkt und über dem Feuer ausgebacken waren. Als er aufgegessen hatte, fütterte er sein Lopec und schwang sich in den Sattel.
Das langhalsige Tier schnaubte unwillig und versuchte mehrmals, nach ihm zu schnappen. Nur mit Mühe gelang es ihm, den scharfen Zähnen auszuweichen. Vor etwa vier Tagen war es ihm ausgebüxt und mitten in ein Dornengebüsch hineingaloppiert. Die meisten Dornen hatte er finden und aus seinem Fell ziehen können, aber der Rest machte dem Tier noch immer schwer zu schaffen. Seitdem war es furchtbar übel gelaunt und zeigte sich von seiner schlechtesten Seite. Zunächst hatte Salter daran gedacht, ihm einen Namen zu geben, um es besser beschimpfen zu können. Doch dann hatte er sich dagegen entschieden. Wenn er es irgendwann verkaufen musste, würde ihm das mit einem Lopec, dessen Namen er kannte, deutlich schwerer fallen. Ein namenloses Tier verkaufte sich dagegen schnell. Da konnte es ihn noch so sehr mit traurigen Augen anschauen.
Andererseits war es vielleicht auch nur glücklich, seiner Gesellschaft endlich entkommen zu dürfen. Immerhin waren seine ersten Erfahrungen mit ihm nicht gerade positiv verlaufen. Zuallererst war es mitten in der Nacht aus seinen Träumen geschreckt und aus dem gemütlichen Stall hinaus in die eisige Nacht gejagt worden. Dann war es beinahe zwei Tage lang ohne Unterbrechung in halsbrecherischem Galopp über die Steppe gehetzt worden, um am Ende an einem Dornengebüsch den Hintern – oder wie man das bei einem Lopec nannte – aufgerissen zu bekommen. Je länger er darüber nachdachte, desto überzeugter war Salter, dass sein Reittier einen regelrechten Freudensprung machen würde, wenn er es an einen langweiligen Händler verkaufte, der ihm reichlich frisches Blattwerk zu fressen gab und es hin und wieder auf einen erfrischenden Ausritt mitnahm.
Salter ritt das Tier, bis es sich weigerte, auch nur einen Schritt weiter zu gehen. Auf einer Hügelkuppe stieg er schließlich ab und legte eine Rast ein. Er band das Lopec an einem Strauch fest und kramte seine Essensvorräte aus der Satteltasche. Ein in Reispapier eingeschlagener Rest Bohnenpampe, zwei verschrumpelte Äpfel und ein trauriges Stück Trockenfisch. Nicht unbedingt das, was sein stattlicher Magen vom Kaiserhof gewohnt war, aber immer noch besser als nichts. Seufzend zog er das Ralgri aus dem Gürtel und legte es griffbereit neben sich ins Gras. Er faltete das Reispapier auf den Oberschenkeln auseinander und starrte missmutig auf die karge Mahlzeit hinunter.
Der Weg, den er eingeschlagen hatte, wurde nicht häufig genommen. In den vergangenen Stunden war ihm bis auf einen altersmüden Eselskarren und zwei stumme Pilger nur ein reitender Bote begegnet. Der Großteil der Reisenden hatte den einfacheren Weg unten entlang des Flusses genommen. Der war für Salters Geschmack allerdings ein ganzes Stück zu stark befahren. Außerdem patrouillierten auf den Straßen die Garden des Kaisers, denen er besser nicht begegnen sollte.
Obwohl die Sonne schien, war es hier oben, so dicht unter den Säulen, selbst um diese Jahreszeit schon empfindlich kühl. Salter besaß neben seiner dünnen Jacke nur noch eine Satteldecke aus dem Stall. Sie war furchtbar kratzig, aber der eisige Wind zwang ihn, sie sich eng um den Körper zu schlingen. Zum Glück war er recht solide gebaut, was ihm zusätzlichen Schutz gegen die Kälte verlieh. Wehmütig stopfte er sich die Bohnenpampe in den Mund. Wenn die Reiter des Kaisers schnell waren – und daran bestand kein Zweifel –, dann hatte sich die Nachricht bereits bis Olderog herumgesprochen. Die Wächter am Mondtor hielten vermutlich schon nach ihm Ausschau. Sicher würden sie auch Boten weiter nach Kaylt und Varun aussenden, nur um ganz sicherzugehen. Jede verdammte Siedlung südlich der Berge musste sein Gesicht inzwischen kennen. Was für eine Ironie. Sein ganzes Leben lang hatte er sich gewünscht, eines Tages berühmt zu sein – seinen Namen neben Mora oder Ijoh dem Älteren stehen zu sehen. Vielleicht sogar sein Bildnis im kaiserlichen Palast. Ein Vorbild, das die Menschen inspirierte und anregte, es ihm gleichzutun. Eine echte Berühmtheit eben.
Das hatte er nun erreicht – nur völlig anders, als er es sich in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hatte. Die Erinnerung daran verdarb ihm den Appetit. Sorgfältig packte er die Reste seiner Mahlzeit zusammen und leckte sich die Finger ab. Die Haut seiner Hände war hell und weich und völlig ohne Schwielen. Nicht die Hände eines Arbeiters und schon gar nicht die eines Kriegers. Aber ganz sicher auch nicht die eines … Er schloss die Augen und atmete tief durch, so wie man es ihm in den Hallen der Kraniche beigebracht hatte. Eine Weile saß er in schwermütige Gedanken versunken da, bis er schließlich von der Müdigkeit übermannt wurde und trotz des eisigen Winds eindöste.
Das leise Klacken von Kieselsteinen schreckte ihn aus dem Dämmerschlaf. Für einen Moment wusste er nicht mehr, wo er war, doch die schneidende Kälte erinnerte ihn augenblicklich an seine verfahrene Situation. Hastig griff er nach dem Schwert, zog es ein Stück aus der Scheide. Argwöhnisch musterte er die Umgebung.
Klick. Klack.
Wie ein Tenburrisches Uhrwerk. Eine einsame Gestalt näherte sich auf der Straße seinem Rastplatz. Bei jedem Schritt klackte ein schwerer Wanderstab auf den Stein. Salter brauchte eine Weile, bis er sie wiedererkannte. Da sie mit der Sonne kam, waren ihre Gesichtszüge nur schwer auszumachen, doch als sie endlich nah genug war, erkannte er die Pilgerin wieder. Einerseits beruhigte ihn das ein bisschen, andererseits machte sich erneut ein seltsames Unbehagen in seiner Brust breit. Wie hatte diese dürre Frau ihn so schnell eingeholt? Er konnte sich nicht daran erinnern, sie auf dem Weg irgendwo überholt zu haben. Also musste sie doch nach ihm aufgebrochen sein. Hatte er etwa mehr als nur ein paar Augenblicke gedöst? Er warf einen Blick in den Himmel. Die Sonne stand noch immer beinahe am selben Fleck wie zu dem Zeitpunkt, als er vom Lopec gestiegen war. Misstrauisch starrte er der Frau entgegen.
Als sie auf der Hügelkuppe angekommen war, stieß sie die Luft aus und warf einen verträumten Blick in die Runde. »Ein schöner Ort für eine Rast, nicht wahr?« Ihre Stimme klang angenehm weich und dunkel. Sie strich mit der Hand über ihr Haar und warf ihm ein Lächeln zu. »Darf ich mich zu dir setzen?«
Salter warf einen Blick über die Schulter und musterte den Pfad und die nähere Umgebung. Ihre Bitte abzulehnen wäre unter Reisenden nicht nur äußerst rüde gewesen, sondern auch ziemlich verdächtig. Trotzdem musste er versuchen, sie höflich, aber entschieden loszuwerden. Während er noch fieberhaft über eine geeignete Antwort nachdachte, hatte sich die Pilgerin bereits neben ihm im Gras niedergelassen und ihren Trinkschlauch gezückt. Ihm fiel auf, dass sie unter ihrem dünnen Überwurf nicht einmal Beinkleider trug. »Eine wirklich schöne Stelle«, sagte sie nach einer Weile. »Ein bisschen luftig, aber durchaus idyllisch. Bist du auf dem Weg nach Atail?« Als Salter die Augen zusammenkniff, wurde ihr Lächeln noch eine Spur breiter. »Keine Sorge, ich habe nicht vor, dich auszurauben. Ich bin eine einsame Pilgerin, und du besitzt immerhin ein Schwert.« Sie nickte zu der Waffe an Salters Seite.
Instinktiv zuckte seine Hand zum Griff des Ralgri, doch schon im selben Augenblick kam er sich furchtbar dumm vor. Die Geste musste den Eindruck erwecken, dass er fürchtete, sie könnte ihm die Waffe stehlen wollen. Zum Glück schien sie seine peinliche Reaktion nicht bemerkt zu haben. Sie gähnte und streckte dabei ungeniert die Arme in die Höhe. »Mein Name ist übrigens Tara. Ich bin auf Pilgerfahrt nach Atail. Ich komme gerade erst aus Bashun zurück. Kennst du Bashun?«
Und ob er die Kaiserstadt kannte. Immerhin war er vor wenigen Tagen erst Hals über Kopf aus ihr getürmt.
»Aber natürlich kennst du Bashun«, sagte Tara.
»Woher …?«
»Deine Kleidung. Kein Mensch außerhalb der Kaiserstadt trägt so eine lächerliche Tracht. Vor allem nicht solche Schuhe. Die müssen furchtbar unbequem sein. Du solltest sie bei nächster Gelegenheit gegen Nocklederstiefel eintauschen. Die stinken zwar immer ein bisschen, aber sie sind unglaublich bequem und halten die Füße warm.«
»Hm«, machte Salter und blickte verstohlen an sich hinab. Die weißen Pluderhosen, die spitz zulaufenden Schuhe mit den Schnürbändern und die brokatbestickte Jacke mit dem silbernen Kranichemblem am Kragen … Bislang war ihm noch gar nicht in den Sinn gekommen, dass ihn seine Kleidung verraten konnte. Aus irgendeinem Grund hatte er sich eingebildet, dass jeder so herumlaufen würde. Brokatbestickte Jacken waren am Kaiserhof schließlich keine Seltenheit. Hier draußen auf dem Land schienen sie zugegebenermaßen ein wenig aus dem Rahmen zu fallen. Verlegen kratzte er sich am Kopf und wechselte schnell das Thema. »Wie lange, sagtest du, bist du schon unterwegs?«
Tara zuckte mit den Schultern. »Tage. Vielleicht Wochen. Ich zähle sie meistens nicht.«
Ihre Antwort beruhigte ihn, denn dann hatte sie wohl noch nichts von den jüngsten Ereignissen gehört. Ohnehin konnte kein Mensch so schnell gelaufen sein. Er machte sich viel zu viele Gedanken. »Ich bin übrigens B… Salter«, sagte er. »Mein Name ist Salter, ja. Ich bin ebenfalls auf Wanderschaft.«
Die Frau nickte. Sie legte sich ins Gras zurück und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. So verharrten sie eine Weile still nebeneinander. Die Sonne verschwand hinter den Wolken, und schnell wurde es bitterkalt. Salter zog die Decke fester um seine Schultern und starrte missmutig ins Leere.
Tara war eine furchtbar lästige Begleitung. Zuerst hatte Salter angenommen, dass sie nach ihrer gemeinsamen Rast wieder verschwinden würde, doch sie hatte sich an ihn gehängt wie eine elende Klette, und er hatte aus irgendeinem unerfindlichen Grund nicht den Mut aufgebracht, sie abzuweisen. Obwohl sie so dünn war, schien sie über unerschöpfliche Energien zu verfügen. Ihre Schritte waren stetig wie ein Uhrwerk, und ihr Stab schlug bei jedem Schritt auf den Boden.
Klick. Klack.
Beinahe schon hypnotisch.
Ihr Alter war wirklich verdammt schwer zu schätzen. Wenn sie lief, wirkte sie wie eine junge Frau, doch die Krähenfüße an ihren Augenwinkeln verrieten ein deutlich höheres Alter. Ihre Augen wiederum strahlten eine Jugendlichkeit aus, die beinahe schon unheimlich war. Ihre Haut war von der Sonne gebräunt, was es schwierig machte, ihre Herkunft zu bestimmen. Die Haare jedenfalls hatte sie nach citanischer Mode geflochten und ihren Überwurf wie ein Sirha um den mageren Körper geschlungen. Sie trug eine Gürteltasche aus edlem Quelecc, und ihr Wanderstab – von der Länge her beinahe schon ein Kamai – schien aus dem Holz der Zefire zu sein, einer robusten Baumart, die nördlich der Säulen wuchs. An den Füßen trug sie die landestypischen Sandalen der Bedreg und um Hand- und Fußgelenke varunische Gebetsketten. Tara schien eine Frau mit tausend Gesichtern zu sein. Vielleicht war sie aber auch nur eine Diebin, die schon eine Menge dummer Reisender um ihren Finger gewickelt hatte. Sie war unglaublich geschwätzig, eine eher untypische Eigenschaft für eine Pilgerin. Möglicherweise war sie aber auch nur froh, der Einsamkeit ihrer Reise für eine Weile entkommen zu sein. Sie stellte eine Menge Fragen, und Salter fiel es schwer, ihnen auszuweichen. Zum Glück war er in der Kunst der unverbindlich-höflichen Konversation geübt. Wenn man in der Kaiserstadt eines lernte, dann Unverbindlichkeit. In gewisser Weise machte es ihm sogar Spaß, sich mit ihr zu messen und mit vielen Worten so wenig wie möglich von sich preiszugeben. Zumindest lenkte ihn dieses Spiel eine Weile von der Sorge ab, von seinen Verfolgern eingeholt zu werden.
Tara selbst schien gar nicht so recht zu wissen, woher sie stammte. Jedenfalls tat sie ihm gegenüber so. Sie hatte Kaiser Gioros gesamte Regierungszeit seit seiner Thronbesteigung miterlebt, und sogar das Debakel, das sein unseliger Vater damals noch angerichtet hatte. Das ließ darauf schließen, dass sie schon an die vierzig Sommer gesehen hatte und aus dem Norden kam. Sie verhehlte nicht ihre Abscheu gegen die gelegentlichen Schreine am Wegesrand, denn sie glaubte nur an eine einzige Gottheit. Eine archaische Gestalt, von der Salter noch nie zuvor gehört hatte, obwohl ihm die Studien der Religionen damals recht leicht von der Hand gegangen waren. Ihre Gottheit besaß einen Schrein in Atail und schien recht streitlustig und humorlos zu sein – eine Eigenschaft, die alleinherrschenden Gottheiten wirklich erstaunlich oft zu eigen war. Während der ersten Nächte traute er sich kaum, ein Auge zuzumachen, aus Angst, von Tara ausgeraubt zu werden. Im Laufe der Zeit wurde er jedoch nachlässiger, denn sie zeigte keinerlei Interesse an irdischen Dingen. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum sie keine Scham an den Tag legte, wenn sie sich vor seinen Augen am Wegesrand erleichterte oder splitterfasernackt in einem Bergsee wusch. Er hatte jedenfalls ziemlich oft damit zu tun, die Sattelgurte seines Reittiers gründlich nachzuziehen oder sich angestrengt um einen lästigen Stein in seinem Schuh zu kümmern. Das Einzige, was ihm an Tara ansonsten noch auf die Nerven ging, war ihre penetrante Forderung, sie nach Atail zu begleiten. Er konnte ihr schlecht gestehen, dass man dort in Kürze wohl genauso nach ihm suchen würde wie überall sonst im Kaiserreich.
Kurz vor den ersten Ausläufern der schneebedeckten Säulen des Himmels übernachteten sie in einem besonders schäbigen Gasthaus. Das Gebäude bestand nur aus einem einzigen, stinkenden Raum mit einer offenen Feuerstelle ohne Abzug. Die Luft war schwer von Rauch und Schweiß und dem säuerlichen Gestank vergorener Oantan-Milch. Die meisten Gäste waren Wollhändler aus Varun, ein gedrungener Menschenschlag mit wettergegerbten Gesichtern und schlechten Zähnen. Einen Botenreiter hatte von ihnen schon längere Zeit keiner mehr zu Gesicht bekommen, was Salter mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis nahm. Offenbar war die schlechte Nachricht noch immer nicht weiter vorgedrungen. Trotz der großen Enge fanden sie einen freien Platz in der Nähe der Feuerstelle – Tara hatte ein Händchen für solche Dinge – und rollten ihre Decken aus. Das Essen bestand aus der üblichen Bohnenpampe, die in Salters Magen zunehmend Protest auslöste. Während er lustlos in seiner Schüssel herumstocherte, bediente sich Tara ungeniert an den Opfergaben, die auf dem winzigen Altar in einer Ecke des Raums aufgestapelt worden waren. Erstaunlicherweise hielt sie niemand davon ab. Entsetzt starrte er auf die Speisen, die sie ihm mit einem triumphierenden Lächeln unter die Nase hielt. »Es ist Frevel, davon zu essen!«
Ungerührt zuckte sie mit den dünnen Schultern. »Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Bei all diesen falschen Göttern und ihren Gesetzen verliert man ohnehin irgendwann den Überblick. Also was soll’s. Willst du nun was abhaben oder nicht?«
Nervös blickte sich Salter um, doch die anderen Gäste schienen sich nicht im Geringsten an ihrer Tat zu stören. Das war alles mehr als verwirrend. Ehe er zu einer passenden Erwiderung ansetzen konnte, drückte sie ihm schon eine gut gefüllte Schüssel Sijangdoc in die Hände und lächelte ihm aufmunternd zu. »Komm schon. Wenn wir nicht vom Blitz erschlagen werden, sind wir auf der sicheren Seite.«
»Ich weiß nicht …« Hungrig schielte er auf die dampfende Köstlichkeit hinunter. Der Duft stieg ihm über die Nase direkt in den Kopf, und sein Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Schon seit Tagen hatte er nichts Anständiges mehr zu sich genommen: immer nur die gleiche Bohnenpampe, gelegentlich abgewechselt von Bohnensuppe oder ausgebackener Bohnenpampe. Sein Magen hing schon bis unter die Kniekehlen, und er hatte langsam genug von dieser Quälerei. Außerdem war es ohnehin zu spät. Wie sollte er die Götter denn noch mehr erzürnen als ohnehin schon? Widerstrebend griff er nach dem Löffel, den die dürre Frau ihm entgegenhielt, und tauchte ihn in die Schüssel. Mit zusammengekniffenen Augen schob er sich einen Bissen in den Mund. Als er weder vom Blitz getroffen noch von der Erde verschlungen wurde, löffelte er nach einem letzten Moment des Zögerns die Schüssel hastig leer.
Nachdem er sich ausgiebig den Bauch vollgeschlagen und dabei schicksalsergeben Taras Schwärmereien von den Vorzügen Altais über sich ergehen lassen hatte, zog er sich schließlich die Satteldecke über den Kopf und rollte sich auf seiner Schlafstelle zusammen. Die Pilgerin hatte die Gelegenheit genutzt, um für eine Weile ungeniert unter der Decke eines stattlichen Varuners zu verschwinden – auch so eine Angewohnheit, die sie im Laufe ihrer gemeinsamen Reise mehr als einmal an den Tag gelegt hatte. Und während die Geräusche ihrer hitzigen Beschäftigung seine Ohren klingeln ließ, grübelte Salter über sein verfahrenes Leben nach.
Vor nicht einmal zwei Wochen hatte es quasi auf einen Schlag geendet. Bis dahin hatte er einen Namen gehabt. Einen Stand und eine Familie, auf deren Hilfe er sich voll und ganz verlassen konnte. Er hatte einen einigermaßen verantwortungsvollen Posten am Kaiserhof bekleidet und war mit seinem Leben voll und ganz zufrieden gewesen. Er hatte die Lehren des Ijoh studiert und sich in der Kunst der Buchführung geübt. Er liebte das Spiel mit Zahlen. Zahlen waren verlässlich und änderten nie ihre Meinung.
Nun allerdings war er ein Niemand. Ein Flüchtiger. Ein Monster, vor dem sich die Menschen fürchteten und auf das sie Jagd machen würden, wenn sie seine wahre Natur aufdeckten. Um zu überleben, hatte er alles hinter sich lassen müssen, was sein ganzes bisheriges Leben ausgemacht hatte. Er wusste nicht, ob er das durchstehen konnte. Ob er wirklich stark genug dafür war.
Sie wanderten zwei Nächte und beinahe drei weitere Tage lang durch immer karger werdende Landschaften, bis sie in einer Senke auf ein einsames Kloster stießen. Das musste das Tal sein, hinter dem sich die Straße aufteilte. Die Straße nach Vyndt verlief westwärts, während Tara weiter in nördlicher Richtung hinauf in die Säulen steigen musste, um Atail zu erreichen. Hier würden sich ihre Wege also trennen. Zum Glück hatte sie schon längere Zeit nicht mehr versucht, ihn von den Vorteilen Atails zu überzeugen, was ihren Abschied sicherlich vereinfachen würde. Dennoch vermisste Salter die seltsame Frau schon jetzt ein kleines bisschen. Ihre Anwesenheit war trotz allem eine nette Abwechslung von der Eintönigkeit seiner Reise gewesen.
Die Mönche bereiteten ihnen einen herzlichen Empfang. Sie lebten recht abgeschieden vom Rest der Welt und freuten sich über den Anblick neuer Gesichter. Eine ganze Traube junger Mönche folgte ihnen – vor allem Tara –, als sie das Lopec absattelten und das Haus des Vorstehers betraten. Der Abt war ein glatzköpfiger Mann, durch dessen Gesicht sich tiefe Krater zogen. Er bat sie in den Gästeraum und verscheuchte mit einer Handbewegung die jungen Mönche, die sich um die besten Beobachtungsplätze an der Tür stritten. Während sie einen etwas fade schmeckenden Tee tranken, rührte er mit einem Holzstäbchen in seiner Tasse herum und musterte sie. »Hm«, sagte er nach einer Weile ausgiebigen Rührens. Und dann noch einmal: »Hm.«
»Hm?«, fragte Salter, dem dieses Verhalten langsam auf die Nerven ging. Sein Magen knurrte, und er fürchtete langsam, dass sich die Mönche ausschließlich von so einem geschmacklosen Tee ernährten und nichts für ordentliches Essen übrighatten.
»Es kommt mir vor, als hätte ich dich schon einmal irgendwo gesehen …«
Salter erstarrte. Hektisch ging sein Blick zu den offenen Fenstern hinüber. Hastig schätzte er die Entfernung ab, und von dort aus die Länge des Wegs über den Hof bis zu seinem Reittier. Kurz dachte er darüber nach, den Abt als Geisel zu nehmen, verwarf den Gedanken jedoch wieder. Unter den jüngeren Mönchen würde sich mit Sicherheit der eine oder andere finden, der so eine Gelegenheit beim Schopf ergriff, um den Alten zu opfern und sich selbst zum neuen Abt aufzuschwingen. Mönche lebten vielleicht abgeschieden vom Rest der Welt, doch in ihren Bedürfnissen und Bestrebungen unterschieden sie sich sicherlich kaum von den Intriganten am Kaiserhof. »So?« Beiläufig stellte er die Tasse vor seinen Knien auf dem Boden ab. »Das kann ich mir kaum vorstellen.«
»Hm«, sagte der Abt und stellte ebenfalls seine Tasse ab. Er blickte Salter jetzt geradewegs in die Augen. Angespannte Stille machte sich in dem kleinen Raum breit.
»Die Frau und der Eber«, sagte Tara, die von der angespannten Stimmung nichts mitzubekommen schien. Lächelnd schenkte sie sich von dem faden Tee nach und nippte an ihrer Tasse.
»Hm?«, machte Salter.
»Hm?«, machte der Abt.