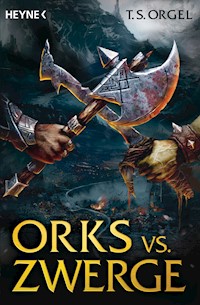11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Blausteinkriege
- Sprache: Deutsch
Im Kaiserreich Berun ist nichts mehr so, wie es war. In der Hauptstadt haben sich die Fürsten versammelt, um den anrückenden Kolnorern entgegenzutreten – umsonst. Es ist längst zu spät, der Feind ist bereits mitten unter ihnen. Sogar das Protektorat Macouban ist mittlerweile vollständig von den Hexern der Huacoun und ihren Vasallen besetzt. Allein Xari, Ordensritter Cunrad und die Schildbrecher stehen ihnen entgegen. Doch die Wahrheit ist noch viel schrecklicher. Denn während das Reich im Krieg versinkt, erwachen uralte Kräfte, und das Ende der Welt steht bevor …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 828
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Der Zerfall des einst mächtigen Kaiserreichs Berun ist nicht mehr zu übersehen. Die Reichsfürsten am Hof sind zerstritten und machthungrig. Im Norden wird von einer Rebellion der Waldmenschen gemunkelt, im Osten rücken die Kolnorer an, und im Süden haben die Feinde längst das Macouban besetzt. Nun soll ein großes Turnier die Fürsten bei Laune halten – doch Sara, die mit Blausteinmagie begabte junge Frau in Diensten der Kaiserinmutter, kennt bereits die heimlichen Pläne des wankelmütigen Kaisers, mit denen die letzten wahren Getreuen beseitigt werden sollen. Währenddessen haben der Ordensritter Cunrat ad Koredin und Xari vom Volk der Metis alle Hände voll zu tun, um zwischen den immer zahlreicheren Truppen, die das Macouban überfallen haben, hindurchzuschlüpfen. Seit sie die grauen Schiffe der Huacoun entdeckt haben, wollen sie die Kaiserinmutter vor den sagenumwobenen Hexern und Fischmenschen und dem drohenden Wiedererwachen der alten Götter warnen. Wohin sie auch kommen, waren die Feinde jedoch bereits da und haben alle auf ihre Seite gezogen. Als Sara in Gefangenschaft gerät und Cunrat und Xari mit dem Rücken zur Wand stehen, scheint jede Hoffnung verloren. Schon bald stehen die feindlichen Mächte überall im Reich vor der alles entscheidenden Schlacht. Einer Schlacht, in der längst vergessene magische Kräfte, verborgene Schicksale und neuer Mut die Zukunft von Berun und seinen Menschen formen werden …
Die Autoren
Hinter dem Pseudonym T.S. Orgel stehen die beiden Brüder Tom und Stephan Orgel. In einem anderen Leben sind sie als Grafikdesigner und Werbetexter beziehungsweise Verlagskaufmann beschäftigt, doch wenn beide zur Feder greifen, geht es in phantastische Welten. Für ihren Debütroman »Orks vs. Zwerge« sind sie mit dem Deutschen Phantastik Preis ausgezeichnet worden und haben sich damit in die Herzen der deutschen Fantasy-Leser geschrieben. Mit »Die Blausteinkriege« stellen sie nun ihre neueste Fantasy-Weltenschöpfung vor.
Die Blausteinkriege 1 – Das Erbe von Berun
Die Blausteinkriege 2 – Sturm aus dem Süden
Die Blausteinkriege 3 – Der verborgene Turm
Mehr über T. S. Orgel auf:
www.ts-orgel.de
Mehr über »Die Blausteinkriege« auf:
www.blausteinkriege.de
T. S. ORGEL
DER VERBORGENE TURM
Originalausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt
und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen
unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung
sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung,
Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglich-
machung, insbesondere in elektronischer Form, ist
untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter
enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine
Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen,
sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der
Erstveröffentlichung verweisen.
Für dich
Originalausgabe 11/2017
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2017 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81637 München
Umschlagillustration: Franz Vohwinkel
Karten: Andreas Hancock
Umschlaggestaltung: Stardust, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-17101-8V003
https://twitter.com/HeyneFantasySF
Inhalt
Was bisher geschah
Karten
Planskizze von Gostin
Stadtplan von Berun
1Tiburone
2Erinnerungen
3Die erste Pflicht
4Ein Festtag
5Kaiser und Krone
6Der Erste Blausteinkrieg
7Ein Bündnis mit den Gruben
8Der Geruch von Angst
9Huacoun
10Unter Schwestern
11Untergang
12Rauch in den Straßen
13Das Blausteinzimmer
14Fischfutter
15Verrat und Gegenverrat
16Rache ist immer ein guter Grund
17Segel
18Das Tor zur anderen Seite
19Wieder zurück
20Rauch, Tod und Schatten
21Grimmige Aussichten
22Zuhause
23Keine gute Idee
24Unverhofft
25Jerik
26Alte Bekannte
27Freud und Leid
28In die Gruben
29Auf in die Schlacht
30Fressen und gefressen werden
31Der verborgene Turm
32Zu den Waffen!
33In den Gruben
34Feuerdrache
35Alles fließt
36Einfach unberechenbar
37Das Ende des Regens
38Winter
Personenverzeichnis
Glossar
Danksagung
Abspann
»Es mag sein, dass Verschwörungen zuweilen
durch geistreiche Köpfe angezettelt werden;
ausgeführt werden sie immer durch Bestien.«
Antoine Comte de Rivaról
(1753–1801)
Was bisher geschah
Seit dem Tod seines Herrschers ist das Kaiserreich Berun im Niedergang begriffen. Der junge Kaiser Edrik ist schwach und weniger am Regieren als an seinen Vergnügungen interessiert. Unruhen unter den unzufriedenen Fürsten stellen Berun vor eine schwere Zerreißprobe. Die Nachbarn des Reichs, wie die Novenischen Stadtstaaten im Westen und das Königreich Kolno, haben ebenfalls bereits ein Auge auf die Provinzen des Reichs geworfen, und Verbrecherkönige wie Feyst Dreiauge herrschen über die Unterwelt.
Kaiserinmutter Ann Revin versucht mit einer kleinen Gruppe ihr treu ergebener Männer und Frauen gegen all diese Widrigkeiten anzukämpfen. Deren Anführer ist Henrey Thoren, genannt der Puppenspieler. Marten und Danil, zwei junge Schwertmänner des Kaisers, und Sara, ein ehemaliges Straßenmädchen aus Feysts Gefolge, geraten unversehens in Thorens Netz der Intrigen. Während Marten wegen eines Mordes in das Macouban verbannt wird, mausern sich Sara und Danil schnell zu wertvollen Trümpfen im Ärmel der Kaiserinmutter.
Doch Sara zieht sich damit nicht nur Feysts Zorn zu, sondern gerät auch in den Fokus Cajetan ad Hedins. Das Oberhaupt des Ordens der Reisenden sieht in der magisch begabten Frau eine Verfluchte, der es laut einer Prophezeiung bestimmt ist, die verbannten Götter zu befreien und damit das Ende der Welt einzuläuten. Als er ihr gegenübertritt, verleugnet Danil seine Gefühle für sie und lässt Sara feige im Stich. Zerfressen von Reue versucht er wenig später, den Ordensfürsten zu töten, und wird zur Strafe in den wilden Norden des Reichs verbannt.
Als sich kurz darauf ein Treffen der Kaiserinmutter mit der kolnorischen Prinzessin Ejin Rigmar als Falle herausstellt, gelingt es Sara und Thoren nur unter großen Verlusten, das Attentat zu vereiteln. In der Folge nutzen sie ein von Ann Revin veranlasstes Zusammentreffen der Reichsfürsten am Kaiserhof dazu, um mit Hilfe des macoubanischen Gesandten Beltran ad Iago die Verschwörer auszuschalten. Der Plan misslingt, und Saras Ziehbruder Flynn wird vor ihren Augen von Feyst Dreiauge getötet.
Danil, der im Norden dem skrupellosen Ordensritter Joring dabei helfen soll, entlegene Siedlungen von Göttergläubigen zu säubern und ihre geheimen Tempel aufzuspüren, trifft dort auf den seltsamen Waldmenschen Bogk. Der will sein Volk unter den Schutz des Kaiserreichs stellen und dient sich ihnen im Gegenzug als Führer an. Doch als Joring ihn feige hintergeht, verüben die Waldmenschen blutige Rache an dessen Heer. Der von Hass erfüllte Ordensritter zwingt Danil zu einem Kampf auf Leben und Tod, und der junge Schwertmann entdeckt dabei sein eigenes magisches Talent: Er kann unter Wasser atmen.
Danils Freund Marten findet sich derweil auf einem Schiff in das Macouban wieder, wo er der Kriegsknechtstruppe der Schildbrecher unter Vibel Brender zugeteilt wird. Zu seinem Pech befindet sich auf demselben Schiff aber auch Ordensritter Cunrat, der aufgrund einer Ehrverletzung auf Rache sinnt und ihn während eines Sturms über Bord gehen lässt.
Als das schwer angeschlagene Schiff die Festungsstadt Gostin erreicht, gerät es mitten in einen Aufstand des Fürsten Antreno gegen das Kaiserreich. Während sich die Schildbrecher zum Schein von Antreno abwerben lassen, werden die Ordensritter gefangen gesetzt. Der Meuchelmörder Meister Messer, der von Cajetan ad Hedin beauftragt wurde, sämtliche illegitimen Halbgeschwister des Kaisers zu beseitigen – unter ihnen auch Marten –, befreit sie schließlich wieder. Gemeinsam mit den Schildbrechern beschließen sie, einen Gegenaufstand vorzubereiten, und senden einen Trupp nach Tiburone aus.
Wie durch ein Wunder erreicht der totgeglaubte Marten die macoubanische Küste und wird von der Fürstentochter Emeri, ihrer Dienerin Xari und der fürstlichen Heilerin Oloare gesund gepflegt. Fürstin Imara Antreno erkennt in ihm einen Bastardsohn des alten Kaisers und erhofft sich eine gute Partie für ihre Tochter. Xari allerdings misstraut dem leichtlebigen Schwertmann und gibt ihm die Möglichkeit, vom Landgut zu flüchten und sich seiner Verantwortung zu entziehen. Durch Zufall erfährt Marten jedoch von einem bevorstehenden Überfall und rettet der Fürstentochter mit Xaris Hilfe das Leben.
Gemeinsam stellen sie fest, dass es sich bei den Attentätern, vermeintlichen Beruner Kriegsknechten, in Wirklichkeit um Kolnorer handelt, die in falschen Rüstungen die Bevölkerung des Macouban gegen das Kaiserreich aufbringen wollen. Als sie kurz darauf in Gefangenschaft geraten, begegnen sie der Heilerin Oloare wieder, die den heimtückischen Angriff mit initiiert hatte. Während Xari im letzten Augenblick die Flucht gelingt, nimmt Theyn Bront, der Anführer der Kolnorer, Emeri und Marten als Gefangene und schleppt sie zu einem Treffen mit seinen Verbündeten – den Huacoun. Die unheimlichen Wassermenschen befinden sich auf der Suche nach einem riesigen Blausteinvorkommen, das tief in den Höhlen eines Gebirges liegen soll, das sich Lambebes Hand nennt.
Xari gelingt es mithilfe von Cunrat, Messer und den Schildbrechern schließlich, die Gefangenen zu befreien. Doch Marten und Emeri entscheiden sich, ihr Leben zu opfern, um die finsteren Pläne ihrer Widersacher zu durchkreuzen: Sie setzen das Blausteinvorkommen in Brand und vernichten die an diesem Ort verborgenen Götter der Huacoun.
Damit ist die Bedrohung des Kaiserreiches jedoch längst nicht aus der Welt geschafft. Es liegt nun an Xari, Cunrat, Sara und Danil, Entscheidungen zu treffen und nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch die Zukunft von Berun und dem Macouban für immer zu verändern.
Der
verborgene
Turm
Planskizze von Gostin
Stadtplan von Berun
1
Tiburone
Wie schätzt Ihr die Lage ein, Cunrat?« Dolen rieb sich das schiefe Kinn. Die Stoppeln wuchsen nur unregelmäßig, wo die alte Narbe seinen Kiefer kreuzte und ihm ein verwegenes, stets etwas abgerissenes Aussehen verlieh. Bereits seit einer guten halben Stunde beobachteten sie das offene Stadttor Tiburones.
Cunrat ließ sich mit der Antwort Zeit. Insekten summten aufdringlich um sie herum, entweder auf der Suche nach Schweiß oder Blut. Dennoch hielten sich die fünf Menschen verborgen.
Die größte Stadt des Macouban lag auf einer kaum eine halbe Meile breiten Landenge, die die flache Bucht des südlichen Meeres vom Gunboru, dem größten Strom des Landes, schied. Nicht nur diese strategisch günstige Lage sprach für die Stadt, sondern auch die Tatsache, dass hier die einzigen Felsen im Umkreis von beinahe zwei Tagesmärschen zu finden waren. Ein Großteil davon war in vergangenen Jahrhunderten dafür aufgewendet worden, eine zwei Schritt hohe Mauer zu errichten. An mindestens zwei Stellen in der Nähe des Tors war das von Moos und Flechten bewachsene Bauwerk inzwischen mit Holz ausgebessert worden. Doch nach allem, was Cunrat wusste, hatte die Mauer ohnehin seit Generationen nicht mehr dazu gedient, menschliche Angreifer abzuwehren, sondern war nur dazu da, die gefährlicheren Flussbewohner davon abzuhalten, nachts in die Stadt zu kriechen. Und diesen Zweck erfüllte sie vermutlich auch mit nachlässigen Flicken. Hinter der Mauerkrone ragten spitze Dächer auf, die mit Schindeln des dunklen einheimischen Holzes gedeckt waren. Sie glänzten feucht im Dunst, der nach dem Regen des Morgens faseriger Watte gleich zwischen den Gebäuden und in den nahen Baumkronen hing.
»Es wäre sicherlich machbar, auch ungesehen in die Stadt zu kommen«, erwiderte der junge Ritter nachdenklich. »Aber die Männer dort am Tor sehen mir nicht sonderlich wachsam aus. Und sie haben zumindest die letzten drei Gruppen von Reisenden nicht kontrolliert. Ich denke, es ist wesentlich einfacher, die Stadt auf normalem Weg zu betreten.«
»Hm«, brummte Dolen, offenbar nicht ganz überzeugt. »Wenn es stimmt, dass Männer in Beruner Rüstungen die Fährstation angegriffen haben, warum dann diese nachlässigen Sicherheitsmaßnahmen? Man sollte erwarten, dass sie zumindest jetzt ein wenig aufmerksamer wären.«
»Was heißt ›wenn es stimmt‹?«, fauchte Xari düster. »Es waren Kolnorer in den Farben des Kaisers. Dieselben, denen wir im Norden begegnet sind. Oder zumindest Verbündete.« Instinktiv ballte sie die bandagierten Fäuste und verzog dann das Gesicht, als die gerade erst verheilenden Brandwunden an ihren Händen protestierten. Fahrig strich sie wieder ihr dünnes Kleid glatt, und Cunrat kam nicht umhin, sich ihrer üppigen Rundungen erneut beinahe schmerzhaft bewusst zu werden. Er räusperte sich. »Wir glauben dir ja. Es leuchtet mir nur nicht ein. Wenn es nicht die sind, denen wir begegnet sind, wo sind sie dann? Und warum ist niemand in Kampfbereitschaft?«
»Da fallen mir auf Anhieb mehrere Gründe ein«, stellte Dolen fest. »Sie wissen, dass die Kolnorer hier nicht angreifen. Oder die Kolnorer haben so gründlich aufgeräumt, dass es keinen Verdacht gibt. Tiburone fühlt sich hinter der kleinen Mauer dort sicher. Oder die dort sind auf der Seite der Kolnorer. Dann ist es eine Falle, und sie warten nur auf uns. Such dir was aus.« Er zuckte mit den Schultern und seufzte. »Wir können nicht durchs Tor gehen«, stellte er fest. »Lasst uns einen Mauerabschnitt suchen, über den wir ungesehen hineinkommen.«
»Vielleicht hätten wir Messer nicht so schnell ziehen lassen sollen«, brummte Wibalt. Der dritte der Ritter war groß, sehnig und behaart wie ein Bär. Im schwülwarmen Mittag glänzten die Schweißperlen auf seinem Gesicht. »Das wäre eine Aufgabe für ihn gewesen.«
Dolen warf dem Haarigen einen düsteren Blick zu. »Seit wann überlassen die Ritter des Ordens ihre Drecksarbeit gedungenen Mördern?«
Wibalt schnaubte belustigt. »Seit wann denn nicht? Und ihr müsst zugeben – er ist wirklich gut in dem, was er tut.«
»Ich glaube, es ist für uns alle besser, wenn der Mörder sein Unwesen in der Hauptstadt treibt und nicht bei uns«, gab Dolen zurück. Vorsichtig zog er sich von ihrem Aussichtspunkt zwischen den Büschen zurück und stand auf. »Also los. Es wird bald dunkel.«
Xari sah zwischen den Männern hin und her, dann schüttelte sie den Kopf und stand ebenfalls auf. »Männer. Ihr denkt wirklich zu kompliziert. Wartet und haltet euch bereit. Oh, und verstopft eure Nasen.« Sie lockerte die Verschnürung über ihrem üppigen Dekolleté und setzte ein Lächeln auf, das Cunrat für verführerisch gehalten hätte, wenn ihm nicht klar gewesen wäre, dass dies zum Talent der jungen Metis gehörte. »Was hast du vor? Das ist viel zu gefähr…«
Xari warf ihm einen spöttischen Blick zu, der Cunrat daran erinnerte, dass sie vor nicht einmal vier Tagen mehr als zwei Dutzend Männer in den Flammentod gelockt hatte. Er verschluckte den Rest seines Satzes. Die Metis schob sich ein winziges Bröckchen Blaustein zwischen die Zähne, zerbiss es knirschend, wandte sich um und trat auf die ausgefahrene Straße. Ein Hauch von Sandelholz lag plötzlich in der Luft. Mit schwingenden Hüften ging sie geradewegs auf die Torwachen zu, und Cunrat fiel es schwer, den Blick von ihrem Hinterteil abzuwenden. Scham stieg in ihm auf und kroch als heiße Spur auf seine Wangen. War es einem Ritter nicht verboten, derartige Gedanken zu hegen, zumal bei einer Metis, einer Verfluchten noch dazu? Widerwillig wandte er sich ab und starrte geradewegs in Wibalts bärtiges Gesicht. Der große Ritter grinste ihn wissend an. Eilig kratzte Cunrat etwas Talg von der Kerze, die ihm Wibalt reichte, rollte ihn und stopfte die Pfropfen in die Nase.
Die Metis hatte die fünfzig Meter schnell überbrückt und die drei Torwachen beinahe schon erreicht, als jene schließlich auf die nur spärlich bekleidete Frau aufmerksam wurden. Für einen kurzen Moment hoben sie die Waffen – nur um sie im nächsten Augenblick wieder zu senken. Stattdessen richteten sie sich auf, streckten die Brust heraus und versuchten, sich von ihrer imposantesten Seite zu zeigen, als Xari bei ihnen stehen blieb, eine Hand scheinbar unbewusst auf die Hüfte gestützt. Bereits im nächsten Moment wanderte die Hand eines der Männer an Xaris Taille.
»Wollt ihr zusehen?«, raunzte Dolen unwirsch, und Cunrat zuckte zusammen. »Bewegung. Sie macht das nicht zum Vergnügen.«
»Sicher?«, murmelte Wibalt, folgte Dolen jedoch auf die Straße hinaus. Schweigend marschierten die vier Männer ohne Hast auf das offene Tor zu. Cunrats Hand krampfte sich um den Griff seines Schwerts, und er musste alle Selbstbeherrschung aufbringen, um die Klinge nicht zu ziehen. Schon kurz darauf hätte ein Dolch gereicht, so dicht passierten sie hinter den Rücken der Männer, die jedoch ausschließlich Augen für Xari hatten. Die blanke Lust in ihren Gesichtern erschreckte Cunrat zutiefst. So sollte kein Mann aussehen. Ein zweiter der Torwächter packte Xaris Hüfte. Es wirkte so besitzergreifend, dass Cunrat unwillkürlich innehielt. Im nächsten Augenblick stieß Wibalt ihn vorwärts, und der Bann war gebrochen. Ohne Worte, nur mit einem Blick und einer Geste kippte Xari die Stimmung zwischen den Wachmännern, die sich plötzlich feindselig musterten. Der erste, der Xari die Hand um die Taille gelegt hatte, knurrte den zweiten in einer Sprache an, die Cunrat nicht verstand. Der verzog das Gesicht, bellte etwas zurück, und plötzlich lag seine Hand an seinem Dolch. Der dritte packte Xari am Arm, um sie aus dem Weg zu ziehen, was aber der erste anscheinend als Affront betrachtete, denn er fuhr herum und schlug seinem Kameraden so heftig ins Gesicht, dass Blut aus dessen Nase schoss. Im nächsten Moment war Xari vergessen, als die drei Männer mit Fäusten übereinander herfielen, während die Ritter in die belebten Gassen Tiburones eintauchten.
»War das … war das dort ihr Fluch?«, raunte Cunrat erschüttert und warf einen Blick zurück, wo sich weitere Männer in die Prügelei einmischten, während Xari unauffällig beiseitetrat.
»Ich bin mir nicht sicher, dass dieses Weib das überhaupt braucht – aber ich denke, ja. So etwas ist der Grund, warum der Orden die Gezeichneten und den Blaustein kontrollieren will«, sagte Dolen leise, als sie im Schatten eines Marktstands stehen blieben. Der narbige Ritter tat so, als würde er die ausgestellten Töpferwaren begutachten. »Nicht auszudenken, was diese Frau am Hofe des Kaisers anrichten könnte.«
»Immerhin ist sie auf unserer Seite«, wandte Cunrat ein.
»Bist du dir da so sicher?«
Cunrat setzte zu einer Antwort an, bevor ihm aufging, dass er auf diese Frage keine hatte. Verstohlen sah er sich um. Innerhalb der Stadtmauer herrschte ein buntes, scheinbar planloses Durcheinander. Die meisten der fast ausschließlich zweistöckigen Gebäude waren aus Holz errichtet. Das obere Stockwerk wies meist einen überdachten Balkon auf, der die gesamte Straßenseite einnahm und in der Regel dazu genutzt wurde, Wäsche zu trocknen. Unter den über die Straße ragenden Balkonen hatten die Einheimischen vor beinahe jeder Hütte einen winzigen Marktstand gezwängt, in denen die unterschiedlichsten Dinge zum Kauf angeboten wurden. Meist schienen die Waren dabei den Aufwand nicht wert. Hier verkaufte einer geflicktes Schuhwerk, dort bot ein kleiner Bengel grob geschnitzte Löffel und Schalen an. Einen Schritt weiter drängten sich ein Dutzend schwarzer Hühner in hölzernen Käfigen zusammen, während direkt daneben in einem großen schwarzen Kessel eine zäh wirkende Masse vor sich hin köchelte und einen intensiven Geruch nach Fisch und fremdartigen Gewürzen verströmte. Zwischen den Ständen und in den engen Gassen drängte sich ein buntes Gemisch an Menschen. Überwiegend waren es die aschbraunen Gesichter der Metis, der Eingeborenen des Macouban. Die meisten reichten den Rittern lediglich bis zur Schulter, und die hochgewachsenen Beruner, deren Gesichter von der ungewohnten Sonne gerötet waren, waren mehr als einer Musterung unterworfen. Zu Cunrats heimlicher Überraschung blieb es jedoch bei neugierigen Blicken, was vermutlich daran lag, dass sie nicht die einzigen Fremden auf den Straßen waren. Braun gebrannte Männer in den bunten Kleidern des novenischen Bundes feilschten mit lebhaften Gesten um irgendwelche Waren, und ihre schnelle Sprache hob sich scharf von den melodischen Stimmen der Einheimischen ab.
Sie bogen an der nächsten Kreuzung ab, und Cunrat zuckte zusammen, als ihnen drei breitschultrige Kolnorer entgegenkamen. Sie trugen ganz offen die Rüstungen und Waffen des Königreichs, auch wenn sie der allgegenwärtigen Hitze zumindest das Zugeständnis gemacht hatten, keine Pelze und wattierten Wollkleider anzuziehen. In ihrer Mitte ging eine füllige Frau mittleren Alters, die mit steinerner Miene die Auslagen der Stände begutachtete. Auch Wibalt spannte sich sichtlich an, und die Hände des Rosskopfs lagen wie zufällig auf den Griffen seiner Schwerter. Dolen jedoch nickte lediglich höflich und trat zur Seite, um die Männer, die keine Notiz von ihnen nahmen, passieren zu lassen. Der Blick der Frau streifte die Ritter kurz, wanderte jedoch ohne Interesse weiter. Als sich die Menschenmenge wieder hinter den Kolnorern geschlossen hatte, verzog Wibalt sein bärtiges Gesicht zu einer angewiderten Grimasse. »Sie wagen es ernsthaft, hier so offen herumzustolzieren? Was glauben sie …«
Dolen ließ sein unverbindliches Lächeln fallen und wandte sich ab. »Sie glauben vermutlich, dass die Tatsache, dass sie hier mehrere Stadthäuser haben, ihnen das Recht gibt, sich zu bewegen, als seien sie hier zu Hause.«
Cunrat sah ihn verblüfft an. »Die Kolnorer haben Grundbesitz im Macouban? Auf dem Gebiet des Kaiserreichs?«
Dolen nickte knapp. »Einige schon, soweit ich weiß. Es ist ihnen nicht verboten. Sie sind Händler, und das hier ist eine der wichtigsten Handelsstädte des Südens. Dutzende Handelsgesandte aus fast genauso vielen Reichen haben Häuser hier. Das ist Teil des Protektoratsvertrags des Kaisers.«
Xari tauchte so lautlos neben Cunrat auf, dass dieser zusammenzuckte. Sie nickte. »Händler, ihre Familien, ihre Bediensteten. Es sind mehr als nur ein paar Dutzend. Nach allem, was wir auf dem Landgut der Fürstin mitbekommen haben, sind es einige Hundert novenische, nochmals einige Hundert Kolnorer, beinahe genauso viele Beruner. Insgesamt mehr als zweitausend, die keine Metis sind – die Fürstenfamilie nicht eingerechnet.«
»Aber …« Cunrat blickte zurück, wo er immer noch die Haarschöpfe der Kolnorer über der Menschenmenge sehen konnte. »… sie sahen mir nicht wie Händler aus.«
»Leibwächter«, sagte Dolen knapp. »Das Macouban ist ein gefährliches Land, wie wir wissen.«
»Erstaunlicherweise ist es durch die vielen Waffen nicht sicherer geworden«, murmelte Xari.
»Verblüffend«, stimmte der Rosskopf trocken zu.
Sie bogen in eine weitere Abzweigung ein, und langsam gelang es Cunrat, sich zu entspannen. Mehr als ein Metis warf ihnen zwar düstere Blicke zu, doch langsam beschlich ihn das Gefühl, dass sie nicht persönlich gemeint waren. Auch hier schien allgemein niemand Beruner wirklich zu mögen. Eine weitere Gruppe Kolnorer unter Waffen tauchte vor ihnen auf. Sie waren ganz offensichtlich damit beschäftigt, einen der Verkaufsstände zu schließen, und sie gingen dabei nicht im Geringsten behutsam mit den Waren oder dem aufgebrachten Besitzer um. Der feiste Mann wurde von zwei der stiernackigen Kolnorer gegen die Rückwand seines Verkaufsbereichs gedrängt, während die übrigen drei das als Dach dienende Segeltuch herabrissen und die Haltestangen und Tische des Stands zerbrachen. Mehr und mehr Menschen versammelten sich um die Szene und äußerten immer lauter ihren Unmut. Und plötzlich wurde Cunrat klar, dass die Menschentraube nicht gegen das raue Vorgehen der Kolnorer protestierte, sondern sie im Gegenteil noch anfeuerte. »Was bei den Gruben …«, knurrte Wibalt düster, doch Xari hob eine Hand und bedeutete den Männern zurückzubleiben. Dann schob sie sich nach vorn in die Menge, bis sie neben einer älteren Metis von beeindruckenden Ausmaßen landete, die die Szene mit vor dem Busen verschränkten Armen und einem Ausdruck grimmiger Zufriedenheit beobachtete. »Was hat er getan, Uguchu?«
Die dicke Metis schnalzte mit der Zunge. »Er hat betrogen. Zum wiederholten Mal. Mit falschen Gewichten gewogen, wie man hört«, sagte sie, ohne sich umzusehen.
Xari schnalzte ebenfalls mit der Zunge. »Was haben die Kolnorer damit zu tun?«
Jetzt warf die Matrone Xari doch einen Seitenblick zu. »Die Kaiserlichen haben ihn die letzten beiden Male laufen lassen. Er ist ein Beruner, Mädchen. Darum. Die halten sie nie fest. Diese Ratten halten zusammen. Es wird Zeit, dass sich jemand mal um die kümmert.«
Xari nickte. »Aber warum die Kolnorer? Was haben die damit zu tun?«
»Du bist neu hier, oder?«
»Ich war das letzte Mal vor einem Jahr in Tiburone.«
Die Matrone nickte. »Die Beruner benehmen sich schon immer so, als sei das Macouban allein ihr Besitz. Und in den letzten Wochen haben sie, nach dem, was man so hört, vermehrt den Grundbesitz der Kolnorer und aller, die mit ihnen verbündet sind, angegriffen.« Sie sah Xari erneut an. »Ich dachte, das hätte sich auch auf den Dörfern schon herumgesprochen. Und nachdem Beruner Kriegsknechte die Fährstation niedergebrannt haben sollen, ist das Maß voll. Die Kolnorer setzen jetzt ihre Männer ein, um ihre Handelshäuser zu schützen. Und bei dieser Gelegenheit schützen sie den Rest der Stadt gleich mit.«
»Ich verstehe das nicht. Was ist mit dem Fürsten? Ist das nicht eigentlich seine Aufgabe?«
»Der Fürst?« Die Matrone schnaufte abfällig. »Der hat sich seit Wochen nicht hier blicken lassen. Der ist doch selbst nur eine Handpuppe des Kaisers. Wir Metis waren ihm vermutlich schon immer egal. Sonst würde er nicht dulden, was hier geschieht. Wenn du mich fragst – wir können froh sein, dass die Kolnorer endlich für Ordnung sorgen.« Sie wandte sich ab, als die Menge aufjohlte. Einer der Kolnorer hatte dem unglücklichen Händler einen Hieb in den Magen versetzt, und dieser erbrach sich soeben geräuschvoll auf seine Schuhe. Xari nutzte die Gelegenheit, um sich unauffällig zurückzuziehen.
Als Xari flüsternd die Worte der Matrone zusammenfasste, verfinsterte sich Dolens Gesicht noch mehr. Noch bevor die junge Frau fertig war, glitt Wibalts Schwert halb aus der Scheide. Dolens Hand stoppte ihn. »Nicht«, zischte der Narbige. »Wir gehen weiter.«
»Aber …« Dolens Blick ließ Cunrat verstummen.
»Was wollt Ihr machen, Cunrat? Die Kolnorer haben hier offensichtlich bereits das Sagen, und ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Mob gegen uns brauchen. Geht. Geht weiter. Wir müssen das Ordenshaus erreichen. Falls es nicht ohnehin schon zu spät ist. Außerdem«, fügte er hinzu, »ist der Krämer vermutlich nicht unschuldig an seinem Schicksal. Und hier steht mehr auf dem Spiel. Wir sind der Sache des Ordens verpflichtet, nicht den Beruner Krämerseelen, vergesst das nicht.«
Zögernd warf Cunrat einen Blick auf die aufgeputschte Menschenmenge. Inzwischen war irgendjemand in das Haus des Krämers eingedrungen, denn unter dem Johlen der Umstehenden flogen jetzt Haushaltsgegenstände aus den Fenstern. Ein Wasserkrug zerschellte an der gegenüberliegenden Wand. »Ist es nicht unsere Pflicht, die Bürger des Reichs zu schützen?«, fragte er, und sogar für ihn selbst klang es beinahe flehentlich.
»Nein«, entgegnete Dolen leise und schob ihn weiter. »Das ist die Aufgabe des Kaisers. Unsere ist es einzig, der Sache der Reisenden zu dienen. Die Huacoun und ihre Götter sind unsere Sache, nicht die Krämer.«
Cunrat setzte zu einer Entgegnung an, doch das Bild der in Blaustein eingeschlossenen Götter und das des brennenden Marten ad Sussetz glitten ungebeten durch seinen Kopf, und er schwieg. Es fiel ihm schwer, das zuzugeben, aber Dolen hatte wohl recht. Alles, was ein Eingreifen bewirken würde, wäre vermutlich, dass sich der Unmut der Menge auch gegen sie richten würde. Und sie durften sich nicht aufhalten lassen. Widerwillig wandte sich der junge Ritter ab.
Dolen und Xari übernahmen abermals die Führung und suchten ihnen den schnellsten Weg durch die verwinkelten Gassen zum Zentrum der Stadt. Jetzt änderte sich die Bebauung. Die Balkone, die die ersten Stockwerke umspannten, blieben zwar gleich, doch jetzt war hier und da ein Haus aus hellem Bruchstein gemauert. Kurz darauf löste ein ausgetretenes Pflaster mit tiefen Rinnsteinen die schlammigen Gassen ab. Jetzt war die Mehrheit der Häuser aus Kalkstein, und immer wieder ragte ein dreistöckiges Haus über seine Nachbarn hinaus. Hölzerne und sogar eiserne Gitter waren vor vielen Fenstern angebracht, und zweiflüglige Tore deuteten darauf hin, dass hinter vielen Hausfronten Höfe verborgen lagen. Schließlich wichen die Häuser zurück und gaben einen Platz frei, auf dem mehrere großblättrige Bäume für Schatten sorgten. Die entfernte Seite der freien Fläche wurde von einem hölzernen Hafenkai begrenzt, hinter dem ein Gewirr aus flachen Kähnen und Booten lag, deren Segel ein buntes Durcheinander von Farbflecken bildeten. Über alldem lag der eigentümliche Geruch von Brackwasser, fauligen Fischresten und heißem Erdpech, mit dem vermutlich irgendwo in der Nähe Boote kalfatert wurden. Die Enden der Mole wurden jeweils von einem ungewöhnlich großen Steingebäude begrenzt. Beide waren von einer hohen Mauer eingefasst, doch während das linke, östliche mit zwei kurzen Türmen und einer Handvoll bemooster Kuppeln eher einer Miniaturausgabe der Burg von Gostin glich, konnte Cunrat im rechten deutlich ein Ordenshaus der Flammenschwertritter erkennen. Wie die meisten davon war auch dieses in Anlehnung an das erste Ordenshaus in Berun in der Art eines festungsartigen Wehrhofs errichtet. Das schwere, auf den Platz gerichtete Tor stand offen, und Cunrat fragte sich im Stillen, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. Eine Patrouille Kolnorer schlenderte den Hafenkai entlang und blieb stehen, um sich mit zwei Metis-Fischern zu unterhalten.
Dolen hielt inne und runzelte die Stirn. »Kann es sein, dass sie bereits den gesamten Wachdienst übernommen haben?«
Der Rosskopf nickte langsam. »Aber ich verstehe nicht, warum. Wenn Fürst Antreno sich die Mühe gemacht hat, von langer Hand alle Kriegsknechte Beruns durch seine eigenen Leute zu ersetzen – warum sollte er den Kolnorern erlauben, sich zu benehmen, als seien sie hier die Herren?«
Dolen zuckte mit den Schultern. »Die Frage ist, ob sie eine Erlaubnis brauchen. Wie sollte er ihnen verwehren, ihre eigenen Bürger zu schützen? Und wenn er sich von Berun lossagt, dann ist es eine gute Gelegenheit für die Kolnorer, offiziell mehr für ihren eigenen Schutz zu tun.«
»Aber … es sind doch die Kolnorer, die überhaupt den Ärger machen!«, warf Cunrat ein.
Xari warf ihm einen Seitenblick zu. »Und das weiß wer genau? Also außer uns?«
»Hör auf die Frau. Sie hat es verstanden.« Dolen warf den Kolnorern einen letzten Blick zu, dann wandte er sich zu seinen eigenen Leuten um. »Also gut, haltet die Augen offen. Ich traue dem Frieden nicht. Vor allem, weil wir keinen haben. Metis, du und der Kriegsknecht, ihr dürft nur den Hof und die Nebengebäude betreten. Besorgt euch etwas zu essen und seht euch um. Versucht herauszubekommen, wie viele Männer das Ordenshaus hat und wem ihre Loyalität gilt. Wibalt und Cunrat, ihr kommt mit mir. Wir müssen den Brüdern so schnell wie möglich Bericht erstatten, und ich werde euer Zeugnis brauchen.« Mit diesen Worten wandte er sich ab und ging zügig auf das offene Tor zu. Kurz bevor er den dunklen Bogen durchschreiten konnte, trat ein Bewaffneter aus dem Schatten und richtete eine Armbrust auf ihn. »Halt. Macht langsam. Was glaubt ihr Lumpengesindel, was ihr hier zu suchen habt?«
Unwillkürlich sah Cunrat an sich hinab. Gut, die Feststellung war nicht ganz unberechtigt. Sie alle, abgesehen von der Metis natürlich, trugen zerfledderte Beruner Rüstungen. Die, wenn man es genau betrachtete, schlimmer aussahen als die der meisten käuflichen Kriegsknechte, die er je gesehen hatte. Vermutlich ähnelten sie Plünderern mehr als alles andere.
Dolen musterte den Mann demonstrativ. Der Wächter trug eine sorgsam gepflegte Rüstung der Ritter des Flammenden Schwerts, auch wenn nicht zu übersehen war, dass es nicht mehr die neueste war und mehr als nur einen echten Einsatz gesehen hatte. Der Mann darin war etwas kleiner, jedoch breiter gebaut als jeder von ihnen, und in seinem faltigen Gesicht kämpften Narben und graue Barthaare erbittert um die Vorherrschaft. Aber auch wenn seine Haut so dunkel gebrannt war wie die eines Einheimischen, verrieten seine Züge unverkennbar seine Beruner Herkunft. Die Armbrust in seinen Händen schwankte nicht im Geringsten, und die Spitze des Bolzens zeigte auf Dolens Brust. Auf diese Entfernung würde das Geschoss vermutlich aus dem Rücken wieder austreten. Cunrat schluckte.
Kurz bevor der Ordensritter die Geduld verlor, nickte Dolen, schlug das Zeichen des Ordens vor der Brust und deutete eine Verbeugung an. »Verzeiht, Bruder, aber wir haben es eilig, und das Tor stand offen. Aber selbstverständlich wollen wir uns an die Regeln halten. Wir sind Ordensritter aus Gostin, vor wenigen Wochen erst eingetroffen aus Berun, und wir müssen dringend darum ersuchen, einen Schwertrat der Brüder einzuberufen. Es gibt schlechte Neuigkeiten.«
Die Armbrust lag vollkommen unbewegt in der Luft, als der Ritter Dolen und seine Begleiter erneut musterte. »Ihr wollt Ritter sein? Fällt mir schwer, das zu glauben.« Er schnaubte abfällig. »Aber dafür gibt es ja die Parole. Ich höre.«
Dolen legte den Kopf ein klein wenig schief. »Welche wollt Ihr hören? Ich kann Euch keine bieten, die jünger ist als zehn Wochen. Das ist Teil des Problems. Davor könnt Ihr jede haben.«
»Jede?« Der Wächter zog zweifelnd eine Braue hoch. »Welches Wort galt, als Kaiser Edrik gekrönt wurde?«
»Die Schwingen der Westhal«, entgegnete Dolen prompt. »Eine außerordentlich dämliche Wahl, wenn Ihr mich fragt. Können wir …«
»Was war die Parole, als Naevus das Amtsschwert an Cajetan übergab?«, fiel ihm der andere ins Wort.
Dolen seufzte. »Kantrenische Barkbeeren. Was wird das jetzt? Wollt Ihr als Nächstes wissen, wie die Parole lautete, als sich Ann Revin den Rücken gebrochen hat? Wir haben keine Zeit für derlei Spielchen, Ritter.« Mit einer blitzschnellen Bewegung nahm er dem Wächter den Bolzen von der Waffe und hielt ihn dem Verblüfften unter die Nase.
»Was immer Eure Begabung ist, Ritter – Aufmerksamkeit oder schnelle Reaktionen sind es schon mal nicht. Hofft besser darauf, dass ich das hier nicht Eurem Vorgesetzten melde, Mann.« Er ließ das Geschoss fallen und schob den Wächter beiseite. »Auf diese Weise werdet Ihr die Kolnorer kaum davon abhalten, als Nächstes hier einzudringen.«
»Kolnorer? Die sind schon da«, gab der verwirrte Mann zurück.
Dolen hielt inne. »Bitte was?«
»Die Kolnorer. Eine Abordnung ist in diesem Moment beim Kommandanten.«
Die Augen des Narbigen verengten sich. »Was bei den Gruben wollen sie von ihm?«
Der Torwächter zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung. Es sind ein halbes Dutzend Männer in Begleitung des kolnorischen Gesandten. Sie haben eine offizielle Audienz erwirkt.«
»Und Ihr habt sie vorgelassen«, stellte Dolen finster fest.
»Natürlich. Warum …?«
Dolen antwortete nicht. Er marschierte an dem Mann vorbei in den Innenhof, und seine Selbstverständlichkeit schien den Ausschlag zu geben: Der Ritter trat beiseite und ließ auch die übrigen passieren. »Hat … hat sich die Kaiserinmutter tatsächlich den Rücken gebrochen?«, fragte er Cunrat gedämpft.
Cunrat sah ihn befremdet an. »Was weiß ich denn? Wir sind seit Wochen aus Berun weg.«
»Aber …«
»Wo finden wir jetzt den Kommandanten und seine Gäste?«, unterbrach Wibalt ihn.
»Ich …« Der Ritter gab auf. »Sie sind in der Amtsstube. Hört mal, ich habe keine Ahnung, was sie wollen, oder auch nur, was ihr wollt, aber etwas braut sich zusammen, und ich bin froh über jeden Ritter, der in der Stadt ist. Oder auch jeden anderen, der auf unserer Seite ist«, fügte er mit einem Blick auf den Rosskopf hinzu.
Wibalt nickte. »Der Baderaum ist dort drüben?« Er deutete über den Hof, und der fremde Ritter nickte. Das war der Vorteil an dem stets gleichen Aufbau der Ordenshäuser. Wohin ein Ritter auch kam, er fand sich schnell zurecht. »Dolen!«, rief er ihrem Anführer hinterher. »Bei aller Eile – es wäre geboten, sich den Schlamm von Händen und Gesicht zu waschen. Gerade, wenn Kolnorer anwesend sind.«
Dolen hielt erneut inne. Auf Cunrats fragenden Blick lenkte er ein: »Wibalt hat natürlich recht. Gerade vor den Kolnorern sollten wir uns keine Blöße geben und wie eine Horde verlauster Flüchtlinge aussehen. Kontrolle oder den Anschein davon – darum geht es. Immer. Aber beeilt euch. Ich fürchte, uns läuft die Zeit davon. Und ihr«, er sah Xari und den Rosskopf an, »besorgt uns was zu essen und findet jemanden, der uns saubere Kleidung verschafft. Wir treffen uns im Refektorium, sobald wir den Herrn dieses Hauses gesprochen haben. Falls er euch nicht ohnehin rufen lässt.«
»Botendienste für die Metis, hm?« Xari schnaubte, winkte dann jedoch ab. »Schon gut. Ich bin das gewohnt.«
»Aber wenn«, Cunrat dämpfte die Stimme, »wenn das hier eine Falle ist? Wenn die Ritter hier bereits unter der Kontrolle der Kolnorer stehen? Was tun wir dann?«
»Dann sorgt dafür, dass die Falle euch nicht fängt«, gab Dolen leise zurück. »In zwei Wochen kann Verstärkung hier sein, und sie wird Gostin anlaufen. Unterrichtet sie darüber, was hier geschieht.«
2
Erinnerungen
Die Glocke schlug zur dritten Stunde des Tages. Der Stunde, in der rechtschaffene Bürger hinter fest verriegelten Fensterläden in ihren Betten schliefen und nur noch die Kreaturen der Nacht auf den Beinen waren. Menschen, die sich von der Dunkelheit ernährten. Diebe, Mörder und arme Sünder, die ihr schlechtes Gewissen nicht zur Ruhe kommen ließ. Eine erwartungsvolle Stille lag über der schlafenden Stadt. Unten im Hafen dümpelten die Schiffe träge auf den Wellen. Nur vereinzelt warf eine brennende Laterne flackernde Schatten auf die Decks und Pflaster der verlassenen Gassen, die sich den Berg hinauf bis zur Oberstadt zogen. Selbst über der Kaiserfestung, die niemals zur Ruhe zu kommen schien, hatte sich in dieser Nacht ein Vorhang aus Stille gelegt.
Tempelfürst Cajetan ad Hedins Schritte hallten unnatürlich laut auf den steinernen Fliesen wider, während er durch die Gänge des Tempels marschierte. Als er die Große Halle betrat, schlug ihm ein warmer Lufthauch entgegen, und er erblickte die ersten der mächtigen Statuen, die im Halbdunkel auf ihn warteten. Die Fackel in seiner Hand flackerte und zischte.
Niemand wusste, woher dieser Lufthauch kam oder was ihn verursachte. Die Bewohner der Stadt nannten ihn den Atem Kazarhs, des Schutzherrn des Ordens. Wer ihn verspürte, dem würde der Legende nach Glück widerfahren. Cajetan hatte für diesen Aberglauben normalerweise nur Verachtung übrig. Doch an diesem Morgen schlugen seine Fingerspitzen beinahe unbewusst das Zeichen der Flamme. Man konnte ja nie wissen.
Je weiter er in die Tiefe der Halle vordrang, desto mehr Statuen schälten sich aus der Dunkelheit. Mogho, der bärtige Schutzreisende der Handwerker, dessen eiserner Schmiedehammer unzählige Götteranbeter zerschmettert hatte. Wenige Schritte weiter Enurg, der Schirmherr der Krieger und Festungsbauer. Dann Adzahid, der Hüter der Lehren. Mihg, der Harfner. Schließlich Hadol, der Heiler, der Herr über Familie, Haus und Hof. Die Scharniere seiner Rüstung schabten leise gegeneinander, als er sich vor der letzten und größten Statue auf den kalten Steinboden kniete. Sie überragte die anderen um beinahe einen Kopf und war aus feuerrotem Sandstein gemeißelt. Rot war die Farbe des Herrn aller Ordensritter. Kazarh, die Ewige Flamme.
Der speckig glänzende Stein zu Füßen der Statue ließ erkennen, dass schon unzählige andere vor ihr niedergekniet hatten. Im flackernden Licht der Fackel schien Kazarh die Augenbraue zu heben, so als würde er sich fragen, was der Tempelfürst zu dieser frühen Stunde von ihm wolle. Cajetans Blick blieb einen Augenblick an seinen scharf geschnittenen Zügen hängen, dann zog er sein Schwert aus der Scheide und legte es behutsam vor sich ab.
Es handelte sich um eine Klinge aus tausendfach gefaltetem Skellvarstahl. Einfach und schlicht und ohne jede Verzierung. Eine Klinge, die er allein zum Zweck des Tötens geschaffen und in seinem eigenen Blut gehärtet hatte. Seine Fingerspitzen strichen sanft über den matten Stahl. Erneut blickte er zu Kazarh auf, der nun über ihm thronte wie ein Scharfrichter vor einem zum Tode Verurteilten. Sein Blick schien jetzt streng und unnachgiebig zu sein. Kein Bitten, kein noch so jämmerliches Flehen schien den Reisenden milde stimmen zu können. Für Gnade waren andere zuständig. Kazarh war die Personifizierung des Kampfs.
Cajetan zog die Hand von der Klinge fort und schloss die Augen. Noch drei Glockenschläge. Eine Handvoll Stunden, bis die Sonne aufging. Noch eine Handvoll Stunden mehr, bis sich endlich sein Schicksal erfüllen würde.
Er dachte daran, wie alles begonnen hatte.
Galarosa. Eine unbedeutende Kleinstadt, irgendwo weit im Süden, auf der anderen Seite der Inneren See. Dort, wo die Sonne am Tag beinahe doppelt so lange am Himmel stand wie in Berun und wo die Unterschiede zwischen Sommer und Winter kaum der Rede wert gewesen waren. Irgendwo auf halbem Weg zwischen Armitago und Veycari lag der Ort, an dem Cajetan ad Hedin geboren worden war. Eine ziemlich glückliche Kindheit, soweit er sich erinnern konnte. Vielleicht aber auch nicht. Die Erinnerungen an die ersten Lebensjahre waren oft trügerisch. Kinder waren meist schon mit wenigen Dingen zufrieden, solange sie nur ein Dach über dem Kopf hatten, und meistens einen gefüllten Magen. Er konnte sich an lachende Gesichter erinnern. An fröhliche Menschen. An Herden von Ziegen und Schafen, und an Schweine, die ihre fetten Bäuche wohlig grunzend im Straßendreck wälzten. Die meisten Häuser waren aus Stein. Sie besaßen sogar ordentliche, strohgedeckte Dächer, die selbst dem Prasseln des Regens standhielten, der zwar selten, dafür aber umso heftiger aus dem Himmel hervorbrach. Cajetan liebte das dumpfe Trommelgeräusch. Noch viel mehr liebte er aber das Gefühl der Nässe auf seiner Haut.
Wenn der Regen kam und die meisten Menschen sich unter den Schutz ihrer Dächer zurückgezogen hatten, stahl er sich heimlich aus dem Haus und genoss die Freiheit und Einsamkeit in der verlassenen Stadt. Dann streifte er manchmal stundenlang durch die Gassen, in denen außer ein paar Straßenkötern und dem einen oder anderen versprengten Reisenden kaum jemand unterwegs war.
An einem dieser Tage, es war beinahe schon Nacht und der Regen hatte langsam nachgelassen, stieß er allerdings auf eine Gruppe von vier jungen Männern, die zum niederen Adel der Region gehörten. Sie hatten die glasigen Augen von Leuten, die eine Menge getrunken hatten und auf Streit aus waren. Da sie auf der verlassenen Gasse sonst niemanden zu Gesicht bekamen, fiel ihr Blick auf Cajetan, den sie unter anderen Umständen wohl ignoriert hätten.
Die Farbe ihrer Kleidung ließ erkennen, dass sie zum Haus Manzano gehörten. Jeder wusste, dass man sich mit denen nicht anlegte. Ihr Patriarch besaß die meisten Ländereien in der Gegend, und sein Geldbeutel beherrschte die halbe Region und deren gesamte Justiz. Hastig senkte Cajetan den Kopf und trat einen Schritt zur Seite, um sie an sich vorüberziehen zu lassen.
Doch einer der Männer, ein junger Kerl mit eitrigen Pickeln im Gesicht, baute sich breitbeinig vor ihm auf und legte die Hand auf den Griff seines Degens. »Du stehst mir im Weg«, lallte er, darum bemüht, seiner Stimme einen tieferen Klang zu geben, als sie in Wirklichkeit besaß. Er schwankte leicht und hatte sichtlich Mühe, sich auf den Beinen zu halten.
Cajetan kniff die Augen zusammen. Doch er trat gehorsam einen weiteren Schritt zur Seite, bis er gegen die Hauswand stieß.
Auch dieser Bewegung folgte Pickelgesicht. »Da, schon wieder!« Er warf seinen Begleitern einen vielsagenden Blick zu. »Offensichtlich legt es dieser Wicht darauf an, sich mit mir zu streiten.«
»Ganz offensichtlich«, bestätigte einer der Männer, ein schlaksiger Jüngling mit einem viel zu großen Hut auf einem viel zu kleinen Kopf.
»Ich würde mir das an deiner Stelle nicht gefallen lassen«, sagte der Zweite, dessen Gesicht so rot wie eine reife Tomate war.
»Er ist noch ein Kind«, brummte der Dritte, ein stiernackiger Kerl, dessen breite Schultern und der mächtige Bauch den Eindruck erweckten, als wäre er als Einziger der vier in der Lage, sich mit einem echten Gegner messen zu können.
Pickelgesicht warf ihm einen verärgerten Seitenblick zu. »Er sieht groß genug aus, um schon ein Messer zu besitzen. Ich wette, er hat schon eines.« Sein Kopf ruckte zu Cajetan herum. Fordernd streckte er die Hand aus. »Gib es mir, dann lasse ich noch mal Gnade vor Recht ergehen.«
Cajetan schüttelte stumm den Kopf. Er würde frühestens in zwei Jahren sein Messer erhalten, falls sein Vater es ihm überhaupt gestattete.
»Du lügst!« Pickelgesichts Hand fuhr nach vorn und stieß Cajetan grob gegen die Hauswand. »Her mit dem Messer, du kleiner Lügner. Oder ich prügle es aus dir heraus.«
»Ich lüge nicht«, sagte Cajetan tapfer. Er hatte es noch nie darauf angelegt, sich mit anderen zu prügeln. Meistens ging er Streit aus dem Weg, so wie es ihm sein Vater beigebracht hatte. In einer beruhigenden Geste hob er die Hände. »Ich bin erst zwölf.«
Pickelgesicht verzog enttäuscht den Mund. Vielleicht weil er ahnte, dass Cajetan die Wahrheit sagte, oder weil es nicht halb so spaßig war, ein Kind zu verprügeln. Doch dann fiel sein Blick auf Cajetans Hand, und seine Augen wurden groß. »Seht euch das an«, stieß er überrascht aus. »Er hat ja sechs Finger an der linken Hand.«
»Scheiße«, rief der Schlaksige. »Der ist ein Krüppel.«
»So ein Quatsch. Wisst ihr, was das wirklich bedeutet? Ich sage es euch: Seine Mutter hat mit einem Fischmenschen geschlafen. Das bedeutet es. Uns ist ein verdammter Fischmensch ins Netz gegangen. Oder jedenfalls seine Ausgeburt …«
Cajetan starrte ihn sprachlos an. Sie konnten ihn einen Lügner nennen, oder seinetwegen auch einen Krüppel. So etwas war ihm egal. Aber dass ihn jemand einen Fischmenschen nannte, machte ihn wütend. So etwas würde er nicht auf sich sitzen lassen, egal, was sein Vater ihm über Friedfertigkeit gepredigt hatte. Seine Hand ballte sich zur Faust und schoss unvermittelt nach vorn. Krachend knallte sie gegen Pickelgesichts Kinn und schleuderte ihn zu Boden.
Mit einem lauten Platscher landete er in einer Pfütze und ließ das Wasser nach allen Seiten aufspritzen. »Waff …?« Einen Augenblick lang blickte er sprachlos zu Cajetan auf. Dann verzog er das Gesicht, als wollte er gleich anfangen loszuheulen, und würgte einen seiner Schneidezähne aus. Der Anblick war so lächerlich, dass seine Begleiter in lautstarkes Gelächter ausbrachen. Zuerst lachte der Schlaksige und nach einem kurzen Augenblick auch der Rotgesichtige. Schließlich rang sich selbst der Stiernackige ein schmales Grinsen ab.
Cajetan presste die Lippen zu einem Strich zusammen. Er ahnte bereits, dass ihn die schlimmsten Prügel seines Lebens erwarteten, sobald sie damit aufhörten. Er sah es an ihren Blicken und daran, wie sie die Schultern kreisen ließen, während sie lachten. Fieberhaft suchte er nach einem Ausweg. Nach einer Geste oder nach Worten, mit denen er sie besänftigen konnte. »Es tut mir leid …«, murmelte er, und dann wurden seine Augen groß.
Mit einem wütenden Aufschrei riss Pickelgesicht seinen Degen aus der Scheide und stach zu. Cajetan blieb keine Zeit zu reagieren. Mit einem hässlichen Schmatzen fuhr die Spitze von schräg unten in seine Brust. Es geschah so unglaublich schnell und so spielerisch leicht, als würde ein Messer durch heiße Butter fahren. Einen Moment lang stand er reglos da und sah auf Pickelgesicht hinab, während Pickelgesicht die Stirn runzelte und zu ihm aufblickte, so als würde er herauszufinden versuchen, was gerade geschehen war. Dann löste er vorsichtig den Griff um seinen Degen und krabbelte rückwärts von ihm fort.
»Scheiße«, murmelte der Schlaksige in die entstandene Stille hinein.
»Du hast ihn umgebracht«, stellte der Rotgesichtige fest.
»Abgestochen wie eine Sau«, sagte der Stiernackige.
Cajetan stand einfach nur da und sagte gar nichts. Eine leichte Benommenheit hatte von ihm Besitz ergriffen. Er hatte kaum Schmerzen, aber das führte er auf den Schreck zurück. Und auf die Gewissheit, dass er tödlich verwundet worden war. Er hätte niemals gedacht, dass es so einfach war zu sterben. Er hatte sich bis zu diesem Augenblick überhaupt noch keine Gedanken über den Tod gemacht. Ein Junge in seinem Alter hielt sich im Allgemeinen für unsterblich, und er war in dieser Hinsicht nicht anders als alle anderen. Mit dem Unterschied, dass ein Degen in seiner Brust steckte.
Schwach hörte Cajetan das Gemurmel der Männer hinter der verschlossenen Tür. Sie hatten die Stimmen gesenkt, doch er kannte die Stelle mit dem Astloch, das er durch Entfernen des Holzplättchens darin freimachen konnte. Geschickt drehte er es heraus und warf einen Blick hindurch. Sie waren zu fünft. Joao, der Schmied des Viertels, Ramos, der Heiler, Pio, der Älteste, und Cajetans Vater, dessen gesenkter Blick ihn immer an einen getretenen Hund erinnerte. Den fünften Mann konnte er nicht erkennen, da er etwas abseits des Kamins stand, um den sich die anderen geschart hatten.
»Er muss sterben«, brummte Joao, dessen tiefer Bass selbst die dicksten Mauern durchdrang. »Das ist das Einzige, was bleibt.«
»Sterben«, murmelte Ramos.
»Sterben«, krächzte auch Pio, dessen viel zu großer Schädel hektisch auf und ab wippte.
Sie haben recht, dachte Cajetan. Es ist die gerechte Strafe. Behutsam tastete er über die Stelle, an der das Loch in seiner Brust hätte sein müssen. Es war nur noch eine winzige Erhebung zu spüren, die kaum der Rede wert schien. Die Verletzung war mit unvorstellbarer Geschwindigkeit verheilt. Ramos musste wahre Wunder an ihr vollbracht haben. Und dennoch. Pickelgesicht hatte einmal versucht, ihn umzubringen, er würde es wieder versuchen. Wenn nicht bei ihm, dann bei einem anderen Bewohner der Stadt. Vielleicht würde er auch Rache an ihnen allen üben. Die Manzanos konnten in Galarosa schließlich schalten und walten, wie sie wollten. Niemand würde ihn aufhalten. Es war das Klügste, ihn unauffällig aus dem Weg zu schaffen, ehe er noch mehr Unheil anrichten konnte. Außerdem war es eine Frage der Ehre.
»Das dürft ihr nicht tun«, hörte er nun die Stimme seines Vaters. Er schnaufte. Sein Vater hatte schon immer ein viel zu weiches Herz. Wenn die anderen sich an den Festtagen mit den Kesselflickern prügelten, dann versuchte er immer, den Streit zu schlichten, statt sich auf die Seite der Männer aus Galarosa zu schlagen. Und wenn in der Stadt flussabwärts eine Hinrichtung stattfand, blieb er als Einziger zu Hause, weil er nicht mit ansehen konnte, wie ein Mensch einem anderen Leid zufügte.
»Wir brauchen deine Zustimmung«, krächzte Pio. »Ohne dich können wir es nicht tun.«
Stimm doch endlich zu, dachte Cajetan. Er ballte die Hände zu Fäusten. Sei einmal im Leben kein verdammter Feigling!
Doch sein Vater schüttelte wie immer nur den Kopf. »Ich kann das nicht«, murmelte er betreten. »Es ist nicht rechtens.«
»Hör endlich auf«, rief Ramos ungehalten. »Der Junge stellt eine Gefahr für uns alle dar. Wenn er hierbleibt, wird sein Fluch uns alle treffen.«
»Entscheide dich, verdammt«, donnerte Joao. Seine Stimme klang jetzt bedrohlich und voller Zorn. Er trat einen Schritt auf Cajetans Vater zu, der verzweifelt die Hände in die Höhe warf.
»Aber er ist doch mein Fleisch und Blut!«
Was? Und da fiel es Cajetan wie Schuppen von den Augen. Die Männer dort drinnen hatten gar nicht über Pickelgesicht beraten. Sie hatten die ganze Zeit über ihn geredet. Er war der Junge, den sie für gefährlich hielten, niemand sonst. Entsetzt fuhr er von der Tür zurück. Unter seinem Fuß knarrte ein Brett, und schlagartig erstarben die Stimmen im Raum. Wie angewurzelt blieb er stehen. Einen Augenblick lang herrschte atemlose Stille. Nur das Knistern des Kaminfeuers war noch zu hören, und sein eigener Herzschlag, der so laut in seinen Ohren dröhnte, dass selbst die Männer dort drinnen ihn doch laut und deutlich vernehmen mussten.
»Eventuell gibt es noch eine andere Lösung«, meldete sich in diesem Augenblick der fünfte Mann zu Wort. Seine Stimme klang tief und rau wie das Knarren eines Boots. Er hatte einen schweren Akzent, den Cajetan noch nie zuvor gehört hatte.
»Ich sehe keine«, knurrte Joao. »Wenn wir Cajetan nicht töten, wird uns sein Fluch eines Tages umbringen. Und wenn es nicht der Fluch ist, dann eben die Manzanos. So oder so haben wir keine Wahl.«
Vorsichtig beugte sich Cajetan nach vorn. Durch das Astloch sah er, dass der Fremde in das Licht des Feuers getreten war. Sein Gesicht war narbenzerfurcht und abstoßend hässlich. In seinen Augen spiegelte sich das flackernde Licht der Flammen. Das Leder seiner pechschwarzen Rüstung knirschte leise, als er ohne Hast seinen Handschuh abstreifte und den Männern die Hand entgegenstreckte. An seinem Ringfinger blitzte ein goldener Siegelring auf. Als sie ihn erblickten, stießen sie erschrocken die Luft aus.
Cajetan sah, wie Ramos hastig das Zeichen des Reisenden Hadol schlug und wie Pio rückwärtstaumelte und beinahe gegen den Kamin stieß. Selbst Joao, dem nachgesagt wurde, einen Bullen mit bloßen Händen niederringen zu können, hob zitternd die Hände, so als wollte er sich ergeben.
Der Fremde beachtete sie nicht. Er wandte sich an Cajetans Vater, der zwar den Blick gesenkt hielt, aber nicht vor ihm zurückwich. »Übergib mir den Jungen.«
»Euch?«, fragte sein Vater leise.
»Das, oder er muss sterben.«
»Kommt das nicht auf das Gleiche heraus?«
Der Fremde schnaufte. Ob ihn die Frage amüsierte oder verärgerte, konnte Cajetan nicht erkennen. »Also? Wie entscheidest du dich?«
»Es ist doch gar nicht sicher, dass er wirklich …«
Der Fremde maß ihn mit kaltem Blick. »Es ist sicher.«
»Woher wollt Ihr das denn wissen?« Cajetans Vater blickte sich hilfesuchend um, doch keiner sprang ihm zur Seite. Er warf die Hände in die Höhe. »Ach herrjeh. Ihr habt ihn doch noch nicht einmal gesehen!«
»Das brauche ich auch nicht. Denn ich spüre es. Weil er in diesem Augenblick hier ist.« Ruckartig fuhr sein Kopf herum, und er blickte Cajetan direkt in die Augen. Beinahe so, als würde die Tür zwischen ihnen überhaupt nicht existieren.
Erschrocken fuhr Cajetan zurück. Schmerzhaft krachte seine Schulter gegen die Wand. Er stieß ein Stöhnen aus, fuhr herum und prallte gegen eine riesige Gestalt, die direkt hinter ihm stand. Instinktiv riss er die Faust in die Höhe, doch auf halber Strecke wurde sie von einer haarigen Pranke abgefangen und unbarmherzig zusammengepresst. Eine zweite Pranke rauschte auf ihn zu und versetzte ihm eine schallende Ohrfeige, die ihn erneut gegen die Wand schleuderte. Sein Hinterkopf prallte hart gegen den Stein, und er biss sich beinahe die Zunge ab. Stöhnend spuckte er Blut aus.
»Ganz ruhig«, brummte der Riese. »Du verletzt dich sonst noch selbst.«
Cajetan schüttelte den Kopf und stieß ein undefinierbares Grunzen aus. Er spürte, wie seine Wange anschwoll. Es fühlte sich an, als hätte jemand mit einem schmutzigen Lederlappen darauf eingeprügelt und den Lappen anschließend fest in seinen Mund gestopft.
Der Riese packte ihn am Kragen und hob ihn so mühelos von den Beinen wie einen Sack voller Gänsefedern. Dann öffnete er die Tür und stieß ihn mitten in den Raum hinein.
Cajetan stolperte ein paar Schritte vorwärts, ehe er sich fing. Fünf Augenpaare richteten sich auf ihn. Sein Vater stieß einen erschrockenen Laut aus.
Der Blick, mit dem der Fremde ihn musterte, war hart und unerbittlich. »Seht ihn euch genau an. Es besteht überhaupt kein Zweifel. Schaut seine Hand an. Er besitzt sechs Finger. Ihr könnt es verleugnen, solange ihr wollt, aber in Wirklichkeit wisst ihr es ganz genau.«
»Was wissen sie?«, nuschelte Cajetan, während er die Hand hinter seinem Rücken verbarg. Er warf einen Blick über die Schulter. Doch der einzige Fluchtweg war von dem Riesen versperrt, der mit gekrümmtem Rücken in der Türöffnung stand, weil sein Kopf beinahe gegen die Decke stieß. »Was wollt ihr denn von mir? Ich habe nichts getan.«
Die Männer erwiderten nichts. Sie blickten ihn mit weit aufgerissenen Augen an, wie eine dieser Kreaturen aus den Tiefen der Peynamounischen Urwälder, die manchmal tot am Strand angeschwemmt wurden. Eine angespannte Stille legte sich über den Raum, und eine ganze Weile sprach niemand ein Wort.
»Huacoun«, stieß Ramos schließlich hervor.
Cajetan zuckte zusammen. Mit einem Mal begannen die Männer, mit den Füßen zu scharren und nach ihren Amuletten zu tasten. Beinahe unmerklich wichen sie vor ihm zurück.
»Was hat das zu bedeuten?«, hauchte er. Seine Augen glitten zu seinem Vater, doch der senkte hastig den Blick und schüttelte den Kopf.
»Huacoun«, wiederholte Ramos. »Du bist verflucht. Du trägst das Zeichen der Fischmenschen. Du bist einer von ihnen.«
»Wir haben keine Wahl«, brummte Joao mit Grabesstimme.
»Du gehörst jetzt mir«, sagte der Fremde. Wie ein Fallbeil senkte sich sein Schatten über Cajetans Gesicht.
Am nächsten Morgen ritten sie kurz nach Sonnenaufgang los.
Der Fremde drückte Cajetans Vater ein paar Münzen in die zitternde Hand. Schwere, glänzende Dinger mit dem Kopf eines Löwen auf der einen und unverständlichen Schriftzeichen auf der anderen Seite. Für die Menschen in Galarosa stellten sie ein halbes Vermögen dar, doch sehr viel später sollte Cajetan erfahren, dass er für nicht einmal fünf Silberadler verkauft worden war. Verkauft wie ein elendes Stück Vieh an den Schlachter.
Die Männer waren zu fünft, und sie bewachten ein ganzes Häufchen aus Jungen und Mädchen, die sie aus unterschiedlichsten Teilen des Landes zusammengetrieben hatten. Drei der Kinder waren mit Stricken aneinander gefesselt und an einem der Pferde festgebunden, damit sie nicht fliehen konnten. Der Rest stand hintereinander aufgereiht auf der Straße und wartete gehorsam auf den Befehl zur Abreise. Sie waren alle jünger als Cajetan, und aus ihren Blicken sprach die pure Verzweiflung.
Jetzt wusste er, um was es sich bei dem Fremden handelte. Er war ein Sklavenhändler. Eine dieser verfluchten Gestalten, die ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Menschenleben verdienten. Seine Mutter begann zu schluchzen, und seine Geschwister starrten betreten zu Boden. Keiner wagte es, gegen diesen Handel aufzubegehren. Cajetan klammerte sich an seinem Vater fest, doch der stieß ihn grob von sich.
»Rühr mich nicht an«, zischte er, ohne ihn anzublicken. In seiner Stimme lag eine Härte, die Cajetan noch niemals zuvor an ihm vernommen hatte. »Komm bloß nie wieder zurück!«
Mit gesenktem Blick reihte sich Cajetan hinter den anderen Kindern ein. Er wagte nicht mehr, sich umzublicken, aus Angst, dass vielleicht niemand mehr vor dem Haus stehen würde. Weil sie alle bereits zurück an ihre Arbeit gegangen waren und ihn schon längst vergessen hatten.
Sie kamen schnell voran. Der Fremde verlor keine Zeit. Unermüdlich trieb er die kleine Schar voran, bis sie nur drei Tage später schon vor den Mauern von Beja standen, dem am weitesten entfernten Ort, den Cajetan je zuvor in seinem Leben besucht hatte. Dort stießen zwei weitere Jungen zu der Gefangenenschar hinzu. Der kleinere der beiden streckte die Hände nach Cajetan aus und stammelte etwas in einer Sprache, die er nicht verstand. Hilflos zuckte er mit den Schultern und wandte den Blick ab. Es war ohnehin bedeutungslos, was der Junge ihm mitteilen wollte. Er konnte nichts für ihn tun. Er konnte sich ja noch nicht einmal selbst helfen.
Nach weiteren vier Tagen erreichten sie die Manarische See. Der Anblick der Weite verschlug Cajetan schier den Atem. Sie standen auf einem kleinen Hügel, von dem aus sie weit über das Meer bis an das Ende der Welt blicken konnten. Ein kalter Wind blies vom Strand herauf und trug den Geschmack von Salz und fauligen Algen mit sich. In einiger Entfernung dümpelte ein gewaltiges Schiff in der Dünung. Es war größer als alle Fischerboote von Galarosa zusammen, und aus seinem pechschwarzen Bauch ragten lange Ruder heraus, die ihm das fremdartige Aussehen eines Käfers gaben. Huacoun, schoss es Cajetan durch den Kopf. Das Wort hatte sich in seinen Schädel eingeprägt wie ein Brandeisen in die Flanke eines Sumpfrinds.
Die Händler aus dem Süden, deren Reisen gelegentlich durch Galarosa führten, erzählten fürchterliche Geschichten über die unheimlichen Herrscher des Peynamoun. Dass sie aus dem Meer stammten, und dass die stürmische See ihr Reich war. Und dass jedes Boot, das sich zu weit von der Küste entfernte, diesen mörderischen Kreaturen rettungslos ausgeliefert wäre. Schlagartig wurde Cajetan bewusst, dass er seine Heimat nie wiedersehen würde, wenn er den Fremden auf dieses Schiff hinausfolgte.
Aber kampflos würde er sich nicht in sein Schicksal ergeben. Als die Gelegenheit günstig war, packte er sie beim Schopf. Der Fremde war gerade zum Strand hinuntergeritten, und die Wächter hatten kaum noch Augen für ihre kleinen Gefangenen übrig. Sie wirkten aufgeregt und fröhlich beim Anblick des hässlichen Gefährts. Beinahe so, als ob sie es gar nicht erwarten konnten, ihrem Tod entgegenzufahren. Unauffällig schlich er sich an den Rand des Wegs, und als keiner mehr hinsah, rannte er blitzschnell los.
Er achtete nicht auf die erschrockenen Rufe in seinem Rücken und das Gestampfe der Stiefel, sondern nutzte den winzigen Vorsprung, den er hatte. Die stählernen Panzer der Wächter sahen zwar beeindruckend aus, aber in dem dichten Unterholz waren sie eher von Nachteil. Er dagegen konnte sich schnell und leichtfüßig bewegen. Oft genug hatte er gemeinsam mit seinem Vater die Kajune durch das Unterholz verfolgt. Langbeinige Tiere, die sich so leichtfüßig bewegten wie Blätter im Wind. Jetzt stellte er sich vor, eines von ihnen zu sein. Er achtete nicht auf die Äste, die ihm ins Gesicht schlugen, oder die Dornen, die an seiner Kleidung rissen. Er dachte nur noch daran, seinen Verfolgern zu entkommen. So schnell ihn seine Beine trugen, stürmte er zwischen den Bäumen entlang. Er sprang und schlug Haken, bis der Abstand immer größer wurde und die wütenden Rufe in seinem Rücken leiser, bis sie schließlich ganz verstummten. Und dann rannte er weiter, bis die Sonne hinter dem Horizont zu versinken begann und den Wald in ein tiefes Dämmerlicht tauchte. Erst als er kaum noch die Hand vor Augen erkennen konnte, wurde er langsamer. Im letzten Licht des Tages fand er eine Wurzel, die groß genug war, um sich darunter zu verbergen. Er schob einen Haufen Blätter zusammen und rollte sich in seinem provisorischen Versteck zusammen. Beinahe augenblicklich fielen ihm die Augen zu, und er versank in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Er schreckte vom Knacken eines Asts auf, der ganz in seiner Nähe unter einem schweren Gewicht zerbrach. Schlagartig schossen ihm die Geschichten der Alten durch den Kopf. Sie erzählten von den nächtlichen Wäldern und von den Geistern, die darin hausen sollten. Kalten Seelen, die sich nach der Wärme ihrer lebendigen Körper zurücksehnten, die sie irgendwann vor langer Zeit einmal hinter sich lassen mussten. Die wie Würmer unter die Haut der Lebenden krochen, in dem verzweifelten Versuch, selbst endlich wieder lebendig zu werden. Er hatte mit eigenen Augen einmal eines ihrer Opfer gesehen, das bei lebendigem Leib verfault war, weil der Geist in seinem Innern keine Nahrung fand.