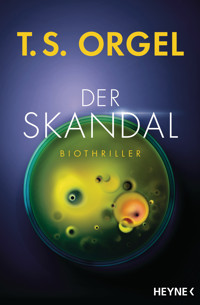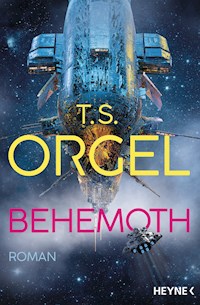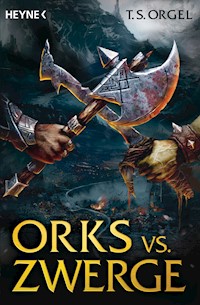11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Blausteinkriege
- Sprache: Deutsch
Magie ist ein gefährliches Spiel …
Einst war es der Nabel der Welt, doch nun steht es vor dem Niedergang: das Kaiserreich Berun, gegründet auf die Schlagkraft seiner Heere und den unerbittlichen Kampf gegen die Magie des Blausteins. Als Beruns Macht schwindet, kreuzen sich die Pfade dreier Menschen – ein Mädchen, ein Schwertkämpfer und ein Spion. Keiner von ihnen ahnt, wie unauflöslich ihr Schicksal mit der Zukunft von Berun verwoben ist.
Das Zeitalter der Blausteinkriege ist angebrochen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 771
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Das einst mächtige berunische Kaiserreich ist im Niedergang begriffen. Der alte Glanz verblasst, der Glaube an den magischen Blaustein wird von der Inquisition blutig verfolgt, während der Kaiser seinen Vergnügungen frönt. Als eine Revolte im Süden ausbricht, schlägt die Stunde ungewöhnlicher Helden: das Straßenmädchen Sara, der königliche Schwertträger Marten ad Sussetz und Thoren, der Geheimagent der Kaiserinmutter, finden sich plötzlich als Spielfiguren in einem Ringen um Macht und Magie wieder. Eine Kriegsflotte wird in den Süden gegen das aufsässige Protektorat Macouban ausgesandt – ebenjene Provinz, in der die Blausteinmagie noch ausgeübt und Menschen mit magischer Begabung noch respektiert und angesehen sind. Währenddessen wächst in den rauhen Ländern des Ostens eine Gefahr heran, die das Kaiserreich in seinen Grundfesten erschüttern wird – und der sich keiner der drei Helden entziehen kann. Die Blausteinkriege haben begonnen …
Die Autoren
Mit ihren »Orks vs. Zwerge«-Romanen haben sich die beiden Brüder Tom & Stephan Orgel in die Herzen der deutschen Fantasy-Fans geschrieben. Mit »Die Blausteinkriege« erschaffen sie nun eine neue, gewaltige Welt, die von blutigen Machtkämpfen, geheimnisvoller Magie und verzweifelten Heldentaten erschüttert wird.
Mehr zu T.S. Orgel und den Blausteinkriegen auf:
www.blausteinkriege.de
T. S. ORGEL
DAS ERBE VON BERUN
Originalausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für unsere Deutschlehrer.
Die guten und … die anderen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Originalausgabe 11/2015
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2015 by Tom & Stephan Orgel
Copyright © 2015 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Umschlagillustration: Franz Vohwinkel
Karte: Andreas Hancock
Umschlaggestaltung: Stardust, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-16885-8V002
www.blausteinkriege.de
INHALT
Karte
Prolog
Fäden
Messer
1 Berun
2 Wein, Weib und Ärger
3 Zweite Chancen
4 Die Bösen und die Narren
5 Rotkittel
6 Kriegsknechte
7 Die Mutter des Kaisers
8 Himmelsfeuer
9 Im Kreis
10 Ein fürstliches Geschenk
11 Totenlichter
12 Kleider machen Leute
13 Sieben Leben
14 Cajetan ad Hedin
15 Sturm
16 Nichts als die Wahrheit
17 Die Flamme des Ordens
18 Listen
19 Der Duft von Flieder
20 Ein Bühnenstück
21 Gaben
22 Rachegedanken
23 Einer von deiner Art
24 Die Brücke über den Korros
25 Der Duft von Rosen
26 Ein perfekter Tag
27 Gostin
28 Es wird Regen geben
29 Das Begleichen von Schulden
30 Das war erst der Anfang
31 Königliches Blut
32 Alles hat seine Ordnung
33 Scheideweg
34 Gezeichnet
35 Flüsters Welt
36 Das Ende des Neumonds
37 Gute und schlechte Nachrichten
38 Für den Moment
39 Ein Pakt
40 Jemand anderes
41 Getrennte Wege
Epilog
Personenverzeichnis
Danksagung
»Was verheißt die despotische Macht?
Oft den Untergang des Despoten und immer
den seiner Nachkommen.«
Claude-Adrien Helvetius (1715 – 1771)
KARTE
PROLOG
FÄDEN
Lebrec kauerte hinter dem Stamm des Waldriesen und wartete auf den Tod. Der Regen prasselte auf die fleischigen, dunkelgrünen Blätter des Dickichts, das den gewaltigen Baum umgab. Der würzige Geruch des Waldbodens, der Duft von verborgenen Blüten, von Fäulnis, Schimmel und Harz hing schwer in der Luft und überdeckte beinahe den metallischen Gestank des Bluts. Das Wasser rann in schmalen Bächen die rissige Rinde herab, durchtränkte sein Hemd und sorgte dafür, dass sich die Blutflecke ausbreiteten und den hellblauen Stoff langsam violett färbten. Es war jedoch nicht sein Blut, sondern das seines Bruders. Batizor lag neben ihm an den Stamm gelehnt im schwarzen Schlamm, und in seinen offenen Augen sammelte sich das Regenwasser, ehe es wie Tränen über seine Wangen rann und in die Pfütze unter ihm tropfte. Der Blutschwall aus seiner Halswunde war inzwischen zu einem dünnen Rinnsal geworden, und sein Brustkorb bewegte sich nicht mehr. Lebrec wagte es nicht, ihn zu berühren. Batizor mochte tot sein, doch sein Geist war sicher noch da, und Lebrec hatte nicht vor, sich von ihm verhexen zu lassen.
Er schielte nach oben. Der feine, blausilberne Faden hing noch immer über ihnen, sichtbar nur wegen der Regentropfen, die an ihm schimmerten – und den Blutstropfen dazwischen. Vielleicht war es auch die bittere Ironie, die ihm die Tränen in die Augen trieb. Batizor, dessen Talent dafür gesorgt hatte, dass sie das Dickicht des Waldes ungehindert durchqueren konnten, war gestorben, weil er den Fangfaden von Ralld-Spinnen übersehen und sich daran den Hals aufgeschlitzt hatte. Schon bald würden die Ralld kommen, handlange schwarze Spinnentiere in glänzenden schwarzblauen Panzern. Sie würden sich in das Fleisch seines Bruders graben, und während der Körper langsam erkaltete, würden die Insekten ihre Eier darin ablegen und ein neues Nest gründen. Ralld waren die Totengräber dieses Waldes – und wie so viele Kreaturen aus den Sümpfen des Macouban überließen sie den Tod nicht dem Zufall, sondern sorgten selbst dafür, dass es immer reichlich davon gab.
Er durfte hier nicht sitzen bleiben. Doch wohin sollte er jetzt fliehen? Um ihn herum ragten die gewaltigen Stämme der Waldriesen auf. Ein Gewirr aus Luftwurzeln verwandelte den sumpfigen Boden in jede Richtung in ein Labyrinth, und das dichte Blätterdach tauchte alles in ewiges Halbdunkel. Dunstfetzen hingen wie Nebel im Geäst und ließen das Licht noch unwirklicher erscheinen. Lebrec strengte sich an, über dem monotonen Rauschen des Regens irgendwas zu hören, doch der Wald blieb so still, wie der Regenwald des Macouban es eben war. Nein, stiller. Zu still. Noch jemand war hier draußen. Waren seine Verfolger so nahe?
Schließlich gelang es Lebrec, die Starre abzuschütteln. Schniefend schob er sich die langen schwarzen Haare aus dem Gesicht und band sein goldgelbes Kopftuch neu. Es wies ihn als Läufer seines Dorfs aus, als Boten und Blausteinsammler, und Lebrec wäre genauso wenig auf den Gedanken gekommen, das auffällige Tuch abzulegen, wie er eines seiner Beine abgelegt hätte. Er war Läufer, und laufen würde er. Auch wenn es jetzt, ohne Batizors Talent, weitaus schwieriger werden würde.
Er zog das geschwungene Messer aus dem Gürtel und fischte mit dessen Hilfe das lederne Band aus Batizors Kragen, peinlich darauf bedacht, den Toten keinesfalls zu berühren. Schließlich griff die Klinge, und er durchtrennte den nassen Riemen mit einem kräftigen Ruck, um den Anhänger aus dem blutigen Hemd zu ziehen. Auf keinen Fall würde er zulassen, dass Batizors Amulett hier zurückblieb und am Ende in die Hände jener fiel, die ihn verfolgten. Er wischte eine blutige Schliere von dem blauen, reich mit Ornamenten beschnitzten Stein. Dann verknotete er den Riemen wieder und hängte sich das Stück Blaustein um den Hals.
»Verzeih mir, Bruder«, murmelte er. »Das Meer wird dich holen, und ich werde ein Feuer für deinen Geist anzünden, damit du den Weg nach Hause findest. Wir werden auf dich warten. Aber jetzt kann ich das nicht. Ich muss nach Tiburone. Ich muss den Fürsten warnen. Wer sollte es sonst tun? Das verstehst du doch?«
Der Tote antwortete nicht.
Ein Krachen im Unterholz ließ Lebrec zusammenfahren. Irgendwo zu seiner Rechten flatterte einer der smaragdgrünen Tauvögel auf und stieg schimpfend in die Kronen der mächtigen Baumriesen. Wieder krachte etwas, und dieses Mal erkannte Lebrec das Geräusch: Eine eiserne Klinge mähte sich durch das Unterholz. Er wirbelte herum. Seine bloßen Füße glitten im schmierigen Morast aus, doch er fing sich und rannte los, weiter auf dem kaum sichtbaren Pfad, dem sie zuvor schon durch das Unterholz gefolgt waren. Dornige Ranken griffen jetzt nach seinen Beinen, zerrten am dünnen blauen Stoff seiner Hose. Das großblättrige Unterholz würde ihn verbergen, wenn er nur weit genug hineinlief. Vielleicht …
Ein kaltes Prickeln zog über seinen Rücken und richtete die Härchen in seinem Nacken auf. Ohne nachzudenken, ließ er sich fallen. Kaum eine Armlänge über ihm flimmerte etwas in der Luft und pflügte eine Schneise von beinahe zwei Schritt Breite durch das Gestrüpp. Blätter, abgeschnittene Zweige und Äste prasselten auf ihn nieder, und nur eine Handbreit vor seinem Gesicht fiel die Hälfte eines großen Leguans in den Schlamm. Lebrec rollte sich zur Seite, kam auf Ellbogen und Knie auf und kroch ins Unterholz rechts des Pfads. So schnell es das Dickicht erlaubte, zwängte er sich durch Ranken und Gestrüpp, ohne auf die Dornen zu achten, die ihm die Haut aufrissen.
Von irgendwo hinter ihm, dort, wo Batizor lag, drangen die Geräusche von Stiefeln in Schlamm zu ihm. Abermals kribbelte seine Haut, und ein zweiter Energiestoß zerfetzte das Gestrüpp weiter den Weg hinab. Es bestätigte nur, was er befürchtet hatte: Zu seinen Verfolgern, allesamt Rotkittel in den Rüstungen Beruns, gehörte mindestens einer der Begabten. Der lange Hakennasige, wenn er sich nicht täuschte. Er war am besten zu Fuß und hatte das Talent, die Luft in eine Klinge zu verwandeln.
Lebrec verzog das Gesicht. Der Hakennasige musste Blaustein verwenden, um sein schändliches Talent zu nutzen, und das in Mengen, mit denen Lebrec und selbst Batizor das nie gewagt hätten. Es würde den Mann unweigerlich umbringen. Aber nicht heute und nicht morgen, und dann war es für Lebrec zu spät.
Hastig robbte er weiter und stieß sich beinahe den Schädel an, als plötzlich der moosbedeckte Stamm eines gestürzten Urwaldriesen vor ihm im Unterholz auftauchte. Frustriert starrte er das faulende Hindernis an. Für einen Moment spielte er mit dem Gedanken, über den Stamm zu klettern, um etwas Solides zwischen sich und die schneidende Luft des Hakennasigen zu bekommen. Doch dann erstarrte er. Ein kaum merkliches Flirren hing in der Luft, nur eine Armlänge vor ihm, so als zertrenne etwas den unablässig rauschenden Regen. Ralld-Fangfäden. Aufstehen war vielleicht nicht die beste Idee.
Ein leises Scharren ließ ihn nach oben schauen. Auf dem Stamm konnte er die Umrisse zweier Männer erkennen, beide in eisernen Rüstungen und mit den roten Wämsern, die er so verabscheute. Nur das Dickicht der fleischigen Blätter über ihm verhinderte, dass sie ihn sahen. Ein dritter Windstoß fuhr in das Gestrüpp hinter ihm und ließ Holz, zerfetzte Blätter und Schlamm auf ihn niederregnen. Und in diesem Moment wurde Lebrec klar, dass ihn die Rotkittel in eine Falle gelockt hatten. Sie verfolgten ihn nicht, sondern wussten recht genau, wo er war – und sie hatten ihn in die Enge getrieben. Aber wie …?
Ein schwarzes Insekt von der Größe seines Daumens schwirrte in der Luft herum, kaum einen Schritt entfernt. Es schien auf der Stelle zu stehen und den kleinen Mann unverwandt anzusehen. Natürlich. Lebrec kannte jede Art von Käfer, die dieser Wald zu bieten hatte, aber ein Tier wie dieses hatte er bislang nur zweimal gesehen, beide Male auf dem Gewand eines der Begabten des Feindes.
Als hätte das Insekt seine Gedanken erkannt, schoss es nach oben aus dem Dickicht und stieß ein gellendes Zirpen aus. Die beiden Männer auf dem Stamm hielten inne und blickten herab.
»Da ist er!«, rief einer in diesen harten, polternden Lauten ihrer Sprache.
Leise zischend fuhr Lebrec zurück, gerade als einer der beiden auf ihn herabsprang und in einem Schauer aus Blut beinahe entzweigeschnitten wurde, noch bevor er den Boden erreichte. Der Jagdfaden eines weiteren Ralld-Nests über Lebrecs Kopf zerteilte den Mann fast bis zum Bauch, bevor er mit dem eisernen Panzer hängen blieb. Der Faden riss, und der Söldner kippte unter gellenden Schreien zur Seite, wo er in einen weiteren Faden fiel, der ihm den Kopf von den Schultern trennte.
Der zweite Rotkittel über ihm war langsamer gewesen, was ihm das Leben gerettet hatte. Unsicher starrte er auf die Reste seines Kumpans und dann auf Lebrec. Ohne Zeit zu verschwenden, sprang der Läufer auf und rammte sein Messer hinter dem Beinschutz in die Wade des Söldners. Jetzt schrie auch dieser Mann, stolperte rückwärts, verlor auf der schmierigen Rinde des umgestürzten Baumriesen das Gleichgewicht und fiel rückwärts auf der anderen Seite des Stamms hinab. Lebrec umklammerte das Messer, so fest er konnte, und wurde vom Gewicht des Fallenden in die Höhe gerissen, hinauf auf den Baum, wo er bäuchlings liegen blieb. Platschend schlug unter ihm der Gepanzerte in den Morast.
Der Läufer sah sich um. Etwas weiter entfernt kletterten zwei Männer gerade auf den gewaltigen Stamm. Hinter ihm hatten zwei andere gepanzerte Rotkittel den Pfad erreicht, den er eben erst verlassen hatte, und dort, wo sein Bruder liegen musste, standen die beiden Begabten mit zwei weiteren Söldnern.
Der Hakennasige deutete auf ihn. Fluchend rollte sich Lebrec über den Stamm und ließ sich fallen, gerade als die Stelle, an der er eben noch gelegen hatte, in einem Schauer aus Moosfetzen und fauligen Holzsplittern explodierte. Hockend landete Lebrec auf dem Söldner, der halb im Morast versunken war und ihn mit verzerrtem Gesicht anstarrte. Ohne Zeit zu verlieren, rammte er dem Mann die nackte Ferse ins Gesicht und fühlte die Nase brechen. Der Kopf des Kerls sackte zurück und klatschte in die schlierig schillernde Sumpfbrühe. Mit einem gegurgelten Fluch versuchte der Mann, ihn zu erwischen, und Lebrec trat ein zweites und drittes Mal zu, so lange, bis der Kopf schließlich unter Wasser geriet. Während die Finger des Kerls in verzweifelter Gegenwehr an seinem Bein kratzten, entwich die letzte Luft aus dem Hals des Rotkittels. Schließlich zitterte der Mann und erschlaffte.
Angewidert starrte Lebrec auf das schwarze Wasser, das vom Todeskampf zu einem widerlich gelben Schaum aufgewühlt war. Die Blasen platzten leise und verströmten einen durchdringenden Gestank. So weit er sehen konnte, erstreckte sich die schillernde Fläche zwischen den Stämmen der Bäume in die Ferne, nur durchbrochen von Inseln aus scharfkantigem Gras und den überwucherten Resten gestürzter Waldriesen. Es war ein trostloser Anblick, aber zum ersten Mal seit Beginn ihrer Flucht vor beinahe zwei Tagen fühlte Lebrec so etwas wie Hoffnung.
Fieberhaft durchsuchte er den Schal, den er als Gürtel trug, fingerte schließlich ein Blausteinfragment von der Größe eines Daumennagels heraus und schob es sich in den Mund. Er biss zu, kaute und schmeckte die Bitterkeit der harzigen Kristalle. Sofort erfüllte ein taubes Gefühl seinen Mund, und eine vertraute Kälte breitete sich in ihm aus und stach in seinen Schläfen, so wie damals, als er in den weit entfernten Bergen Wasser direkt aus der Quelle unter den Schneefeldern getrunken hatte. Prickelnd stellten sich die Haare auf seinen Armen auf, und er keuchte unwillkürlich. Selbst die Luft, die er in seine Lungen sog, schien jetzt kälter zu sein. Der Gestank des Sumpfs bohrte sich mit plötzlicher Wucht in seine Nase, legte sich auf seine Zunge und ließ ihn würgen, und das Grün des Urwalds brannte plötzlich in seinen Augen. Lebrec schüttelte den Kopf und rang um sein Gleichgewicht.
Schließlich sah er auf den Söldner unter sich, dessen Kopf inzwischen tiefer im Wasser lag. Die Brühe hatte seinen halb geöffneten Mund gefüllt, doch er rührte sich nicht. Lebrec leckte sich über das taube Zahnfleisch, dann zog er das Messer aus dem Gürtel des Toten, stand auf und machte einen vorsichtigen Schritt auf das ölig-schlierige Wasser. Es trug sein Gewicht, und der kleine Läufer grinste. Batizor hatte sich durch Unterholz bewegen können, doch sein eigenes Talent war das Wasser. Er sah auf seinen Unterarm, von dem der Regen jetzt abprallte, ohne die Haut überhaupt zu erreichen, dann hinunter auf seine Füße, die nur schwache Vertiefungen in der Oberfläche des Sumpfs hinterließen. Abermals leckte er sich über das Zahnfleisch. Vorsichtig machte er einen Schritt, dann noch einen, und dann war er auf dem Weg hinaus in den schillernden Sumpf, hinter dem sich irgendwo in der Ferne das Meer verbarg. Hätte er das erst erreicht, ging es immer nach Westen und nach Süden, bis er die Wildnis verlassen und das Macouban warnen konnte, vor der Armee aus Berun, die ihm folgte, ohne dass irgendjemand etwas davon ahnte. Er hatte es geschafft. Niemand konnte ihn jetzt noch auf…
Ein heftiger Schlag traf sein Schienbein und ließ ihn nach vorn stürzen, wo der Sumpf ihn federnd auffing. Stechender Schmerz folgte. Stöhnend hob Lebrec den Kopf und starrte auf sein Bein, in dem er weißlich den Knochen schimmern sah. Dicht über dem Sumpfwasser erstreckte sich ein weiterer Ralld-Faden, an dem jetzt Reste seiner Hose und sein Blut hingen. Seine Konzentration flackerte, und mit einem heißen Aufwallen von Angst fühlte er, wie die bislang beinahe feste Oberfläche des Wassers unter ihm nachgab. Der Sumpf zog ihn in seine Umarmung.
MESSER
So, da wären wir.« Der Kriegsknecht deutete auf einige schlicht gemauerte Gebäude. Ohne weiter auf den Mann zu achten, der ihm folgte, nahm er seine beiden Eimer auf und schlenderte grußlos über den sandigen Hof in Richtung eines niedrigen, lang gestreckten Nebengebäudes davon. Aus dem Schornstein quoll weißer Rauch. Der Mann würdigte die Unfreundlichkeit des Kriegsknechts keiner Regung. Stattdessen sah er sich wortlos auf dem beinahe quadratischen Hof des Kastells um. Wie die meisten der Grenzkastelle am östlichen Rand Beruns war Arneck ein schmuckloser, grob quadratischer Bau, aufgemauert aus Bruchstein und umgeben von einem steilwandigen Graben. Wie bei den meisten Anlagen dieser Art so weit in der östlichen Ebene war er wasserlos und felsig. Niedrige, geduckt wirkende Türme mit hölzernen Schindeldächern bildeten die Ecken des Quadrats, zwei weitere erhoben sich über den Toren, die nach Osten und Westen führten. Sie markierten den Grenzübergang des berunischen Reichs, auch wenn es etwas seltsam wirkte, wenn man bedachte, dass es hier keinerlei Grenzwall oder sonstige Markierung abseits des Kastells gab. Der Theorie nach lag im Westen das großartige berunische Kaiserreich und östlich von hier das wilde Königreich Kolno. Tatsächlich erstreckte sich in alle vier Himmelsrichtungen bis zum Horizont eine endlos wirkende Grassteppe, die sich um keine Grenzen scherte und bemerkenswert frei von landschaftlichen Merkmalen war. Arneck war ein staubiger Ort, der nur existierte, weil hier eine der wenigen Handelsstraßen zwischen Berun und dem Kolno entlangführte und auf den Karten beider Reiche nun mal ein Punkt existieren musste, an dem das eine aufhörte und das andere begann. Einen halben Tag östlich von hier lag eine ziemlich ähnliche Grenzstation der kolnorischen Truppen. Zwischen hier und dort erstreckte sich Niemandsland. Wie auch in jede andere Richtung, wenn man ehrlich war. Kein Mensch wohnte freiwillig hier.
Im Inneren der Mauern drängte sich ein knappes Dutzend grasgedeckter Häuser aus demselben rötlichen Bruchstein. Baracken für die hier stationierten Kriegsknechte, Stallungen, Speicher, ein Gästehaus für die Besatzungen der hier passierenden Handelszüge, eine Taverne, eine Schmiede und andere Versorgungseinrichtungen, die man hier draußen brauchte, um über die langen, trockenen Sommer und die ebenso langen, eisigen Winter zu kommen. Vor dem östlichen Tor, durch das der Mann gerade gekommen war, duckte sich eine kleine Anzahl niedriger Behausungen, die Winterlager einiger Viehhirten, Jäger und einer Handvoll anderer, die hier draußen gestrandet waren und wohl nicht wussten, wohin sie noch gehen sollten. Vermutlich auch die Unterkünfte der Familien einiger der Kriegsknechte, denn wie überall in Berun war es den Angehörigen verboten, innerhalb des Kastells zu wohnen. Was vor den Mauern geschah, wurde stillschweigend toleriert.
Wie es aussah, gab es zurzeit nicht viele Besucher. Lediglich ein abgedeckter Wagen voller Kisten stand im Schatten einer der Außenmauern, Pferde waren nirgendwo zu sehen, und nur eine Handvoll Männer ging innerhalb des Kastellhofs ihrer Arbeit nach. Alle trugen die rostroten Hosen, Hemden und Wämser der Truppen Beruns – Rüstungsteile schienen jedoch keine Pflicht zu sein. Dem Anschein nach nahm man es hier draußen mit der Disziplin nicht ganz so genau wie anderswo. Lediglich die beiden Männer am Tor hatten die vollständige Rüstung der Beruner Kriegsknechte angelegt, aber wesentlich wachsamer hatten sie auch nicht gewirkt. Zumindest hatten sie für den einsamen Fremden und seinen zerknitterten Passierschein kaum mehr als einen gelangweilten Blick übrig gehabt, bevor sie ihn ins Innere des Kastells gewinkt hatten.
Der Fremde wirkte nicht sonderlich imposant. Er war eine hagere, etwas gebeugte Gestalt, über deren schmalen Schultern ein abgeschabter dunkler Staubmantel hing. Dünne Beine ragten darunter hervor. Sie steckten in staubigen Hosen und ausgetretenen Schnabelschuhen und verliehen ihm das Aussehen eines großen, missmutigen Schreitvogels. Die spitze Nase, die zwischen dunklen, fettsträhnigen Haaren hervorschaute, machte es nicht besser.
Der vogelhafte Mann band sein dürres Maultier an einen der Geländerpfosten am Vordach der Schmiede, schöpfte einen Eimer Wasser aus einem nahen Bottich und stellte ihn vor seinen langohrigen Begleiter. Dann streckte er den Kopf durch das offene Tor und nickte dem untersetzten Schmied zu. »Die Reisenden zum Gruß, Meister«, sagte er und klopfte mit einer silbernen Münze gegen den Torpfosten. »Mein Muli hat ein lockeres Eisen, denke ich. Könnten Sie mal danach sehen?«
Der Schmied sah auf, seine Augen wanderten zu der Münze, und er wischte sich mit dem Ärmel über den Mund, bevor er nickte. »Nach dem Essen«, brummte er.
Der Vogelhafte schüttelte den Kopf und wirkte ein wenig enttäuscht. »Jetzt. Wenn Sie die Münze ganz haben wollen. Ich möchte heute noch ein ganzes Stück weiter kommen.«
Der Schmied runzelte die Stirn. Seine Augen ruckten wieder zur Münze, auf der gut sichtbar der berunische Adler prangte. Dann zuckte er mit der Schulter und nickte. »Lassen Sie’s hier.«
»Das hatte ich vor.« Der Fremde legte die Münze auf ein Fass an der Tür. »Taugt das Essen in eurer Schänke etwas?«
»Es ist besser, als hungrig zu bleiben.« Der Schmied legte den Hammer beiseite und wischte sich die Hände an einem Tuch im Gürtel ab. »Die Auswahl ist hier nicht so groß. Ein Rat: Nehmen Sie nicht den Eintopf.«
Der Fremde nickte. Seine langen dürren Finger tippten neben die Münze, dann verließ er die Werkstatt und marschierte auf die Schänke zu.
Man hatte vor dem Eingang einige roh gezimmerte Bänke und Tische aufgestellt, und der Vogelmann setzte sich in die Sonne, faltete die Hände und schloss halb die Augen. Reglos wartete er, bis sich ein Schatten zwischen ihn und die frühherbstliche Sonne schob, bevor er die Lider hob. Eine ältere Frau stand vor ihm, nicht sonderlich attraktiv, doch der Vogelmann beurteilte Menschen nicht nach ihrem Äußeren. »Die Reisenden zum Gruß«, sagte er leise. »Ich habe gehört, der Eintopf sei zu empfehlen.«
Die Frau sah ihn für einen Moment misstrauisch an, doch das schmale Gesicht des Fremden zeigte nichts als Aufrichtigkeit. Schließlich zuckte sie mit den Schultern und nickte.
»Ihr habt Bier?«
Die Frau nickte erneut. »Ich braue es selbst.«
Der Vogelmann lächelte schmal. »Ich freue mich darauf«, sagte er. »Dann einen Eintopf und ein Bier, bitte.« Er schielte an der Alten vorbei nach der Sonne. »Sie wissen, wo ich die anderen Männer in diesem Kastell finde? Meister Barnard Lisst, den Schreiber, zum Beispiel?«
Die Frau sog an einer Lücke in ihrem Gebiss, dann sah sie über den Hof und nickte in Richtung eines der Türme. »Da kommt er gerade«, stellte sie fest.
Der Vogelmann folgte ihrem Blick und lächelte erneut. »Das trifft sich hervorragend. Richten Sie ihm bitte aus, dass ich ihn sprechen möchte, und bringen ihm ebenfalls ein Bier. Das geht auf mich.« Er legte einige Kupfermünzen auf den Tisch, die schneller in der Schürze der Wirtin verschwanden, als sie auf dem Tisch gelandet waren. Dann passte die Alte den sich jetzt nähernden Mann ab und wechselte einige Worte mit ihm, wobei sie in Richtung des Fremden nickte, bevor sie sich wieder nach drinnen verzog.
Der Vogelmann faltete erneut seine dürren Finger auf der Tischplatte und musterte den Mann mit einem schmalen Lächeln. Barnard Lisst war untersetzt, mit offenem Gesicht und Tintenflecken an Fingern und Hemd. Obwohl er vermutlich die dreißig Jahre noch nicht erreicht hatte, war deutlich zu sehen, dass sich seine rötlich braunen Haare bereits auf dem Rückzug befanden, was er mit Öl und einem strengen Scheitel zu kaschieren versuchte. Lisst erwiderte den Blick des Fremden verwundert, bevor er an den Tisch trat. »Sie wollten mich sprechen …?«
»Messer«, sagte der Vogelmann.
Die Verwirrung des Rundlichen nahm zu, und der Fremde nickte entschuldigend, was ihn noch vogelhafter erscheinen ließ. »Meister Messer«, wiederholte er.
»Messer? Sie sind …?«
»Ein Bote. Im Moment. Ich habe vor Jahren als Feldscher gedient. Daher der Name. Ich habe mich an ihn gewöhnt.« Er deutete auf die Bank auf der anderen Seite seines Tischs. »Es trifft sich gut, dass Sie gerade Zeit haben, Meister Lisst. Ich habe Ihnen eine Nachricht zu überbringen.«
»Eine Nachricht?« Der Schreiber ließ sich auf die Bank fallen. »Für mich? Von wem?«
»Dazu komme ich gleich. Ah, danke Euch, gute Frau.« Messer nahm von der zurückgekehrten Wirtin zwei Tonkrüge entgegen, schob einen davon dem Schreiber über den Tisch und zog die Schale mit Eintopf heran, um den Inhalt interessiert zu mustern. Die Schüssel war gefüllt mit einer sämigen grauen Masse, in der weißliche Klumpen und einige braune Fäden an die Oberfläche dümpelten und träge wieder in der Tiefe verschwanden. Abermals das vogelhafte Nicken, dann griff Meister Messer zum Löffel und schob sich eine Kostprobe in den Mund. Er hob die dünnen Brauen, riss ein Stück des ebenfalls grauen Brots ab und schob es dem Eintopf hinterher. »Ah«, stellte er fest. »Lokale Spezialitäten. Immer wieder ein Erlebnis.« Erneut nahm er einen Löffel voll, wiegte den Kopf, dann sah er den Schreiber an.
»Ich habe eine Nachricht für einen Barnard Lisst, stationiert in Arneck«, wiederholte er.
Der Schreiber beobachtete mit unergründlichem Gesichtsausdruck, wie sich der Vogelmann durch den Eintopf löffelte, bevor er sich mit einem leisen Kopfschütteln von dem Anblick losriss. »Das bin ich, ja.«
»Ich muss das überprüfen«, stellte Messer fest. »Geboren und aufgewachsen in Berun, also der Hauptstadt selbst. Im Gelldern-Viertel, als Sohn der freien Marktständerin Gund Lisst.«
Der Schreiber nickte verwirrt. »Was …?«
Messer hob die Hand. »Vater Marek Lisst, Beruf …«
Der Schreiber sah ihn verwirrt an. »Das ist nicht richtig. Ich kenne keinen Marek. Mein Vater war … Nun, meine Mutter war nicht verehelicht, als ich geboren wurde. Sie trägt immer noch den Namen ihrer Eltern.«
Wieder hielt das schmale Lächeln auf Messers Gesicht Einzug, und sein Kopf zuckte in der Karikatur eines Nickens erneut vor und zurück. »Danke. Das war die Bestätigung, die ich wollte.« Er griff in seinen Mantel, zog einen mehrfach gefalteten und versiegelten Bogen Pergament hervor und legte ihn auf den Tisch. »Ihr Vater war ein Beruner Edelmann. So sagte mir Ihre Mutter jedenfalls. Interessant. Sie haben weder ihre Haar- noch ihre Augenfarbe.«
Der Schreiber sah Messer jetzt misstrauisch an. »Meine Mutter hat mit Ihnen darüber gesprochen?«
»Ausführlich. Eine sympathische, hilfsbereite Dame, die viel zu lange keinen Besuch von ihrem Sohn hatte.«
Lisst schnaubte. »Das klingt nicht so, als hätten Sie sie jemals getroffen, Meister Messer. Was wollen Sie von mir?«
Messer zuckte mit den Schultern. Das dünne Lächeln war noch da. »Nichts. Ich muss nur wirklich sichergehen, dass meine Botschaften auch die richtigen Personen erreichen. Entschuldigen Sie bitte diese kleine Finte.« Er schob dem Schreiber den Brief zu und widmete sich abermals seinem Eintopf. Als Lisst, noch immer misstrauisch, nach dem Brief griff, deutete Messer mit seinem Löffel auf den Ärmel des Schreibers. »Sie haben ein Talent, Meister Lisst, richtig?«
Die Hand des Schreibers erstarrte in der Luft, und er sah sich unwillkürlich um. Erst als er niemanden in Hörweite entdecken konnte, bewegte er sich wieder. »Was soll diese Frage?«
Messer winkte mit dem Löffel ab. »Nicht so wichtig. Es hat mich nur interessiert. In der Tinte an Ihrem Ärmel scheint mir Blaustein zu sein, und mir fällt nur ein Grund ein, warum das so sein könnte.«
Der Schreiber starrte argwöhnisch auf die Flecken an seinen Händen. »Und wenn es so wäre?«, murmelte er.
Messer zuckte mit den Schultern. »Dann wäre es so. Ich denke nicht, dass das hier draußen, so weitab der Hauptstadt, jemanden interessiert. Und falls es Sie beruhigt – Sie sind nicht der Einzige hier.« Messer drehte einen Ring an seiner knochigen Linken, bis ein kleiner blauer Stein darauf sichtbar wurde, den er bis jetzt in der Handfläche verborgen gehalten hatte. »Es ist nur persönliche Neugier. Mein Talent ermöglicht es mir, dafür zu sorgen, dass andere keine Schmerzen empfinden. Deshalb bin ich einst Feldscher und Knochenrichter geworden. Es schien mir eine logische Wahl zu sein. Seitdem versuche ich, anhand der Professionen anderer ihr Talent herauszufinden. Nennen Sie es eine Art Passion. Bei Ihnen bin ich mir aber noch unschlüssig.«
Lisst leckte sich über die Lippen. Dann nahm er einen tiefen Schluck von seinem Bier und sah sich abermals um. »Nichts Großartiges«, murmelte er schließlich. »Mein Gedächtnis ist ungewöhnlich. Ich merke mir, was immer ich lese oder aufschreibe. Wort für Wort.«
Messer zog beide Augenbrauen hoch. »Das passt. Beeindruckend. Wenn man bedenkt, was man mit diesem Talent woanders als hier anfangen könnte. Sie würden es weit bringen, Meister Lisst.«
Der Schreiber zuckte mit den Schultern und senkte geschmeichelt den Kopf. »Meine Dienstzeit hier ist bald vorbei. Ich denke, ich werde nach Berun zurückkehren und sehen, was ich daraus machen kann.«
Messer legte den Löffel in die mittlerweile leere Schale, nahm einen tiefen Zug aus seinem Krug und seufzte zufrieden. »Ein guter Plan. Es ist immer gut, Pläne für die Zukunft zu haben.« Er deutete auf den Brief unter Lissts Fingern. »Dann will ich Sie mal nicht länger von Ihrer Botschaft abhalten. Wenn Sie entschuldigen, ich werde kurz nachsehen, wie weit der Schmied mit meinem Reittier ist. Genießen Sie die letzten Sonnenstrahlen. Es wird bald kalt werden.« Er erhob sich von der Bank und klopfte Lisst freundschaftlich auf den Rücken, als er sich an ihm vorbei in Richtung der Schmiede schob. Die fingerlange, kaum sichtbare Nadel aus Blaustein in seiner Hand glitt beinahe widerstandslos zwischen die Nackenwirbel des Schreibers. Nur für einen Lidschlag glomm sie in der Sonne bläulich auf, dann verschwand sie vollständig unter der Haut. Lisst zuckte nicht einmal. Messer hatte nicht gelogen, was sein Talent anging. Gemächlich ging er in Richtung Schmiede und wechselte einige Worte mit dem Handwerker, der noch immer mit dem Hufeisen seines Maultiers beschäftigt war.
Als er wieder an den Tisch kam, saß der Schreiber reglos über seinen Brief gebeugt. Er war blass, und eine Vielzahl kleiner, glitzernder Schweißperlen hatte sich auf seiner Stirn und seinen Schläfen gebildet. Messer beugte sich vor, die Augen scheinbar auf das Schreiben geheftet, das vor Lisst auf dem Tisch lag. »Die eigentliche Nachricht, Meister Lisst«, raunte er dicht neben dem Ohr des Schreibers, »ist, dass man herausgefunden hat, wer Ihr Vater ist. Ich gratuliere – wie es aussieht, sind Sie ein Prinz. Zumindest ein Bastardprinz, einer aus einer ganzen Reihe. Der alte Löwe von Berun war … umtriebiger, als gemeinhin bekannt ist. Das Schlechte daran ist, dass unsere Kaiserliche Hoheit, die Reisenden mögen ihn bewahren, lieber ein Einzelkind ist, als Bastardgeschwister anzuerkennen, um sein Erbe zu teilen. Also hat man mich geschickt, um das den Betreffenden möglichst schmerzfrei nahezubringen. Es tut mir wirklich leid. Aber das Leben ist nicht gerecht.« Mitfühlend tätschelte er Lisst die Schulter und richtete sich auf.
Die Wirtin sah ihn fragend an, und Messer zuckte mit den Schultern. Er nickte in Richtung des stoßweise atmenden Mannes. »Es scheinen schlechte Nachrichten gewesen zu sein«, sagte er. »Vielleicht bringen Sie ihm noch ein Bier auf meine Kosten. Ich mag es nicht, schlechte Nachrichten zu überbringen.« Er verzog das Gesicht. »Aber einer muss es wohl tun.« Seufzend drückte er der Wirtin noch eine Münze in die Hand und ließ sich den Weg zum Abort weisen. Ohne Hast erledigte er sein Geschäft, bevor er zur Schmiede zurückschlenderte und sein Maultier abholte. Der Schreiber saß noch immer am Tisch, als Messer das Osttor in Richtung des Kolno passierte. Erst eine kleine Weile später fiel er nach vorn und schlug mit dem Kopf auf die Tischplatte.
Auf dem halben Weg zum kolnorischen Grenzkastell verließ der Vogelmann die Handelsstraße und schlug einen Weg über die staubige Grasebene ein, der ihn in einem großen Bogen, außerhalb der Sichtweite von Arneck, zurück nach Westen führte. Weitere Arbeit wartete in Berun auf ihn, Arbeit von der Art, die ihn nach Arneck und zu Barnard Lisst gebracht hatte.
»Sieh an«, sagte er nach einer Weile zu seinem Maultier. »Der Schmied hatte recht, was den Eintopf anging. Wer hätte das gedacht?«
1
BERUN
Die Stadt erstreckte sich um die lang gezogene Bucht herum, eingebettet zwischen sanften, mit Pinienwäldern überzogenen Hügelketten auf der einen und den schroffen Felsen der Steilküste auf der anderen Seite. Auf der Spitze thronte uneinnehmbar die Kaiserfestung. Ein Ehrfurcht gebietendes Gebilde aus Mauern, Toren und massiven Türmen, die sich weit über den Dächern der Stadt in den grauen Herbsthimmel hineinstreckten. Darunter fielen terrassenartig die Dächer der Altstadt ab, deren Plätze und Gassen durch steile Treppen miteinander verbunden waren und für Fremde ein undurchdringliches Labyrinth aus Stein bildeten. Ein Haus drängte sich an das nächste, bis ganz hinunter zum Hafen, in dem Boote und Schiffe aus aller Herren Länder auf den Wellen schaukelten.
Schon an normalen Tagen waren Beruns Gassen völlig überfüllt, doch heute schienen sie aus allen Nähten zu platzen. Trotz des andauernden Regens hatten unzählige Händler ihre Stände zu Füßen der Kaiserfestung aufgebaut, und ein steter Strom aus Pferden und Menschen wälzte sich vom Haufen aus entlang der Tempelstraße auf den großen Marktplatz zu. Aus allen Teilen des Reichs waren sie angereist. Bauern aus Doring, die zu Fuß die gefährliche Reise entlang der Küste auf sich genommen hatten, Priester aus Starnim, heilige Männer aus den Orden der Sucher, Schausteller, Artisten, ehrbare Handwerker und unehrliche Bettler. Und natürlich all jene Gestalten, die auf unauffälligere Art ihren Lebensunterhalt erwarben und von Menschenmassen wie dieser geradezu magisch angezogen wurden.
Viele von ihnen kannte Sara mit Namen. Dammer und Thurwieser zum Beispiel, die die Gassen rund um den Heumarkt für sich beanspruchten und dort schon seit dem frühen Morgen unachtsame Reisende um die Geldbeutel erleichterten. Oder die alte Sumpfhaag, die den Leichtgläubigen ihr Schicksal aus der Hand las. Und natürlich Heygl und Scheel Einohr, die ältesten Söhne von Feyst, dem fetten Wirt des Roten Bären. Scheel war der Schlimmste seiner Brut. Ein zäher, dünner Kerl mit scharfer Klinge und einem fiebrigen Glanz in den Augen. Er hatte dafür Sorge zu tragen, dass die Straßenkinder ihre Arbeit zuverlässig verrichteten und keins von ihnen sich auch nur eine einzige der ergaunerten Münzen selbst unter den Nagel riss.
Scheel hasste jeden Menschen auf der Welt, aber auf Sara hatte er es ganz besonders abgesehen. Sie war eine Metis aus dem Süden des Macouban, und allein die dunkle Färbung ihrer Haut reichte aus, um sie zum Ziel seiner Verachtung zu machen. Noch viel weniger gefiel ihm allerdings, dass sein Vater sie brauchte, mehr noch als ihn. Denn Sara besaß das, was die Beruner das Schandmal nannten und sie selbst einen Fluch. Für Feyst waren ihre Fähigkeiten dagegen ein wahrer Segen. Nur deshalb hatte er sie von der Straße aufgesammelt und ihr zu Essen und ein Dach über dem Kopf gegeben. Es hatte sich für ihn ausgezahlt. Wenn es hart auf hart käme und er sich zwischen einem seiner eigenen Söhne oder Sara entscheiden müsste, hatte er mal gesagt, dann würde er ganz sicher seinen Sohn opfern, denn er hatte ja ohnehin schon mehr als genug. Diese Worte hatten ihr Leben nicht gerade leichter gemacht. Scheel hatte es bislang zwar nicht gewagt, ernsthaft Hand an sie zu legen, aber sie wollte es auch nicht darauf ankommen lassen. Es schien besser, ihm aus dem Weg zu gehen, wann immer es möglich war.
Ganz besonders an einem Tag wie heute. Sie öffnete die Hand und blickte auf die Kupfermünzen hinab, die sie für sich abgezweigt hatte. Wenn Scheel sie damit erwischte, würde er wohl jede Zurückhaltung aufgeben. Für so einen Diebstahl, wie er es nannte, hatte nämlich auch sein Vater kein Verständnis. Der hatte mal eines der Kinder, einen stotternden Jungen, der auf den Namen Schiefer hörte, dabei erwischt, wie er eine Handvoll Münzen unter einem Stein im Keller versteckte. Er hatte sie alle zusammenrufen lassen und Schiefer so heftig mit seinem Stock verprügelt, bis der winselnd und blutend zusammengebrochen war. Dann hatte er gewartet, bis sich Schiefer aufgerappelt hatte, und weiter auf ihn eingeprügelt. Als er fertig war, konnte der Junge nicht mehr richtig laufen. Seitdem saß er mit einem dümmlichen Grinsen auf dem Untermarkt und bettelte dort für den Wirt und seine Familie.
Es hatte wieder zu regnen begonnen, und die Straße verwandelte sich unter den Füßen der Marktbesucher langsam in einen Sumpf aus Schlamm und Dreck. In ihrer Heimat hatte Sara das Gefühl des Regens auf ihrer Haut geliebt. Doch dort war er auch warm und weich gewesen, während er in Berun immer nur die Kälte des Nordens mit sich brachte.
Zitternd zog sie den Kopf zwischen die Schultern und stapfte die Straße hinab auf die finstere Fassade des Flammenschwertordens zu. Ein Ehrfurcht gebietendes Gebäude, dessen Glockenturm wie ein mahnender Zeigefinger in den schmutziggrauen Herbsthimmel ragte und der den Schauplatz des heutigen Spektakels darstellte. Sie kam an einem rauchenden Herdfeuer vorbei und stieß auf Flynn Hasenfuß, der mit großen, hungrigen Augen zu den Bucheckernfladen hinaufblickte, die im heißen Fett einer Eisenpfanne vor sich hinbrutzelten. Der Duft des frisch gebackenen Teigs ließ ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen, und das schmerzhafte Ziehen im Magen erinnerte sie daran, dass sie heute noch nichts gegessen hatte.
»Scheel sucht nach dir«, sagte Flynn, während er seinen hungrigen Blick auf die Münzen in ihrer Hand richtete. Er war eines der zahlreichen Waisenkinder, die Feyst bei sich aufgenommen hatte. Ein dürrer Junge von vielleicht zehn oder zwölf Sommern, der eine schnelle Auffassungsgabe besaß und noch schnellere Beine – die hatten ihm auch seinen Beinamen eingebracht. »Er sagt, dass es wichtig ist und dass er dich unbedingt sehen will.«
Sara schnaufte. Natürlich ließ Feyst nach ihr suchen. Ein Tag wie heute war wie geschaffen für seine Art von Geschäften. Er musste schon sehr betrunken sein, um diese Gelegenheit nicht beim Schopf zu packen. Dennoch war sie fest entschlossen, sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen zu lassen. Nicht heute, verdammt.
»Wir sollen alle nach dir suchen.« Flynn trat von einem Fuß auf den anderen, schniefte und warf einen Blick über die Schulter. »Du weißt, was passiert, wenn wir dich nicht zu ihm bringen.«
Sie verzog das Gesicht. Sie konnte sich nur zu gut vorstellen, wie der alte Fettsack schimpfend und fluchend durch das Wirtshaus tobte und nach allen Seiten Schläge mit seinem Stock austeilte. Selbst die eigenen Söhne fürchteten ihn, wenn er einen seiner unkontrollierbaren Wutausbrüche bekam. Um die tat es ihr zwar nicht leid, aber um Flynn schon. Der Junge war einer der wenigen Menschen, denen es egal war, ob sie verflucht war oder nicht. Vielleicht war er auch noch zu jung, um zu begreifen, was das bedeutete, aber zumindest akzeptierte er sie so, wie sie war – und dafür sollte er nicht auch noch bestraft werden. Nachdenklich kaute sie auf ihrer Unterlippe herum. »Also gut, ich komme mit dir.« Sie schnipste eine ihrer Münzen in die Luft. »Aber zuerst besorgen wir uns etwas zu essen und schauen das Spektakel an. Einverstanden?«
Flynns Blick folgte der Bahn der Münze und wanderte dann zurück zu den Teigfladen in der Pfanne. Mit dem Ärmel wischte er sich den Rotz von der Oberlippe und grinste.
»Vier Kupfer«, sagte der Mann an der Feuerstelle. Er war groß und fett, und ein dichter Pelz aus schwarzen Haaren bedeckte seine Unterarme. Mit seinem schweren Holzlöffel fischte er einen Fladen aus der Pfanne. »Wenn du überhaupt so viel dabeihast. Ansonsten verpiss dich. Deine dunkle Haut vergrault mir die Kundschaft.«
»Vier?«, fragte Sara. »Seit wann kannst du für einen Haufen verbrannten Teig so viel verlangen?«
»Seitdem die Leute so viel dafür bezahlen.« Der Bäcker wies mit dem Löffel die Straße hinab. »Schau dich mal um. Der Markt ist voll mit hungrigen Reisenden, die jeden Preis für meine Fladen bezahlen würden. Aber ich bin ein anständiger Mann und verlange nur vier.« Nach kurzem Zögern streckte er die entsprechende Zahl Finger in die Luft, und Sara vermutete, dass er nur nicht mehr verlangte, weil er nicht weiter zählen konnte. Sie hielt ihm ihre drei Münzen unter die Nase. »Wie viel bekomme ich hierfür?«
»Dafür kannst du zusehen, wie ich mit den Teigresten meine Schweine füttere.«
»Ich habe aber nicht mehr.«
Der Bäcker grunzte und musterte sie von Kopf bis Fuß. Ein lüsternes Glitzern trat in seine Augen. »Du kannst vielleicht auch noch auf andere Art bezahlen. Aber so, wie du aussiehst, schuldest du mir danach immer noch deine drei Kupferstücke.«
Sara warf ihm einen finsteren Blick zu. »Und weißt du, was du mich kannst?«, zischte sie.
Der Bäcker lachte und schüttelte den Kopf. »Ich habe es mir gerade anders überlegt. An einer wie dir hätte ich mir ohnehin nicht die Hände schmutzig gemacht.« Er hob den Holzlöffel. »Und jetzt mach, dass du davonkommst, oder ich geb dir hiermit eins drüber, du Metisschlampe.«
»Halt den Mund!«, rief Flynn und hob einen Stein von der Straße auf. Zornig baute er sich vor Sara auf und funkelte den Bäcker an. »Sonst bekommst du es mit mir zu tun!«
Der Bäcker lachte noch lauter. »Schaut euch das an, der kleine Ritter nimmt seine Metisschlampe in Schutz. Ich werde dir zeigen, was mit kleinen Rittern geschieht, die in den Krieg ziehen …« Der Holzlöffel fuhr herab und hätte Flynn hart getroffen, wenn nicht eine Hand dazwischengefahren wäre und dem Mann die Waffe entrissen hätte.
»Genug«, rief eine tiefe, raue Stimme. Sie gehörte einem stämmigen Glatzkopf, nicht sehr groß, mit einem harten Gesicht, das von tiefen Furchen durchzogen war. Seine platte Nase sah aus, als wäre sie in ein paar Faustkämpfe zu viel geraten, seine Ohren standen ab wie Blumenkohlblätter. Sara kam dieses Gesicht bekannt vor. Sie konnte sich ziemlich gut an Gesichter erinnern – vor allem, wenn sie so hässlich waren wie dieses.
»Wenn ihr euch gegenseitig umbringen wollt«, sagte der Glatzkopf, »dann trefft euch draußen auf dem Richtfeld. Innerhalb der Stadtmauern ist es verboten, die Schwerter zu ziehen.«
»Die was?« Der Bäcker glotzte ihn mit großen Augen an. Flynn lachte.
»Das gilt auch für dich, Junge. Lass den Stein fallen!« Der Glatzkopf funkelte ihn finster an und gab dann dem Bäcker seinen Löffel zurück. »Einen Fladen für mich, zwei für den kleinen Ritter und seine Dame, und die Reste für deine Schweine.«
Der Bäcker wurde knallrot und blies die Backen auf. »Was fällt dir ein? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich die Metisschlampe und das Bettlerkind bedienen?«
»Weil du mit einem Mann redest, der das Recht besitzt, innerhalb der Stadtmauern die Waffe zu ziehen.« Der Glatzkopf schlug seinen Umhang zurück und legte die Hand auf den Griff eines langen Schwerts. Es war eine schlichte Klinge ohne Verzierungen. Eine Klinge, die für den Kampf geschmiedet war und nicht für Prahlerei.
Der Bäcker riss die Augen auf und verneigte sich eilig. »Ich konnte doch nicht ahnen, dass Ihr … Ich wusste doch nicht, Herr …«
»Jetzt weißt du es.« Der Glatzkopf zog einen Geldbeutel hervor und warf ihm eine Handvoll Kupferstücke vor die Füße. »Wenn ich du wäre, würde ich jetzt die besten Fladen backen, die ich zustande bringen kann. Und zwar schnell. Ich habe nicht viel Zeit.«
Flynn stopfte sich seinen Fladen fast ganz in den Mund. Sara zwang sich, das Knurren ihres Magens zu ignorieren. Sie war es nicht gewohnt, dass ihr in dieser Stadt etwas geschenkt wurde, und schon gar nicht von einem Fremden. Misstrauisch beäugte sie den Glatzkopf. »Was verlangt Ihr dafür, Herr?«
»Dass ihr es esst.« Der Glatzkopf verzog keine Miene. »Was denn sonst? Außerdem kannst du dir die Anrede sparen. Ich gehöre nicht zum Adel.« Er biss in seinen Fladen und wandte sich zum Gehen.
Sara runzelte die Stirn. »Aber Ihr gebt ihnen Befehle.«
Der Glatzkopf blieb stehen. Der Ausdruck seines zerschundenen Gesichts änderte sich nicht. »Wie kommst du darauf?«
»Weil Ihr der Puppenspieler seid.« Sie nickte in Richtung des Ordenshauses der Flammen. »Ich habe Euch auf der Bühne gesehen. Ihr sagt den Adligen dort oben, welche Rolle sie zu spielen haben, nicht wahr?«
»Eine interessante Feststellung.« Der Glatzkopf wischte sich mit dem Ärmel über den Mund. »Wenn ich der Puppenspieler sein soll, wer sind dann deiner Meinung nach die Marionetten?«
Sara dachte darüber nach. »Da wäre zunächst mal der Richter. Das ist der hagere Mann mit dem stechenden Blick. Wenn er auf der Bühne steht, trägt er eine rote Robe mit dem Bild einer brennenden Klinge. Außerdem der Weise. Das ist der Mann mit den schlohweißen Haaren und dem dicken Bauch. Er hätte vermutlich eine Menge kluger Dinge zu sagen, aber keiner hört ihm zu, weil er schon alt ist und sich kein Gehör mehr verschaffen kann. Dann fehlen noch der Herrscher, die Edelleute, der Henker. Der Narr, der Wahnsinnige und das Hofvolk.« Konzentriert zählte sie die Marionetten an ihren Fingern ab. »Und natürlich der Hauptdarsteller. Manchmal sind es gleich mehrere, aber nur selten Heldenfiguren. Denn meistens führen sie ein Lehrstück auf, fast nie eine Komödie. Obwohl ich die am liebsten sehe.«
Der Glatzkopf lachte. »Wirklich ein interessanter Vergleich. Ich kann sie beinahe vor mir sehen, so wie du sie beschrieben hast. Ein Haufen aufgeblasener Schauspieler, die alle nur versuchen, sich im besten Licht darzustellen. Als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt als diese Bühne. Nur leider ist das alles kein Spiel, und ich habe meine Zweifel, dass das Publikum die richtigen Lehren daraus zieht.« Er spuckte auf den Boden und zuckte mit den Schultern. »Mein Name ist übrigens Henrey Thoren. Meinetwegen kannst du mich auch ›Puppenspieler‹ nennen. Die Geschichten schreibt allerdings ein anderer.«
Der Platz vor dem Ordenshaus der Flammen war eine Masse aus schiebenden und drückenden Leibern. Edelleute und Bauern standen dort Schulter an Schulter, begierig darauf, so nah wie möglich an den Rand der Bühne zu gelangen, um den besten Blick auf das anstehende Spektakel zu erhaschen.
Geschickt drückte sich Sara durch das Gedränge, Flynn fest an der Hand, damit er von der Menge nicht davongerissen wurde. Es schien Stunden zu dauern, bis sie endlich durch das schlimmste Gedränge hindurch waren. Entlang der uralten Tempelmauer war eine Handvoll Marktstände aufgebaut. In einem unbeobachteten Augenblick schlüpften sie an den Stadtwächtern vorbei, und Sara kletterte eine der wackligen Konstruktionen hinauf auf das Dach. Als sie einigermaßen sicher saß, streckte sie die Hand aus und zog Flynn zu sich nach oben. Einer der Wächter rief ihnen noch etwas hinterher, doch seine Worte wurden von den lautstarken Trommelschlägen übertönt, die das Eintreffen der Schauspieler ankündigten.
Es war ein beeindruckender Auftritt aus Reichtum und Macht. Stadtvogt Johen ad Rincks kam zuerst, in einer goldenen Prunkrüstung mit einem fellbesetzten roten Umhang um die Schultern und der eisernen Krone des Reichsverwesers auf dem Kopf. Der Stellvertreter des Kaisers war an diesem Tag eine Ehrfurcht gebietende Erscheinung. Groß und muskelbepackt, trotz seines fortgeschrittenen Alters, und auf dem Schlachtfeld wohl noch immer ein gefürchteter Gegner.
Ihm folgte Patriarch Veit ad Gillis in seiner strahlend weißen Robe aus Samt. Seine Schritte wirkten unsicher und müde, und er stützte sich schwer auf seinen runenverzierten Amtsstab. Zwei Akolyten halfen ihm die Stufen zur Bühne hinauf und führten ihn zu seinem Platz.
Direkt danach kamen die Edelleute, dann die Ritter und Knappen und schließlich die Abordnungen der Räte und Gilden in ihren jeweiligen Standesfarben.
In einigem Abstand folgte am Ende der Prozession der Henker mit seinen Knechten. War Johen ad Rincks schon groß, so konnte man diesen Mann als Riesen bezeichnen. Er überragte seine Begleiter um mehr als einen Kopf, und seine bloßen Arme hatten den Umfang von Baumstämmen. Sein Gesicht hielt er unter einer langen Kapuze verborgen, die ebenso schwarz war wie das gigantische Schwert, das er über der Schulter trug. Als er mit schweren Schritten die Stufen zur Bühne hinaufschritt, wich der Lärm auf dem Platz für einen Augenblick ehrfürchtiger Stille.
Gebannt beobachtete Sara seinen Auftritt und übersah beinahe den Puppenspieler, der nur wenige Schritte hinter ihm folgte und sich mit ausdrucksloser Miene am äußersten Rand der Bühne positionierte, die Arme vor der Brust verschränkt. Seine Augen huschten über den Platz, schienen jede Bewegung der lärmenden Menge aufzunehmen und zu bewerten.
»Da kommt der Ordensfürst!« Aufgeregt deutete Flynn nach unten und brach damit den Bann.
»Ist kaum zu übersehen«, murmelte Sara. »Seine blasse Haut leuchtet ja bis hierher.«
Flynn kicherte. »Scheel Einohr hat ihn mal einen Fischmenschen genannt.«
Er wollte noch etwas hinzufügen, doch Sara hielt ihm den Mund zu. »Sei still! Für solche Worte schneiden sie dir die Zunge aus dem Mund.«
Flynn grinste und streckte die Zunge heraus. »Dafür müssen sie Flynn Hasenfuß erst mal kriegen. Außerdem plappere ich bloß nach, was andere Leute im Suff von sich geben.«
Großmeister Cajetan ad Hedin hatte tatsächlich etwas von einer Kreatur aus dem Meer. Ungewöhnlich schlank und feingliedrig und im Gesicht vollständig unbehaart, hatte er große dunkle Augen und einen eiskalten, stechenden Blick. Er trug einen silbernen Schuppenpanzer und darüber eine blutrote Robe, auf der das Zeichen des Flammenden Schwerts prangte. Kaum jemand hatte ihn je ohne seine Rüstung gesehen, und hinter vorgehaltener Hand murmelte man, dass er darin auch badete und schlief. »Vielleicht ist er mit ihr verwachsen«, sagte Flynn. »Wie eine Schildkröte, verstehst du? Sie werden ihn eines Tages herausschneiden müssen, so wie den fetten Torl, als er in die Regentonne gefallen ist.«
Der Ordensfürst rückte mit einem Schwarm schwer gepanzerter Ordensritter an. Allesamt hochgewachsen, in glänzende Plattenrüstungen gehüllt und mit Schwertern und Spießen bewaffnet, bildeten sie einen Kreis aus Stahl um die Bühne, die ausdruckslosen Gesichter nach außen auf die wartende Menge gerichtet. Aus den vorderen Reihen wurden Unmutsrufe von Zuschauern laut, die sich um ihre guten Plätze betrogen fühlten, doch die Besonneneren unter ihnen wichen respektvoll zurück.
Schweigend trat Cajetan ad Hedin auf die Bühne, kniete nieder und senkte das Haupt zum Gebet. Viele Bürger taten es ihm nach, und während der Regen in dünnen Fäden vom Himmel fiel, legte sich eine erwartungsvolle Stille über den Platz. Die Zeit verstrich. Über ihren Köpfen krächzte ein einsamer Rabe.
Dann, endlich, setzte eine Trommel ein, und ein Ruck ging durch die Menge. Alle Augen richteten sich auf den Eingang zur Büßergasse. An deren Ende erschien ruckelnd und knarrend ein altersschwacher Pferdekarren. Seine Räder versanken im aufgeweichten Boden, doch keiner der Zuschauer half oder wagte es auch nur, dem Karren zu nahe zu kommen. Jeder wusste, dass er verflucht war. Verflucht wie der altersschwache Gaul, der ihn zog, wie der Wagenlenker, der mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze nebenher stapfte, und vor allem wie die Last, die er transportierte. Mit hängendem Kopf hockte er auf der Ladefläche, die zerschundenen Arme und Beine in Ketten geschlagen und die Hände zum Gebet gefaltet. Sara und Flynn hielten den Atem an und verfolgten seinen Weg mit fasziniertem Entsetzen.
»Das ist Friedmann Gorten«, raunte Flynn. Seine Augen leuchteten. »Der Bannwart des Hauses Born.«
Sara nickte. Die Gortens waren eine uralte berunische Familie, die dem Haus ad Born vor Urzeiten die Treue geschworen hatte. Soweit man sich zurückerinnern konnte, hatten sie schon immer die Aufsicht über die Ländereien der Grafschaft gehabt. Der Mann, der dort unten auf dem Karren hockte, galt als gerecht und zuverlässig. Ein Mann des Volkes, hieß es, der immer gewissenhaft seine Arbeit erledigt hatte. Was für eine Art Lehrstück würde das werden, einen gerechten Mann zu verurteilen?
Ächzend kam der Karren vor der Bühne zum Stehen, und der Wagenlenker stieß seinen Passagier grob mit dem Knüppel an. Friedmann Gorten erwachte aus seiner Starre, schüttelte den Kopf und kauerte sich zusammen, die Arme eng um die verschorften Knie geschlungen. Auf einen Befehl des Puppenspielers hin packten ihn zwei Henkersknechte unter den Achseln und schleiften ihn die Stufen hinauf und vor die Füße des Ordensfürsten.
Cajetan ad Hedin legte die weiß behandschuhte Linke auf seinen Kopf. Klar und deutlich hallte seine Stimme über den Platz. »Friedmann Gorten, verstehst du, warum man dich hierher gebracht hat? Gestehst du deine Taten? Bereust du deine Sünden?«
Mal nickte Friedmann, mal schüttelte er den Kopf, dann wieder stieß er wimmernd Worte aus, die niemand verstand. Es war ohnehin nicht wichtig, das Urteil war längst gefällt.
Cajetan ad Hedin erhob die Stimme. »Friedmann Gorten, Bannwart des Hauses Born. Du wirst beschuldigt, die Hand gegen deinen eigenen Herrn erhoben zu haben, der nach dem Willen der Reisenden und dem Recht des Kaisers über dir stand, dem du zu dienen und zu gehorchen geschworen hast. Friedmann Gorten, im Angesicht von Orden, Herrscher und Volk spreche ich dich des Mordes an Graf Rikkert ad Born schuldig. Für das Leben, das du genommen hast, sollst du deines geben. Blut muss mit Blut vergolten werden. Im Namen der Reisenden, im Namen des Einen, der einst gelobt hat, Recht und Gerechtigkeit im Reich zu bewahren, im Namen des Kaisers von Berun verurteile ich dich zum Tod durch das Schwert.«
Ein Stöhnen lief durch die Menge, vereinzelte Rufe wurden laut. Es war nicht zu erkennen, ob sie Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken sollten, aber der Ordensfürst ließ sich dadurch nicht irritieren und trat mit gefalteten Händen zur Seite. Auf ein Zeichen von Thoren hin schleiften die Henkersknechte den Verurteilten zur Mitte der Bühne, wo sie ihn erneut auf die Knie zwangen und seinen Kopf nach vorn drückten. Der Regen prasselte jetzt stärker vom Himmel, und Sara schlang fröstelnd die Arme um ihren Körper.
Der Henker trat vor und hob seine schwarze Klinge weit über den Kopf.
»Blut für Blut.« Eine schrille Stimme übertönte die Rufe der Menge und das Prasseln des Regens. Fabin ad Born schob sich durch die Reihen der Adligen, stieß Männer und Frauen beiseite und blieb keuchend und mit knallrotem Kopf vor dem Henker stehen. »Ich fordere mein Recht!«
Der Sohn des getöteten Grafen war ein fetter junger Mann mit aufgedunsenem Gesicht. Er schwankte leicht, als wäre er betrunken. Anklagend richtete er den Zeigefinger auf Friedmann. »Er hat ihn abgeschlachtet wie ein Schwein. Ich habe es mit eigenen Augen ansehen müssen. Mein Vater war unbewaffnet und wehrlos!«
»Und außerdem steckte sein Schwanz in Friedmanns Frau«, murmelte Flynn, »und sie ließ das nicht freiwillig geschehen.«
»Er war ein elender Drecksack.« Sara ballte die Hände zu Fäusten. Heiße Wut kochte in ihr hoch. »Friedmann hat getan, was jeder anständige Mann in so einer Situation getan hätte.«
»Er hätte es richtig machen sollen.« Flynns schmale Schultern zuckten nach oben. »Dann würde er heute nicht da oben knien. Er hat den Vater getötet, aber den Sohn am Leben gelassen. Ich an seiner Stelle hätte allen beiden meinen Dolch zwischen die Rippen gerammt und sie danach den Schweinen zum Fraß vorgeworfen.« Er machte eine anschauliche Armbewegung, die ihn um ein Haar vom Dach geworfen hätte.
Sara zog ihn am Hemd zurück in die Waagerechte. »Du hättest dich eher selbst umgebracht, du Dummkopf. Außerdem hat der Sohn nichts getan. Er ist nicht schuld an den Sünden seines Vaters.«
»Und was nützt das Friedmann jetzt, hä?«
Thoren trat vor und legte die Hand auf den Griff seines Schwerts. »Ihr bekommt Euer Recht, Graf Born. Was wollt ihr noch?«
Fabin ad Born starrte ihn mit blutunterlaufenen Augen an. Er zitterte, wich aber nicht zurück. »Rikkert war mein Vater, und ich fordere das Recht, den Verurteilten eigenhändig hinzurichten.« Er wandte sich zu den versammelten Adligen um, dann zu Cajetan. »Es steht mir zu. Oder etwa nicht?«
Thoren schnaubte, doch der Ordensfürst neigte den Kopf. »Es ist Euer Recht, Graf Born.«
»Dann gebt mir die Klinge.« Fabin streckte die Hand nach dem Richtschwert aus.
Der Henker blickte zu dem jungen Mann hinab, dann auf Thoren, der nur mit den Schultern zuckte. Widerstrebend übergab er das Schwert an den Adligen.
Fabin nickte und schlurfte mit zusammengebissenen Zähnen auf den Verurteilten zu, leckte sich die Lippen und hob das Schwert über den Kopf. Seine Arme zitterten unter dem Gewicht der mächtigen Waffe. »Ich übe Rache im Namen meines Vaters. Das hier soll allen eine Warnung sein, die es wagen, ihre Hand gegen einen ad Born zu erheben.«
Das Schwert fuhr herab. Der Schlag war ungezielt und schwach und Fabin betrunken oder viel zu aufgebracht. Vielleicht hätte es dennoch ausgereicht, um den Bannwart zu töten, wenn der arme Mann nicht ausgerechnet in diesem Augenblick aus seiner Lethargie erwacht wäre und sich gegen den Griff seiner Wächter gestemmt hätte. Statt in den Hals schlug die Klinge gegen seinen Schädel, rutschte seitlich ab und polterte harmlos auf die Bretter des Holzbodens. Blut spritzte, und Friedmann bäumte sich auf und schrie wie am Spieß. Sehr zum Unmut des Publikums, das diese Zurschaustellung von Unfähigkeit mit Schmährufen und gereckten Fäusten belohnte. Flynn lachte, und Sara gab ihm einen Klaps auf den Hinterkopf.
»Haltet ihn fest, ihr Hunde!«, brüllte Fabin mit hochrotem Kopf. Er stellte das Schwert mit der Spitze nach unten auf dem Boden ab, wischte zuerst die rechte, dann die linke Hand am Wams ab und holte erneut aus. Die Henkersknechte zerrten den schreienden Bannwart in die Höhe, und der junge Graf schlug zu. Diesmal deutlich stärker, doch Friedmann wand sich zur Seite, sodass die Klinge tief in seine Schulter schnitt. Bis die Henkersknechte ihn diesmal wieder in ihre Gewalt bekommen hatten, waren sie bereits von Kopf bis Fuß in Blut gebadet. Aus der Zuschauermenge drangen wütende Rufe hervor. Fäuste wurden geschüttelt, faules Obst und Gemüse auf die Bühne geschleudert, und Fabin wurde von einem Stein am Oberschenkel getroffen. Brüllend riss er die Klinge in die Höhe und hackte auf den Bannwart ein wie ein Schlachter auf ein totes Stück Vieh. Nur dass sein Opfer noch am Leben war und nicht aufhörte zu schreien.
Der Regen aus Steinen und faulem Obst verstärkte sich, und die Zuschauermenge drängte nach vorn gegen die Wand aus stählernen Rüstungen. Ritter zogen ihre Schwerter, und Heetleute brüllten Befehle. Flynn ballte die Hände zu Fäusten und stimmte in das Gebrüll mit ein. »Tötet ihn! Tötet das Schwein!« Sara wusste nicht, ob er Friedmann meinte oder den jungen Grafen.
Endlich erbarmte sich der Henker und entriss dem wütenden Grafen das Schwert. Mit zwei schnellen Schritten war er beim Bannwart. Eine seiner riesigen Hände packte zu, zog grob seinen Kopf zurück. Die andere mit dem Schwert schlug zu. Friedmann riss schützend den Arm vor das Gesicht, doch die schwarze Klinge durchschlug mühelos den Knochen und danach seinen Hals.
Mit einem dumpfen Geräusch landete der Kopf auf den Brettern. Geistesgegenwärtig beugte sich einer der Henkersknechte hinab, packte ihn beim Schopf und streckte ihn in die Höhe.
»Den Reisenden sei Dank«, seufzte Sara, »es ist vorbei.«
»Sie hätten den Grafen gleich mit köpfen sollen«, sagte Flynn, während sie sich vom Marktplatz entfernten. Er machte eine Geste, die wohl einen Schwertstreich andeuten sollte. »Und alle anderen dort oben gleich mit.«
»Halt den Mund«, zischte Sara. Sie erinnerte sich an die Worte des Glatzkopfs. Ich habe meine Zweifel, dass das Volk die richtigen Lehren daraus zieht. Da war etwas Wahres dran. Aber vielleicht zog das Volk ja doch die richtigen Lehren. Vermutlich nur nicht die, die der Adel gern hätte.
Flynn boxte ihr in die Seite. »Du bist zu weich, Schwesterherz. Du hast den Blick abgewandt, als der Fettsack auf ihn eingehackt hat. Ich habe es genau gesehen.«
»Wenn du es so genau gesehen hast, dann konntest du die Hinrichtung ja auch nicht mitverfolgen.«
Flynn dachte darüber nach und zog eine Schnute. »Konnte ich wohl«, sagte er und sprang davon.
Sara folgte ihm schweigend.
Das Wirtshaus unter dem Zeichen des Roten Bären stand in der Gerbergasse, keinen Steinwurf vom Handelshafen entfernt. Der allgegenwärtige Uringestank hielt die Stadtsoldaten fern, und die zahlreichen vorbeieilenden Boten und Arbeiter sorgten für einen steten Fluss an Gästen und Informationen. Ein äußerst lohnenswerter Standort für einen Wirt, der nicht viel Wert auf Sauberkeit, dafür aber auf leicht verdientes Geld legte.
Die Witterung hatte dem hölzernen Abbild des Namensgebers bereits arg zugesetzt. Schramm, der zweitjüngste von Feysts Söhnen, lehnte unter dem Schild im Türrahmen und hielt Wache. »Wird aber auch Zeit«, sagte er, während er provozierend langsam zur Seite trat. Er nickte in den stickigen Raum hinein. »Er erwartet euch dort drüben.«
Als Erstes erkannte Sara die massigen Umrisse von Bedbur im Dämmerlicht. Der kolnorische Barbar, der mit seinem räudigen Wolfsfell, dem zotteligen Bart und den behaarten Pranken wie ein Monster aus einer uralten Sage wirkte, hockte gemeinsam mit Feyst und einem Fremden am Tisch vor der Feuerstelle. Der Wirt saß am Kopfende. Ein fettbäuchiger alter Mann, der seine Haare offen trug wie ein Adliger und die Hände mit goldenen Ringen schmückte. Als er Sara und Flynn erkannte, winkte er sie heran. »Was hat euch so lange aufgehalten?«