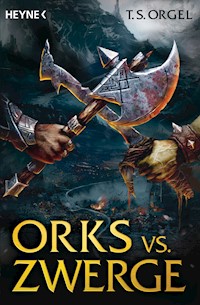10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Orks vs. Zwerge-Serie
- Sprache: Deutsch
Das Ende der Welt naht - der letzte Kampf zwischen Orks und Zwergen steht bevor
Der Lange Winter hat den Krieg zwischen Orks und Zwergen zum Erliegen gebracht. Vorerst. Hunger, Kälte und eine geheimnisvolle Seuche haben einen Großteil der orkischen Schamaninnen und ihres Heeres dahingerafft und die Generäle der Zwerge planen im Geheimen einen gewaltigen Angriff, um den Norden zurückzuerobern. Doch auch ihre Reihen werden durch eine Serie mysteriöser Todesfälle gelichtet. Während die Zwerge fieberhaft den Verräter in ihrer Festung suchen, macht sich ein Orktrupp auf den Weg ins verbotene Land, um die Quelle des Wahnsinns zu suchen, der die Welt befallen hat. Was sie im ewigen Eis finden, könnte dafür sorgen, dass diese Schlacht der Orks und Zwerge ihre letzte wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
DAS BUCH
Der Lange Winter hat den Krieg zwischen Orks und Zwergen zum Erliegen gebracht. Vorerst. Hunger, Kälte und eine geheimnisvolle Seuche haben einen Großteil der orkischen Schamaninnen und ihres Heeres dahingerafft und die Generäle der Zwerge planen im Geheimen einen gewaltigen Angriff, um den Norden zurückzuerobern. Doch auch ihre Reihen werden durch eine Serie mysteriöser Todesfälle gelichtet. Während die Zwerge fieberhaft den Verräter in ihrer Festung suchen, macht sich ein Orktrupp auf den Weg ins verbotene Land, um die Quelle des Wahnsinns zu suchen, der die Welt befallen hat. Was sie im ewigen Eis finden, könnte dafür sorgen, dass diese Schlacht der Orks und Zwerge ihre letzte wird …
Der grandiose Höhepunkt der Fantasy-Saga um die größte Schlacht aller Zeiten:
Erster Roman: Orks vs. Zwerge
Zweiter Roman: Orks vs. Zwerge – Fluch der Dunkelheit
Dritter Roman: Orks vs. Zwerge – Der Schatz der Ahnen
DIE AUTOREN
Hinter dem Pseudonym T. S. Orgel stehen die beiden Brüder Tom und Stephan Orgel. In einem anderen Leben sind sie als Grafikdesigner und Werbetexter beziehungsweise Verlagskaufmann beschäftigt, doch wenn beide zur Feder greifen, geht es in phantastische Welten. Ihr erster gemeinsamer Roman »Orks vs. Zwerge« wurde mit dem Deutschen Phantastik Preis 2013 für das beste Debüt ausgezeichnet.
Mehr über die Autoren und ihre Romane auf www.ts-orgel.de
T.S. Orgel
ORKS
VS.
ZWERGE
Der Schatz der Ahnen
Roman
Originalausgabe
Mit ausführlichem Glossar
und Ork-Wörterbuch im Anhang
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
2. Auflage
Originalausgabe 12/2014
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2014 by Tom & Stephan Orgel
Copyright © 2014 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Karten: Andreas Hancock
Umschlagillustration: Alexander Tooth
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-14660-3
twitter.com/HeyneFantasySF
Die Einsicht in das Mögliche
und Unmögliche ist es, die den
Helden vom Abenteurer unterscheidet.
THEODOR MOMMSEN
PROLOG
Borms eisenbeschlagene Stiefel schlugen schwer auf den Stein, während er bedächtig die Stufen zur Mauer erklomm. Immer einen Schritt nach dem anderen, denn der Morgentau hatte das alte Gemäuer klamm und rutschig gemacht. Ein falscher Tritt konnte in dieser Höhe fatale Folgen haben. Schwer atmend blieb er auf dem Absatz stehen, wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und warf einen Blick in die Ferne. Während die Landschaft zu seinen Füßen noch unter einem schwarzen Schleier verborgen lag, waren am Horizont bereits die ersten Sonnenstrahlen zu erahnen. Borm liebte diese kurze Zeitspanne zwischen Nacht und Tag, wenn die Welt außerhalb der Minen noch den Eindruck einer gewaltigen Höhle vermittelte und das Licht der Sonne nicht in den Augen schmerzte, aber schon stark genug war, um einen Blick auf die zerstörte Stadt zu Füßen der Bergfestung zu gewähren.
Derok.
Das allgegenwärtige Symbol der Schwäche aller Oberen. Von den Orks mit einem einzigen Handstreich vom Antlitz der Erde gefegt, so als wäre die Stadt nichts weiter als eine lästige Schmeißfliege gewesen, die sich zufällig an die gedeckte Tafel des Nordens verirrt hatte. Nichts hatten die einst so stolzen Händler den Angriffen entgegensetzen können. Ihre Mauern waren zu Staub zerfallen, ihre Häuser hatten wie Stroh gebrannt, und ihre überheblichen Gesichter waren in Blut ertränkt worden. Schwächlinge!
Borms Finger tasteten nach dem goldverzierten Trinkhorn an seinem Gürtel. Es war mit dem stärksten und edelsten Tropfen angefüllt, den Gott in seiner Gnade erschaffen hatte. Ein Bier aus den Minen der Zinnkopfhöhen. So dunkel wie die Nacht und so weich und vollmundig wie … nun ja, wie eben nur dieses einzigartige Bier zu schmecken vermochte.Grüßend hob er das Horn dem roten Streifen am Horizont entgegen, und dann den rußgeschwärzten Ruinen Deroks. »Mit diesem Tropfen trinke ich auf die Niederlage der Unvernunft. Auf dein Wohl, Derok!« Als er sich den Bart abwischte, spielte ein stilles Lächeln um seine Lippen. Er hätte es gern mit einem Gleichgesinnten geteilt, doch zu dieser frühen Stunde war er allein auf den Mauern. Der nächste Wächter stand weit entfernt auf einem der zahlreichen Wehrtürme, die sich wie mahnende Zeigefinger dem roter werdenden Himmel entgegenstreckten. Eine dunkle Silhouette, das bärtige Gesicht unverwandt in die Ferne gerichtet.
Er schwankte leicht, was Borm beunruhigte. Festungswächter waren unverrückbar wie der Fels, sie schwankten nicht, jedenfalls normalerweise. Borm kniff die Augen zusammen und öffnete sie wieder. Doch das machte die Sache nur noch schlimmer, denn jetzt begann sich der gesamte Turm zu wiegen wie ein Ast im Wind. Er runzelte die Stirn. Was in Gottes Namen erlaubt der sich?
Langsam übertrug sich das Schwanken nun auch auf die Mauer, sprang von dort behäbig auf die Brüstung über und wanderte über den Fluss nach Derok und darüber hinaus. Bis es schließlich den Horizont erreicht hatte und die gesamte Welt sich zu drehen begann.
Scheppernd ließ Borm das Trinkhorn fallen und streckte die Hände nach der Brüstung aus. Mit einem Mal schien sie meilenweit entfernt zu sein. Panisch warf er sich nach vorn, krallte die Finger in das harte Gestein und stieß ein Wimmern aus. »In Gottes Namen, was geht hier vor?« Als er spürte, wie der Sandstein unter seinen Fingern zu bröckeln begann, erstarb seine Stimme. Erst lösten sich nur winzige Stückchen, kaum mehr als Krümel, und rieselten sanft auf seine Stiefel herab. Dann knirschte es leise, und ein sanfter Schauer fuhr durch den Stein. Er wagte kaum zu atmen. »Herr«, wimmerte er. »Mach, dass es aufhört!«
Ein lautes Knirschen ertönte, dann gab es einen heftigen Ruck, und schließlich rutschte die gesamte Brüstung vor seinen Augen in die Tiefe. Für einen winzigen Augenblick existierten nur noch er und der Stein. Der Stein, der sich im Fallen behäbig drehte und dabei immer kleiner wurde, auf halber Höhe mit einem hässlichen Krachen gegen eine Felsennase schlug und in zwei Teile zerbarst, die noch einmal mit leisem Knirschen tief unten gegen den Fuß des Bergs polterten, um nach einer Ewigkeit schließlich in die tosenden Fluten des Flusses zu klatschen.
Mit Wucht kehrte die Wirklichkeit zurück. Fauchend zerrte der Wind an Borms Kleidung und versuchte, ihn dem Stein hinterher in den Abgrund zu reißen. Mit vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen stolperte er rückwärts. Sein Herz pumpte wie ein Blasebalg, seine Arme und Beine zitterten wie Blätter im Wind.
Aber er lebte. Und langsam hörte die Welt auf, sich zu drehen.
Zorn wallte in ihm auf und verdrängte die Erleichterung darüber, dem Tod so knapp entronnen zu sein. Zorn über die unfähigen Baumeister, die so leichtsinnig mit dem Leben eines Clanoberhaupts gespielt hatten. »Diese verschissenen Pfuscher«, grollte er und bleckte die Zähne. Wie konnten sie es wagen, die Festungsmauern so verkommen zu lassen? Dieser Vorfall würde Konsequenzen haben, so viel war sicher. Irgendjemand würde dafür zur Rechenschaft gezogen werden.
Aus dem Augenwinkel nahm er eine Bewegung wahr und wirbelte herum, jede Faser seines Körpers voll gerechtem Zorn. Er brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, was er sah. Seine Augen weiteten sich, schon zum zweiten Mal an diesem Morgen, und seine Hand fuhr zu der goldverzierten Klinge, die er am Gürtel trug. Unter anderen Umständen wäre sie vielleicht schnell genug gewesen, doch der Schreck saß ihm noch so tief in den Knochen, dass sie unkontrolliert zitterte und den Griff verfehlte.
Der Stoß war gar nicht mal heftig. Eher ein sanfter Schubser, den er kaum spürte. Doch er reichte aus, um Borm einen Schritt zurücktaumeln zu lassen. Er fummelte weiter an seinem Gürtel herum und hatte die Klinge schon halb aus der Scheide gezogen, als der zweite Stoß ihn noch weiter zurückwarf. Erst jetzt begriff er, dass sich zwischen ihm und dem Abgrund keine schützende Brüstung mehr befand. »Das ist ungünstig«, krächzte er und spürte, wie der Wind erneut an seiner Kleidung zerrte. Diesmal hatte er mehr Erfolg. Langsam kippte Borm nach hinten, breitete dabei die Arme aus wie ein Vogel und stürzte mit einem verwunderten Ausdruck im Gesicht in den Tod.
NYORDA
Kleine Eisbrocken trieben auf dem rasch und doch lautlos dahinströmenden Wasser, bleich schimmernde Flecken auf dem schwarzen, nächtlichen Fluss, wie Knochensplitter in Strömen von Blut. Vergangene Ströme oder zukünftige? Eine interessante Frage. Im vergangenen Herbst, als Derok gefallen war, hatte der Fluss eine Menge Blut gesehen. Und er würde mehr sehen. Blut, das sie vergießen würde– oder ihr eigenes. Wahrscheinlich beides.
Nyorda sah die Sache nüchtern genug, um zu wissen, dass ihre Chancen, den kommenden Frühling zu erleben, gering genug waren, um besser nicht allzu viele Gedanken darauf zu verschwenden. Falls ich die nächste Stunde überleben sollte. Die junge Frau sah hinab auf die glasklare Schwärze vor ihren bloßen Zehen. Kein Spiegelbild starrte zurück; dafür war die mondlose Nacht zu dunkel. Aber es wäre ohnehin nichts Sehenswertes darin gewesen. Eine hochgewachsene, hagere, bleiche Gestalt, und darüber ein kantiges Menschengesicht. Zu schmale Lippen, dunkle, harte Augen, umrahmt von struppigem, kurzem Haar, das sie erst gestern mit einem Messer nachlässig gekürzt hatte, damit es ihr nicht im Weg war. Nichts, wonach sich jemand zweimal umgesehen hätte.
Sie rieb sich mit dem Daumen über die schief verheilte Nase. Die hatte sie sich verdient. Es erinnerte sie daran, dass man Stumpen nicht trauen konnte. Sie belohnten Treue nicht. Nun ja.
Nyorda hob den Blick und starrte flussabwärts, wo in der Ferne der Festungsberg von Derok aufragte, der als schwarzer Fleck die Sterne verbarg. Hoch oben fügte er dagegen neue Sterne hinzu, Öllichter oder Fackeln, die auf Zinnen und in Fenstern brannten. Ihr Ziel.
Ein letztes Mal atmete Nyorda tief durch, dann ließ sie sich in das eisige Wasser gleiten. Der Schock traf sie wie ein Tritt in den Magen und raubte ihr den Atem. Unwillkürlich schnappte sie nach Luft. Verdammt! Sie hatte natürlich gewusst, dass der Fluss kalt war – immerhin eilte er direkt von den ewigen Eisfeldern der Berge im Osten herab –, doch mit dieser brennenden Kälte hatte sie trotzdem nicht gerechnet. Eilig schlang sie die Arme um den von Eis überzogenen Baumstamm, auf dem sie ihr Bündel befestigt hatte. Die gefrorene Rinde schnitt ihr schmerzhaft in die bloße Brust, doch sie lockerte den Griff nicht, sondern stieß sich stattdessen kräftig vom felsigen Ufer ab. Für eine Umkehr war es ohnehin zu spät. In dem kurzen Moment, den sie gebraucht hatte, um sich vom ersten Schock des Eiswassers zu erholen, hatte der Fluss sie bereits erfasst und mit sich gerissen. Das Schweigen des schwarzen Wassers war trügerisch – die Gewalt des Flusses war auch jetzt, wo sich der Winter in die Berge zurückzog, ungemindert. Vermutlich sogar noch heftiger, wenn man bedachte, dass einiges an Schmelzwasser hinzukommen musste. Wärmer wurde das Wasser dadurch jedenfalls nicht. Nyordas Atem kam stoßweise, und jeder Zug brannte in ihren Lungen. Ihre Haut brannte ebenfalls, als wäre sie unbekleidet durch ein Nesselfeld gekrochen. Wenn das Gnarrafett, mit dem jeder Zoll ihres Körpers beinahe fingerdick eingerieben war, tatsächlich gegen die Kälte half, bedeutete das wohl nur, dass sie ein, zwei Atemzüge mehr hatte. Es war kaum zu glauben, aber schon nach diesen wenigen Augenblicken im Fluss fühlte sie ihre Beine kaum noch. Jetzt kam alles darauf an, dass sie sich nicht verschätzt hatte.
Lautlos trug das Wasser den geborstenen Stamm davon und auf die Steilwand zu, die hoch über den Ruinen Deroks aufragte. Genau genommen ragte sie über dem Wenigen von Derok empor, das nicht in Ruinen lag. Auf der Südseite des Flusses lagen zwei Straßenzüge schmaler, dunkler Steingebäude, die sich dicht an dicht zwischen dem schroff abfallenden Flussufer und der sich drohend erhebenden Steilwand des Festungsbergs drängten. Die Zwerge hatten die Behausungen am Ufer abgerissen und die Reste der Brücken, die die Südstadt mit der Nordstadt verbunden hatten, sorgfältig geschleift. Kein Ork konnte unbemerkt den Fluss überqueren. Schwimmen konnten die Krieger der Stämme ohnehin nicht, und die immer noch Tag und Nacht am Ufer stationierten Wachen bemerkten jedes noch so kleine Boot oder Floß, mit dem sich mehrere oder auch nur eine der Grünhäute hätten einschleichen können. Die Orks hatten es versucht. Mehr als einmal. Bislang sah es nicht so aus, als hätte es auch nur einer ihrer … »Gesandten« bis ans südliche Ufer geschafft. Vielleicht trügte der Schein, doch die Häuptlinge der Stämme konnten kein Risiko eingehen. Also sandten sie mehr. Leute wie Nyorda.
Es gab einen kleinen, steinigen Streifen am östlichen Ende der Kaimauer, an der der Fluss Abfall, Treibholz und Eisschollen sammelte, und genau diese dunkle Ecke war es, die Nyorda ansteuerte. Sie ließ sich tief ins Wasser hängen, den Kopf gerade so oben gehalten und im Schatten des treibenden Stamms verborgen. Mit sparsamen Bewegungen lenkte sie das geborstene Treibgut in die Strömung. Sie konnte nur hoffen, dass es reichte – und dass ihre Bemühungen unbemerkt blieben. Sie hatte nur diesen einen Versuch – verfehlte sie ihr Ziel, wäre sie erfroren, bevor sich ihr eine weitere Möglichkeit bot, den Fluss zu verlassen. Inzwischen spürte sie kaum noch ihre Finger, und sie musste die Zähne fest zusammenpressen, um zu verhindern, dass sie klappernd aufeinanderschlugen.
Einen Versuch nur – mehr verlangte sie nicht. Eine Chance war mehr, als sie hatte erwarten können. Mehr als die Menschen am Fluss, in den Weilern, Dörfern und Wehrhöfen, oder die Menschen in Derok, die die Zwerge zurückgelassen hatten, als sie die Tore hinter sich schlossen und die Brücken über den Fluss abbrachen. Absurderweise hatte sie überlebt, weil sie gekämpft hatte. Oder, wie sie inzwischen wusste, weil sie eine Frau war und den ersten Orkkrieger getötet hatte, der sich an ihr hatte vergehen wollen. Und wider alle Erwartungen auch den zweiten. Orks respektierten Frauen, sogar menschliche, wenn sie nur stark waren. Es hatte ihr nichts genutzt, als der dritte über sie gekommen war, und dann der vierte. Es hatte den Menschen in ihrer Schmugglersiedlung nichts genutzt, die so dumm gewesen waren, sich gegen die Grünhäute zu wehren, als der lange Winter gekommen war und die Orks schließlich über jede noch so versteckte Siedlung hergefallen waren, um auch die letzten Vorräte zu plündern. Fressen oder gefressen werden. Doch am Ende hatten sie sie genau deshalb am Leben gelassen. Sie hatten ihr zu essen gegeben, als die Dunkelheit anhielt und mit ihr der lange, eisige Winter. Weil sie stark war und nicht aufgegeben hatte. Die anderen, Schwächeren hatten nicht überlebt. Orks verschwendeten keine Nahrung an Schwache oder Kranke, nicht einmal an die ihrer eigenen Art, das wusste sie jetzt. Die Starken dagegen durften überleben, als Sklaven der Grünhäute. Aber Sklaven, dessen war sich Nyorda schon lange bewusst, waren sie auch unter den Zwergen gewesen. Die Stumpen gewährten jenen Menschen Schutz, die ihnen nützlich waren. Auf den Rest verschwendeten sie keinen Gedanken.
Im Gegenteil. Die Orks wussten um den Wert von Stärke. Sie sahen Nyordas Wert und gaben ihr auch dann noch Essen und einen Platz am Feuer, als Nahrung und Feuerholz rar wurden und die meisten der anderen Gefangenen einer ungewissen Zukunft im Norden entgegengetrieben worden oder Hunger und Kälte zum Opfer gefallen waren. Und schließlich hatte Nyorda den Unterschied erkannt. Unter den Orks konnte sich jeder einen Platz erkämpfen, der zu kämpfen bereit war. Abstammung war ihnen weniger wert als Stärke, und jeder bekam eine Chance, sich zu beweisen. Es war hart, doch auf fremdartige Weise gerecht.
Für die Zwerge dagegen war sie Abschaum, allein schon, weil sie als Mensch geboren war. Es war nicht die Schuld der Orks, dass so viele Menschen in Derok gestorben waren – es war allein die Schuld der Stumpen, selbst wenn sie die Arbeit den Klingen der Grünhäute überlassen hatten!
Eine heiße Welle der Wut überschwemmte Nyorda und verdrängte die unbarmherzige Kälte aus ihren Gliedmaßen. Die Orks hatten ihr eine Chance gegeben, und sie wollte verflucht sein, wenn sie sie nicht nutzte. Der Fluss hatte den Stamm inzwischen beinahe bis in den Schatten des gegenüberliegenden Steilufers getragen. Mit zwei kräftigen Schwimmstößen schob die junge Frau ihr provisorisches Floß aus der Strömung. Dumpf klopfend stieß der Stamm gegen das Eis am Ende der Ufermauer. Nyorda verlor keine Zeit. Sie packte das Bündel, das in den gebrochenen Ästen des Baums hing, und warf es auf die blasse Eisfläche, auf der es bis zum Ufer glitt. Dann stieß sie sich ab und zog sich mit zusammengebissenen Zähnen auf das Eis. Ein Stöhnen und Knistern durchlief die dünne Decke, wobei feine Risse bis zum schwarzen Ufer eilten. Die Kante der Eisfläche zerbrach unter ihrer rechten Hand in scharfe Splitter, die sich vom Rand lösten und davontrieben. Sofort verharrte sie vollkommen still. Das Knistern verebbte. Vorsichtig hob sie den Kopf.
Ein leises Singen aus dem Eis antwortete ihr, und sie hielt inne. Verdammt. Reglos lag sie auf dem schmalen Eisstreifen. Kälte kroch in ihren ohnehin schon ausgekühlten nackten Körper. Lange konnte sie so nicht liegen bleiben, das stand fest. Nicht, wenn sie nicht als Leiche gefunden werden wollte. Einbrechen und nochmals ins Wasser fallen war allerdings auch keine Alternative. Auch das würde sie nicht überleben.
Lautlos fluchte sie, verwünschte den Fluss, die Kälte, Derok, die Wühler, den bescheuerten Plan der Orks, sich selbst. Sie begann zu zittern, ohne dass sie das Geringste dagegen unternehmen konnte, und das Knistern im Eis kehrte zurück. Verdammte Scheiße!
»Oi!«
Der leise Ruf kam so unerwartet, dass sie zusammengezuckt wäre, wenn sie gekonnt hätte. Andererseits – momentan bestand sie ohnehin nur noch aus leisem Zucken.
»Du da! Weib!« Eine Zwergenstimme, unverkennbar in ihrer kantigen, polternden Art, die Laute der menschlichen Sprache auszusprechen. »Keine Bewegung!«
Ein kurzer Moment verstrich, während Nyorda sogar den Atem anhielt. Schließlich fügte der Besitzer der Stimme etwas weniger barsch hinzu: »Oder doch. Eine Bewegung, wenn du noch lebst.« Und einen Augenblick darauf: »Lebst du noch?« Schließlich schniefte der Zwerg. »Mist«, murmelte er.
Irgendetwas stach ihr unsanft in die Rippen. Das Stochern wiederholte sich, doch noch immer regte sich Nyorda nicht. Die Wachleute der Stumpen hier am Ufer trugen lange Stangenäxte, mit denen sie Dinge aus dem Wasser ziehen konnten. Oder aber sie hineinstoßen. Und für gewöhnlich fischten sie nichts aus dem Wasser, das noch lebte.
Ein eisiger Haken kroch unter ihre Achsel, schnitt ihr schmerzhaft in die blau gefrorene Haut. Dann spürte sie, wie sie über das Eis gezogen wurde, während der Stumpen sie ächzend auf die scharfkantigen Steine des Ufers zerrte. Raue Lederhandschuhe griffen unter ihre Arme, und sie fühlte, wie sie hochgehoben und umgedreht wurde. Heißer, stinkender Atem wusch über ihr Gesicht. Nyorda zwang ihre Lider auf und sah in die dunklen Zwergenaugen, die dicht über ihr schwebten. Ohne nachzudenken, stieß sie den Eissplitter in ihrer Rechten unter das bärtige Kinn. Der Stumpen starrte sie verständnislos an, als ein Blutschwall aus seinem Rachen schoss und sich heiß über ihre Hand und ihr Gesicht ergoss. Für einen Moment verkrampften sich die Handschuhe so fest um ihre Oberarme, dass sie fürchtete, der Kerl würde ihr die Knochen brechen, dann erschlaffte er, sackte nach hinten und riss sie mit sich, während sich ein gurgelndes Seufzen den Weg an der eisigen Klinge vorbei nach draußen bahnte.
Ein Zittern durchlief den untersetzten, gepanzerten Körper, während die dunklen Augen noch immer in ihre sahen und es dabei fertigbrachten, den verletzten Ausdruck anzunehmen, der in denen eines zu Unrecht geschlagenen Hundes lag. Er war jung, ging Nyorda auf. Natürlich. Es waren immer die ganz Jungen und die Erfolglosen, die beschissene Posten wie diesen erhielten. Und es waren immer sie, die deshalb zuerst verreckten, im Grunde immer jene, die am wenigsten etwas für irgendetwas konnten. Das war wohl überall so.
Die Lippen des Stumpen bebten, doch sie brachten nichts weiter hervor als noch mehr Blut. Angewidert rollte sich Nyorda von dem Sterbenden fort, wobei ihr nicht ganz klar war, was sie mehr anwiderte: das Sterben, die Ungerechtigkeit der Welt oder sie selbst. Das Blut war es nicht, davon hatte sie schon zu viel gesehen.
Sie zog sich zu ihrem Bündel, das nur noch einen Schritt entfernt lag. Die Schnur, die es verschlossen hielt, war steif gefroren. Knurrend zerrte sie mit den Zähnen daran, bis sich schließlich der Knoten löste und sie die lederne Hülle auseinanderschieben konnten. Ein Schwall Wärme wallte ihr entgegen, als sie die trockene Kleidung auseinanderschob, und hüllte sie in den Geruch von verschmorter Wolle. Noch immer zitternd kniete sie sich in den Haufen warmen Stoffs und wühlte darin herum, bis sie auf etwas Hartes stieß, an dem sie sich beinahe die Hände verbrannte. Mit zusammengebissenen Zähnen ließ sie ihre Hände auf dem noch immer heißen Stein liegen, bis das Kribbeln des wiederkehrenden Gefühls in den Fingerspitzen auf ein erträgliches Maß zurückgegangen war. Für einen Moment noch ließ sie sich von der mitgebrachten Wärme durchströmen, dann zog sie sich ihre Kleider über. Es waren keine bemerkenswerten oder gar guten Kleider, doch sie waren warm, sauber und vor allem unauffällig. Ein Unterkleid, ein einfaches Überkleid aus verschlissenem, jedoch dickem Wollstoff, darunter gestrickte Beinlinge gegen die Kälte, Socken und feste Schnürschuhe aus gefettetem Leder. Sie genoss die Wärme, die ihren Körper durchströmte, und das Prickeln, als endlich auch Gefühl den Weg in ihre Schenkel, Arme und Brüste zurückfand. Schließlich atmete sie tief durch und gürtete sich mit einem schmalen Lederband, an dem eine kleine Tasche hing, die die einzigen Gegenstände enthielt, die sie auf ihre Mission mitgenommen hatte: ein paar Münzen und ein kleines Messer mit hölzernem Griff. Keine echte Waffe, nur etwas Unauffälliges, wie es beinahe jeder bei sich trug.
Dann runzelte sie die Stirn. Ihr Blick fiel auf den Zwergenwächter, der inzwischen still war. Noch lag er in der Dunkelheit der Uferbefestigung, doch für jeden, der eine Laterne mit sich führte, war er deutlich genug zu erkennen, und spätestens bei Sonnenaufgang würde er hier für jeden sichtbar sein. Vermutlich war es also besser, ihn nicht einfach liegen zu lassen. Nachdenklich musterte sie das Eisbrett, von dem der Stumpen sie mit seiner Stangenaxt hereingezogen hatte. Die fahl schimmernde Fläche hatte schon unter ihrem geringen Gewicht gestöhnt – ein mit Eisen gepanzerter Zwerg allerdings …
Kurz entschlossen packte sie den Toten an Bart und Kragen und zerrte ihn auf den Rand des Eises. Sie nahm sich nur kurz die Zeit, ihm die silberne Trinkflasche abzunehmen, bevor sie ihm die Spitze seiner Stangenwaffe auf die Brust setzte und sich mit vollem Gewicht gegen den Schaft stemmte. Leise knirschend löste sich der Leichnam vom Ufer und glitt zwei Schritte dem Fluss entgegen, bevor das Eis unter ihm knackte, splitterte und schließlich in kleine Brocken zerbrach, die auf dem schwarzen Fluss in die Dunkelheit davontrudelten, während der Körper lautlos zwischen ihnen versank.
Grimmig sah Nyorda ihm hinterher. Ein Zwerg weniger. Aber es lagen noch einige vor ihr. Schnell schob sie den Heizstein und die Reste des Ledersacks ebenfalls über das Eis in den Fluss, dann warf sie die Langaxt des Wächters hinterher. Als Letztes entkorkte sie die Flasche des Wächters. Der scharfe Geruch von gebranntem Schnaps schlug ihr entgegen, und sie rümpfte die Nase. Sorgsam goss sie den größten Teil des Inhalts aus, bevor sie das Gefäß zwischen die Steine fallen ließ. Wenn jemand den Stumpen schließlich doch vermissen sollte, würde er außer dem Blutfleck und dem zerbrochenen Eis auch dieses Ding finden und eigene Schlüsse ziehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Besoffener gestürzt wäre, sich den Schädel angeschlagen hätte und orientierungslos im Fluss gelandet wäre. Solche Dinge passierten. Zufrieden schlang sie sich ihren Schal um Hals und Gesicht und wandte sich den Häusern zu.
Hier am östlichen Ende des Südstadtufers ragten nur mehrgeschossige Lagerhäuser zwischen dem Fluss und der Felswand des Festungsbergs auf, doch weiter flussabwärts gabelte sich die gepflasterte Uferstraße und verschwand zwischen düsteren Wohnhäusern, deren spitze, schiefergedeckte Dächer drohend in den eisigen Sternenhimmel ragten. Die Südstadt Deroks – und damit alles, was von Derok übrig geblieben war – war ein alter Stadtteil, wohlhabend genug, um fast ausschließlich von Zwergen bewohnt zu sein. Wahrscheinlich war es jetzt eng in den Prunkbauten der Stumpen, wenn man bedachte, wie viele der kleinen Stinker sie vor dem Fall Deroks noch auf diese Seite hier evakuiert hatten. Vor allem jene aus der Oststadt, in der Leute mit Geld wohnten, also Leute, die einen Wert besaßen. Was sie am Ende von den Menschen der Weststadt unterschieden hatte, denen man die Flucht über den Fluss verwehrte. Sie fletschte die Zähne.
Aber wenn Nyorda den Beobachtern der Orks trauen konnte, war sie nicht die einzige Menschenfrau auf dieser Seite des Flusses. Andere hatten mehr Glück gehabt – wenn man es denn als Glück bezeichnen wollte, dass sie als Bedienstete der Stumpen arbeiteten und daher in deren Häusern in der Südstadt wohnten, als die Orks über Derok hereingebrochen waren. Die Orks konnten sie einen ganzen Winter lang beobachten, wie sie ihren Handlangerdiensten für die Stumpen nachgingen, unbehelligt und unbeachtet. Natürlich – für die Zwerge sah jeder Mensch aus wie der andere. Die Menschen waren nützlich, aber letztendlich nicht ihrer Aufmerksamkeit wert. Das war der Grund, warum die Orks Menschen wie sie, Nyorda, gesucht hatten. Menschen, die nicht auffielen, schwimmen konnten und vom Hass auf die Stumpen erfüllt waren. Von Letzteren hatten sie eine ganze Menge gefunden, von Ersteren zumindest eine Handvoll. Jetzt würde sich zeigen, ob ihr Plan aufging.
Nyorda schlug den Weg durch die schmale Gasse am Fuß des Festungsfelsens ein und begann, Gebäude zu zählen. Sie war noch nie auf der Südseite des Flusses gewesen, doch es gab hier jemanden, der ihr weiterhelfen konnte. Ihre Schwester lebte hier. Als die Orks kamen, war Ayna Küchenhilfe in einem der Zwergenhaushalte hier drüben gewesen, und wie es aussah, wollten die Stumpen auch jetzt noch nicht auf sie verzichten. In der Zeit, in der Nyorda die Südstadt aus dem Schatten der Ruinen im Norden beobachtet hatte, hatte sie Ayna mehr als einmal gesehen. Gebeugt, in Lumpen gehüllt, mit schweren Eimern in den Händen – aber am Leben.
Leise trabte Nyorda zwischen den schmutzigen Schneehaufen hindurch, die im Schatten der eng zusammenstehenden Häuser hoch aufgetürmt lagen. Der Frühling mochte sich endlich angekündigt haben, doch es würde noch eine ganze Weile dauern, bis er die Hinterlassenschaften des Dunklen Winters beseitigt hatte. Zwischen den verharschten Hügeln zweigten Pfade in Hinterhöfe ab, und vor einem blieb sie schließlich stehen. Die Treppe des Haupthauses wurde hier von zwei aufgerichteten, steinernen Grubenbären flankiert, den einzigen, die sie bislang hier gesehen hatte und, soweit sie wusste, den einzigen in dieser Straße. Für einige Augenblicke stand sie reglos in der leeren Straße, eine vermummte Gestalt, die das dunkle Haus musterte. Wie seine Nachbarn erhob es sich drei Stockwerke hoch in den Nachthimmel. Ein spitzes Schieferdach, steil genug, damit der Schnee nicht darauf liegen blieb, bedeckte das abweisende Bauwerk, dessen sämtliche Fensteröffnungen mit schweren hölzernen Laden gegen die Winterkälte verbarrikadiert waren. Aber die Stumpen liebten ja ohnehin die Dunkelheit.
Der enge Durchgang an der linken Seite des Anwesens war wohl mit einer Schaufel freigekratzt und überdies von vielen Füßen aus dem schmutzigen Schnee herausgetreten worden. Auch das ergab Sinn. Die Dienstboten der Zwerge wohnten in den dunklen Hinterhofkammern. Dienstboten – das bedeutete in den meisten Fällen Menschen. Und falls sie nicht die Stelle gewechselt hatte, dann war dies das Haus, in dem ihre Schwester arbeitete.
Nyorda warf einen letzten Blick nach rechts und links, dann trat sie in den Schatten zwischen den Häusern und sog die Luft ein. Ein schwerer, scharfer Geruch wehte ihr entgegen, der charakteristische Gestank von Wühlerhunden. Diese Biester waren in den Haushalten der Zwerge nicht selten; grobknochige Köter, die als Wachhunde dienten und nur aus Muskeln, Sehnen, zotteligen Haaren und schlechter Laune zu bestehen schienen. Ganz wie ihre Herren. Vorsichtig machte sie einen weiteren Schritt und schnalzte mit der Zunge. Das leise Scharren einer eisernen Kette auf Pflasterstein antwortete ihr, gefolgt von einem ebenso leisen, bedrohlich tiefen Knurren.
Nyorda biss die Zähne zusammen. Das Letzte, was sie jetzt brauchen konnte, war das Gebell eines Kettenhunds. Gut, vielleicht war das nicht wirklich das Letzte. Würde sie darüber nachdenken, fielen ihr sicherlich noch einige andere Dinge ein – aber im Moment stand es ziemlich weit oben auf der Liste. Nach einem langen, reglosen Moment erstarb das Grollen wieder. Die Kette schabte abermals leise. Angestrengt lauschte die junge Frau. Nur eine Kette, und es hatte auch kein zweiter Hund auf sie reagiert. Das war gut.
Behutsam zog Nyorda ein kurzes Rohr aus ihrem Strumpf. Lautlos schob sie einen winzigen Pfeil hinein und verschloss das Mundstück des Blasrohrs mit einem Wattepfropfen. Dann holte sie tief Luft und lief in die Gasse. Diesmal rasselte die Kette, und unter das zurückkehrende Knurren mischte sich das Scharren von Krallen auf vereistem Stein. Nyorda lief aus dem Durchgang in den Hinterhof und kam schlitternd zum Stehen, als eine große, dunkle Masse auf sie zuschoss. Sie hob das Rohr an den Mund, zielte, blies und ließ sich nach hinten fallen, als das knurrende Monstrum nur eine Handbreit von ihr entfernt an das Ende seiner Kette kam. Der Schwung riss dem Hund die Beine unter dem Körper weg, und mit einem erstickten Röcheln fiel das Tier nach hinten. Doch statt sofort wieder hochzuschnellen und in verräterisches Gebell auszubrechen, stieß er nur ein eigenartig drollig klingendes Fiepen aus. Ein Zittern durchlief den Körper des Hundes, dann lag er still.
Nyorda lauschte für einen Moment. Dann schniefte sie, zog sich den Schal wieder über den Mund und zupfte den Pfeil aus der breiten Brust des Tiers. Besser keine Spuren hinterlassen.
Nachdenklich musterte sie den engen Hof. Auch hier türmten sich Berge schmutzigen alten Schnees, ergänzt von einem großen Haufen, der dem Geruch nach aus fauligem Stroh sowie Geflügel- und Schweinemist bestand. Ein kaum sichtbarer Dunst stieg von ihm auf, und trotz der Duftnote lief Nyorda beim Gedanken an gebratenes Schweinefleisch das Wasser im Mund zusammen. Sie schniefte nochmals. Ein Traum, der sich hier kaum erfüllen würde. Es war unwahrscheinlich, dass die Wühler ihr etwas von ihrem kostbaren Schwein abgeben würden. Ohnehin war es erstaunlich, dass hier noch so etwas Nahrhaftes wie ein Schwein existierte. Auf der anderen Seite des Flusses, jener, auf der sie den Winter zugebracht hatte, war auf mehrere Tage kaum noch eine Ratte zu finden gewesen. Das Heer der Orks hatte alles kahl gefressen. Wie es aussah, hatten die Zwerge ihren Nachschub deutlich besser im Griff, was nichts daran änderte, dass sie nicht dazu neigten, ihr Fleisch mit Menschen zu teilen. Die bekamen vielleicht noch die Reste. Die, die das Schwein nicht schaffte.
Neben dem Dunghaufen gab es eine Reihe von hölzernen Hütten und Schuppen, die sich an die steil aufragende Flanke des Festungsfelsens drückten. Licht fiel durch die Ritzen zweier ansonsten fest verschlossener Fensterläden in den Bretterbauten. Vermutlich ein Stall. Auch die Fenster auf der Rückseite des Zwergenhauses waren dicht verschlossen, und hohe Mauern grenzten den kleinen Hof zu denen der Nachbargebäude ab. Kein guter Platz, wenn man eilig verschwinden musste, aber die Wühler bauten nun mal gern Festungen. Mit einem letzten Blick auf den im Schatten liegenden Körper des Hunds stieg Nyorda die Stufen zur Hintertür hinauf und schickte sich bereits an zu klopfen, als sie das Quietschen einer Tür innehalten ließ.
»Hrakka! He! Hund!« Eine Gestalt stand in der Tür des Schuppens, den Nyorda für einen Stall gehalten hatte, und schien zu versuchen, die Dunkelheit des Hofs mit Blicken zu durchdringen. Dass es ihr nicht gelang, hätte sie allein schon als Mensch verraten, selbst wenn es der Umriss des Körpers nicht getan hätte. Licht fiel an ihr vorbei auf den Hof – direkt auf den leblosen Tierleib. »Hrakka?«, wiederholte die Gestalt argwöhnisch.
Nyorda fluchte innerlich, sprang von der Treppe und überbrückte die Entfernung mit drei schnellen Schritten, packte die fremde Frau an den Haaren und stieß sie zurück in die Hütte. Das kleine Messer aus ihrer Gürteltasche lag jetzt am Hals der Frau, und Nyorda sah sich in der Hütte um, bereit, sofort die Flucht anzutreten. Wie es aussah, waren sie allein. »Einen Laut, und ich stech dich ab«, zischte sie der anderen ins Ohr.
Diese schien immerhin intelligent genug, Anweisungen zu verstehen, und schwieg bis auf ein verängstigtes Wimmern, das ihr Nyorda großzügig durchgehen ließ. Stattdessen schob sie mit dem Fuß die Tür zu und manövrierte die andere in das Licht der Kerzen auf dem Tisch.
»Ich … oh.« Erst jetzt konnte sie die andere Frau richtig erkennen und ließ das Messer sinken. Zögerlich ließ sie die Haare los und trat einen Schritt zurück. »Hallo Schwester.«
Die Wut der älteren Frau war noch nicht verraucht. Zu Recht, wie Nyorda widerstrebend zugeben musste. Von der eigenen Schwester in der eigenen Wohnung ein Messer an den Hals gehalten zu bekommen, war nichts, was man eben mal so beiseiteschob. »Hör mal, Ayna, es …«
»Sag jetzt bloß nicht ›Es tut mir leid‹, Nyorda! Bloß nicht. Oder ich hau dir das hier über den Schädel.« Ayna machte Anstalten, die Flasche in ihrer Hand auf den Tisch knallen zu lassen, besann sich jedoch im letzten Moment eines Besseren und warf einen Seitenblick auf den aus alten Pferdedecken genähten Vorhang, der den kleinen Raum teilte. »Du hast Glück, dass sie es nicht mitbekommen haben. Was sollte Ygrane von ihrer Tante denken?«, fauchte sie leise.
Nyorda schloss den Mund und biss die Zähne aufeinander. Schließlich senkte sie den Kopf und nickte dann zum Vorhang hinüber. »Ygrane und wer noch?«
Ihre Schwester verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich wüsste nicht, was dich das angeht.«
»Ich frage mich nur, warum meine Schwester und ihre Tochter im Schweinestall eines Stumpenhauses wohnen und mit wie vielen Menschen sie diesen Verschlag teilen müssen.« Nyorda musterte die beiden mageren Schweine, die in einer abgetrennten Ecke des Raums in schmutzigem Stroh lagen. Irgendwo im Halbdunkel des Stalls gackerte verschlafen ein Huhn. Sie hob eine Augenbraue. »Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hattest du wenigstens noch ein Zimmer im Haus selbst. Bist du so in ihrer Gnade gesunken?«
Ayna verweigerte für einen langen Moment die Antwort, ehe sie tief durchatmete und sich mit immer noch verschränkten Armen an die Abtrennung zum Schweinekoben lehnte. »Flüchtlinge«, sagte sie knapp. »Sie haben alle Zimmer mit Flüchtlingen belegt. Mit Verwandten aus der Oststadt … von der anderen Flussseite. Beinahe jedes Haus hier ist bis zum Rand belegt. Wer hier keinen Platz gefunden hat, ist in der Zeltstadt. Ich kann froh sein, dass wir das hier haben. Wenigstens ist es warm.«
Da ist etwas dran, musste Nyorda zugeben. Zwischen den beengten Verhältnissen, den Schweinen und dem kleinen Eisenofen war es tatsächlich warm. In einem Zelt wäre es ungemütlicher. In einem richtigen Haus allerdings nicht. Sie kniff die Lippen zusammen. »Das ist kein Grund. Die sind die Flüchtlinge. Die sollten hier wohnen.«
Ayna zuckte mit den Schultern.
Sie ist schmaler geworden.
»Sie sind Familie. Natürlich lassen sie sie nicht im Schweinestall wohnen.«
»Dich schon.«
»Ich …« Ayna unterbrach sich. Ihre Augen waren hart. »Was willst du hier, Nyorda? Wenn ich mich recht erinnere, hattest du ein eigenes Dorf, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Gräfin Nyorda. Und jetzt überfällst du mitten in der Nacht Leute, die in Schweineställen wohnen.«
Nyorda beherrschte sich mühsam. »Dinge ändern sich.«
»Tatsächlich.« Diesmal war es an der anderen, eine Augenbraue hochzuziehen.
»Drüben auf der anderen Seite ist es nicht mehr wie vor diesem beschissenen Krieg. Dort herrschen jetzt die Orks. Kein Platz mehr für unabhängige Freigeister.«
»Du bist geflohen.«
»So ähnlich.«
»Und jetzt kommst du zu mir. Was willst du?«
»Ich brauche deine Hilfe, Ayna.«
»Hilfe?« Die Ältere schnaubte. »Ich habe keine Hilfe.« Mit dem Kinn wies sie unbestimmt in den Raum. »Das hier ist alles, was ich habe. Und das reicht nicht mal für uns. Seit Gord … seit wir allein sind, kommen wir drei ohnehin kaum noch über die Runden.«
Nyorda runzelte die Stirn. »Allein? Was ist mit deinem Mann?«
»Ich hatte gehofft, du könntest mir das sagen.«
»Ich? Warum …«
Ayna sackte kaum merklich in sich zusammen. Es schien, als sei ein Schatten über sie gefallen. »Er war auf der anderen Flussseite, als die letzte Brücke fiel. Sie haben alle Männer zusammengezogen, um die Orks auf der anderen Seite zurückzuhalten, jeden, der eine Axt, einen Spieß oder auch nur ein Messer halten konnte. Er war dabei, genau wie Nyall. Seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Ich dachte … wir …« Ihre Stimme brach für einen Augenblick, und ihre Worte klangen heiser, als sie weitersprach. »Den ganzen Winter über haben wir gehofft, er und Nyall hätten es überlebt. Sich vielleicht bis zu dir durchgeschlagen. Wir haben von Flüchtlingen gehört, die weiter unten den Fluss überquert haben. Ich dachte, er weiß, wo du wohnst, und hat dich irgendwie erreicht …«
»Nein.« Nyorda sah ihre Schwester an und hasste sich dafür, diese Antwort geben zu müssen. »Wenn er an der Brücke war, dann ist er tot. So gut wie niemand hat das überlebt.« Sie runzelte die Stirn. »Wer bei den Göttern ist eigentlich Nyall?«
Ihre Schwester warf ihr einen Seitenblick zu. »Ygranes Versprochener und der Vater ihres Kindes.«
»Ihr … was? Wie alt ist sie? Dreizehn Winter? Vierzehn?«
»Sechzehn, Nyorda. Alt genug. Ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, dir ein Urteil zu erlauben. Woher weißt du, dass niemand an der Brücke überlebt hat?«
»So gut wie niemand. Ich habe einen Zwerg getroffen, der dabei war. Außer ihm hat dort niemand diesen Tag überlebt, der kein Ork war. Auf jeden Fall kein Mensch.«
Ayna nickte. Es war das kontrollierte Nicken einer Frau, die diese Nachricht schon geahnt hatte und es sich nicht zugestand, in diesem Moment die Fassung zu verlieren. Sie hatte gerade schon die Hoffnung verloren. Das war mehr als genug.
Nyorda schwieg. Was gab es auch zu sagen? Es tut mir leid? Ihr tat schon zu viel leid. Andere mochten unerschöpfliche Mengen an Mitleid besitzen, doch Nyorda hatte schon immer nur einen sehr begrenzten Vorrat davon gehabt. Auf diese Weise konnte man eine Siedlung voll der miesesten Halsabschneider und Verbrecher führen, die die Menschheit hervorgebracht hatte. Aber in Sachen Familie war sie noch nie besonders gut gewesen. »Wie kommt ihr über die Runden?«, fragte sie schließlich.
Einen Moment lang kaute Ayna abwesend auf ihrer Unterlippe, fest genug, um sie blutig zu beißen. Sie schien es nicht zu bemerken. Schließlich holte sie zitternd Luft und zuckte mit den Schultern. »Gerade so. Der Winter war für alle hart, aber ich dachte, wir kommen besser durch als viele andere. Es sah auch so aus. Zumindest, bis …«
»Bis was?«
»Ygrane hat die Keuche.«
Jetzt sagte sie es doch: »Tut mir leid.«
Ayna nickte. Sie wirkte unendlich müde. »Und ohne sie kann ich die Kleine nicht am Leben erhalten«, flüsterte sie, bevor sie aufsah. »Bald sind nur noch wir übrig, Schwester. So wie früher.«
Früher. Das war ein Ort, den Nyorda nicht gern besuchte. Zu wenige gute Erinnerungen lauerten dort, und viel zu viele schlechte. Es schien so, als würde sie ihr ganzes Leben lang von dort weggehen, ohne ihn jemals zurücklassen zu können. »Was sagen die Heiler?«
Kraftlos hob Ayna die Schultern. »Nichts. Wir haben nichts, was wir ihnen geben könnten, also sind sie blind und taub.«
»Und eure Dienstherrn? Die Stumpen?«
»Nicht unsere. Meine. Ygrane arbeitet nicht für sie. Und das ist das Problem. Du weißt, wie sie sind. Wäre ich es, würden sie sich natürlich um mich kümmern. Aber sie? Ygrane arbeitet oben in der Festung. Sie haben keine Verpflichtung meiner Tochter gegenüber, und das nehmen sie wörtlich. Wie sie es immer tun. Schon dass sie sie hier bei mir wohnen lassen, ist ein Zugeständnis, das ich nicht von jedem Haus erwarten könnte. Das und die Tatsache, dass sie ihr Essen – unser Essen besorgt hat.«
»Und das heißt?«
»Sie hat in der Küche gearbeitet, oben in der Festung. In der Soldatenküche. Du kennst die Zwerge, sie lassen ihre Krieger nicht hungern. Und was übrig bleibt, teilen sich jene, die dort arbeiten. Nicht schmackhaft, aber es hat uns am Leben erhalten. Aber jetzt …?« Sie hob die leeren Hände und ließ sie wieder fallen.
Nyorda starrte die Tischplatte an, dann gab sie sich einen Ruck. Sie hob den Rand ihres Kleids an und begann, einen Teil der Saumnaht aufzutrennen. Schließlich fielen einige Münzen heraus. Nyorda fing sie auf und legte sie auf den Tisch. »Geh einen Heiler holen. Kauf, was du brauchst.«
Ayna starrte auf die Münzen, die auf dem wackeligen Tisch lagen, groß, matt glänzend und golden. »Zwergengold. Das ist … ich habe noch nie so viel gesehen. Woher stammt das?«
»Es liegt genug davon herum, wenn man weiß, wo man es findet.« Nyorda winkte unbestimmt hinter sich, wo in der Dunkelheit auf der anderen Seite des Flusses die Ruinen von Derok lagen. »Es ist nicht wichtig, woher es stammt. Nur, was du damit tust.«
Ayna starrte noch immer auf die Münzen. »Warum?«
»Weil wir durch die Stumpen schon genug Familie verloren haben. Es wird Zeit, dass sie dafür bezahlen.« Sie schob das Geld über den Tisch auf ihre Schwester zu, die noch immer ungläubig die Hand ausstreckte. »Geh einen Heiler holen. Besorg etwas zu essen. Und wenn Ygrane dazu in der Lage ist, besorg euch auch eine Passage nach Süden. Und dann tu noch etwas für mich. Du hast gesagt, deine Tochter arbeitet in der Festung?«
Die Ältere nickte zögerlich.
»Ich nehme an, man braucht einen Passierschein?«
»Ja. Sie hat einen.«
»Gib ihn mir.«
Ayna sah sie forschend an.
»Ich brauche Arbeit.« Nyorda zuckte mit den Schultern und ignorierte den Blick, den ihre Schwester auf die Münzen vor ihr warf. »Und ich habe gehört, dass dort eine Stelle für eine Küchenhilfe frei geworden ist.«
»Aber …« Ayna unterbrach sich selbst und nickte. »Ich hoffe, du weißt, was du tust, kleine Schwester.«
Nyorda zuckte mit den Schultern und gestattete sich ein dünnes Lächeln. »Wieso hätte ich mich ändern sollen? Stellst du mir jetzt deine Enkelin vor, Großmutter?«
EIN DÜSTERER MORGEN
Es war ein düsterer Morgen für Glond, kalt und nass und voller trüber Gedanken. Nachdenklich stand er am Fenster und blickte auf die grauen Dächer von Süd-Derok hinab, die sich dicht gedrängt die Flanke des Bergs hinaufzogen. Schmale Gassen, in denen sich trotz der frühen Stunde bereits die ersten Dalkar zeigten, um schmutzig graue Schneereste vor ihren Türen beiseitezuschaufeln und ihre Waren für den Markt zu schultern, der seit der Zerstörung der Nordstadt auf dem Richtplatz abgehalten wurde. Die Stadt war überfüllt mit Dalkar. Untere aus dem Süden, die erst vor Kurzem mit ihren Kriegern in der Festung eingetroffen waren. Clans aus den Ebenen, die von den Orks in den Süden getrieben worden waren, und unter ihnen die überlebenden Bewohner der Nordstadt. Im äußeren Mauerbereich waren die Königlichen stationiert, die dem direkten Befehl von General Variscit unterstellt waren. Eine kluge Entscheidung, denn inoffiziell sollten sie Sorge dafür tragen, dass die wilden Bergclans, die am Fuß der mächtigen Wehrmauer ihre Zelte aufgeschlagen hatten, nicht allzu viel Ärger in der Südstadt verursachten.
Nach seiner Rückkehr hatten die Herren der Stadt ihn mit Ehren überhäuft. Sie hatten ihm auf die Schulter geklopft, bis sie erneut zu schmerzen begann, hatten ihm einen nichtssagenden Titel verliehen und feierlich die silbernen Schellen angesteckt, die an seinem kurzen Bart ziemlich lächerlich wirkten und außerdem beim Essen störten. Und als sie damit fertig waren, hatten sie nicht so recht gewusst, was sie noch mit ihm anfangen sollten. Helden waren eine schöne Sache, aber eher etwas für Geschichtstafeln und düstere Erzählungen vor dem prasselnden Kaminfeuer. Im täglichen Leben hatten sie wenig Nutzen. Vor allem, wenn sie keine Adelstitel trugen und sich nicht so recht zum Kämpfen eigneten.
Zunächst hatte ihn das amüsiert. Doch mit der Zeit hatte sich eine eigenartige Unruhe in Glond breitgemacht, die von Tag zu Tag größer wurde. Beinahe ebenso wie der dumpfe Schmerz, der seit dem Kampf gegen den Echsenmann in seiner Schulter saß. Die Verletzung hatte am Anfang gar nicht so schlimm ausgesehen, doch sie hatte sich als hartnäckig herausgestellt. Ein tief sitzendes Stechen, das sich besonders in kalten Winternächten bemerkbar machte und ihn täglich neu an die Geschehnisse in der Orkstadt erinnerte. Nachdenklich massierte er das Gelenk und bohrte die Fingerspitzen tief in den darüberliegen Muskel, bis der Druck den Schmerz für einen Augenblick verdrängte.
Sein Blick wanderte zu dem mächtigen Kamin, in dem die letzte Glut des Vorabends glimmte. Er hatte mit eigenen Augen gesehen, wie der Echsenmann in die Flammen gestürzt war. Zusammen mit diesem verfluchten Stein, der das ganze Unheil verursacht hatte. Die Herzen der getöteten Krieger hatten seinen Bann gebrochen – jedenfalls hatte ihm das die Schamanin der Orks erzählt. Das Feuer hatte dann den Rest besorgt. Jedes Mal, wenn er die Augen schloss, tauchte das Gesicht des Echsenmanns vor ihm auf. Die Verzweiflung in seinem Blick, während er fiel, die panische Angst in den schwarzen Pupillen, die schon lange nicht mehr seine eigenen gewesen waren. Welcher böse Geist sich auch seiner Seele bemächtigt hatte, war am Ende in den Flammen umgekommen. So viel war sicher.
Oder etwa nicht?
In den wenigen Augenblicken bevor das Feuer den Echsenmann verschlang, hatte Glond die Stimmen ebenfalls gehört. Fremdartig und seltsam hatten sie geklungen, und weit entfernt. Sie hatten gefleht und gedroht und ihm Dinge versprochen, von denen andere nur träumen konnten. Doch er hatte ihre falschen Worte ignoriert, denn er war voller Wut auf den Echsenmann gewesen. Und was hätten sie ihm auch bieten können? Alles, was er wollte, war, dass es endlich ein Ende hatte. Dass er in aller Ruhe nach Hause gehen konnte, um ein kühles Bier zu trinken. Als alles Flehen nichts genützt hatte, als der Stein bereits auf die Glut zustürzte, da hatten sie sich endlich von ihm abgewandt und stattdessen ihre Blicke in die Ferne gerichtet.
Und sie hatten um Hilfe gerufen.
»Über was grübelst du nach?« Unbemerkt war Axt an ihn herangetreten und hatte ihm die Hand auf die schmerzende Schulter gelegt.
Glond fühlte die Wärme ihres Körpers an seinem Rücken und lächelte. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund wusste diese Frau immer ganz genau, wie er sich fühlte. Wenn es tatsächlich eine Art von Magie auf der Welt geben sollte, dann gehörte diese Fähigkeit sicherlich dazu. Anders konnte er sich das einfach nicht erklären. »Es ist nichts.« Er zuckte mit den Schultern. »Dieser ewige Winter. Wie lange dauert er schon an? Der Frühling ist bald vorbei, und es liegt immer noch Schnee. Und die Orks ziehen weiter durch das Land und verwüsten unsere Felder und Dörfer.«
»Lass mal sehen.« Sie reckte sich und warf einen Blick über seine Schulter nach draußen. »Hm, der Schnee ist deutlich weniger geworden, und Zornthal hat die Orks aus der Stadt vertrieben. Kein Grund also, so ein Gesicht zu machen.«
Glond verzog es trotzdem. »Zornthal ist ein muskelbepacktes Arschloch. Der alte Drecksack hat nur die Ernte eingefahren, nachdem du den Orks die Nachschubwege abgeschnitten hast. Einen halb verhungerten Gegner kann selbst ein Mensch in die Knie zwingen. Vielleicht sogar ich. Aber um sich diesen Vorteil erst mal zu verschaffen, muss man Köpfchen haben.« Sein Zeigefinger tippte sanft gegen ihre Stirn. »Wenn es noch dazu ein so hübsches ist wie deins, gefällt mir das umso besser.«
»Das erzählst du sicherlich jedem Heerführer, dem du schmeicheln möchtest.«
»Nur den klugen und gut aussehenden. Zornthal ist nicht mal eins davon.«
Axt lachte leise. »Rede nicht so über den Dienstherrn, dem du in einem Anflug geistiger Umnachtung die Treue geschworen hast. Ich bin froh, dass er uns unterstützt. Sein Clan ist einer der wenigen, der sich ohne Gejammer und Geschachere für den Norden einsetzt. Ohne ihn und die Bergclans sähe es wesentlich schlimmer aus.«
»Ohne dich hätten sie gar nichts. General Variscit weiß das. Ich hoffe, sein Nachfolger wird das auch so sehen.«
»Das liegt nicht in meiner Hand.« Sie zuckte mit den Schultern und seufzte. »Er wird von Stunde zu Stunde schwächer …«
Glond nickte finster. »Man muss ihn nicht gesehen haben, um das zu wissen. Die Krähen versammeln sich bereits in der Festung, um das beste Stück vom Kadaver zu ergattern. Erst gestern sind wieder zwei Hertige aus dem Süden angereist.«
»Ich weiß. Die Königlichen mussten sie gewaltsam trennen. Keiner wollte dem anderen den Vortritt durch das Haupttor lassen.«
»Als es um die Verteidigung Deroks ging, haben sie nicht halb so viel Einsatz gezeigt. Und dabei tun sie noch so, als wären sie rein zufällig hier. Die Geschäfte. Der Krieg. Die Sorge um einen Angehörigen aus Derok. Als ob sich ein Hertig jemals Sorgen um seine Angehörigen gemacht hätte …« Glond rollte vielsagend mit den Augen. »Nur weil sie nicht zugeben wollen, dass sie scharf auf den Generalsposten sind. Der zweite Mann im Reich zu werden, ist aber auch zu verlockend für sie. Viel verlockender, als sein Leben für ein paar Obere und einen Haufen zerlumpter Menschen in Derok zu riskieren.«
»So sind sie eben. Aber besser, sie kommen jetzt als nie. Wenn sie erst einmal versammelt sind, werden sie sich nicht mehr so leicht vor der Verantwortung drücken können. Einem guten General kann es gelingen, die Heere zu vereinen und dazu zu bringen, gemeinsam gegen die Eindringlinge vorzugehen.«
Glond schnaubte. »Nur wenn es diesen störrischen Mauleseln überhaupt gelingt, sich auf einen aus ihren Reihen zu einigen. So wie ich sie kenne, werden sie die nächsten Jahre damit verbringen, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Die Wahl wird erst beendet sein, wenn alle tot sind oder die Biervorräte zur Neige gehen.«
»Wir werden sehen. Es sind auch ein paar ganz passable Kandidaten darunter. General Variscit mag schwer krank sein, aber noch ist er am Leben und kann Einfluss auf ihre Meinung nehmen. Vergiss nicht, dass er über das Stimmrecht des Königs verfügt.« Axt zog ihn am Kragen zu sich herab und gab ihm einen Kuss. »Ich muss los. Diese Maulesel füttern, ehe sie sich vor Hunger gegenseitig totbeißen.«
»Manchmal helfen nur Stockschläge.«
»Ich denke darüber nach.« Sie klopfte mit der Hand auf den Griff ihrer Waffe und zwinkerte ihm zu. Dann musterte sie ihn mit diesem Blick, der jedes Mal dieses unglaubliche Kribbeln in seiner Bauchgegend verursachte, und griff nach ihrem Umhang. »Sehen wir uns heute Abend?«
Er lächelte. Natürlich. Natürlich sehen wir uns! Nichts auf der Welt würde ich lieber tun. Das weißt du doch, oder? Ich … Ich … verdammt, warum wollten ihm die Worte nicht über die Lippen kommen? Was war denn daran nur so schwer? »Ich habe nichts vor. Ich werde mich nicht von der Stelle rühren, bis du wieder in meinen Armen liegst.«
Noch lange nachdem ihre Schritte auf dem Flur verhallt waren, schaute er auf die verschlossene Tür. Er würde sich nicht von der Stelle rühren. Jedenfalls nicht sehr weit. Nur ein kurzes Stück den Gang hinunter und über ein paar Treppen in die unteren Ebenen der Festung, so wie er es in den letzten Monaten beinahe jeden Tag getan hatte. Doch davon musste Axt nichts wissen. Sie hatte schon mehr als genug Sorgen, da musste er sie nicht auch noch mit seinen Problemen belasten.
Glond nahm eine Laterne von ihrer Halterung an der Wand und machte sich auf den Weg. Das Gewimmel in der Bergfestung war beinahe noch schlimmer als draußen in der Stadt. Neben den Clankriegern der Unteren waren es vor allem Flüchtlinge aus Derok, die sich in den schmalen Gängen drängten. Die wenigsten wirkten zufrieden, der Großteil heruntergekommen, erschöpft und ausgezehrt. Überall stank es nach Unrat, Fäkalien und Verzweiflung.
Glond kam kaum ein paar Schritte weit, ohne angerempelt oder geschubst zu werden. Immerhin machten die meisten ihm nach einem Blick auf seine Bartklemmen widerstrebend Platz – wenn auch nicht, ohne ihm finstere Blicke und leise gemurmelte Flüche hinterherzuschicken. Am Wegesrand hockten zahlreiche Bettler. Kriegsversehrte, die Glond ihre schwärenden Armstümpfe entgegenstreckten und ihn um Almosen anflehten, Alte mit zahnlosem Grinsen in den verfallenen Gesichtern und Kinder, deren Bäuche vom Hunger schon ganz aufgedunsen waren. Es war ein ungewöhnlicher Anblick, der vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Doch im Reich der Unteren waren die einstigen Herren der Nordstadt kaum mehr wert als die Menschen, die bei ihnen in Lohn und Brot standen. Axt hatte ihr Möglichstes getan, ihre Lebensbedingungen zu verbessern, doch eine echte Veränderung würde nur eine Neubesiedelung der Nordstadt bringen. Nur ließ die nun schon viel zu lange auf sich warten.
Glond drängte sich eine gewundene Treppe hinab und stieß in einer Biegung beinahe mit einem wild dreinblickenden Kerl in zerlumpter Kleidung zusammen, der ihn nach dem ersten Schreck wüst beschimpfte. Zorn wallte in ihm auf, und er packte ihn am Kragen und schüttelte ihn kräftig durch. Dabei fielen mehrere Laibe Brot unter seinem zerschlissenen Mantel hervor und kullerten in den Dreck.
»Ich habe sie nicht gestohlen!«, kreischte der Mann und wand sich verzweifelt in Glonds Griff. »Ganz sicher nicht. Sie wurd’n mir geschenkt – von einem Freund!« Mit einer überraschenden Drehung riss er sich los und stolperte davon.
»Wartet!«, rief Glond ihm hinterher. »Ich kenne Euch doch. Seid Ihr nicht Meister Rothaar aus der Edelsteinschleiferstraße? Wir sind uns in der Ratshalle begegnet, erinnert ihr Euch?«
Doch der Mann war bereits im dichten Gedränge verschwunden. Seufzend schob Glond zwei Bettler zur Seite, die sich bereits um die heruntergefallenen Brote stritten, hob eines davon auf und drückte es einem Straßenjungen in die Hand, der es hastig unter sein schmutziges Hemd stopfte und ihm vor die Füße spuckte, bevor er sich aus dem Staub machte.
In den Archiven war es ungleich ruhiger als in den oberen Bereichen der Festung, geradezu totenstill. Nur den wenigsten Dalkar war es vergönnt, in den heiligen Hallen zu wandeln, die von den Priestern des Dalkargottes mit Argusaugen bewacht wurden. Einzig aufgrund der Fürsprache von Dion, dem letzten überlebenden Priester aus Derok, war ihm der Zugang gewährt worden.
Ein einsamer alter Schreiber saß über sein hölzernes Pult gebeugt und malte mit akribischer Genauigkeit Schriftzeichen auf ein in Leder gebundenes Pergament. Glond nickte ihm zu, und der Alte wandte sich nach einem misstrauischen Blick kopfschüttelnd wieder seiner Arbeit zu.
In den letzten Monaten war er diesen Weg so oft gegangen, dass er ihn inzwischen blind beschreiten konnte. Er war Stufen hinauf und hinab geeilt, war uralten Gängen gefolgt, die sich kreuz und quer durch den Berg zogen, und war auf weitere, noch ungleich ältere Gänge gestoßen, die in vergessene Höhlen mündeten oder unvermittelt in Sackgassen endeten. Unzählige Regale war er abgeschritten und hatte Schriftstücke gewälzt und Steintafeln entziffert, von denen manche so alt und verwittert waren wie der Anbeginn der Zeit. Es war die sprichwörtliche Suche nach einem im Moor Versunkenen gewesen. Ziellos, verzweifelt und ohne Aussicht auf Erfolg.
Seine Laterne beleuchtete eine natürlich gewachsene Höhle, deren Decke sich irgendwo weit über seinem Kopf im Dämmerlicht verlor. Regale über Regale türmten sich in die Höhe, bis zum Bersten gefüllt mit Pergamenten. Archiviert, katalogisiert und geordnet von den Händen unzähliger Archivare, die in ihrem Leben kaum etwas anderes getan hatten, als ein Dokument über das nächste zu schichten.
Er stellte die Laterne auf einem schweren Eichentisch ab und ließ den Blick über die Regale schweifen. So viele Schriftstücke. So viel Wissen an einem einzigen Ort vereint. Dort oben, irgendwo in den Schatten versteckt, lagen die Antworten, nach denen er suchte. Tief im Inneren war er sich dessen absolut sicher. Doch wo fing man an, wenn man noch nicht einmal die Frage kannte? Er schloss die Augen und lauschte in die Stille hinein. Der Berg hatte seine eigene Stimme. Kaum hörbar zwar, aber dennoch vorhanden. Je länger er lauschte, desto lauter wurde sie. Zuerst ein leises Tröpfeln; Wasser, das sich irgendwo seinen Weg durch einen Riss im Gestein in die Tiefe bahnte. Ein Knacken hier, ein Wispern dort. Ein altes Sprichwort besagte, dass der Berg der Freund der Dalkar war und alle ihre Geheimnisse kannte. Man musste nur seine Sprache verstehen.
Stein war so einer gewesen, der sie verstand. Doch der seltsame kleine Mann war in den Ruinen von Derok umgekommen. Ratlos blickte Glond an der schweigsamen Fassade der Regale empor. Wie wäre Stein vorgegangen? Sicherlich nicht nach einem Plan, so wie er selbst es die ganze Zeit getan hatte. Stein hätte keine Archivierungslisten studiert, wäre kaum bis über den Kopf in Dokumenten versunken und hätte nicht unzählige Archivare mit seinen Fragen zur Verzweiflung gebracht. Stein hätte unvermittelt aufgestampft, und die eine, alles erklärende Schriftrolle wäre ihm direkt vor die Füße gefallen.
ENDE DER LESEPROBE