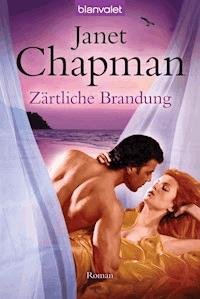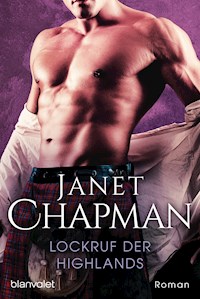5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Highlander-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine wilde Schönheit, gezähmt von den heißen Berührungen eines Highlanders
Bei einem Flugzeugabsturz über Maine gibt es nur zwei Überlebende: Die schöne Wissenschaftlerin Grace Sutter und den umwerfend charmanten Greylen MacKeage. Doch Greylen birgt ein unglaubliches Geheimnis: Er stammt aus dem 12. Jahrhundert – und ist auf der Suche nach seiner wahren Liebe durch die Zeit gereist! In der eisigen Wildnis lodert zwischen den beiden bald ungezügelte Leidenschaft …
Die »Highlander«-Reihe:
Band 1: Das Herz des Highlanders
Band 2: Mit der Liebe eines Highlanders
Band 3: Der Ring des Highlanders
Band 4: Der Traum des Highlanders
Band 5: Küss niemals einen Highlander
Band 6: In den Armen des Schotten
Band 7: Lockruf der Highlands
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Nach einem Flugzeugabsturz findet sich die schöne, brillante Wissenschaftlerin Grace Sutter auf einem eisigen Berg irgendwo in Maine wieder – mit dem einzigen anderen Überlebenden, dem umwerfend attraktiven Schotten Greylen MacKeage. Doch Greylen birgt ein unglaubliches Geheimnis: Er stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist ein tapferer Highland-Krieger, der auf der Suche nach seiner schicksalhaften Liebe durch die Zeit gereist ist! Nur gemeinsam können Grace und Greylen in der harten, rauen Wildnis überleben. Aber keiner von beiden ist auf die wilde, ungezügelte Leidenschaft gefasst, die zwischen ihnen auflodert. Während Grace nicht gewillt ist, ihren Gefühlen zu folgen, wird Greylen nicht eher aufgeben, bis er das Herz seiner Geliebten erobert hat …
Autorin
Janet Chapman ist das jüngste von fünf Kindern. Schon immer hat sie sich Geschichten ausgedacht, aber erst mit ihrem ersten Roman »Das Herz des Highlanders« begann die Gewinnerin mehrerer Preise, professionell zu schreiben. Janet Chapman lebt mit ihrem Mann, ihren zwei Söhnen, drei Katzen und einem jungen Elchbullen, der sie regelmäßig besucht, in Maine.
Janet Chapman
Das Herz des Highlanders
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Sabine Beckmann
blanvalet
Die Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Charming the Highlander« bei Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2003 by Janet Chapman Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2006 by Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.. Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (miami beach forever; FXQuadro; Gmorv; Dmytro Vietrov; fotobook) LW · Herstellung: HN Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Dies Buch ist für Robbie
Der während all der Jahre am Tor Wache stand und nicht zuließ, dass die Welt in meinen Traum vordringt.
Für deine Geduld, deine Unterstützung und deine Kraft, Schweres auf dich zu nehmen.
Weil du ein Feld in den Strömungen des Lebens für mich warst – einfach nur: Danke.
Es sind jetzt schon fünfundzwanzig Jahre, mein Gatte, und die Reise wird immer besser.
PROLOG
Schottisches Hochland im Jahr 1200 n. Chr.
Es war wirklich kein guter Tag für einen starken Zauber. Das gnadenlos grelle Gleißen der Sonne, die nahe dem Zenit stand, wurde in Wellen erdrückender Hitze von der vertrockneten Landschaft reflektiert. Nichts bewegte sich, außer ein paar kleiner Staubwölkchen, die hier und da von einer leichten Brise im Tal aufgewirbelt wurden. Selbst die Vögel bewegten sich nicht fort aus dem Schatten des durstigen Eichenwaldes.
Pendaär stützte sich schwer auf seinen uralten Kirschholz-Stab, während er den Weg hinauf zum Gipfel des steilen Hügels wanderte. Er schalt sich im Stillen, weil er in vollem Zeremonial-Ornat hier hinaufkletterte. Mehr als einmal musste der alte Zauberer stehen bleiben und seine Robe freimachen, die in einem Busch hängen geblieben war.
Herrgott noch mal, er war wahrhaftig müde.
Pendaär blieb stehen und lehnte sich an einen Felsbrocken, um zu Atem zu kommen, schob sich das jetzt schweißfeuchte, lange, weiße Haar aus dem Gesicht und beobachtete die Straße unter sich auf der Suche nach einem ersten Anzeichen vom Erscheinen der MacKeages. Den Sternen sei Dank, dass er bald schon diesen gottverlassenen Ort hinter sich lassen würde. Er hatte genug von diesen rauen Zeiten, von dem ständigen Kampf ums Überleben und von den unaufhörlichen, sinnlosen Kriegen zwischen arroganten Männern um Macht und gesellschaftliche Stellung.
Ja, er war mehr als nur bereit dazu, die Bequemlichkeiten einer wesentlich moderneren Welt zu entdecken.
Pendaär schüttelte seine Robe aus und wischte über den Staub, der sich am Saum angesammelt hatte. Dabei verfluchte er noch einmal die Planeten dafür, dass sie ausgerechnet an einem derart üblen Tag eine perfekte Konjunktion bildeten. Aber Laird Greylen MacKeage stand kurz davor, eine äußerst bemerkenswerte Reise zu beginnen, und Pendaär war entschlossen, sich einen guten Platz zu suchen, um ihn auf den Weg zu schicken. Um möglichst schnell in die richtige Ausgangsstellung zu kommen, verließ der müde Zauberer seinen Rastplatz und schnaufte weiter den Hügel hinauf.
Als er den Gipfel schließlich erreicht hatte, setzte er sich auf einen vorspringenden Granitfelsen und hob das Gesicht der Sonne entgegen, so dass die warme Brise sein Haar bewegte und seinen Hals abkühlte. Als seine Atmung sich schließlich wieder beruhigt hatte, legte Pendaär sich seinen Kirschholz-Stab auf den Schoß und berührte die knorrigen Verdickungen im Holz, wobei er langsam die Worte seines Zauberspruches wiederholte, konzentriert darum bemüht, ihn auch richtig herzusagen.
Heute kamen einunddreißig Jahre sorgfältiger Arbeit zu einem Höhepunkt. Einunddreißig Jahre führten endlich zum erfolgreichen Abschluss, Jahre, in denen er konstant um den Anführer, genannt Laird, des MacKeage-Clans bemüht gewesen war, einen starken, oft wilden Mann bewacht und beobachtet hatte. Die Sonne hatte den Zenit fast erreicht. Die Planeten-Konjunktion war beinah vollständig.
Und Greylen MacKeage kam zu spät.
Das überraschte Pendaär nicht. Der Junge war schon bei seiner Geburt gute zwei Wchen zu spät dran gewesen. Und jetzt lief er Gefahr, genau jene Zukunft zu versäumen, die die Sterne vor zweiunddreißig Jahren versprochen hatten, in der Nacht, als der junge Laird empfangen worden war.
Greylen MacKeage trug den Samen von Pendaärs Nachfolger in sich.
Doch die Frau, die zu Greylen gehörte, war im Amerika des zwanzigsten Jahrhunderts geboren worden. Und so verursachte der Versuch, die beiden zusammenzubringen, dem alten Zauberer unsagbare Bemühungen voller Rückschläge.
Es wäre natürlich schon hilfreich gewesen, wenn er gewusst hätte, wer die Frau war.
Doch das genau war das Problem. Die Mächte des Universums hatten einen herzlosen und manchmal eigenartigen Sinn für Humor, durch den Pendaär in diesem Falle nur die Möglichkeit hatte, den Mann oder die Frau zu kennen, die seinen Erben hervorbringen würden, nicht beide.
Pendaär hatte damals den Zauberspruch gewählt, der ihm Greylen MacKeage zeigte. Dann hatte er die ersten einunddreißig Jahre von Greylens Leben damit verbracht, ihn irgendwie am Leben zu erhalten. Das war keine einfache Aufgabe gewesen. Die MacKeages waren ein kleiner, aber mächtiger Clan, der mehr Feinde zu haben schien als die meisten anderen. Sie lagen ständig mit dem einen oder anderen fremden Stamm im Krieg, und ihr halbstarker junger Laird bestand grundsätzlich darauf, an erster Stelle in den Kampf zu ziehen.
Doch jetzt hätte Pendaär gern mehr über die Frau gewusst. War sie schön? Intelligent? Hatte sie genug Widerstandskraft und Mut, um sich mit einem solchen Mann einzulassen, wie Greylen MacKeage es war? Bestimmt würde die andere Hälfte dieses magischen Paares alles besitzen, was notwendig war, um einen Zauberer ins Leben zu bringen – oder etwa nicht?
Pendaär hatte viele schlaflose Nächte mit derartigen Sorgen verbracht. Er war sogar so weit gegangen, die nordwestliche Gebirgslandschaft von Maine achthundert Jahre in der Zukunft zu besuchen, in der Hoffnung, die Frau erkennen zu können. Doch der Zauber, der sie beschützte, war besiegelt, und keine seiner magischen Künste würde dieses Siegel brechen können.
Nur der Mann, dem es bestimmt war, sie zu gewinnen, würde sie finden können. Auf seine eigene Art und unter seinen ganz bestimmten Bedingungen konnte nur Greylen MacKeage die Frau für sich beanspruchen, die die Uralten ihm zur Gefährtin ausersehen hatten.
Vorausgesetzt, er erschien jetzt überhaupt.
Es verging beinahe eine Stunde, bevor Greylen und drei seiner Krieger auf dem felsigen Pfad um die Ecke bogen und endlich in Sicht kamen. Sie boten zweifellos einen eindrucksvollen Anblick. Die MacKeages ritten schweigend in einer Reihe, auf starken Streitrossen, die sie anscheinend ohne große Mühe beherrschten. Die Männer waren schmutzig und vielleicht vom langen Ritt ein wenig müde, schienen jedoch den Weg ohne nennenswerte Schwierigkeiten hinter sich gebracht zu haben.
Pendaär stand mühsam auf. Es war Zeit. Er schob die Ärmel seines Gewandes zurück und hob seinen Stab gen Himmel. Dabei schloss er die Augen und begann den Zauberspruch zu rezitieren, der die Kräfte der Natur in Bewegung bringen sollte.
Plötzlich durchdrang Kriegsgeheul die Luft.
Greylen MacKeage hielt sein Pferd an und zog sein Schwert aus der Scheide. Er sah Krieger auf Pferden aus einem Versteck zwischen den Bäumen auf sich zustürmen. Sie kamen, in voller Kriegsbemalung beinah unkenntlich, bis zu den Zähnen bewaffnet und mit hoch aufgereckten Schwertern auf Greylen und seine kleine Gruppe von Leuten zu.
Das waren die MacBains, die hinterhältigen Schufte.
Greylens Bruder Morgan stellte sich sofort an seine Seite, und zusammen mit Greylens beiden anderen Männern bildeten sie eine eindrucksvolle Schlachtreihe. Greylen schaute nach links, dann nach rechts, und nun erst wandte er seine Aufmerksamkeit wieder seinen Feinden zu, hob mit einem erwartungsvollen Grinsen das Schwert und antwortete auf das Kampfgeheul der Gegner mit seinem eigenen Schlachtruf. Die vier MacKeage-Krieger spornten ihre Pferde und griffen die MacBains an, wobei sich ihr Lachen schnell im Schlachtlärm verlor.
Greylen hatte diesen Kampf nicht führen wollen, doch bei Gott, wenn Michael MacBain heute sterben wollte, würde Greylen ihm bestimmt den Gefallen tun und diesen Mistkerl zur Hölle schicken.
Das allerdings nur, falls er Ian dran hindern konnte, den Schuft zuerst zu erledigen. Ian, der schon gute fünf Jahre über das beste Alter hinaus war, kämpfte wie ein Besessener, und Greylen konnte nicht mehr tun, als seinem alten Freund den Rücken freizuhalten, während er sich selbst schützte. Der Geruch vom Schweiß der Pferde stieg mit dem Staub in die Luft, den die Schlacht aufwirbelte; der Geschmack von Blut, Galle und Zorn brannte in Greylens Kehle.
Sein Pferd stolperte durch den Angriff von MacBains Pferd, Grey duckte sich, wich nach rechts aus, schwang den Arm in großem Bogen und schlug Michael MacBain mit der flachen Seite seines Schwertes mitten auf den Rücken. Ein schwächerer Mann wäre von einem solchen Schlag aus dem Sattel gehoben worden, aber MacBain lachte nur laut und wandte sein Pferd ab.
Diese Schlacht war eine vergebliche Übung, und beide Männer wussten das. Sechs MacBains gegen vier MacKeages war nicht gerecht. Es würde noch ein halbes Dutzend MacBains erfordern, damit der Kampf gleichwertig wurde, und Greylen fragte sich noch einmal, was MacBain heute eigentlich vorhatte.
Stand ihm der Sinn nur nach sportlicher Betätigung? Wollte er Greylen ärgern? Oder hatte er keine Lust mehr, auf Greylens Rückschlag zu warten?
Also gut. Michael war es während der vergangenen drei Jahre müde geworden, ständig einen unerwarteten Angriff einplanen zu müssen, und jetzt versuchte er, einen Krieg zu erzwingen, den Greylen ihm nicht erklären wollte. Keine einzelne Frau, egal wie unschuldig und wie lange schon tot, war es wert, dass sich ein ganzer Clan im Krieg gegen einen anderen erhob. Michael brauchte nicht heute zu sterben, um die Feuer der Verdammnis zu erfahren. Greylen würde seinen Schwertarm darauf verwetten, dass MacBain schon jetzt wohlvertraut war mit dem Hades.
Ein greller Lichtblitz vom höchsten Gipfel des Hügels zog Greylens Aufmerksamkeit auf sich, und er drehte sein Schlachtross zur Seite, um besser sehen zu können, was dort geschah. Eine einzelne Gestalt stand ganz oben auf der Höhe, seine langen Gewänder wurden vom aufkommenden Wind gebläht, sein wirres weißes Haar verdeckte sein Gesicht. Seine Arme waren ausgestreckt, vor einem sich verdunkelnden Himmel hoch erhoben, in der einen Hand hielt er einen Stock, der glühte wie die Kohlen eines prasselnden Feuers.
Grey warf wieder einen schnellen Blick auf den Kampf hinter sich und sah, wie Michael MacBain ebenfalls sein Pferd zügelte und zur Höhe hinaufspähte. Doch noch bevor Grey Zeit hatte, darüber nachzudenken, was er dort oben eigentlich sah, wurden er und MacBain wieder ins Getümmel des Kampfes zurückgezwungen, den Greylen plötzlich gar nicht mehr kämpfen wollte.
Pendaär schloss die Augen und rezitierte laut den Spruch seiner Vorfahren. Blitze zuckten um ihn her, sein Haar sträubte sich an seinem Hals, und der Wind drückte die Gewänder gegen seine Beine. Licht drang brennend unter seinen Lidern hervor, und der alte Zauberer wankte unter seiner Macht.
Der Lärm der Schlacht unter ihm wurde lauter.
Pendaär öffnete langsam die Augen und richtete den Blick finster auf den verwitterten, knotigen Stab in seiner Hand. Nichts war geschehen. Er sah wieder nach unten. Diese gesetzlosen MacBains bedrängten immer noch die MacKeages.
Er hob noch einmal den Stab und befahl den Wolken zu brodeln, den Winden zu heulen und dem Regen zu strömen. Er reichte tief ins Innere seiner Seele und beschwor die Macht der Uralten, um ihre Kraft der seiner eigenen vierzehnhundert Jahre Zauberei hinzuzufügen. Am heutigen Tag durfte Greylen MacKeage nichts zustoßen. Er hatte ein viel würdigeres Schicksal vor sich, eines, das ihn auf eine Reise schicken würde, wie sie bisher nur wenige Sterbliche gekannt hatten.
Die Beine weit gespreizt, die Füße fest in den Boden der Anhöhe gestemmt, bereitete sich Pendaär auf den vertrauten Energiestoß vor, den er in Kürze loslassen würde. Mit hoch erhobenem Kopf und ausgestreckten Armen sprach er den Zauberspruch langsamer, um in seinem Zauber die Macht der Zeit über die der Materie zu stellen. Sein langes weißes Haar wurde erneut elektrisch geladen, und jeder Muskel in seinem Körper bebte voller Macht.
Und immer noch geschah nichts.
Mit einem wilden Brüllen vor Ärger schleuderte Pendaär den Stab gegen den Felsen, auf dem er gesessen hatte. Der Stab prallte davon ab und wurde knisternd lebendig, bevor ihn unvermittelt ein Blitzstrahl erfasste. Er flog hoch über den Hang hinaus, und Lichtbögen voller Energie strahlten in alle Richtungen davon aus.
Eine große Dunkelheit legte sich über das Land. Das Klirren von Stahl auf Stahl, Männerrufe, das Stampfen riesiger Hufe wurde von betäubendem Donnern übertönt. Prasselnder Regen strömte nieder und verstärkte die totale Verwirrung, die ausgebrochen war. Bäume bogen sich, bis sie brachen. Felsen wurden gespalten, und Brocken lösten sich von der Anhöhe, auf der Pendaär stand.
Pendaär fiel mit ihnen den Hang hinunter, rollte Hals über Kopf abwärts, seine jetzt völlig durchweichten Gewänder klebten an seinen Beinen, als er versuchte, in dem Erdrutsch wieder auf die Füße zu kommen. Regen, Schlamm, Felsbrocken und Gestrüpp rauschten den steilen Hang hinunter und rissen den Zauberer mit sich.
Als das Chaos schließlich endete, landete Pendaär mit einem heftigen Aufprall in einer schlammigen Pfütze, das Gesicht zum Himmel gewandt. Die Sonne schien wieder, ihr Gleißen war so hell, dass er die Augen schließen musste.
Er bewegte sich schließlich, weil eine seltsame Stille herrschte. Der alte Zauberer setzte sich langsam auf, strich sich die Haare aus dem Gesicht und sah sich um. Dann rieb er sich die Augen mit den Fäusten und schaute sich nochmals um, schließlich begrub er mit einem verärgerten Ächzen das Gesicht in den Händen.
Was hatte er getan?
Ja, Greylen MacKeage hatte zweifellos an diesem Tag seine Reise begonnen, doch es sah ganz so aus, als ob der Krieger nicht allein unterwegs wäre.
Denn es war kein einziger MacKeage mehr da, um weiterzukämpfen. Und auch keiner der aus dem Hinterhalt gekommenen MacBains war mehr zu sehen. Selbst ihre Pferde waren mit ihnen im Unwetter verschwunden. Nichts blieb vom Kampf als zerwühlter Schlamm, aufgerissene Gras-Soden und immer ferner vertönender Donner.
Pendaär betrachtete entsetzt den leeren Hang.
Er war nicht bei ihnen geblieben.
Greylen MacKeage, seine Männer und diese verdammten MacBains waren ohne ihn durch die Zeit gereist. Herrgott noch mal! Sie waren ohne Anleitung oder Ziel im einundzwanzigsten Jahrhundert gelandet, und er saß hier herum wie eine Warze auf einer Kröte und hatte nicht die leiseste Ahnung, wohin sein widerspenstiger Stab verschwunden war.
Pendaäer kam mühsam auf die Beine und begann danach zu suchen. Dabei rang er die Hände, murmelte fluchend vor sich hin und rannte aufgebracht im Kreis herum. Er musste bei den Kriegern bleiben. Er musste dafür sorgen, dass sie sich nicht gegenseitig töteten oder gar irgendeinen unschuldigen Menschen des einundzwanzigsten Jahrhunderts, der ihnen womöglich nichtsahnend begegnete.
Pendaär suchte eine halbe Stunde lang, bevor er schließlich seinen Stab fand. Er stand aufrecht in einer Schlammpfütze, noch bebend von Energie. Der Zauberer hob sein Gewand, stieg in die Pfütze, griff nach dem summenden Stab und zerrte daran, in dem Versuch, ihn aus der Erde zu ziehen. Das Kirschholz wand sich und bog sich heftig zur Seite – offensichtlich war der Stab nachhaltig verärgert darüber, dass er ihn fortgeworfen hatte.
Pendaär kümmerte sich nicht weiter um den Protest des Stabs und zog mit einem kräftigen Ruck daran, durch den er schwungvoll rückwärts fiel und auf dem nassen Boden landete. Er drückte den Stab fest an seine Brust und murmelte ein Gebet mit der Bitte um Geduld.
Danach brauchte der Zauberer weitere zwanzig Minuten, bis er den missmutigen Kirschholz-Stab wieder besänftigt hatte, indem er mit sanfter Hand über das knorrige Holz strich und sich leise bei ihm entschuldigte.
Der Stab ließ sich zusehends wieder beruhigen, und schließlich stand Pendaär auf. Er drängte den Stab, wieder zu wachsen, die Mächte des Universums erneut in seiner Hand zu versammeln. Der Stab wurde länger und wärmer, begann zu summen. Diesmal schien alles zu klappen.
Pendaär schloss die Augen und begann einen neuen Zauberspruch zu rezitieren, wobei er den Stab in großem Bogen herumschwang. Plötzlich erschien ein Beutel zu seinen Füßen, und Pendaärs nasse, schlammige Robe verschwand magisch von seinem Körper. Er öffnete die Augen und strich den frischen, schwarzen, wollenen Talar glatt, den er jetzt trug, fühlte an dem weißen Kragen an seinem Hals.
Pendaär lächelte. Jawohl. Das war schon besser. Er hatte seinen Zauber wieder im Griff.
Eilig kniete er sich neben den Beutel auf den Boden und prüfte nach, ob alles darin war, was er für seine eigene Reise brauchen würde. Er schob die Rosenkranzperlen beiseite, ebenso die Zahnbürste und den elektrischen Rasierapparat, den auszuprobieren er schon sehr gespannt war. Seine Hände tasteten nach den Bündeln von Papiergeld, die er verlangt hatte. Sie lagen direkt unter einem zweiten wollenen Talar, fünf Paar Socken und einem schweren Mantel aus rotem Schottenkaro des Mackinaw Clans.
Alles schien an seinem Platz zu sein.
Pendaär richtete sich auf und hob seinen Stab zum Himmel, wobei er wieder begann, den Spruch zu singen, der Materie durch die Zeit bewegen konnte. Erneut wurde es dunkel um die Hügelkuppe, Blitze zischten durch den Himmel, und Pendaär hielt seinen Beutel ganz fest, schloss die Augen und beugte die Schultern, um sich gegen das Chaos zu wappnen, das ihn gleich verschlingen würde.
KAPITEL 1
Früher Winter im heutigen Amerika
Mary blieb jetzt nur noch aus reiner Sturheit am Leben. Da war noch etwas, das sie zu sagen hatte, und sie weigerte sich, dem Locken des Todes nachzugeben, solange sie noch nicht ihrer Schwester Grace ihre letzten Anweisungen gegeben hatte.
Grace saß neben dem Krankenhausbett, ihre Augen waren geschwollen von ungeweinten Tränen, und das Herz brach ihr, wenn sie zusah, wie Mary zu sprechen versuchte. Das leise Piepsen und Summen war verschwunden, die zahlreichen medizinischen Geräte, die ihren Verfall überwacht hatten, waren vor einer Stunde fortgeräumt worden. Eine bedeutungsschwere Stille hatte sich stattdessen über den Raum gelegt. Grace saß in schmerzlichem Schweigen da und dachte nur daran, wie sehr sie wollte, dass ihre Schwester weiterlebte.
Der Anruf, durch den Grace von dem Autounfall erfuhr, hatte sie gestern Mittag erreicht. Bis sie beim Krankenhaus angekommen war, war Marys Kind schon geboren worden, seiner Mutter durch einen Notkaiserschnitt entrissen. Und gegen sechs Uhr früh hatten ihr die Ärzte schließlich mitgeteilt, dass ihre Schwester im Sterben lag.
Mary, die drei Jahre Jüngere, war stets die praktischere der beiden Schwestern gewesen, die lebensnähere. Sie war auch die tonangebende der beiden Mädchen gewesen. Als sie das fünfte Lebensjahr erreicht hatte, regierte Mary schon den Haushalt der Sutters, indem sie ihren Willen sowohl bei den Eltern, bei den älteren Halbbrüdern, soweit sie noch zu Hause lebten, und bei Grace durchsetzte. Und als die Eltern vor neun Jahren bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen waren, war es die achtzehnjährige Mary gewesen, die die Tragödie managte. Ihre sechs Halbbrüder waren aus allen vier Ecken der Welt nach Hause gekommen, nur um zu erfahren, dass es ihre einzige Aufgabe sein würde, ihrem Vater und der Stiefmutter die letzte Ehre zu erweisen.
Nach der wunderschönen, doch schmerzlichen Zeremonie waren die sechs Brüder zu ihren Familien und Berufen zurückgekehrt, Grace war wieder nach Boston gefahren, um ihren Doktor in mathematischer Physik abzuschließen, und Mary war in Pine Creek in Maine geblieben und hatte das Heim der Sutter-Familie zu dem ihren gemacht.
Deswegen war Grace auch so überrascht gewesen, als Mary vor vier Monaten plötzlich bei ihr in Norfolk in Virginia vor der Tür gestanden hatte. Nur etwas ungemein Bedeutendes konnte ihre Schwester dazu bewegen, die Wälder zu verlassen, die sie so liebte. Aber Mary hatte nur die Jacke auszuziehen brauchen, da verstand Grace, was der Grund war.
Ihre Schwester war schwanger. Ihr Bäuchlein hatte sich grade erst sichtbar zu wölben begonnen, als Mary bei ihr ankam, und Grace hatte begriffen, dass Mary über ihre Lage ratlos war.
Während der vergangenen vier Monate hatten sie mehrmals darüber hitzig diskutiert. Aber Mary, die nun mal eine sture Frau war, hatte sich geweigert, den Hintergrund ihres Problems mit Grace zu besprechen. Sie war gekommen, um sich zu sammeln, nachzudenken, Mut zu fassen und zu entscheiden, was sie tun sollte. Ja, sie liebte den Vater des Babys mehr als alles im Leben. Aber nein, sie war nicht sicher, ob sie ihn heiraten konnte.
War er mit jemand anderem verheiratet?, hatte Grace wissen wollen.
Nein.
Dann lebte er womöglich in der Stadt, und sie würde umziehen müssen.
Nein.
War er ein Strafgefangener?
Natürlich nicht.
Was auch immer Grace versuchte, sie konnte ihre Schwester nicht dazu bewegen, ihr zu sagen, warum sie nicht nach Hause gehen und heiraten konnte – vorzugsweise noch vor der Geburt des Babys.
Mary wollte ihr nicht einmal den Namen des Mannes sagen. Sie erzählte insgesamt keine weiteren Einzelheiten, nur dass er Schotte und erst vor einem Jahr nach Pine Creek gezogen war. Sie waren sich bei einem Nachbarschaftsessen begegnet und hatten sich während der folgenden drei Monate heftig ineinander verliebt. Schon beim ersten Mal, als sie miteinander schliefen, war sie schwanger geworden.
Es folgten vier Monate des Glücks und erst dann war Marys Welt plötzlich aus den Fugen geraten. In den stillen Abendstunden eines Spaziergangs hatte ihr der Schotte eines Tages eine fantastische Geschichte (so Marys Worte) erzählt, und dann hatte er sie gebeten, seine Frau zu werden.
Zwei Tage später hatte Mary bei Grace in Virginia vor der Tür gestanden. Und während der ganzen letzten vier Monate hatte Grace Mary bekniet, ihr doch zu verraten, was der Schotte erzählt hatte, aber ihre Schwester hatte eisern geschwiegen. Bis sie dann gestern, aus heiterem Himmel und nur mit dem Versprechen, alles später zu erklären, verkündet hatte, sie werde nach Pine Creek zurückkehren. Doch es war keine Stunde vergangen, da kam der Anruf. Mary hatte noch nicht einmal die Stadt verlassen, da war ihr Auto von einem betrunkenen Fahrer auf die gegenüberliegende Fahrbahn einer sechsspurigen Autobahn katapultiert worden. Die Rettungsmannschaft hatte drei Stunden gebraucht, um Mary aus dem Wrack ihres Mietautos zu befreien.
Und jetzt lag sie im Sterben.
Und ihr neugeborener Sohn lag nur zwei Räume weiter den Flur hinunter, erstaunlich gesund, wenn man bedachte, dass er einen ganzen Monat zu früh aus dem Schutz des Bauches seiner Mutter geholt worden war.
Eine Krankenschwester betrat das Zimmer und prüfte die Infusionsflasche über Marys Bett, dann ging sie schweigend wie sie gekommen war wieder hinaus und ließ Grace mit einem mitfühlenden Lächeln und der geflüsterten Aufforderung allein, sie jederzeit wissen zu lassen, wenn sie etwas brauchte. Grace folgte ihr hinaus.
»Kann sie das Baby sehen?«, fragte Grace die Schwester. »Kann sie es in den Arm nehmen?«
Die Krankenschwester dachte nur eine Sekunde nach. Ihr mütterliches Gesicht hellte sich auf. »Ich glaube, das kann ich machen«, sagte sie und nickte zustimmend. »Ja, wirklich, ich glaube, das Baby sollte dringend in die Arme seiner Mutter gelegt werden.«
Sie berührte mit einer Hand Graces Schulter. »Es tut mir so Leid, was hier geschieht, Miss Sutter. Aber durch den schrecklichen Unfall hat ihre Schwester schwerste Verletzungen am ganzen Körper. Der Not-Kaiserschnitt hat natürlich alles noch verschlimmert. Unter anderem ist die Milz Ihrer Schwester gerissen, und ihre Organe geben eines nach dem anderen den Dienst auf. Keiner unserer Versuche, sie am Leben zu halten, hat Erfolg. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt bei Bewusstsein ist.«
Die Schwester beugte sich vor und sagte mit einem Flüstern wie in der Kirche: »Sie nennen das Kind das Wunder-Baby, müssen Sie wissen. Und es braucht nicht einmal einen Inkubator, obwohl sie ihn vorsichtshalber hineingelegt haben.«
Grace erwiderte das Lächeln, wenn auch freudlos. »Bitte, bringen Sie Mary ihren Sohn«, sagte sie. »Es ist wichtig, dass sie sieht, dass es ihm gut geht. Sie hat nach ihm gefragt.«
Mit diesen Worten kehrte Grace ins Zimmer zurück und merkte, dass Mary wach war. Der matte Blick aus den blauen Augen folgte ihr, als sie um das Bett herumging und sich wieder neben sie setzte.
»Ich will, dass du mir etwas versprichst«, flüsterte Mary mühsam.
Grace nahm vorsichtig Marys Hand mit den Infusionsschläuchen dran und hielt sie in der ihren. »Was immer du willst«, erklärte sie und drückte sanft ihre Finger. »Sag es nur einfach.«
Mary lächelte kurz. »Jetzt weiß ich, dass ich sterben werde«, sagte sie und versuchte den Fingerdruck zu erwidern. »Beim letzten Mal, als du mir etwas versprochen hast, ohne zu wissen, um was es ging, warst du acht Jahre alt.«
Grace strengte sich an, eine komische Grimasse zu schneiden und gab sich die größte Mühe, nicht erkennen zu lassen, wie sehr sie jenes eine Wort, sterben, schmerzte. Sie wollte nicht, dass ihre Schwester starb. Sie wollte die Zeit zumindest um zwei Tage zurückdrehen, als sie sich so gezankt hatten, wie Schwestern es eben taten, wenn sie einander liebten.
»Höchstwahrscheinlich werde ich dieses Versprechen genauso bereuen wie das damalige«, erklärte ihr Grace mit falscher Heiterkeit.
Marys Blick verdunkelte sich. »Ja, das wirst du wahrscheinlich.«
»Sag’s mir«, erklärte sie ihrer Schwester.
»Ich möchte, dass du mir versprichst, das Baby nach Hause zu bringen zu seinem Vater.«
Grace war sprachlos. Sie hatte erwartet, Mary würde sie bitten, ihren Sohn bei sich zu behalten und aufzuziehen, nicht ihn wegzugeben.
»Ich ihn zu seinem Vater bringen?«, wiederholte Grace und schüttelte verdutzt den Kopf. »Zu dem Mann, vor dem du vor vier Monaten davongelaufen bist?«
Mary drückte müde die Hand ihrer Schwester. »Gestern war ich auf dem Weg zu ihm zurück«, gab sie zu bedenken.
»Ich werde nichts versprechen, solange du mir nicht verrätst, warum du überhaupt aus Pine Creek fort bist. Und warum du dich entschlossen hast, zurückzugehen«, verlangte Grace kategorisch. »Sag mir, was dir so viel Angst gemacht hat.«
Mary starrte ins Leere, und einen Moment lang fürchtete Grace, sie hätte das Bewusstsein verloren. Mary atmete mit kurzen, flachen Stößen, die immer mühsamer zu werden schienen. Ihre Lider waren schwer, ihre Pupillen leicht glasig und in die Ferne gerichtet. Doch nun begann Mary zu sprechen.
»Er hat mir Angst gemacht«, sagte sie. »Als er mir seine Geschichte erzählte, war ich fast starr vor Angst.«
»Was für eine Geschichte?«, fragte Grace und drückte Marys Hand. »Was hat er dir erzählt?«
Marys Augen leuchteten plötzlich mit einem Funken von humorvollem Feuer auf. »Dreh mein Bett hoch«, wies sie Grace an. »Ich will den Blick auf deinem Gesicht sehen, meine kleine Naturwissenschaftlerin, wenn du hörst, was er mir erzählt hat.«
Grace drückte auf den Knopf, der das Kopfende des Bettes hob und ihre Schwester dadurch in eine aufrechtere Position brachte. Mary nannte sie nie Naturwissenschaftlerin, außer wenn sie irgendeine unglaubliche Idee hatte, deren Verwirklichung sie irgendwie für möglich hielt. Grace war die Raketen-Wissenschaftlerin, Mary war die Träumerin.
»Also gut, heraus damit«, forderte sie und hielt sich an dem kleinen Funken im Blick ihrer Schwester fest wie an einem Rettungsring. »Was hat dir dein Liebster gesagt, vor dem du davongelaufen bist?«
»Er heißt Michael.«
»Na endlich. Der Mann hat tatsächlich einen Namen. Michael was?«
Mary antwortete nicht. Sie konzentrierte sich ganz darauf, Worte zu finden, und starrte an Graces Schulter vorbei ins Leere.
»Er kam von Nova Scotia nach Pine Creek«, sagte Mary. »Und davor hat er in Schottland gelebt.« Sie wandte Grace ihren Blick zu, und ihre von Medikamenten erweiterten blauen Augen bekamen auf einmal ein erwartungsvolles Schimmern. »Er sagte mir, er wäre in Schottland geboren worden.« Und dann fügte sie, beinah flüsternd, hinzu: »Im Jahre elfhunderteinundsiebzig.«
Grace richtete sich in ihrem Stuhl gerade auf und starrte Mary an. »Was?«, gab sie ebenfalls flüsternd zurück, überzeugt, sie hätte etwas Falsches gehört. »Wann?«
»Im Jahr elfhunderteinundsiebzig.«
»Du meinst nicht vielleicht im elften Monat des Jahres neunzehnhunderteinundsiebzig?«
Mary schüttelte langsam den Kopf. »Nein, ich meine eintausendeinhundertundeinundsiebzig. Vor achthundert Jahren.«
Grace dachte darüber nach. Fantastisch war ja wohl eher gelinde ausgedrückt für diese Behauptung. Doch dann lachte sie plötzlich leise. »Mary, du bist vor dem Mann davongelaufen, weil er an Reinkarnation glaubt?« Sie fuhr mit der Hand durch die Luft. »Himmel, die halbe Menschheit glaubt heutzutage, sie hätte schon einmal gelebt. Ganze Religionen sind auf der Theorie der Reinkarnation aufgebaut.«
»Nein«, sagte Mary nachdrücklich und schüttelte den Kopf. »Das hat Michael nicht damit gemeint. Er sagte, er hätte die ersten fünfundzwanzig Jahre seines Lebens im Schottland des zwölften Jahrhunderts verbracht und nur die letzten vier Jahre hier im modernen Amerika. Er sagte, ein wildes Gewitter hätte ihn durch die Zeit geschleudert.«
Grace fehlten die Worte.
»Genauer gesagt«, fuhr Mary fort, »kamen auch noch fünf Männer seines Clans mitsamt ihrer Streitrosse mit.«
Grace holte tief Atem angesichts des Kummers im Blick ihrer Schwester. »Und wo sind diese Männer jetzt … und ihre … ihre Pferde?«
»Sie sind alle tot«, sagte Mary. »Michael ist der Letzte seines Clans.« Ihre Züge entspannten sich plötzlich. »Jetzt gibt es allerdings auch noch seinen Sohn.«
Sie griff nach Graces Hand und drückte sie mit erstaunlicher Kraft. »Darum wollte ich auch wieder zurück. Die Familie ist Michael ganz wichtig. Er ist jetzt allein auf dieser Welt, mit Ausnahme unseres Kindes. Und darum musst du seinen Sohn zu ihm bringen.«
Mary atmete angestrengt aus. »Ich sterbe.« Sie sah Grace mit traurigem, resigniertem Blick an. »Das musst du für mich tun, Gracie. Und du musst Michael sagen, dass ich ihn liebe.« Tränen begannen, über ihre Wangen zu rinnen.
Grace blickte durch ihre eigenen Tränen die Schwester an. »Ist dir eigentlich klar, was du da von mir verlangst, Mary? Ich soll deinen Sohn zu einem Wahnsinnigen bringen? Wenn er wirklich glaubt, er wäre durch die Zeit gereist, dann ist er doch nicht ganz richtig im Kopf. Und du willst, dass dieser Mann dein Kind großzieht?«
Mary atmete unsicher aus und schloss die Augen. Stille breitete sich erneut im Zimmer aus.
Mary verlangte von ihr, sie solle ihr Kind – ihren Neffen – zu einem Mann bringen, der nicht bei vollem Verstand war. Grace bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. Wie konnte Mary so etwas von ihr verlangen?
Und wie konnte sie es fertig bringen, ihrer Schwester nicht den letzten Wunsch zu erfüllen?
Die Tür öffnete sich und Grace beobachtete, wie ein durchsichtiges Kunststoffbettchen ins Zimmer gerollt wurde. Von weißem Baumwollstoff bedeckte kleine Ärmchen fuchtelten in der Luft, und die Ärmel waren so lang, dass nichts von den kleinen Händchen zu sehen war, die eigentlich hätten daraus hervorschauen sollen.
Grace musste sich die Tränen aus den Augen wischen und bemerkte erst dann, dass Mary wach war und sich bemühte, ihren Kleinen anzuschauen.
»O Gott, schau doch nur, Gracie«, flüsterte Mary und streckte eine unsichere Hand nach ihm aus. »Er ist ja so winzig.«
Die Krankenschwester stellte das Bettchen neben Marys Bett. Sie legte ein Kissen auf Marys Schoß und vorsichtig Marys eingegipsten rechten Arm darauf. Dann nahm sie das kleine, quietschende Bündel aus dem Bettchen und legte es behutsam auf das Kissen in Marys Schoß.
»Er ist so rosa«, flüsterte Mary und umfasste sanft seinen Kopf. »Und so schön.«
»Er glaubt, dass es Zeit zum Abendessen ist«, sagte die Krankenschwester. »Vielleicht möchten Sie ihm ein wenig Zuckerwasser füttern? Fühlen Sie sich dazu stark genug?«
»O ja«, sagte Mary und zupfte an seiner Decke.
Die Krankenschwester legte ihn auf Marys Armgips zurecht und gab ihr eine kleine Flasche mit klarer Flüssigkeit darin und einem Sauger darauf. Die Schläuche, die aus Marys linker Hand ragten, verhedderten sich in den strampelnden Füßen ihres Kindes. Die Krankenschwester ging um das Bett herum, gab Grace das Fläschchen und zog vorsichtig die Infusion aus Marys Handrücken, den sie rasch mit einem Verband bedeckte.
»So ist es besser, Sie brauchen das hier eigentlich nicht unbedingt«, sagte sie und hängte die Schläuche auf den Infusionsständer. Sie nahm die Flasche mit dem Zuckerwasser wieder von Grace entgegen und steckte den Schnuller dem zappelnden Baby in den Mund. Mary übernahm die Flasche eifrig, wenn auch ein wenig unsicher, mit der nun freien Hand.
Die Krankenschwester schaute noch eine Minute zu, um sicherzugehen, dass Mary mit der Aufgabe zurechtkam, dann wandte sie sich an Grace.
»Ich werde Sie jetzt in Ruhe lassen«, sagte sie, und in ihrem Blick war die Traurigkeit zu erkennen, mit der sie Mary und ihrem Sohn zulächelte. »Klingeln Sie nach mir, wenn Sie etwas brauchen, dann komme ich sofort.«
Grace war ganz starr vor Panik. Die Krankenschwester wollte sie allein lassen? Obwohl keine von ihnen beiden die geringste Ahnung von Babys hatte?
»Schau nur, Gracie, ist er nicht wunderschön?«, fragte Mary.
Grace stand auf und beugte sich über ihren Neffen. Schön? Er war zweifellos das durchschnittlichste Baby, das sie je gesehen hatte. Seine runden Bäckchen waren vor Anstrengung gerötet, seine Augen geschlossen, sein Kinn und sein Hals faltig, und Büschel von dunklem, geradem Haar lugten unter einer leuchtend blauen Strickmütze hervor.
»Er ist prächtig«, lobte sie.
»Zieh ihm die Mütze aus«, bat die Schwester sie. »Ich möchte seine Haare sehen.«
Grace zog ihm vorsichtig die Mütze vom Kopf, empfand aber sofort das Bedürfnis, sie wieder draufzustülpen. Zwei ziemlich große, perfekt geformte Ohren standen gute zwei Zentimeter von seinem Kopf ab, und das nun befreite Haar stand in borstigen Büscheln nach oben.
Er sah aus wie ein Troll.
»Ist er nicht wunderschön?«, fragte Mary noch einmal.
»Er ist prächtig«, log Grace wieder und versuchte mit aller Kraft, ihren neugeborenen Neffen mit den gleichen Augen zu sehen wie ihre Schwester.
Mary war immer die Tierliebhaberin in der Sutter-Familie gewesen und hatte ständig fast verhungerte Kätzchen, verletzte Vögel und Erdhörnchen und räudige Hunde nach Hause geschleppt. Kein Wunder, dass Mary so verzückt war von ihrem Sohn und ihn als etwas Besonderes betrachtete.
Natürlich war er ein Schatz. Ein recht durchschnittlicher Schatz, aber selbstverständlich ein Schatz.
»Komm, wir wollen ihn ausziehen«, sagte Mary. »Hilf mir, seine Finger und Zehen zu zählen.«
Erschreckt sah Grace ihre Schwester an. »Sie zählen? Warum? Glaubst du, ihm fehlen welche?«
Mary lachte schwach und wischte ihrem Sohn mit dem Rand seiner Decke den Mund ab. »Natürlich nicht. Aber so machen es eben junge Mütter.«
Grace entschied sich, ihrer Schwester den Gefallen zu tun. Sie versuchte, die Bändchen am unteren Rand des winzigen Nachthemds aufzuziehen. Das war keine leichte Aufgabe, denn das Baby strampelte jetzt zufrieden und satt mit seinen winzigen Beinchen und produzierte mit vorgewölbten Lippen große Speichelblasen.
Schließlich gelang es ihnen, mit Graces zwei gesunden Händen und Marys unsicherer linken Hand, gemeinsam seine Beinchen zu befreien. Grace hielt erst den einen Fuß und dann den anderen hoch und zählte laut seine Zehen.
Verblüfft zählte sie noch einmal.
Zwölf.
Sechs an jedem winzigen Füßchen.
Mary stieß einen schwachen Freudenschrei aus. Zumindest hörte es sich danach an. Grace musterte sie sprachlos.
»Geschenke von seinem Papa«, hauchte sie atemlos. »Michael hat an jedem Fuß sechs Zehen.«
Und das war ein Grund zur Freude?, wollte Grace fragen. Es war etwas Gutes, missgebildet zu sein?
»Zieh ihm das Hemd und die Windel aus«, sagte Mary als Nächstes. »Ich will ihn nackt sehen.«
Grace fürchtete sich davor. Was für weitere Überraschungen versteckten wohl die Kleider? Doch sie tat, worum ihre Schwester sie gebeten hatte, obwohl sie befürchtete, der Winzling würde womöglich unter ihren Handgriffen zerbrechen. Sie wusste doch gar nicht, wie man das richtig machte. Verflixt, sie hatte ja nicht einmal als Kind mit Puppen gespielt. Sie war mit ihrem Vater zum Wandern und Fischen gegangen, bis sie acht war, bis einer ihrer älteren Brüder eine Biographie von Albert Einstein mitgebracht hatte und sie die Welt der Wissenschaft entdeckte. Von da an gab es für sie nur noch Teleskope, wissenschaftliche Werke und mathematische Formeln auf Wandtafeln.
Grace zog dem Baby das Nachthemd aus und öffnete die Windel. Sie holte tief Luft und deckte ihn hastig wieder zu.
Mary zog ihm die Windel ganz aus. »Sei doch nicht so prüde, Gracie«, sagte Mary und umfasste sein kleines Hinterteil mit einer Hand. »Er muss so aussehen und wird schon noch hineinwachsen.« Mary streichelte über sein Gesicht und rieb dann mit den Fingern besitzergreifend über seinen ganzen Körper. »Hol eine frische Windel, bevor er uns nass spritzt«, sagte sie.
Grace folgte rasch der Anweisung. Und mit vereinten Kräften und drei Händen gelang es ihnen, ihn zu wickeln und wieder in sein Hemdchen zu stecken.
Grace band gerade das letzte Bändchen zu, da fiel ihr eine Träne auf die Hand. Sie hielt inne, sah auf und merkte, dass Mary leise zu weinen begonnen hatte, den Blick auf ihren Sohn gerichtet.
»Was ist los, Mary, hast du Schmerzen?«, fragte sie und hielt die Füßchen des Babys fest, damit er sie nicht treten konnte.
Mary schüttelte langsam den Kopf, den Blick fest auf ihren Sohn gerichtet, und strich sanft über seine Wange. »Ich will ihn aufwachsen sehen«, flüsterte sie mit einer Stimme, die zunehmend müder und schwächer wurde. Sie sah Grace an. »Ich will für ihn da sein, wenn er hinfällt und sich das Knie aufschürft, wenn er seine erste Schlange fängt, sein erstes Mädchen küsst und danach jeden zweiten Tag ein gebrochenes Herz hat.«
Grace zuckte zusammen, als hätte sie ein Schlag getroffen. Sie schloss die Augen, als der Schmerz in ihre Kehle aufstieg und sie zuschnürte, zwang sich, nicht zu weinen.
Mary hob die Hand und strich mit zitterndem Finger über Graces Wange, genauso wie sie es bei ihrem Sohn getan hatte. »Dafür musst du jetzt sorgen, Gracie. Du musst an meiner Stelle für ihn da sein. Bring ihn zu seinem Vater, und sei für beide da. Versprochen?«
»Er ist nicht bei Verstand, Mary. Er denkt, er wäre durch die Zeit gereist.«
Mary schaute wieder ihren Sohn an. »Vielleicht hat er das wirklich getan.«
Grace hätte am liebsten einen Schrei ausgestoßen. Wurde das Urteilsvermögen ihrer Schwester von den Medikamenten in ihrem Körper beeinträchtigt? War sie so matt, so geistig erschöpft, dass sie gar nicht bemerkte, was sie da forderte?
»Mary«, sagte sie, griff nach dem Kinn ihrer Schwester und zwang sie dazu, sie anzusehen. »Menschen können nicht durch die Zeit reisen.«
»Mir ist es egal, und selbst wenn er vom Mars kommt, Gracie. Ich liebe ihn. Und er wird unseren Sohn mehr lieben, als es jeder andere tun kann. Sie brauchen einander, und ich brauche dein Versprechen, dass du die beiden zusammenführst.«
Grace wandte dem Bett den Rücken zu und ging zum Fenster. Sie hasste es, ein solches Versprechen geben zu müssen. Sie verstand nicht das Geringste von Babys, aber sie war intelligent und finanziell unabhängig. Wie schwer würde es schon sein, einen kleinen Jungen aufzuziehen? Sie konnte Bücher über Kindererziehung lesen und ihm ein gutes Leben voller Liebe und Aufmerksamkeit versprechen.
Sie war noch nie diesem Schotten Michael begegnet, und das Wenige, was sie über ihn wusste, gefiel ihr absolut nicht, verflixt.
Doch andererseits war es noch schlimmer, Mary ihren Wunsch abzuschlagen. Dies war das erste Mal, dass ihre Schwester sie je um etwas gebeten hatte, und sie war hin- und hergerissen zwischen ihrer Liebe für Mary und ihrer Sorge um ihren Neffen.
»Komm, leg dich zu uns ins Bett«, sagte Mary. »Wie wir es früher so oft getan haben.«
Grace drehte sich um und sah, dass Mary mit geschlossenen Augen dalag, ihren Sohn fest an ihre Brust gedrückt. Der Kleine schlief. Grace kehrte zum Bett zurück und brachte es wieder in eine waagerechte Position. Ohne Zögern schob sie die Schuhe von den Füßen, klappte den Seitenrand des Bettes herunter und legte sich neben ihre Schwester. Mary kuschelte sich sofort an sie.
»Mmm, das hab ich gern«, murmelte Mary, ohne die Augen zu öffnen. »Wann haben wir zuletzt so zusammen im Bett gelegen?«
»Nach Mamas und Papas Beerdigung«, erinnerte sie Grace. Sie legte eine Hand auf das Hinterteil des Babys, das in die Luft ragte. »Meinst du nicht, wir sollten diesem Burschen einen Namen geben?«, fragte sie und rieb seinen Rücken.
»Nein, das ist Michaels Vorrecht«, entschied Mary. »Nenn ihn bis dahin einfach nur Baby.«
»Baby wer? Du hast mir noch nicht den Nachnamen seines Vaters verraten.«
»Er heißt MacBain. Michael MacBain. Er hat die Bigelow Weihnachtsbaum-Pflanzung gekauft.«
Das war Grace neu. »Was ist denn mit John und Ellen Bigelow passiert?«
»Sie leben immer noch dort. Michael ist bei ihnen eingezogen«, sagte Mary, und ihre Stimme klang fern. Sie drehte das Gesicht zur Seite und sah Grace an, ihre einst so strahlenden blauen Augen wirkten matt von Tränen. »Er ist ein guter Mann, Gracie. Fest wie ein Fels«, sagte sie und schloss erschöpft die Augen.
Außer dass er glaubt, er wäre achthundert Jahre alt, dachte Grace. Sie nahm ihre Hand vom Hinterteil ihres Neffen und strich ihrer Schwester übers Haar, schob es von ihrer Stirn.
»Ich warte immer noch auf dein Versprechen«, sagte Mary und drehte ihr Gesicht in Graces Hand.
Grace holte tief Atem und sprach endlich aus, was sie so stur, und vielleicht egoistisch, unterdrückt hatte.
»Ich verspreche es, Mare. Ich werde deinen Sohn zu Michael MacBain bringen.«
Mary drückte einen Kuss in Graces Handfläche, seufzte tief und kuschelte sich noch ein wenig enger an ihre Schwester.
»Und meine Asche sollst du auf dem TarStone-Berg verstreuen«, sagte sie dann, wobei ihre Stimme zu einem Flüstern verklang. »Am Morgen der Sommersonnenwende.«
»Am … am Morgen der Sommersonnenwende. Versprochen.«
KAPITEL 2
Wenn Lügen Regentropfen gewesen wären, wäre Grace zweifellos in den Wassermassen ertrunken. Sie hatte in den vergangenen vier Wochen so viele Unwahrheiten und Ausflüchte erzählt, dass sie sich nicht einmal an die Hälfte davon erinnerte.
Grace klappte den letzten Koffer zu und verriegelte das Schloss. Dann machte sie sich auf die Suche nach ihrer Handgepäck-Tasche. Dabei musste sie sich zweimal an Jonathan vorbeidrängen, und beide Male kümmerte er sich nicht im Geringsten darum, dass sie nicht an dem interessiert war, was er sagte.
Oder besser gesagt, was er forderte.
Jonathan Stanhope III. war der Eigentümer und Leiter der Firma StarShip Spaceline, ein High-Tech-Unternehmen, das vorhatte, Weltraumreisen in naher Zukunft für Privatleute zugänglich zu machen. StarShip beschäftigte fast dreihundert Leute und befand sich auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Entdeckungen. Jonathan war während der letzten eineinhalb Jahre Graces Boss gewesen.
Er war gleichzeitig der Mann, den sie zu heiraten hoffte.
Obwohl sie im Augenblick wünschte, er würde an Bord einer ihrer noch nicht getesteten Raumfähren steigen und sich selbst zum Mond schießen.
Jonathan gefiel es gar nicht, dass sie fortging. Er hatte seine Pflicht getan und ihr vier Wochen gegeben, um den Tod ihrer Schwester zu »überwinden«, und er konnte es nicht glauben, dass sie die Stirn besaß, noch mehr Urlaub zu erwarten.
»Aber du redest über Maine, Grace«, sagte er zum vierzehnten Mal und folgte ihr aus dem Schlafzimmer in die Küche. »Da oben im Norden haben sie nicht einmal Telefonleitungen, die modern genug sind für Datenübertragungen. Das ist total am Ende der Welt.«
»Dann werde ich eine Satellitenverbindung einrichten«, erwiderte sie, machte Schränke auf und holte Flaschen mit Babynahrung und sonstige Utensilien heraus. Sie zählte die Nahrungsportionen, um genug für drei Tage zu haben, und begann sie in ihre Handgepäck-Tasche zu packen. Nur für die Windeln würde sie noch eine zweite Tasche brauchen. Also machte sie sich erneut auf den Weg ins Schlafzimmer.
Jonathan folgte ihr.
»Bleib doch endlich mal stehen«, sagte er, griff nach ihrem Arm und hielt sie fest. Dann drehte er sie um, damit sie ihn anschaute.
Grace blinzelte hoch in sein gewöhnlich liebenswürdiges, wohlgeformtes Gesicht. Nur sah Jonathan diesmal gar nicht so liebenswürdig aus. Er war verärgert. Ernsthaft verärgert. Seine intelligenten, grauen Augen wirkten schmal, und sein Unterkiefer malmte im Moment so hart, als könnten ihm die Zähne brechen.
Grace wandte ihren Blick zuerst zu seiner einen Hand auf ihrem Arm, dann zur anderen. Dabei fiel ihr auf, wie seine Rolex unter der perfekt gebügelten Manschette hervorglitzerte.
»Du tust mir weh«, sagte sie.
Jonathan, der sogar, wenn er verärgert war, noch Gentleman blieb, ließ sie sofort los. Er holte tief Luft, trat einen Schritt zurück und fuhr sich mit der Hand durch das professionell gestylte, sonnenblonde Haar.
»Verdammt, Grace. Dies ist der absolut unpassendste Zeitpunkt zum Verreisen. Bis Ende der Woche empfangen wir die ersten Daten von Schötchen.«
Das war Jonathans tatsächliche Sorge. Er war nicht verärgert, weil er sie aus romantischen Gründen vermissen würde, sondern weil sein Geschäft womöglich durch ihre Abwesenheit Schaden leiden könnte. Der Satellit, den sie vor sechs Wochen ins All geschickt hatten – es war Graces Idee gewesen, ihn Schötchen zu nennen, weil er sie an eine lange Erbsenschote erinnerte, in der mehrere empfindliche Computer untergebracht waren –, hatte endlich seine volle Funktion aufgenommen. Und sie war die einzige Person bei StarShip Spaceline, die die Daten entziffern konnte, die der Satellit zur Erde sendete.
Da war er wieder, der Wettlauf ins All, nur diesmal waren nicht Russen und Amerikaner die Gegenspieler. An diesem neuen Rennen waren private Unternehmen beteiligt, die um zukünftige Marktanteile an der privaten Weltraumfahrt konkurrierten. StarShip Spaceline befand sich in einem hitzigen Konkurrenzkampf mit zwei anderen privaten Firmen – eine in Europa und eine in Japan. Und alle drei waren sie drauf und dran, neue Formen des Antriebs zu entwickeln.
Fester Raketentreibstoff, in der Art wie die NASA ihn verwendete, war ineffizient. Einfach ausgedrückt war er schlicht zu schwer. Die Raumfähre musste deswegen auf einer Rakete angebracht werden, die ein Mehrfaches ihrer Größe und ihres Gewichts hatte, nur damit sie die Erdatmosphäre verlassen konnte.
Alternative Formen, so wie Ionenantrieb oder andere Formen mit Mikrowellen oder Antimaterie, konnten jedoch aus Weltraumreisen ein lukratives Geschäft und auf die Dauer sogar Raumkolonien auf Mond und Mars möglich machen. Unter dem Bruchstrich war es alles eine Frage der mathematischen Physik.
Und an dieser Stelle gehörte Grace ins Bild. Sie war die leitende Mathematikerin bei StarShip Spaceline. Sie brachte die Zahlen auf die richtige Reihe und entwirrte Theorien. Sie konnte sich einen Plan ansehen und mit Hilfe mathematischer Formeln eine Aussage dazu machen, ob er eine Chance hatte zu funktionieren oder nicht.
In nicht mehr als den achtzehn Monaten, die sie für StarShip gearbeitet hatte, hatte Grace Jonathan Stanhopes Firma schon Millionen von Dollar an Ausgaben gespart, weil sie Theorien als unbrauchbar beweisen konnte, bevor sie in die Tat umgesetzt wurden.
Schötchen war jetzt in der Erdumlaufbahn, und es gab große Hoffnungen, dass die Daten, die der Satellit sendete, dem Wettrennen um einen neuen Antriebsstoff für Raketen zu Gunsten von StarShip ein Ende bereiten würden.
»Ich kann Schötchens Daten genauso gut in Maine empfangen wie hier, Jonathan«, versicherte sie ihm. »Ich habe meinen Computer und alles, was ich für die Satellitenverbindung brauche, schon eingepackt.«
»Und was ist mit deinen anderen Projekten?«
»Carl und Simon haben in den vergangenen vier Wochen auch schon ohne Probleme daran gearbeitet. Ich sehe keinen Grund, warum das damit nicht weiter so gut klappen sollte.«
Sie ging hinüber zum Schrank und zog noch eine Tasche heraus, um sie mit Windeln zu füllen. Als sie sich umdrehte, verstellte ihr Jonathan nochmals den Weg. Seine Züge waren weicher geworden, und seine Augen hatten wieder jenes intelligente warme Grau, in das sie sich während der vergangenen achtzehn Monate verliebt hatte.
»Und was ist mit dem Baby, Grace?«, fragte er weich.
»Was soll mit ihm sein?«
»Wird es noch bei dir sein, wenn du zurückkommst?«
Tja, das war nun wirklich die Vierundsechzigtausend-Dollar-Frage, nicht wahr? Grace versuche sich daran zu erinnern, welche Halbwahrheiten sie Jonathan erzählt hatte – von den Angestellten des Sozialamtes und von ihren Brüdern ganz zu schweigen. Und wie war es mit jenen Halbwahrheiten, die sie Emma, der netten Krankenschwester aus dem Krankenhaus, erzählt hatte, die so freundlich gewesen war, ihren Urlaub zu nehmen, um Grace während der vergangenen vier Wochen mit dem Baby zu helfen?
»Um das herauszufinden, gehe ich nach Maine«, erklärte sie Jonathan.
»Der Junge gehört zu seinem Vater.«
»Er gehört zu derjenigen Person, die am besten für ihn sorgen kann«, gab sie zurück.
»Du hast es deiner Schwester versprochen«, rief er ihr in Erinnerung. Er griff erneut nach ihrem Arm, diesmal sanfter. Doch sein Gesichtsausdruck war alles andere als sanft. »Und du setzt dich nicht mit Marys Tod auseinander, Grace«, sagte er. »Solange du dich noch an ihr festhältst, meinst du, dein Versprechen nicht halten zu müssen.«
»Das ist nicht wahr.«
Er hob eine Hand und strich ihr eine störrische Haarsträhne aus dem Gesicht und hinters Ohr. »Jetzt gerade steht sie mitten auf deinem Küchentisch. Du hast deine Schwester in eine große Oreo-Keksdose gepackt – und du redest mit ihr.«
Grace blieb eisern und zeigte ihren Schmerz nicht. »Sie ist meine kleine Schwester, Jonathan. Willst du, dass ich sie im Schrank verstecke? Oder soll ich sie per Kurier nach Pine Creek schicken? Mary hat Oreo-Kekse geliebt. Ich kann mir keinen Platz vorstellen, an dem sie zurzeit lieber wäre – bis zur Sommersonnenwende, wenn ich sie auf dem Berg TarStone verstreuen soll.«
»Es sind noch vier Monate bis zur Sommersonnenwende«, sagte er und sah wieder ärgerlich aus. »Schon letzte Woche, als du mich um diese Auszeit gebeten hast, habe ich dir erklärt, dass vier Monate zu lang ist. Du hast schon einen Monat lang gefehlt, und länger kann ich im Moment nicht auf dich verzichten.«
»Ich werde vier Monate weg sein, Jonathan«, erklärte sie ihm entschieden und machte sich auf einen Streit gefasst. »Das bin ich Mary und dem Baby schuldig.«
»Du musst sie loslassen, Grace«, wiederholte er, zog sie plötzlich in seine Arme und drückte sie fest an sich.
Grace seufzte an seiner Schulter. Es gefiel ihr in Jonathans Armen – normalerweise. Verflixt, bei den paar Gelegenheiten, an denen sie bisher miteinander ausgegangen waren, hatte sie das Gefühl gehabt, als läge eine viel versprechende Zukunft vor ihnen. Also warum war sie jetzt enttäuscht? Konnte es ein, dass dieser moderne, von Erfolgsstreben getriebene Mann keine Spur von Empfindsamkeit besaß? War es möglich, dass er so egoistisch war, nicht zu verstehen, warum sie den Tod ihrer Schwester auf ihre Weise richtig hinter sich bringen wollte?
»Du musst nach Maine gehen, den Vater des Kindes finden und dann dein eigenes Leben weiterleben«, fuhr er über ihren Kopf hinwegsprechend fort. »Deine Schwester hat dich ja so gut wie mit ins Grab gezogen.« Er beugte sich zurück, um sie anzusehen. »Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Du trägst Jogginghosen und ein Sweatshirt, Herrgottnochmal. Dieselben, die du gestern auch schon anhattest.«
»Sie sind am leichtesten zu waschen«, sagte sie, löste sich aus seiner Umarmung und begann, Windeln in die Tasche zu stopfen. »Babyspucke und Babynahrung vertragen sich halt nicht gut mit Seide.«
»Das ist der nächste Punkt«, sprach er weiter, auch wenn sie ihm den Rücken zudrehte. »Du bist Wissenschaftlerin, nicht Mutter. Du hast nicht die leiseste Ahnung, wie man ein Kind erzieht. Du kannst doch nicht mal die Verschlüsse an seinen Kleidern richtig zumachen. Der Kleine sieht genauso durcheinander aus wie du in letzter Zeit.«
Sobald sie sich wieder zu ihm umdrehte, griff er nochmals nach ihren Schultern und brachte sie dazu, die Tasche mit den Windeln fallen zu lassen. »Grace«, flüsterte er, und sein Gesicht wirkte jetzt eher verzweifelt als ärgerlich. »Geh nicht. Nicht jetzt. Warte, bis Schötchen im August gelandet ist, und starte dann nach Maine. Dann ist es sicherer.«
»Sicherer?«
»Dann ist es besser«, korrigierte er sich. »Wenn die Schote erst sicher wieder auf der Erde und in unseren Händen ist, dann kannst du meinetwegen gehen.«
»Das ist zwei Monate zu spät, Jonathan. Da verpasse ich die Sommersonnenwende. Und ich muss mich um Marys Besitz kümmern. Ich kann nicht alles noch sechs Monate schleifen lassen. Und die Leute in Pine Creek sollten auch erfahren, was mit ihr geschehen ist.«
»Dann ruf sie an«, sagte er und drückte ihre Schultern. »Und ruf gleichzeitig den Vater des Kindes an, damit er kommt und seinen Sohn abholt. Das wäre wirklich eine praktische Lösung.«
»Für dich natürlich«, zischte Grace, entzog sich seinem Griff und hob die Tasche mit den Windeln auf. Sie stellte sich vor ihn und musterte ihn finster. »Man verkündet nicht den Tod eines Menschen schlicht am Telefon. Und man ruft auch keinen Mann an, erklärt ihm, die Frau, die er liebt, ist tot, und ›Ach übrigens, sie hat dir einen Sohn hinterlassen‹, verdammt noch mal!«
Grace verließ eilig das Zimmer, bevor sie ihrem Boss noch die Tasche mit den Windeln um die Ohren haute. Sie stürzte fast ins Wohnzimmer, stoppte aber an der Tür abrupt, als sie Emma sah, die das Baby fütterte. Emma schaute auf und richtete einen finsteren Blick auf eine Stelle hinter Grace, so dass Grace klar war, dass Jonathan hinter ihr stand.
»Ich bringe deine Koffer zu meinem Auto«, presste er hinter zusammengebissenen Zähnen heraus. »Stell die Sachen, die du noch mitnehmen willst, an die Tür, ich hole sie dann.«
»Ich werde die Sachen in mein Auto bringen«, sagte sie, während sie sich umdrehte und ihn fixierte. »Emma wird mich und das Baby zum Flughafen bringen.«
Er fuhr sich mit einer Hand durchs Haar. »Ich schätze, ich habe in der Sache weiter nichts zu sagen«, meinte er, und sein Blick wirkte durchdringend in seinem Ärger. »Du weißt, wie sehr StarShip deine Spezialkenntnisse braucht.« Er zeigte mit dem Finger auf sie. »Ich erwarte, dass du mir während deiner Abwesenheit täglich einen Bericht zu Schötchen schickst. Und sieh zu, dass es auf keinen Fall vier Monate werden«, fügte er mit einem Knurren hinzu, drehte sich auf dem Absatz um und ging schweigend hinaus zu seinem am Straßenrand geparkten Auto.
»Jetzt nehmen Sie sich mal das, was er da alles von sich gegeben hat, nicht so zu Herzen«, riet Emma und ließ damit erkennen, dass sie die Auseinandersetzung mit angehört hatte. »Sie werden das mit dem Kind prima hinkriegen, Grace. Und was Ihre Schwester betrifft: Ich weiß, wie es ist, wenn man jemanden verliert, den man liebt. Das überwindet man nicht in vier Wochen.«
»Danke, Emma. Und ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich geflunkert habe, Sie würden uns zum Flughafen bringen. Ich konnte den Gedanken an weitere zwanzig Minuten von Jonathans Litanei nicht ertragen.«
»Nein, Liebes. Es wird mir ein Vergnügen sein, Sie zu fahren. Hier, er kann jetzt ein Bäuerchen machen«, sagte sie und hielt Grace das Baby hin.
Vorsichtig und sehr darauf bedacht, seinen Kopf so zu halten, wie man es ihr beigebracht hatte, nahm Grace das Baby auf den Arm und legte es sich an die Schulter. Sie klopfte seinen Rücken mit sanften, rhythmischen Bewegungen.
»Haben Sie sich schon Gedanken über einen Namen gemacht?« , fragte Emma und packte die Kleider des Babys in eine zusätzliche Tasche.
»Ich habe mir Hunderte überlegt«, gab Grace zu und ging jetzt ruhig auf und ab, wobei sie weiter sanft den Rücken des Babys klopfte und es sachte auf und ab wiegte. »Aber irgendwie passen sie alle nicht«, fügte sie mit abgewandtem Blick hinzu.
Mein Gott, wie sie es hasste, diese nette Frau anzulügen. Aber sie konnte ihr nicht sagen, dass sie nicht das Recht hatte, dem Baby einen Namen zu geben, sondern dass das ein Privileg seines Vaters sein würde.
Sie hatte den Angestellten im Krankenhaus und den Leuten vom Sozialamt gesagt, dass sie nicht wisse, wer der Vater des Kindes wäre. Das war die Lüge, die ihr von allen am schwersten gefallen war, wenn auch die nützlichste. Das Krankenhaus hatte sie und das Kind nur ungern gehen lassen, ohne einen Namen auf die Geburtsurkunde zu schreiben. Unter den gegebenen Verhältnissen war er offiziell – und vorübergehend – einfach nur Baby Boy Sutter.
Mit nur wenig Papierkram und genauso ungern angesichts der Namenlosigkeit wie die Leute vom Krankenhaus hatte das Gericht Grace die vorläufige Erziehungsberechtigung gegeben, so lange, bis ihre Kollegen in Maine der Sache genauer nachgehen konnten. Als Grace das hörte, ging sie sogar so weit zu erklären, Mary hätte nur eine einzige Nacht mit einem Mann verbracht, der in Pine Creek auf der Durchreise gewesen war. Es war ein Wunder, dass die Keksdose auf dem Küchentisch nicht angesichts dieser unglaublichen Lüge zerplatzt war. Aber Grace wollte nicht, dass irgendwelche offiziellen Stellen weitere Nachforschungen zu der Angelegenheit unternahmen.
Bei ihren Brüdern war das eine ganz andere Sache. Jeder von ihnen hatte versprochen, sofort einen Flug zu buchen, als Grace sie telefonisch mit der schrecklichen Neuigkeit konfrontiert hatte. Aber sie hatte sie davon überzeugt, dass sie momentan nichts weiter tun konnten, und dass sie, wenn sie ihrer Liebe für Mary noch einmal Ausdruck verleihen wollten, zur Sommersonnenwende auf dem TarStone erscheinen sollten.
Ihnen gegenüber bestand ihre Lüge in einer Auslassung. Sie hatte ihnen nichts von dem Baby erzählt.
Obwohl Grace jeden von ihnen sehr lieb hatte, wollte sie auf keinen Fall, dass sie herkamen, um die Sache in die Hand zu nehmen, von der sie jetzt ja nichts wussten. Sie selbst wusste allerdings auch nicht viel mehr. Wie sollte sie erklären, dass sie zwar wusste, wer der Vater war, jener aber glaubte, er wäre durch die Zeit gereist? Und wie sollte sie diese Einzelheit auslassen, ohne vorher Michael MacBain zu treffen und selbst zu entscheiden, ob er bei Verstand war oder nicht?
Nein, so war es besser. Sie hatte keinerlei Verlangen oder Bedarf nach sechs eigenwilligen Männern, die sich in das Versprechen einmischten, das sie ihrer Schwester gegeben hatte.
Grace ging hinüber zum Wohnzimmerfenster und sah, wie Jonathans Mercedes beim Stoppschild am Ende der Straße hielt und dann verschwand. Sie begrub ihre Nase im Haar des Babys und genoss die wohlriechende Mischung aus Shampoo und Puder.
Sie hatte gerade ihren ersten Streit mit Jonathan gehabt, und das war ein erhellendes Ereignis gewesen.
Er machte sich Sorgen um seine Firma, um die Konkurrenz, die ihnen zunehmend näher kam, und um Schötchens Funktion. Nun ja, an der Konkurrenz konnte sie nichts ändern, aber sie konnte sich um Schötchen kümmern, selbst von Maine aus. Jonathan würde sich wieder beruhigen, wenn er erst einmal erkannte, dass er nicht auf ihren Sachverstand verzichten musste, sondern nur auf ihre körperliche Gegenwart. Sie würde in den nächsten vier Monaten gute Arbeit für StarShip leisten, vielleicht dabei sogar einen Präzedenzfall schaffen, der ihr von da an erlaubte, jedes Jahr eine Weile nach Maine zu gehen.
Doch aus Jonathans Stimme und seinem Verhalten war in letzter Zeit noch etwas anderes zu hören gewesen, das nicht dazu passte. Wenn sie es genauer bezeichnen sollte, würde Grace es Angst nennen. Jonathan hatte auch gerade eben gewirkt, als habe er Angst, weil er es nicht geschafft hatte, sie vom Fortgehen abzuhalten.
Hatte er womöglich Angst, dass sie nicht zurückkam?
Oder war der Satellit seine einzige Sorge?